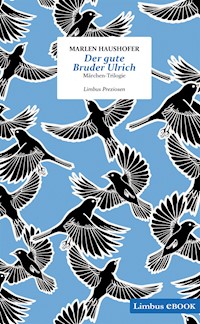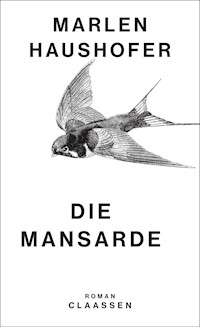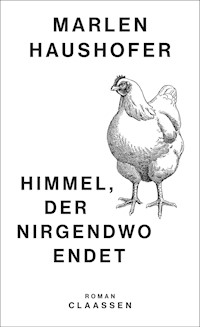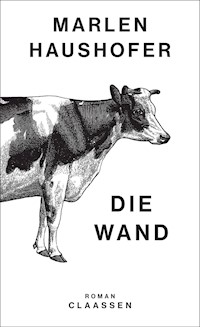
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Hauptwerk der großen österreichischen Autorin Marlen Haushofers: zeitlos, klug und bewegend! »Wenn mich jemand nach den zehn wichtigsten Büchern fragen würde, dann gehörte dieses auf jeden Fall dazu.« Lesen! Die Wand, weite Natur und die große Einsamkeit Eine Frau will mit ihrer Cousine und deren Mann ein paar Tage in einem Jagdhaus in den Bergen verbringen. Nach der Ankunft unternimmt das Paar noch einen Gang ins nächste Dorf und kehrt nicht mehr zurück. Am nächsten Morgen stößt die Frau auf ein unsichtbares, glattes, kühles Hindernis – eine unüberwindbare Wand, hinter der Totenstarre herrscht. Abgeschlossen von der übrigen Welt, richtet sie sich inmitten ihres engumgrenzten Stücks Natur und umgeben von einigen zugelaufenen Tieren aufs Überleben ein… »Ich habe Die Wand schon dreimal gelesen und bin noch lange nicht fertig.« Nicole Krauss *** Eine Geschichte, die tief berührt und nachhaltig im Gedächtnis bleibt! ***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Das Buch
Eine Frau will mit ihrer Kusine und deren Mann ein paar Tage in einem Jagdhaus in den Bergen verbringen. Nach der Ankunft unternimmt das Paar noch einen Gang ins nächste Dorf – und kehrt nicht mehr zurück. Am nächsten Morgen stößt die Frau auf eine unüberwindbare Wand, hinter der Totenstarre herrscht. Abgeschlossen von der übrigen Welt, richtet sie sich inmitten ihres engumgrenzten Stücks Natur und umgeben von einigen zugelaufenen Tieren aufs Überleben ein ...
»Ein großer Bericht, dessen äußerste Einfachheit klassisches Maß erreicht. Man kann ihn einreihen unter die Meisterwerke abendländischer Literatur.« (Hans Weigel)
Die Autorin
Marlen Haushofer wurde am 11. April 1920 in Frauenstein/ Oberösterreich geboren. Sie studierte Germanistik in Wien und Graz und lebte später mit ihrem Mann und zwei Kindern in Steyr. Marlen Haushofer starb am 21. März 1970 in Wien. Obwohl sie unter anderem 1968 mit dem Österreichischen Staatspreis für Literatur ausgezeichnet wurde, hatten ihre Bücher erst nach ihrem Tod großen Erfolg, als die Frauenbewegung sie für sich entdeckte.
In unserem Hause sind von Marlen Haushofer bereits erschienen:
Bartls Abenteuer
Schreckliche Treue. Gesammelte Erzählungen
Wir töten Stella/Das fünfte Jahr. Novellen
Himmel, der nirgendwo endet
Die Mansarde
Marlen Haushofer
Die Wand
Roman
Mit einem Nachwort
von Klaus Antes
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.list-taschenbuch.de
Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch
List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.
1. Auflage Dezember 2004
12. Auflage 2009
ISBN 978-3-548-92100-6
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2004
© 1968 by Claassen Verlag, Hamburg und Düsseldorf
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
www.kreutzfeldt.de
Für meine Eltern
Heute, am fünften November, beginne ich mit meinem Bericht. Ich werde alles so genau aufschreiben, wie es mir möglich ist. Aber ich weiß nicht einmal, ob heute wirklich der fünfte November ist. Im Lauf des vergangenen Winters sind mir einige Tage abhanden gekommen. Auch den Wochentag kann ich nicht angeben. Ich glaube aber, daß dies nicht sehr wichtig ist. Ich bin angewiesen auf spärliche Notizen; spärlich, weil ich ja nie damit rechnete, diesen Bericht zu schreiben, und ich fürchte, daß sich in meiner Erinnerung vieles anders ausnimmt, als ich es wirklich erlebte.
Dieser Mangel haftet wohl allen Berichten an. Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben; es hat sich eben so für mich ergeben, daß ich schreiben muß, wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Es ist ja keiner da, der für mich denken und sorgen könnte. Ich bin ganz allein, und ich muß versuchen, die langen dunklen Wintermonate zu überstehen. Ich rechne nicht damit, daß diese Aufzeichnungen jemals gefunden werden. Im Augenblick weiß ich nicht einmal, ob ich es wünsche. Vielleicht werde ich es wissen, wenn ich den Bericht zu Ende geschrieben habe.
Ich habe diese Aufgabe auf mich genommen, weil sie mich davor bewahren soll, in die Dämmerung zu starren und mich zu fürchten. Denn ich fürchte mich. Von allen Seiten kriecht die Angst auf mich zu, und ich will nicht warten, bis sie mich erreicht und überwältigt. Ich werde schreiben, bis es dunkel wird, und diese neue, ungewohnte Arbeit soll meinen Kopf müde machen, leer und schläfrig. Den Morgen fürchte ich nicht, nur die langen, dämmrigen Nachmittage.
Ich weiß nicht genau, wie spät es ist. Wahrscheinlich gegen drei Uhr nachmittags. Meine Uhr ist verlorengegangen; aber sie war mir schon vorher keine große Hilfe. Eine winzige, goldene Armbanduhr, eigentlich nur ein teures Spielzeug, das die Zeit nie richtig anzeigen wollte. Ich besitze einen Kugelschreiber und drei Bleistifte. Der Kugelschreiber ist fast ausgetrocknet, und mit Bleistift schreibe ich sehr ungern. Das Geschriebene hebt sich nicht deutlich vom Papier ab. Die zarten grauen Striche verschwimmen auf dem gelblichen Grund. Aber ich habe ja keine Wahl. Ich schreibe auf der Rückseite alter Kalender und auf vergilbtem Geschäftspapier. Das Briefpapier stammt von Hugo Rüttlinger, einem großen Sammler und Hypochonder.
Mit Hugo sollte eigentlich dieser Bericht anfangen, denn wäre seine Sammelwut und Hypochondrie nicht gewesen, säße ich heute nicht hier; wahrscheinlich wäre ich überhaupt nicht mehr am Leben. Hugo war der Mann meiner Kusine Luise und ein ziemlich vermögender Mensch. Sein Reichtum stammte aus einer Kesselfabrik. Es waren ganz besondere Kessel, die nur Hugo erzeugte. Leider habe ich, obgleich ich es mir oft genug erklären lassen mußte, vergessen, worin die Einmaligkeit dieser Kessel lag. Es tut auch gar nichts zur Sache. Jedenfalls war Hugo so vermögend, daß er sich irgend etwas Besonderes leisten mußte. Er leistete sich also eine Jagd. Ebensogut hätte er Rennpferde oder eine Jacht kaufen können. Aber Hugo fürchtete Pferde, und es wurde ihm übel, sobald er ein Schiff betrat.
Auch die Jagd hielt er nur des Ansehens halber. Er war ein schlechter Schütze, und es war ihm zuwider, arglose Rehe zu erschießen. Er lud seine Geschäftspartner ein, und die erledigten mit Luise und dem Jäger den vorgeschriebenen Abschuß, während er, die Hände über dem Bauch gefaltet, in einem Lehnstuhl vor dem Jagdhaus saß und in der Sonne döste. Er war so gehetzt und übermüdet, daß er einnickte, sobald er sich in einem Sessel niederließ – ein riesengroßer, dicker Mann, von dunklen Ängsten geplagt und von allen Seiten überfordert.
Ich mochte ihn gern und teilte seine Liebe für den Wald und ein paar ruhige Tage im Jagdhaus. Es störte ihn nicht, wenn ich mich irgendwo in der Nähe aufhielt, während er im Sessel schlief. Ich unternahm kleine Spaziergänge und freute mich über die Stille nach dem Getriebe in der Stadt.
Luise war eine leidenschaftliche Jägerin, eine gesunde, rothaarige Person, die mit jedem Mann anbändelte, der ihr über den Weg lief. Da sie den Haushalt verabscheute, war es ihr sehr angenehm, daß ich so nebenbei ein wenig für Hugo sorgte, Kakao kochte und seine zahllosen Mixturen mischte. Er war ja krankhaft besorgt um seine Gesundheit, was ich damals nicht recht verstehen konnte, weil sein Leben doch nur eine ständige Hetzjagd war und sein einziger Genuß ein Schläfchen in der Sonne. Er war sehr wehleidig und, abgesehen von seiner geschäftlichen Tüchtigkeit (die ich voraussetzen mußte), ängstlich wie ein kleines Kind. Er hatte eine große Liebe für Vollständigkeit und Ordnung und reiste immer mit zwei Zahnbürsten. Von jedem Gebrauchsgegenstand besaß er mehrere Exemplare; dies schien ihm Sicherheit zu verleihen. Im übrigen war er recht gebildet, taktvoll und ein schlechter Kartenspieler.
Ich erinnere mich nicht, jemals mit ihm ein Gespräch von einiger Bedeutung geführt zu haben. Manchmal unternahm er kleine Vorstöße in diese Richtung, ließ aber jedesmal vorzeitig davon ab, vielleicht aus Schüchternheit oder einfach, weil es ihm zu mühsam war. Mir war das jedenfalls sehr angenehm, denn es hätte uns doch nur in Verlegenheit versetzt.
Damals war immerzu die Rede von Atomkriegen und ihren Folgen, und das bewog Hugo dazu, sich in seinem Jagdhaus einen kleinen Vorrat von Lebensmitteln und anderen wichtigen Gegenständen einzulagern. Luise, die das ganze Unternehmen sinnlos fand, ärgerte sich darüber und fürchtete, es werde sich herumsprechen und Einbrecher anlocken. Sie hatte wahrscheinlich recht damit, aber in diesen Dingen konnte Hugo einen Starrsinn entwickeln, der nicht zu brechen war. Er bekam Herzbeschwerden und Magenkrämpfe, bis Luise ihren Widerstand aufgab. Es war ihr im Grund auch ganz gleichgültig.
Am dreißigsten April luden mich die Rüttlingers ein, mit ihnen zum Jagdhaus zu fahren. Ich war damals seit zwei Jahren verwitwet, meine beiden Töchter waren fast erwachsen, und ich konnte mir meine Zeit einteilen, wie es mir gefiel. Allerdings machte ich wenig Gebrauch von meiner Freiheit. Ich war immer schon eine seßhafte Natur gewesen und fühlte mich zu Hause am wohlsten. Nur Luises Einladungen schlug ich selten aus. Ich liebte das Jagdhaus und den Wald und nahm gerne die dreistündige Autofahrt auf mich. Auch an jenem dreißigsten April nahm ich die Einladung an. Wir wollten drei Tage bleiben, und es war kein weiterer Gast geladen.
Das Jagdhaus ist eigentlich eine einstöckige Holzvilla, aus massiven Stämmen gebaut und heute noch in gutem Zustand. Im Erdgeschoß ist eine große Wohnküche in Bauernstubenart, daneben ein Schlafzimmer und eine kleine Kammer. Im ersten Stock, um den eine Holzveranda führt, liegen drei kleine Kammern für die Gäste. Eine dieser Kammern, die kleinste, wurde damals von mir bewohnt. Etwa fünfzig Schritt entfernt liegt auf einem Abhang, der zum Bach abfällt, ein kleines Blockhaus für den Jäger, eigentlich nur eine einräumige Hütte, und daneben, gleich an der Straße, steht eine Brettergarage, die Hugo bauen ließ.
Wir fuhren also drei Stunden mit dem Wagen und hielten im Dorf, um Hugos Hund vom Jäger abzuholen. Der Hund, ein bayrischer Schweißhund, hieß Luchs und war zwar Hugos Eigentum, aber beim Jäger aufgewachsen und von ihm abgerichtet. Seltsamerweise war es dem Jäger gelungen, den Hund dahin zu bringen, daß er Hugo als seinen Herrn anerkannte. Luise allerdings beachtete er nicht, er gehorchte ihr auch nicht und ging ihr aus dem Weg. Mich behandelte er mit freundlicher Neutralität, hielt sich aber gern in meiner Nähe auf. Er war ein schönes Tier mit dunklem rotbraunem Fell und ein ausgezeichneter Jagdhund. Wir unterhielten uns ein wenig mit dem Jäger, und es wurde vereinbart, daß er am nächsten Abend mit Luise zur Pirsch gehen sollte. Sie hatte die Absicht, einen Rehbock zu schießen; die Schonzeit endete gerade am ersten Mai. Dieses Gespräch zog sich dahin, wie es eben auf dem Land üblich ist, und sogar Luise, die das nie verstehen konnte, zugehe ihre Ungeduld, um den Jäger, den sie notwendig brauchte, nicht zu verstimmen.
Erst gegen drei Uhr erreichten wir das Jagdhaus. Hugo ging sofort daran, aus dem Kofferraum seines Wagens neue Vorräte in die Kammer neben der Küche zu schaffen. Ich kochte Kaffee auf dem Spirituskocher, und nach der Jause, Hugo fing gerade an einzunicken, schlug Luise ihm vor, mit ihr noch einmal ins Dorf zu gehen. Es war natürlich die pure Bosheit. Jedenfalls ging sie sehr geschickt vor, indem sie Bewegung als unerläßlich für Hugos Gesundheit hinstellte. Gegen halb fünf Uhr hatte sie ihn endlich soweit und zog triumphierend mit ihm ab. Ich wußte, sie würden im Dorfwirtshaus landen. Luise liebte den Umgang mit Holzknechten und Bauernburschen, und es kam ihr nie in den Sinn, daß die verschlagenen Gesellen heimlich über sie lachen könnten.
Ich räumte das Geschirr vom Tisch und hängte die Kleidungsstücke in den Kasten; als ich damit fertig war, setzte ich mich auf die Hausbank in die Sonne. Es war ein schöner warmer Tag, und nach dem Wetterbericht sollte es auch heiter bleiben. Die Sonne stand schräg über den Fichten und mußte bald sinken. Das Jagdhaus liegt in einem kleinen Kessel, am Ende einer Schlucht, unter steil aufsteigenden Bergen.
Während ich so saß und die letzte Wärme auf dem Gesicht spürte, sah ich Luchs zurückkommen. Wahrscheinlich hatte er Luise nicht gehorcht, und sie hatte ihn zur Strafe zurückgeschickt. Ich konnte sehen, daß sie ihn gescholten hatte. Er kam zu mir, sah mich bekümmert an und legte den Kopf auf meine Knie. So blieben wir eine Weile sitzen. Ich streichelte Luchs und redete ihm tröstend zu, denn ich wußte ja, daß Luise den Hund ganz falsch behandelte.
Als die Sonne hinter den Fichten verschwand, wurde es kühl, und bläuliche Schatten fielen in die Lichtung ein. Ich ging mit Luchs ins Haus, heizte den großen Herd und fing an, eine Art Reisfleisch zu bereiten. Ich hätte es natürlich nicht tun müssen, aber ich war selbst hungrig, und ich wußte, daß Hugo ein richtiges, warmes Nachtmahl vorzog.
Um sieben Uhr waren meine Gastgeber noch nicht zurück. Das war auch fast nicht möglich, ich rechnete damit, daß sie vor halb neun nicht kommen würden. So fütterte ich den Hund, aß meinen Teil vom Reisfleisch und las schließlich im Schein der Petroleumlampe die Zeitungen, die Hugo mitgebracht hatte. In der Wärme und Stille wurde ich schläfrig. Luchs hatte sich ins Ofenloch zurückgezogen und schnaufte leise und zufrieden vor sich hin. Um neun Uhr beschloß ich, zu Bett zu gehen. Ich versperrte die Tür und nahm den Schlüssel mit mir in meine Kammer. Ich war so müde, daß ich trotz der feuchtkalten Steppdecke sofort einschlief.
Ich erwachte davon, daß die Sonne auf mein Gesicht fiel, und erinnerte mich sofort an den vergangenen Abend. Da wir nur einen Hüttenschlüssel mithatten, der zweite lag beim Jäger, hätten Luise und Hugo mich bei ihrer Rückkehr wecken müssen. Im Schlafrock rannte ich die Stiege hinunter und sperrte die Eingangstür auf. Luchs empfing mich ungeduldig winselnd und wischte an mir vorbei ins Freie. Ich ging ins Schlafzimmer, obgleich ich sicher war, dort keinen Menschen zu finden, das Fenster war ja vergittert, und selbst durch ein unvergittertes Fenster hätte sich Hugo nicht durchzwängen können. Die Betten waren natürlich unberührt.
Es war acht Uhr; die beiden mußten im Dorf geblieben sein. Ich wunderte mich sehr darüber. Hugo verabscheute die kurzen Wirtshausbetten, und er wäre niemals so rücksichtslos gewesen, mich allein über Nacht im Jagdhaus zurückzulassen. Ich konnte mir nicht erklären, was geschehen war. Ich ging wieder hinauf in meine Schlafkammer und zog mich an. Es war noch sehr kühl, und der Tau glitzerte auf Hugos schwarzem Mercedes. Ich kochte Tee und wärmte mich ein wenig auf, und dann machte ich mich mit Luchs auf den Weg ins Dorf.
Ich merkte kaum, wie kühl und feucht es in der Schlucht war, weil ich darüber nachgrübelte, was aus den Rüttlingers geworden sein mochte. Vielleicht hatte Hugo einen Herzanfall erlitten. Wie es so geht, im Umgang mit Hypochondern, hatten wir seine Zustände nicht mehr ernst genommen. Ich beschleunigte meine Schritte und schickte Luchs voraus. Freudig bellend, zog er ab. Ich hatte nicht daran gedacht, meine Bergschuhe anzuziehen, und stolperte ungeschickt über die scharfen Steine hinter ihm her.
Als ich endlich den Ausgang der Schlucht erreichte, hörte ich Luchs schmerzlich und erschrocken jaulen. Ich bog um einen Scheiterstoß, der mir die Aussicht verstellt hatte, und da saß Luchs und heulte. Aus seinem Maul tropfte roter Speichel. Ich beugte mich über ihn und streichelte ihn. Zitternd und winselnd drängte er sich an mich. Er mußte sich in die Zunge gebissen oder einen Zahn angeschlagen haben. Als ich ihn ermunterte, mit mir weiterzugehen, klemmte er den Schwanz ein, stellte sich vor mich und drängte mich mit seinem Körper zurück.
Ich konnte nicht sehen, was ihn so ängstigte. Die Straße trat an dieser Stelle aus der Schlucht heraus, und so weit ich sie überblicken konnte, lag sie menschenleer und friedlich in der Morgensonne. Unwillig schob ich den Hund zur Seite und ging allein weiter. Zum Glück war ich, durch ihn behindert, langsamer geworden, denn nach wenigen Schritten stieß ich mit der Stirn heftig an und taumelte zurück.
Luchs fing sofort wieder zu winseln an und drängte sich an meine Beine. Verdutzt streckte ich die Hand aus und berührte etwas Glattes und Kühles: einen glatten, kühlen Widerstand an einer Stelle, an der doch gar nichts sein konnte als Luft. Zögernd versuchte ich es noch einmal, und wieder ruhte meine Hand wie auf der Scheibe eines Fensters. Dann hörte ich lautes Pochen und sah um mich, ehe ich begriff, daß es mein eigener Herzschlag war, der mir in den Ohren dröhnte. Mein Herz hatte sich schon gefürchtet, ehe ich es wußte.
Ich setzte mich auf einen Baumstamm am Straßenrand und versuchte zu überlegen. Es gelang mir nicht. Es war, als hätten mich alle Gedanken mit einem Schlag verlassen. Luchs kroch näher, und sein blutiger Speichel tropfte auf meinen Mantel. Ich streichelte ihn, bis er sich beruhigte. Und dann sahen wir beide hinüber zur Straße, die so still und glänzend im Morgenlicht lag.
Ich stand noch dreimal auf und überzeugte mich davon, daß hier, drei Meter vor mir, wirklich etwas Unsichtbares, Glattes, Kühles war, das mich am Weitergehen hinderte. Ich dachte an eine Sinnestäuschung, aber ich wußte natürlich, daß es nichts Derartiges war. Ich hätte mich leichter mit einer kleinen Verrücktheit abgefunden als mit dem schrecklichen unsichtbaren Ding. Aber da war Luchs mit seinem blutenden Maul, und da war die Beule auf meiner Stirn, die anfing zu schmerzen.
Ich weiß nicht, wie lange ich auf dem Baumstamm sitzen blieb, aber ich erinnere mich, daß meine Gedanken immerfort um ganz nebensächliche Dinge kreisten, als wollten sie sich um keinen Preis mit der unfaßbaren Erfahrung abgeben.
Die Sonne stieg höher und wärmte meinen Rücken. Luchs schleckte und schleckte und hörte schließlich auf zu bluten. Er konnte sich nicht arg verletzt haben.
Ich begriff, daß ich etwas unternehmen mußte, und befahl Luchs, sitzen zu bleiben. Dann näherte ich mich vorsichtig mit ausgestreckten Händen dem unsichtbaren Hindernis und tastete mich an ihm entlang, bis ich an den letzten Felsen der Schlucht stieß. Hier kam ich nicht weiter. Auf der anderen Seite der Straße kam ich bis zum Bach, und jetzt erst bemerkte ich, daß der Bach ein wenig gestaut war und aus den Ufern trat. Er führte aber nur wenig Wasser. Der ganze April war trocken gewesen und die Schneeschmelze schon vorüber. Auf der anderen Seite der Wand, ich habe mir angewöhnt, das Ding die Wand zu nennen, denn irgendeinen Namen mußte ich ihm ja geben, da es nun einmal da war – auf der anderen Seite also lag das Bachbett eine kleine Strecke fast trocken, und dann floß das Wasser in einem Rinnsal weiter. Offenbar hatte es sich schon durch das durchlässige Kalkgestein gegraben. Die Wand konnte also nicht tief in die Erde reichen. Eine flüchtige Erleichterung durchzuckte mich. Ich mochte den gestauten Bach nicht überqueren. Es war nicht anzunehmen, daß die Wand plötzlich aufhörte, denn dann wäre es Hugo und Luise ein leichtes gewesen, zurückzukommen.
Plötzlich fiel mir auf, was mich im Unterbewußtsein schon die ganze Zeit gequält haben mochte, daß die Straße völlig leer lag. Irgend jemand mußte doch längst Alarm geschlagen haben. Es wäre natürlich gewesen, hätten sich die Dorfleute neugierig vor der Wand angesammelt. Selbst wenn keiner von ihnen die Wand entdeckt hatte, mußten doch Hugo und Luise auf sie gestoßen sein. Daß kein einziger Mensch zu sehen war, erschien mir noch rätselhafter als die Wand.
Ich fing im hellen Sonnenschein zu frösteln an. Das erste kleine Gehöft, eigentlich nur eine Keusche, lag gleich um die nächste Biegung. Wenn ich den Bach über querte und ein Stückchen die Bergwiese hinaufstieg, mußte ich es sehen können.
Ich ging zu Luchs zurück und redete ihm gut zu. Er war ja ganz vernünftig, ich hätte viel eher Zuspruch gebraucht. Es war mir plötzlich ein großer Trost, Luchs bei mir zu haben. Ich zog Schuhe und Strümpfe aus und durchwatete den Bach. Drüben zog sich die Wand am Fuß der Bergwiese dahin. Endlich konnte ich die Keusche sehen. Sie lag sehr still im Sonnenlicht; ein friedliches, vertrautes Bild. Ein Mann stand am Brunnen und hielt die rechte Hand gewölbt auf halbem Weg vom Wasserstrahl zum Gesicht. Ein reinlicher alter Mann. Seine Hosenträger baumelten wie Schlangen an ihm nieder, und die Ärmel des Hemdes hatte er aufgerollt. Aber er erreichte sein Gesicht nicht mit der Hand. Er bewegte sich überhaupt nicht.
Ich schloß die Augen und wartete, dann sah ich wieder hin. Der reinliche alte Mann stand noch immer regungslos. Jetzt sah ich auch, daß er sich mit den Knien und der linken Hand auf den Rand des Steintrogs stützte, vielleicht konnte er deshalb nicht umfallen. Neben dem Haus war ein Gärtchen, in dem, neben Pfingstrosen und Herzblumen, Küchenkräuter wuchsen. Es gab dort auch einen mageren, zerzausten Fliederbusch, der schon abgeblüht war. Der April war fast sommerlich warm gewesen, selbst hier im Gebirge. In der Stadt waren auch die Pfingstrosen schon verblüht. Aus dem Kamin stieg kein Rauch auf.
Ich schlug mit der Faust gegen die Wand. Es schmerzte ein wenig, aber nichts geschah. Und plötzlich hatte ich auch nicht mehr das Verlangen, die Wand zu zerschlagen, die mich von dem Unbegreiflichen trennte, das dem alten Mann am Brunnen widerfahren war. Ich ging sehr vorsichtig zurück über den Bach zu Luchs, der an etwas schnupperte und seinen Schrecken vergessen zu haben schien. Es war ein toter Kleiber, eine Spechtmeise. Sein Köpfchen war zerstoßen und seine Brust mit Blut befleckt. Jener Kleiber war der erste einer langen Reihe kleiner Vögel, die auf diese jämmerliche Weise an einem strahlenden Maimorgen ihr Ende gefunden hatten. Aus irgendeinem Grund werde ich mich immer an diesen Kleiber erinnern müssen. Während ich ihn betrachtete, fiel mir endlich das klagende Geschrei der Vögel auf. Ich mußte es schon lange gehört haben, ehe es mir bewußt wurde.
Ich wollte plötzlich nur weg von diesem Ort, zurück ins Jagdhaus, weg von dem jämmerlichen Geschrei und den winzigen, blutbeschmierten Leichen. Auch Luchs war wieder unruhig geworden und drängte sich winselnd an mich. Auf dem Heimweg durch die Schlucht blieb er dicht an meiner Seite, und ich sprach ihm beruhigend zu. Ich weiß nicht mehr, was ich zu ihm sagte, es schien mir nur wichtig, die Stille zu brechen, in der düsteren feuchten Schlucht, wo das Licht grünlich durch die Buchenblätter sickerte und winzige Bäche von den nackten Felsen zu meiner Linken rieselten.
Wir waren in eine schlimme Lage geraten, Luchs und ich, und wir wußten damals gar nicht, wie schlimm sie war. Aber wir waren nicht ganz verloren, weil wir zu zweit waren.
Das Jagdhaus lag jetzt im hellen Sonnenschein. Der Tau auf dem Mercedes war getrocknet, und das Dach glänzte in einem fast rötlichen Schwarz; ein paar Schmetterlinge gaukelten über die Lichtung, und es fing an, süß nach warmen Fichtennadeln zu riechen. Ich setzte mich auf die Hausbank, und sogleich schien mir alles, was ich in der Schlucht gesehen hatte, ganz unwirklich. Es konnte einfach nicht wahr sein, derartige Dinge geschahen einfach nicht, und wenn sie doch geschahen, nicht in einem kleinen Dorf im Gebirge, nicht in Österreich und nicht in Europa. Ich weiß, wie lächerlich dieser Gedanke war, aber da ich genauso dachte, will ich es nicht verschweigen. Ich saß ganz still in der Sonne und sah den Faltern zu, und ich glaube, eine Zeitlang dachte ich wirklich gar nichts. Luchs, der am Brunnen getrunken hatte, sprang zu mir auf die Bank und legte seinen Kopf auf meine Knie. Ich freute mich über diesen Gunstbeweis, bis mir einfiel, daß dem armen Hund ja keine andere Wahl blieb.
Nach einer Stunde ging ich in die Hütte und wärmte das restliche Reisfleisch für Luchs und mich, dann kochte ich Kaffee, um einen klaren Kopf zu bekommen, und rauchte dabei drei Zigaretten. Es waren meine letzten Zigaretten. Hugo, der ein starker Raucher war, hatte versehentlich vier Päckchen in der Manteltasche ins Dorf mitgenommen, und er war auch noch nicht dazu gekommen, den Zigarettenvorrat für die nächste Nachkriegszeit im Jagdhaus einzulagern. Nachdem ich die drei Zigaretten geraucht hatte, hielt ich es nicht länger im Haus aus und ging nochmals mit Luchs in die Schlucht zurück. Der Hund folgte mir ohne Begeisterung und hielt sich dicht an meinen Fersen. Ich lief fast den ganzen Weg und hielt atemlos inne, als der Scheiterstoß auftauchte. Dann ging ich langsam mit ausgestreckten Händen weiter, bis ich die kühle Wand berührte. Obgleich ich doch gar nichts anderes hatte erwarten können, war diesmal der Schock viel heftiger als beim erstenmal.
Der Bach war noch immer gestaut, aber das Rinnsal auf der anderen Seite war ein wenig breiter geworden. Ich zog die Schuhe aus und schickte mich an, das Wasser zu durchwaten. Diesmal folgte mir Luchs zögernd und widerwillig. Er war nicht wasserscheu, aber der Bach war eiskalt und reichte ihm bis zum Bauch. Es störte mich, daß ich die Wand nicht sehen konnte, und so brach ich einen Arm voll Haselzweige ab und fing an, sie an der Wand in die Erde zu stecken. Diese Tätigkeit schien mir das Nächstliegende zu sein, und sie beschäftigte mich vor allem so sehr, daß ich dabei nicht denken mußte. Ich steckte also ordentlich meine Zweige. Mein Weg stieg jetzt ein wenig an, und ich erreichte wieder die Stelle, von der aus ich das kleine Anwesen sehen konnte.
Der alte Mann stand noch immer am Brunnen, die gehöhlte Hand zum Gesicht erhoben. Das kleine Stück Tal, das ich von hier aus überblicken konnte, war erfüllt von Sonnenlicht, und die Luft zitterte goldgrün und durchsichtig an den Waldrändern. Auch Luchs konnte jetzt den Mann sehen. Er setzte sich hin, streckte den Hals steil empor, und ein langgezogenes schreckliches Geheul brach aus ihm hervor. Er hatte begriffen, daß das Ding am Brunnen kein lebender Mensch war.
Sein Geheul zerrte an mir, und etwas wollte mich zwingen mitzuheulen. Es zerrte an mir, als wollte es mich in Stücke reißen. Ich nahm Luchs am Halsband und zog ihn mit mir fort. Er verstummte und folgte mir zitternd. Langsam tastete ich mich weiter an der Wand entlang und steckte ein Holz nachdem andern in den Boden.
Wenn ich zurücksah, konnte ich die neue Grenze bis zum Bach verfolgen. Es sah aus, als hätten Kinder gespielt, ein heiteres harmloses Frühlingsspiel. Die Obstbäume jenseits der Wand waren schon verblüht und trugen glänzendes hellgrünes Laub. Die Wand stieg jetzt allmählich bergan bis zu einer Gruppe Lärchen inmitten der Bergwiese. Von hier aus konnte ich zwei weitere Keuschen und ein Stück Tal überblicken. Ich ärgerte mich, daß ich Hugos Fernglas vergessen hatte. Jedenfalls konnte ich keinen Menschen sehen, überhaupt kein lebendes Wesen. Aus den Häusern stieg kein Rauch auf. Das Unglück mußte sich, nach meiner Überlegung, gegen Abend ereignet und die Rüttlingers noch im Dorf oder auf dem Heimweg überrascht haben.
Wenn der Mann am Brunnen tot war, und daran konnte ich nicht mehr zweifeln, mußten alle Menschen im Tal tot sein, und nicht nur die Menschen, alles was lebend gewesen war. Nur das Gras auf den Wiesen lebte, das Gras und die Bäume; das junge Laub spreizte sich glänzend im Licht.
Ich stand, beide Handflächen an die kühle Wand gepreßt, und starrte hinüber. Und plötzlich wollte ich gar nichts mehr sehen. Ich rief Luchs, der angefangen hatte, unter den Lärchen zu graben, und ging zurück, immer entlang der kleinen Spielzeuggrenze. Nachdem wir den Bach überquert hatten, steckte ich die Straße ab bis zum Felsen und kehrte dann langsam zum Jagdhaus zurück. Nach der grünen, kühlen Dämmerung der Schlucht überfiel uns die Sonne mit Gewalt, als wir auf die Lichtung traten. Luchs schien von dem Unternehmen genug zu haben, lief ins Haus und verkroch sich im Ofenloch. Wie immer, wenn er ratlos war, schlief er nach ein wenig Schnaufen und Winseln sofort ein. Ich beneidete ihn um diese Fähigkeit. Jetzt, wo er schlief, vermißte ich die leichte Unruhe, die er ständig um sich verbreitete. Aber es war immer noch besser, einen schlafenden Hund im Haus zu haben, als ganz allein zu sein.
Hugo, der selbst nicht trank, hatte einen kleinen Vorrat an Kognak, Gin und Whisky für seine Jagdgäste eingelagert. Ich schenkte mir ein Glas Whisky ein und setzte mich an den großen Eichentisch. Ich hatte nicht die Absicht, mich zu betrinken, ich suchte nur verzweifelt nach einer Medizin, die die dumpfe Benommenheit aus meinem Kopf vertreiben sollte. Es fiel mir auf, daß ich an den Whisky als an meinen Whisky dachte, ich glaubte also nicht mehr an die Rückkehr des rechtmäßigen Besitzers. Dies versetzte mir einen kleinen Schock. Nach dem dritten Schluck schob ich das Glas angeekelt zurück. Das Getränk schmeckte nach in Lysol eingeweichtem Stroh. Es gab da gar nichts zu klären in meinem Kopf. Ich hatte mich davon überzeugt, daß über Nacht eine unsichtbare Wand niedergegangen oder aufgewachsen war, und es war mir in meiner Lage ganz unmöglich, eine Erklärung dafür zu finden. Ich fühlte weder Kummer noch Verzweiflung, und es hätte keinen Sinn gehabt, diesen Zustand mit Gewalt herbeizuführen. Ich war alt genug, um zu wissen, daß er mir nicht erspart bleiben würde. Die wichtigste Frage schien mir, ob nur das Tal oder ob das ganze Land von dem Unglück betroffen war. Ich beschloß, das erstere anzunehmen, denn dann blieb mir die Hoffnung, daß man mich in wenigen Tagen aus meinem Waldgefängnis erlösen würde. Heute scheint es mir, als hätte ich insgeheim schon damals nicht an diese Möglichkeit geglaubt. Ich bin aber nicht sicher. Jedenfalls war ich vernünftig genug, zunächst die Hoffnung nicht aufzugeben. Nach einer Weile merkte ich, daß meine Füße schmerzten. Ich zog Schuhe und Strümpfe aus und sah, daß ich mir Blasen an den Fersen gelaufen hatte. Der Schmerz kam mir ganz gelegen, denn er lenkte mich von fruchtlosen Gedanken ab. Nachdem ich meine Füße gebadet und die Fersen mit Salbe bestrichen und mit Pflaster verklebt hatte, beschloß ich, mich im Jagdhaus so einzurichten, wie es mir am erträglichsten schien. Zunächst schob ich Luises Bett aus der Schlafkammer in die Küche und stellte es so an die Wand, daß ich den ganzen Raum und Tür und Fenster überblicken konnte. Luises Schaffell breitete ich vor dem Bett aus, in der heimlichen Hoffnung, Luchs würde es zum Lager erwählen. Er tat es übrigens nicht und schlief nach wie vor im Ofenloch. Auch das Nachtkästchen holte ich aus der Schlafkammer. Den Kleiderkasten schob ich erst einige Zeit später in die Küche. Die Fensterläden im Schlafzimmer schloß ich, und dann versperrte ich die Tür von der Küche aus. Auch die oberen Kammern versperrte ich und hängte die Schlüssel an einen Nagel neben den Herd. Ich weiß nicht, warum ich das alles tat, es war wohl eine Instinkthandlung. Ich mußte alles überblicken können und mich vor Überfällen sichern. Hugos geladene Büchsflinte hängte ich neben dem Bett auf, und die Stablampe legte ich auf das Nachtkästchen. Ich wußte, daß alle meine Maßnahmen gegen Menschen gerichtet waren, und sie erschienen mir lächerlich. Aber da bisher jede Gefahr von Menschen gedroht hatte, konnte ich mich nicht so schnell umstellen. Der einzige Feind, den ich in meinem bisherigen Leben gekannt hatte, war der Mensch gewesen. Ich zog meinen Reisewecker und meine Armbanduhr auf, und dann holte ich Holz, das geschnitten und zerhackt unter der Veranda aufgestapelt lag, in die Küche und schichtete es neben dem Herd auf.
Inzwischen war es Abend geworden, und die kühle Luft wehte vom Berg herab in das Haus. Das Sonnenlicht lag noch auf der Lichtung, aber alle Farben wurden allmählich kälter und härter. Ein Specht hackte im Wald. Ich war froh, ihn zu hören, ihn und das Geplätscher des Brunnens, der in einem armdicken Strahl in den Holztrog rann. Ich legte meinen Mantel um die Schultern und setzte mich auf die Hausbank. Von hier aus konnte ich den Weg bis zur Schlucht sehen, die Jägerhütte, die Garage und dahinter die dunklen Fichten. Manchmal bildete ich mir ein, Schritte aus der Schlucht zu hören, aber es war natürlich jedesmal eine Täuschung. Eine Zeitlang betrachtete ich ganz gedankenlos ein paar riesige Waldameisen, die in einer kleinen hastigen Prozession an mir vorüberzogen.
Der Specht stellte sein Klopfen ein; die Luft wurde immer kühler und das Licht bläulich und kalt. Das Stückchen Himmel über mir färbte sich rosarot. Die Sonne war hinter den Fichten verschwunden. Der Wetterbericht hatte gestimmt. Bei diesem Gedanken fiel mir das Autoradio ein. Das Fenster war halb heruntergelassen, und ich drückte auf den kleinen schwarzen Knopf. Nach einer kleinen Weile vernahm ich zartes, leeres Summen. Am Vortag hatte Luise zu meinem Ärger während der Fahrt Tanzmusik gehört. Jetzt wäre ich vor Freude über ein bißchen Musik umgefallen. Ich drehte und drehte an den Knöpfen; es blieb dabei, fernes zartes Summen, das vielleicht nur aus dem Mechanismus des kleinen Kastens kam. Schon damals hätte ich begreifen müssen. Aber ich wollte nicht. Lieber redete ich mir ein, irgend etwas an dem Ding wäre über Nacht kaputtgegangen. Immer wieder versuchte ich es, und nie kam etwas anderes aus dem Kästchen als jenes Summen.
Schließlich gab ich es auf und setzte mich wieder auf die Bank. Luchs kam aus dem Haus und legte den Kopf auf meine Knie. Er hatte Zuspruch nötig. Ich redete zu ihm, und er lauschte aufmerksam und drängte sich winselnd an mich. Schließlich leckte er meine Hand ab und klopfte zögernd mit dem Schwanz auf den Boden. Wir hatten beide Angst und versuchten, einander Mut zu machen. Meine Stimme klang fremd und unwirklich, und ich senkte sie zu einem Flüstern, bis ich sie nicht mehr vom Plätschern des Brunnens unterscheiden konnte. Der Brunnen sollte mich noch oft erschrecken. Aus einer gewissen Entfernung klingt sein Geplätscher wie die Unterhaltung zweier verschlafener Menschenstimmen. Aber das wußte ich damals noch nicht. Ich hörte auf zu flüstern und merkte es gar nicht. Ich fröstelte unter meinem Umhang und sah zu, wie der Himmel ins Graue verblaßte.
Endlich ging ich in die Hütte zurück und heizte ein. Später sah ich, daß Luchs bis zur Schlucht vorging und dort regungslos stehenblieb und wartete. Nach einer Weile kehrte er um und trabte mit gesenktem Schädel zum Haus zurück. An den folgenden drei oder vier Abenden hielt er es ebenso. Dann schien er endlich aufzugeben; jedenfalls tat er es nie wieder. Ich weiß nicht, ob er einfach vergaß oder auf seine Hundeart eher die Wahrheit begriff als ich.
Ich fütterte ihn mit Reisfleisch und Hundekuchen und füllte seine Schüssel mit Wasser. Ich wußte, daß er für gewöhnlich nur am Morgen gefüttert wurde, aber ich mochte nicht allein essen. Dann kochte ich Tee für mich und setzte mich wieder an den großen Tisch. Es war jetzt warm in der Hütte, und die Petroleumlampe warf ihren gelben Schein auf das dunkle Holz.
Ich merkte erst jetzt, wie müde ich war. Luchs, der seine Mahlzeit beendet hatte, sprang zu mir auf die Bank und sah mich lange und aufmerksam an. Seine Augen waren braunrot und warm, ein wenig dunkler als sein Fell. Das Weiße um die Iris glänzte feucht und bläulich. Plötzlich war ich sehr froh, daß Luise den Hund zurückgeschickt hatte.
Ich stellte die leere Teeschale weg, goß warmes Wasser in die Blechschüssel und wusch mich, und dann, da gar nichts mehr zu tun blieb, ging ich zu Bett.
Die Fensterläden hatte ich geschlossen und die Tür versperrt. Nach einer kleinen Weile sprang Luchs von der Bank, kam zu mir und beschnüffelte meine Hand. Dann ging er zur Tür, von dort zum Fenster und zurück zu meinem Bett. Ich redete ihm gut zu, und schließlich, nach einem Seufzer, der fast menschlich klang, suchte er seinen Schlafplatz im Ofenloch auf.
Ich ließ die Stablampe noch ein wenig brennen, und als ich sie endlich ausdrehte, schien es mir stockdunkel im Zimmer. Es war aber gar nicht so dunkel. Das niedergebrannte Herdfeuer warf einen schwachen, flackernden Schein auf den Boden, und nach einer Weile konnte ich die Umrisse der Bank und des Tisches erkennen. Ich überlegte, ob ich eine von Hugos Schlaftabletten nehmen sollte, konnte mich aber doch nicht dazu entschließen, weil ich fürchtete, irgend etwas zu überhören. Dann fiel mir ein, daß die schreckliche Wand in der Stille und Dunkelheit der Nacht vielleicht langsam näher rücken mochte. Aber ich war viel zu müde, um mich zu fürchten. Meine Füße schmerzten noch immer, und ich lag lang ausgestreckt auf dem Rücken und war zu müde, um den Kopf zu drehen. Nach allem, was sich ereignet hatte, mußte ich mich auf eine schlimme Nacht gefaßt machen. Aber als ich mich mit diesem Gedanken abgefunden hatte, war ich schon eingeschlafen.
Ich träumte nicht und erwachte ausgeruht gegen sechs Uhr, als die Vögel zu singen anhoben. Sofort fiel mir alles wieder ein, und ich schloß erschreckt die Augen und versuchte, noch einmal in den Schlaf unterzutauchen. Es gelang mir natürlich nicht. Obgleich ich mich kaum bewegt hatte, wußte Luchs, daß ich erwacht war, und kam an mein Bett, um mich mit freudigem Gewinsel zu begrüßen. So stand ich also auf, öffnete die Fensterläden und ließ Luchs ins Freie. Es war sehr kühl, der Himmel noch blaßblau und die Büsche taunaß. Ein strahlender Tag erwachte.
Plötzlich schien es mir ganz unmöglich, diesen strahlenden Maitag zu überleben. Gleichzeitig wußte ich, daß ich ihn überleben mußte und daß es für mich keinen Fluchtweg gab. Ich mußte mich ganz still verhalten und ihn einfach überstehen. Es war ja nicht der erste Tag in meinem Leben, den ich auf diese Weise überleben mußte. Je weniger ich mich wehrte, desto erträglicher würde es sein. Die Benommenheit des Vortags war ganz aus meinem Kopf gewichen; ich konnte klar denken, so klar ich eben überhaupt denken konnte, nur wenn sich meine Gedanken der Wand näherten, war es, als stießen auch sie gegen ein kühles, glattes und ganz unüberwindliches Hindernis. Es war besser, nicht an die Wand zu denken.
Ich schlüpfte in Schlafrock und Hausschuhe, ging über den nassen Weg zum Wagen und stellte das Radio an. Zartes, leeres Summen; es klang so fremd und unmenschlich, daß ich es sofort abstellte.
Ich glaubte nicht mehr daran, daß etwas an dem Ding zerbrochen war. In der kalten Helle des Morgens war es mir ganz unmöglich, daran zu glauben.
Ich erinnere mich nicht mehr, was ich an jenem Vormittag tat. Ich weiß nur noch, daß ich eine Weile regungslos neben dem Wagen stand, bis die Nässe, die durch die leichten Hausschuhe drang, mich aufschreckte.
Vielleicht waren die folgenden Stunden so arg, daß ich sie vergessen mußte; vielleicht verbrachte ich sie auch nur in einer Art Betäubung. Ich erinnere mich nicht. Ich tauchte erst wieder gegen zwei Uhr nachmittags auf, als ich mit Luchs durch die Schlucht ging.
Zum erstenmal fand ich die Schlucht nicht reizvoll romantisch, sondern nur feucht und düster. Sogar im Hochsommer bleibt sie so, das Sonnenlicht fällt nie bis auf ihren Grund. Nach Gewitterregen kriechen dort die Feuersalamander aus ihren Steinverstecken. Später, im Sommer, konnte ich sie manchmal beobachten. Es gab eine Menge von ihnen. Oft sah ich zehn oder fünfzehn an einem Nachmittag; prächtig, schwarz-rot gefleckte Geschöpfe, die mich eigentlich immer mehr an gewisse Blumen, Tigerlilien und Türkenbund, erinnerten als an ihre schlichten graugrünen Eidechsen verwandten. Ich habe nie einen Salamander berührt, während ich Eidechsen gern anfasse.
Damals, am 2. Mai, sah ich sie nicht. Es hatte ja auch nicht geregnet, und ich wußte überhaupt noch nicht, daß es sie gab. Ich schritt schnell aus, um aus der feuchten grünen Dämmerung zu entkommen. Diesmal war ich besser ausgerüstet, mit Bergschuhen, Kniehosen und einer warmen Joppe. Der Mantel war mir am Vortag ein Hindernis gewesen, beim Grenzabstecken hatten seine Enden auf der Wiese dahingeschleift. Auch Hugos Fernglas hatte ich mitgenommen und im Rucksack eine Thermosflasche mit Kakao und Butterbrote.
Außerdem trug ich, neben meinem kleinen Taschenmesserchen (zum Bleistiftspitzen), noch Hugos scharfes Knickmesser mit mir. Ich konnte es gar nicht verwenden, denn zum Ästeabschneiden war es viel zu gefährlich, man hätte sich dabei nur die Hand verletzt. Obgleich ich es mir nicht eingestehen mochte, trug ich das Messer zu meinem Schutz mit. Es war ein Ding, das mir-eine trügerische Sicherheit verlieh. Später ließ ich es häufig zu Hause. Seit Luchs tot ist, trage ich es wieder auf allen Wegen bei mir. Allerdings weiß ich jetzt sehr genau wozu und rede mir nicht mehr ein, daß ich es zum Schneiden von Haselzweigen brauche. Die Wand war natürlich noch immer am abgesteckten Platz und hatte sich nicht, wie mir am Abend durch den Kopf gegangen war, näher an das Jagdhaus geschoben. Sie war auch nicht zurückgewichen, aber das hatte ich ohnedies nicht von ihr erwartet. Der Bach hatte seinen gewöhnlichen Spiegel erreicht, offenbar war es für ihn ein leichtes gewesen, sich durch das lockere Gestein zu graben. Ich konnte ihn, von Stein zu Stein springend, überqueren und folgte dann meiner Spielzeuggrenze bis zum Aussichtspunkt bei den Lärchen. Dort brach ich frische Zweige und fing an, die Wand weiter abzustecken.
Es war eine mühevolle Beschäftigung, bald tat mir der Rücken weh vom vielen Bücken. Ich war aber wie besessen von der Vorstellung, daß ich diese Arbeit, soweit es mir möglich war, erledigen mußte. Sie beruhigte mich und brachte einen Hauch von Ordnung in die große, schreckliche Unordnung, die über mich hereingebrochen war. Etwas wie die Wand durfte es einfach nicht geben. Daß ich sie mit grünen Hölzern absteckte, war der erste Versuch, sie, da sie nun einmal da war, auf einen angemessenen Platz zu verweisen.
Mein Weg führte über zwei Bergwiesen, durch eine junge Fichtenkultur und über einen verwachsenen Himbeerschlag. Die Sonne brannte, und meine Hände bluteten, aufgerissen von Dornen und Schiefern. Die kleinen Hölzer konnte ich natürlich nur auf der Wiese verwenden, im Unterholz brauchte ich richtige Stecken; stellenweise markierte ich auch mit dem Taschenmesser die Bäume in der Nähe der Wand. Das alles hielt mich sehr auf, und ich kam nur ganz langsam vorwärts.
Auf der Höhe des Himbeerschlages sah ich fast das ganze Tal vor mir liegen. Durch das Fernglas konnte ich alles sehr klar und scharf sehen. Vor dem Häuschen des Wagnermeisters saß eine Frau regungslos in der Sonne. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, sie hielt den Kopf gesenkt und schien zu schlafen. Ich sah so lange hin, bis meine Augen tränten und das Bild in Formen und Farben zerrann. Quer über der Türschwelle lag ein Schäferhund, den Kopf auf die Pfoten gelegt, unbewegt.
Wenn das der Tod war, so war er sehr rasch und sanft gekommen, auf eine fast liebevolle Weise. Vielleicht wäre es klüger gewesen, mit Hugo und Luise ins Dorf zu gehen.
Endlich riß ich mich los von dem friedlichen Bild und steckte weiter meine Zweige. Die Wand senkte sich jetzt wieder in eine kleine Wiesenmulde, in der ein einschichtiges Gehöft lag; eigentlich nur ein sehr kleiner Hof, wie man ihn oft im Gebirge findet, nicht zu vergleichen mit den Vierkantern über Land.
Die Wand teilte die kleine Wiese hinter dem Haus und hatte von einem Apfelbaum zwei Äste abgeschnitten. Sie sahen übrigens nicht wie abgeschnitten aus, eher wie geschmolzen, wenn man sich geschmolzenes Holz vorstellen könnte.
Ich berührte sie nicht. Zwei Kühe lagen jenseits der Wand auf der Wiese. Ich sah sie lange an. Ihre Flanken hoben und senkten sich nicht. Auch sie wirkten eher schlafend als tot. Ihre rosigen Nüstern waren nicht länger feucht und glatt, sondern sahen aus wie hübsch bemalter feinkörniger Stein.
Luchs wandte den Kopf und sah in den Wald hinein. Er brach nicht wieder in das entsetzliche Geheul aus, er sah einfach nicht hin, so als hätte er beschlossen, alles, was jenseits der Wand lag, nicht zur Kenntnis zu nehmen. Früher einmal hatten meine Eltern einen Hund, der sich auf ähnliche Weise von jedem Spiegel abwandte.
Während ich noch die beiden toten Tiere betrachtete, hörte ich plötzlich hinter mir das Brüllen einer Kuh und Luchs' aufgeregtes Bellen. Es riß mich herum, und da teilte sich das Unterholz, und heraus schritt, gefolgt von dem aufgeregten Hund, eine brüllende und lebendige Kuh. Sie kam sofort auf mich zu und schrie mir ihren ganzen Jammer entgegen. Das arme Tier war zwei Tage nicht gemolken worden, seine Stimme klang schon ganz heiser und rauh. Ich versuchte sofort, ihr Erleichterung zu verschaffen. Als junges Mädchen hatte ich zum Spaß melken gelernt, aber das lag zwanzig Jahre zurück, und ich hatte jede Übung verloren.
Die Kuh ließ sich alles geduldig gefallen, sie hatte begriffen, daß ich ihr helfen wollte. Die gelbe Milch spritzte auf die Erde, und Luchs machte sich daran, sie aufzulecken. Die Kuh gab sehr viel Milch, und mir taten die Hände weh von den ungewohnten Griffen. Die Kuh war plötzlich ganz zufrieden, neigte sich und näherte ihr großes Maul Luchs' brauner Nase. Die gegenseitige Begutachtung schien günstig ausgefallen zu sein, denn beide Tiere waren zufrieden und beruhigt.
Da stand ich also auf einer wildfremden Wiese mitten im Wald und besaß plötzlich eine Kuh. Es war ganz klar, daß ich die Kuh nicht zurücklassen konnte. Ich bemerkte jetzt erst Blutspuren an ihrem Maul. Offenbar war sie immer wieder verzweifelt gegen die Wand gerannt, die sie daran hinderte, in den heimatlichen Stall und zu ihren Menschen heimzugehen.
Von diesen Menschen war nichts zu sehen. Sie mußten sich zur Zeit der Katastrophe im Haus aufgehalten haben. Die zugezogenen Vorhänge vor den kleinen Fenstern bestärkten mich darin, daß sich dies alles am Abend ereignet hatte. Nicht zu spät, denn der alte Mann hatte sich gerade gewaschen und die alte Frau mit der Katze war noch auf der Hausbank gesessen. Am frühen Morgen, wenn es noch kühl ist, sitzt eine alte Frau mit ihrer Katze nicht auf der Hausbank. Außerdem, hätte das Unglück sich am Morgen abgespielt, so wären Hugo und Luise längst daheim gewesen. Ich überlegte das alles und sagte mir sogleich, daß derartige Überlegungen für mich völlig wertlos waren. So gab ich sie auf und suchte im Unterholz unter lockenden Rufen nach einer weiteren Kuh, aber nichts regte sich. Hätte es noch irgendwo in der Nähe ein Rind gegeben, hätte es Luchs längst aufgestöbert.
Es blieb mir nichts übrig, als die Kuh über Berg und Tal nach Hause zu treiben. Damit hatte meine Grenzabsteckung ein jähes Ende gefunden. Es war ohnedies spät geworden; gegen fünf Uhr nachmittags, und das Sonnenlicht fiel nur noch in schmalen Streifen auf die Lichtung ein.
So traten wir also zu dritt den Heimweg an. Es war gut, daß ich die Äste gesteckt hatte und mich nicht mit dem Abtasten der Wand aufhalten mußte. Ich schritt langsam zwischen Wand und Kuh dahin, immer in Sorge, das Tier könnte sich ein Bein brechen. Sie schien aber an das Gehen im bergigen Gelände gewöhnt zu sein. Ich mußte sie auch nicht antreiben, sondern nur darauf achten, daß sie in sicherer Entfernung von der Wand blieb. Luchs hatte schon begriffen, was meine Spielzeuggrenze bedeutete, und hielt sich immer in sicherem Abstand.
Auf dem ganzen Weg dachte ich nicht einmal an die Wand, so sehr war ich mit meinem Findling beschäftigt. Manchmal blieb die Kuh plötzlich stehen und fing an zu grasen, dann legte Luchs sich in ihre Nähe und ließ sie nicht aus den Augen. Wenn es ihm zu lange dauerte, stieß er sie sanft an, und sie setzte sich gehorsam wieder in Bewegung. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber in der folgenden Zeit hatte ich manchmal den Eindruck, daß sich Luchs sehr gut auf den Umgang mit Kühen verstand. Ich glaube, der Jäger mußte ihn manchmal als Wachhund benützt haben, wenn er im Herbst seine Kühe auf die Wiese trieb.
Die Kuh schien völlig ruhig und zufrieden zu sein. Sie hatte nach zwei schrecklichen Tagen einen Menschen gefunden, war von der schmerzenden Milchlast befreit worden und dachte gar nicht daran wegzulaufen. Irgendwo mußte es einen Stall geben, in den dieser neue Mensch sie treiben würde. Hoffnungsvoll schnaubend, trabte sie an meiner Seite dahin. Als wir mit einiger Mühe den Bach überschritten hatten, wurde sie sogar schneller, und schließlich konnte ich kaum Schritt halten.
Inzwischen war mir klargeworden, daß diese Kuh zwar ein Segen, aber auch eine große Last war. Von größeren Erkundungsausflügen konnte nicht mehr die Rede sein.
So ein Tier will gefüttert und gemolken werden und verlangt einen seßhaften Herrn. Ich war der Besitzer und der Gefangene einer Kuh. Aber selbst wenn ich die Kuh gar nicht gewollt hätte, wäre es mir unmöglich gewesen, sie zurückzulassen. Sie war auf mich angewiesen.
Als wir die Lichtung erreichten, es war schon fast dunkel, blieb die Kuh stehen, wandte den Kopf zurück und muhte leise und freudig. Ich führte sie zur Jägerhütte. Dort drinnen gab es nur zwei Bettstellen in Kojenart, einen Tisch, eine Bank und einen gemauerten Herd. Ich trug den Tisch ins Freie, riß den Strohsack aus einer der Bettstellen und führte die Kuh in ihren neuen Stall. Er war geräumig genug für eine Kuh. Ich nahm ein Blechschaff vom Herd, füllte es mit Wasser und stellte es in die leere Bettstatt. Mehr konnte ich an diesem Abend nicht für meine Kuh tun. Ich streichelte sie, erklärte ihr die neue Lage und verriegelte dann den Stall.
Ich war so müde, daß ich mich fast nicht zum Jagdhaus schleppen konnte. Meine Füße brannten in den schweren Schuhen, und das Kreuz tat mir weh. Ich fütterte Luchs und trank Kakao aus der Thermosflasche. Die Butterbrote konnte ich vor Müdigkeit nicht essen. An diesem Abend wusch ich mich kalt am Brunnen und ging dann sofort ins Bett. Luchs schien auch müde zu sein, denn er kroch gleich nach dem Fressen ins Ofenloch.
Der folgende Morgen war nicht mehr so unerträglich wie der vergangene, denn sowie ich die Augen aufschlug, fiel mir die Kuh ein. Ich war sofort hellwach, aber noch sehr zerschlagen von den ungewohnten Anstrengungen. Ich hatte mich auch ein wenig verschlafen, das Sonnenlicht fiel schon in gelben Streifen durch die Spalten der Fensterläden.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.