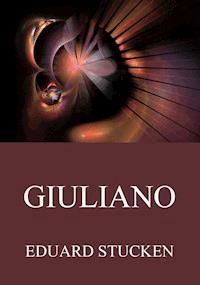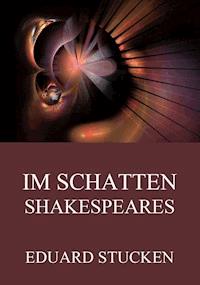Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stuckens größter Erfolg war der mehrbändige Roman "Die weißen Götter", in dem der Untergang des Aztekenreiches geschildert wird. Diese Ausgabe enthält die ersten beiden Bände.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1885
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die weißen Götter
Eduard Stucken
Inhalt:
Eduard Stucken – Biografie und Bibliografie
Die weißen Götter
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Viertes Buch
Fünftes Buch
Sechstes Buch
Siebentes Buch
Achtes Buch
Neuntes Buch
Zehntes Buch
Elftes Buch
Zwölftes Buch
Dreizehntes Buch
Vierzehntes Buch
Die weißen Götter, Eduard Stucken
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849637309
Cover Design: Orange, von Sharon Apted
www.jazzybee-verlag.de
Eduard Stucken – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller, geboren am 18. März 1865 in Moskau, verstorben am 9. März 1936 in Berlin. Sohn eines deutsch-amerikanischen Großkaufmanns. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Dresden absolvierte er von 1882 bis 1884 eine kaufmännische Ausbildung in Bremen. Anschließend studierte er Kunstgeschichte, Assyrologie und Ägyptologie in Dresden und Berlin. Er war zeitweise tätig bei der Deutschen Seewarte in Hamburg und unternahm ausgedehnte Reisen, die ihn u.a. nach Griechenland, auf die Krim, in den Kaukasus sowie nach Italien und England führten. 1890/91 nahm er an einer wissenschaftlichen Expedition nach Syrien teil. Ab 1891 lebte er als freier Schriftsteller in Berlin. In den folgenden Jahrzehnten veröffentlichte er neben wissenschaftlichen Studien zu ethnologischen und sprachhistorischen Themen ein umfangreiches literarisches Werk.
Eduard Stuckens literarisches Werk umfasst Romane, Erzählungen, Gedichte und Theaterstücke. In seinen frühen, neuromantischen Dramen verarbeitete er häufig Stoffe aus der keltischen Sagenwelt. Seine Prosaarbeiten sind geprägt von des Autors Hang zu Prunk und Exotismus sowie von einem zum Bombast neigenden Stil. Seinen größten Erfolg erzielte Stucken mit dem mehrbändigen Roman "Die weißen Götter", in dem der Untergang des Aztekenreiches geschildert wird.
Eduard Stucken gehörte der Preußischen Akademie der Künste an und blieb auch nach den nationalsozialistischen Säuberungen der Akademie im Jahre 1933 Mitglied. Im Oktober 1933 zählte er zu den Unterzeichnern des "Gelöbnisses treuester Gefolgschaft", einer an Hitler gerichteten Ergebenheitsadresse regimetreuer deutscher Autoren.
Wichtige Werke:
Die Flammenbraut. Blutrache, 1892
Astralmythen der Hebräer, Babylonier und Ägypter, 1896/97
Yrsa, 1897
Gawân, 1901
Hine-Moa, 1901
Lanvâl, 1903
Myrrha, 1908
Lanzelot, 1909
Astrid, 1910
Romanzen und Elegien, 1911
Merlins Geburt, 1912
Die Opferung des Gefangenen, 1913
Die Hochzeit Adrian Brouwers, 1914
Das Buch der Träume, 1916
Tristram und Ysolt, 1916
Die Menschheit ist gefangen auf der Erde –: der blaue Äther ist ihre Kerkermauer.
Gefesselt an die Erde, gebunden ist die Menschheit. Ihre Gedanken sind die Gedanken der Erde, sie ist die Trägerin der Gedanken der Erde. Und sie trägt sich mit ihnen, als wären es Girlanden, als wären es keine lastenden Sklavenketten.
Oh, wenn wir die Ketten brechen könnten, das Gefängnis verlassen könnten! Jenseits der Kerkermauer – dem kristallenen Äther, der gewölbten Schädeldecke – sind andere Welten.
In Sternennächten lugen wir durch das Gitterfenster, ahnen und ersehnen. Und wohl spüren wir dann unsere grausige Kerkereinsamkeit, – ein Schiffbrüchiger auf kahler Klippe im Ozean ist nicht einsamer.
Seit uralters war es ein Menschheitstraum –: hinausfliegen ins All, den Fuß setzen auf einen anderen Planeten! Irdische Farben, Düfte, Klänge und Worte hinüberretten in die grenzenlose Welt! Außermenschliches schauen, miterleiden, miterleben! ... Überirdisch würde uns das Furchtbare dort sein, überirdisch auch das Schöne. (Unsere Blutsverwandten dort – sind sie vielleicht Schmetterlinge von betäubendem Schimmerglanz? onyxäugige Sphinxe vielleicht mit Luchsleibern und Mädchenantlitzen? buntschillernd gefiederte Harpyien vielleicht? oder sind sie übergroße, denkende, redende Blumen, ein zauberschönes, grausames Blumenvolk?) ...
Einst war die eine Erdenhälfte der anderen fremd wie ein ferner Stern. Da setzte Columbus den Fuß auf eine Neue Welt.
Doch er wußte es nicht. Stolz glaubte er, den Ostrand der Alten Welt erreicht zu haben.
Er sah keine buntgefiederten Harpyien-Menschen, kein schönes grausames Blumenvolk. Denn nur den Außenbezirk des seltsamen Erdreiches berührten seine Karavellen. Von der Inkaherrlichkeit und von den Pyramiden Mexicos kam ihm keine Kunde.
Auch nicht seinen Nachfolgern in der Statthalterschaft der Antillen. Ein Jahrzehnt lang hatten Vizekönige vollauf zu tun, die Insel Haiti zu pazifizieren – so nannte man die Ausrottung der armen Karaiben – und die zu vielen mißlebenden Abenteurer und Kolonisten vor Hunger zu bewahren. Entdeckungsfahrten aber und Freibeuterzüge nach dem Festland – im Norden und im Süden des Isthmus von Panama – scheiterten kläglich.
Doch nahe genug lagen die Wunderstätten, so daß ihr Glanz herüberglitzerte über die steilen Anden und Kordilleren und den Beutesuchern zum Bewußtsein kam. Sagenhaft erst und gleichsam symbolisch kündigte sich ein Goldland an. Gen Sonnenuntergang, hieß es, in einem See, in dessen felsiges Ufer Treppenstufen gemeißelt seien, bade allabendlich ein vergoldeter König. Jeden Morgen aber werde der nackte Mann mit Harz beschmiert und über und über mit Goldstaub und kleinen Goldplättchen bedeckt, so daß er für Tagesfrist wieder zum vergoldeten König – el Dorado – werde.
Unausrottbar setzte sich das Phantom des nackten vergoldeten Mannes fest in die Herzen aller Konquistadoren, schwebte ihnen vorauf, führte sie in Abgründe oder über Abgründe hinweg ...
Ein zweites Jahrzehnt ging dahin. Franziskaner- und Dominikanermönche stritten, ob die Indianer Menschen oder Sklaven seien. Bald gab es keine Indianer mehr auf Haiti.
Der letzte Statthalter Haitis pazifizierte daher Kuba, siedelte nach Kuba über. Nicht viele Indianer überlebten die Befriedung der Insel, und sie siechten in den Silberbergwerken dahin.
Die Silberbergwerke fraßen zu viele Indianer.
Sklavenraubzüge an den Küstenstrichen des Festlandes mußten Ersatz schaffen. Der Statthalter sandte drei Schiffe aus. Yucatan wurde entdeckt; doch mehr als die Hälfte der Schiffsbesatzung ging zugrunde, und die Ausbeute waren zwei armselige Sklaven.
Mehr Erfolg hatte ein späterer Raubzug. Sklaven zwar wurden nicht heimgebracht, dafür einiges Gold und die erste Nachricht von Mexico.
Freilich kaum mehr als der Name Mexico-Tenuchtitlan war, aus unverständlichen Reden der Küstenbewohner, den Weißen ans Ohr geklungen. Hätten sie in Erfahrung gebracht, daß die Stadt, befestigt inmitten eines Schilfsees, im Hochtal Anahuac siebentausendvierhundert Fuß über dem Meeresspiegel lag und daß das Hochtal, durch viele himmelnahe Kordillerenketten eingemauert, zwanzig Tagereisen von der Küste entfernt war – das Entzücken der beutegierigen Abenteurer, die Begeisterung für das zauberhafte Mexico wäre im Keime erstickt, und manche, die bald darauf Cortes auf seinem waghalsigen Freibeuterzuge folgten, hätten es für ratsamer gehalten, dem Phantom des nackten vergoldeten Mannes nicht nachzujagen.
So aber hatte man einen Namen erhascht und berauschte sich an seinem Wunderklang. Die Ahnungslosigkeit macht sieghaft. Ein Vierteljahrhundert nach des großen Admirals Entdeckung betraten Bewohner dieses alten Sternes ein Land, das sie fremdartig anmuten mußte wie ein anderer Stern im Weltenmeer.
Und auch uns mutet es so an, wenn wir das dahingeschwundene Reich betreten, durch seine zerstörten Tempel, durch seine versunkenen Paläste und Schloßgärten wandeln. Särge toter Völker sind die alten Chroniken – sie bergen Moder, Juwelen und tiefe Traurigkeiten.
Die gigantische Gestalt des Columbus hatte, über kleine Antilleninseln hinweg, auf den Horizont strahlender Kulturländer nördlich vom Isthmus, einen beängstigenden Schatten geworfen.
Von Volk zu Volk war es geraunt worden. Bis in die vulkanumgrenzte Hochebene Anahuac war die dunkle Kunde von der Ankunft bleicher Männer gedrungen. Und aus östlichen Küstenstrichen brachten reisende Mexikaner die Nachricht heim, daß als Trophäe an einem Altare dort die weiße Menschenhaut eines Schiffbrüchigen hing ...
Seit einem Vierteljahrhundert senkte sich der Schatten des weißen Mannes auf alle Freuden. In jedem Naturgeschehnis glaubten die Verängstigten ein Wahrzeichen des nahenden Weltumschwungs zu sehn. Zweifelhaft schien nur noch, ob Sintflutgewässer die Bergspitzen bedecken, ob die Erde in Flammen aufgehn, ob ein Orkan Paläste und Hütten gleich Blättern fortfegen werde.
Es fehlte an Zeichen nicht und nicht an Zeichendeutern. War doch der See, aus dem die Lagunenstadt Mexico-Tenuchtitlan sich erhob, jüngst siedend emporgeschäumt in brandenden Wogen. War doch das seltene Jubelfest Unsere-Jahre-umgürten-sich, bei welchem nach zweiundfünfzigjähriger Frist alles Feuer des Landes gelöscht und im Heiligtum des benachbarten Iztapalapan neu entzündet wurde – war es doch zum Trauerfest geworden durch den unerklärlichen Brand in den Türmen des großen Tempels. Hatte doch eine Luftspiegelung im Dunste der untergehenden Sonne gepanzerte, kämpfende Männer dem staunenden Volke gezeigt. Und hatten doch nächtliche Wanderer eine Stimme vernommen, schmerzlich wehklagend in den Lüften: "Weh, meine Töchter I Weh, meine Söhne! Die Stunde des Verderbens naht I"
Am Nachthimmel aber schritt ein Komet seine Bahn in blauem Geloder.
Da geschah im alten Schloß von Tlatelolco ein Wunder, das auch den Sorglosen die Brust beengen mußte.
#####
Tlatelolco, einst Schwesterstadt und Rivalin, war jetzt Mexico einverleibt und bildete, eine dreieckige, von Kanälen durchaderte Insel ausfüllend, den nördlichen Stadtteil der Lagunenstadt.
Als in grauer Vorzeit die sieben Stämme der Azteken ihre Urheimat, das Reiherland, verlassen hatten, fanden sie unter einem geknickten Baum zwei Kästchen, die sie öffneten, in dem einen lag ein Smaragd, und alsbald begannen sechs Stämme Streit um ihn, – in dem anderen aber lagen Stäbe zum Feuerreiben, und nur der Stamm der Tenuchcas legte Wert auf deren Besitz. Entzweit, in zwei Haufen geteilt, setzten sie ihre Wanderung fort, durchzogen Culhuacan, Xalisco, Michuacan, kamen nach Tula, Tlacopan und Chapultepec, und bedrängt von mächtigen Nachbarn, suchten sie Schutz auf zwei Inseln inmitten eines Schilfsees, die sie besiedelten: die Besitzer der Feuerstäbe wurden die Gründer Mexico-Tenuchtitlans, die Erbauer Tlatelolcos aber besaßen den Smaragd und nannten sich die Adligen.
Jahrhundertelang hielt gemeinsam ertragene Not den aufzüngelnden Bruderhaß nieder. Als aber der kühne Bastard Obsidian-Schlange, der vierte König Mexicos, die Macht des Tyrannen Schambinde gebrochen, das Tepanekische Kaiserreich zerstört und mit den an der Lagune gelegenen Städten Tezcuco und Tlacopan den unüberwindlichen Drei-Städte-Bund geschlossen hatte, sahen sich die Könige von Tlatelolco zu Vasallen erniedrigt. Sie leisteten Kriegsgefolgschaft, planten jedoch im Herzen den Tod des Herrn der Welt. Obsidian-Schlange und sein Nachfolger Montezuma I., der Himmelspfeil, entgingen nur durch Zufall ihren Anschlägen. Unter dem Enkel der Obsidian-Schlange, dem grausamen König Wassergesicht, kam es zu blutiger Abrechnung. Wassergesicht hatte seine Schwester dem letzten Könige von Tlatelolco, dem Dornenreichen Baum, zum Weibe gegeben. Dennoch schmiedete der Dornenreiche Baum Ränke mit Mexicos Erbfeinden, den Staaten Chalco, Huexotzinco und Matlatzinco. Die Königin, der dies nicht verborgen blieb, wollte an seinem Verrat nicht teilhaben und flüchtete mit ihren vier Kindern zu Wassergesicht.
Nun war das Los geworfen, und Wahnsinn ergriff die Stadt Tlatelolco. Frauen und Mädchen eilten nachts nach Mexico und durchliefen wie tollwütige Wölfinnen die Straßen, Wutschreie und Drohrufe ausstoßend. Der Schwarzbraune, ein Priester des Huitzilopochtli, wusch den Altar des Kriegsgottes und gab das mit Menschenblut gemischte Wasser dem König und dem Volk zu trinken, um sie zu entflammen. Bei Sonnenuntergang verkündete das Gedröhn der Schildkrötenpanzer-Trommel das Nahen der mexikanischen Standarten. Die Schlacht auf dem großen Marktplatze war bald entschieden. Der Dornenreiche Baum, der auf die oberste Terrasse des von ihm erbauten Tempels der Erdgöttin – der Frau mit dem Schlangen-Unterrock – hinaufgeflohen war, wurde ergriffen, nach Mexico geschleppt und in einen Holzkäfig gesperrt. Wassergesicht aber ließ in seinem Palaste ein glänzendes Festmahl rüsten, zu welchem er alle Großen des Reiches und den Adel Tenuchtitlans einlud. Und während mit ihm seine Gäste von goldenen Schüsseln weiße Mais-Würmer aßen und aus goldenen Bechern kostbaren Honigwein und Kakaoblumenwein tranken, ließ er den Dornenreichen Baum hereinführen, gräßlich foltern und dem Kriegsgott schlachten – vor den Augen der Schwelgenden, um die Festfreude zu erhöhen und den Genuß der Speisen und Kräutertränke auf abgefeimte Art zu würzen.
So endete der letzte König von Tlatelolco.
Im verwaisten Königsschlosse residierten seitdem Statthalter. Als dann – nach einem Menschenalter – Montezuma der Jüngere als neunter König über Mexico-Tenuchtitlan herrschte, verlieh er das Schloß und die Statthalterschaft seinem Schwager, dem Steinigen Feld. Wenige Jahre darauf starb das Steinige Feld. Seine junge Witwe aber, Papan, des Montezuma Schwester, blieb im alten Schlosse von Tlatelolco wohnen, und betreut von einigen Palastdamen und einem alten Haushofmeister, mit Namen die Stechende Ameise, brachte sie ihre Tage in den verödeten Prunksälen und unter Fächerpalmen des am Schilfsee gelegenen Gartens hin.
Sie war ungewöhnlich schön und von weicher Gemütsart. Von Kind an hatte sie den Trieb, Balsam zu träufeln in Wunden, die Mexicos Größe und Glanz geschlagen. Doch es waren zu viel der Wunden, und sie war allein.
Die jahrhundertelang getriebene Inzucht der chichimekischen Fürsten hatte einen Spätling am alten Stamm, eine fast krankhaft verfeinerte Blüte hervorgebracht. Unterrichtet von den besten Lehrern, berühmten Philosophen, Rhetoren und Künstlern der jüngst errichteten Akademien in Tenuchtitlan und Tezcuco, hatte Papan ihre Begabung für Musik und Poesie bis zur höchsten Vollendung entwickelt. Ihre Reden wurden bewundert in diesem Lande der feinhörigen Redner, ihre sinnschweren Verse trugen ihr den Ruhm einer Dichterin ein. Doch ihr Herz blieb unbefriedigt. Ihr selbst erst unbewußt, hatte sich ein heimlicher Haß in sie eingeschlichen gegen die eigene überfeinerte, berückende Kultur, die aus Sklavenhekatomben emporgewachsen war wie ein leuchtender Scharlachpilz aus Morästen. Zu teuer erkauft mit Blut und Tränen erschien ihr das Kolibrifeder-Mosaik ihres Stirndiadems und der Wohllaut ihrer kleinen Flöte aus geschliffenem Kristall.
Der Tod des Steinigen Feldes hatte sie zutiefst erschüttert, so daß sie, Freuden und Festen entsagend, in ihrem einsamen Palaste das Leben einer Heiligen zu leben begann. Damals hatte ihr Oheim, der Herr des Fastens, König von Tezcuco und Mitregent Montezumas, ein Hospital für Blinde erbaut. Zur feierlichen Entzündung des Herdfeuers war auch Papan erschienen, und seither wurde es ihr eine liebe Beschäftigung, die Blinden zu besuchen und zu trösten. Fast täglich ließ sie sich an die östliche Küste der Lagune hinüberrudern. Doch nicht nur die Blinden lockten sie nach Tezcuco. Das Hospital unterstand einem Kloster, welches Quaquiles bewohnten, fanatische Asketen und Anhänger des Heilbringers Quetzalcoatl, und diese hatten es unternommen, die mexikanische Prinzessin in die Mysterien ihrer Geheimlehre einzuweihen. Nicht ohne Hintergedanken taten sie es. Denn Mexico diente fast nur noch den blutdürstenden Göttern Tezcatlipoca und Huitzilopochtli, und im großen Tempel des Kriegsgottes war bereits ein Gefängnis für andere Götter errichtet. Die Mönche des Quetzalcoatl hatten das Ziel, die Menschenopfer abzuschaffen. Und Tezcucos König der Herr des Fastens unterstützte diese Bestrebungen.
Wundersam schwermütig klangen die heiligen Lieder, die von Quetzalcoatl, der Grüngefiederten Schlange, erzählten. Als noch das verschollene Volk der Tolteken das Hochtal Anahuac bewohnte, war er unter ihnen erschienen, geboren von der jungfräulichen Mutter, dem Mädchen von Tula, welche geschwängert worden war durch einen grünen Edelstein, den sie als Schmuck am Busen trug. In Tula, der Hauptstadt der Tolteken, nahm Quetzalcoatl Wohnsitz und hauste als Priesterfürst in der auf einer Flußinsel aus Meermuscheln und Silber erbauten Königsburg – ein hoher starker Mann, mit weißem Antlitz, mit langem, dichtem Bart und hochgewölbter Stirn. Schamhaft war er – darum trug er sein weißes, mit Kreuzen besätes Gewand lang herabwallend bis an die Knöchel. Täglich kasteite er sich, stach sich das Fleisch der Schenkel mit scharfen Aloe-Dornen blutig. Und mitternachts badete er einsam in einem Brunnen inmitten des Schlosses.
Er verabscheute die Menschenopfer, nur Schlangen, Blumen und Schmetterlinge opferte er. Gesetze, Kalender und Schrift führte er bei dem noch rohen Volke ein, er unterwies die Tolteken in allen Künsten, er lehrte sie Baumwolle weben, Steine schneiden, Tonwaren brennen und Metalle schmelzen. Ein goldenes Zeitalter brach in Anahuac an. Maiskolben erreichten Manneshöhe, Melonen hatten den Umfang halbwüchsiger Kinder. Doch die Büßerkraft dieses Asketen gefährdete den Krieg, ohne den die Welt nicht bestehen kann, und die Götter in den dreizehn Himmeln sahen ihre Macht bedroht. Wie sie einst den Büßer Yappan durch die schöne Liebesgöttin Ixcuinan verführt hatten (in Staub war sie zerfallen, als er sie zu umarmen suchte), so beschlossen sie auch Quetzalcoatl zu verderben. Der unheimliche Tezcatlipoca ließ sich an einem Spinnenfaden vom Himmel herab, und in der Gestalt eines Greises überreichte er dem Heiligen einen gekrümmten Spiegel. Grauen erfaßte Quetzalcoatl, als er sich im Spiegel gesehen. "Ich bin alt", sagte er. Vor keinem Menschenauge wollte er sich mehr blicken lassen. Umsonst schmiedete ihm sein treuster Jünger eine kostbare, mit Türkis-Mosaik überkrustete Schädelmaske. Und wieder kam Tezcatlipoca und brachte Wein, den er als den Trunk der Unsterblichkeit anpries. "Ich berausche die Welt! Du wirst mir danken!" sprach er in Zauberergestalt. Da schlürfte Quetzalcoatl den Trank durch einen Rohrstiel ein, bis er berauscht war, und seiner Sinne nicht mächtig, schändete er die eigene Schwester Quetzalpetlatl. Nun war seines Bleibens nicht mehr im Lande, Scham und Verzweiflung trieben ihn fort in die Ferne. Die Stimme des genossenen Zauberweins raunte ihm gebieterisch zu, er müsse nach Süden, seiner Seele Heimat, das Fabelreich Tlillan-Tlapallan, suchen. "Die Sonne ruft mich!" sagte er. Und in einen Quellbrunnen versenkte er seine Kostbarkeiten, Bücher und Kleinodien. Viele seiner Anhänger und alle Singvögel der Gärten Tulas begleiteten ihn auf der nun beginnenden Irrfahrt, von der noch späteren Geschlechtern sein Händeabdruck im Fels bei Tlalnepantla und ein von ihm gesteinigter Fruchtbaum Zeugnis gaben. Über Schneegebirge zog Quetzalcoatl, und im Schneesturm erfroren die meisten seiner Begleiter, wohl weinte er um sie und um sich, doch dann wieder verwirrte ihn so wilde, unsinnige Hoffnungsfreude, daß er sich vom Krater eines Vulkans bis in die Ebene sausend hinabgleiten ließ. Als er an der Stadt Cholula vorbeizog, hielten ihn die Bürger fest und zwangen ihn, ihres Landes Krone zu tragen. Jahrelang blieb er in der heiligen Stadt, ein gefangener König und Gott. Dann floh er auch aus Cholula, mit nur vier Jüngern, und irrte von neuem umher, das Land Tlillan-Tlapallan suchend. An der Seeküste durchschoß er mit einem Pfeil einen Baum, und die zwei aus dem Stamm ragenden Enden des Pfeiles wurden dick wie der Stamm, so daß der Baum einem Kreuze glich. Danach entließ er die vier Jünglinge, und tränenschweren Abschied nehmend, trug er ihnen eine Botschaft auf an seine Anhänger in Cholula und Tula: sie sollten sich nicht grämen, einst werde er wiederkommen mit anderen weißen Gefährten, um wieder König über sein Volk zu sein, Frieden allen Ländern zu bringen und die Tränen der Witwen und Waisen zu trocknen. – So lautete seine Verkündigung. Doch niemand erfuhr je, was aus ihm geworden. Einige meinten, er habe ostwärts, über das Weltmeer in einem Schiff aus Schlangenhäuten segelnd, Tlillan-Tlapallan erreicht und lebe dort in ewiger Jugend, andere sagten, er habe sich selbst in einer Steinkiste verbrannt, und sein Herz sei der Morgenstern geworden, seine Asche aber sei in der Gestalt von Blumenvögeln mit strahlendem Gefieder in alle Winde geflogen.
Nun verehrten ihn die Völker Anahuacs als den Gott des Windes und sein Herz als den Herrn der Morgenröte, den blauen Planeten. Doch er war ein Mensch gewesen – diese Erinnerung schwand niemals –, ein Mensch und zugleich ein König, anders geartet als die entmenschten Könige der Chichimeken, und ein Feind der bluttrinkenden Götter Mexicos. Wo war ein Volk, wo eine Stadt, die nicht seufzten unter dem Joch ihrer Knechter? So kam es, daß Mexicos bange Ahnung und die Hoffnung der Unterdrückten auf den weißen Kreuzträger nie ganz erlosch durch Jahrhunderte, ja, in weichen Gemütern wollte der Traum vom Friedensreich wieder Flamme werden, seit Gerüchte schwirrten von den gelandeten bleichen Göttern auf den Inseln des Südens.
#####
Während bei der Einweihung des neuerbauten Tempels Tlamatzinco zwölftausendzweihundertundzehn Kriegssklaven das Herz aus der Brust gerissen wurde, erkrankte die Prinzessin Papan. Nach Wochen erhob sie sich vom Krankenlager, doch nie mehr genas sie ganz. Ihr Gemüt war zart wie eine Schneeflocke und vorherbestimmt für die Heilslehre vom künftigen Friedensreich. Sie, die mexikanische Prinzessin, die Schwester des großen Montezuma, stand im Begriff, Nonne in einem Frauenkloster der Quaquiles zu werden ...
Ihr Tod vereitelte diesen Plan. Kaum fünfunddreißig Jahre alt, starb sie im Frühling des Unheilsjahres Ce-Acatl, Eins-Rohr.
Der schweigsame Montezuma hatte ihr stets mehr ausgesuchte Höflichkeit als Liebe bezeigt. Wohl lag es in seinem Wesen, falsche Gefühle, als wären es Juwele, auf dem Handteller zu tragen, um so scheuer verbarg er die echten. Jetzt, wo sie tot war, übermannte ihn der Schmerz, und die nie gesprochenen Worte der Liebe erhoben sich in seiner Brust wie Ankläger.
Er ließ Papan pomphaft bestatten. Die Könige von Tezcuco und Tlacopan kamen zur Beerdigung und ebenso die sechshundert Adligen aus dem großen Palast in Tenuchtitlan.
Auf die übliche Opferung von Sklaven und Dienerinnen wurde verzichtet, da Montezuma dem auf dem Sterbebett geäußerten Wunsche seiner Schwester nicht zuwiderhandeln mochte.
Eigenhändig schnitt er ihr die Stirnlocke – den Sitz der Seele – vom Haupt und verwahrte sie in einem kostbaren Kästchen.
Im Schloßgarten von Tlatelolco wurde ihr Leichnam bei Sonnenuntergang beigesetzt, in einem unterirdischen ausgemauerten Mausoleum, dessen Treppeneingang nicht weit von ihrem Lieblingsaufenthalt entfernt war, einem von weißen Terebinthen umschatteten gestuften Steinbecken aus poliertem Porphyr, darin sie – vor ihrer Krankheit – bei Mittagsglut zu baden pflegte.
Auf einen Stuhl inmitten des Grabgewölbes wurde die Leiche gesetzt, nachdem sie in weiße Totengewänder aus seidigem Kaninchenhaar-Gewebe gekleidet worden war. Ihr Gesicht bedeckte eine buntbemalte Maske. Über die Schultern ward ihr ein Mantel gebreitet, reichgewebt mit den Abzeichen des Gottes, den ihr Herz erwählt hatte, Quetzalcoatls. Auf die Knie legte man ihr einen Spinnrocken. Und in einem Achatgefäß, auf welches ein Schmetterling gemalt war, wurden Speisen neben sie gestellt, damit sie nicht darbe auf der weiten Fahrt ins Totenland. Und Priester mit Fackeln und Papierfahnen räucherten auf weißen Tonschalen kleine Pillen des köstlichsten Kopalharzes und trösteten mit Litaneien die Tote: sie werde – gleich den gefallenen Kriegshelden und den in Geburtswehen verblichenen Frauen – in das beste der drei Totenreiche eingehen, in das Land der Sonne, wo die Verstorbenen zwischen zauberhaften Blumenbeeten tanzen und im Goldgefieder bunter Vögel den Sonnenball umfliegen. Nachdem Papans Totenwohnung durch eine Steinplatte geschlossen worden war, begab sich Montezuma nach Tenuchtitlan zurück, betete lange im Tempel der Trauer und suchte Zerstreuung und Vergessen bei einem prächtigen Leichenmahl.
#####
Als am folgenden Morgen die noch nicht aufgegangene Sonne den Schnee der östlichen Kordillerenkämme gelblich zu durchleuchten begann, lief das Töchterchen einer Palastdame, ein etwa fünfjähriges, melancholisch dreinschauendes Mädchen mit goldenem Lippenring, durch den dämmerigen Schloßgarten. Das Kind hatte das in einem Seitenflügel des Schlosses gelegene Schlafgemach seiner Mutter verlassen, um im Hauptgebäude eine alte Edelfrau aufzusuchen, der die Aufsicht über die jüngeren Hofdamen und die Erziehung der im Schlosse lebenden Kinder übertragen war. Der Weg führte das Mädchen am porphyrnen Badebecken vorbei, und im schummrigen Morgenlicht gewahrte es, daß auf den Steinstufen des Beckens eine Gestalt saß. Das Kind trat neugierig und furchtlos heran und sah: eine hagere Frau saß dort, in ein schneeig schimmerndes Hemd gehüllt, strähnige, mit duftendem Harz verharschte Haare fielen ihr auf die Schultern, zerzaust und wirr, wie zerwühlt von schmerzdurchkrampften Händen. In diesem Augenblick schossen die ersten Sonnenstrahlen durch das dichte Baumgeäst und verwandelten die weißen Terebinthenblüten in rosenrote. Da erkannte das Kind die junge Frau, obgleich eine Maske ihre Züge verdeckte, und da es zu klein war, um zu begreifen, was Sterben bedeutet, glaubte es, die Prinzessin Papan entkleide sich dort und nehme ein Bad. Auch lief es nicht davon, als die Verstorbene es mit dem Schmeichelwort Cocoton, das heißt Täubchen, heranrief, es kam vielmehr ganz unbefangen näher und fragte, was die Prinzessin begehre. Da trug ihr die Tote auf, sie solle zu jener alten Edelfrau, ihrer Erzieherin, laufen. "Und sage ihr, Täubchen, daß ich sie rufe und daß sie gleich kommen muß."
Sofort eilte das Kind, den Auftrag auszuführen.
Die Erzieherin, die Schaum des Meeres hieß, war die Witwe eines im Kriege gegen die Zapoteken gefallenen Feldherrn. Einst, unter Montezumas Vorgänger, König Molch, dem Tempelerbauer, hatte sie am Hofe von Tenuchtitlan ein glanzvolles Leben geführt, hochangesehen wegen ihres Adels – sie war mit dem Königshause verwandt – und wegen der Zierlichkeit ihrer Ausdrucksweise, denn nichts wurde in Anahuac mehr geschätzt als die Eleganz der Rede und die souveräne Beherrschung der bunt schillernden und wie Feuersteinmesser klirrenden Sprache. Da Schaum des Meeres auch über eine nicht gewöhnliche Kenntnis der Ritualbücher und heiligen Bilderschriften verfügte, wurde sie später von Montezuma dazu ausersehen, bei der früh verwaisten Papan Mutterstelle zu vertreten. Als dann das Steinige Feld gestorben, war sie ins Schloß von Tlatelolco gezogen, um auf Wunsch der versonnenen Prinzessin die Damen des kleinen Hofstaates in Zucht zu halten.
Die Augen dick verschwollen nach durchweinter Nacht, hockte sie jetzt in ihrem mit Wandteppichen behängten Zimmer auf einem gelben, blaugetüpfelten Kissen und hielt in der Hand einen kreisrunden schwarzen Obsidian-Spiegel am länglichen rotlackierten Holzstiel. Sie beendete eben ihre Gesichtsbemalung. Zum Zeichen der Trauer zog sie sich weiße Streifen vom Mundwinkel zum Ohr. Da hob sich der Korallenvorhang, der ihrer Kammer als Tür diente, und das Kind trat ein.
Tränen stürzten aus den Augen der alten Frau, sobald sie des Kindes Botschaft vernommen. Mit wehmütigem Lächeln suchte sie der Kleinen verständlich zu machen, daß die Toten nicht wiederkehren aus dem Himmel der Sonne, wo sie zum Lohn für gute Taten mit den Göttern vereint sind.
Doch das Kind ließ es sich nicht ausreden, immerzu wiederholte es, was die badende Prinzessin gesagt hatte, und schließlich erfaßte es den ärmellosen hemdartigen Überwurf der Erzieherin und zerrte sie hinaus. Widerwillig, bloß um das erregte Kind zu beschwichtigen, ließ sich Schaum des Meeres die breite Schloßtreppe hinab in den Garten führen. Doch als sie sich dem Porphyrbecken genähert hatte, rieselte ihr das Grauen in eisigen Bächen über den Rücken. Ja, dort kauerte die weiße Gestalt Papans – so steinern und still, daß ein großer Atlasfalter an ihr linkes, von einem nephritenen Ohrpflock erweitertes Ohrläppchen herangeflattert war, er klammerte sich daran, als wäre es ein Blumenkelch, und die Spiralen des Saugrüssels rollend, schlug er mit den ausgebuchteten Azurflügeln an ihr Nackenhaar.
Die alte Frau brach ohnmächtig zusammen.
Jetzt erschrak auch das Kind, als es die Greisin leblos daliegen sah, und wild aufschreiend floh es in den Seitenflügel zu seiner Mutter. Diese hörte ungläubig an, was ihr Töchterchen erzählte, begab sich aber trotzdem, von mehreren anderen Palastdamen begleitet, sogleich zum Badebecken. Wirklich, das Kind hatte die Wahrheit gesprochen –: dort lag die Ohnmächtige am Boden, und auf den Steinstufen hockte der begrabenen Prinzessin weißes Gespenst.
Ergrausend wollten die Frauen fliehen.
Da hob Papan ihre Hand – rotbemalt war die Hand, die Fingernägel schneeweiß –, und sie sprach mit müder, kaum vernehmlicher Stimme:
"Bleibt ... Ich erwachte nachts ... Eine Schlange raschelte, glitt eisig über meinen Fuß ... Da fürchtete ich mich ... Ich rief, ich schrie – niemand kam ... Oh, wie ich schrie! ... Ich tastete mich zur Tür ... Der Stein gab nach ... Haltet es geheim, daß mich die Götter zurückgeschickt haben aus dem Haus der Eule ... Ich muß noch eine Weile bei euch sein ... Führt mich in mein Zimmer ... Mich friert ..."
Wie das Lallen einer Irren klangen die fiebrig gehauchten Worte.
Doch die Frauen begriffen, daß sie ins Leben zurückgekehrt war, und drängten sich an die Herrin heran, knieten, schluchzten, küßten ihr die Hände.
Ihre seitwärts gestellten, länglichen Augen blickten starr in die Ferne, als sähe sie die Menschen nicht. Mühsam öffnete sie noch einmal den schmerzlich zuckenden Mund: "Ich will schlafen", sagte sie.
Da trugen sie die Frauen ins Schloß, entkleideten sie, brachten sie zu Bett. Mit Mänteln aus Edelmarderfell und aneinandergenähten Papageiendaunen wurde sie bedeckt. Frost schüttelte ihre sterbensmatten Glieder.
Gegen Mittag fiel Papan in einen tiefen, heilgebenden Schlaf.
Ihre Wiederkehr aus dem Lande der Sonne wurde streng geheimgehalten.
Früh am nächsten Morgen ließ Papan den alten Haushofmeister die Stechende Ameise an ihr Bett rufen. Jetzt war ihr Lager von Blumen bedeckt.
"Warum weinst du?" fragte sie.
"Vor Freude, Herrin", erwiderte er kniend, die Arme ehrfürchtig auf der Brust verschränkt. Doch in seiner Stimme bebte mehr Grausen als Freude. Er war abergläubisch und fürchtete sich vor den an Kreuzwegen lauernden vampirhaften Seelen verstorbener Frauen, welche aus dem Westen, der Gegend der Weiber, auf die Erde niedersteigen.
"Dir bangt vor mir", fuhr sie matt lächelnd fort. "Warum? Weil ich die Götter von Angesicht zu Angesicht gesehen? Keine Leiter führt von ihren Geheimnissen hernieder zu uns, die wir auf Erden atmen und Schmerz ertragen. Warum also erschreckt dich mein Anblick? Ich bin nur ein armer Mensch wie du!"
"Verlaß uns nicht wieder, Herrin!" sprach er verlegen.
Sie schien es zu überhören. Mit dem abgemagerten Nacken gegen ein aufrecht gestelltes weißes Baumwollkissen gelehnt, flocht sie emsig an ihrem langen Zopf.
"Schau, Stechende Ameise, mein schwarzes Haar ist weiß geworden ...", sagte sie. "Das geschah, als die kalte Schlange über mich kroch ... Geh nach Tenuchtitlan zu König Montezuma, melde ihm, daß seine Schwester lebt und ihn bittet, zu ihr zu kommen. Große Dinge muß ich ihm enthüllen."
Der alte Mann stand da wie vom Blitz gerührt.
"Vergib mir – ich wage es nicht, Herrin", stammelte er.
Erstaunt sah ihn Papan an. Doch gleich darauf begriff sie. Dem Herrn der Welt die Nachricht überbringen, daß er eine Lebende betrauert und begraben! Kein Zweifel – das hieß ihren Diener ins Verderben schicken. Montezuma würde den alten Mann, ohne auch nur die Nachricht zu prüfen, als Lügner totpeitschen lassen, damit den vielen üblen Vorzeichen, die ihn und seine Völker schreckten, kein neues sich geselle. Sie wußte, wie krankhaft gereizt ihr Bruder war, seit der Blaue Himmel – die turmartige Kapelle auf der Stufenpyramide des großen Tempels – sich selbst entzündet und Nacht für Nacht der Komet über Tenuchtitlan drohte wie eine gezückte Todeswaffe.
Die Prinzessin sann eine Weile nach. Dann sagte sie: "Rudere nach Tezcuco hinüber und bitte meinen Oheim, den Herrn des Fastens, zu mir her."
Der Haushofmeister atmete auf. Er beugte sich, berührte mit der Hand die Erde zum Gruß und verließ das Gemach.
#####
Wie eine riesige Vogelspinne saß Mexico-Tenuchtitlan in der Südwestecke des Schilfsees und hatte ein Netz von gequaderten Steindämmen über den Wasserspiegel gesponnen, – ein Dammweg führte nach Iztapalapan im Süden, ein anderer nach Chapultepec im Westen, ein dritter nach Tepeyacac im Norden. Diese herrlich ausgemeißelten Dämme, der Stolz der Könige Mexicos, ermöglichten den Fußgängerverkehr mit den Uferstädten. Nach dem nordöstlich am Seeufer gelegenen Tezcuco jedoch führte kein Damm, ja nicht einmal im Boot konnte man es geradeswegs erreichen, denn als die große Überschwemmung einen Teil Tenuchtitlans unterspült und viele Häuser fortgerissen hatte, glaubten die Mexikaner sich durch ein Steinwehr schützen zu müssen, das nun den See zwischen Tenuchtitlan und Tezcuco in zwei Hälften zerschnitt. Nur am südlichen Teil des Sees befand sich eine leicht verstopfbare Wehröffnung, um größeren Lastkähnen die Durchfahrt zu ermöglichen.
Der Haushofmeister ließ sich von zwei Sklaven an das Wehr heranrudern und fand jenseits ein Boot, das ihn nach Tezcuco brachte.
Die Stadt Tezcuco, obgleich um vieles kleiner als Tenuchtitlan und nicht so reich an prunkvollen Palästen, übertraf doch die mächtige Bundesgenossin und Rivalin durch den ausgesuchten Geschmack in der Architektur seiner Bauten, durch die sprichwörtliche Höflichkeit und Gesittung seiner Bewohner und durch das ehrwürdige Alter vieler seiner Heiligtümer. Hier war der Sitz und Mittelpunkt der chichimekischen Kultur Anahuacs. Das Volk Quetzalcoatls, die erfinderischen Tolteken, durch die von Norden her einbrechenden Chichimeken aus Tula vertrieben, war in südliche Maya-Länder gewandert, war verschollen, nachdem es Bilderschriften, Flöten und Gesänge mit sich genommen. Doch blieb die Überlieferung lebendig, daß ein kleiner Teil der Vertriebenen sich in Tezcuco angesiedelt und die Segnungen ihrer hohen Geistesbildung und Kunstfertigkeit den rohen Eroberern, den chichimekischen Acolhuas, übermittelt habe. An dieser Tradition hingen die Acolhuas, die Bewohner Tezcucos, mit stolzer Überheblichkeit und rühmten sich, daß zu allen Zeiten ihre Stadt die bedeutendsten Dichter und Weisen beherbergt habe. Aber der Glanz Tezcucos drohte jetzt zu erblassen, überstrahlt vom übermächtigen Tenuchtitlan. Ein uneingestandener Groll gegen die unersättlichen Bundesgenossen war im Herzen der Acolhuas und zernagte auch ihrem Könige, dem Herrn des Fastens, das Herz.
Sein Vater, der Hungrige Schakal, der berühmte, in Liedern gefeierte Held und König, war als Jüngling vom tepanekischen Tyrannen Zürnender Aderlasser und dessen Sohn, Prinz Schambinde, seiner Herrschaft beraubt worden und hatte lange Jahre, von Dorf zu Dorf, von Berg zu Berg wie ein Wild gehetzt, das Leben eines Flüchtlings führen müssen. Damals trug auch Tenuchtitlans König, der Bastard Obsidian-Schlange, noch das Joch der Tepaneken. Und erst als des Hungrigen Schakals kleine Begleiterschar, mit den Jahren zum Heer angewachsen, sich den aufständischen Mexikanern verbündet hatte, gelang es, den Tyrannen und sein Tepanekenreich zu vernichten. Beide Könige, der von Tenuchtitlan und der von Tezcuco, hatten gleichen Anteil am Sieg, am Ruhm, an der ihnen nun zugefallenen Macht und sollten gleichberechtigte Stimmen haben bei der Leitung des von ihnen begründeten Drei-Städte-Bundes, in den sie auch, zum Lohn für geleistete Hilfe, das schwächere Tlacopan aufnahmen, welches neben den Ruinen von Azcaputzalco, der zerstörten Hauptstadt der Tepaneken, am nordwestlichen Seeufer emporblühte. Gleichberechtigt sollten sie sein – das war beschlossen und beschworen worden damals –, und wie ungleich waren sie jetzt schon, kaum zwei Menschenalter hernach. Das habgierige Mexico streckte seine Fangarme bis an die heißen Küsten beider Ozeane, und der König von Tenuchtitlan hieß: der Einzige Herr der Welt.
Des Hungrigen Schakals strahlende Liebenswürdigkeit hatte sein jüngster Sohn und Nachfolger, der Herr des Fastens, nicht geerbt – eine düstere, keine Schranken kennende Tugendliebe war sein hervorstechender Wesenszug. Wohl aber hatte er von seinem Vater die Neigung überkommen, den Kunstwerkstätten und Gelehrtenschulen seines Landes ein Förderer zu sein. Und der bange Zweifel, der die Denkenden jener Zeit beunruhigte und sogar die letzten Jahre seines aufgeklärten Vaters getrübt hatte, ließ auch ihm das Glück seiner Königsherrlichkeit fragwürdig erscheinen – der Zweifel nämlich, ob die goldschimmemde Kultur der Völker Anahuacs von Bestand sein könne, da sie errichtet war auf einem Fundament von Sklavenschädeln. Zehntausende und aber Zehntausende Kriegsgefangener fraßen die Götter Mexicos alljährlich, und das Fleisch der menschlichen Opfer wurde, mit Mais gebacken, an das Volk verteilt. Nie zu sättigen war der gierige Rachen, um ihn zu füllen, mußten Kriege, die nichts anderes waren als Sklavenraubzüge, geführt werden, aber jeder Sieg vermehrte die Feinde Anahuacs diesseits und jenseits der Grenzen. In unmittelbarer Nähe Tenuchtitlans lauerten mächtige Stadtgemeinden auf den Augenblick, über den Bluttrinker herzufallen wie Aasgeier über einen toten Wolf.
Die Prinzessin Papan hatte vor ihrer Erkrankung, wenn sie zu den Quaquiles nach Tezcuco kam, oft mit ihrem Oheim Zwiesprache gehalten und ihn, der sie wie eine Heilige verehrte, in seiner Abneigung gegen die Menschenschlächterei bestärkt. Da entschloß er sich eines Tages, den Befehl zu erteilen: in Zukunft sollten in seinem Lande keine Menschen mehr geopfert werden. Seit Quetzalcoatls goldenem Zeitalter hatte sich kein Fürst Anahuacs erkühnt, der Blutgier der Götter Einhalt zu tun. Und auch der Herr des Fastens sollte von seinem Wagemut mehr Kummer als Befriedigung ernten.
Zwar bei den Bewohnern Tezcucos, die sich rühmten, von den Tolteken, dem Volk Quetzalcoatls, abzustammen, stieß seine Neuerung auf keinen Widerstand. Und längere Zeit wurden nur Opfertiere die steilen Tempeltreppen emporgeführt. Die Sklavenjagden hörten auf, die Krieger halfen ihren Frauen, Maisfelder zu bestellen.
Doch die Götter grollten. Der Schatten des weißen Mannes verdüsterte mehr und mehr den Horizont. Der blaue Komet leuchtete am Nachthimmel. Und die Priester des Tezcatlipoca und Huitzilopochtli bestürmten den verängstigten Montezuma und wiesen auf Tezcuco als auf die Ursache so schlimmer Vorzeichen.
Da sandte Montezuma Boten an seinen Oheim, den Herrn des Fastens, und ließ ihm Vorhaltungen machen: erzürnt seien die Götter, denn seit vier Jahren habe er mit den Nachbarrepubliken Huexotzinco und Tlascala nicht mehr den üblichen Blumenkrieg geführt, seit vier Jahren sei in Tezcuco keinem menschlichen Opfer der Edelstein (nämlich das Herz) aus der Brust gerissen worden, uneingedenk der Ruhmestaten seiner Vorfahren schände er den großen Namen der Chichimeken und Acolhuas, indem er den Göttern das Blut vorenthalte, das ihnen am süßesten schmecke. So lautete seine Botschaft.
Der Herr des Fastens war tief verletzt. Er ließ seinem mächtigen Neffen zurückmelden: Nicht aus Feigheit lasse er die Waffen ruhen, denn Kriegstaten, die er einst vollführt, sprächen für ihn, und Lieder rühmten ihn als Blume auf dem Felde der Schlacht. Uralte Weissagung habe jedoch prophezeit, daß im herannahenden Jahre Eins-Rohr den beiden Kronen von Tenuchtitlan und Tezcuco Gefahr drohe, darum wolle er die kurze Zeit, die das Schicksal ihm gelassen, in Frieden genießen.
Doch diese stolze Antwort befreite den Herrn des Fastens nicht vom Stachel, der in seiner Seele saß, bis sie wund ward und eiterte. Er begab sich nie mehr nach Tenuchtitlan zu den Festen des Großkönigs. Jahrelang blieb er fern, und wenn Montezuma ihn auffordern ließ, fand er Ausflüchte.
Erst das jähe Hinscheiden Papans riß ihn aus seiner trotzigen Vereinsamung. Zu ihrem Begräbnis kam er über den See. Die Begrüßung zwischen ihm und Montezuma war eisig. Nachdem das Grabgewölbe mit der Steinplatte geschlossen war, ließ er sich zurückrudern.
Der Herr des Fastens war jetzt ein Mann von neunundfünfzig Jahren, doch erschien er weit jünger –: das Alter drückt auf indianische Gesichter selten seinen zerbeizenden Stempel. Das breitknochige Gesicht war bartlos. Die vorspringende, sehr gebogene Nase war an den durchbohrten Nüstern mit Türkispflöcken geziert, dem Abzeichen hohen Feldherrnranges. Die dünnen, an den Mundwinkeln herabgezogenen Lippen hatten einen weichlichen, schwermütigen Ausdruck. Das Haar, vom Federschmuck fast ganz verdeckt, war hartsträhnig, blauschwarz und weiß gemischt.
Als Papans Haushofmeister vor ihn geführt worden war und ihm geheimnisvoll Mitteilung machte von der Wiederkunft der Begrabenen und ihrem Wunsch, ihn zu sprechen, verriet kein Zug im grünlichgrau bemalten Antlitz des Königs, welch ein Sturm in seinem Innern tobte. Die Sterne, deren Lauf er allnächtlich in einer Sternkammer auf dem flachen Dache seines Palastes zu verfolgen pflegte und deren Flammenschrift zu entziffern er den besten Sterndeutern seines Landes abgelernt hatte – die Sterne hatten nicht getrogen. Die Natur hörte auf, sich selbst zu gleichen, Gräber taten sich auf. Das war der Anfang des Endes. Schlimmeres mußte folgen, unaufhaltsam, unabwendlich.
Der Herr des Fastens bestieg seine Königsgaleere, ein schlankes, zwanzig Ellen langes, aus kostbaren Hölzern gezimmertes Ruderschiff, in dessen kraus geschnitzte und mit rotem Glanzlack polierte Seitenwände Tropfen und Arabesken aus milchigem Speckstein eingelassen waren. Den Bug bildete ein ungeheurer stilisierter Alligator: der aufgerissene Rachen mit den bleckenden Hakenzähnen, die hervorquellenden blutigen Augen scheuchten böse Wassergeister. Der Griff des Steuerruders verzweigte sich als emporstrebendes Blättergerank, von dessen Höhe eine Blume sich niederneigte, übergroß, einem Lilienkelch ähnlich, aus grünpatinierter Bronze.
Zwanzig nackte Sklaven ruderten aufrecht stehend das Schiff.
Nur den jungen Prinzen Ixtlilxochitl, die Schwarze Blume, den hoffnungsreichsten seiner Söhne, nahm der König als Begleiter mit. Im funkelnden Federschmuck des Kopfputzes und der juwelbeladenen Gewandung glichen König und Prinz zwei wütend schwirrenden, grellfarbigen Hummeln.
Die Galeere brachte sie an den Damm, wo die Ruderknechte des Haushofmeisters noch warteten. Im kleinen Kanoe erreichten sie die Landungsstelle am Schloßgarten von Tlatelolco.
Der Herr des Fastens begab sich sofort hinein zu seiner Nichte. Das Gespräch, das er mit ihr führte, war kurz. Er kehrte zurück zur Landungsstelle und ließ sich nach Tenuchtitlan rudern.
#####
Bei der Flutkatastrophe, die dem Vorgänger Montezumas, dem König Molch, das Leben geraubt hatte, war der größere Teil des alten, aus Lehm erbauten Tenuchtitlan fortgespült worden, und ein blitzend neues, verschönertes Tenuchtitlan war seitdem aus dem Schilfsee emporgetaucht, eine Stadt der Tempel, Kapellen und Paläste. Denn die wachsende Königsmacht, die früher nur Werkzeug und Waffe der Adelsherrschaft gewesen, ließ voll Mißtrauen den überflügelten und abhängig gewordenen Adel nicht aus den Augen: die grundbesitzenden Landedelleute waren verpflichtet, den größten Teil des Jahres in der Wasserstadt zu verbringen, und mußten, wollten sie sich auf ihre Besitzungen begeben, ihre Söhne oder ihre nächsten Verwandten als Geiseln zurücklassen. Und da die Schlafkammern des Königspalastes – einige hundert – kaum genügten, alle Höflinge und Prinzen königlichen Geblütes zu herbergen, sahen sich die Großen des Reiches gezwungen, Schlösser in Tenuchtitlan zu errichten, und sie taten es prunkvoll, dem üppigen Reichtum und Glanz ihrer Geschlechter entsprechend.
Aus dem Herzen der Stadt strebte die steile Tempel-Pyramide Coatepetl, der Schlangenberg, in die Wolken, alle hängenden Blumengärten auf den flachen Dächern der einstöckigen, aus Quadern eines roten porösen Lavasteines erbauten Häuser um ein Zehnfaches überragend. Und wie der Kraterkuppe eines Vulkans entquoll dem Allerheiligsten auf der obersten Tempelterrasse der schwarze Rauchfaden des ewigen Feuers und verlor sich im Himmel.
Älter und daher weniger prangend, aber steiler und sogar höher noch, erhob sich weit im Norden die immense Schwesterpyramide Tlatelolcos.
Achtundsiebzig kleinere schneeweiße Teocalli (Gotteswohnungen) lagen rings verstreut im roten Häusermeer, und ihre rhombisch verjüngten Bronze- und Strohdächer mit gestuften Steinzinnen umragten die beiden großen Pyramiden wie Bergzacken zwei Bergriesen. Besonders ein zierlicher Tempel im Südosten der Stadt fiel seiner pittoresken Schlankheit wegen in die Augen, er war dem Gotte Xipe-Totec geweiht, Unserm Herrn dem Geschundenen, und sein Dach bestand aus weißgeblichenen Menschenschädeln.
Westlich von der großen Schlangenberg-Pyramide erstreckte sich das Palast-Geviert des Königs Wassergesicht bis an den See, leer jetzt und ausgestorben, seit Montezuma sich in der Südwestecke Tenuchtitlans, in dem Moyotla genannten Stadtviertel, einen neuen märchenhaften Palast hatte empormeißeln lassen.
Dieser Huei-tecpan oder Große Palast war eine unbezwingbare Wasserburg, auf hochgestuftem Unterbau, eine Stadt in der Stadt, ein unermeßliches Labyrinth von reich tapezierten und bemalten Zimmern mit Decken aus Zedergebälk, Empfangsräumen, Rüstkammern, schattigen Höfen mit speienden Marmorfontänen – gespeist von fernen Gebirgsquellen, die der große Aquädukt hinleitete –, weiten Thronsälen, deren Wände von Silber und Jaspis erstrahlten, Tanzhöfen, einem Tierpark und Gartenanlagen, welche, umspült vom See, unter uralten Bäumen Lusthäuser und Pavillons bargen: ein heizbares Badehaus, ein Ballspiel-Haus und ein Haus der Trauer. Der Palast hatte dreißig Tore, und sein größter Hof konnte einige tausend Menschen fassen. Wildes Arabeskenwerk und mythische Gestalten in wütender Verzerrung grinsten und glotzten aus dem polierten Steinglanz der Außenmauern den Beschauer an. Niedrige Treppen von zehn Stufen führten zu den Eingängen empor.
Jedem Eintretenden wurden von einem Torhüter die Sandalen abgebunden, und dann wurde ihm – je nach seiner Kaste oder seinem Rang – in einem der drei Vorzimmer ein steinerner Schemel als Sitz zugewiesen. Ein Schreiber verzeichnete in einem Buche die Wünsche der wartenden Bittsteller. Wem das Glück zuteil ward, vor den Colhuatecuhtli, den König Mexicos, treten zu dürfen, der mußte es sich gefallen lassen, daß ihm ein grauer, rauher Mantel aus schlecht gewebten Agave-Fasern über Kopf und Schultern gelegt wurde, auf daß kein Zierat mit dem Schmuck des Weltherrn wetteifere. Vor den Augen Montezumas war jeder, auch der Höchststehende, nichts als ein Bettler oder Sklave, und strafwürdiger Frevel wäre es gewesen, hätten eines reichen Kaufherrn Perlenketten oder eines Feldherrn Abzeichen vor seiner Königsherrlichkeit als Symbole des Besitzes und Verdienstes zu prunken gewagt.
Nur den Höflingen und den befreundeten Fürsten war diese Selbsterniedrigung erlassen. Und als der Herr des Fastens und sein Sohn, die Schwarze Blume, durch den den Fürsten vorbehaltenen Schlangensaal geführt, der geheiligten Schwelle nahten, flimmerten ihre königlichen Quetzalfederkronen und ihr viereckiger Brustschmuck unverhüllt. An den Händen trugen sie die Mayehuatl genannten Handschuhe.
#####
Die toten Krieger des Himmels hatten eben die Sonne bis zum Zenit geleitet und stiegen auf die Erde herab in Gestalt von Blumensaugern – Schmetterlingen und Kolibris –, während Frauenseelen die Sonne in Empfang nahmen und sie ins Land der Geburt und der Frauen im Westen fortführten.
Montezuma – sein Name bedeutet der Zornige Herr – pflegte um diese Stunde sich von Krüppeln und Narren die Sorgen des Tages verscheuchen zu lassen. Da nämlich Mißgeburten bei den indianischen Völkern von größter Seltenheit sind, standen Krüppel des Körpers und des Geistes hoch im Werte, und der Zornige Herr sammelte sie, wie er seltene Blumen, Tiere und Süßwasserperlen sammelte.
Seine Tageseinteilung war streng geregelt. Bei Sonnenaufgang wurde er durch Lieder einer Coco oder Dienerin geweckt. Er wusch sich mit der Wurzel der Hundsnelke, die als Seife diente. Ein Haus-Erleuchter – so hießen die Pagen – rasierte ihm den spärlichen Bart mit scharfen Obsidianmessern, und ein anderer führte die Gesichtsbemalung aus – meist ockergelb, nur bei gewissen Anlässen, Festtagen oder Trauerfällen, mit anderen Farben, wobei dann die Gesichtshaut sei es mit Sternen, sei es mit Querstreifen oder auch Ringen – uralten Vorschriften gemäß – bedeckt wurde. Dem Vogelhaus genannten Saal, der königlichen Kleiderkammer, entnahmen Sklaven Gewänder aus bunt zusammengefügten Kolibrifedern und Geweben mit phantastischen Drachen-, Schmetterlings- oder Treppen-Mustern und legten sie dem Herrscher zur Auswahl vor, welches er wählte, trug er nur einen Tag, um es dann einem Günstling zu verschenken.
Mit gleicher Freigebigkeit verschenkte er nach eintägigem Gebrauch seinen Nackenfederschmuck, seine Wadenschienen aus Goldblech, seine mit Smaragden eingelegte goldene Fußspange oder sein Mundgeschmeide – einen in die Unterlippe gesteckten knopfartigen Lippenpflock in Gestalt eines kleinen goldenen Adlers. Aber auch adlige Mädchen und sogar Königstöchter verschenkte er, nachdem sie nur eine Nacht im Hause der Vierhundert Frauen zugebracht hatten. Die unterjochten Fürsten mußten, als Tribut, dem Herrn der Welt ihre Kinder senden. Und ebenso hatte er ein Anrecht auf alle in Mexico geborenen Mädchen. Die Schönsten unter den Töchern des aztekischen Adels wurden, nachdem sie mannbar geworden, in das Haus der Vierhundert Frauen eingeliefert, damit der König sie besichtige. Er tat es mit satten, müden Blicken, strich mit lassen Fingern durch eine herabwallende Haarmähne, strich über eine weiche Hüfte, über eine kindliche Brust und ließ sich die dreieckig abgefeilten Zähne zeigen (alle vornehmen Mexikanerinnen hatten spitzgefeilte und mit Cochenille rotgefärbte Zähne). Oft geschah es, daß er wie ein finsterer Gott durch die Schar der vor Demut Bebenden hinschritt und mit grausam-gleichgültigen Augen sie sehend übersah. Oft auch gab er die Anmutigsten, ohne sie berührt, ohne sie mit einem Blick gestreift zu haben, seinen Staatsdienern zu Ehefrauen. Wurde aber seine verlebte Lust geweckt, so mußte eine ältere Aufseherin der Erwählten den Mund waschen (wie es bei Hochzeiten die Mutter des Bräutigams der Braut zu tun pflegte) und sie in einem der hundert Bäder des königlichen Frauenhauses baden – da Montezuma, der selber dreimal jeden Tag badete, auf peinlichste Sauberkeit Gewicht legte. Schmuckbehängt, lebten die Mädchen wie Prinzessinnen und wurden – wie Prinzessinnen – äußerst streng von ältlichen Aufseherinnen bevormundet und überwacht. Früher, in den ersten Jahren nach Montezumas Krönung,waren zuweilen hundertundfünfzig der Mädchen zu gleicher Zeit von ihm schwanger gewesen. Doch pflegten die Geburten im Hause der Vierhundert Frauen verhindert zu werden, indem von Priestern der Xochiquetzal, der Göttin der Liebe und der Blumen, qualvolle Kasteiungen mit scharfen Knochendolchen – Blutabzapfungen in der Nabelgegend – den Mädchen vorgeschrieben wurden. Am Hof zu Tenuchtitlan waren diese Kasteiungen eingeführt worden, seit Obsidian-Schlange, ein Ahnherr des königlichen Hauses, beim Regierungsantritt seine sämtlichen zweihundertundzwanzig Geschwister hatte ermorden lassen.
Nachdem Montezuma, gekleidet mit allen Insignien seiner Königsherrlichkeit, mit der azurenen Stirnbinde und auf Sandalen aus Türkismosaik, in den Saal der Botschaften getreten, thronte er unter einem Baldachin aus Adlerdaunen auf einem silbernen Armsessel, über welchen Jaguarfelle, das Wahrzeichen der Fürstlichkeit, gebreitet waren. Die Zeit bis Mittag widmete er den Staatsgeschäften, dem Empfang von Boten, der Beratung mit Feldherren und Erzpriestern. Sodann nahm er in einem angrenzenden Gemach, bedient von jungen Cocos, sein Mittagsmahl ein, indem er unter fünfzig kleinen Goldschüsseln, die die Mädchen trugen, aussuchte, was der Laune seines Gaumens entsprach. Nach dem Essen rauchte er aus einer kristallenen Pfeife Tabak, der mit flüssigem Amber gemischt war. Nachdem er dann kurze Zeit geschlafen, erfreute er sich am Anblick seiner Narren und Krüppel.
#####
Es war ein ereignisreicher Tag. Als ob das Schicksal lange Zeit gezögert, die Schwelle zu übertreten, von der es bald nicht mehr weichen sollte, brachte es nun seine aufgesparten Gaben fast alle zugleich herbei.
Die ersten Gaben waren erfreuliche.
Gleich am frühen Morgen hatten Boten einen großen Sieg gemeldet, den die beiden Feldherren Mexicos gegen die Mayas im fernen Guatemala erfochten, wobei dreizehnhundertzweiunddreißig Kriegsgefangene erbeutet worden waren. Die mexikanischen Heere wurden immer von zwei Oberfeldherren, dem Vorsteher des Hauses der Pfeile und dem Ordner der Heerscharen, befehligt. Und in diesem Kriege war der Vorsteher des Hauses der Pfeile ein Tlascalteke in mexikanischen Diensten, mit Namen Tlalhuicolotl, der Irdene Krug, – der Ordner'der Heerscharen aber war Guatemoc, der Herabstoßende Adler, der Vetter Montezumas und Sohn seines Vorgängers, des Tempelerbauers König Molch. Ein Liebling der Mexikaner war Guatemoc, schön und jung – kaum zwanzig Jahre alt –, und sein beginnender Kriegsruhm erfüllte Tenuchtitlan mit Jubel. Doch der Freude Montezumas über die Siegesnachricht war ein Tropfen Galle beigemischt.
Seit sein Sohn der Menschen-Fänger im Feldzuge gegen die Republik Tlascala den Heldentod gefunden, umstrahlte eine Aureole künftigen Königtums den Herabstoßenden Adler, waren doch die jüngeren Söhne Montezumas fast noch Kinder und sein Bruder Cuitlahuac, der Überwältiger, ein kränklicher, früh gealterter Mann. Darum sahen alle, denen die Größe Mexicos am Herzen lag, in Guatemoc den aufgehenden Stern. Montezuma wußte das und billigte es. Er mißgönnte es ihm nicht, daß er an die Stelle seines toten Sohnes getreten, ja er übertrug sogar die Zuneigung und Hoffnung, die er für jenen gehegt, ohne Einschränkung auf den jugendlichen Vetter. Als daher, vor etwa einem Jahr, der Herabstoßende Adler bei einem Feste die wunderschöne, eben erblühte Prinzessin Maisblüte, des Königs Lieblingstochter, erblickt und seiner Bewunderung kein Hehl gemacht, hatte Montezuma sie ihm zum Lohne versprochen, falls er aus Guatemala als Sieger heimkehren würde. Nun wurden seine ersten Siege gemeldet – Montezuma aber wußte, daß er sein Versprechen nicht halten konnte.
Der Staatsklugheit mußte diese Liebe geopfert werden. Der Drei-Städte-Bund drohte zu zerfallen, augensichtlich war die versteckte Feindseligkeit Tezcucos, sein König, der Herr des Fastens, mied Tenuchtitlan. Und die Ratgeber der Krone drängten, Montezuma möge durch seine Tochter das gelockerte Band wieder enger knüpfen. Montezuma konnte sich der Einsicht nicht verschließen, daß eine Heirat der Prinzessin Maisblüte mit des Herrn des Fastens ältestem Sohne Cacama, dem Edlen Traurigen, das Land vor mancher Gefahr zu bewahren imstande war.
Es kam von den drei Söhnen des Herrn des Fastens nur Cacama in Frage, der immer zu Mexico gehalten, der nie seinem Vater vergeben, daß er seinen eigenen Sohn, Cacamas ältesten Bruder, den Pflanzer des Weidenbaums, um eines unbedachten Wortes willen hatte hinrichten lassen. Der mittlere der Brüder, Prinz Ohrring-Schlange, schien wenig verläßlich, noch unreif, leicht zu beeinflussen, schwankend in seinen Neigungen und Abneigungen. Anders die Schwarze Blume, der jüngste, der, fast noch ein Knabe, schon einen stählernen Willen verriet, doch seinem Vater so zugetan, so übeneugt war vom geschmälerten Recht Tezcucos und so unbeugsam seines Weges ging, daß Montezuma nicht hoffen durfte, ihn in sein Netz zu ziehen, selbst wenn er ihn zum Eidam machen und mit Huld überschütten wollte.
Der Plan war weit ausblickend. Gelang es, die Heirat noch bei Lebzeiten des Herrn des Fastens zustande zu bringen, so mußte es nach dessen Tode bei der Königswahl in Tezcuco in die Wagschale fallen, daß der Edle Traurige die Tochter des Herrschers der Welt gefreit, und sollte auch – was zu befürchten stand – der Herr des Fastens auf dem Sterbebette den Lieblingssohn, die Schwarze Blume, zum Nachfolger bestimmen, so würden gewiß die Königskinder sich darüber hinwegsetzen, wenn Mexicos Gold und des Großkönigs Gunst den Edlen Traurigen unterstützten. Falls jedoch die Brüder sich entzweiten, so würde das die Schwächung der Macht Tezcucos zur Folge haben – und Mexico hätte erst recht nur Vorteil davon. Frohlockend würden seine Bewohner über den See blicken und sich des Schauspiels freuen, wie die stolze Rivalin an selbstgeschlagenen Wunden verblutete.
Dennoch konnte sich Montezuma eines Unbehagens nicht erwehren, dachte er an den Herabstößenden Adler, der meilenfern, im Pfeilregen der Schlachten, sein Versprechen wie einen Talisman im Herzen trug. Auch war es schwierig, die Verlobung einzuleiten, solange der Herr des Fastens grollte, da der Anschein vermieden werden mußte, als bemühe man sich um eine Versöhnung.
Daher glätteten sich die Falten in Montezumas Gesicht, als ihm hinterbracht wurde (Spione gab es diesseits und jenseits des Wassers), daß der Herr des Fastens und die Schwarze Blume die Prunkgaleere bestiegen, in Tlatelolco gelandet, daß sie im Boot sich dem Großen Palast näherten, daß sie angelangt und schon im Schlangensaal warteten. Er begrüßte dies als einen geschickten Handstreich seines Glückes und gab seinem Haushofmeister, dem Vorsteher des Hauses der Teppiche, Befehl, sie sogleich vorzulassen. Die Narren und Krüppel entließ er. Nur sein zittriger rosa Xolo, ein künstlich enthaarter wolfähnlicher Hund, durfte in der Decke liegenbleiben, die ihn vor Erfrieren schützte.
Der Herr des Fastens und die Schwarze Blume traten ein. Sie trugen Rosenknospen in den behandschuhten Händen. Montezuma nahm die Rosen entgegen und stellte sie in eine für diesen Zweck bereitstehende Tonvase. Dann kniete die Schwarze Blume nieder und küßte dem Großkönig die Hände und die Füße. Montezuma zog ihn empor, umarmte ihn und umarmte auch den Oheim. Auf silbernen Sesseln, dem Thron gegenüber, nahmen die Gäste Platz.
Die herkömmlichen, feierlich zeremoniösen Begrüßungsformeln wurden ausgetauscht; und sie klangen heute nicht so kühl wie neulich im Schloßgarten von Tlateloko. Dann stellte Montezuma die aus Höflichkeit hinausgeschobene Frage, was "den König und großen Chichimeca seinen lieben Vater und Oheim" (so lautete die Anrede) hergeführt habe.
Der Herr des Fastens berichtete nun das Wunder. Ein Grab hatte sich geöffnet. Papan, die Bestattete und Beweinte, war zurückgekehrt aus dem Himmel der Sonne.
Ohne Ausruf des Staunens oder Schreckens, regungslos hörte Montezuma zu. Lange schwieg er, nachdem der alte König seine Erzählung beendet.
Seine dünnen Lippen lächelten noch immer, doch in seinen Augen hatte sich ein böser Trotz verhärtet – ein Trotz gegen den Himmel und gegen den Mann, der ihm die Unheilsbotschaft überbrachte, um ihnzu demütigen.
Nie war es geschehen, daß ein Toter wieder auferstand. Bis vor hundert Jahren wurden alle Leichen auf den Scheiterhaufen gelegt, und auch jetzt noch war die Leichenverbrennung allgemein Sitte unter dem Volke. Erst in jüngster Zeit hatten die Könige und reiche Adlige begonnen, ihre Toten in unterirdischen, mit Kalk und Stein ausgemauerten. Grabhäusern beizusetzen. Und immer bisher hatten die Verschlußplatten vor den Grabeingängen dem Heimweh der Toten widerstanden.
"Ich will sie nicht sehen!" sagte endlich Montezuma. "Gespenster muß man verscheuchen. Ich werde Priester hinschicken, die sie ins Grab zurückführen sollen!"
Es war klar: Montezuma wollte sie wieder einmauern lassen, obgleich er wußte, daß sie lebte. Die Sterne durften nicht recht haben! Wenn Zeichen geschahen, so geschah ja auch, was die Zeichen androhten. Das durfte nicht sein, Stolz und Furcht wiesen es von sich. Das Geschehene mußte ungeschehen sein und bleiben.
Der Herr des Fastens verlor seine Selbstbeherrschung. Erregt stand er auf und trat nahe an Montezuma heran. "Der Himmel birst, die Erde klafft", rief er keuchend, "doch du Verblendeter willst blind sein, willst nicht sehen!" Und wie ein mahnender Seher erhob er den Arm.
Da ereignete sich etwas Unerhörtes. Der Hund Montezumas hatte die Armbewegung falsch gedeutet. Ohne zu bellen, unheimlich still, stand er plötzlich neben dem Herrn des Fastens, und an ihm emporspringend, biß er ihn ins Handgelenk, nahe bei der Pulsader.
Doch fast im selben Augenblick lag auch schon der Hund tot am Boden. Prinz Schwarze Blume hatte ihm mit seinem Obsidiandolche den Bauch aufgeschlitzt. Eine dunkle Blutlache breitete sich langsam auf dem weißen Marmorboden aus.
#####
Montezuma war emporgeschnellt. Er und die Schwarze Blume starrten sich in die Augen.
Augen können aufeinandertreffen wie Feuersteine und Zündflammen geben. Blühende Städte sind durch solche Funken eingeäschert worden.
Es stand in Montezumas Macht, den Brand mit Blut zu löschen. Doch er war ein Zauderer, gebunden und gehemmt durch die Spinnfäden seiner Ränke. Heute brauchte er den Frieden. Und so ließ er die Hand, die schon mit dem Dolchgriff spielte, wieder sinken.
Der Vorsteher des Hauses der Teppiche, der Oberhaushofmeister, trat ein. Verwirrt durch den Anblick des toten Hundes, brachte er stotternd vor: im Saale der Gesandten warte ein Bote mit wichtiger Nachricht aus der totonakischen Provinz am östlichen Weltmeer.
Der Botendienst in Anahuac war gut geregelt. Obgleich die amerikanischen Völker keine Reittiere besaßen, konnten Briefe aus den entlegenen Teilen des Reiches die Hauptstadt in kürzester Zeit erreichen. An den gutgepflasterten Kunststraßen waren in gleichen Abständen Stationen erbaut, wo immer Träger und Boten bereitstanden, einander abzulösen.
Die Läufer hatten weithin sichtbare Abzeichen, an denen zu erkennen war, ob sie dem Könige wichtige oder weniger wichtige, gute oder schlimme Nachricht überbrachten. In den Dörfern und Städten, die sie durchliefen, hinterließen sie zuweilen Jubel, zuweilen Trauer. Und waren sie im Großen Palast angelangt, so sahen die Hofbeamten gleich, ohne den Inhalt der Botschaft zu kennen, ob der Herr der Welt beim Essen, Spiel und Schlaf gestört werden durfte. So wußte auch der Vorsteher des Hauses der Teppiche, daß der eben eingetroffene Bote wichtige Kunde trug, und er hatte es gewagt, ungerufen in den Thronsaal einzutreten.
Seine Meldung brach den beklemmenden Bann. Gleichmütig, als wäre nichts vorgefallen, befahl Montezuma dem Haushofmeister, die Berater der Krone zugleich mit dem Boten hereinzuführen. Der Vorsteher des Hauses der Teppiche entfernte sich. Nackte Sklaven eilten herein und trugen die weißliche Hundeleiche hinaus. Zwei schöne Coccs in grasgrünen, bis an die roten Knie reichenden Röcken brachten Tonschalen mit heißem Wasser und scheuerten den Marmorboden. Der rote Fleck wollte jedoch nicht bleichen.
Dann traten, mit phantastisch gegabelten Zeremonienstäben in den Händen, die Ratgeber ein: Cuitlahuac, der Überwältiger, Fürst von Iztapalapan und einziger Bruder Montezumas, Quauhpopoca, das Schwelende Holz, und Xuchitl, die Rose, zwei Oberfeldherren im Rang von Vorstehern des Hauses der Spiegelschlange, und endlich der Cihuacoatl, d. h. der Weibliche Zwilling – der höchste Würdenträger, wir würden sagen Kanzler – mit Namen Tlilpotonqui, der Schwarze Amber.
Die Willkür eines mexikanischen Despoten hatte Grenzen. Bei allen Staatsgeschäften stand ihm ein diademloser Nebenkönig, der Weibliche Zwilling, zur Seite. In früheren Zeiten hatten schwächliche Könige ein Schattendasein neben tatkräftigen Weiblichen Zwillingen geführt. Aber schon den letzten Vorgängern Montezumas war es geglückt, die lästige Bevormundung dadurch unwirksam zu machen, daß sie Greise zu diesem Amt ersahen. Halberblindet war der Schwarze Amber und ging gebeugt unter der Last von hundertundsechs Lebensjahren.
So sehr die beiden Feldherren einander äußerlich glichen, übereinstimmend in der Farbe und Form des Federwamses, des Federhelmes, der Sandalen mit goldenen Glöckchen – so verschieden war ihr Auftreten und Benehmen. Während die Rose einen ungezügelten Stolz zur Schau trug, erschien das Schwelende Holz überernst und bescheiden, in seinem blaugelb gestreiften Antlitz war ein starr melancholischer Ausdruck unverkennbar – trotz der Bemalung und obgleich die untere Gesichtshälfte verdeckt war durch das Abzeichen hohen Kriegerranges, ein Nasengehänge aus Türkis in Gestalt einer kleinen dreistufigen Treppe, an der durchbohrten Nasenscheidewand befestigt, reichte es bis zum Kinn hinab. Das Schwelende Holz stand Montezuma besonders nahe, seit er ihm in Atlixco das Leben gerettet, das geschah bei einem Sklavenraubzuge, den der Zornige Herr – noch als Prinz, doch schon zum König gewählt – hatte unternehmen müssen, um zur Feier seiner Krönung die nötige ungeheuerliche Anzahl Menschenherzen dem Himmel darbringen zu können. Das Schwelende Holz und der König waren Altersgenossen, eben ins vierzigste Lebensjahr getreten. Die Rose war zwei Jahre jünger, wie auch Montezumas Bruder, der Überwältiger.
Zwar fieberverzehrt infolge einer nie heilenden Beinwunde, die das Pfeilgift eines südlichen Volkes verursacht, und entstellt im verschrumpften Gesicht durch das Heraustreten der breiten Backenknochen und der gebogen vorspringenden Nase (was ihm den Ausdruck eines entfiederten Papageien gab), hatte doch der Überwältiger ein kraftvolles, ritterliches Wesen. Wie Montezuma war auch er schweigsam, doch schneller zum Handeln bereit. Und der gefestigte ruhige Blick seiner schwarzen Glanzaugen unterschied sich vorteilhaft vom unsicheren Geflacker in den Augen des Großkönigs.
Nach stummer Begrüßung nahmen die Ratgeber auf niedrigen, mit buntgemusterten Baumwollkissen bedeckten Schemeln Platz, rechts und links von den Gästen aus Tezcuco einen Halbkreis um Montezuma bildend.
Der Mann, den der Vorsteher des Hauses der Teppiche hereinführte, war kein gewöhnlicher Bote, vielmehr ein Staatsdiener von Rang, der das Amt eines Steuererhebers in dem vor kurzem unterworfenen Küstenlande versah. Er hatte sich gescheut, die ungeheuerliche Kunde, die er wußte, gemeinen Läufern anzuvertrauen, darum hatte er selbst den weiten Weg vom Meer bis zur Hauptstadt in der Sänfte zurückgelegt.
Eintretend ließ er ein Kügelchen aus Kopalharz in ein Kohlenbecken fallen, um dem Herrn der Welt zu räuchern, er näherte sich mit drei Verbeugungen, wobei er "Großer Herr! Großer Herr! Erhabener großer Herr!" sprach. Dann warf er sich zu Boden und erhob sich erst, als eine Handbewegung Montezumas ihn zum Reden ermuntert hatte. Er begann mit niedergesenkten Blicken: "Töte mich, o König und Herr, ich habe zehnfachen Tod verdient, denn ungerufen kam ich! Vernimm, was ich gesehen, als ich am Ufer des Ostmeeres stand. Drei Häuser, gezimmert aus Holz, groß wie Türme oder wie kleine Hügel, schwammen auf den Wellen, so leicht, als wären es Nachen. Und auf den Dächern der drei Wasserhäuser sah ich weiße Götter, Diener des großen Quetzalcoatl. Doch ob Unser Herr Quetzalcoatl unter ihnen war, weiß ich nicht."
Eine Schwalbe hatte sich in den Saal verirrt und schoß unter dem Zedergebälk hin und her, einen Ausweg suchend. Ihr ängstlicher Ruf schrillte durch die Totenstille.
Nach einer Weile fragte Montezuma:
"Sind sie herabgestiegen auf die Erde?"