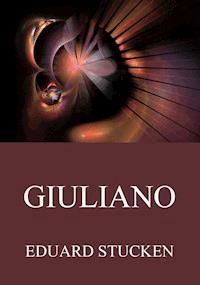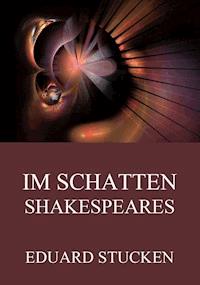
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roman aus dem England des 16. Jahrhunderts.
Das E-Book Im Schatten Shakespeares wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Schatten Shakespeares
Eduard Stucken
Inhalt:
Eduard Stucken – Biografie und Bibliografie
Im Schatten Shakespeares
Erstes Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Zweites Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Drittes Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Epilog
Im Schatten Shakespeares, Eduard Stucken
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849637316
Cover Design: Orange, von Sharon Apted
www.jazzybee-verlag.de
Eduard Stucken – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller, geboren am 18. März 1865 in Moskau, verstorben am 9. März 1936 in Berlin. Sohn eines deutsch-amerikanischen Großkaufmanns. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Dresden absolvierte er von 1882 bis 1884 eine kaufmännische Ausbildung in Bremen. Anschließend studierte er Kunstgeschichte, Assyrologie und Ägyptologie in Dresden und Berlin. Er war zeitweise tätig bei der Deutschen Seewarte in Hamburg und unternahm ausgedehnte Reisen, die ihn u.a. nach Griechenland, auf die Krim, in den Kaukasus sowie nach Italien und England führten. 1890/91 nahm er an einer wissenschaftlichen Expedition nach Syrien teil. Ab 1891 lebte er als freier Schriftsteller in Berlin. In den folgenden Jahrzehnten veröffentlichte er neben wissenschaftlichen Studien zu ethnologischen und sprachhistorischen Themen ein umfangreiches literarisches Werk.
Eduard Stuckens literarisches Werk umfasst Romane, Erzählungen, Gedichte und Theaterstücke. In seinen frühen, neuromantischen Dramen verarbeitete er häufig Stoffe aus der keltischen Sagenwelt. Seine Prosaarbeiten sind geprägt von des Autors Hang zu Prunk und Exotismus sowie von einem zum Bombast neigenden Stil. Seinen größten Erfolg erzielte Stucken mit dem mehrbändigen Roman "Die weißen Götter", in dem der Untergang des Aztekenreiches geschildert wird.
Eduard Stucken gehörte der Preußischen Akademie der Künste an und blieb auch nach den nationalsozialistischen Säuberungen der Akademie im Jahre 1933 Mitglied. Im Oktober 1933 zählte er zu den Unterzeichnern des "Gelöbnisses treuester Gefolgschaft", einer an Hitler gerichteten Ergebenheitsadresse regimetreuer deutscher Autoren.
Wichtige Werke:
Die Flammenbraut. Blutrache, 1892
Astralmythen der Hebräer, Babylonier und Ägypter, 1896/97
Yrsa, 1897
Gawân, 1901
Hine-Moa, 1901
Lanvâl, 1903
Myrrha, 1908
Lanzelot, 1909
Astrid, 1910
Romanzen und Elegien, 1911
Merlins Geburt, 1912
Die Opferung des Gefangenen, 1913
Die Hochzeit Adrian Brouwers, 1914
Das Buch der Träume, 1916
Tristram und Ysolt, 1916
Die weißen Götter, 1918 - 1922
Das verlorene Ich, 1922
Vortigern, 1924
Larion, 1926
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; zusätzliche Bedingungen können anwendbar sein, und ist im Detail zu finden unter http://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Stucken
Im Schatten Shakespeares
Erstes Buch
1
Im Sommer 1927 berichteten die Zeitungen, daß der berühmte Essexring von seinem letzten Besitzer dem Staate England geschenkt worden sei. Einst hatte ihn Königin Elisabeth ihrem Günstling Essex an den Finger gesteckt, – nicht um den schwer zu Bändigenden an sich zu fesseln, vielmehr, um sich und ihrem unbändigen, alternden Herzen eine Fessel anzulegen. Ihre Gunst, das wußte sie, war eine Liane, die leicht welken konnte; der Weg vom Königspalast zum Tower war nicht gar weit; ein Henkergespenst kauerte zu Füßen des Thrones und erwartete die Zuhochgestiegenen ... Darum forderte sie den Günstling auf, ihr das Kleinod zuzuschicken, falls er künftig einmal in Ungnade fallen, dem Schafott verfallen sollte; sie werde beim Anblick des Ringes – das versprach sie feierlich – gedenken, Gnade walten lassen, aus Todesnot befreien.
Als wenige Jahre später Essex seinen Kopf verwirkt hatte, bat er eine nahe Verwandte, Alice Lady Howard, seinen Ring der Königin zu bringen. Die Lady war bereit, es zu tun; ihr Gatte jedoch, dem sie davon erzählte, verbot es ihr. Nicht verwinden konnte Admiral Howard, der einst gemeinsam mit Essex die Spanier bei Cadiz überfallen hatte, daß er vom glanzvollen Rivalen überstrahlt und in den Schatten gestellt worden war. Sein heimlicher Erzfeind bisher, wurde er nun sein heimlicher Mörder.
Zwei Jahre vergingen. Lady Howard erkrankte. Der Königin, die an ihr Sterbebett kam, zeigte sie den Ring. Stöhnend, zerfressen von Reue, halb wahnsinnig vor Mitgefühl mit sich selbst und mit der schmerzerstarrten Königin, beichtete sie, was Essex ihr aufgetragen und was sie, eingeschüchtert durch das Verbot ihres Gatten, auszuführen unterlassen hatte. Ehe sie tränengebadet dies hervorächzte, waren auf ihren Wunsch alle Anverwandten und Pflegerinnen wie auch das Gefolge Elisabeths ins Nebenzimmer gegangen, – allein war sie mit ihrer Richterin. Diese sagte nichts, stierte hilflos vor sich hin. Zuerst hatte ein flüchtiges Lächeln über ihr greises, fahles Gesicht hingezuckt, als wäre sie befreit von bleierner Last –: also war er doch nicht so hochmütig und trotzig zum Henkerblock geschritten, also hatte er doch ihre Güte nicht verschmäht, hatte also doch die Hand nach ihrer Hand ausgestreckt und an ihr Erbarmen geglaubt ... Doch das Lächeln versteinerte, wurde blutfinster, wurde schmerzhafte Verzerrung. Stumm, qualvoll stumm, wiegte sie wie ein todwundes Tier den Kopf und den ins perlenbesäte Mieder geschnürten Rumpf von links nach rechts und von rechts nach links – immer wieder ohne Unterlaß ... Plötzlich umkrallte sie die abgemergelten Arme der Sterbenden, beugte sich über sie, brachte ihr Gesicht dicht an das blutlose Gesicht, senkte den brennenden Blick in die erlöschenden Augen, um Höllenflammen darin zu entzünden ... Lady Howard vernahm den gemurmelten grauenvollen Fluch nicht mehr. Die draußen Wartenden aber vernahmen gleich darauf einen gräßlichen Aufschrei; – als sie ins Zimmer traten, lag die Königin schluchzend über einer Leiche.
Die vergoldete Hofkarosse fuhr nach Whitehall zurück, – da sah jedermann den Tod in Elisabeths Blick. Unenträtselbar war, was sie, flüsternd vor sich hinredete. Sie verweigerte jegliche Nahrung, legte sich angekleidet aufs Bett, fand nicht Schlaf noch Ruhe und irrte, eine flackernde Kerze in der Hand, durch die nachtfinstern Prunksäle, als wäre sie ihr eigenes Gespenst. Sie überlebte Lady Howard nur zwölf Tage und verschied erwürgt vom Gram.
2
Als die Kinderlose die Augen geschlossen hatte, ahnte ihr ehrlich trauerndes Volk noch nicht, daß die Krone dem Sohne ihrer geköpften Feindin Maria Stuart zufallen würde. Andere, in deren Adern gleichfalls Tudor-Blut floß, schienen würdiger zu sein als der unwürdige, Knaben liebende Schulmeister auf Schottlands Thron, der freilich nach dem Tode seiner Mutter die blutbefleckte Hand Elisabeths feige und liebedienerisch geküßt, sich ihre Gunst erschmeichelt hatte. In Tavernen und bei Hahnenkämpfen und Pferderennen, aber auch in den parfümierten Gemächern des Adels, erhitzten sich manche für William Seymour, Lord Beauchamp: stammte er doch von Maria Tudor, einer Schwester Heinrichs VIII. ab. Am meisten Sympathie beim Volk und der Nobility genoß indes ein zehnjähriges Kind von wunderbarer Schönheit, Lady Arbella Stuart, deren Großmutter eine andere Schwester jenes hochbegabten Blaubarts, also eine Tante der jungfräulichen Königin, gewesen war. Sir Walter Raleigh, Krieger, Seeheld und Dichter, verfocht in dem von ihm gegründeten Mermaid-Klub die Rechte der noch ungekrönten kleinen Königin ...
Was beim Wein, beim Tennis, bei Hahnenkämpfen verfochten wurde, blieb dem allmächtigen Staatssekretär Sir Robert Cecil nicht verborgen – das Entziffern der Spionenberichte trug mit Schuld daran, daß seine grünen Kaninchenaugen stets karminrote Lider umränderten. Doch Kinder zu krönen und eine Regentschaft zu errichten war nicht nach seinem Geschmack; vielleicht auch darum nicht, weil seine Freundin, die nicht mehr junge Catherine Lady Suffolk, längst unauffällig dem Schottenkönig den Weg geebnet hatte, seit Jahren von dessen heimlichem Sachwalter, dem Earl of Mar, erkauft. An Elisabeths unbestechlichem Hof war sie ein Monstrum an Bestechlichkeit; ihr war für Gold ihr Leib feil und feil auch die Gesinnung ihres Gatten Thomas Lord Howard of Walden; mit den Dukaten, die sie von Don Fernando Gyrone, dem spanischen Gesandten, und vom schottischen Earl of Mar erhalten hatte, erbaute Lord Howard den mehr als fürstlichen Palast Suffolk House in London.
Seit Jahren war der Boden beackert worden, auf dem die tragische schottische Saat aufgehen sollte. Schon Essex war ein Partisan des Königs James gewesen.
3
Der wilde Jäger reitet in Winterstürmen nicht so rastlos wie Robert Cecil's Bote Tage und Nächte nordwärts ritt, die Nachricht von Elisabeths Tod dem verkrüppelten Schottenkönig zu überbringen. Denn ein Krüppel an Leib und Seele war James, vor seiner Geburt bereits, während der Ermordung Rizzios, durch einen Fall oder Stoß in seiner Mutter Leib verletzt, nicht fähig, ungestützt zu gehn oder zu stehn. Und wie sollte seine Seele geradegewachsen und aufrecht sein, da sein eigner Vater Darnley ihm, dem noch Ungeborenen, das eine Bein gelähmt, das andere verkürzt hatte! ...
Den Tod Elisabeths bejubelte James mit einem kniefälligen Lob- und Preisgebet, mit einem Humpen Kanariensekt, mit Kirchgang, Glockengeläut und Kanonendonner. Das Tafelgeschirr aus König Malcolm's Zeiten, das er verpfändet hatte, ließ er sofort auslösen. Weniger beglückt war seine aus Dänemark stammende Frau, Königin Anna. Sie hatte vor kurzem erst mit den edelsten Schotten ein Komplott eingefädelt, James zu entthronen. Und es war ihr zweifelhaft, ob der englische Adel so gefällig sein werde, ihren pedantischen Ehemann, als wär's ein ungezogener Junge, mit seinen lateinischen Folianten und theologischen Streitschriften einzusperren, ihn hinter Schloß und Riegel zu setzen, wie es schon zweimal – in Stirling Castle und Ruthven Castle – ihm geschehen war. Eine Balladengestalt war Königin Anna in ihrer ersten Jugend gewesen, hatte ein romantisches, wildes Leben geführt, von den undurchsichtigen, hüllenden Nebeln Schottlands den Blicken entzogen. Nun bangte ihr, ins hellere Licht Südenglands zu treten. Daß die Hungerleiderei der Königsfamilie ein Ende fand, mochte James erfreuen; – lockender als die Fettgänse Englands waren ihr die kreischenden Wildgänse und singenden Schwäne des Firth of Forth ...
4
Sie tröstete sich erst, als beschlossen wurde, daß James zu Schiff vorausfahren, sie aber auf dem Landwege ihm nach London nachfolgen sollte. Das gab ihr die Möglichkeit, sich ihr ältestes Kind, den damals zehn Jahre alten Thronfolger Prinz Henry – oder Prince Hal, wie er meist genannt wurde – zurückzurauben, der ihr bald nach seiner Geburt von James geraubt worden war. Südwärts reisend, traf sie unangemeldet und völlig unerwartet mit großem Gefolge auf dem Schlosse des Earl of Mar ein, von dessen Mutter Anabella der junge Thronfolger erzogen wurde. Die Königin forderte die Auslieferung ihres Sohnes und begann zu toben, als die Schloßherrin sich herausnahm, sie nach dem schriftlichen Befehl des Königs zu fragen. Die steinalte hagere strenge Countess of Mar, Witwe des einstigen Regenten Schottlands, stand mit ausgestreckten Armen schirmend vor dem Knaben – königlicher als eine Königin, beschämte sie durch ihre eisige Kälte die Rasende. Der tolle Auftritt endete damit, daß Königin Anna, die schwanger war, zu Boden stürzte und in Gegenwart ihrer Feinde und ihres Sohnes dort auf den Steinfliesen der alten Burghalle ein totes Kind gebar.
Statt den Embryo zu begraben, ließ sie ihn einbalsamieren und reiste, nach kurzer Erholungsfrist, durch Schottland und durch ganz England mit dem Kindersarg – täglich von Bürgermeistern und Schultheißen, Schulkindern, Studenten und Handwerkern als Fürstin der geeinten drei Reiche – ja sogar Frankreichs – begrüßt und unablässig Tränen über dem kleinen Sarge vergießend, damit alle Welt es sehe und erfahre, vor allem aber James erfahre, wie schmachvoll sie behandelt worden war.
Als sie in London einzog, zog auch die Pest in London ein und warf den ersten Schatten auf das rausch- und tanzbereite neue Stuart-England. Der vor Angst schlotternde Hof sagte alle Festlichkeiten ab; Krönung, Stierkämpfe und Hinrichtungen wurden verschoben. Auf Königin Anna's Bitte, den Earl of Mar und seine Mutter grausam zu strafen, erwiderte der König: "Essex, Howard und Mar verdanken wir, daß uns die Krone Englands zufiel."
"Wenn ich sie Mar danken soll, so verzichte ich auf Englands Krone!" trotzte die Königin.
Jedoch die neue Krone stand ihrer üppigen Blondheit gut, – so behielt sie sie denn. Und als der Totentanz der Pest von dannen zog, anderen Tänzen, Schmausereien und Maskeraden Platz zu machen, entdeckte sie, daß es auch in England singende Schwäne gab – nicht nur den Sweet Swan of Avon – und auch reichere Wucherer und Geldleiher als im ärmlichen, durch ständige Fehden verarmten Edinburgh. Sie vergeudete und tanzte und fand sich drein, daß Prinz Hal – den sie jetzt ebenso haßte, wie sie ihn vordem überschwenglich geliebt – auch in London, wohin James ihn hatte nachkommen lassen, zunächst noch seine Erzieher behielt. Dann – der Earl of Mar starb bald – wurde Hal in die Hände des Humanisten Adam Newton gegeben, eines berühmten Lateiners und feinen Kopfes, der als Mensch freilich zu gutherzig, schwach und devot war, ein so unbändiges Rassepferd, wie der kleine Thronfolger eines war, an der Kandare zu halten. Allzufrüh entglitten die Zügel. Vater und Mutter, in Anspruch genommen durch läppische Vergnügungen, kümmerten sich nicht um den außerordentlich begabten, seinem Alter weit vorausgeeilten Knaben, fragten nie, wo und wie er seine Mußestunden verbrachte. Das war ja Sache des Lehrers; – dem aber hatte das Kind mit funkelnden Augen solche Fragen ein für allemal untersagt. Wenn The Lord of the Isles – (so lautete der schottische Titel des kleinen Thronfolgers) – gegen Mitternacht eine Kalesche anzuspannen befahl, um aus Whitehall nach London hineinzufahren, stieß er auf keinen Widerspruch. Sein kindliches Ideal wurde sein großer Namensvetter, Shakespeare's Prince Hal, der mit Falstaff, Pistol, Dortchen Lakenreißer gelumpt, dann aber Frankreich erobert hatte; und es fehlte nicht an Schmeichlern, die ihm die Hände küssend versicherten, er habe eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Bilde jenes kriegerischen Königs der roten Rose.
5
Andersgeartet war James, der sich gern Rex Pacificus nennen hörte. Er wollte England einer Glanzzeit zuführen, – doch nicht durch Kriege, sondern durch Ausweichen und Zurückweichen vor Spanien, vor Frankreich und vor jeglicher Art von Verantwortlichkeit. Auch im geeinigten Königreich wollte er ein Friedensbringer sein, den jahrtausendalten schottisch-britischen Haß auslöschen – doch die Presbyterianer bedrohen; Balsam auf irische Wunden träufeln – doch die Katholiken verfolgen; zu den Protestanten halten – doch die Puritaner verhöhnen und die katholischen englischen Adligen schonen; das Parlament einberufen – doch sein Gottesgnadentum verkünden; sich mit dem Heiligen Stuhl gut stellen – doch den Papst öffentlich als Antichrist brandmarken. Kurz und gut, er wollte schwarz und weiß zugleich sein; – und die Speichellecker nannten ihn darum den britischen Salomo.
Als Rex Pacificus wollte er auch die beiden verfeindeten Familien Essex und Howard aussöhnen, ohne die seine Krönung in London nie erfolgt wäre. Der hingerichtete Essex hatte einen kleinen Sohn hinterlassen und der Lord-Kämmerer Thomas Howard, Earl of Suffolk, hatte ein beinah gleichaltriges Töchterchen. Doch die Ausführung des Planes, durch eine Heirat dieser Kinder den Haß der Familien aus der Welt zu schaffen, mußte James sechs Jahre lang hinausschieben.
In die Zwischenzeit fielen folgenreiche Geschehnisse: ein schlecht vorbereiteter Aufstand, dessen Ziel es war, die zehnjährige Prätendentin Lady Arbella Stuart zur Königin Englands auszurufen, und an dessen Spitze der große Sir Walter Raleigh stand, wurde im Keime erstickt. In dem darauffolgenden langwierigen Prozeß wagte der dickschädlige Lord Oberrichter Sir Edward Coke den berühmten Seehelden in wegwerfendem Ton zu duzen, und ganz England stieß einen Schrei der Wut darüber aus, einen Schrei, der an die Fensterscheiben des Königsschlosses dröhnte. Nie war Raleigh ein so gelenker Fechter gewesen wie beim Wortkampf mit seinen königstreuen Anklägern, nie so löwenkühn, witzig, geistig überlegen, genial. Die ihm das Todesurteil sprachen, waren die Besiegten in dieser Schlacht; er war der gefeierte Sieger, – und blieb es, im Tower eingekerkert, Liebling und Stolz seiner Landsleute, ein Adler im Käfig, dem länger als ein Jahrzehnt lang James weder den Tod zu geben noch das Leben zu schenken den Mut fand. Von den Mitangeklagten bestiegen zwei elegant und würdig das Schafott; Lord Cobham aber ließ man entweichen. Der endete als Schweinehirt. Seiner Latifundien beraubt, verstoßen und gemieden von seiner Kaste als erbärmlicher Verräter, weil er vor Sir Edward Coke ein Geständnis abgelegt und Mitschuldige genannt hatte, fand er in der armseligen Hütte eines Bauern, seines einstigen Dieners, ein jämmerliches Asyl, vor dem Hungertode gerettet, verpflegt, so gut es ging. Zum Dank hütete der Lord dem Kätner das Vieh.
Die ahnungslose Urheberin aber so vieler Tragik, die kleine wunderschöne Arbella verschwand spurlos aus dem Schlosse Worksop, wo sie, die elternlose, bis dahin unter Aufsicht ihrer Tante Mary Countess of Shrewsbury eine prinzliche Erziehung erhalten, Spanisch, Italienisch, Französisch und auch Lateinisch fließend zu sprechen gelernt hatte. Der Schotte George Gordon, Marquis of Huntley, kurz vordem vom König zum Lord-Schatzmeister ernannt, hatte sich erboten, das Kind in Sicherheit zu bringen. Seither wußte kein Mensch, was aus dem Kinde geworden war. Selbst James wußte es nicht; und sein bequemes, träges Gewissen erlaubte ihm nicht, danach zu fragen.
Durch die zwei Jahre später erfolgte Aufdeckung der Pulververschwörung entging ein anderes Kind, Lady Elisabeth – die spätere Winterkönigin – dem Geschick, ein Kind auf dem Thron Englands, eine kleine blutige Mary zu werden, wie die katholischen Verschwörer es planten. Da der Lord-Kämmerer Thomas Howard, Earl of Suffolk, das Parlamentgebäude durchsuchend als erster die sechsunddreißig Pulverfässer und die glühenden Augen des Guy Fawkes erblickt hatte, schloß ihn James noch mehr ins Herz als zuvor: nicht nur die Krone dankte er ihm fortan, sondern sein und der Seinen Leben. Von jetzt ab pflegte er Lady Suffolk auf den Mund zu küssen, – wenn er sich auch sonst verteufelt wenig aus Frauenküssen machte.
Die zweitälteste Tochter der Lady Suffolk, die inzwischen dreizehn Jahre alt gewordene Lady Frances Howard, verlobte James im Dezember 1609 mit dem vierzehnjährigen Robert Earl of Essex. Im Königsschlosse sollte zu Pfingsten die Hochzeit gefeiert werden. Es wurde eine Doppelhochzeit, weil James, als die furchtbare, von seinen Landsleuten nie vergessene Ermordung des jungen schönen Earl of Moray sich wieder einmal jährte, auf den Gedanken kam, zwei verfeindete schottische Familien gleichfalls durch eine erzwungene Verehelichung in Whitehall auszusöhnen. Das von Lucy Lady Bedford, der geistvollsten Hofdame der Königin, bei ihrem Freunde und Anbeter Ben Jonson für Frances Howard und Robert Essex bestellte Hochzeitsfestspiel – the Masque of Hymen – sollte mit Hymens Sprüchen nun auch dem andern Brautpaar – Sir David Moray, dem Sohn des einstmals von Huntley Ermordeten, und Anne Lady Gordon, Huntleys Tochter, – zum Bewußtsein bringen, daß im Königsschloß getraut zu werden, nur Gottbegnadeten, von Göttern Gesegneten beschieden sei.
6
Es war zwei Tage vor der Hochzeit. Das Gold der Morgensonne blinkte auf den Fenstern von Suffolkhouse, glitzernde, vorwitzige Strahlen bahnten durchs Glas sich den Weg ins geheiligte Schlafgemach der einen der zwei Bräute, Frances Howard, und durchblinkten den rosigen Körper der splitternackten Dreizehnjährigen, die auf einer sehr flachen kupfernen Kufe inmitten des Zimmers, kichernd und mit den dunklen Fuchsaugen zwinkernd, dastand. Mistris Margaret Brown, die Kammerfrau, seifte der kleinen Lady Nabel, Schenkel und Knöchel ein, während eine andere Handmaid sie aus einem überaus kleinen Krug mit warmem Wasser übergoß; – denn es war ein Aberglaube, daß je kleiner beim Baden der Krug sei, um so kleiner die Mädchenbrüste blieben. Elisabeth Lady Knollys, um fünf Jahre älter als Frances, streifte ein Spitzenhemd auseinander, es ihr überzuwerfen. Lady Catherine aber, die jüngste der drei Schwestern, ein melancholisches Frätzchen, hielt in den Kinderhänden ein Paar grüne Hosen und grüne Strümpfe. Die Sonne umstrahlte lachend dies Lever d'une petite duchesse.
Die Idylle fand ein jähes Ende. Lady Knollys, welcher der Aberglaube der Kammerfrauen unbekannt war, bemerkte nichtsahnend zu Frances:
"Du solltest dich mit einem größeren Krug begießen lassen, es würde schneller gehn."
Das empfand Frances als eine Anspielung auf ihre Gestalt, die zu ihrem Leidwesen noch kindlich und unentwickelt war. Böse entgegnete sie:
"Ich soll wohl Ammenbrüste haben, – wie du vor deiner Hochzeit?"
Lady Knollys wurde rot und weiß im Gesicht. Welche bodenlose Gemeinheit, sie in Gegenwart der Kammerfrauen so zu beschimpfen. Ein stadtbekanntes ehebrecherisches Verhältnis hatte sie mit Lord Vaux, ihrem Jugendfreund und einstigen Verlobten, den sie nicht hatte heiraten dürfen, von ihrer geldgierigen Mutter an den greisen Lord Knollys, Earl of Banbury, verschachert.
Aufschluchzend eilte Lady Knollys zur Tür. Dort wandte sie sich um und sagte:
"Ich wünsche dir, daß du Robert Essex so treu bleibst, wie ich meinem ersten Verlobten!"
"Treu? ... Ich hasse Robert!" rief Frances, – so stark mit dem nackten Bein in der übervollen Kufe aufstampfend, daß alle Anwesenden bespritzt wurden. Ihre jüngste Schwester, die melancholische, rächte sich, indem sie die Zöpfe packte, die über Frances Rücken wie zwei dicke schwarze Nattern niederhingen. Frances glitt aus, stürzte in die Kufe, ihre Beine schnellten aufwärts, Wasser plantschte klafterhoch empor. Die Kammerfrauen kreischten, halfen Frances sich aufrichten. Schuldbewußt war Catherine hinaus geflohen; – doch Lady Knollys stand noch immer an der Tür und sagte sanft, als Frances sich erhoben hatte:
"Du bist eine süße kleine Schlangenkönigin, Frances, Gott schütze dich und ihn vor dir! ... Warum heiratest du ihn, wenn du ihn haßt?"
"Bin ich gefragt worden?" schrie Frances plötzlich wild. Jetzt war sie es, die hemmungslos zu weinen begann. Doch Lady Knollys ging achselzuckend aus dem Zimmer.
7
Eine Stunde später war Frances gekleidet, geschminkt, gekämmt und schlürfte Schokolade aus einer chinesischen Porzellantasse, einem Geschenk der East India Company. Da trat, ein Rosenbukett in der Hand, die Putzmacherin Mistris Turner ein. Ihre ihr folgende Dienerin, ein bleichsüchtiges aschblondes Mädchen, breitete das Hochzeitskleid über die Lehne eines Sessels. Welch ein lilienweißer Schaum und Traum, welch ein tauflirrendes Spinngewebe aus Brüsseler Spitzen und Silberbrokat, – welch ein Wunderwerk, welch ein Zauberwerk! Doch Frances streifte das Hochzeitskleid bloß flüchtig mit einem finstern Blick.
Während der Anprobe waren Frances und Mistris Turner allein, und niemand außer der lachenden Sonne hörte ihr ruchloses Geflüster.
"Was macht Franklin?"
"So ein loser Schelm! Meinem stolzen Engel sein teuerstes Juwel zu stehlen!"
Frances kicherte vor sich hin:
"Was stahl er denn? ..."
"Deinen süßen roten Mund, Frances!"
Und Mistris Turner küßte Frances auf den geschminkten Kindermund.
John Franklin war ein Apothekerlehrling in Diensten der Putzmacherin: er arbeitete in der ihr durch Erbschaft zugefallenen Apotheke des Master Turner, ihres nach einjähriger Ehe jählings verstorbenen Gatten. Mit Schröpfköpfen, Spanischen Fliegen, Hühneraugenpflastern und Klystieren verstand Franklin gut umzugehn und wurde darum nicht selten in Adelspaläste gerufen; so hatte er kürzlich erst Frances von einer Kolik kuriert ...
"Hast du ihn gebeten? ..."
"Ja, dies schickt er dir."
"Was ist das? Vitriol? ..."
"Sprich nicht so laut ... Franklin war weiß wie ein Laken, als er es mir gab."
"Der arme weiße Junge! Eigentlich brauche ich das Mäusegift nicht mehr – das Mäuschen will den Speck nicht und will mich zur Strohwitwe machen ... zum Mäusestrohwitwelein!"
"Lord Essex?"
"Seine Majestät hat befohlen, daß Robert gleich nach unserer Hochzeit nach Italien reist. Seine Majestät meint nämlich, Robert sei noch zu jung, in meinem Bett zu liegen!"
"Dann gib mir bitte das Fläschchen wieder, Frances!"
Aber Frances schloß schnell das Fläschchen in eine Kommode.
"Wer weiß – vielleicht kann ich's mal brauchen ..."
"Höre, Frances, versprich mir ... Versprich mir, recht vorsichtig zu sein! Franklin trug mir auf, dir's zu sagen ... Du könntest sonst ihn und mich an den Galgen bringen!"
"Dich, Ann? Hahaha, das möchte ich sehn: Du wirst die entzückendste Galgenfrau sein, Ann, die jemals vom Winde geschaukelt wurde! Alle Männer werden um dein Nonnengesicht weinen – glaubst du nicht, Ann? Und wie viele Balladen man auf deine schönen toten Augen dichten wird, Ann! Stell dir's doch vor: der Wind wird dich um und um wie einen Kreisel drehn – so wie ich dich jetzt herumdrehe, Ann!"
Hell und kindisch lachend, in krampfhafter Ausgelassenheit, packte Frances Mistris Turner an den Ellenbogen und schwirrte und tanzte mit ihr im Zimmer umher. Dann schlang sie den Arm ihr um den Nacken und strahlte sie mit unschuldigen Kinderaugen an.
"Du glaubst doch nicht wirklich, daß ich einem armen niedlichen Mäuschen ein Leid tun könnte, Ann? Sehe ich denn wie eine Katze aus? Alle sagen, ich sehe wie ein Reh aus – nicht wahr? ... Sieh mal, es ist nur so aufregend zu wissen: daß man könnte, wenn man wollte! ... Aber, wahrhaftig, ich will nicht! ... Und ich wollte auch gar nicht! – Das schwöre ich bei Jesus Christus, unserm Herrn! ... Das Fläschchen werde ich wegwerfen, – habe keine Angst, Ann! Ich bin keine kleine Schlangenkönigin, wenn auch Elisabeth mich so genannt hat! ..."
"Und wenn du's wärst, man kann nicht anders als dich lieben, du Kindchen du!"
Seit frühster Jugend kannte Frances die Putzmacherin. Diese hatte, als sie noch Ann Norton hieß, in Suffolk House eine bevorzugte Stellung als Oberhofmeisterin innegehabt. Durch die keltischen Sagen, die sie in ihren freien Stunden den Kindern erzählte, war früh in Frances, ihrer aufmerksamsten Zuhörerin, ein Hang zum Unheimlichen und Dämonischen geweckt worden. Eine Freundschaft entstand zwischen der Erwachsenen und dem Kinde, eine leidenschaftliche Freundschaft von Seiten der Erwachsenen, die bald in eine Art Hörigkeit und Idolatrie ausartete: Frances hätte sich den Mond zum Abendessen wünschen können und Ann Norton wäre vor dem Versuch nicht zurückgeschreckt, ihr den Mond zu fangen und zu braten. Eines Tages wurde Ann entlassen, weil Lady Suffolk entdeckt hatte, daß sie vom Oheim ihres Gatten, dem Haupte der spanischen Hofpartei, Henry Earl of Northampton, verführt worden war. Der greise, sündenbeladene Junggeselle behielt die Verführte eine Weile noch in Northampton House und verheiratete sie dann an einen "Doctor of Physicke" namens Turner. Da nach des Doctors plötzlichem Tode sich herausstellte, daß seine Apotheke überschuldet war, eröffnete seine Witwe ein Putzmacherei- und Schneidereigeschäft. Nicht lange, und ihr strömte die vornehmste Kundschaft zu.
Ann Turner war fünfunddreißig Jahre alt und glich einer Madonna. Das hinderte ein leise schleichendes, ungreifbares Gerücht nicht, dem Madonnenbilde Kränkendes nachzusagen: in ihrem vierstöckigen Hause, das einst ein Karmeliterinnenkloster gewesen war, gäbe es – außer der Werkstatt und der Apotheke – auch noch andere geheimnisvolle durchaus nicht klösterliche Räume ... Das Gerücht war taktvoll genug, mehr nicht anzudeuten, – es hätte ja sonst zu viele Damen und Herren des Hofes bloßgestellt ...
8
Frances hatte sich mit allen Schmucksachen behängt, die sie besaß, und ließ ihre Mutter herbeibitten, damit sie sie im Hochzeitsstaat bewundere.
Lady Suffolk rauschte herein, groß, fleischig, ausladend, das immer zu rote Gesicht mit dem dreifachen Unterkinn und der rassigen Habichtsnase kalkig überpudert. Ein Zerrspiegelbild ihrer elfenhaften Tochter.
Hinter ihr drein, kaum bis an ihr Knie reichend, trippelte ein winziges Hottentottenknäbchen in grasgrünseidener Pagentracht, welches das Ende ihrer allzu langen Schleppe auf der Schulter trug.
Nachdem sie das Kleid begutachtet und gelobt hatte, entdeckte sie, daß an Frances' ringbedeckten Fingern der berühmte Essexring fehlte.
"Hat ihn dir Robert noch immer nicht geschenkt?"
"Geschenkt wohl, aber nicht gegeben."
"Warum nicht?"
"Lady Penelope, scheint es, hütet den Hort wie ein Drache."
Vor sieben Jahren, nach dem Tode Elisabeths, hatte die Familie Essex den Ring zurückerhalten. Von den beiden Schwestern des hingerichteten Essex lebte damals die ältere, Dorothy Countess of Northumberland, auf Gütern im Norden; darum nahm die jüngere, Lady Penelope, den Ring in Verwahrung, um ihn ihrem unmündigen Neffen – wenn die Zeit gekommen sein würde – auszuhändigen. Die Zeit war nunmehr gekommen, seitdem der König den freilich noch immer halbwüchsigen Robert mit Frances verlobt hatte.
Lady Suffolk ließ sich Papier und Tinte geben und schrieb einen unorthographischen, überaus höflichen Mahnbrief. Das Negerkind barst schier vor Stolz, weil es den Brief zu Penelope Countess of Devonshire hintragen mußte.
Nach einer Stunde kam eine liebenswürdige ausweichende Antwort: der Ring sei verkramt und werde gesucht.
9
Aus einer Gartentür des Audienzzimmers in Whitehall waren zwei junge Kavaliere David Earl of Moray und Sir Thomas Overbury auf die Terrasse hinausgetreten und stiegen die granitene, von zwei Sphinxen flankierte Treppe hinab dem großen Park zu, der damals noch das Königsschloß umgab.
Der unschöne Sohn des schönen vom Marquis of Huntley ermordeten Lieblings der Schotten und der Königin, des unglücklichen Earl of Moray, war den Abend zuvor erst in London eingetroffen, um die vom König anbefohlene Hochzeit mit Anne Gordon, des Mörders Tochter, zu feiern. Er war vom König in der Presence Chamber huldvoll empfangen und eines kurzen Gesprächs gewürdigt worden. Dann hatte James aus der Schar der in der angrenzenden Great Chamber harrenden Höflinge Overbury herangewinkt und ihm befohlen, Moray in den Park zur Königin zu führen.
Sympathisch und grotesk sah Moray aus. Anziehend waren seine blauen sinnenden Augen. Einen Abglanz der Schönheit seines Vaters ließ sein flachsbärtiges gutartig-grimmes Gesicht wohl erkennen. Doch sein zu kleiner Kopf stak auf einem viel zu langen, spindeldünnen Körper; seine in Turnieren gestählten Arme und Beine erinnerten – sobald er, wie jetzt, nicht im Sattel saß – an die Gliedmaßen einer schlenkerig laufenden Spinnenkrabbe.
Overbury war in allem sein Gegenspiel, ein kultivierter Höfling vom Scheitel bis zur Sohle. Er, der in Italien gereist war, verachtete die aus Spanien stammende martialische Barttracht und rasierte sein blasses, langes, rassiges Gesicht. Wenn jener flachsblond war, so war er braunhaarig. Wenn jener als Meister des Florettkampfes galt, so war Overbury's Waffe das Denken – und er konnte zuweilen ein meisterlicher Fechter sein.
Das riesige Parkgelände war Blumengarten nur dicht beim Palast mit Fontänen, Heckenwänden, Laubgängen und Alleen, sonst aber Forst voll greiser Baumriesen, teils urwaldhaft, teils gelichtet, überraschend durch ungeahnte, plötzlich sich öffnende Ausblicke auf Schilfteiche oder Wiesen, ein tags von Hirschen, nachts von Dachsen, Uhus, Titanias Elfenschar und vom blödäugigen, zottigen Einhorn bewohnter Zauberwald.
Zu einem der Ausblicke führte Overbury den Schotten. Sie standen erhöht auf welligem Boden, der, über den Trümmern einer Umwallung aus Normannenzeit, dicht überwachsen und überwuchert, sich dort zu einem niedrigen Hügelzug wölbte. Die Zweige des Unterholzes beiseite schiebend zeigte Overbury auf einen weiten Rasenplatz, wo einige zwanzig reichgekleidete Menschen saßen und standen, deklamierten und zuhörten, sangen und lachten, – ein buntscheckiges, grellfarbiges Bild, umrauscht von einem ebenso buntscheckigen, grellstimmigen Klanggewirr. Die Königin übte dort – wie schon seit Wochen täglich – mit Hofdamen und Hofherren "Hymens Maskenspiel" ein. Weil eine Störung während der Probe von der Königin stets übel vermerkt wurde, hatte Overbury den Gast auf den erhöhten Platz geführt, wo sie zuschauend und beobachtend abwarten konnten.
Moray's erste Frage war, ob seine Braut Anne Gordon unter den Hofdamen sei. Overbury verneinte: so viel er wisse, werde Anne Gordon erst zum Hochzeitstag erwartet.
Bedrückt schwieg Moray eine Weile. Man hatte ihm nicht einmal ein Bild des unbekannten Mädchens geschickt, das er haßte und das ihn doch rätselhaft anzog und beschäftigte; – nicht der alten Familienfehde wegen, sondern weil ihm zumute war, als werde er in ein stockfinsteres Zimmer geführt und müsse ein Ungeheuer umarmen, welches vielleicht – vielleicht – bei Lichte gesehen – sich als liebreizendes Feenkind entpuppen könnte ...
Wer die Königin sei, fragte Moray nicht: ihre Brillanten verrieten sie. Voll Bitterkeit betrachtete er das fette, plumpe, glitzernde Weib: das also war die einst so schlanke, in Liedern besungene Dänische Anna, um derentwillen sein Vater ... Sind Frauenaugen den Tod eines Mannes wert? ...
Von seinem Begleiter ließ sich Moray die Namen der Damen und Kavaliere nennen. Nur wenigen darunter, allzu wenigen, hatte die chronique scandaleuse nicht eine Narrenschelle oder Schandglocke angehängt – mochten sie Pembroke, Southampton, Doncaster, Montgomery heißen oder steinreich sein wie Lady Bedford, Lady Rutland, Lady Compton und andere.
"Wer kriecht da auf allen vieren herum?"
"Das ist unser Nebukadnezar – er frißt Gras wie ein Ochse zum Vergnügen der jungen Ladies. Vordem hieß er Lord Compton."
"Vordem? ..."
"Ja, vordem jüngst sein Schwiegervater, der Wollhändler Spencer, starb und er erfuhr, wie unermeßlich groß die Erbschaft ist. Vor Glück ist er etwas übergeschnappt. Nicht ganz, denn er kann auch Kaviar essen – und auf zwei Beinen gehn. Wenn er von einem schwarzen Schoßhündchen hört, fährt er sechsspännig hin und ersteht, ohne zu handeln, für jeden Preis das Tier. Er soll bereits siebenhundert Schoßhündchen haben ..."
10
Trotz des Verbotes der Königin, die Probe zu stören, geschah es nun dennoch. Eine hohe Frauengestalt mit langer Schleppe – aus der Ferne gesehen einem Känguruh ähnlich – fegte über die Rasenfläche daher und die zwei Straußenfedern ihres Hutes pendelten wie zwei lange Känguruhohren. Es war Lady Suffolk; so zornbeschwingt hastete sie, daß das Hottentottenkind nicht Schritt halten konnte und voll Wichtigtuerei einen Brief tragend, als wäre es ein Obsttablett, hinterdrein stolzierte. Lady Suffolk entriß das Antwortschreiben Lady Penelope's dem Mohrenknaben, färbte flüchtig küssend die ihr huldvoll hingereichten königlichen Finger mit geschmolzener Lippenschminke und verbeugte sich tief, steif, übertrieben zeremoniös vor ihrer Feindin. Schutz suchend stand diese neben der Königin – wie ein Baptisterium im Schatten einer Kathedrale. Das Ansinnen, den Essexring unverzüglich herauszugeben, lehnte Lady Penelope mit einem Hinweis auf ihren Brief ab: darin habe sie ja die Gründe genannt, die es ihr zur Zeit unmöglich machten ... Doch wenn sie sich auch bemühte, der Gegnerin hoheitsvoll zu begegnen, – ihre Entschuldigung klang matt, fast kleinlaut, schüchtern.
Beide Frauen hatten einst Lady Rich geheißen, beide waren mit demselben Sir Everard Rich, einem berüchtigten Hasardspieler und Tunichtgut, verheiratet gewesen. Vor fast zwei Dezennien hatte Lady Suffolk sich von Sir Everard – nach gütlicher Übereinkunft – scheiden lassen, um eine zweite Ehe mit dem Earl of Suffolk einzugehen. Fünfzehn Jahre später war dem geschiedenen Sir Everard eine große Erbschaft zugefallen und solange die nicht verjubelt war, konnte er für einen annehmbaren Freiersmann gelten, wenn auch kein Härchen mehr auf dem gelbroten Kugelspiegel seiner Glatze sproßte. Mit einer jünglinghaften Perücke geziert, hielt er um die Hand der jungen Lady Penelope an, die aus ihrer Abneigung kein Hehl machte. Das war noch zu Elisabeths Zeiten gewesen, als nach Essex' Hinrichtung die Familie in Not geraten war. Um ihrem Schwager, dem unermeßlich reichen Earl of Northumberland, nicht zur Last zu fallen, in einem Anfall von Mutlosigkeit und Selbstverkleinerung, gab Lady Penelope schließlich dem ältlichen Bewerber ihr Jawort. Kaum war sie seine Frau geworden, begann er wieder in gewohnter Weise zu vergeuden. Im Laufe eines Jahres hatte er nahezu alles vertrunken und verspielt; – da aber bestieg James den Thron und erstattete der Familie Essex – außer dem berühmten Ring – auch die von Elisabeth konfiszierten Güter. Jetzt war Penelope reich genug, sich vom kostspieligen Lebensgefährten loszukaufen. Auf eine Scheidung ging er zwar nicht ein. Als sie aber mit ihm nach Venedig, dem Dorado für Glücksritter seines Schlages, gereist war und er sich bald von unerbittlichen Gläubigern bedrängt und verfolgt sah, schloß sie mit ihm einen Pakt: sie nahm es auf sich, ihn los und ledig zu zahlen, ihn vor dem Schuldturm zu bewahren; dafür verpflichtete er sich, ihr einen Totenschein – über sein Hinscheiden und sein Begräbnis auf einer Laguneninsel – zu verschaffen, dann nach Rußland zu ziehen und hinfort am Zarenhof in Moskau zu leben, wo englischer und schottischer Adel gern gelitten war und leicht zu hohen Ehren kommen konnte.
Die Verpflichtungen des Vertrages wurden genau eingehalten. Lady Penelope erhielt den Totenschein. Sir Everard Rich reiste nach Rußland und ließ nie wieder von sich hören. Erst einige Wochen nach seiner Abreise entdeckte sie, daß er den Essexring mit nach Moskau genommen hatte.
Machte zwar diese Entdeckung sie seelisch krank, so doch nur für eine Weile. Nach London zurückgekehrt zeigte sie ihren Freunden den Totenschein – mit einer Handbewegung wie etwa eine Eingekerkerte den Begnadigungsschein vorweist. Sie wurde bemitleidet und beglückwünscht. Schreck und Angst wichen dem Jubel, den üblen Patron für immer los zu sein.
Den Ring vergaß sie, weil sie ihn vergessen wollte. Jeden Gedanken an ihn scheuchte sie von der Schwelle fort.
Ein Jahr später wurde sie die Frau des jungen, liebenswürdigen Earl of Devonshire. Kein Mensch in England wußte von ihrer Bigamie. Weder vor ihrer Schwester Dorothy noch vor dem eigenen vergötterten Gatten hatte sie ein Geständnis abzulegen den Mut gehabt. Nicht einmal vor sich selbst; – redete sie sich doch ein, Rich müsse tot sein, da er sonst längst Bettelbriefe aus Rußland geschickt hätte ... Ihr Gewissen freilich ließ sich nicht allstündlich betrügen, – und das machte sie schüchtern, flackerhaft, scheu.
Vier Babys hatte sie vom Earl, wolkenlos war der Himmel ihrer Ehe bisher gewesen – bis am Morgen dieses Tages der Hottentottenknabe ihr Lady Suffolk's Brief gebracht hatte, mit beiden schwarzbraunen Händen ihn haltend, als trüge er ein Obsttablett.
11
"Wer ringt dort verzweifelt die Hände?" fragte Moray seinen sarkastisch lächelnden Begleiter.
"Das ist der Dichter des Maskenspiels, der berühmte Ben Jonson. Der Ärmste! – er ist genau so klug und arrogant wie er aussieht, und würde herzlich gern beide Ladies erstechen – so wie er einst einen Schauspieler erstach ... Aber die Gefängnisjahre, mit denen er es büßte, haben ihn Zurückhaltung gelehrt!"
Deklamation und Gitarrespiel waren verstummt, fast nur noch die schrille Stimme der Lady Suffolk durchzitterte die Luft. Die lauschende Gruppe rings um die beiden Streitenden wurde immer größer. Im Banne der Wirklichkeit war Königin Anna nicht mehr Juno, Lady Penelope nicht mehr die Vernunft, und ebenso waren die acht Ehehüterinnen Junos und Hymen und die acht Leidenschaften nur noch Mylord oder Mylady und reckten sich, neugierig blickend, die Hälse aus. Abseits hockte Ben Jonson gottergeben ins Gras nieder. Die Stimmung seiner Allegorie war zerrissen wie ein Tempelvorhang, die Welt seiner Verse war versunken, erschien wie Tand, blutlos neben zwei bebenden blutvollen Herzen, schattenhaft wie Laternenlicht im prallen Sonnenschein.
Die buntfarbigen Lords in seidenen Pluderhosen, die Hofdamen im Filigran hoher Spitzenkrausen, waren zu wohlerzogen, offen Partei zu nehmen oder gar Lady Suffolk zu verlachen. Das tat einer, der weder Earl noch Lord war: wie ein Pikador beim Stierkampf kam er in die Arena, um Wut anzustacheln. Seine aufreizende Waffe war seine Gitarre. Sich wundervoll begleitend, sang er mit affektiertem Augenaufschlag Lady Suffolk an.
"Wer ist der Lautenspieler?" fragte Moray.
"Campion, der Liederdichter und Arzt; zu Hause in Spitälern, Palästen und Hurenhäusern – wenn das nicht ein und dasselbe ist ..."
Ein Aufschrei ertönte. Mit einem Schlag ihres Sonnenschirmes hatte Lady Suffolk die wertvolle Gitarre in Trümmer geschlagen.
Die Königin wurde kupferrot:
"Entfernen Sie sich, Madam!"
"Verzeihung, Euer Gnaden, – ich bleibe! ... Nous maintiendrons – lautet unser Wappenspruch!"
"Gehen Sie, Madam!"
"Nein, Euer Gnaden! ... Wir sind nicht in Schottland!"
Die Königin kochte, siedete, barst. Das war ja die nie vernarbende Wunde, daß in England James sich nicht mehr einsperren ließ, ihr die Zügel nicht mehr überließ, und sie darum gezwungen war, sich mit Maskeraden die Zeit zu vertreiben. Wie sicher gebettet mußte sich die Lady in der Gunst des Königs glauben, daß sie sich nicht scheute, ihr einen solchen Affront zuzufügen.
Ein etwa dreißigjähriger Lord, breitschultrig, untersetzt, mit Stutzbart und wässerig-hellen Lamaaugen, ging auf Lady Suffolk zu und sagte phlegmatisch:
"Edle Lady, ich kann nicht dulden, daß Ihre Majestät beleidigt wird."
"Ei, ei, Sie sind wohl ihr Ritter, Sir?"
"Madam, ich bin aller Frauen Beschützer – das habe ich geschworen, als ich den Ritterschlag empfing!"
"Es wird nicht der letzte Schlag sein, den Sie empfingen, Sir!"
"Darf ich Sie begleiten, süße Lady? Darf ich Ihnen meinen Arm anbieten?"
Sich tief verbeugend hielt er ihr seinen Ellenbogen hin, um sie wegzuführen. Als Antwort hierauf zerschlug sie ihren Sonnenschirm auf seinem Kopf. Verbiß er den Schmerz, so kreischte das Hottentottenkind um so lauter vor Angst und die anderen kreischten vor Lachen.
In Atem gehalten durch den dramatischen Vorgang – denn Schläge, ob Schicksalsschläge, ob Pritschenschläge Polichinells, sind immer dramatisch – brachte Moray nur ein flüchtiges "Wer? ..." hervor, das Overbury ebenso flüchtig beantwortete.
"Lord Harbert of Chirbury, Philosoph und Favorit und Mädchenjäger und Ehegatte einer Sechzigjährigen ..."
Der Sonnenschirm nahm monströse Formen an. Beide Hände hielt Lord Harbert an die Beulen seines Kopfes. Zum Schaden hatte er auch noch den Spott.
"Prügel von schöner Frauenhand sind immer Liebkosungen!" bemerkte des Königs Hofnarr Archie Armstrong, ein struppiger, bäurischer Geselle in schellenbedeckter rotgrauer Narrentracht, der bisher abseits gestanden hatte, jetzt aber näher kam.
Sogar Lady Suffolk konnte ein Lächeln nicht verbergen, des Mohrenknaben zinnoberrote Wulstlippen verbreiterte ein Grinsen, die Earls und Ladies wanden sich vor Lachen.
Nur Königin Anna lachte nicht. Ihr war, als sei sie geschlagen worden, als gelte ihr der Hohn. Es ächzte aus ihr hervor:
"Ist denn niemand hier, der mir beisteht?"
Da geschah das Unerhörte. Der Hofnarr, der sich hinter Lady Suffolk gestellt hatte, krallte plötzlich seine eisernen Finger in ihren Haarknoten und riß mit aller Gewalt. Und als er merkte, daß es nicht ein Chignon aus falschem Haar war – wie ihn damals die meisten Damen (und sogar Kinder) trugen –, sondern daß die ganze Haartracht der Lady aus einer Perücke bestand, zupfte er diese mitsamt dem großen Strohhut ihr vom Kopf herab. Blitzschnell war das geschehen. Ein erbarmungswürdiger Anblick bot sich den entsetzten Zuschauern dar. Beinah glatzköpfig bis auf ein jämmerlich schmächtiges, fingerlanges Zöpfchen glänzte der Schädel wie rötliches Elfenbein, das Sonnenlicht widerspiegelnd. Sofort packte der tolle Hofnarr dieses Zöpfchen und ließ es nicht los. Mochte die Lady (die hochmütigste des Inselreiches) in die Knie sinken, plebejisch mit den Armen fuchteln, ihm sein ernstes Bauerngesicht zerkratzen, mochte sie stöhnen, prusten und kreischen – er zog am Zöpfchen, als schöpfte er Wasser aus einem Ziehbrunnen.
Den Zeugen dieses Auftritts verging der Atem und der Humor. Das überstieg alle Grenzen. Die Gönner Shakespeare's, – Southampton, Pembroke, Montgomery, – ertrugen den widerwärtigen Anblick nicht. Sie wollten hinstürzen, der Dame beistehen. Die königliche Barbarin jedoch verwehrte es ihnen mit erhobenem Arm. Ihr tat die krasse Roheit Genüge. Archie war ihr Rächer und durfte am Zöpfchen Klimmzüge machen wie ein Schimpanse am Trapez.
Wer weiß, wie das geendet hätte, wäre nicht gerade in dem Augenblick ein sechzehnjähriger Knabe von auffallender Schönheit in Begleitung zweier Stallknechte auf dem Reitweg am andern Ende der Wiese aufgetaucht. Er hielt im Ritt inne, hieß die Grooms warten und galoppierte über den Rasenplatz.
Moray's Frage – ob dies Prinz Henry sei? – beantwortete Overbury ernster als die früheren Fragen:
"Ja, das ist unser Prinz Hal ... Er nennt sich auch ›Meliades, Herr der Inseln‹. – Sagt das nicht alles? ... In Whitehall ist er der einzige Mann, obgleich er noch kein Mann ist ... und dazu schön ist wie ein Mädchen ... Nicht einmal seine Mutter ist so sehr Mann wie dieser Knabe, den sie haßt wie die Sünde ..." Sich verbessernd fügte Overbury hinzu, gleichsam zu sich selbst: "Das heißt, wann haßte sie wohl die Sünde? ..."
Die Earls und Ladies gaben scheu auseinanderweichend einen Raum frei, so daß Prinz Hal sein schnaufendes Pferd dicht vor Archie parieren konnte. Er sprang aus dem Sattel und hob die Reitpeitsche. Der Hofnarr zuckte zusammen vor dem Zorn des schönen Knaben und ließ das Zöpfchen los. Hal schleuderte ihn zur Seite und bemühte sich, die noch immer knieende, nach Luft schnappende, heulende Lady Suffolk emporzurichten. Sie lallte nur und küßte seine Hände.
Könnten Blicke töten, so wäre Hal jetzt vom Glutblick seiner Mutter getötet worden. Auch Dolchworte hatte sie bereit für ihn, doch sie kam nicht dazu, sie auszusprechen. Denn – vom Schlosse her – nahte eben der König mit einigen älteren Lords, angelockt durch das viele langandauernde Gelächter und Geschrei. Auf den Arm des Duke of Lenox gestützt, watschelte er heran. Sein nicht unedles Gesicht überhuschte ein spöttischer Zug, hatte er doch seit einer Weile schon am Waldesrand lauschend gestanden.
Als er herantrat, wurde es totenstill.
Wenn James der Salomo Englands sein wollte, – hier hatte er Gelegenheit, ein salomonisches Urteil zu fällen. Er ließ sich die Beschwerden vortragen und stellte ein Verhör an wie ein Richter. Leicht war es für ihn nicht, die schwanke Schaluppe seines Rechtsspruches zwischen alle Klippen hindurchzusteuern: er wollte die Familie Howard nicht kränken, die Familie Essex auch nicht und seine Frau erst recht nicht. Die finstern Blicke der Königin flößten ihm mehr Sorge ein als das Gezeter der Lady Suffolk – welche die Verlobung ihrer Tochter zu lösen drohte. Solch eine Drohung war in den Wind geredet, das wußte James. Sein niemand befriedigendes Verdikt lautete schließlich: bis zum Hochzeitstage müsse Lady Penelope den Ring gefunden und abgeliefert haben.
Die volle Schale seines Zorns ergoß sich sodann über Archie.
"Was fiel dir ein, du verdammter Hund? Bist du besoffen?"
"I wo, Gevatter, ich habe mir keinen Zopf getrunken! Doch Nase und Zopf sind wie eine Wippschaukel oder wie die zwei Schalen der Wage: sinkt die eine, so steigt die andere. Was kann man also einer hochnäsigen Nase Lieberes antun, als daß man ihr einen Zopf dreht?"
James ließ ihn nicht weiterreden und verurteilte ihn zu zwei Tagen Hausarrest.
"O weh! Jetzt muß ich die Nase hängen lassen, denn ich habe eine Nase bekommen!" seufzte der Hofnarr.
Das Gelächter, das er erntete, stellte die heitere Stimmung wieder her. Moray und Overbury verließen ihr Versteck, stiegen zum Rasenplatz hinab. Von James der Königin vorgestellt, durfte Moray mit seinem Mund ihre gepolsterten Finger streifen, während Hymen bereits nach der Vernunft rief und die acht Leidenschaften sich malerisch lagerten – denn die Probe nahm ihren Fortgang.
Junos Augen aber wußten nichts mehr von Moray's Vater ...
12
Erst nach Mitternacht verließ Sir Thomas Overbury Whitehall, um sich zu seiner unweit der Old London Bridge befindlichen Wohnung rudern zu lassen. Das enge damalige London war eine Wasserstadt wie Venedig – Tausende von grellfarbig befrachteten Booten und Lastkähnen wimmelten tagsüber auf der Themse; und durchbrochen sich spiegelnde Laternenlichter schaukelten nachts, wie ein Gewühl von Leuchtkäfern, auf den kohlschwarzen Flußwellen. An die vierzigtausend Menschen lebten von der Gunst der Wasserstraße als Bootsverleiher, Bootsbauer, Bootsknechte, Bootswächter.
Müde war Overbury. Seines feinen Geschmackes und Urteils wegen war er unablässig in Anspruch genommen worden den ganzen Nachmittag hindurch, als die vom Bildhauer Nicholas Stone entworfenen allegorischen Kostüme und Haartrachten zum erstenmal in Erscheinung traten, und erst recht abends im großen Saal der Banqueting Hall, wo der geniale Architekt Inigo Jones die Kulissen für das Maskenspiel aufstellen ließ nebst einer gewaltigen Maschinerie, durch die eine drehbare hohle, acht Damen fassende Erdkugel bewegt werden konnte. Die Hammerschläge der Arbeiter hallten noch, als Overbury den Palast verließ.
Er kam zur Landungsstelle und fand dort weder sein Boot noch seinen Diener Jasper. Das war an sich nichts Verwunderliches. Auch sonst, wenn es spät wurde, pflegte Jasper sich die Zeit zu vertreiben, indem er die Themse hinauf oder hinab ruderte. Doch blieb er stets in Hörweite und schoß heran, sobald seines Herren Pfiff erscholl.
Doch Overbury's mehrmaliges Pfeifen blieb diesmal ungehört. Mißmutig und gähnend setzte er sich auf die oberste Stufe der breiten, in die Themse hinabführenden Steintreppe. Seltsam verlassen und allein fühlte er sich. Die Vorderfront des spätgotischen Palastes, kaum hundert Schritt vom Fluß entfernt, war mit grauweißem Monddunst überschleiert, unwahrscheinlich ferngerückt. Geschlossen war das große Portal, die Lichter in den Fenstern der Hoffräuleins erloschen. Der schwere Schritt des Wache haltenden Hellebardiers verhallte und erstarb auf einer Terrasse an der rechten Schmalseite des Schlosses.
Da sah Overbury in der nachtschwarzen Themse ein blutjunges Mädchen schwimmen, und ihm schien, er habe niemals eine geübtere, niemals eine zauberhaftere Schwimmerin gesehen. Sie schwamm auf die Steintreppe zu; und als sie näher und näher kam, erhob er sich sacht und stellte sich hinter den Stamm eines alten Ahorns. Sie landete an der Brücke, – und jetzt erst gewahrte er, daß sie vom Nabel abwärts einen Fischschwanz hatte voll großer grünblau und milchig und rubinrot opalisierender Fischschuppen.
Flink und gelenk streifte sie den Schwanz ab als wär's ein Gewand. Und herrlich, wie Gott sie erschaffen hatte, stieg sie die Treppe hinauf, ging auf ein Rasenstück zu und tanzte dort längere Zeit träumerisch, sehnsüchtig und traurig, – wie eine, der zu tanzen nur selten vergönnt ist. Dann stellte sie sich weiß und schlank vor ein Blumenbeet. Einen großen Nachtfalter, – man nennt ihn den Totenkopf oder Totenvogel –, der eben an einer dunklen Rose sog, haschte sie, blickte ihm sinnend in die winzigen erschreckten Augen und küßte ihn. Und es war, als hätte ihr Kuß den Totenvogel ihr hörig gemacht, denn als sie ihn auf ihre linke Brust gesetzt hatte, blieb er berauscht sitzen und streichelte ihre silbrige Haut mit seinen bebenden Flügeln.
Overbury schlich jetzt die Treppe hinab und ergriff den Fischschwanz. Sie sah es, sie stieß einen leisen schrillen Schrei aus. Wie ein Marmorbildnis stand sie am Blumenbeet, regungslos, nur daß große, glitzrige Tränen ihr über die Wangen perlten. Der Schmetterling aber flog weg, flog ihm entgegen, umflatterte ihn, und schien hindern zu wollen, daß er ihr ein Leid antue.
Doch wollte denn Overbury ihr ein Leid antun? Er hatte ein junges, krankes Weib zu Hause. Mehr als sein Augapfel war sein Weib ihm lieb. Den Leib des Mädchens ersehnte er nicht, – wie berückend sie auch war.
Plötzlich warf sich das Mädchen auf die Knie vor ihm nieder:
"Laß mich eine Meermaid bleiben! Gib mir den Fischschwanz zurück!"
"Und wenn ich es tue – was gibst du mir dafür?"
"Diese schwarze Rose!"
"Das ist wenig ... Oder öffnet sie Schatzhöhlen?"
"Sie öffnet Menschenaugen."
"Bedarf ich dessen?"
"Rieche an dieser Rose, so wirst du wissend werden und wirst es erblicken ..."
"Was? ..."
"Gottes Schreckenshand über Sodom und Gomorrha! ... Ach, wie blind, wie verblendet seid ihr Menschen, daß ihr die weiße Schreckenshand nicht seht!"
Overbury roch an der schwarzen Rose, die sie abgepflückt hatte und ihm hinhielt. Da sah er im Park, der linken Palastecke gegenüber, ein hohes, schwarzes Schafott, umstanden von Myriaden ergrausender Menschen. Ein König legte sein Haupt auf den Block, des roten Henkers Schwert sauste nieder, polternd rollte des Königs Kopf über die Planken, der Aufschrei der Myriaden erdröhnte wie das Gebrüll eines wunden Stiers ...
Overbury fühlte sich unsanft am Arm gepackt.
"Sie sind eingeschlafen, Sir Thomas! Um ein Haar wären Sie in die Themse geglitten, hätte ich Sie nicht aufgefangen!"
Sein Diener Jasper stand grinsend vor ihm. Overbury rieb sich ärgerlich und etwas beschämt die Augen. Vom Schafott und von der Meermaid war nichts zu sehn, Flußnebel weißten den Rasen, wo sie getanzt hatte. Weit hinten vor dem Schloßportal blinkte bläulich eine Hellebarde im Mondenschein.
Herr und Diener stiegen schweigend ins Boot.
13
Als Overbury zu Bett lag neben Oriana, seiner kranken Frau, erzählte er ihr sarkastisch, sich selbst verlachend, seine Vision.
"Das Mädchen", spottete er, "war ein Fisch. Darum weinte das arme Ding so, als es sich gefangen sah, – es fürchtete nämlich, ich würde es essen ... Eigentlich war ich auch zu gutmütig; – ich hätte das Fräulein mitbringen sollen, dann hätten wir morgen ein schmackhaftes Fischgericht!"
Oriana schüttelte ernst den Kopf.
"Du willst durch Lachen deinen Schreck meistern, Thomas. Doch was hilft's. Du kannst das Bild von Gottes Schreckenshand dir nicht aus den Augen wischen. Und durch dich sehe ich fortan Gottes Schreckenshand."
"Über London?"
"Nein. Über Whitehall; – denn dort ist Sodom und Gomorrha."
"Mehr Sodom als Gomorrha!" bemerkte Overbury bitter.
Oriana schauderte. In die Leere starrend sagte sie:
"An Kindern und Kindeskindern werden Sünden gestraft ... Wie sah der Geköpfte aus?"
"Nicht wie Seine Majestät – (was denkst du!) – und auch – gottlob! – nicht wie Prinz Hal ... Aber wozu das, Oriana? Nebelgebilde am Themseufer – was bedeuten die? Du glaubst doch auch ans Wassermädchen nicht."
"Ich glaube, daß das wundervollste Alpenglühen sich in schwärzeste Nacht verwandeln muß, Thomas. Unabwendbar ist es, unaufhaltsam, ein Kreislauf – wie das Auf und Ab am Rad des Glückes. Der Anfang der Nacht aber ist, wenn die Sonne im Zenit steht: die Eulen der Nacht werden am strahlenden Tage ausgebrütet! ... Und noch eins will ich dir sagen: Verfall ist die geheime Sehnsucht aller Paläste."
14
Oriana war unheilbar krank: mit verletztem Rückgrat siechte sie seit Jahren dahin. Ihr Siechtum hatte sie, die einst so Flatterhafte, ernst, tief und hellsichtig gemacht. Sie war Märtyrerin und genoß die Ehren einer Märtyrerin. Nicht nur ihrem Gatten erschien sie als ein fast überirdisches Wesen, ein an Erdenleid gebannter Engel, eine delphische Priesterin, eine Heilige. Um ihr Krankenbett versammelten sich täglich Bürgerstöchter und junge Ladies, schmückten ihr Zimmer mit Blumen und hatten kein anderes Begehren, als ihr frommes Gesicht zu betrachten, ihren gütigen Worten zu lauschen.
Sie war kurz vor Elisabeths Tode Hofdame geworden, eine der jüngsten und leichtsinnigsten. Ahnungslos, einer Mondwandlerin gleich, war sie an manchem Abgrund unversehrt vorbeigegangen, hatte schöngetan, geliebelt und geäugelt, Hände gedrückt, sich auch wohl Küsse gefallen lassen. Das flatterhafte Spiel war trotz allem unschuldsvoll geblieben, kein Schatten verdunkelte ihren lauteren Ruf, die jungfräuliche Königin lobte ihre kindliche Reinheit. Was Liebe sei, erfuhr Oriana erst, als ihr Overbury wie ein junger Gott entgegentrat, ihr die Augen, den Verstand und die Seele blendend. Ein vollendeter Weltmann, ein Kunstliebhaber und Kenner, ein überragender Kopf war er eben damals aus Madrid, Rom und Florenz zurückgekehrt, wohin er auf Anraten Sir Robert Cecil's, seines Gönners, gereist war, nachdem er zuvor in Oxford Bakkalaureus der freien Künste geworden und im Londoner Middle Temple Juristerei getrieben hatte. Durch den Aufenthalt im Süden geschliffen und poliert, aber auch hochmütig geworden, fand er kein Genügen mehr an der Rechtsgelahrtheit, – höher hinaus wollte sein Ehrgeiz. Von seinem allmächtigen Gönner konnte er sich die Tore des Hofes aufschließen lassen; – und, im Bewußtsein alle Altersgenossen auszustechen, zögerte er nicht, sich hineinzuwagen in die fährnisreiche Welt, deren Rangunterschiede und Schranken von der Heraldik errichtet werden. Sein Wagnis brauchte er – zunächst wenigstens – nicht zu bereuen: der alten strengen Königin Blicke ruhten wohlwollend auf seiner Gestalt, Walter Raleigh und Francis Bacon schätzten seinen geschmeidigen Geist.
Auch schriftstellerischen Ehrgeiz hatte Overbury, ein Werk über Charaktere – nach Art des Theophrast – schwebte ihm vor; seine gelegentlichen Sonette fielen auf durch Bildhaftigkeit und graziösen Rhythmus. William Shakespeare riet ihm nicht ab, den Dornenweg eines Dichters zu gehn; Beaumont und Fletcher behandelten ihn kameradschaftlich wie ihresgleichen, der junge John Ford wurde sein Freund.
Kein Wunder, daß Oriana wie eine Motte ins Licht flog.
15
Einen Jugendfreund hatte Overbury gehabt und verloren. Seltsamerweise wurde dieser entschwundene, unwiederbringlich verlorene Freund zum Kuppler zwischen ihm und Oriana.
Auf der Schulbank in Eton College war Overbury einst von einer geradezu krankhaften Schwärmerei und Liebe zu einem Mitschüler namens Robert Car erfaßt worden. Der Bildhauerin Natur war freilich selten ein so schönes Kunstwerk wie dieser Knabe geglückt. Overbury dichtete ihn an, und in mancher Nacht träumte er vom Freund, wie wenn es ein Mädchen wäre. Unzertrennlich wurden sie. Keine höhere Seligkeit kannte Overbury, als Robert Car sein Innerstes aufzudecken, seine Knabenseele – gleichsam als läge sie auf einem Tisch im Anatomiesaal – aufzuschneiden, sein pochendes Herz ihm hinzuhalten ... Robert Car erwiderte Gleiches mit Gleichem nicht, blieb verschlossen, lächelte undurchsichtig; – ein Unbekannter blieb er trotz aller Treueschwüre. Auch gab sich Overbury keiner Täuschung hin, schmerzlich wurde es ihm nach und nach bewußt, daß er sich vergeudete an einen, der nur durch seines Körpers und Antlitzes zauberhafte Schönheit fesselte, dessen Geist und Herz jedoch taube Blüten waren. Aber gerade die Unbegabtheit Robert Car's weckte in ihm, dem Hochbegabten, ein Mitleid und ein Bestreben, ihm beim Lernen behilflich zu sein, sein Mentor zu werden. Die Launen des Freundes, seine Unwahrhaftigkeiten, seine Unerzogenheit bewiesen ja nur, wie sehr er eines Führers bedurfte.
Mehrere Jahre vor Overbury mußte Car die Schule verlassen: der für ihn sorgende und zahlende Vormund war gestorben – mittellos stand der Knabe in der Welt und mußte, wollte er nicht verhungern, eine Pagenstelle beim schottischen Earl of Dunbar annehmen.
Später, als sich Overbury bereits in Oxford das Bakkalaureat erwarb, kamen ihm böse Gerüchte zu Ohren: Car habe versucht, die Tochter des Earl of Dunbar zu vergewaltigen, und sei mit Schimpf und Schande aus dem Schloß gejagt worden ... Wieviel daran wahr sei, vermochte Overbury, trotz redlichen Bemühens, nicht aufzuhellen; nur die Tatsache wurde ihm bestätigt, daß Car im Schloß Dunbar nicht mehr weilte.
Erst in Rom erhielt er einen aufklärenden, wenn auch kaum etwas erklärenden, Brief – und zwar von Car selbst. Dieses erste Lebenszeichen seit der Schulzeit war unbeholfen im Stil, lügnerisch, hämisch: Wäre er weniger stolz, hätte er längst geschrieben und sein Leid geklagt. Das Leid eines armen Pagen – könne ein Bakkalaureus das verstehn, ein von Fortuna verhätschelter Bakkalaureus? Die Metze Fortuna verfolge ihn mit ihrem Haß; Schloß Dunbar habe er verlassen, weil zehn Jungfrauen ihn küßten und er zehn Wochenbetten aus dem Weg gehn mußte. Jetzt sei er in London und habe sich selbst zum Bakkalaureus der freien Künste ernannt, als Seiltänzer, als Balladensänger, als Schauspieler im Globe-Theater, als Parfümeur, als Marktschreier, als Hahnenkampfleiter ... Das hübsche Stück Geld, das er sich verdient und erspart hatte, sei ihm nun kürzlich von einer Freundin und Meisterdiebin, Moll Cutpurse – der berühmten Moll Cutpurse –, gestohlen worden. Ratzekahl ausgeplündert, habe er sich gezwungen gesehn, wieder – obgleich wahrlich kein Kind mehr – als Page zu dienen. Wenn Overbury aus Italien heimkomme und Fortunas Lächeln ihn nicht zu hochmütig gemacht habe, möge er im Hause des Earl of Southampton nach dem Pagen Robert Car fragen. Es würde ihn freuen, Overbury die Hand zu drücken und ihn mit seiner entzückend frechen Freundin Moll Cutpurse bekannt zu machen.
Daß Car im Globe-Theater aufgetreten sei, war ebenso unwahrscheinlich, wie die zehn gleichzeitig ins Wochenbett steigenden Mädchen. Doch mochte der Brief noch so verlogen sein, mochte ein Schamgefühl den Weg zum Earl erschweren (ein Schamgefühl, dessen Overbury sich schämte), – stärker als die Hemmungen war die ehrliche Freude, den schönen Menschen endlich wiedersehn, ihm vielleicht aus dem Sumpf heraushelfen zu können.
Nach London heimgekehrt, kam Overbury nicht gleich dazu, den Pagen aufzusuchen. Seinen eigenen Schicksalsgang mußte er in jenen Tagen gehn. Zum erstenmal atmete er Hofluft und ließ sich von ihrem Ambraduft umnebeln. Schicksalsvoll betrat er Whitehall, wie Tannhäuser den Venusberg, um dem Hof nie mehr Valet zu sagen. Der Audienzsaal wurde ihm zur Zauberhöhle ...
Bald hatte er Wurzel geschlagen im neuen Erdreich. Seine Absicht, in Whitehall gesprächsweise Southampton über Car auszukundschaften, ließ sich nicht ausführen, da Southampton gerade damals in London blieb, allabendlich die Schauspielhäuser der Bank-Side – des rechten Themseufers – besuchte, mit Dramatikern in Falkon Inn zechte, jedoch nach Whitehall nicht kam, vom Bannstrahl der erzürnten Jungfräulichen getroffen wegen seiner heimlichen Ehe mit der Hofdame Elizabeth Varnon. Strenger als einst strafte die alternde Königin alle Liebesvergehen.
Wochen vergingen. Da fand Overbury, in alten Papieren kramend, zufällig ein Gedicht, das er als Knabe an jenen Knaben gerichtet hatte. Und plötzlich stand in seltsamer Greifbarkeit und doch Ungreifbarkeit, wie ein Nachtnebeln entsteigendes Phantom, das vergessene Bild vor ihm. Mochte das Gedicht auch kindlich und unschuldig entstanden sein, – ihn, den Herangereiften, berührte es wie der Hauch einer Giftblume, die ja auch unwissend und unschuldig blüht – und betäuben kann ... Eine Glut war in den unbeholfenen Versen, – eine Glut, die dem sündigen grünen Feuer der Shakespeare-Sonette fast gleichkam. Overbury erschrak über sich selbst. Die Hölle hielt ihm den Spiegel vor. War er das? ... War er so? ... Das hatte er nicht gewußt oder bereits vergessen, daß er so hatte empfinden können ... Er fühlte, wie seine Wangen sich röteten. Nein, es war doch klüger, den Pagen nicht aufzusuchen ...
Einige Tage später änderte er seinen Entschluß, der ihm nachträglich als Feigheit erschien. Jenes Kind war ja geschwunden wie der vorjährige Schnee, und am verlotterten, erwachsenen, bärtigen Robert Car erinnerte schwerlich noch irgendwas an jenes sylphenhafte Geschöpf ... Von plötzlicher Sehnsucht erfaßt, begab er sich in Southampton's Haus. Er traf den Earl nicht an; der Haushofmeister aber teilte ihm mit, der Page Car sei schon vor längerer Zeit wegen liederlichen Lebenswandels verabschiedet worden und habe England verlassen, um in Spanien Kriegsdienst zu suchen.
16
Rot färbte die untergehende Sonne in Whitehall's Park den kleinen Schilfteich, an welchem tags darauf Overbury saß, schwermütig in das gläserne, gespiegelte Abendrot starrend. Frösche quakten und sprangen, ein Specht pochte an einer Baumrinde. Da setzte sich das junge Hoffräulein Oriana Leyburne neben ihn. Sie hatte einen kleinen Laubfrosch gefangen und ließ ihn an ihren milchweißen Fingern wie an Sprossen einer Leiter emporklimmen. Leicht mußte sie wohl sein, daß sie so unhörbar leise herangekommen war. Verwundert sah Overbury sie an. Eigentlich kannte er sie kaum. Was störte sie seine heilige Einsamkeit?