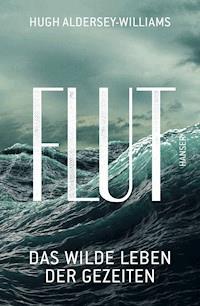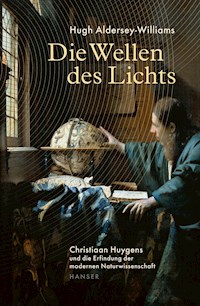
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Wiederentdeckung eines vergessenen Genies: Wie der Niederländer Christian Huygens die Grundlagen der modernen Naturwissenschaft legte
Das 17. Jahrhundert war das Goldene Zeitalter für die Niederlande. Es zog Künstler und Geschäftsleute ebenso an wie Gelehrte und Naturforscher. Im Zentrum dieser intellektuellen Blüte stand ein Mann, dessen Schaffen sämtliche Zeitgenossen in den Schatten stellte – und der doch in Vergessenheit geraten ist: Christiaan Huygens, Erfinder von Teleskopen und der mechanischen Uhr, Entdecker des Saturnrings, Vater der Wellentheorie des Lichts, Bekannter von Descartes, Newton und Spinoza, Lehrer von Leibniz und Erbe einer in ganz Europa bestens vernetzten Dynastie. Hugh Aldersey-Williams zeichnet ein schillerndes Porträt eines außerordentlichen Mannes und einer bewegten Epoche, ohne die die Welt heute eine andere wäre. Eine packende Geschichte über die vergessenen Wurzeln der modernen Naturwissenschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 766
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Die Wiederentdeckung eines vergessenen Genies: Wie der Niederländer Christian Huygens die Grundlagen der modernen Naturwissenschaft legteDas 17. Jahrhundert war das Goldene Zeitalter für die Niederlande. Es zog Künstler und Geschäftsleute ebenso an wie Gelehrte und Naturforscher. Im Zentrum dieser intellektuellen Blüte stand ein Mann, dessen Schaffen sämtliche Zeitgenossen in den Schatten stellte — und der doch in Vergessenheit geraten ist: Christiaan Huygens, Erfinder von Teleskopen und der mechanischen Uhr, Entdecker des Saturnrings, Vater der Wellentheorie des Lichts, Bekannter von Descartes, Newton und Spinoza, Lehrer von Leibniz und Erbe einer in ganz Europa bestens vernetzten Dynastie. Hugh Aldersey-Williams zeichnet ein schillerndes Porträt eines außerordentlichen Mannes und einer bewegten Epoche, ohne die die Welt heute eine andere wäre. Eine packende Geschichte über die vergessenen Wurzeln der modernen Naturwissenschaft.
Hugh Aldersey-Williams
Die Wellen des Lichts
Christiaan Huygens und die Erfindung der modernen Naturwissenschaft
Aus dem Englischen von Elsbeth Ranke und Sabine Reinhardus
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Vorbemerkung des Autors
Einleitung
1 Sand, Licht, Glas
2 Ein vielseitiger kenner
3 Geniale Zeitgenossen
4 Zu Hause in Den Haag
5 Beinahe ein Wunderkind
6 Umkehr und Stoß
7 Saturn
8 Zeit und Wahrscheinlichkeit
9 Wissenschaftliche Gesellschaft
10 Neue Musik
11 Pariser Jahre
12 Die Wissenschaft in Zeiten des Krieges
13 Fehden und Prozesse
14 Licht und Gravitation
15 Fremde Welten
Nachwort
Bildteil
Dank
Kurzbiografien
Anmerkungen
Bibliografie
Bildnachweis
Register
Für Sam
Vorbemerkung des Autors
Meine wichtigste Quelle waren Christiaan Huygens’ Œuvres Complètes mit den Briefen von Huygens und seinen Korrespondenten in französischer, lateinischer, niederländischer und in anderen Sprachen sowie den Texten seiner wichtigsten Abhandlungen jeweils in der Originalsprache. Außerdem liefern die Herausgeber Zusammenfassungen von Huygens’ wissenschaftlichen Leistungen und eine kurze Biografie auf Französisch. Zitate aus dieser Quelle oder aus Originalmanuskripten in der Universitätsbibliothek Leiden habe ich selbst übersetzt.*1 Ein Großteil der Sekundärliteratur ist ebenfalls niederländisch (oder gelegentlich in anderen Sprachen) verfasst, und auch in diesen Fällen benutze ich meine eigene Übersetzung, auch für Verszeilen — es sei denn, eine bessere Übersetzung stand mir zur Verfügung: Dann ist sie in den Anmerkungen nachgewiesen.
Wenn nicht anders angegeben, entsprechen Datumsangaben dem gregorianischen Kalender.
Einleitung
Klares Licht fällt durch die Bleiglasfenster auf den blank geputzten Fußboden und legt ein schräges Gitternetz über das geometrische Muster der schwarz-weißen Fliesen. An der Fensterfläche bricht es sich, und noch einmal, wenn es seine ursprüngliche Richtung wieder aufnimmt. Es tanzt und windet sich, hüpft und umspielt kleine Schlieren in dem alten Glas. Hier und da wirken kleine Bläschen als improvisierte Linsen und Prismen, die vergrößerte oder verzerrte Lichtpunkte auf den Boden werfen, manchmal gar einen winzigen Regenbogen. Das hellste Lichtmuster zerschneiden die scharfen Schatten der Bleiruten im Fenster. Weil die Sonne schräg am Himmel steht, ist es seitlich verzogen. Aber direkt unter dem Fenster liegt noch eine weitere Lache aus Licht: Ein bläulich verschwommener Schimmer steigt von den Fliesen auf — die Spiegelung des Lichts im Himmel.
Der Raum ist groß und hell; ursprünglich wurden dort Festmahle und musikalische Gesellschaften abgehalten. Er hat Fenster auf drei Seiten und ist doch noch heller, als man erwarten würde. Man fühlt sich fast wie im Freien — was merkwürdig ist, denn über einem liegt nicht Luft, sondern eine schwere Balkendecke. Dann aber merkt man, dass auch diese Decke selbst von Licht geradezu funkelt, von Licht aus noch einer anderen, einer tiefer gelegenen Quelle, das durch dasselbe Fenster nach oben geworfen wird, und zwar vom Wasser im Graben rund um das Haus der Familie Huygens, Hofwijck.
In diesem Anwesen fünf Kilometer südöstlich von Den Haag lebte Christiaan Huygens nach dem Tod seines Vaters, des Dichters und Diplomaten Constantijn, bis zu seinem eigenen Tod nur acht Jahre später, im Jahr 1695. Als Constantijn etwa 50 Jahre zuvor Hofwijck erbaute, schrieb er, er wolle, dass es aussieht, »als wär es über Nacht wie ein Täubling plötzlich ans Licht gebracht«.1 Und wie es da mitten im ruhigen, spiegelglatten Wasser steht, und das, obwohl heute gleich dahinter die viel zu laute Hochautobahn dröhnt, tut es das noch heute. Hier vollendete Christiaan seine Abhandlungen über die Natur des Lichts und die Gravitation, die seine gewaltigen Beiträge zur Physik zusammenfassten. Hier stellte er im weitläufigen Gelände seine Teleskope auf und fing an, über das Leben auf fremden Planeten zu spekulieren.
Christiaan Huygens war in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts der größte naturwissenschaftliche Gelehrte Europas, bis zum Aufstieg Isaac Newtons, von dem er vor allem in der anglofonen Welt weitgehend in den Schatten gestellt wurde.*2 Das bleibt ein ungerechtes Urteil der Wissenschaftsgeschichte, denn in einigen wichtigen Punkten übersteigen Huygens’ Leistungen die von Newton. Er war ein Macher genauso wie ein Beobachter und Denker, er mehrte das theoretische wie praktische Wissen in den Bereichen Astronomie, Optik und Mechanik. Als außerordentlicher Mathematiker bewältigte Huygens Probleme in so unterschiedlichen Bereichen wie Geometrie und Wahrscheinlichkeitsrechnung, und als Erster setzte er mathematische Formeln zur Lösung physikalischer Fragestellungen ein — diese Methode ist heute die Grundlage allen naturwissenschaftlichen Arbeitens. 200 Jahre vor ihrer allgemeinen Anerkennung legte er eine Wellentheorie des Lichts vor. Als Erster beschrieb er die Zentrifugalkraft. Mithilfe von ihm selbst entworfener und gefertigter Teleskope entdeckte er das Ringsystem des Saturns und seinen größten Mond, den Titan. Er schätzte die Größe des Mars und die Entfernung zu vielen Sternen. Er fand heraus, wie sich genauere Pendeluhren bauen ließen, und setzte damit Galileos Vision in die Wirklichkeit um. Seine Innovationen im Bereich des optischen Instrumentariums und der Zeitmessung sind bis heute in Gebrauch.
Auch auf andere Gebiete erstreckten sich seine Talente: Er war ein guter Zeichner, was ihm nicht nur beim Entwerfen mechanischer und optischer Geräte zugutekam, sondern auch, um der Welt die planetaren Phänomene vor Augen zu führen, die er durch seine Teleskope beobachtete; freilich ging er nicht über Skizzen hinaus, wenn er etwa mit einem Porträt Freundinnen schmeicheln wollte oder kleine Landschaftsansichten seiner Lebenswelt fertigte. Er war ein versierter Musiker und musizierte gemeinsam mit anderen, wo immer er hinkam. Gelegentlich finden sich an den Rändern seiner wissenschaftlichen Notizen ein paar Noten einer Melodie oder eines Liedtexts. Doch auch in die Musik wollte er seine Mathematik einbringen und schlug eine Unterteilung der Oktave in 31 Tonstufen vor — ein Vorgriff auf musikalische Innovationen des 20. Jahrhunderts.
Von bleibenderer Bedeutung war sein Beitrag zum Aufstieg der naturwissenschaftlichen Institutionen in Europa, und das nicht nur in der Republik der Niederlande, sondern vor allem auch in Frankreich, wo er wesentlich an der Einrichtung der französischen Académie des Sciences beteiligt war. Auch bei der Londoner Royal Society war er ein frühes Mitglied und verkörperte damit das Potenzial der Naturwissenschaften, nationale Grenzen zu überwinden.
Der Welt zeigte er sich freilich nicht immer in diesem Licht. Als Huygens 1671 aus Paris nach Den Haag zurückkehrte, ließ er sich von Caspar Netscher porträtieren, der bereits mehrere andere Familienmitglieder gemalt hatte. Netschers kleines Ölgemälde zeigt die Meisterschaft des Künstlers in der Darstellung feiner Stoffe. Huygens blickt mit weit geöffneten Augen aus einem Meer von Seide und Spitze. Er steht am Höhepunkt seines Einflusses, und doch hat er immer noch etwas von dem hübschen Kind, das er einst war. Und falls wir nach irgendeinem Hinweis auf seine Gelehrsamkeit suchen — etwa einem Tisch mit wissenschaftlichen Gerätschaften und ein paar hingeworfenen Blättern voller Berechnungen —, dann müssen wir danach anderswo Ausschau halten. Hier sehen wir allein einen Mann der Mode und des extravaganten Geschmacks.
Und doch war er gleichzeitig auch der Prototyp des modernen Gelehrten. Zwar war er auf vielen Gebieten tätig und sprang opportunistisch zwischen ihnen hin und her, statt sich an das zu halten, was wir heute als stringentes Forschungsprogramm bezeichnen würden; dennoch betrieb er seine Untersuchungen stets mit Sorgfalt und Präzision, selbst wenn er, wie viele seiner Zeitgenossen, seine Erkenntnisse nicht immer umgehend publizierte. Sein Rückgriff auf die Mathematik sowie sein Bewusstsein für die Bedeutung der Kriterien Reproduzierbarkeit, Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit — nach diesem Verständnis müssen Experimente wiederholbar sein, damit sich ihre Richtigkeit beweisen lässt, und Versuchsergebnisse, die eine Hypothese nicht stützen, zum Verwerfen der Hypothese führen — zeigen, wie ernsthaft er seine Geschäfte betrieb. Zu seinen Themen wählte er sorgfältig die Gebiete, auf denen sich realistischerweise ein Durchbruch erzielen ließ. Nie driftete er in den Bereich des Aberglaubens ab, was ihn von einigen seiner Zeitgenossen deutlich abhebt. Er war derart auf neue Erkenntnisse aus, dass er sich bei seinem ersten London-Besuch 1661 die Gelegenheit entgehen ließ, der Krönung von König Karl II. beizuwohnen, und lieber den interessanteren Merkurdurchgang beobachtete.
Die Vervollkommnung seiner vielfältigen Begabung verdankte Huygens mit Sicherheit seinem Vater Constantijn, der ihn von klein auf vergötterte und später rückhaltlos bewunderte; Descartes und anderen illustren Besuchern seines Hauses stellte er ihn als »mein Archimedes« vor. Constantijn, der sehr alt wurde, übte auf Christiaan fast sein gesamtes Leben lang einen strengen moralischen und intellektuellen Einfluss aus — und als er schließlich im Alter von 90 Jahren verstarb, ließ der damals 58 Jahre alte Christiaan sich verdrossen im Gewand eines Waisen malen.
Der Dichter, Komponist, Diplomat, Architekt und Künstler Constantijn Huygens war in keinerlei Hinsicht weniger bemerkenswert als sein Sohn, weshalb auch er in diesem Buch ausführlich gewürdigt wird. 1596 geboren, diente er als Sekretär bei mehreren Stadhouders, den Statthaltern einzelner Provinzen in der Republik der Niederlande. Constantijn war, so nannten es die Niederländer, ein kenner — kein Amateur, kein einfacher Liebhaber und Dilettant, sondern einer, der sich mit Schweiß und Mühe eingearbeitet hat, bis er selbst zum Meister wurde, obgleich er diese Kenntnisse nie zur Bestreitung seines Lebensunterhalts nutzte.
So lernte Constantijn Huygens bei einem der besten Zeichner seiner Zeit zeichnen und malen; diese Expertise aus erster Hand konnte er dann gewinnbringend nutzen, als er das noch ungeschliffene Talent des jungen Rembrandt entdeckte, dessen Werk, so meinte er, eine passende Ausschmückung für den Hof des Statthalters in Den Haag wäre. Huygens lancierte wirksam die Karriere des Künstlers; allerdings versandete ihre Freundschaft in einem ausladenden Briefwechsel, in dem der zunehmend blasierte Rembrandt in überbordender Dreistigkeit seine Honorare einforderte.
Huygens war auch genügend Architekt, um eine tragende Rolle beim Entwurf seiner eigenen Häuser einzunehmen. Mühelos reihte er sich ein in den Kreis führender niederländischer Poeten, dokumentierte sein langes Leben in Versen. Und als er etwa den Bau einer großen Prachtstraße von Den Haag bis an die Küste bei Scheveningen vorschlug, schrieb er auch dazu ein Gedicht. Er komponierte Hunderte Musikstücke und spielte diverse Instrumente. Selbstverständlich erreichten seine diplomatischen Missionen eine kulturelle Dimension, die ihm nicht zum Schaden gereichte, und lange vor seinem 40. Geburtstag war er sowohl in England, wo er Jakob I. mit seinem Lautenspiel erfreut hatte, als auch in Frankreich, wo er Ludwig XIII. mit seinen literarischen Leistungen beeindruckte, zum Ritter geschlagen worden.
Bei dieser breiten Interessenslage ist es nicht erstaunlich, dass Constantijn sich auch Fragen der Naturwissenschaft widmete. Die Qualität seines Umgangs mit den Naturwissenschaften steht in lehrreichem Kontrast zu dem seines Sohns; auch das rechtfertigt es, ihn hier ausführlich zu behandeln. Wenn Christiaan der Prototyp des modernen Wissenschaftlers war, dann war Constantijn ein Beispiel für den früheren »Curioso« — einer, der die Phänomene der Natur kennenlernen möchte, aber nicht immer die richtigen Fragen stellt oder über die nötige Ausrüstung verfügt, um sie zu beantworten. Diese Faszination beim Vater war für seine Kinder sicher prägend.
Constantijn und seine Frau Susanna hatten vier Söhne und eine Tochter. Der kenner-Instinkt ging auf sie alle über, besonders aber auf die beiden ältesten Söhne: Der ältere, ebenfalls Constantijn, wurde ein geschickter Linsenschleifer; und Christiaan lernte, die komplexen Mechanismen für seine eigenen uhrmacherischen Erfindungen und optischen Geräte zu konstruieren. Vielleicht trug auch die pathologisch schlechte Sehkraft des Vaters dazu bei, dass die Jungen diesen Weg einschlugen. Der jüngere Constantijn folgte seinem Vater schließlich in die Diplomatenlaufbahn und wurde zum Sekretär des Statthalters Wilhelm III.; ihn begleitete er 1688 auf seiner Triumphreise durch England, wo er neben seiner Gattin Maria Stuart den englischen Thron bestieg. Wie Samuel Pepys führte auch Constantijn ein Tagebuch, das jeden Aspekt seines persönlichen und politischen Lebens festhielt — von erotischem Klatsch bis zum Fortschritt der Glorious Revolution.
Wesentlich für ein Verständnis von Christiaan Huygens’ Werdegang ist auch das familiäre Milieu der Familie in Den Haag. Nicht nur waren in diesem Hause Descartes und Rembrandt zu Gast; außerdem lag es in Reichweite zum Macht- und Einflusszentrum der Republik der Niederlande. Das alles vereinfachte die Kontakte, und Christiaans Brillanz tat den Rest dazu, dass er seinen Platz im Firmament der europäischen Gelehrten fand — zwischen Blaise Pascal, Pierre de Fermat, Marin Mersenne, Jacob Bernoulli, Robert Hooke, Robert Boyle, John Wallis, Giovanni Cassini, Thomas Hobbes, John Locke, Gottfried Leibniz und Isaac Newton.
War da nicht etwas mit dem Licht? Das fragte sich jeder bei der Betrachtung der Malerei im niederländischen Goldenen Zeitalter. Die Sonne war weicher, die Farben weniger grell, die Kontraste weniger hart als in der Toskana oder in Madrid. Die Fenster waren größer, die Räume weniger dämmerig. Das niederländische Licht brachte die Künstler dazu, erstmals vom häuslichen Alltag zu schwärmen mit seinen ruhigen Landschaften, unprätentiösen Räumen und vornehmen Begegnungen.
Bereits Anfang des 17. Jahrhunderts profitierten niederländische Künstler vom wissenschaftlichen Verständnis der Perspektive, sie kannten die Camera obscura, eine Vorrichtung, in der sich das Bild einer Szene durch ein kleines Loch in einer Wand oder sonstigen Abtrennung auf eine Art Bildschirm projizieren ließ. Diese Neuheit machten sich die Kreativen zu eigen, als entdeckt wurde, dass man die äußere Szene optisch verändern konnte, indem man in das Loch eine Linse setzte; damit konnten Künstler undenkbar weitläufige Panoramen auf die Leinwand komprimieren. Fast schien es, als könnten sie das Licht an sich einfangen und es in einem vergoldeten Rahmen wieder freilassen als Visionen einer rundum erneuerten Welt. Doch die Szenen, die sie einfingen, und das Licht, mit dem sie arbeiteten, waren natuurlijk, natürlich, also frei von Künstlichkeit und zugleich von der Natur komponiert. Sie entsprangen aus heimischem Boden, Luft und Wasser. Ihre Kunst war eine zutiefst lokale Kunst.
Profitierte auch die Naturwissenschaft von ihren Ursprungsbedingungen? Wir kennen die unübertroffene niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts: Die Landschaften von Ruisdael, die Porträts von Rembrandt, die Interieurs von Vermeer. Doch neben ihr stand gleichberechtigt die Naturwissenschaft, und wir sollten uns nicht scheuen, beide auch gemeinsam zu denken. So erklärte der niederländische Maler und Kunstgelehrte Samuel van Hoogstraeten1687: »Die Kunst der Malerei ist eine Wissenschaft zur Darstellung aller Konzeptionen oder Eindrücke, die die Gesamtheit der sichtbaren Natur bietet, und zum Betören des Auges mit Kontur und Farbe.«2 Und welches Instrument war schließlich wichtiger für den Betörer als die Fähigkeit, mit Licht umzugehen, das Licht, das die sichtbare Natur erhellt, das Licht, das es uns erlaubt, sie zu sehen? Der gemeinsame Faktor, der die Interessen von Kunst und Wissenschaft vereint, ist also mit Sicherheit das Licht.
So richtet sich denn auch ein großer Teil des naturwissenschaftlichen Forschens in dieser Zeit auf das Verständnis des Lichts. Der Leidener Willebrord Snellius vermaß die Größe der Erde und formulierte das Brechungsgesetz, das noch heute seinen Namen trägt: das Snellius-Gesetz. Und im nahen Delft sowie in Alkmaar und Middelburg stellten Antoni van Leeuwenhoek, Jan Swammerdam und Cornelis Drebbel die ersten Untersuchungen mit selbst gebauten Mikroskopen an. Das erste Teleskop wurde auf einem Turm in Den Haag vorgeführt. Neben Huygens und seiner Familie folgten noch viele andere niederländische Linsenschleifer und Konstrukteure optischer Geräte, nicht zuletzt auch der Philosoph Baruch Spinoza, der seinen bescheidenen Lebensunterhalt als lenzenslijper verdiente, nachdem er von seiner religiösen Gemeinde in Amsterdam verbannt worden war.
Spinoza, dessen Eltern aus Portugal immigrierte Juden waren, hatte Glück, dass er in der relativ liberalen Republik der Niederlande geboren wurde. Andere kamen wegen genau dieser Freiheiten eigens hierher. Der Bekannteste von ihnen war René Descartes, der 1628 aus den religiösen Turbulenzen in Frankreich in die intellektuelle Freiheit der neuen niederländischen Universitäten floh, um dort in aller Ruhe sein philosophisches Meisterwerk zu verfassen, den Discours de la Méthode. Vielen gilt diese Abhandlung, in der Descartes sein berühmtes Cogito ergo sum (»Ich denke, also bin ich«) darlegt, als Grundlage der modernen Philosophie. Descartes selbst dagegen schätzte sie ganz anders ein, nämlich als theoretische Präambel zu einer Reihe von Arbeiten über die Natur der Welt in all ihren Aspekten, etwa La dioptrique, seine Studien zur Physik der Optik, zur Natur des Lichts und der Anatomie des Auges. Auch diese beiden großen Philosophen ließen sich also vom Licht leiten.
Das Licht machte die Vereinigten Provinzen zu einem Ort des Sehens. Die liberalen, wissbegierigen Zeiten machten es möglich. Und der Ort bestand darauf: keine Schatten auf dem Boden.
Was könnte man da sehen wollen? Zuallererst geht der Blick nach draußen. Gefahr könnte dort drohen in diesen Zeiten ständiger Kriege und zerbrechlichen Friedens. Über das flache Land hinweg könnte man Fremde kommen sehen, oder feindliche Soldaten. Zur See ferne Schiffe, unbekannte Flaggen und gefährliche Sandbänke knapp über der Wasseroberfläche. Gefahr vielleicht — und Gelegenheit. Ferne Küsten, die sich für Handel und Herrschaft beanspruchen lassen. Jeder Ort auf einer Karte, oder besser noch, ein Ort, der noch auf keiner Karte verzeichnet ist. Ein bisher ungesehener Ort. Den sichtbar machen. Nennt man einen erhofften Gewinn nicht eine Aussicht?
Dann schweift der Blick umher. Was sind diese Niederlande? Woraus bestehen sie? Aus Wasser. So viel Wasser, flache zeeën und meeren, manchmal spiegelnd, manchmal dunkel, wenn der Wind darüberfährt. Das Licht ist immer ein anderes. Platte Felder mit Gräben und Deichen bis an den niedrigen Horizont, hier und da vielleicht ein paar Baumgruppen, die sich in der Brise ducken. Ausgewaschene Küsten, offenes Heideland, blanke Städte und Dörfer, von ferne an ihren Kirchtürmen erkennbar.
Oder blicken wir nach oben. Vielleicht wächst da der Ehrgeiz, nach dem unerreichbar Fernen zu greifen, dem Himmel, den Sternen und Planeten und der Leere zwischen ihnen. Lässt sich Dunkelheit sichtbar machen? Was ist da draußen? Oder blicken wir nach unten. Nach innen. Sehen wir genau hin — erstmals war das Menschen möglich — auf die winzigen Wunder der Natur, Samen, Insekten, Schimmelpilze, schwimmende Mikroben. Wagen wir einen Blick auf den menschlichen Körper? Den eigenen in einem größeren, perfekteren Spiegel, als man ihn je zuvor kannte, oder den eines anderen (der arme Kerl) in der Anatomiestunde eines chirurgischen Lehrmeisters. Beide Spektakel, das eine häuslich und privat, das andere in theatralischer Öffentlichkeit, wurden technisch machbar und sozial akzeptabel, als Scham und Aberglaube in Sachen menschlicher Körper passé waren. Vielleicht sind wir neugierig auf den Ursprung des Lebens und würden gerne hineinblicken in unsere potenziellen Nachkommen in semine oder in utero. Immer weiter hinschauen, solange wir es aushalten. Auf Dreck und Staub. Auf menschlichen Abfall. Was kommt heraus, wenn wir spucken und defäkieren? Im 17. Jahrhundert liegt plötzlich alles vor unseren Augen. Noch die entferntesten Dinge. Die kleinsten. Die schönsten, die wunderbarsten. In Kosmos und Mikrokosmos.
Vielleicht wollen wir auch Qualitäten sehen: die Feinheit eines Gewebes, die Reinheit des Diamanten, die Geschicklichkeit des Künstlers mit dem Pinsel. Das Alltägliche, das Gewöhnliche, das Kleine: das Nadelöhr, das Fadenende, den verlorenen stuiver oder duit, den Boden einer Tasche, ein beginnendes Loch. Vielleicht brauchen wir Hilfe, um Geschriebenes zu lesen, so wie Vater Constantijn. Vielleicht sehnen wir uns danach, wieder zu sehen, was wir einst ohne Hilfe sehen konnten.
Und sehen wir uns um. Betrachten wir unsere Mitbürger. Wie gut sie sich anstellen! Vielleicht wollen wir auch in Nachbars Zimmer spähen, nur um sicherzugehen, dass sie nichts zu verbergen haben. Und sie verleiten uns ja auch dazu mit ihren großen, blanken Fenstern. »Das Land ist flach«, schreibt der Romanautor Cees Nooteboom,
was zu einer extremen Sichtbarkeit der Menschen führt, und dies wiederum wird in deren Verhalten sichtbar. Niederländer gehen nicht miteinander um, sie begegnen einander. Sie bohren ihre hellen, leuchtenden Blicke in die Augen des anderen und prüfen seine Seele. Es gibt keinerlei Schlupfwinkel. Sie machen ihre Vorhänge nicht zu und halten dies für eine Tugend.3
Na los, gucken wir, schnüffeln wir. Beides sind übrigens Wörter niederländischer Herkunft.
Natürlich erkennt man alles das besser, wenn man die geeigneten optischen Geräte benutzt. Den neuen Sezierern, die bereit sind, mit scharfem Stahl in schleimige Eingeweide zu stechen, verdanken wir die Erkenntnis, dass die Linse im menschlichen Auge nicht das eigentliche Sehorgan ist, sondern das Sehen nur möglich macht, als eine Art Sekretär, der eintreffende Information so in eine Ordnung bringt, dass das Gehirn sie exekutiv verarbeiten kann. Wenn Hornhaut, Kammerwasser und Linse dazu nicht in der Lage sind, brauchen wir die Hilfe zusätzlicher Linsen in Form einer Brille oder einer Lupe. Um neue Welten zu sehen, brauchen wir neue Instrumente: ein Fernglas oder Fernrohr für das Große, Entfernte; einen Fadenzähler oder ein »Flohglas« für das Kleine, Nahe. Nirgends war man besser gerüstet zur Herstellung dieser Geräte als in den florierenden Technikmetropolen der niederländischen Provinzen.
Und wen, wenn nicht einen Künstler, beauftragt man, die Bilder, die man im Okular sieht, festzuhalten?
Außer natürlich man ist Künstler genug, um das selbst zu erledigen — und das war Christiaan Huygens mit Sicherheit.
Christiaan Huygens hat so viel zu bieten: Er machte höchst bedeutsame Entdeckungen in Astronomie und Physik; er zeigte, wie sich natürliche Vorgänge in mathematischen Begriffen beschreiben lassen — ohne diese Erkenntnisse könnte moderne Naturwissenschaft nicht funktionieren; er erfand und baute ausgeklügelte Geräte. Seine Geschichte ruft förmlich danach, erzählt zu werden. Die Aussage, wir müssen ihn aus dem Mottenschrank der Geschichte holen, sollte eigentlich übertrieben sein, so eng ist seine Arbeit verflochten mit der bekannterer Gelehrtengrößen. Doch selbst viele Wissenschaftshistoriker haben es fertiggebracht, ihn zu ignorieren. Und wer sonst kennt Huygens heute schon? Sollten wir uns nicht daran erinnern lassen, warum er »der größte Wissenschaftler seiner Generation« gewesen wäre, so John Gribbin, »hätte er nicht das Pech gehabt, fast genau zeitgleich mit Isaac Newton tätig zu sein«?4
Solche Amnesien sind in der anglofonen Welt nicht selten. Und doch ist die Art und Weise, wie Huygens’ Ruf durch die turmhoch überragende Gegenwart Newtons regelrecht vernichtet wurde, nicht einfach nur nachlässig, sondern aktiv ungerecht. Wer über Huygens schreiben will, muss daher Stellung beziehen. Nach den Regeln der Naturwissenschaftsgeschichte geraten die, deren Theorien von besseren Theorien überholt werden, in Vergessenheit. Doch das trifft bei Huygens ja gar nicht zu. Seine Entdeckungen gelten größtenteils bis heute — jede mechanische Armbanduhr tickt dank seinem Mechanismus; und wir gehen weiterhin davon aus, dass Licht sich als Welle fortbewegt. Aber Newton strahlt eben ein derart blendendes Licht aus, dass Huygens darin ganz einfach überstrahlt wird.
Wie also erzählt man Huygens’ Geschichte? Soll ich so tun, als gäbe es Newton nicht? Das wäre eine Möglichkeit. Huygens wirkte in der Republik der Niederlande und in Frankreich. Da wäre es doch verlockend, über dem Ärmelkanal dichte Nebelschwaden aufziehen zu lassen, sodass die Britischen Inseln außer Sichtweite gerieten und die englische Naturwissenschaft einstweilen außen vor bliebe. Doch Huygens und Newton waren Zeitgenossen: Newton war 13 Jahre jünger als Huygens und überlebte ihn um 32 Jahre. Und wichtiger: Sie wussten jeweils von der Arbeit des anderen. Sie korrespondierten und begegneten sich sogar. Huygens war tatsächlich einer der wenigen Menschen, deren wissenschaftliche Meinung Newton wertschätzte. Also keine Nebelschwaden.
Dann könnte ich Huygens vielleicht als Gegenpol zu Newton aufbauen. Doch damit wäre es schon wieder Newtons Geschichte, und die von Huygens wäre die Antithese, die Nicht-Geschichte. Er wäre der, der nicht die Gravitation erklärte, der nicht die Infinitesimalrechnung gebrauchte, der nicht mit einem Prisma das Licht zerlegte. Dieses Narrativ würde eine Art Parität zwischen diesen und Huygens’ Entdeckungen behaupten — Zentrifugalkraft, mathematische Formeln, Licht als Welle —, und als Lektüre wäre das so langweilig wie tendenziös.
Nun könnten die aufrechten Naturwissenschaftler einwenden, ich solle doch einfach objektiv die Geschichte von Huygens’ Leben erzählen und Newton einbringen, wo er relevant ist, und weglassen, wo er irrelevant ist. Wäre das nicht am besten so? Warum sollte ich es mir unnötig schwer machen? Es stimmt, Christiaans Leben beschreibt auch für sich selbst genommen einen schönen Bogen. Mit 17 hatte er 1646 ein mathematisches Können unter Beweis gestellt, das die größten Spezialisten seiner Zeit aufhorchen ließ. 1665 wurden der Saturnmond Titan und der mysteriöse Ring des Planeten zu seiner Visitenkarte. 1658 stellte er dem niederländischen Staat seinen Entwurf einer genaueren Uhr vor. 1659 zeichnete er den Vorläufer des Diaprojektors, den er »Laterna magica« nannte. Ende der 1660er-Jahre hielt er sich überwiegend in Paris auf, wo er seine professionellen Beziehungen pflegte. Nach weiteren Arbeiten zum Licht — er wies nach, dass es wellenförmig sein muss, führte weitere Experimente mit Teleskopen und Mikroskopen durch und verbesserte die Uhrenmechanik weiter — veröffentlichte er 1673 bedeutende Abhandlungen zur Zeit und 1690 zum Licht. Nach seiner fulminanten Jugend schritt er mit Glück und Geschick voran (das Glück bevorzugt den, der vorbereitet ist, sollte ein anderer Naturwissenschaftler später formulieren), nutzte seine Gelegenheiten zu ein paar erstaunlichen Entdeckungen, vergrub sich im zähen Ringen um andere Ziele, bevor er in der Reife mit seinen Hauptwerken eine bemerkenswerte Synthese schuf und sich schließlich in eine Phase des exzentrischen Niedergangs zurückzog.
Das wäre doch ein zufriedenstellendes Narrativ! Doch bei genauerer Betrachtung erweist sich dieses als grobe Vereinfachung. Huygens’ Leben war keineswegs so wohlgeformt, wie diese Storyline es suggeriert. Ihm funkt die Welt dazwischen: Er verfolgt viele Projekte auf einmal; sie stocken, beginnen neu; er ist hier (Den Haag) und dort (Paris); er ist gesund, er ist krank; es herrscht Frieden, es herrscht Krieg. Alles das macht es unmöglich, Huygens’ Geschichte einfach als eine Abfolge von Ereignissen zu erzählen.
Zumal Huygens auch noch andere Geschichten hat. Er ist nicht nur das überschattete Genie. Er ist ein Universalgelehrter — neugierig und kompetent genug, um auf mehreren verschiedenen Gebieten gleichzeitig voranzuschreiten. Diese Geschichte hat ihren Reiz, besonders heute, wo es schon schwer genug ist, in einem winzigen Spezialgebiet ein Experte zu sein, und wo Universalität wirkt wie ein Traum aus einer Welt vor einem gewissen Niedergang. Er ist auch der Korrespondent, der Netzwerker, der Diplomat.
Ein weiterer Zweig von Huygens’ Geschichte dreht sich um seine außerordentlich reizvolle Familie: sein produktiver, allgegenwärtiger und scheinbar unsterblicher Vater, Dichter, Komponist und rechte Hand der Statthalter; dann sein älterer Bruder, auch Constantijn, Nachfolger des Vaters als Begleiter Wilhelms III. von Oranien bei seiner friedlichen Invasion Englands, der das Abenteuer in einem bemerkenswerten Tagebuch festhielt. Wäre John Donne, der Doyen der englischen metaphysischen Dichter, der Vater und Isaac Newton und Samuel Pepys seine Söhne gewesen, so wäre die Familienkonstellation nicht günstiger gewesen.
Und dann noch etwas. Christiaan ist ein Internationalist, heroisch ignoriert er nationale Differenzen und Unterschiede, weil sie in seiner Welt nichts bedeuten. Er ist eine Schlüsselfigur — vielleicht die Schlüsselfigur — beim Aufbau der naturwissenschaftlichen Forschung als internationales Projekt im 17. Jahrhundert. Wieder eine ganz andere Geschichte. Die Naturwissenschaft der frühen Neuzeit war in erster Linie ein Unterfangen brillanter Individuen unter der Schirmherrschaft einzelner aufklärerischer Fürsten. Vor dem Aufkommen vieler Nationalstaaten war sie natürlich nicht auf nationaler Ebene organisiert. Und genau das macht Huygens’ Pariser Jahre wirklich bemerkenswert. Seine Brillanz als Mathematiker und Astronom wurde von den meisten führenden französischen Naturphilosophen bereitwillig anerkannt, und er reagierte 1666 umgehend auf die Initiative des einflussreichen Ministers von Ludwig XIV., Jean-Baptiste Colbert, der die Gründung einer Akademie anstieß, um Anregungen für eine wissenschaftlich fundierte Optimierung des französischen Staatswesens zu liefern. Ohne Huygens — und einen oder zwei andere kosmopolitische Vermittler wie Henry Oldenburg bei der Londoner Royal Society — wäre die Naturwissenschaft vielleicht noch sehr lange ein führerloses Privatvergnügen voneinander isolierter Fürstenhöfe geblieben.
In Holland gab es keinen Monarchen, und ein großer Teil von Huygens’ Wirkungszeit fiel zudem in eine statthalterlose Zeit; dennoch prosperierte das Land weiter — dank kolonialer Eroberungen und der Ausweitung des Seehandels. Dieser Wirtschaftsaufschwung brachte einen Wind der Freiheit mit sich, der anderswo unbekannt war. Offenere Arbeitsbedingungen hätte sich Huygens gar nicht wünschen können. Doch unter der intensiven Rivalität, in der die Städte und Provinzen miteinander wetteiferten, hätten die Vereinigten Niederlande damals nie ein eigenes Wissenschaftszentrum bieten können. Huygens konnte froh sein, dass Paris ihn so offen aufnahm, und Frankreich konnte froh sein, ihn zu finden.
Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts — Huygens’ Blütezeit — eine Epoche großen religiösen und politischen Aufruhrs und fast durchgehender Kriege zwischen den Ländern Europas war. Die Unruhe beschleunigte die Verbreitung neuer Ideen und errichtete zugleich praktische Hindernisse für den intellektuellen Fortschritt. So befanden sich etwa die englischen Philosophen Thomas Hobbes und John Locke, beide gute Bekannte der Familie Huygens, zu unterschiedlichen Zeiten im Exil in Paris beziehungsweise Amsterdam, während niederländische Maler wie Peter Lely und Godfrey Kneller in England Arbeit suchten, wo häufiger Mäzene zu finden waren. Huygens bemühte sich 1667 um englische Patente für seine Schiffsuhr, während gleichzeitig die niederländische Flotte die Themse aufwärtssegelte, um in Chatham Kriegsschiffe der Royal Navy in Brand zu setzen. Und fünf Jahre danach arbeitete er weiter mit seinen französischen Kollegen zusammen, als Ludwig XIV. in die Niederlande einmarschierte — ein Feldzug, bei dem die Niederländer sich gezwungen sahen, ihr eigenes wertvolles Ackerland zu fluten, um sich gegen den französischen Vorstoß zu schützen.
Zwei Faktoren erklären demnach, warum Huygens sich mit Fug und Recht eine Führungsrolle bei der »Erfindung der modernen Naturwissenschaft« zuerkennen darf: Erstens seine Einführung mathematischer Präzision in die Beschreibung physikalischer Phänomene; und zweitens sein Ideenreichtum bei der Entwicklung institutioneller Rahmenbedingungen für die naturwissenschaftliche Forschung in Europa. Man kann sich den heutigen wissenschaftlichen Fortschritt unmöglich vorstellen, wären diese beiden Bedingungen nicht fest institutionalisiert. Oder wie Huygens gesagt haben soll: »Die Welt ist meine Heimat, die Wissenschaft meine Religion.«
Bei meinen Wanderungen durch die Dünen, die die niederländischen Städte vor dem Eindringen der Nordsee schützen, wurde mir langsam klar, dass Huygens’ geografische Verortung für seine Arbeit vielleicht von höherer materieller Relevanz war, als ich zunächst meinte. Aus diesen Dünen stammte der Sand für das Glas, aus dem sich Linsen schleifen ließen. Erklärte das die außerordentliche Blüte der Optik in dieser Gegend, die unter Huygens kulminierte, aber in Snellius einen Vorgänger hatte und in den zahlreichen Kandidaten, die das Teleskop entwickelt haben wollen, bis zu den Mikroskopbauern Leeuwenhoek und Swammerdam und den philosophischen Linsenschleifern Descartes und Spinoza? Vielleicht stimmte, was Constantijn Huygens geschrieben hatte: »Gottes Güte scheint von jeder Düne«?5
Dann müsste die Geschichte wieder anders lauten. Es wäre nicht die alte Geschichte vom einsamen Genie mit seinen Geistesblitzen aus dem Nichts. Sondern die eines tief mit seinem lokalen Dasein verbundenen Forschers, dem Licht und Sand als Rohmaterial dienten.
Diese Welt möchte ich in Die Wellen des Lichts beschreiben. Ich bin in Huygens’ Fußstapfen durch die Niederlande und nach Paris und London gereist. Ich habe seine Häuser besucht, oder häufiger die Stellen, an denen sie einst standen. Ich saß in Hofwijck auf dem Gelände, wo er seine Skizzen machte, und habe drinnen zugesehen, wie das Sonnenlicht über den schwarz-weiß karierten Boden kroch. Ich habe die wenigen noch vorhandenen Instrumente, die er gebaut und verwendet hat, betrachtet — und gelegentlich sogar hindurchgesehen. Ich habe seine Porträts nach Hinweisen auf seine Persönlichkeit durchforscht.
Meine Hauptquelle waren natürlich die 22 Bände von Christiaan Huygens’ Œuvres complètes, die ein internationales Team aus Naturwissenschaftlerinnen und Historikern über zwei Weltkriege hinweg zwischen 1888 und 1950 zusammenstellte. Darin bekam ich die authentische Stimme des Gelehrten zu hören. Und in ihren Briefen, Tagebüchern und Gedichten hörte ich die Stimmen seines Vaters und seiner Geschwister. Um eine persönlichere Verbindung herzustellen, konsultierte ich Christiaans Originaldokumente in der Bibliothek der Universität Leiden, die mir weitere Facetten von Huygens’ Charakter eröffneten, in ihrem dichten Gewebe von Arbeitsskizzen und Berechnungen, an denen abzulesen ist, wie viele Gedankengänge — mathematische, mechanische, astronomische und musikalische — er gleichzeitig verfolgte. Dort hielt ich auch Christiaans eigene kleine Skizze von Saturn und seinem Ring in der Hand (und versuchte, den zittrigen Bleistiftstrich zu ignorieren, mit dem die Herausgeber sie für eine Reproduktion in den Œuvres complètes markiert hatten). Der vollkommene Kreisbogen des Planeten war haargenau mit Tusche ausschraffiert, ebenso die Kanten der Ellipse, die ihn umgürtete. Der Raum um den Planeten und vor allem auch der Raum zwischen der Oberfläche des Planeten und der Innenkante des Rings waren zart in taubengrau verwaschener Tinte abschattiert, und das Ganze war umgeben von emsigen handschriftlichen Bemerkungen. Huygens hatte seine hübsche kleine Zeichnung 1659 gefertigt.
Meine Entdeckungsreise war nicht besonders abenteuerlich. Es war eher eine innere Reise in eine Welt von Luxus und Muße, aber auch in eine Welt der Neugierde, der Ernsthaftigkeit und der Zielstrebigkeit. Auf ihre Art eine bescheidene Welt, die aber keine kleinere war. Wie das Gemälde eines »niederländischen Interieurs« enthält sie, so zeigt sich am Ende, alles.
1
Sand, Licht, Glas
Hatte der Mensch je etwas Schnelleres erschaffen? Schnurgerade wie ein Pfeil sauste es über den Strand in Scheveningen an der Küste bei Den Haag und erreichte bis zu 40 Stundenkilometer. Ein Fahrgestell mit vier großen Wagenrädern trug den Rumpf, der 20 oder mehr tollkühnen Passagieren Platz bot. Der Wind in den breiten Rahsegeln an den beiden Masten trieb das Gefährt über den Sand voran, und als Statthalter Prinz Moritz, Zweitgeborener des ermordeten Königs Wilhelm des Schweigers, das Steuer übernahm, flatterte die Prinzenflagge des Hauses Oranien am Mast. Bei kräftiger Brise schoss der zeilwagen (Segelwagen) am Strand entlang, scheuchte die Möwen auf und legte ein Tempo wie der Wind vor, sodass die Passagiere keinen Fahrtwind mehr auf ihren Gesichtern spürten, wie ein französischer Augenzeuge 1606 berichtete.1
Dieses erstaunliche Wunderwerk der Technik hatte Simon Stevin erdacht und erbaut, höchstwahrscheinlich angeregt von Illustrationen wesentlich älterer chinesischer Segelwagen, die der flämische Kartograf Gerard Mercator nach den Beschreibungen damaliger Forschungsreisender in seinen wunderschönen Atlanten abgebildet hatte. In Laurence SternesTristram Shandy schwärmt Onkel Toby in einer Passage ebenfalls von dem »berühmten Segelwagen, der dem Prinzen Maurice gehörte und der von so wundervoller Konstruktion und Geschwindigkeit war, dass er ein halbes Dutzend Personen in ich weiß nicht wie wenigen Minuten dreißig deutsche Meilen beförderte«, obgleich er den Wagen schwerlich selbst gesehen haben kann, wenn er denn tatsächlich, wie er ja beharrlich behauptet, in der Schlacht von Namur (1695) gekämpft hat.2
1Simon Stevins Segelwagen rast über den Strand in Scheveningen. Prinz Moritz befindet sich an Bord, seine Standarte flattert oben am Mast.
Stevin war der Prototyp des niederländischen Wissenschaftlers schlechthin, ein vorzüglicher Mathematiker, dem es vor allem um den praktischen Nutzen seiner Arbeit ging. 1581 war er als 33-Jähriger aus seiner Heimatstadt Brügge nach Leiden geflüchtet und veröffentlichte dort in rascher Folge Bücher über Arithmetik, Geometrie, Maßsysteme, Buchhaltung, Mechanik und Hydrostatik (die Lehre von unbewegten, strömungsfreien Flüssigkeiten). Daneben verfasste er angewandte und praxisbezogene Schriften, in denen er sich beispielsweise mit Idealentwürfen für Festungen und Schleusen beschäftigte. Er unterrichtete nicht an der Universität und verdiente sein Geld durch die Verbesserung von Windmühlen oder Wasserbauprojekten, ohne dass diese Tätigkeit seine wissenschaftlichen Interessen behindert hätte. In gewissem Sinn war seine Situation sogar kennzeichnend für den Zustand der Niederlande, denn »dass keine wissenschaftlichen oder philosophischen Glaubenskriege geführt wurden, (…) bot vielfältige Gelegenheiten für neue Ideen«.3 Das dichte kommerzielle und kulturelle Netzwerk in den selbstbewussten Städten trug in erster Linie und in viel größerem Umfang als die akademischen Institutionen zur Entstehung und Verbreitung neuer Ideen bei.
Und es waren wirklich neue Ideen. Stevin schuf sozusagen den Segelwagen der Buchhaltung mit seinem Vorschlag, statt der bis dahin üblichen gewöhnlichen Bruchzahlen mit einer Vielzahl möglicher Nenner Dezimalzahlen einzuführen. Zuvor hatte ein Händler, der seine täglichen Einnahmen aufrechnete, mit Preisangaben zu kämpfen, die, je nach den unterschiedlichen Währungen, in Dritteln, Achteln, Fünfzehnteln oder Sechzigsteln angegeben waren. In seinem Lehrbuch De Thiende (»Das Zehntel«) aus dem Jahr 1585 setzte Stevin eine eingekreiste Null neben eine Zahl, um die verschiedenen Potenzen der Zehntel darzustellen (um tatsächlich also zu zeigen, dass die Gesamtzahl durch zehn hoch null geteilt wurde — oder mit anderen Worten unverändert blieb). Eine umkreiste Eins stand für Zehntel (geteilt durch zehn hoch eins), eine umkreiste Zwei repräsentierte Hundertstel (geteilt durch zehn hoch zwei) und so weiter. 30 Jahre später entwickelte der schottische Mathematiker John Napier Stevins Schreibweise weiter zur uns heute vertrauten Form der Kommasetzung oder des Punktes, durch den die Bruchteile der jeweiligen Zahl von der Zahl selbst abgetrennt werden. Die eingekreisten Zahlen waren damit überflüssig, aber das Prinzip der aufeinanderfolgenden Zehnerpotenzen war zu diesem Zeitpunkt bereits etabliert. Die irrationale Kreiszahl, in Napiers System dargestellt als 3.1416 (…), sieht in Stevins Notation so aus: 3(0)1(1)4(2)1 (3)6(4).
Im Jahr 1590 trat Stevin als Quartiermeister der Armee in den Dienst des Statthalters Prinz Moritz. Er beschäftigte sich mit militärischen Vermessungen und passte die Konstruktion italienischer Festungsbauten aus der Renaissancezeit an die geografischen Bedingungen der Niederlande an. Die ursprünglichen Trockengräben ersetzte er dabei durch Kanäle oder Wassergräben und errichtete die fortschrittlichsten Festungsanlagen Europas an der sich ständig verschiebenden Südgrenze zwischen der Republik der Niederlande und den Spanischen Niederlanden. Im Jahre 1600 gründete Stevin auf Wunsch des Statthalters eine Schule für Ingenieure in Leiden. Dort wurde, auf seine Entscheidung hin, Unterricht auf Niederländisch statt Latein erteilt. Die Ingenieurskunst war bald als »dytsche mathematycke« oder niederländische Mathematik bekannt.4 Der berühmteste Lehrer der Schule war Frans van Schooten, dessen gleichnamiger Sohn später Christiaan Huygens in Mathematik unterrichtete.
Stevin ging es in erster Linie um den praktischen Nutzen seiner Arbeiten, und auch rein mathematische Disziplinen wie die Geometrie sollten dem Wohl der ganzen Nation dienen. Durch die Veröffentlichung seiner Lehrbücher hoffte er, dass viele seinem Beispiel folgen würden.5 Eines dieser Bücher, verfasst für Prinz Moritz, Van de Deursichtighe (»Über die Perspektive«), ist bemerkenswert wegen der ausschließlich rationalen Analyse künstlerischer Geheimnisse und enthält unter anderem den Entwurf für ein Gerät zum räumlichen Sehen; auf einer Glasplatte konnte man akkurat die sich dahinter befindende Szene wiedergeben. Prinz Moritz zeigte sich so beeindruckt von dieser Idee, dass er sich ein solches Modell anfertigen ließ.
Stevins wichtigstes Vermächtnis sind jedoch weder der Segelwagen noch die Dezimalzahlen, sondern die Einführung einer Wissenschaftssprache in den Niederlanden. Er veröffentlichte seine Schriften in der Landessprache, damit Bauherren, Handwerker und Händler sie lesen konnten. Beispielsweise widmete er De Thiende den »Sternenbeobachtern, Landmessern, Tuchmessern, Weinmessern, Messleuten im Allgemeinen, Münzmeistern und allen Kaufleuten«.6 Dass er nur wenige Jahre nachdem sich die Nordprovinzen von der spanischen Krone getrennt hatten, in Niederländisch schrieb, war auch ein stolzes Bekenntnis zur nach wie vor bedrohten Unabhängigkeit seines Heimatlandes.
Und dabei ließ es Stevin nicht bewenden. In Beghinselen der Weeghconst (»Prinzipien des Wiegens«, 1586) formulierte er seine Überzeugung, das Niederländische sei die ideale Wissenschaftssprache, weiter aus. Er kam zu diesem Schluss, weil das Niederländische über eine ungewöhnlich große Anzahl an einsilbigen Wörtern verfügt, die sich nötigenfalls zu längeren Wörtern zusammensetzen lassen. Stevin vertrat sogar die ziemlich steile These, die Menschen hätten sich in einer imaginären wijsentijt, dem Zeitalter der Weisheit lange vor dem antiken Griechenland, als der Mensch noch allwissend war, miteinander auf Niederländisch verständigt.7
Stevins Begriffe, mit denen er die einzelnen Bereiche der Naturwissenschaften bezeichnete, spiegeln seine Argumente wider.8 Physik bezeichnet er als natuurkunde, also das Wissen über die Natur. So gut wie keine andere Sprache außer dem Niederländischen hat einen eigenständigen, nicht vom griechischen physika abgeleiteten Begriff für Physik. Andere Wortschöpfungen sind noch ehrgeiziger und erheben nicht nur Anspruch auf die Urheberschaft über einen Zweig der Wissenschaft, indem sie den griechischen oder lateinischen Namen verwerfen, sondern auch, indem sie auf einen subtilen Zusammenhang zwischen dem Nachweisbaren und dem Wissenschaftlichen verweisen. So wird die Mathematik zur wiskunde, was man als Lehre des gesicherten Wissens übersetzen kann. Chemie ist die scheikunde, also die Lehre vom (Unter-)Scheiden, ein Hinweis auf den sich abzeichnenden Richtungswechsel hin zu einer analytischen Wissenschaft und eine höchst sinnvolle Alternative zum Begriff Chemie, denn die etymologische Nähe zur unseriösen Alchemie wird aufgehoben.
Zum Vergleich: Das Oxford English Dictionary nennt 1605 als das Jahr, in dem chemistry zum ersten Mal im Englischen auftaucht, zeitgleich mit Stevins wissenschaftlichen Fachbegriffen; im Englischen bezeichnet der Begriff sowohl die Alchemie als auch die gerade entstehende Wissenschaft der Chemie. Bis heute muss sich das englische chemistry mit wenig hilfreichen sekundären Bedeutungsebenen wie »geheimnisvolle Wirkung oder Verwandlung« und »instinktive Anziehung« zwischen zwei Menschen herumschlagen. Die »Astronomie« hat ähnliche Probleme. Ursprünglich, als ein Teilbereich der sogenannten klassischen freien Künste (Quadrivium), bezeichnete der Begriff die Wissenschaft von der Bewegung der Sterne und Planeten sowie deren Einfluss auf Natur und Mensch — eingeschlossen jener Pseudowissenschaft, die wir als Astrologie bezeichnen. Das Englische kämpft immer wieder gegen diese frühere Doppelbedeutung an; Stevins Begriff der sterrenkunde, der Sternkunde, umschifft das Problem dagegen elegant.
Stevin erfand oder warb auch für unzweideutige, beschreibende Begriffe innerhalb der von ihm benannten Disziplinen, beispielsweise driehoek (Dreieck) statt Triangel und lanckrondt (Langrund) statt Ellipse. Ein Trapez wird zum bijl, das niederländische Wort für Axt, und damit wesentlich anschaulicher.9 Wahrscheinlich ist kein Begriff so kennzeichnend für Stevins vor allem praktisches Verständnis von Wissenschaft wie seine etwas verschmitzte Wortwahl für »Theorie«, nämlich spiegeling.10 Wörtlich übersetzt also »Spiegelung«, etwas freier und taktvoller auch »Reflexion«; und noch freier, aber provokanter einfach nur »in der Kristallkugel lesen«.
Wollte man Stevin als den Prototypen bezeichnen, wäre Christiaan Huygens das ausgereifte Produkt. Stevin hatte den Beweis geliefert, dass sich auch außerhalb der Universität ein intellektuell äußerst ergiebiges Leben führen ließ, vorausgesetzt, es fand sich ein entsprechender Mentor. Wie Stevin war Huygens vor allem am praktischen Nutzen seiner Arbeit gelegen. Seine Arbeit beruhte, wie die von Stevin, auf grundlegenden mathematischen Methoden in den Grenzbereichen zwischen Mechanik, Geometrie und Optik. Ein vielseitiger niederländischer Mathematiker bestellte gleichsam das Feld für seinen Nachfolger in genau den Wissenschaftszweigen, in denen der andere es später zu höchsten Ehren bringen sollte. Ein halbes Jahrhundert nach Stevin wird man Huygens als den größten Mathematiker, Astronomen und Physiker seiner Zeit feiern.
Einige berauschende Jahrzehnte lang, als das 16. Jahrhundert unter ziemlichem Getöse ins 17. überging, wurde Middelburg endlich seinem Namen gerecht. Unversehens war es nicht nur die zentrale Festungsstadt des von Dünen umschlossenen Walcheren, eine der sechs Inseln, aus denen die Provinz Zeeland zum größten Teil besteht, sondern entwickelte sich auch für kurze Zeit zum geschäftlichen und kreativen Zentrum der Niederlande. Kunst und Wissenschaft erlebten einen gewaltigen Aufschwung.
Die Bevölkerung von Middelburg verdoppelte sich von 1570 bis 1600 auf 20.000 Einwohner und wuchs bis 1622 um weitere 5000.11 Damit war Middelburg größer als Delft und Dordrecht und die viertgrößte Stadt der nördlichen Niederlande nach Amsterdam, Leiden und Haarlem. Grund für den Aufstieg und Wohlstand der Stadt war ihre geografische Lage — wieder lag sie in der Mitte — während des Achtzigjährigen Krieges, der schließlich zur Gründung der unabhängigen Republik der Niederlande führte.
Der Krieg war im April 1568 ausgebrochen, als Wilhelm I. von Oranien aus dem selbst erwählten Exil in Deutschland zurückkehrte und mit einer Söldnerarmee den Versuch unternahm, den Herzog von Alba, den Philipp II. zum Generalgouverneur ernannt hatte, aus dem Land zu vertreiben. Den Aufständischen, bekannt als geuzen (Bettler), war es innerhalb kurzer Zeit gelungen, den Spaniern durch mehrere Anschläge einige schwach verteidigte Häfen abzunehmen, und eine zunehmende Anzahl von Städten geriet unter den Einfluss der Protestanten. Nach langer Belagerung schloss sich Middelburg im Jahr 1574 den Protestanten und Prinz Wilhelm an. Die große Abtei im Zentrum der Stadt wurde besetzt und zum Verwaltungssitz der Provinz Zeeland erklärt. Im Zeeuwsmuseum in Middelburg, inzwischen in einem Teil des Klosterkomplexes untergebracht, stellt ein anonymes allegorisches Gemälde die niederländischen Provinzen als kniende, blonde Frauen in Ketten vor dem Herzog von Alba dar, der unter dem üppig mit Folterwerkzeugen dekorierten Baldachin thront, während ein ganz in Rot gekleideter Kardinal mit einem Blasebalg Ego und Ärger des Herzogs anfacht.
Albas brutale Repressionsmaßnahmen gegen alle Städte, die mit dem Protestantismus sympathisierten, dauerten an. Besonders hart griff er in Antwerpen durch, dem mächtigsten europäischen Wirtschaftszentrum der damaligen Zeit: Am 4. November 1576 liefen die unbezahlten, ausgehungerten spanischen Söldner Amok, und es kam zur »Spanischen Furie«, als sie die Stadt plünderten, in Brand setzten und ein Massaker unter den Bewohnern anrichteten. Nach dieser Gräueltat schloss sich Antwerpen dem Norden und dem zerbrechlichen »Religionsfrieden« an, den Wilhelm von Oranien versprach, als man ihn 1581 zum Statthalter der sieben niederländischen Provinzen ernannte.*3
1585 fiel Antwerpen abermals an die Spanier, als der Stadt durch die Blockade der Schelde, über die der gesamte Handel abgewickelt wurde, eine Hungersnot drohte. Man zwang Protestanten zum Verkauf ihres gesamten Besitzes, und beinahe die Hälfte der 80.000 Drucker und Finanziers, Goldschmiede und Maler, Gewürz- und Kleiderhändler — die angesehensten Mitglieder der insgesamt über 100 Gilden — flüchtete im Lauf der folgenden vier Jahre Richtung Norden.12 Der erste Ort, an dem sie eintrafen und hoffen durften, ihr bisheriges Handwerk weiterzuführen, während sie darauf warteten, dass in Antwerpen wieder das normale Leben zurückkehrte, war das nur knapp 80 Kilometer entfernte Middelburg.
Zuvor hauptsächlich das Zentrum für Weinimport, verfügte die Stadt mit einem Mal über eine Vielzahl neuer »reicher Geschäftszweige« und machte das Beste aus diesem Zustrom an Künstlern und Händlern. Eine »illustre Schule«, seinerzeit eine Art Hochschule, wurde 1592 gegründet. Niederlassungen der niederländischen Ost- und Westindienkompanie wurden eröffnet, deren Schiffe Gewürze, Porzellan, seltsame, unbekannte Tiere und Pflanzen brachten. Diese aufregenden Entdeckungen blieben nicht ohne Auswirkung auf die betuchten Familien der Stadt, und das Interesse für Themen wie Alchemie und Botanik, Mathematik oder Kochkünste stieg sprunghaft an. Ein Bürger, Jehan Sommer, ließ sich trotz seiner Krücken nicht davon abhalten, Seereisen ins östliche Mittelmeer zu unternehmen. Von seinen Reisen kehrte er mit einer Reihe exotischer Blumen zurück, die er in seinem Garten in Middelburg anpflanzte. Eine dieser Pflanzen war die Tulpe, und später sollten enthusiastische Liebhaber astronomische Summen für die unscheinbaren Knollen ausgeben.13
Seit 1540 gab es Glashütten in Antwerpen.*4 Venezianische Glasmacher hatten das seit Jahrhunderten gehütete Geheimnis der Produktion aus Murano mitgebracht.14 Im Jahr 1582, als sich der emigrierte Antwerpener Govert van der Haghen mit seinen italienischen Angestellten in Middelburg niederließ und am Kousteensedijk, am Stadtrand, eine Hütte eröffnete (Produktionsstätten mit Feuerung lagen aus Sicherheitsgründen meist außerhalb der Stadt), besaß die Stadt als erste in den nördlichen Niederlanden eine eigene Glasproduktion.15
Zuvor war das Glas in den Niederen Landen »grob und körnig«.16 Venezianisches Glas bezeichnete man dagegen wegen seiner Ähnlichkeit mit Bergkristall (Quartz) und weil es farblos und vollkommen transparent war, als cristallo. Der wichtigste Bestandteil der Glasproduktion ist Sand, der bis zum Schmelzpunkt erhitzt wird — in den niederländischen Glashütten benutzte man dafür wahrscheinlich Torffeuerung.17 Der Schmelzpunkt wird durch die Beigabe von Alkalien gesenkt, die als Flussmittel wirken und aus Pflanzenasche, die Pottasche oder Soda enthält, gewonnen werden. Die Asche ist außerdem reich an Kalk, der die Sprödigkeit des Glases reduziert. Durch Muschelschalen lässt sich der Kalkanteil der Mischung erhöhen. Manchmal gibt man der Mischung ein manganhaltiges Mineral bei, dessen scharlachrote Färbung den Grünstich aufhebt, der aufgrund der Eisenanteile im Sand auftreten kann.
Die Glasmacher in Murano arbeiteten mit speziellen Zutaten — Sand aus dem Tessin, ein Zufluss des Po aus den westlich von Mailand gelegenen Alpen; die Asche einer Salzkrautgattung namens Barilla, die man aus Syrien importierte; und Mangan aus Gruben im Piemont.18 Für Glasmacher im Norden Europas standen diese Zutaten nicht zur Verfügung, glücklicherweise ist Glas jedoch ein flexibles Material, und seine Herstellung steht und fällt nicht mit ganz bestimmten Zutaten oder präzisen Mischungen. Asche ließ sich auch aus dem Tang der Nordsee und Sumpfpflanzen gewinnen. Die Pigmente der Maler, die in den Niederen Landen so kunstvoll eingesetzt wurden, enthielten ebenfalls Manganoxide — Maler und Glasmacher gehörten daher auch derselben Gilde an.19 Und Sand gab es in Hülle und Fülle: Dünen, so hoch wie Bäume, umschlossen nur wenige Meilen entfernt die Stadt.
Man ist versucht, die Gründe für Middelburgs ebenso plötzlichen wie unerwarteten Beitrag zur Entwicklung im Bereich der Optik auch in den Gegebenheiten der Stadt selbst zu suchen, etwa in besonderen Eigenschaften des Sandes, jenem »prägendsten Merkmal der niederländischen Landschaft«, wie der Chemiker und Philosoph André Klukhuhn es formuliert hat.20 Doch bevor wir den Beweis für die Besonderheit Middelburgs antreten, sollten wir bedenken, dass die meisten größeren und kleinen Städte an der niederländischen Küste ebenfalls auf Sand gebaut und von schützenden Dünen umgeben waren. Warum also kam es nicht in Brügge, Den Haag oder Haarlem zu diesen Entdeckungen? Wesentlicher Bestandteil für die Herstellung von feinem Gebrauchsglas oder optischem Glas ist Sand mit geringem Eisenanteil, denn sonst kann nur dunkelgrünes oder braunes »Waldglas« produziert werden, das sich lediglich für Flaschen eignet. Ein solches Glas hätte an jedem der genannten Orte hergestellt werden können. Aber das war nicht der Fall. Und obgleich Sand recht problemlos von überallher angeliefert werden konnte — Schiffe führten das Material häufig als Ballastladung mit —, benutzte Govert van der Haghen höchstwahrscheinlich Sand aus der Nähe von Middelburg in seinem Ofen in Kousteensedijk, und seine Glasmacher aus Murano kannten sich mit der Herstellung aus.21 In seiner Hütte entstand bald hochtransparentes Glas, das sich in Spiegeln, Glasperlen und Brillen für die begeisterten Bürger der Stadt verarbeiten ließ.
Noch wichtiger als das Rohmaterial selbst war daher letztlich das wirtschaftliche und kulturelle Umfeld in Middelburg, entstanden durch den kosmopolitischen Zustrom von Flüchtlingen aus Antwerpen, der neue Entdeckungen begünstigte. Ein neuer Geist breitete sich von hier in den gesamten Niederlanden aus und schuf die Grundlagen für das heraufziehende sogenannte Goldene Zeitalter. Im ausgehenden 16. Jahrhundert waren die Notabeln von Middelburg schlau genug, um zu erkennen, dass ihr großer Moment gekommen war, und entschlossen, nichts unversucht zu lassen, um ihn so lange wie möglich auszukosten. Im Jahr 1591 verlieh die Provinz Zeeland Govert van der Haghen das lokale Glasmacherpatent und dazu einen zinsfreien Kredit, damit er nicht nach Amsterdam abwanderte. Durch dieses weitsichtige Handeln sicherte sie ihrer Stadt einen Platz in der Geschichte der Wissenschaft.
Die Middelburger Glashütte war bereits gut etabliert, als im Jahr 1594 ein deutscher Immigrant namens Hans Lipperhey direkt neben der Kirche St. Nicholas seinen Optikerladen eröffnete und Glas zur Brillenherstellung kaufte. Seine Geschäftsräume befanden sich in Bestlage; Markt, Münze und die »illustre Schule« lagen allesamt in unmittelbarer Nähe der Kirche. Damit hatte er die meisten seiner potenziellen Kunden, die arbeitsbedingt viel lesen mussten und daher eventuell Brillen benötigten, direkt vor der Haustür. Sein rasch wachsender Kundenkreis beförderte ihn bald in den Mittelpunkt eines Netzwerkes der Mächtigen und Gebildeten, das sich innerhalb der niederländischen Provinzen und über sie hinaus erstreckte.
Brillengläser ließen sich auf unterschiedliche Arten herstellen. Eine Methode bestand darin, eine braune Glaskugel in konvexe Fragmente zu brechen, aus denen wiederum tellerähnliche runde Formen geschnitten wurden (dünnes Glas lässt sich, jedenfalls grob, mit der Schere schneiden, was zum Schutz vor absplitternden Teilen häufig unter Wasser geschieht). Diese runden Scheiben wurden durch den Schliff der einen oder anderen Seite entweder zu konvexen oder konkaven Linsen geformt. In jedem Fall war die Oberfläche der ursprünglichen Glaskugel nicht gleichmäßig gekrümmt, was mitunter zu optischen Verzerrungen führte. Statt der Kugel benutzte man daher auch Flachglas als Ausgangsmaterial, dessen eine Seite garantiert plan war und Verzerrungen ausschloss. Die andere Seite ließ sich dann einfacher und mit besserem Resultat in die gewünschte Form schleifen.
Lipperhey hat mit Sicherheit beide Möglichkeiten gründlich erforscht. Er stellte dabei fest, dass seine Linsen zur Mitte der Glasscheibe hin von guter Qualität waren, die jedoch an den Rändern deutlich nachließ. Er bemerkte außerdem, dass sich die Gläser optisch verbessern ließen, wenn er den Lichteinfall am äußeren Linsenrand durch einen nicht lichtdurchlässigen Ring blockierte. Bereits seit dem 16. Jahrhundert war bekannt, dass man vergrößerte Bilder herstellen konnte, wenn man zwei Linsen — eine konvexe und eine konkave — in einem gewissen Abstand voneinander platzierte und von Nahem durch eine der beiden hindurchblickte. Solche Bilder waren jedoch verschwommen. Lipperhey konstruierte ein Rohr mit zwei Linsen — einer konvexen Objektivlinse und einer konkaven Okularlinse — und fügte eine Teilblende ein, die den Lichteinfall in den äußeren Bereich der Objektivlinse verhinderte. Erneut stellte er fest, dass die Helligkeit zwar abnahm, weil weniger Licht durch die Linse einfiel, die Schärfe des Bildes jedoch deutlich zugenommen hatte. Durch das schlichte — wenn auch zunächst den Erwartungen widersprechende — Einsetzen der Blende in den Lichtstrahl hatte Lipperhey ein praktisch verwendbares Fernrohr entwickelt.22
Am 25. September 1608 erhielt Lipperhey ein Empfehlungsschreiben der Zeeländischen Verwaltung, die ihm gestattete, seine »die Sicht betreffenden Gläser« der Regierung in Den Haag vorzustellen, wo er auf ein Patent hoffte.23 Seite an Seite mit Prinz Moritz von Nassau, dem Statthalter und zukünftigen Prinzen von Oranien, und dessen Halbbruder und späterem Nachfolger Friedrich Heinrich erklomm Lipperhey wenige Tage später die große Eichentreppe im neuen Turm des Binnenhofes, dem Palast des Statthalters in Den Haag. Ebenfalls mit dabei waren Johan van Oldenbarnevelt, der wichtigste Berater des Prinzen und Chefunterhändler der Dreierallianz der jungen, aufstrebenden Nation mit Frankreich und England gegen Spanien, sowie Ambrogio Spinola, genuesischer Kommandant der spanischen Streitkräfte in den Niederlanden, der bereits seit fast einem Jahr über einen Waffenstillstand in dem langen Krieg verhandelte. Die wissenschaftliche Präsentation muss für die anwesenden Entsandten und Generäle eine willkommene Abwechslung gewesen sein.
Und sie wurde ein triumphaler Erfolg für Lipperhey. Die Männer hätten bis zum Kirchturm in Delft gesehen, mehr als acht Kilometer weit entfernt, hieß es später, und im Licht der untergehenden Sonne vielleicht sogar die Kirchenfenster im noch weiter entfernten Leiden erspäht. Mit dem Fernrohr ließen sich kleinere Objekte innerhalb von zwei oder drei Kilometern genau erkennen und am Nachthimmel Sterne sehen, die vorher dem bloßen Auge verborgen geblieben waren. Hätte Moritz etwas von der militärischen Brisanz des Instrumentes geahnt, das ihm da vorgestellt werden sollte, hätte er seine Feinde wohl kaum zu der Präsentation eingeladen. Jeder auf dem Turm des Binnenhofes erfasste sofort das militärische Potenzial der Erfindung. Spinola bemerkte: »Von jetzt an werde ich nie mehr in Sicherheit sein, denn Ihr könnt mich von Weitem sehen.«24 Woraufhin Moritz ihm versprach, dass seine Soldaten, wenn sie Spinola tatsächlich erspähen sollten, Befehl erhalten würden, nicht zu schießen.
Eine Woche darauf, nach genauer Prüfung des Instrumentes, zahlten die Generalstaaten Lipperhey300 Gulden für seine Erfindung, allerdings unter der Bedingung, dass er ein Doppelfernrohr herstellte und dafür ein noch klareres Glas verwendete.25 Er lieferte das Gewünschte innerhalb weniger Monate und wurde mit weiteren 600 Gulden belohnt. Der französische Botschafter wusste, was die Stunde geschlagen hatte, und gab ebenfalls ein Fernrohr bei Lipperhey in Auftrag. Doch der Vertrag des Middelburgers mit den Generalstaaten untersagte ihm vernünftigerweise, mit anderen Auftraggebern zusammenzuarbeiten. Lipperhey hatte zwar zunächst versucht, den Preis für jedes Fernrohr auf 1000 Gulden anzuheben, aber 300 Gulden waren in jedem Fall ein stattlicher Betrag. Er konnte damit sofort das Haus seines Nachbarn in Middelburg kaufen, das er auf den Namen »De Drie Vare Gesichten« (Die Drei Weiten Blicke) taufte.26
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen der Niederländer machte die Nachricht von der neuen Erfindung schnell die Runde, als die europäischen Diplomaten von den Friedensverhandlungen in Den Haag in ihre Heimatländer zurückkehrten. In Den Haag war bald ein Schreiben im Umlauf, das auf »gewisse ›lunettes‹« anspielte, die dem Prinzen Moritz präsentiert worden seien und durch welche man drei oder vier Wegstunden entfernte Objekte so deutlich erkennen könne, »als seien diese nur 100 Schritte entfernt«.27 Innerhalb weniger Wochen gelangte das Schreiben bis nach Paris, und es dauerte nicht lange, bis europäische Herrscher, Prinzen und Gelehrte ihr eigenes Fernrohr besaßen. Der französische Botschafter war zwar nicht mit Lipperhey ins Geschäft gekommen, wusste sich aber zu helfen: Er wandte sich einfach an einen französischen Soldaten, der gegen die Niederländer kämpfte; die setzten das »Weit-Sicht« bereits im Feld ein, und er kam auf diese Weise an die geheimen Informationen über den Entwurf.28
Schon im darauffolgenden Frühjahr konnte man sogenannte Spionbrillen in Paris kaufen, und bald darauf auch bei Galileo in Padua. Der nahm einige Verbesserungen vor, erklärte sich selbst zum Erfinder, stellte Dutzende Prototypen her und reichte seine verworfenen Versuche weiter; der Kreis von Personen, die über das neue Instrument Bescheid wussten, erweiterte sich damit rasant. Im Januar 1610 beobachtete Galileo mit seinem perspicillum oder occhiale vier Monde um den Jupiter und entdeckte die ersten neuen Objekte im Sonnensystem seit der Antike. Und im darauffolgenden Jahr veröffentlichte Johannes Kepler in Prag die erste theoretische Analyse dieser äußerst praktischen Erfindung, die man inzwischen als »Teleskop« bezeichnete.
Die Rolle Middelburgs in dieser Geschichte ist bisher noch nicht vollständig geklärt. Da inzwischen mehrere Antragsteller das Recht auf die Erfindung für sich beanspruchten, gewährten die Generalstaaten Lipperhey verständlicherweise keinen Patentschutz. Einer dieser Nebenbuhler war Zacharias Jansen, Lipperheys Nachbar in Middelburg, der nicht den besten Ruf hatte und als Trinker und Fälscher galt. Nichtsdestotrotz glaubte man Jansen, als er behauptete, er selbst habe das Teleskop bereits erheblich früher, nämlich um 1590, erfunden. Das hatte er vor allem der geschickten Mythenbildung seines Sohnes Johannes Sachariassen zu verdanken, der sich später ebenfalls als Linsenschleifer und Brillenmacher selbstständig machte. Wie dem auch sei, fest steht nur, dass Jansen im Jahr 1590 noch ein Kind war. Höchstwahrscheinlich hat der zwielichtige Jansen Lipperheys Arbeit 1608 gesehen, sie eilends kopiert und dann die günstige Gelegenheit gewittert, sich zu bereichern.29
Middelburg war damals offenbar eine wahre Brutstätte für optische Erfindungen. Das Brillengeschäft blühte, und Produzenten und Konsumenten konnten ungehindert die Möglichkeiten der neuen Technologie erforschen, entweder um sich zu zerstreuen oder um ihren Wissensdurst zu löschen. Neugierige aus allen Berufszweigen besuchten die Stadt, vom fortschrittlichen kopernikanischen Pfarrer wie Philippus Lansbergen bis hin zum Dichter Jacob Cats, der 1621 zum Stadtrichter ernannt wurde.
In Cats’ Scherzgedicht »Cupido brilleman« (Cupido, der Brillenmacher) schildert ein Teleskopmacher der Stadt, wie Cupido eigenhändig das Fernrohr ergreift, um seine Kuppeleien voranzutreiben: »Hy is nu enckel spot, die eerst de spotter was« (Ein ferner Fleck ist er, der früher Spötter war).30 Das Wortspiel bezieht sich auf die Größenänderung des Beobachteten und des Beobachters, ist aber auch — das geht in der Übersetzung verloren — satirisch gemeint, denn spot bedeutet im Niederländischen sowohl Fleck als auch Spott.
2Dieser Stich, auf dem Cupido und Venus am Horizont nach Liebespaaren spähen, gilt als erste Abbildung des Teleskops in den Niederlanden.
Nur zwei Wochen nach Lipperheys Audienz in Den Haag meldete ein gewisser Jacob Metius aus Alkmaar ebenfalls glaubhafte Ansprüche auf die Erfindung an; Metius, ein Sohn des Adriaen Metius, des Militäringenieurs von Wilhelm I. von Oranien, und Bruder des Mathematikprofessors der Universität Franeker.31 Vermutlich war sein Gerät nicht ganz so leistungsfähig wie das Lipperheys, denn man schickte ihn mit lediglich 100 Gulden und der Anweisung, den Apparat zu verbessern, wieder davon. Vielleicht hatte Metius Middelburg ja ebenfalls einen Besuch abgestattet, obwohl es weit entfernt von Alkmaar lag, denn er beklagte immer wieder die mangelnde Qualität des Glases in seiner Heimatstadt, und Middelburg lieferte bekanntlich das beste Glas.32 Mag sein, dass er bei einem solchen Besuch dem besten Brillenmacher vor Ort, Hans Lipperhey, etwas zu offenherzig von seinen Ideen erzählt hat.
Die Vermutung, Metius sei der eigentliche Erfinder des Teleskops gewesen, wurde später, als René Descartes ihn in seiner 1637 erschienen Abhandlung über Optik erwähnte, noch zusätzlich bestätigt.*5 Vermutlich hatte Descartes durch Metius’ Bruder davon erfahren, mit dem er gemeinsam in Franeker studierte.33 Descartes zeigte sich dennoch von der Vorstellung bestürzt, dass ein reiner Handwerker ohne jede wissenschaftliche Theorie auf eine derart bahnbrechende Entdeckung gestoßen sein könnte.34
Der rege Austausch zwischen Alkmaar und Middelburg geht auch auf einen gewissen Cornelis Drebbel zurück, einen außerordentlich produktiven Erfinder des 17. Jahrhunderts, der sich einen Namen machte, indem er »Perpetuum mobile«-Maschinen und andere wilde Ideen an den Höfen in London und Prag vorstellte. Drebbel stammte aus Alkmaar und war ursprünglich Kupferstecher. Als Zeitgenosse der Gebrüder Metius erlernte er möglicherweise von ihnen die Glasbearbeitung.35 Um 1600 zog er für einige Jahre nach Middelburg.36 Er entwarf einen Stadtbrunnen, entwickelte seine Fähigkeiten als Glasmacher stets weiter und tat sich insbesondere im Linsenschliff hervor, wobei ihm sein Erfindungsgeist zugutekam, denn er entwickelte einige Geräte, die Ergebnisse auf gleichbleibend hohem Niveau ermöglichten.
3Cornelis Drebbel, vielseitig begabter niederländischer Erfinder und Ingenieur, der das erste Unterseeboot auf der Themse zu Wasser ließ und Constantijn Huygens im Linsenschliff unterrichtete.
Als 1608 in Den Haag der Streit zwischen den rivalisierenden Antragstellern auf das Patent besonders heftig tobte, lebte Drebbel zwar bereits in London, stellte aber später gleichfalls Teleskope her, deren Erfinder, seiner Ansicht nach, Metius war.37
Drebbel, der seine Kenntnisse im Linsenschliff an Schüler weitergab, ist eine zentrale Figur in der Entwicklung der optischen Technologie. Einer seiner Schüler war Isaac Beeckman, dessen Familie, wie so viele andere, im Achtzigjährigen Krieg aus dem Süden nach Middelburg geflüchtet war.38 Beeckman, ebenfalls ein vielseitig begabter Mathematiker, erforschte die Wasserbautechnik, Medizin und Meteorologie; er war eng mit Descartes befreundet und ermutigte ihn zu seinen mathematischen