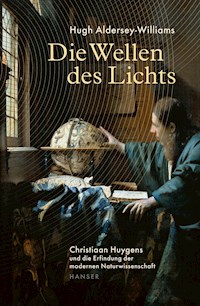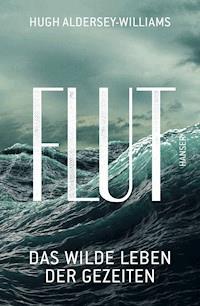
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Hälfte der Menschheit lebt an Küsten – trotzdem wissen wir wenig über die Elementarkraft der Gezeiten. Und das obwohl deren physische Präsenz uns seit jeher beeinflusst und vielleicht sogar unsere DNA miterschaffen hat. Schon Aristoteles brachte ihre Unberechenbarkeit zur Weißglut, und ihre potenziell zerstörerische Kraft wird die Menschheit auch in Zukunft betreffen. Hugh Aldersey-Williams beschreibt, wie der Mensch die Gesetze erforscht, denen das Wasser – und damit auch das Klima – unterworfen ist. Leichtfüßig verbindet er die Wissenschaft von Ebbe und Flut mit großen Erzählungen und Mythen. Nehmen Sie Platz, das maritime Drama mit einer Länge von 12 Stunden und 30 Minuten beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Seit jeher prägen die Gezeiten den Menschen, waren Projektionsfläche von Fantasie und Objekt der Wissenschaft. Im Jahr 322 vor Christus stürzte sich Aristoteles verzweifelt in die Wellen, so eine Überlieferung. Er konnte zwar erkennen, dass die Gezeiten nicht vom Wind bestimmt wurden, hinter ihr Geheimnis kam er jedoch nicht. Auch wenn viele der Mythen, die die Gezeiten umgeben, heute von der Naturwissenschaft aufgeklärt werden können, gibt es nach wie vor offene Fragen. Denn die Wissenschaft von den Ozeanen ist jung. Von Aristoteles über Galilei und Newton bis zu unserem modernen Verständnis von Ebbe und Flut ist die naturwissenschaftliche Erklärung der Gezeiten hier eingebettet in den kulturellen Kontext und verbunden mit Orten, die auf besondere Weise von den Gezeiten geformt wurden.
Der Autor porträtiert die faszinierendsten und am meisten gefürchteten Tide-Orte unseres Planeten – von den stärksten Gezeiten in Nova Scotia in Kanada bis zur zerfallenden Küste Ostenglands. Er beweist auf eindrückliche Weise, dass die Gezeiten eine Macht sind, die der moderne Mensch nach wie vor unterschätzt. Nehmen Sie Platz, das große maritime Drama mit einer Länge von 12 Stunden und 30 Minuten beginnt.
Hanser E-Book
Hugh Aldersey-Williams
FLUT
Das wilde Leben der Gezeiten
Aus dem Englischen von Christophe Fricker
Carl Hanser Verlag
INHALT
Vorbemerkung
Einleitung
Ein Blick auf entspannte Gezeiten
Dreizehn Stunden
Erste Ebbe
Der Schlick erwacht
Eine unberechenbare Macht
Jenseits des Mikromareals
Philosopher’s End
Mediterrane Gezeiten Skylla und Charybdis
Der Kaiser experimentiert Alexander und Pytheas
Ein größeres Reich
Ufer des Unwissens
Der König lädt zur Flut
Der Wortschatz der Gezeiten
Byrhtnoths letztes Gefecht
Die Schlacht davor
Bedas Zeitgefühl
Ein lösbares Rätsel
Auswegloses Wasser
Anderswo
Küstenlinien
Herzmuscheln
Grausame und unerhörte Strafen
Mönche des Mittelalters
Der Führer der Königin
Terra infirma
Galilei in der Klemme
Acqua alta
Flut über Flut
Die venezianische Barriere
Der Schlamm der Themse
Charles Dickens’ Fluss
Newtons Quaestiones
Die Himmelsleine
Auf der Jagd nach Monddaten
Dreckspatzen
Das Auf und Ab des Handels
Billighäfen
Spät erst reisen die Pilger
Teepreise, Teil I
Sur le flux et reflux de la mer
Frankreichs Newton
Entdeckungsreisen
Teepreise, Teil II
Ein Bild der Gezeiten
Ein Ort der Resonanz
Bore oder Börchen?
Die höchste Flut der Welt
Kunst und Kraft
Der viktorianische Alleswissenschaftler
In großen Wassern
Gerechtigkeit des Meeres
Liebe und Verlust
Die große Welle
Geheime Landung
Mitfahrgelegenheiten
Die Knutts kommen
Wettlauf der Grunions
Die Kalendermethode
Gezeitensinn
Ein Meer des Wissens
Über den Mahlstrom
Ein Platz in der Literatur
Prinz Breackans Kessel
Norden
Eine Brücke über schwerem Wasser
Der Nabel des Meeres
Mythos und Mathematik
Signal und Geräusch
Die Suche nach dem Meeresspiegel
Merkwürdigere Gezeiten
Isolierte Variable
Reförmchen
Klimaziele
Diluvion
Auf der Shinglestraße
Reiner Wahnsinn
Die Rückkehr des Meeres
Letzte Ebbe
Dank
Glossar
Abbildungsverzeichnis
Literaturauswahl und Quellen
Register
Für John
»Es ist gut, den Blick vom Gezeitentümpel
zu den Sternen schweifen zu lassen
und dann wieder zurück.«
John Steinbeck, Logbuch des Lebens
VORBEMERKUNG
Die Gezeitenstände, die einzelnen Abschnitten vorangestellt sind, wurden mithilfe der »Admiralty Easytide«-Webseite des britischen Hydrographischen Dienstes errechnet (www.ukho.gov.uk/easytide). Ausnahmen: die Werte für Dover, deren Quelle im entsprechenden Kapitel genannt wird, und die Angaben für Stockholm, die ich Martin Ekman verdanke.
Datumsangaben entsprechen in der Regel dem zur jeweiligen Zeit gebräuchlichen Bezugssystem (also zum Beispiel dem julianischen Kalender). Nur im Zusammenhang mit Gezeitenständen wurden alle Datumsangaben in den heutigen, gregorianischen Kalender übertragen.
EINLEITUNG
Wer an der Küste der nordenglischen Grafschaft Northumberland der Dammstraße durch das Watt und das Marschland folgt, um zur Burg und Abtei der heiligen Insel Lindisfarne zu gelangen, erreicht auf halber Strecke einen kleinen Unterstand. Hölzerne Stufen führen hinauf zu dieser Hütte auf Stelzen. Hinweisschilder an der Tür erklären, wozu das eigenartige Gebäude da ist. Es diene jenen Reisenden, die auf der fünf Kilometer langen Strecke von der Flut überrascht werden. Zwischen den Schildern hängt ein sonnenvergilbter Comic aus der Lokalzeitung. Man sieht eine auf dem Autodach kauernde Familie – das steigende Meerwasser schwappt schon an die Fenster. Ein Elternteil sagt zu dem anderen: »Ich wusste ja nicht, dass die Gezeiten auch Touristen betreffen.«
Auf den Britischen Inseln sind wir von Wasser umgeben. Es steigt und sinkt nach Gesetzen, die den meisten von uns ein Rätsel sind. Wir treiben in einem Meer, dessen Bewegungen wir nicht verstehen. Fast jeden Sommer zerren die Gezeiten an meinem Norfolker Küstenabschnitt ein Kind aufs offene Meer hinaus, das Tage oder Monate später meilenweit entfernt tot wieder angespült wird. Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Küstengegenden, die den Gezeiten ausgesetzt sind, und dennoch achtet kaum einer von uns, die wir unseren Lebensunterhalt nicht mit dem Meer verdienen, auf ihre eigenartigen Rhythmen und verborgenen Triebkräfte.
Deshalb verstehen wir auch nicht, warum der Vergnügungsdampfer am Sonntagmorgen nicht fährt, obwohl wir doch Wochenendpläne hatten. Wir verstehen nicht, warum der schöne Sandstrand, den wir noch von früher kennen, zu einem wenig einladenden Geröllfeld geworden ist. Wir verstehen nicht, dass ein einziger Gezeitenwechsel den Ausgang einer Seeschlacht oder eines Angriffs vom Meer aus entscheidend beeinflusst hat und dass wir deshalb so leben, wie wir heute leben, und die Sprache sprechen, die wir heute sprechen. Wir verstehen nicht, warum die Auster, deren Nährstoffzufuhr von den Gezeiten abhängt, früher einmal ein Arme-Leute-Essen war. Wir verstehen nicht, dass wir auf die beeindruckende Artenvielfalt der Gezeitenzone angewiesen sind, und wir vergessen allzu leicht, dass das Auf und Ab der großen Ozeane die Evolution selbst beeinflusst, weil es erst die Bedingungen dafür schuf, dass aus der richtigen Mischung chemischer Zutaten die ersten Organismen entstanden.
Die Gezeiten? Die sind doch so unwichtig, wie wenn in China ein Sack Reis umfällt! Oder eine Kiste Tee nicht richtig zu ist. Mit den Säcken und Kisten haben die Gezeiten vielleicht nicht so viel zu tun, wohl aber mit den Preisen, die man für Tee aus China bezahlen muss. Denn als die mit Tee beladenen Schiffe sich ein Wettrennen um das Kap der Guten Hoffnung lieferten, weil sie als Erste die neuesten Blätter nach London oder Boston bringen wollten, konnte der Gezeitenstand über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und nur wer als Erster einlief, konnte seine Fracht zu guten Preisen verkaufen. Die Gezeiten hatten immer wieder etwas damit zu tun, wo wichtige Meeresressourcen zu finden waren. Im Lauf der Jahrhunderte waren sie oft der Grund dafür, dass große Häfen hier statt dort entstanden und dann mehr oder weniger erfolgreich waren.
Meine prägende Begegnung mit den Gezeiten spielte sich vor der Isle of Wight ab, jenem geradezu absurd ruhigen Ort, an dem das Wasser an eine Spielzeuginsel voller Gartenzwerge und Modelleisenbahnen schwappt. Ich bin heute noch verblüfft, dass wir hier in tödliche Gefahr gerieten.
Wir segelten in jenem hölzernen Boot von Weymouth nach Yarmouth, das mein Vater in zwölfjähriger Handarbeit gebaut hatte. Die Entfernung von fast fünfzig Kilometern entsprach für unser kleines Gefährt etwa einer Tagesreise – ostwärts an der Küste von Dorset entlang, an der Isle of Purbeck (eigentlich eine Halbinsel) und an Bournemouth vorbei und dann durch den Needles Channel in den Solent, die Meerenge zwischen Isle of Wight und englischem Festland. Der Needles Channel ist schwierig zu navigieren. Auf der einen Seite liegen die Shingles, eine Reihe von Kiesbänken, auf der anderen die scharfen Felsvorsprünge der Isle of Wight. Die Strömung ist schnell, vor allem bei Hurst Point, einem weit ins Meer hinausragenden Stück Festland, wo sich das Wasser durch eine weniger als eine Meile breite Öffnung zwängt.
Auch weil es sich um eine der meistbefahrenen Schifffahrtsrouten der Welt handelt, gibt es hier jede Menge Bojen – rote backbord und grüne steuerbord sowie die sogenannten kardinalen Zeichen, die auf unter Wasser liegende Hindernisse hinweisen. Nichts davon ähnelt den weichen Plastikbojen, die man von Ankerplätzen in geschützteren Wassern kennt. Platziert werden sie von Trinity House, der für die Sicherheits-»Beschilderung« auf dem Wasser zuständigen Behörde. Für schwimmende Objekte sind sie ganz schön groß – besonders die kardinalen Zeichen sind imposante Stahlstrukturen: Bis zur Höhe eines Doppeldeckerbusses ragen sie als Gerüste aus den Wellen, und unter Wasser ist noch einmal ebenso viel Eisen in Schwimmkästen und Ballast versteckt. Sie haben einen Durchmesser von ungefähr drei Metern und wiegen sechs Tonnen. Kein Schiff legt sich gern mit ihnen an, egal, wie groß es ist. Für eine kleine Holzyacht gilt das erst recht.
Als Segler muss man sich vor dem Ablegen über die Wetterverhältnisse informieren, besonders über Windstärke und -richtung und die Gezeitenbewegungen unterwegs. Was unter günstigen Bedingungen nur ein paar Stunden dauert, kann bei widrigem Gezeitenstand unmöglich sein. Im Ärmelkanal läuft das Wasser, wie in den meisten Küstengewässern der Welt, etwa sechs Stunden auf und dann die nächsten sechs Stunden ab. Unsere fünfzig Kilometer lange Route war so lang, dass uns die Strömung nicht immer begünstigen würde.
Die Herausforderung bestand für uns darin, eine Abfahrtszeit zu wählen, bei der die Strömung möglichst lange in unsere Richtung wirkte, besonders dort, wo sie besonders schnell sein konnte. Sonst würden wir zum Stehen gebracht oder gar zurückgedrängt. Vor allem mussten wir so planen, dass das »Tidetor« bei Hurst Point uns nicht gefährlich werden konnte. Hier werden Fließgeschwindigkeiten von bis zu vier Knoten erreicht – so schnell konnten wir kaum segeln, und selbst unter Motor und in ruhiger See waren wir nicht so schnell.
Wir wussten alles, was wir wissen mussten. Wir hatten die richtigen Karten: Bill of Portland to The Needles und Solent: Western Approaches. Meine Mutter tat alles dafür, dass sie auf dem neuesten Stand waren, und trug Korrekturen, die sich aus den wöchentlichen »Admiralty Notices to Mariners« ergaben, mit einer besonderen, lilafarbenen Tinte ein. Wir hatten auch einen Gezeitenatlas, eine jener Broschüren, die einen vollständigen, zwölfstündigen Gezeitenzyklus für ein bestimmtes Gewässer zeigten – eine Seite für jede volle Stunde vor und nach dem Hochwasser. Pfeile verschiedener Stärke zeigten die erwartete Geschwindigkeit und Richtung der Strömung im gesamten abgebildeten Gebiet an.
Mein Vater rechnete und rechnete, und dann legten wir an jenem Septembermorgen um zehn nach acht bei ablaufendem Wasser in Weymouth ab. Der Plan: gegen die Strömung segeln, wo sie schwach war, nämlich in Weymouth Bay, dann durch Stillwasser und schließlich mithilfe der Strömung in den Solent. Wenn alles gutging, war uns die Strömung am Tor eine Hilfe. Vor Einbruch der Dunkelheit wären wir in Yarmouth.
Morgens kam kaum Wind auf, und wir mussten mehrere Stunden lang unter Motor fahren, bis eine sanfte westliche Brise uns anregte, den Spinnaker zu setzen. Wir kamen quälend langsam voran. Erst im Laufe des Nachmittags konnten wir im Dunst endlich die Konturen der Isle of Wight ausmachen.
Einige Stunden später passierten wir die Needles. Die Sonne ging schon unter. Wir waren gegen eine sanfte Strömung vorangekommen, nun aber hatte sie sich zu unseren Gunsten gedreht. Wir hielten Ausschau nach den nächsten Anhaltspunkten: Shingle Elbow würde backbord vor uns liegen, steuerbord eine Boje namens Bridge. Letztere war ein Kardinalzeichen am westlichen Ende einer unter Wasser verlaufenden Felsenkette, die von den Needles ausging (und sich, geologisch gesprochen, bis zu den Kreidefelsen von Purbeck erstreckte, die wir längst hinter uns gelassen hatten). Wenn wir die Bridge-Boje gut gesehen hätten, wären wir westlich daran vorbeigefahren, gemäß den aufeinander zu zeigenden Kegeln oben auf der Boje. Weil es aber schon fast dunkel war, erkannten wir die Boje nur an ihrem Licht, das auf der Karte als VQ (9)10s gekennzeichnet war. Das bedeutet, dass sie alle zehn Sekunden neun kurze Lichtsignale aussendet. Es war schwer zu sehen, wie weit sie entfernt war, aber allem Anschein nach ziemlich weit steuerbord.
Wir segelten langsam durch das zähe Wasser, das Licht der Boje kam mit jeder Blitzsequenz näher. Diese Lichtstrahlen blieben aber nicht, wie wir angesichts der uns vorwärts tragenden Strömung erwartet hätten, steuerbord hinter uns zurück, sondern standen uns in gleichbleibender Entfernung vor Augen. Alle zehn Sekunden wurden sie heller und größer, und sie blieben stur an derselben Stelle vor unserem Bug. Langsam dämmerte uns, was da geschah. Unser Boot glitt zur Seite, während wir vorwärtssegelten. Die Strömung brachte uns nicht in den Kanal, sie drängte uns ostwärts, auf die unter der Wasseroberfläche lauernden Felsen zu. Wir bewegten uns mit Absicht vorwärts und unabsichtlich seitwärts und im Ergebnis auf Kollisionskurs auf die Boje. Wir kamen allerdings kaum voran. Es wirkte so, als wäre die Boje viel schneller, und das begriffen wir auf einmal, denn wir hörten ihre »Bugwelle« näher kommen.
Vom Land aus hatte ich oft beobachtet, wie die Strömungen des Solent an den küstennahen Bojen zerrten, deren auf dem Meeresgrund verankerte Vertäuungen sie kaum festhalten konnten. Zwischen all dem Schaum wirkten sie wie hastige Fähren. Oft hörte ich, wenn es abends stürmte, beim Einschlafen den fernen Glockenton einer wellenumspülten Boje, obwohl sie eine ganze Meile weit entfernt war. Erbarmungslos wechselten die Gezeiten einander circa alle sechs Stunden ab, und all die Bojen pendelten wieder zurück. Kurz vor oder nach dem Gezeitenwechsel, beim sogenannten Stauwasser, lagen sie still und schwer im Wasser, als könnte keine Macht der Erde sie in so hektische Bewegung versetzen. Zweifellos würde die Bridge-Boje in ein oder zwei Stunden ebenfalls zur Ruhe kommen. Aber das nützte uns nichts.
Um gegen die Strömung anzukommen, setzten wir hektisch einen neuen Kurs, mein Vater stieß die Pinne um, wir anderen trimmten die Segel in der Hoffnung, uns enger an den Wind zu legen und die Boje zu überholen. Es funktionierte nicht. Noch immer hielt unser armes Holzboot auf sechs Tonnen Trinity-House-Stahl zu. Die nächste, »sehr schnelle« Lichtsequenz wirkte umso bedrohlicher. Mir wurde plötzlich klar, dass wir nicht auf der richtigen Seite vorbeikamen. Das Boot würde einfach zum Stillstand kommen. Wir wären völlig machtlos. Instinktiv griff ich nach der Pinne und zog sie entschieden luvwärts, sodass das Boot sich aus dem Wind drehte und wir auf der »falschen« Seite ganz knapp an der Boje vorbeischossen.
Weil wir in unserem Übermut dachten, dass man auf einem Schiff ein Logbuch führen muss, hatte einer von uns noch auf der kleinsten Exkursion alle Einzelheiten festgehalten: Wetterverhältnisse, Abfahrts- und Ankunftszeiten und so weiter. Manchmal war es etwas Aussagekräftiges wie die Geschwindigkeit, die wir in einem bestimmten Wind erreichten, indem wir dieses statt jenes Segel setzten, oder Informationen über die Anlegeplätze in einem unvertrauten Hafen. So mancher Messwert hatte damit zu tun, wie wir unter Motor möglichst schnell sein konnten. Wir notierten Propellersteigungen und Umdrehungszahlen, mit denen wir möglichst nah an die ersehnten vier Knoten kamen, die offenbar eine Art Höchstgeschwindigkeit waren. All das zeigte, dass wir irgendwie schon wussten, wie schnell die Strömung hier sein konnte und dass wir ihr unter Umständen hilflos ausgeliefert sein würden.
Über das Drama jener Septembernacht steht im Logbuch fast nichts. Eine Fahrt von 52,77 nautischen Meilen findet sich dort festgehalten, was fast dem Doppelten der eigentlichen Distanz entspricht. Wir hatten also einen Großteil der Fahrt mit einem langsamen Kampf gegen die Strömung zugebracht, die unserem Fortkommen eher im Weg stand, als ihm zu nützen. »Fast ganz dunkel«, steht unter 20.00 Uhr. »Beinahezusammenstoß mit Bridge-Boje aufgrund des Gezeitensinns, während wir uns an den Richtfeuern von Hurst orientierten.« Zwischen den Zeilen steht: Mit unserer Unerfahrenheit oder Unfähigkeit hatte das alles natürlich gar nichts zu tun! Wir taten schon das Richtige, indem wir uns an den Lichtsignalen orientierten. Der »Gezeitensinn« war schuld! Die Gezeiten, jene unberechenbare, bösartige, weltbewegende Macht …
Dies ist kein Buch über das Meer. Es geht nicht um Mast und Skorbut, Walfänger und Piraten, Schiffszwieback und Rum. Niemand kämpft hier gegen Hurrikane und Taifune. Es geht nicht um Männer, deren Schicksal es ist, ihr Leben lang über die Ozeane zu segeln, und auch nicht um Meerjungfrauen, die sie verführen. Es geht nicht um die tiefsten Tiefen und die oft eigenartigen Gründe, aus denen der Mensch die Auseinandersetzung mit ihnen sucht.
Und doch ist dies ein Buch über das Meer. Es geht um das Meer, das wir alle kennen: den Strand, die Küste, die letzten Ausläufer und Vorposten des Festlands. Das Meer, das wir im Urlaub aufsuchen und das wir doch kaum verstehen. Das Meer, auf dem wir uns vorsichtig bewegen und das uns auf geheimnisvolle Art und Weise körperlich und seelisch bewegt.
Die Gezeiten sind kompliziert, und manche meinen, dass die Mathematik sie am elegantesten erkläre. Aber auch wenn man die Symbole und Gleichungen nachvollziehen kann, spürt man in ihnen nicht das Auf und Ab der Meere und die Macht, die die Gezeiten über menschliche Vorstöße auf dem Meer haben. Die Gezeiten sind stärker als ein kleines Boot auf hoher See, aber manchmal auch stärker als unsere Wahrnehmung und unser Denkvermögen. Wer von Bord eines landnah in einem Gezeitengewässer vor Anker liegenden Bootes seinen Blick schweifen lässt, setzt sich eindringlichen Halluzinationen aus. Denn während die Strömung stark in die eine oder andere Richtung wirkt, scheint das Boot die Wellen ganz aktiv zu zerteilen, obwohl unser Verstand doch weiß, dass es sich gar nicht fortbewegt. Der Eindruck ist stark und verwirrend, und Lichteffekte auf dem strömenden Wasser oder das rhythmische Schaukeln des Bootes oder Hunger und Durst verstärken die hypnotische Wirkung noch. Wir blinzeln, um nüchtern zu werden, aber wenn wir die Augen wieder aufmachen, ist der Eindruck noch da: Ganz bestimmt bewegt sich das Boot vorwärts, einschließlich der Ankerkette, an der das Meer so beharrlich arbeitet wie ein Narwal mit seinem Stoßzahn.
Irgendwann stellt sich unser Gehirn auf das Trugbild ein. Zwischen all den funkelnden kleinen Wellen denkt es, dass das Wasser stillsteht und wir und das Boot und das ferne Land auf ein gemeinsames Ziel zurasen. Die Wasseroberfläche mag glatt wie Glas sein oder von der Strömung ganz leicht in Bewegung gebracht oder so aufgewühlt, wie wenn der Wind gegen die Strömung anweht und die Spannung zwischen Luft und Wasser kurze, steile Wellen aufwirft. Egal. Wir haben weiterhin den Eindruck, dass das Wasser eigentlich stillsteht. Welche riesige Macht könnte auch solche Wassermassen hin und her bewegen, ohne dass man irgendwo sieht, wie einer sich anstrengt?
Wir lernen natürlich in der Schule, dass der Mond und seine Gravitationskraft daran schuld sind, und als Erwachsene sind wir mit dieser Information zufrieden. Wir haken die Gravitation einfach ab und staunen allenfalls über moderne Verrücktheiten wie dunkle Materie oder die Quantentheorie. Aber die gigantische, unsichtbare Gravitationskraft erscheint uns dann doch sehr eigenartig, wenn wir einmal darüber nachdenken. In Ebbe und Flut haben wir einen sichtbaren, nassen und unbezweifelbaren Ausdruck dieser eigenartigen Kraft vor uns.
Bevor die Wissenschaft sich ihrer annahm, haben Mythen und Geschichten sie schon auf ihre Art verstanden. Schon weil die Gezeiten Seeleute wirklich in den Tod reißen, sind die Geschichten von Sirenen und die Tentakel von Kraken so spannend. Das Meer ist auf die Mithilfe böswilliger Kreaturen nicht angewiesen. Ungebildete Seeleute haben sie erfunden, weil sie eine glaubwürdige Geschichte erzählen mussten, damit keiner dachte, dass etwas so Banales und Berechenbares wie die Gezeiten einen Menschen umbringen könnten. Die fabelhaften Seeungeheuer auf den Rändern früher Weltumseglerkarten könnten doch unbekannte Tiefseefische sein, die die Gezeiten ans Licht gebracht haben, und die Gezeitenwellen mancher Flüsse haben ihnen den Namen eines Gottes oder Monsters eingetragen.
Die Wissenschaft hat inzwischen manches erklärt, aber die Geschichten leben weiter. Naturwissenschaftler beschäftigen sich mit den Geheimnissen der Ozeane, aber sie stehen noch ganz am Anfang: Die Meereskunde ist eine der jüngsten Wissenschaften, und ihr Arbeitsgebiet ist riesig. Auch bedeutet eine solche Beschäftigung nicht, dass wir die Meere zähmen. Theoretisch können wir die Gezeiten sehr genau vorhersagen, und zwar noch viel genauer, als wir sie je erfahren werden, denn in unser eigenes Erleben spielt noch vieles andere hinein. Warum sind wir also so besessen von der Präzision? Vielleicht weil die Gezeiten ein so gutes Beispiel für ein komplexes Problem sind, das eine genaue Lösung zu haben scheint. Wir kennen alle Teile, jetzt müssen wir nur noch das Ganze ausrechnen. Die Gezeiten sind eine unwiderstehliche mathematische Herausforderung, und wohl deshalb haben sie über Jahrhunderte hinweg die besten Physiker und Astronomen fasziniert. Aber auch aus praktischen Gründen gibt es einen Bedarf an Antworten, der über die Bedürfnisse von Seeleuten und Fischern hinausgeht, und diese Antworten sind für unser aller Zukunft relevant.
Dass es noch kein allgemein verständliches Buch über die Erforschung der Gezeiten gibt, hat seinen Grund. Das Thema wächst sehr schnell über das hinaus, was die Sprache erfassen kann. Die wenigen diesbezüglichen Bemerkungen in einem Exkursionsführer für die Salzmarschen Neuenglands tragen die trockene Überschrift: »Eine vielleicht für dieses Buch unnötig detaillierte Darstellung der Gezeiten«. Ich kann mir vorstellen, was der Autor durchgemacht hat. Mit ihren schönen und vielseitigen Gleichungen können Naturwissenschaftler effektiv arbeiten. In Ihrem und in meinem eigenen Interesse gehe ich aber einen anderen Weg.
Ich werde versuchen, die Geschichte der Gezeitenforschung von den Anfängen bis heute in Geschichten zu erzählen. Die Reise führt mich von den frühsten wissenschaftlichen Projekten des Aristoteles, der sich in die Wellen gestürzt haben soll, weil ihm die griechischen Gezeiten ein Rätsel blieben, über die faktenreicheren Untersuchungen von Galilei und Newton bis zu einem naturwissenschaftlichen Forschungsstand, der uns heute jene so genaue Voraussage der Gezeiten erlaubt, die über die Bedürfnisse von Seeleuten hinausgeht und die Auswirkungen unseres eigenen Handelns auf den so wasserreichen Planeten Erde sichtbar macht. Unterwegs legen wir auch in weniger bekannten Häfen an und lernen die Beiträge kennen, die zum Beispiel Beda der Ehrwürdige oder Thomas von Aquin zum Verständnis der Gezeiten geleistet haben. Beide waren nicht in erster Linie Wissenschaftler, konnten sich dem kosmischen Rätsel der Gezeiten aber auch nicht entziehen.
Den wissenschaftlichen Teil meiner Erzählung habe ich um zwei weitere ergänzt: einerseits um historische, künstlerische oder gänzlich fiktive Ereignisse, für die die Gezeiten eine wichtige Rolle spielen, andererseits um meine eigene Suche nach Orten, die von den Gezeiten geschaffen wurden. Durch diese beiden Aspekte will ich Ihnen zeigen, dass die Gezeiten nicht nur eine Herausforderung für die Wissenschaft sind, sondern auch eine physische und psychologische Macht ausüben, die aus unserer Kultur nicht wegzudenken ist. Die Gezeiten haben Schlachten beeinflusst und Dichter und Künstler inspiriert und tun dies bis auf den heutigen Tag.
Ich weiche manchmal von der Chronologie ab, um thematische Querverbindungen aufzeigen zu können. Was ich aus wissenschaftlicher Perspektive sage, ist hoffentlich leicht zu verstehen, ohne eine unzulässige Vereinfachung darzustellen. Dies ist kein Schulbuch, sondern ein Buch der Reisen und Geschichten. Ich würde mich freuen, wenn Sie seinen Rhythmen folgen könnten. Gegen die Gezeiten sollte man sich nicht auflehnen.
Was ist älter, die Zeit oder die Gezeiten? Da gibt es keine klare Antwort. Beide Wörter haben ähnliche Wurzeln. Tide und Zeit sind phonetisch miteinander verwandt. Im Englischen hatte tide früher nicht unbedingt etwas mit dem Meer zu tun, eher mit wichtigen Zeitpunkten oder Zeiträumen, und einige etwas altertümliche Bezeichnungen haben sich im kirchlichen Kalender gehalten: Whitsuntide ist im gehobenen Wortschatz Pfingsten (das man auch »Whitsun« nennen kann). Das altenglische heahtid ist »Hoch-Zeit« im Sinne eines Feiertags. Für alle, die am Meer leben und deren Schicksal vom Meer abhängt, hatte tide aber immer mit Hoch- und Niedrigwasser zu tun.
Im Englischen bezeichnet tide wohl erst seit dem 14. Jahrhundert die Gezeiten. Damals ergänzte dieser mittelalterliche Neologismus die aus dem Altnordischen und Urgermanischen stammenden Wörter ebba und flod, Ebbe und Flut, die wahrscheinlich sogar indogermanische Wurzeln haben. Flut ist im engeren Sinne das auflaufende Wasser. Die weitere Bedeutung »gefährlich hoher Wasserstand« steht nicht im Widerspruch dazu, auch wenn das hohe Wasser nicht unbedingt vom Meer stammen muss. Ebbe ist das ablaufende Wasser. Bis ins 15. Jahrhundert zurück gehen die übertragenen Bedeutungen von Ebbe und Flut, beispielsweise flood of tears (Tränenflut) und das ebbing als Schwinden von Möglichkeiten.
Jonathan Raban spekuliert in seinem gezeitenreichen Abenteuerbuch Passage nach Juneau, dass der Mensch mit der Erfindung des Kompasses auf die kühne Idee kam, das Meer auf einer geraden Linie zu überqueren. Darauf weisen mittelalterliche Portolankarten hin, deren Routen von Dutzenden kerzengeraden Loxodromen – das sind Kurven auf der Erdoberfläche, die die Meridiane im geographischen Koordinatensystem immer unter dem gleichen Winkel schneiden – gekreuzt werden. Ein eher naturverbundener Segler versuchte dagegen vielleicht, die Strömung unter dem Bug zu erspüren und zu seinem Vorteil auszunutzen, ohne sich darum zu kümmern, wie sein Kurs auf einer Karte aussehen würde. Womöglich war es auch erst die Uhr, mit deren Erfindung das abstrakte Konzept der »Zeit« die viel greifbareren Gezeiten als Orientierungsmaßstab ablöste.
In unserem Wortschatz gibt es noch einige Spuren aus jenen Tagen, da die Technik Zeit und Gezeiten noch nicht voneinander getrennt hatte. In der englischen Umgangssprache bedeutet »someone will tide me over«, dass jemand mich eine Zeitlang unterstützt, meistens finanziell. Die Formulierung hat einen nautischen Ursprung: »Tide over« hieß, hohe Wasserstände auszunutzen, um ein Boot über Sandbänke oder andere seichte Stellen zu steuern, die sonst nicht passierbar waren.
Weil die beiden Wörter so ähnlich klingen und auch inhaltlich zusammengehören, werden time und tide oft verbunden. »Time and tide wait for no man«, heißt es, Zeit und Gezeiten warten auf keinen. Das klingt nach Shakespeare oder Chaucer, ist aber noch älter und stammt wahrscheinlich aus dem 13. Jahrhundert, von einem gewissen Sankt Marher, über den man kaum etwas weiß. Der Satz ist wahr und auch wieder nicht wahr. Zwar folgen Zeit und Gezeiten himmlischen Gesetzen und stehen nicht in menschlicher Macht. Doch vergeht die Zeit ein für alle Mal, während das Wasser stets wieder zurückkehrt. Die Zeit vergeht kontinuierlich, sie ist der Hintergrund allen Geschehens. Die Gezeiten ereignen sich innerhalb der Zeit.
Die Art und Weise, wie Zeit und Gezeiten nicht auf uns warten, ist also jeweils eine andere. Wenn wir eine Verabredung verpassen, weil die Zeit nicht auf uns wartet, haben wir vielleicht keine zweite Chance. Wenn wir einmal die Flut verpasst haben, ist uns ebenfalls etwas entgangen, aber wir wissen, dass wir dieselbe oder jedenfalls eine sehr ähnliche Möglichkeit bald wieder haben werden.
Es gibt auch andere wichtige Unterschiede. Der Zeitstrahl ist schwerelos, während hinter den Gezeiten gigantische Kräfte stehen. Wir können ihren Fluss spüren. Wenn wir in den Wellen stehen, bricht sich das steigende Wasser an uns. Die Ebbe zieht an unseren Waden oder Knöcheln. In solchen Augenblicken vergessen wir, dass die Gezeiten zyklische Prozesse sind, deren Bewegungen sich in immer neuer Gestalt endlos wiederholen. Dass wir das einzelne Ereignis an unseren Körpern spüren, schlägt sich in der Sprache nieder. Wir sprechen von Gezeiten und Ebbe und Flut auch in vielen anderen Zusammenhängen.
Dass zum auflaufenden Wasser die günstige Gelegenheit gehören kann, formuliert Brutus am Vorabend der Schlacht bei Philippi in Shakespeares Julius Cäsar:
Der Strom der menschlichen Geschäfte wechselt;
Nimmt man die Flut wahr, führet sie zum Glück;
Versäumt man sie, so muss die ganze Reise
Des Lebens sich durch Not und Klippen winden.
Wir sind nun flott auf solcher hohen See
Und müssen, wenn der Strom uns hebt, ihn nutzen;
Wo nicht, geht unser schwimmend Gut verloren.
Wenn die Wasser hoch genug sind, kann unsere Entdeckungsreise beginnen – die manchmal auch eine Reise zu uns selbst ist.
Mit der Ebbe ist dagegen eine besondere Traurigkeit verbunden, eine körperliche Leere, die in eine geistige mündet, weil wir instinktiv den Verlust von Wasser mit einer Gefahr für das Leben verbinden. Das Wasser »macht sich davon«, und der Vorgang ist so einfach und verzweifelt wie die Formulierung. Seinem Schicksal folgend, lässt das Wasser eine Ödnis aus Sand oder Schlick zurück.
Mit der Ebbe entzieht sich das Leben mit seinen reichen Möglichkeiten. So scheint es jedenfalls. Die Natur sieht es aber anders. Ihren größten Reichtum finden wir oft in den Grenzbereichen zweier Lebensräume. Vögel nisten gern in Hecken, nicht auf offenem Feld oder mitten im Wald. Amphibien lieben die Randzonen von Gewässern, nicht die Tiefe oder die trockene Erde. An den Rändern hat man die Auswahl – Nahrung auf der einen, Rückzugsräume auf der anderen Seite zum Beispiel. Und wo sich diese Ränder stets verschieben, wie in der Gezeitenzone des glänzenden Landes zwischen Hoch- und Niedrigwasserlinien, wird das Angebot immer wieder aufgefüllt. Innerhalb der Gezeitenzone, deren Streifen auf einer Länge von über einer Million Kilometern die Kontinente umflattert (genau lässt sich das kaum messen), liegen einige der Gegenden mit der weltweit größten Artenvielfalt. Hier »kriecht und krabbelt es so verrückt wie nirgends sonst«, wie es im Musical Pipe Dream von Rodgers und Hammerstein II heißt, dem wohl einzigen Musical, in dem ein Meeresbiologe im Mittelpunkt steht. Es geht auf John Steinbecks Roman Sweet Thursday(Wonniger Donnerstag) zurück.
Auflaufendes und ablaufendes Wasser füllt die Regale der Kontinente zweimal täglich so effizient auf, wie es keine Supermarktkette vermag. Die Natur ist darauf angelegt, Energie zu sparen. Alle Lebewesen wollen sich durchschlagen und sich vermehren, sich dabei aber möglichst wenig anstrengen. Die einen fahren per Anhalter, die anderen warten den Lieferservice ab. Das begünstigen die Gezeiten. Sie stellen jede Menge Energie zur Verfügung, und Tiere und Pflanzen können sie nutzen, wenn sie sich auf ihren Fahrplan einstellen.
In diesem Buch geht es um die Entdeckung und Erforschung kosmischer Gesetze, denen unser Planet unterworfen ist. Es geht aber auch um Orte. Auf der unendlichen Küstenlinie aller Kontinente gibt es viele Stellen, an denen die unwiderstehliche Macht der Gezeiten und die unbewegliche Masse der Erde gemeinsam am Werk sind und natürliche Häfen, Flussmündungen, Meeresarme und Fjorde, Landengen und Felsvorsprünge schaffen, deren besondere Form sich den Bildhauerkünsten der Gezeiten verdankt.
Für die Seeleute halten die Gezeiten auch Orte des Schreckens bereit: Strudel und Gezeitenströme und Widerwellen, hier einen riesigen Tidenhub und dort, weit draußen auf dem Meer, inmitten großer Gezeitenbewegungen, stille Stellen, an denen das Wasser weder steigt noch sinkt. In den Atlanten der Landratten tauchen sie nicht auf, nur auf manchen Seekarten finden wir sie. Es sind Orte, und es sind Spektakel. Sie finden zu ganz bestimmten Zeitpunkten statt, und nur, wenn den Schauspielern danach ist. Einmal kommt es zu dramatischen Strudeln oder Gezeitenwellen, und bei der nächsten, genauso hohen Flut bleiben sie aus, weil irgendwelche Umstände sich geändert haben.
So außergewöhnliche Gewaltausbrüche ereignen sich meist dort, wo die Gezeiten durch die besondere Gestalt des Meeresbodens oder der Küstenlinie stark beeinflusst werden. Dies mag am Äquator oder an den Polen, in stürmischer oder ruhiger See, in der Nähe großer Küstenstädte oder in abgelegenen Regionen der Fall sein. Ich bin nach Nova Scotia in Kanada gefahren, wo es die größten Gezeitenunterschiede überhaupt gibt, hätte aber auch nach Argentinien oder Nordwestaustralien fahren können. In der norwegischen Arktis habe ich beobachtet, wie das Wasser erschreckend schnell ansteigt, aber auch in Japan oder der Magellanstraße oder der Bucht von Vancouver hätte ich das erleben können. Auf den genauen Ort kommt es nicht an. Etwas Ähnliches gibt es an jeder Küste eines jeden Ozeans.
Eigentlich könnte ich in meiner Heimat bleiben. Die Küsten der Britischen Inseln werden von den Gezeiten mit einem weltweit fast einmaligen Nachdruck bearbeitet. Wohl kein Land kann mit der Geschwindigkeit und den Höhenunterschieden des Gezeitenwassers mithalten, das man in Großbritannien beobachten kann. Wie wirkt sich das aus? Es wird mehr angespült und mehr weggespült und beschädigt, es gibt mehr Erosion, mehr Sedimente, mehr Leben, mehr Tod. Wir halten uns gern für eine Seefahrernation, aber wir wissen erschreckend wenig darüber, was an unseren Küsten vor sich geht.
Die flüchtigen Wirkungsstätten der Gezeiten hinterlassen keine Narben oder Spuren, die uns wie berühmte Straßen oder Berggipfel zum Nachdenken anregen. Wir können sie uns nur anschauen und von ihnen berichten. Daher widme ich mich nicht nur der wissenschaftlichen Forschung, sondern erzähle auch fantastische Geschichten und berichte von meinen eigenen Reisen.
Wenn eine einzelne Ebbe oder Flut das Gesicht eines Ortes prägen kann, ergibt ein ganzer Gezeitenzyklus eine Lebenslinie. Wenn ich von einem Ort an der Küste aus die Gezeiten beobachte, müsste ich mich erst wie von Zauberhand in ein neues Land versetzt und dann wieder in meine Heimat zurücktransportiert fühlen. Ich müsste mich fragen, ob ich meinen Augen trauen kann.
Das will ich versuchen. Ich kenne die Küste bei Ebbe und bei Flut. Ich habe mir die äußersten Punkte des Gezeitenzyklus schon zunutze gemacht: Bei hohem Wasser bin ich in seichten Gewässern gesegelt, bei niedrigem habe ich Gezeitentümpel bestaunt. Ich habe aber noch nie einen ganzen Zyklus verfolgt. Ich habe noch nie genau gesehen, wie sich die Gezeiten bewegen. Vielleicht kann ich einen mystischen Einklang zwischen ihnen und mir herstellen, sie danach vielleicht besser wissenschaftlich und theoretisch analysieren. Meine Fragen will ich aber aus persönlicher Erfahrung ableiten, erst dann soll die Suche nach Antworten beginnen.
Nehmen wir also unsere Plätze ein. Das große Meeresspektakel beginnt in Kürze. Die Vorstellung dauert ungefähr zwölf Stunden und dreißig Minuten.
EIN BLICK AUF ENTSPANNTE GEZEITEN
Dreizehn Stunden
Blakeney, Norfolk
HW*
NW**
HW
NW
4. September 2013
05:57
18:27
3,0 m
2,9 m
* Hochwasser ** Niedrigwasser
Zugegeben, es ist eine kauzige Idee, zwölf oder dreizehn Stunden lang aufs Meer zu schauen. Dem Gras beim Wachsen zuzusehen ist interessanter, werden Sie sagen. Aber ich lasse mich nicht abhalten. Ich weiß auch nicht, was mich erwartet, aber ich werde alles sorgfältig aufschreiben. Ich weiß wirklich nicht, was mich erwartet, und genau deshalb reizt es mich.
Zuerst musste ich mich entscheiden, wo ich dieses kleine Experiment denn durchführen wollte. An der britischen Küste sind die Gezeiten überall mächtig am Werk. Ich lebe in Norfolk, einer fast schon unanständig weit in die Nordsee hinausragenden Grafschaft. Wenn auf alten Landkarten Großbritannien als Person dargestellt ist, ist Norfolk meist der dicke Bauch. Entsprechend ausgedehnt ist die Küste, und so fiel mir die Wahl nicht leicht. Ich dachte an Blakeney Quay. Dort hatte ich einmal beobachtet, dass das Wasser so schnell die Flussbiegung hinauflief (sicher drei Meter pro Sekunde, wie ich an vorbeischwimmendem Gras ablas), dass es feste hölzerne Dalben richtig durchschüttelte. Doch gab es dort zu viele Touristen. Irgendjemand würde mich dauernd ablenken. Deshalb suchte ich mir eine Stelle ein oder zwei Kilometer weiter aus, wo mich niemand stören würde.
Es hätte natürlich auch viele andere schöne Möglichkeiten gegeben: den Tidefluss Yar, der die Isle of Wight, wo ich meine Kindheit verbrachte, praktisch in zwei Teile teilt. Griswold Point an der Mündung des Connecticut River, wo mich mein amerikanischer Cousin hinführte und wo wir zuschauten, wie die seltenen Gelbfuß-Regenpfeifer ihre Nestmulden in den Sand scharrten. Viele der verlassenen Strände, die ich vor Jahren an der Route 101 sah, als ich durch Oregon Richtung Süden fuhr. Die Hafenstadt Cádiz, die dank ihrer Lage auf einer atlantischen Halbinsel schon den Phöniziern als Hafen diente und wo sich die streunenden Katzen auf dem Wellenbrecher treffen. Oder auch Cape Trafalgar, jenen sandüberwehten Strand, wo ich einmal darüber meditierte, wie der Norfolker Seeheld Horatio Nelson die spanische Flotte besiegte.
Am Ende blieb ich aber in meiner Heimat. Die Küstenlandschaft ist hier größtenteils flach. Tiefliegende Weideflächen gehen in breite Salzmarschen über, die von einem Labyrinth schlickiger Priele und Wasserläufe, durchzogen werden, bis schließlich Dünen und Kies den Meeresstrand bilden. Diese Szenerie ist ganz anders als zum Beispiel die ins Gediegene gewendete Erhabenheit des Strandes in Lyme Regis, die Jane Austen in Persuasion (Überredung) beschreibt: »Mit seinen vielen kleinen Felsen ist der Strand ideal für die Beobachtung der Gezeiten.« Mich erwartet eher das, was George Crabbe in »The Borough«,einem epischen Gedicht über das Leben in East Anglia, beschreibt: »entspannte Gezeiten, die durch heiße Schlickkanäle langsam gleiten«. Aus mir würde, wie bei Charles Dickens in Our mutual friend (Unser gemeinsamer Freund),eines jener »amphibienähnlichen Menschenwesen, die die undurchsichtige Fähigkeit besitzen, aus der Gezeitenströmung nur dadurch Kraft zu saugen, dass sie sie betrachten.«
Für viele Autoren sind Ebbe und Flut offenbar so etwas wie das Pendel eines Hypnotiseurs. Der Beobachter gerät in einen Traumzustand, der sich zur gefährlichen Trance steigern kann. Ich musste aufpassen, nicht zum Tagträumer zu werden, wenn ich dem endlosen Kommen und Gehen des Meeres etwas Sinnvolles abgewinnen wollte.
Als Nächstes musste ich mir eine geeignete Jahres- und Tageszeit für meine kleine Studie aussuchen. Die Gezeiten sind immer in Bewegung, aber sie werden von astronomischen Faktoren beeinflusst, die wiederum eigenen, komplexen zeitlichen Rhythmen unterworfen sind. Ich wollte auf dem Marschland weder erfrieren noch verbrutzeln, vor allem aber wollte ich die für meine Beobachtungen nötigen dreizehn Stunden bei Tageslicht verbringen. Denn so lange dauert ein ganzer Gezeitenzyklus von Hoch- zu Hoch- beziehungsweise Niedrig- zu Niedrigwasser, und zwar überall auf der Welt. Also kamen nur die Monate März bis September infrage, wenn die Tage lang genug sind. Außerdem wollte ich einen einigermaßen typischen Gezeitenverlauf beobachten und keine Extreme, die mich bei auflaufendem Wasser von meinem Aussichtspunkt fortspülten oder so mager wären, dass mir kaum etwas auffiele.
Bei jeder Spanne von dreizehn Stunden würde ich ein Hochwasser und ein Niedrigwasser sehen, einmal Ebbe und einmal Flut. Aber an welchem Punkt des Zyklus sollte ich anfangen? Das war natürlich vor allem eine Frage der künstlerischen Vorlieben eines Geschichtenerzählers. Bei einem der Extreme zu beginnen, hätte etwas Melodramatisches. Eine etwas eigenartige Logik sagte mir, dass Niedrigwasser der naheliegende Einstieg wäre: Immerhin sind auch eine Badewanne und ein Eimer zuerst leer, und unser Umgang mit ihnen beginnt damit, dass wir sie füllen. Der Eindruck der Flut wäre besonders augenfällig. Ich könnte zuschauen, wie sie in die kleinen Priele dringt, müsste dann aber auch verfolgen, wie das Wasser wieder abläuft, und irgendetwas daran störte mich. Ich könnte auch bei Hochwasser anfangen. Aber auch das kam mir unangemessen vor. Ich würde zwar aufhören, wenn es am schönsten ist, aber ich müsste mit dem Abschied dessen beginnen, worum es in meiner Geschichte geht. Wenn sofort das Wasser ablaufen würde, käme vielleicht auch meine Erzählung vorschnell zu einem Ende.
Letztlich hatte ich weniger Auswahlmöglichkeiten, als ich dachte. Laut Gezeitentafel war der Tidenhub nur an relativ wenigen Tagen so, wie ich ihn mir wünschte, und wenn ich ausreichend Sonnenstunden und gute Wetterverhältnisse haben wollte, aber keine Wochenendausflügler oder Schulklassen, blieben immer weniger Tage übrig. Ich entschied mich für einen, an dem sich der Wasserablauf bei Sonnenaufgang gerade beschleunigen würde. Mein Tag als Beobachter würde also etwa eine Stunde nach dem Hochwasser beginnen, in ruhiger, erwartungsvoller Atmosphäre. Vormittags würde die Ebbe schlickiges Watt zum Vorschein bringen. Die Flut käme spät, als willkommener Höhepunkt. Wenn ich eine oder zwei Stunden nach dem Hochwasser anfinge, würde ich die ganze folgende Flut erleben und dann gerade noch den Anfang der nächsten Ebbe. Damit hätte ich gesehen, dass der Gezeitenzyklus bei Hochwasser nicht wirklich zu einem klaren Gipfelpunkt kommt, wie wir allzu leicht denken, sondern dass es sich um einen unendlichen Vorgang handelt, bei dem kein einzelner Augenblick wichtiger ist als die anderen.
Meinen Tag musste ich gut vorbereiten. Ich wollte möglichst viel von dem beobachten, was mit den Gezeiten zu tun hat: Veränderungen des Wassers selbst, der von ihm beeinflussten Pflanzen, der Tiere, wie sie kommen und gehen, auch der Menschen, die sich die Gezeiten zunutze machen. Meine Liste der dazu nötigen Dinge wurde schnell länger: Fotoapparat, Notizbuch, Millimeterpapier, Vergrößerungsglas, kleine Tüten für Pflanzen. Und auch ein alter Windsurfmast aus Fiberglas, den ich in einen Tidenmesser verwandelte, indem ich ihn in Abständen von zehn Zentimetern mit wasserfestem Klebeband umwickelte. Ich schnallte mir sogar mein Kanu aufs Autodach, für den Fall, dass ich die mich umfließenden Geheimnisse durch einen Vorstoß aufs Wasser näher erkunden wollte.
Es war meine Absicht, ein unermüdlicher Beobachter zu sein, aber ich stellte mich darauf ein, dass auch immer wieder längere Zeit wenig passieren würde. Deshalb packte ich das Oxford Book of the Sea ein. Es enthielt Auszüge aus vielen Werken, mit denen ich mich vertraut machen musste, von Rachel Carsons The Sea Around Us (Wunder des Meeres)bis zu Matthew Arnolds allegorischem Gedicht »Dover Beach«. Diese Gedichte und Prosastücke sollten mich immer wieder an den Hauptstrom erinnern, mit dem meine unbedeutenden gedanklichen Priele durch die Gezeiten auf ewig verbunden blieben.
Erste Ebbe
Eines warmen Septembermorgens kurz nach Sonnenaufgang komme ich also auf dem Marschland an. Die Sonne scheint und hat den leichten Morgennebel schon aufgelöst. Ein sanfter südlicher Wind macht sich auf dem Wasser bemerkbar. Auf den Zuflüssen eines größeren Wasserlaufs kann ich an der Bewegung jenes leichten Films an der Wasseroberfläche ablesen, dass die Ebbe begonnen hat.
Ich postiere mich an einer Holzbrücke über einem Priel und richte meine Messlatte ein, indem ich den Mastfuß ins Wasser stoße, bis ich spüre, wie er den Grund erreicht. Das obere Ende binde ich am Geländer der Brücke fest. Die erste Messung ergibt, dass das Wasser um 7:15 Uhr 2,02 Meter tief ist. Dann suche ich mir eine Stelle, von der aus ich Fotos machen kann. Im Sucher sehe ich einen Priel, der sich von meinem Beobachtungspunkt aus in den Hauptarm entleert, und Ufer, Brücke und mein Messinstrument. Im Vordergrund ruht ein kleines Boot, das hier schon so lange liegt, dass es von Flechten überwachsen ist.
Im Lauf der nächsten Minuten bemerke ich, wie das ablaufende Wasser an Fahrt gewinnt. Der Wind weht in den Priel und kräuselt das Wasser, sodass der Eindruck eines glatten Wasserlaufs der Vergangenheit angehört. Ich hatte vor, ungefähr einmal pro Stunde den Messwert abzulesen, aber schon jetzt wird mir klar, dass mir dann das Wichtigste entgehen würde. Ich muss alle paar Minuten nachschauen. Um 7:30 Uhr ist der Wasserstand schon auf 1,92 Meter gefallen.
Ich hechte zurück zu meinem Auto und schnalle das Kanu ab, um es über das ablaufende Wasser zu meinem Aussichtspunkt zu bringen, solange noch genug Wasser im Priel ist. Fast ohne dass ich paddeln muss, gleite ich durchs Wasser. Der Gezeitenstrom bleibt dem Auge verborgen, auch von diesem niedrigen Punkt aus. Nur die Geschwindigkeit, mit der Schlickbänke und festgebundene Boote an mir vorbeiziehen, zeigt ihn an. Ich kenne das bestrickende Gefühl, das diese optische Täuschung hervorruft, und doch verunsichert es mich jedes Mal aufs Neue. Man sieht daran, wie unwohl es uns bei dem Gedanken ist, dass die Wassermassen der ganzen Erde ihren eigenen, undurchsichtigen Gesetzen folgend über festen Grund gleiten.
Ich binde das Kanu fest und kehre zu meinem Aussichtspunkt zurück. Im immer schneller fließenden Wasser hat sich das übergrünte Boot um seinen Pfahl gedreht, und sein Bug zeigt jetzt genau stromaufwärts. Ein besonders klares Zeichen für die Veränderung der Fließgeschwindigkeit. Um den tiefsten Brückenpfeiler hat sich eine Welle gebildet. Ihre Bewegung lässt immer neue kleine Wirbel entstehen. Es sind Kommas und Doppelpunkte, die nach ein paar Sekunden von der Strömung mitgerissen werden. Mir fällt auf, dass sie sich sowohl mit dem als auch gegen den Uhrzeigersinn drehen. Warum sind sie offenbar immun gegen die berühmte Badezimmergeschichte, der zufolge abfließendes Wasser sich immer in die gleiche Richtung dreht? Die größeren Wirbel ziehen kleine Pflanzen nach unten, spielen ein bisschen mit ihnen und bringen sie dann einige Meter weiter wieder zum Vorschein.
An den Rändern des Wassers haben sich kleine Schwimmschlamminseln gebildet. Wo kommen sie her? Hat das fließende Wasser sie hervorgetrieben? Hat die Kraft der Strömung sie hervorgeschäumt? Leben sie? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wie Schnee-Eier bewegen sie sich ziellos umher. Einige von ihnen bummeln den Priel entlang, andere schlagen sich auf die Seite und in kleine Seitenarme, Fußgängern gleich, die sich nach einem Schaufenster umdrehen. Ich sehe mir das Wasser um sie herum genauer an und bemerke, dass sie in kleinen Wirbeln stecken, in Kehrwasser, das auf eine Unregelmäßigkeit im Wasserlauf zurückgeht. Sie erinnern mich daran, dass die Gezeiten im Großen und Ganzen verständlich und vorhersehbar sein mögen, in ihren konkreten Verläufen aber alles andere als simpel sind.
In einiger Entfernung suchen Vögel nach Nahrung. Ein Gänseschwarm ist von irgendwoher aufgetaucht. Aus der Nähe dringt der Gesang von Wiesenpfeifern herüber, auch das hohle Piepen von Watvögeln. Zwei Brachvögel fliegen steil heran und landen in einem Zufluss ganz nah bei mir, offenbar von der Aussicht auf Nahrung in dem gerade freigelegten Schlick angezogen. Über mir segelt eine redselige Schwalbe. Die Schwalben kommen auf den Oberleitungen zusammen, um sich auf ihren Zug vorzubereiten – ein weiterer jener natürlichen Zyklen, in dem das himmlische Uhrwerk für ein Kommen und Gehen sorgt.
Schon ist es Zeit für meine nächste Messung, meine erste offizielle, stündliche: 1,38 Meter. Es ist erstaunlich, wie viel Wasser schon abgeflossen ist, in aller Stille, ohne Aufsehen zu erregen. Sechs Stunden Ebbe sollen es doch sein, aber schon in der ersten Stunde hat sich ein Drittel der Handlung ereignet. Wie es dazu kommt, weiß ich nicht.
Mir sind frühmorgens einige Spaziergänger mit Hunden begegnet, zwei oder drei Motorboote sind an mir vorbeigefahren, aber jetzt, wo der Wasserstand schon so niedrig ist, steht mir wohl ein ruhiger Tag bevor. Früher war hier mehr los, als die örtliche Bevölkerung Schalentiere und Meerfenchel sammelte. Heute ist die Küste ein Ort der Erholung, und um als solcher attraktiv zu sein, braucht es Wasser. Selbst die Landschaft zieht bei Ebbe kaum Besucher an.
Ich wende mich einem der Schnee-Eier zu, um es genauer zu untersuchen. Es ist graubraun und schaumbekrönt wie ein mittelmäßiger Cappuccino. Die Größe der Bläschen schwankt zwischen Stecknadelkopf und Erbse. Obenauf sitzen winzige Insekten: schlanke, langbeinige Fliegen mit eckigen Gelenken und eleganten, nach hinten abstehenden Flügeln. Unterdessen bemerke ich, dass sich auch auf der Unterseite der Schnee-Eier Insekten niedergelassen haben. Eine Welt im Spiegel. Ich hebe etwas von dem Schaum auf, er zerrinnt mir zwischen den Fingern. Er ist völlig geruchs- und geschmacklos. Eindeutig ein Naturprodukt, kein Zeichen von Umweltverschmutzung, wie wir vielleicht schlechten Gewissens vermuten würden.
Der schlammige Schaum zieht auch winzige segmentierte Wesen an, deren Farbe zwischen Anthrazit und Blau schwankt. Die zusammengerollten Tierchen wirken leblos. Erst halte ich sie sogar für Samenschoten. Aber sobald ich eines aufhebe, wird es lebendig und turnt um meine Finger herum. Sein Körper ist gelenkig, und sowohl sein Hinterteil als auch sein Kopf halten Ausschau nach den Gründen für den plötzlichen Aufruhr. Dieses hier ist so blau, dass ich es nicht mehr sehe, wenn ich es auf einen hellen Plastikfender lege. In meinem »vollständigen« Handbuch der britischen Küstenfauna kommt es nicht vor. In dem Buch kommen überhaupt keine Lebewesen vor, die kleiner als fünf Millimeter sind, und ich frage mich, ob das ein Zugeständnis an den Publikumsgeschmack ist: Werden nur noch mit dem bloßen Auge sichtbare Organismen aufgenommen? Schlägt sich diese Haltung auch in der Forschungsagenda der Meeresbiologen nieder?
Ich versuche, mich zwischen den Vogelrufen und den Verkehrsgeräuschen auf etwas zu konzentrieren, was ich, wie mir jetzt bewusst wird, bis vor Kurzem als »Schwappen« des Wassers abgetan habe. Hier gibt es aber gar keine Wellen, die schwappen könnten. Was höre ich da also? Ich fixiere den Schlick, der seit ungefähr einer Stunde sichtbar vor mir liegt, und plötzlich sehe ich, dass es dort vor kleinen Tieren nur so wimmelt. Fast durchsichtige Würmer wirbeln durch den dünnen Film auf dem Schlick. Die kleinen Löcher, aus denen sie gekrochen sind, fallen wieder zu, öffnen sich wieder mit einem nassen Plopp, und all das hundertfache Öffnen und Schließen sorgt für das musikalische Hintergrundrauschen. Aus dem wärmer werdenden Schlick, der seit einem halben Tag kein Sonnenlicht mehr gesehen hat, steigt ein süßer Geruch nach Schalentieren auf. Der Meeresgrund lebt auf.
Der Schlick erwacht
Die Sonne steigt. Das gekräuselte Wasser wirft helle Flecken auf die Unterseite der Holzbrücke. Ich habe einmal gehört, dass es im Venezianischen ein Wort für dieses wunderbare Lichtspiel gibt, konnte es aber nicht finden und frage mich, ob ich das vielleicht nur geträumt habe. Vielleicht werde ich der Sache auf den Grund gehen, wenn ich in Venedig erkunde, wie sich die Stadt vor Überschwemmungen schützt.
Ich hatte mich eigentlich auf Phasen der Langeweile eingestellt, aber mir wird nun klar, dass ich den ganzen Tag beschäftigt sein werde. Meine Aktivitäten zwischen zwei Messungen müssen sorgfältig geplant werden, weil ich einige Dinge, zum Beispiel die Suche nach Würmern im Schlick oder die Beobachtung des vom Wind aufgewühlten Wassers, nur bei bestimmten Wasserständen erledigen kann. So ergibt sich ein Stundenplan fast wie in der Schule. Alle Fächer kommen zum Zuge: Veränderungen des Wasserstandes auf einem Diagramm eintragen (Mathematik), Fauna und Flora von Schlick und Marschland beobachten (Biologie), Fließeigenschaften des Wassers aufzeichnen (Physik), Kanufahren (Sport), über die Ordnung der Welt und des Kosmos nachdenken (Religion?). Das wird mich so sehr auf Trab halten, dass der Englischunterricht ausfallen muss. The Oxford Book of the Sea habe ich beiseitegelegt. In der trockenen Brise werden die Seiten schon spröde.
Um zehn Uhr ist mein Priel so gut wie leer. Mir gegenüber verläuft ein weiterer kleiner Priel, aus dem nun die verfaulenden Planken eines hölzernen Bootes auftauchen, das hier vor langer Zeit seine letzte, augenscheinlich recht bequeme Ruhestätte gefunden hat. Meine Messlatte zeigt 0,21 Meter an. Selbst im Hauptarm steht das Wasser nun beinahe. Man sieht es daran, dass der vorher von einer schnelleren Strömung aufgewirbelte Schlick, der immer noch im Wasser hängt, inzwischen wie Rauch in der Luft Richtung Meer von dannen zieht.
Auf der glitzernden Schlammbank haben sich nahrungssuchende Möwen niedergelassen. Eine Lachmöwe tut plötzlich etwas, was ich noch nie gesehen habe. Mit ihren Füßen schlägt sie wie wild auf die Oberfläche des Schlicks ein. Dann hält sie inne und schaut nach unten. Und legt wieder los. Irgendwann wird mir klar, was da vor sich geht: Unter ihren roten Füßen wird der Schlick weicher, und das soll ihre Chancen erhöhen, dass etwas Essbares auftaucht.
An der Mündung meines Priels lässt sich die Strömung nun an nichts mehr ablesen. Der Wind hält ein paar Schaumflecken fest, sodass das Fließen des Wassers darunter kaum noch erkennbar ist. Im Hauptwasserlauf fällt der Wasserstand aber weiter – das kann man sehen und nun auch hören. Das Wasser schlägt an den festgebundenen Booten an. Es ist hier so trüb, dass ich seine Tiefe nicht einschätzen kann. Vor allem könnte ich eines wohl nur mit großer Mühe prüfen, was mich wirklich interessiert, nämlich wie sich das Fließen des Wassers in unterschiedlicher Tiefe darstellt. Wird ein Kubikzentimeter Wasser, der sich bei Flut an der Oberfläche befindet, bis auf den Grund absinken oder sich seitwärts bewegen? Runter oder raus? Wir stellen uns die Gezeiten als ein Kommen und Gehen vor, aber der Wasserspiegel steigt und sinkt doch. Was ist wichtiger? Oder ist beides wichtig? Welches Wasser fließt am schnellsten? Das Wasser an der Oberfläche, das am Meeresgrund keiner Reibung ausgesetzt ist? Das Wasser mittendrin, in mittlerer Tiefe? Wie lange wird mein imaginärer Kubikzentimeter überhaupt in Form bleiben? Wird er auf seiner Reise zum Meer langgezogen wie ein Kaugummi, den man sich aus dem Mund zieht? Oder dehnt er sich komplizierter aus, indem er sich wie eine Hydra mit ähnlichen, brackigen Kubikzentimetern rechts und links verwickelt? Diese Fragen sind vielleicht naiv. Ich will es aber wissen. Die Vorstellung, dass verschiedene Teile desselben Gewässers unterschiedlich schnell und in unterschiedliche Richtungen fließen, mag auf den ersten Blick wenig Sinn machen, entspricht aber der Wirklichkeit, denn ich sehe zum Beispiel, dass das Wasser sich aus meinem Norfolker Priel zurückzieht, während es in ähnlichen Prielen, ganz in der Nähe, in die entgegengesetzte Richtung fließt. Wasser ist eine unelastische Flüssigkeit. Es lässt sich weder komprimieren noch expandieren. Wenn Wasser irgendwo verschwindet, muss es anderswo auftauchen. Wie wird jener Kubikzentimeter Wasser also auf seiner Reise aus meinem Priel auf die offene See gedehnt oder gestaucht, verwandelt oder vermischt?
Ich werfe eine trockene Samenhülse ins Wasser und versuche, ihre Geschwindigkeit abzuschätzen. Dann suche ich etwas, was langsam sinkt und mich die Fließgeschwindigkeiten an der Oberfläche und im tieferen Wasser vergleichen lässt. Mir fällt auf, dass der Tang, der von den Anlegern herunterhängt, in mittlerer Wassertiefe zu flattern beginnt. Ich reiße einige Büschel aus, die ich in jeweils unterschiedlicher Tiefe loslasse. Anscheinend schwimmen sie alle gleich schnell weg. Als würde das ganze Meer abgesaugt.
Mit dem Sinken des Wasserspiegels wird immer mehr Schlick sichtbar. Was vor einer Stunde wie ein flacher Hang aussah, fällt nun steil als weiche, klebrige Klippe ab. Selbst in diesem kleinen Maßstab hat die Topographie etwas Erhabenes – Norfolks Grand Canyon. Ich bemerke ein von der immer noch schräg stehenden Sonne grell beleuchtetes Stück Schlick. Seine Oberflächenstruktur ist außerordentlich fein, einige Stellen glitzern wie Chrom. Schattig sind die tieferen Mulden, als hätten Kinder dort bei der letzten Ebbe Fußspuren hinterlassen. Hier und da macht sich ein später Tropfen noch auf den langen Weg zum Meer, eine winzige, gräuliche Welle, wie eine Kontaktlinse, die durch ein feuchtes Becken gleitet.
Der nur scheinbar unbelebte Schlick zwitschert nun so lauthals wie Spatzen im Gebüsch. An der Oberfläche hat er die Farbe einer Pastete. Aber schon unmittelbar darunter und so tief, wie ich mit der Hand hinunterkomme, ist er bläulich schwarz und feinkörnig. Woran liegt das? Warum ist die Farbe oben anders? Fragen über Fragen. Geräusche kommen aus kleinen Löchern überall um mich herum, die in dieser mondgleichen Gegend wie Fumarolen vor sich hin blubbern. Bei genauerem Hinsehen erkenne ich, wie sich an einem der Löcher etwas bewegt. Ich greife eine Handvoll Schlick heraus. Nach kurzer Suche finde ich ein fünf Zentimeter langes, hellgrünes Tier, eine Art Tausendfüßler mit schwarzen Streifen auf dem Rücken. Zum roten Schwanz hin verjüngt es sich. Später erfahre ich, dass es sich um einen Schillernden Seeringelwurm handelt. Er wirkt ziemlich schlaff – ein bisschen wie ein alter Wischmopp aus bunten Stofffetzen. Es ist erstaunlich, ein so buntes Wesen, das auf Lateinisch passenderweise Hediste diversicolor heißt, in einer beinahe farblosen Umgebung vorzufinden. Welchen evolutionären Vorteil die farbenfrohe Vielfalt wohl verheißt?
Mein kleiner Zufluss ist beinahe leer, das harte Bett aus Kies und Muscheln ist auch an der tiefsten Stelle sichtbar – das Wasser ist nur wenige Zentimeter tief und fließt jetzt eindeutig abwärts, es will in seiner Gänze aus dem Marschland abziehen, was ihm natürlich bis zur nächsten Flut nicht gelingen wird.
Eine unberechenbare Macht
Nach der nächsten Messung habe ich Zeit, mir die Flora genauer anzuschauen. Was hier wächst, ist höhenabhängig, denn je nachdem, wie lange eine Stelle aus dem Salzwasser herausragt, ist sie für die eine oder andere Pflanze geeignet. Ökologen nennen das Zonierung – Organismen suchen sich die für sie günstigsten biogeographischen Zonen aus. Das gilt für alle Organismen, Pflanzen wie Tiere, aber normalerweise betrifft es riesige Landflächen mit unklaren Grenzen, sodass man eine Zone als solche fast nie wahrnimmt. Das Siedlungsgebiet der Lachmöwe, der ich vorher bei der Nahrungsaufnahme zuschaute, erstreckt sich über mehr als drei Prozent der Erdoberfläche und umfasst Meere und Ackerflächen in ganz Europa, an der Nordwestküste Amerikas und in großen Teilen Asiens und Afrikas nördlich des Äquators.
Aber hier, zwischen den Hoch- und Niedrigwasserhöhen, lösen die Zonen einander schnell ab. Eine deutlich sichtbare biologische Grenze liegt vielleicht nur Meter oder sogar Zentimeter von der nächsten entfernt, und die horizontalen Bänder erstrecken sich, so weit das Auge reicht, an der zerklüfteten Küste entlang. Ich beginne mit den Pflanzen, die an den höchsten Stellen am weitesten hinaufwachsen, mache mir Notizen und nehme Proben, um sie nachher einzuordnen. Die auffälligste Pflanzenart ist ein Busch, der etwa einen Meter Höhe erreicht. Seine kleinen, fleischigen Laubblätter sind an den Spitzen rot. Wie sich später herausstellt, handelt es sich um eine Suaeda, die Strand-Sode. Wo die Flut nur wenige Male im Jahr hingelangt, wachsen auch verschiedene Gräser. Nach Wuchshöhe, Umfang und Dicke der Blätter sowie nach Fruchtstand unterscheiden sie sich. Viele gehören zum Schlickgras, mit dem man die Erosion des Schlickwatts verhindern will. Ich sehe auch Meerlavendel, der ganz anders als sein festländischer Namensvetter aussieht.
Bis im 18. Jahrhundert die wissenschaftliche Bestandsaufnahme der Natur im eigentlichen Sinne begann, glaubten viele, dass jede Pflanze und jedes Tier des Festlands am oder im Meer ein Gegenstück besaß. Ein Erbe dieser Zeit sind die vielen Pflanzen und Tiere, deren Namen mit »See-« oder »Meer-« anfangen, obwohl sie kaum Ähnlichkeit mit ihren vermeintlichen Festlandsverwandten aufweisen. So blüht der Meerlavendel anders als der Gartenlavendel nicht an langen, grauen Stielen, sondern in niedrigen, trockenen Büschen, die ich beim Vorbeigehen zum Rascheln bringe.
Der Bodenbewuchs besteht vor allem aus Strand-Salzmelden, kleinen Büschen mit salbeiartigen Blättern, die angeblich essbar sind und von skandinavischen Modeköchen sehr gelobt werden, an die ich mich aber noch nicht herangetraut habe. Nur etwas Meerfenchel nehme ich für die heimische Küche mit. Er sprießt ein bisschen weiter unten aus dem getrockneten Schlick. Zu den anderen Pflanzen gehören ein großer Wegerich mit spatelförmigen Blättern, die weichen, grauen, aromatischen Blätter des Strandbeifußes, die malvenfarbenen und gelben Blüten der Strandaster und viele andere, die ich nicht bestimmen kann.
Bei meinem einzigen früheren Besuch hier war mir aufgefallen, wie bei besonders hohem Wasser große Mengen von totem Laub und Grashalmen zusammen mit Schaumbergen fortgespült wurden. Mich würde interessieren, wie viel Pflanzenabfall auf diese Weise das Meer erreicht und was mit ihm passiert und wie viele tote Hinterlassenschaften des Meeres umgekehrt von der Flut an den Stränden abgeladen werden.
Dass ich nichts aus Plastik an mir vorbeischwimmen sehe, freut mich allerdings. Wie an so vielen Küsten zeichnet sich jedoch auch hier die Hochwasserlinie durch eine Mischung aus bunten Plastikflaschen, zerrissenen Fischernetzen und jeder Menge Leinen, Bändel und Kordeln aus, die aus dem faulenden Tang hervorglänzen. Winden und Wasser transportieren dieses Strandgut oder Treibgut (die Bedeutung dieser Wörter wird mir später klarwerden) über große Entfernungen und verteilen es dann an den Stränden. Kaputte Plastikschäufelchen und verknitterte Luftballons, die wie durchsichtige Meerestiere vor mir liegen, stammen sicherlich aus der Nähe. Aber hier und da erspähe ich den Teil einer norwegischen Transportkiste für Fische oder eine Flasche mit kyrillischer Aufschrift. Sie legen Zeugnis ab von Verschwendung und mangelndem Umweltbewusstsein, aber natürlich auch von den Bewegungen von Ebbe und Flut.
Etwas unterhalb der Linie, wo die Strand-Salzmelde nicht mehr wächst, fällt der Schlick plötzlich steil ab. Über viele Hektare war er völlig flach und gehörte sichtlich zu einer Landschaft, die auf die See angewiesen ist und von ihr stabilisiert wird. Der erste halbe Meter eines so steilen Teilbereichs besteht vor allem an der Südseite oft aus aufgesprungenem Schlick, der also nicht von jeder Flut bedeckt wird. Der Meerfenchel der Ebene und seine Nachbarn wachsen hier nicht, dafür aber andere Pflanzen. Mir springt vor allem eine ins Auge, deren viele winzige, artischockenartige Köpfchen jeweils eine große Zahl noch verschlossener gelber Blüten enthalten.
Die unmittelbar darunterliegende Schicht ist feuchter und von einer königsblauen Algenblüte bedeckt. Es folgt ein Streifen scheinbar leeren Schlicks und danach der eigentliche Tang. Dunkel klammert er sich an die Brückenpfeiler, und er hängt in Fransen herab, sobald das Wasser sich zurückzieht. Hier und da sieht man fast durchsichtige, grüne Tangwedel. Ich muss aufpassen, dass ich nicht dauernd ausrutsche. Dem aufmerksamen Beobachter erschließt sich eine beeindruckende Pflanzenvielfalt. Aber vor allem die vertikale Ordnung ist faszinierend. Jede Pflanze bleibt auf Linie, als hätte sie Angst vor der ordnungsstiftenden Macht der bald zurückkehrenden Flut.
Es ist zwei Uhr. Das Wasser steht. Altweibersommer nach der Urlaubszeit. Ich bin allein auf dem Marschland. Das Wasser ist wieder so glatt wie bei Sonnenaufgang, die leichte Brise reicht nicht mehr bis zu seinem tiefen Spiegel herunter. Ein letztes, winziges, aber schnelles Rinnsal schwemmt einigen Schlick in den Hauptarm, in dessen langsamerem Wasser er sich zu einer trägen Haut verbreitert.
An den allertiefsten Stellen besitzt der Schlick eine andere Farbe. Mit ihm wird eine senfgelbe Blütenschicht sichtbar. Möwen haben ihre Fußabdrücke hinterlassen. Einige deuten, ganz wie meine, darauf hin, dass sie ausgerutscht sind. Auch dies ist eine überraschende Entdeckung.
Auch nachdem es seinen Tiefststand erreicht hat, steht das Wasser noch lange still, jedenfalls wenn ich Niedrigwasser als den genauen Mittelpunkt zwischen zwei Hochwasserhöhen definiere. Ich weiß aber nicht genau, ob das so richtig ist, und meine Gezeitentafel hilft mir nicht weiter, denn sie zeigt nur die Hochwasserhöhen an.
Plötzlich sehe ich etwas Eigenartiges. Breite, kleine Wellen dringen in den flachen, ruhigen Hauptwasserlauf vor, und zwar gegenläufig zu den letzten abfließenden Rinnsalen. Neues Wasser setzt sich über das alte hinweg – mit einem so komplexen Bild hatte ich nicht gerechnet. Kann Wasser gleichzeitig kommen und gehen? Wenige Augenblicke später sind die kleinen Wellen verschwunden. Hat mir die heiße Sonne einen Streich gespielt? Die Gezeiten werden mich doch nicht zum Narren halten, sie sind doch sicher majestätisch und unwandelbar ehrlich?
Gegen vier Uhr werde ich ungeduldig. Ich bin überhaupt nicht eins mit der Natur, sondern frage mich, ob die Flut je wiederkommen wird. Der Zeitpunkt genau in der Mitte zwischen zwei Höchstständen liegt schon drei Stunden zurück. Wie kann es zu solchen Unregelmäßigkeiten kommen? Sind die Gezeiten nicht eine gut geölte Maschine wie ein oszillierender Kolben, dessen Bewegung mathematisch als Sinuskurve beschreibbar ist, die aussieht wie eine ungebrochene Wasserwelle? Gibt es diese Störungen überall oder nur hier? Bei jedem Gezeitenwechsel oder eher selten? Was ist da mit dem kosmischen Uhrwerk los?
Die gleichmäßige Bewegung von Mond und Sonne wird doch sicher für einen ebenso ruhigen Puls des Meeres sorgen. Warum also diese Unregelmäßigkeiten? Diese Verspätungen? Sobald ich alle Daten für meinen Gezeitenzyklus zusammen habe, werde ich sie als Diagramm darstellen. Dann lässt sich ablesen, wie sich das Wasser zwischen zwei Höchstständen wirklich verhält. Die Winkel des Graphen werden zeigen, wie schnell sich meine kleine Bucht geleert und wieder gefüllt hat.