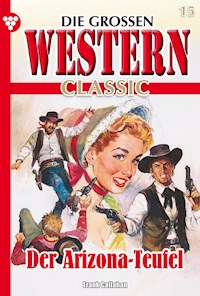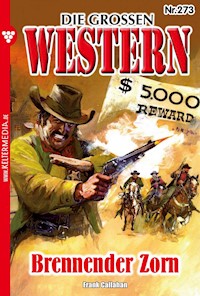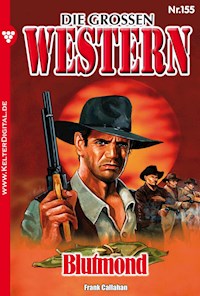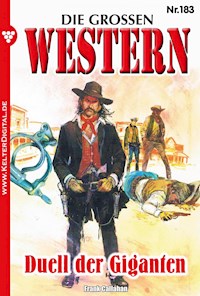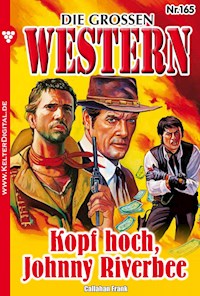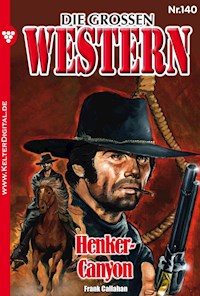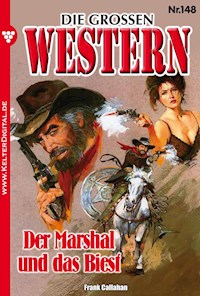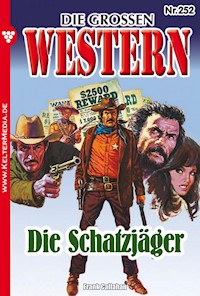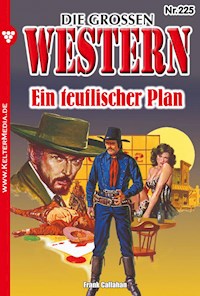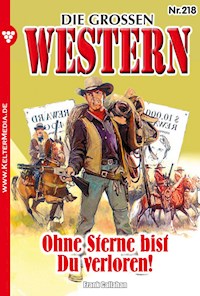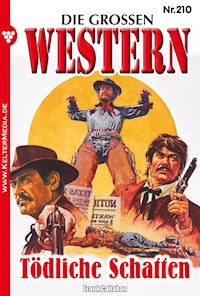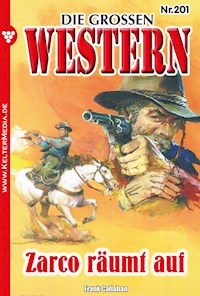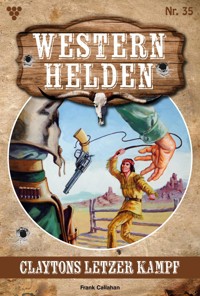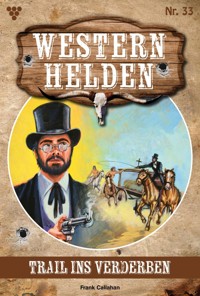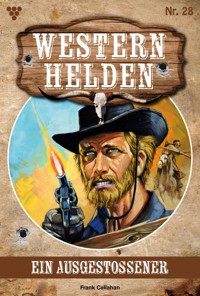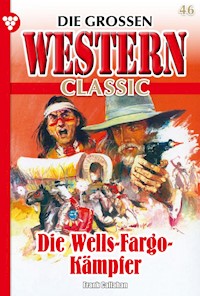
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western Classic
- Sprache: Deutsch
Nun gibt es eine exklusive Sonderausgabe – Die großen Western Classic Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Dieser Traditionstitel ist bis heute die "Heimat" erfolgreicher Westernautoren wie G.F. Barner, H.C. Nagel, U.H. Wilken, R.S. Stone und viele mehr. »Apachen!« George McGregor starrte überrascht zurück. Über ein Dutzend Krieger sprengte eben um die Felsgruppe. Der Kutscher spornte das Gespann an, während der Beifahrer Ben Stewart die Winchester aus der Halterung zerrte und sofort zu feuern begann. »Hölle!«, murrte der Fahrer. »Ich dachte, wir hätten sie abgehängt!« Ben feuerte erneut. Einer der Verfolger riss die Arme hoch und stürzte vom Pferderücken. Kugeln und Pfeile sirrten heran. Die Geschosse bohrten sich in den Aufbau der Kutsche. Auf ihren flinken Mustangs kamen die Krieger rasch näher. Kriegsgeschrei gellte. George McGregor schwang die lange Peitsche und brüllte sich die Kehle heiser, um das Sechsergespann mehr anzutreiben. Bert Stewart jagte Kugel um Kugel aus dem Lauf der Winchester. Drei Mustangs stürzten und katapultierten die Reiter auf den steinigen Boden. Jetzt schoben auch zwei Männer ihre Köpfe aus den Fenstern der Stage Coach. Ihre Revolver spuckten Blei. Die wenigen Apachen, die noch auf den Pferden saßen, drehten ab und ließen die Postkutsche ziehen. »Geschafft«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western Classic – 46 –Die Wells-Fargo Kämpfer
Frank Callahan
»Apachen!« George McGregor starrte überrascht zurück. Über ein Dutzend Krieger sprengte eben um die Felsgruppe. Der Kutscher spornte das Gespann an, während der Beifahrer Ben Stewart die Winchester aus der Halterung zerrte und sofort zu feuern begann. »Hölle!«, murrte der Fahrer. »Ich dachte, wir hätten sie abgehängt!« Ben feuerte erneut. Einer der Verfolger riss die Arme hoch und stürzte vom Pferderücken. Kugeln und Pfeile sirrten heran. Die Geschosse bohrten sich in den Aufbau der Kutsche. Auf ihren flinken Mustangs kamen die Krieger rasch näher. Kriegsgeschrei gellte.
George McGregor schwang die lange Peitsche und brüllte sich die Kehle heiser, um das Sechsergespann mehr anzutreiben.
Bert Stewart jagte Kugel um Kugel aus dem Lauf der Winchester.
Drei Mustangs stürzten und katapultierten die Reiter auf den steinigen Boden.
Jetzt schoben auch zwei Männer ihre Köpfe aus den Fenstern der Stage Coach. Ihre Revolver spuckten Blei.
Die wenigen Apachen, die noch auf den Pferden saßen, drehten ab und ließen die Postkutsche ziehen.
»Geschafft«, knurrte McGregor zufrieden.
Er wandte sich seinem Partner zu und erschrak.
Ben Stewart hockte zusammengekrümmt neben ihm auf dem Kutschbock. Ein Pfeil ragte aus der Schulter.
Der Verletzte hielt sich mit letzter Kraft fest, in seinem bleichen Gesicht stand der Schmerz.
»Nicht anhalten, Kumpel«, ächzte der Verwundete. »Ich halte schon durch. Du darfst kein Risiko eingehen. Der Kratzer bringt mich nicht um.«
George McGregor war da ganz anderer Meinung. Die Wunde sah übel aus.
Blut färbte die Lederjacke des Gefährten dunkel.
Der Oberkörper schwankte immer mehr. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis Ben Stewart vom Kutschbock stürzen würde.
Der Kutscher blickte auf das graue Band der Poststraße zurück, das sich zwischen Hügeln und Felsen hindurchschlängelte. Er konnte keinen Indianer entdecken.
Die Apachen hatten wohl genug, würden sich erst einmal um die Verwundeten und Toten kümmern und ihre Wunden lecken. Natürlich war es aber möglich, dass weitere Kriegshorden durch das Land streiften und in der Stage Coach eine willkommene Beute sahen.
McGregor ließ es langsamer angehen. Das Gespann kam nach einigen hundert Yards in einer Staubwolke zum Stehen.
Der Körper des Begleitmannes sackte in sich zusammen. George packte rasch zu, sonst wäre Ben Stewart vom Kutschbock gestürzt.
Zwei Männer verließen die Kutsche, schoben die Stetsons in den Nacken und rückten die Revolvergurte zurecht. Einer von ihnen, ein großgewachsener und schlanker Mann, knapp 30 Jahre alt, nahm den Verwundeten vom Bock und bettete ihn ins kniehohe Gras.
»Danke, Mister Wood«, sagte George McGregor.
Er wandte sich an den anderen Mann, der sich über den Verwundeten beugte und ein skeptisches Gesicht zog.
»Auch Ihnen danke ich, Mister Jordan. Ohne Ihre Hilfe hätten sich die Rothäute unsere Skalps geholt.«
Ray Jordan, ein untersetzter und breitschultriger Mann von ungefähr vierzig Jahren, sah den Driver ernst an.
»Ihr Beifahrer hat ’ne Menge Blut verloren«, erklärte er. »Wir müssen den Pfeil entfernen. Das übernehme ich. Halten Sie Ben fest, sonst geht er senkrecht in die Luft.«
Der Begleitmann lächelte verzerrt. Das bleiche Gesicht war schweißbedeckt. Er biss die Zähne so fest aufeinander, dass es knirschte, und holte dann tief Atem. »Macht schon«, stöhnte er. »Ich halte das schon durch. Aber holt mir die verdammte Pfeilspitze aus dem Körper.«
Ray Jordan legte die Wunde frei und schnitt eine Kerbe in den Pfeilschaft, ehe er ihn abbrach.
Dann entfachte er ein kleines Feuer, erhitzte die Spitze seines Bowie-Messers und machte sich an die Arbeit.
George McGregor und Gerald Wood hielten den Verwundeten fest. Der Mann stöhnte, ächzte und keuchte, wurde aber bewusstlos. Blut färbte Jordans Hände rot. Endlich hielt er die Pfeilspitze in der Hand.
»Haben Sie irgendwo ’ne Whiskypulle versteckt?«
McGregor nickte und brachte eine Flasche mit der bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Der untersetzte Mann nahm einen Schluck, schmatzte zufrieden, ehe er den Whisky über die Wunde schüttete.
Ben Stewart schrie auf und wollte sich losreißen, dann aber erschlaffte der geschwächte Körper von einer Sekunde zur anderen.
»Sorry«, murmelte Ray Jordan. »Es ist aber besser für dich. Ich bin nämlich noch nicht fertig.«
Der breitschultrige Mann, der wie ein Spieler gekleidet war, zog eine Patrone aus dem Revolvergurt, entfernte das Blei und schüttete das Pulver in die offene Wunde.
Dann riss er ein Schwefelholz am Stiefelschaft an und entzündete das Pulver. Eine Stichflamme schoss empor.
»Her mit dem Verbandszeug, Driver«, sagte er zu McGregor.
Kurze Zeit später lag der Verwundete im Innern der Stage Coach. Ray Jordan nahm ihm gegenüber Platz, während Gerald Wood sich neben den Fahrer auf den Kutschbock hockte.
»Ich glaube kaum, dass uns die Apachen vor der Town noch angreifen werden«, meinte der großgewachsene Mann. »Sie können es ruhig langsam angehen lassen. Bis nach Tucson sind es höchstens noch vier oder fünf Meilen. Also bringen Sie Ihre Hoppagäulchen schon in Schwung!«
George McGregor löste den Bremshebel und schwang die Peitsche über den Köpfen des Gespanns.
Die Postkutsche setzte die Fahrt fort.
Kein Apache ließ sich blicken. Es schien, als wäre der Überfall nichts anderes als ein teuflischer Spuk gewesen.
*
»Darf ich ’nen Whisky spendieren, Gents?«, fragte George McGregor zwei Stunden später und trat neben Gerald Wood und Ray Jordan an den Tresen.
»Da sagen wir nicht nein, George«, antwortete Wood lächelnd. »Außerdem sollten wir alle Förmlichkeiten weglassen, wie geht’s eigentlich Ben Stewart? Hast du ihn zum Doc gebracht?«
»Ben wird’s schaffen«, meinte der Driver zufrieden und begrüßte den Keeper hinter der Theke. »Das hat wenigstens der Knochenflicker behauptet. Und er sagte auch, dass du gute Arbeit geleistet hast, Ray.«
Der wie ein Spieler gekleidete Mann nickte.
»War nicht der erste Pfeil, den ich entfernt habe«, sagte er.
»Mir hat er mal ’ne halbe Unze Blei aus der Schulter geholt«, erklärte Gerald Wood. »So rettete er mir das Leben. Seitdem sind wir Freunde. Wir sollten jetzt aber trinken, damit die Pferdespucke nicht verdunstet.«
Die drei Männer prosteten sich zu und jagten den Whisky durch die Kehlen.
Gerald Wood winkte den Salooner heran, der die Gläser erneut vollschenkte und die Flasche gleich stehen ließ.
»Wie lange geht das schon mit diesen Überfällen?«, fragte Ray Jordan.
»Seit ungefähr vier Wochen ist die Hölle los«, antwortete der Postkutschenfahrer. Heißer Zorn schwang in seiner Stimme mit. »Die Apachen blieben lange Zeit friedlich. Keiner weiß, warum sie plötzlich durchdrehen und immer wieder über die Stage Coachs herfallen. Die Wells Fargo Company macht seit Wochen riesige Verluste. Kaum jemand vertraut uns Waren an, da auch Frachtzüge überfallen wurden. Die Passagiere für die Stage Coach werden von Tag zu Tag weniger. Keiner will das Risiko eingehen, seinen Haarschopf an die Indianer zu verlieren.«
George McGregor fuhr mit der Hand durch den mächtigen Bart, der Kinn und Wangen bedeckte, griff nach dem Glas und trank. Er stellte das Glas auf den Tresen zurück und sah die beiden Männer forschend an.
»Ihr habt’s ja selbst erlebt, wie schnell und frech die Roten zuschlagen. Ohne eure beiden Revolver hätten wir es nie geschafft. In Tombstone und in Benson geht’s inzwischen ebenfalls rund. Bald werden die Towns von der Außenwelt abgeschnitten sein. Dann geht’s uns allen ganz schön an den Kragen. Das könnt ihr mir glauben.«
McGregor leckte über die Lippen und trank erneut, nachdem Gerald Wood nachgeschenkt hatte.
Dann legte der Oldtimer den Kopf leicht schief und blickte die beiden Männer aus listig funkelnden Augen an.
»Was führt euch eigentlich in diese Gegend?«, fragte er. »Well, Ray sieht wie ein Gambler aus, der in Tucson auf den dicken Pott hofft und groß absahnen möchte. Und dich, Gerald, halte ich für einen Revolverkämpfer, der seinem Partner den Rücken decken will.«
Die beiden Partner grinsten.
»Warum fragst du eigentlich, wenn du sowieso alles weißt?«, sagte Ray Jordan. »Ich gelte als einer der besten Spieler jenseits des Mississippis. Gerald ist einer der ganz Großen bei den Revolvermännern. Bist du nun zufrieden, Alterchen?«
Der Oldtimer richtete sich gerade.
»Dann passt nur auf, dass euch Charles Blaisdell nicht auf die Hühneraugen tritt. Er ist so was Ähnliches wie der große Boss hier in Tucson und hat die Hände fast in allen Geschäften, die hier laufen. Die Wells Fargo Company hat viel Ärger mit dem Burschen, da einige Wagenladungen mit Waren den Indianern in die Hände gefallen sind. Er verlangte Schadenersatz, und die Frachtgesellschaft musste zähneknirschend zahlen.«
»Wie lange hat dieser Blaisdell schon das Sagen in der Stadt?«, wollte Gerald Wood wissen.
»Seit ungefähr einem halben Jahr«, antwortete McGregor. »Er kam in die Stadt und kaufte recht schnell drei Saloons und ein Restaurant. Es dauerte nicht lange, dann war er an einigen anderen Geschäften und Handwerksbetrieben beteiligt. Charles Blaisdell muss über ’ne Menge Greenbacks verfügen.«
Ray Jordan nickte nachdenklich.
»Er macht also lange Schritte, um es einmal so auszudrücken«, sagte er ruhig. »Hat er sich schon mit dem Sheriff angelegt?«
Der Stage Coach Driver winkte ab.
»Ach was. Blaisdell und Sheriff Hunter sind ein Herz und eine Seele. Blaisdell hat bis jetzt niemanden in den Staub getreten, wenn du das meinst, Ray. Er bot immer ’ne Menge Dollars – meist sogar mehr, als die Geschäfte wert waren. Und so wurde er innerhalb kürzester Zeit der ungekrönte King von Tucson. Wenn man den Gerüchten trauen kann, will er sich bei der nächsten Wahl zudem zum Bürgermeister wählen lassen.«
Gerald Wood wischte mit dem Handrücken übers Kinn und verscheuchte eine hartnäckige Fliege.
»Nicht schlecht«, sagte er. »Ich frage mich aber, warum du Charles Blaisdell nicht magst, McGregor.«
»Ich?«, entrüstete sich der graubärtige Alte und starrte den Revolverkämpfer erstaunt an.
»Genau. Das habe ich deutlich aus deinen Worten herausgehört. Vielleicht bist du aber nur neidisch auf den erfolgreichen Geschäftsmann. Sollte etwas anderes dahinterstecken, dann sag’s uns.«
George McGregor nagte an der Unterlippe. Er schien sich plötzlich nicht besonders wohl in seiner Haut zu fühlen.
»Heiliger Hosenträger«, ächzte er. »Zum Henker, ich kenne euch zu wenig, Jungs. Vielleicht steht ihr bereits auf Charles Blaisdells Lohnliste und schwärzt mich später bei ihm an.«
»Unsinn, Oldman«, sagte Ray Jordan. »Blaisdell interessiert uns eben. Das ist alles. Wir sind neu in der Town und müssen deshalb wissen, was hier läuft, sonst stehen wir bald im Regen.«
Gerald Wood stimmte den Worten seines Begleiters zu.
»Wir müssen wissen, welche Strömungen und Gruppierungen es hier gibt«, erläuterte er. »Eigentlich sind wir nach Tucson gekommen, um uns die Town in die Tasche zu stecken.«
Der Oldtimer staunte schon wieder.
»Was es nicht alles gibt!«, spottete er.
»Traust du uns das nicht zu?«, fragte der Gambler.
»Ihr seht nicht gerade wie Chorknaben für die Sonntagsschule aus«, räumte der Alte ein. »Ihr seid meiner Meinung nach zwei verdammt harte Brocken, die dem Teufel schon mehr als einmal in die Suppe gespuckt haben. Richtig, Jungs?«
Die Freunde grinsten um die Wette.
»Aber jetzt sag uns, was du gegen Charles Blaisdell hast, McGregor, du kannst uns vertrauen.«
Der Oldman zierte sich noch ein bisschen.
»Na gut«, seufzte er dann. »Es gehen Gerüchte um, dass Charles Blaisdell eine eigene Frachtgesellschaft gründen will. Dazu eine Stage Coach Linie. Das schmeckt mir nicht. Immerhin verdiene ich schon seit über zehn Jahren mein Brot bei Wells Fargo. Ich bin immer gut behandelt worden, verstehe mich auch mit dem Boss und den anderen Jungs ausgezeichnet. Und nun sieht es so aus, als würde Wells Fargo hier im südlichen Teil des Arizona-Territoriums aufgeben müssen. Blaisdell macht einfach zu große Schritte.«
Gerald Wood und Ray Jordan sahen sich kurz an, und ein wortloses Verstehen herrschte zwischen den Partnern.
»Das wäre alles halb so schlimm, McGregor«, meinte Gerald Wood. »Charles Blaisdell würde dich bestimmt als Driver übernehmen, weil du über viel Erfahrung verfügst und Land und Leute kennst. Um den Lohn brauchst du dir dann keine Sorgen zu machen.«
George McGregor winkte wütend ab.
»Du kapierst überhaupt nichts«, knurrte er übellaunig, übersah dabei das vergnügte Funkeln in den Augen des Revolvermannes. »Mir geht’s nicht um die Bucks, sondern um Wells Fargo, die hier in mühevoller Arbeit den Fracht- und Passagierbetrieb aufgebaut hat. Außerdem bin ich kein Jüngling mehr. Es wäre gut möglich, dass sich Blaisdell jüngere Leute sucht. Das ist aber nicht das Problem, wie ich bereits andeutete. Ich mag es nicht, wenn sich großkotzige Burschen ins gemachte Nest setzen und eine alte Firma verdrängen.«
»So schlimm wird’s ja kaum werden«, meinte der Spieler. »Wells Fargo ist auf dem Weg, eine der größten Unternehmungen dieser Art zu werden. Da steht ’ne Menge Kapital dahinter. So leicht geben sich die Bosse der Company nicht geschlagen.«
»Bis jetzt scheinen die Jungs bei Wells Fargo geschlafen zu haben. Da tut sich überhaupt nichts, obwohl Stan Mannigan, dem hiesigen Leiter, das Wasser bereits bis zum Hals steht.«
»Ich komme da nicht so ganz mit«, meinte Gerald Wood. »Charles Blaisdell hätte doch die gleichen Probleme mit den Indianern. Den Roten ist es doch völlig egal, welcher Company die Stage Coachs gehören. Die Apachen sind auf Beute aus – mehr nicht!«
McGregor nickte.
»Das stimmt schon, Gerald«, gab er zu. »Ich habe aber läuten gehört, dass Charles Blaisdell über ein Dutzend hartbeiniger Schießer anwerben will. Die Gunner sollen die Kutschen schützen. Außerdem will er die Armee auffordern, Stage Coachs und die Frachtwagen zu begleiten.«
»Das hat Wells Fargo bestimmt auch von den Blauröcken gefordert«, meinte Jordan.
»Natürlich, doch mein Boss erhielt eine Absage nach der anderen. Die Soldaten sind nun mal sehr dünn in diesem Gebiet gesät und haben angeblich ’ne Menge anderer Aufgaben zu lösen, wenigstens im Moment. Wer von uns kennt schon die Beziehungen, die Blaisdell zu den Soldiers hat?«
»Woher weißt du eigentlich von Blaisdells Plänen?«
»Ich habe einen seiner Leute ein wenig ausgefragt, als er einen über den Durst getrunken hatte. Der Bursche wollte mich sogar anwerben. Ich fürchte, dass dieser Big Boss alles tun wird, um viele Driver der Wells Fargo ins andere Lager zu holen. Und die Stimmung unter meinen Kollegen ist verdammt mies geworden und wird von Woche zu Woche schlimmer. Es hat zu viele Tote und Verwundete gegeben. Wir riskieren bei jeder Fahrt Kopf und Kragen. So kann’s auf die Dauer auf keinen Fall weitergehen.«
Gerald und Ray nickten beruhigend.
»Mach dir keine großen Sorgen, McGregor«, sagte Gerald Wood. »Vielleicht geben die Apachen schon bald auf und ziehen sich in ihre Apacheria zurück. Mich würde nur interessieren, wie die Rothäute an die modernen Winchestergewehre herangekommen sind.«
Die Hände des Oldtimers ballten sich zu Fäusten.
»Das würde mich auch mal interessieren. Und nicht nur mich. Irgendein skrupelloser Hurensohn hat sie an die Apachen verhökert und sich dabei bestimmt eine goldene Nase verdient.«
Ray Jordan und Gerald Wood sahen sich ernst an.
»Nimm noch ’nen Schluck, McGregor«, sagte der Gambler. »Dann sieht die Welt nicht mehr so düster aus. Aber jetzt verrat uns mal, wohin deine nächste Fahrt geht!«
*
»Da kommt die Stage Coach«, sagte Gerald Wood und blickte zur Postkutsche hinüber.
Sie war einen Steinwurf von den beiden Männern entfernt. Und nur eine halbe Meile hinter der heranjagenden Kutsche waren die letzten Häuser von Tucson zu sehen.
»Hoffentlich hält uns McGregor nicht für Outlaws«, meinte Ray Jordan.
Er folgte dem Partner, der auf den Postweg trat und mit beiden Händen zu winken begann.
Es zeigte sich, wie gut der Oldtimer sein Gespann beherrschte. Die Kutsche kam wenige Yards vor den Gefährten zum Stehen. Eine große Staubwolke wallte auf.
»Was soll das, Jungs?«, rief McGregor, während Gerald und Ray näher traten. »Ist euch der Whisky nicht bekommen, oder was?«
»Wir klettern jetzt in die Kutsche, und du nimmst uns einige Meilen mit«, sagte der Gambler. »Wie wir sehen, hast du weder ’nen Beifahrer noch Reisende dabei. Das haben wir herausgefunden. Wir möchten nicht zulassen, dass du eine zu leichte Beute für die Apachen wirst.«
Der Oldman schob den speckigen Lederhut in den Nacken und kratzte sich am Bart, ehe er die Schultern hob.