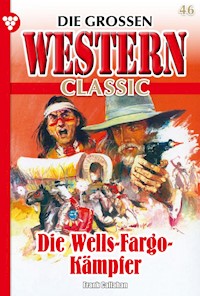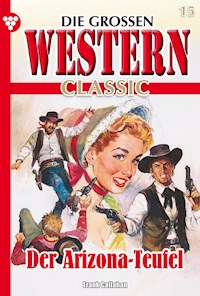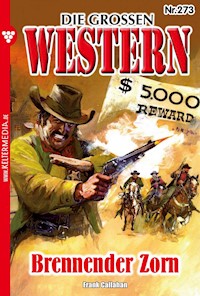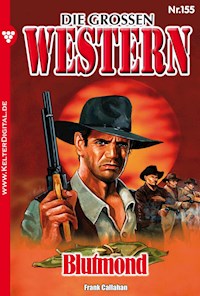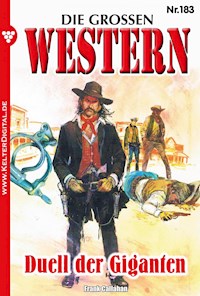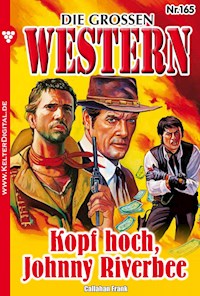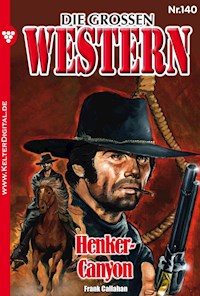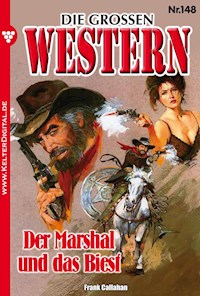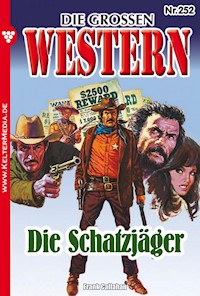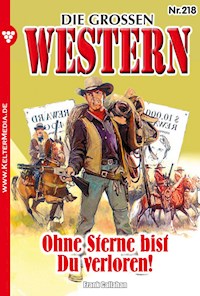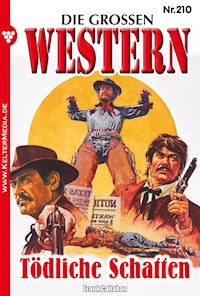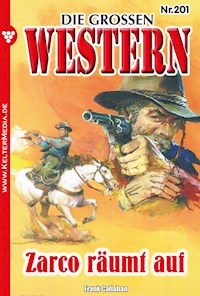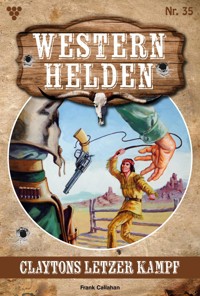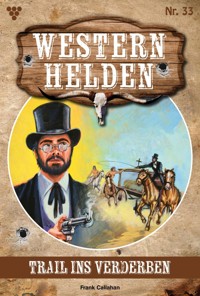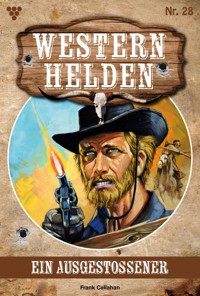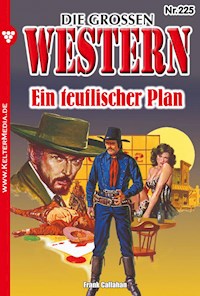
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). »Hast du Sorgen?« fragt Gregory Heavens seinen Vormann und legt ihm die Hand auf die Schulter. Neil O'Conner wendet sich seinem Boß zu. Er lächelt, und dann fährt er sich mit gespreizten Fingerspitzen durch sein rotblondes Haar. Er schüttelt den Kopf. »No, Gregory«, antwortet er. Die beiden Männer stehen am Pferdecorral und beobachten gespannt, wie ein Cowboy einen Mustang zuzureiten versucht. Man könnte die beiden für Brüder halten, so sehr gleichen sie sich. Sie sind hochgewachsen und sehr schlank, braungebrannt, und beide haben blaue Augen. Nur in der Haarfarbe unterscheiden sie sich. Der Rancher Gregory Heavens hat dichtes schwarzes Haar, das er sehr kurz geschnitten trägt. »Du kommst mir in den letzten Wochen so merkwürdig vor«, beginnt Gregory wieder und beobachtet aufmerksam die Reaktion seines Vormanns. Dieser stößt ein heiseres Lachen aus. »Es ist nichts«, sagt er, und für Sekundenbruchteile sehen sie sich in die Augen. Sie schlendern um den Corral und lachen, als der Cowboy nun aus dem Sattel geschleudert wird und in hohem Bogen durch die Luft fliegt. »Du kannst jederzeit zu mir kommen, falls du dich einmal aussprechen willst«, sagt Gregory Heavens und sieht die Unmutsfalte, die auf Neils Stirn sichtbar wird. »Ich bin zwar dein Boß, Neil, aber auch dein Freund. So habe ich immer gedacht.« »Okay, Boß«, knurrt Neil O'Conner. »Wenn ich dir mein Herz ausschütten will, melde ich mich! Okay…?« Er sagt es sehr bestimmt, und für ihn ist dieses Thema damit beendet. Mit einem Sprung schwingt sich der Vormann über das Gatter und ist mit wenigen Schritten bei dem schnaufenden und mit den Hufen scharrenden Pferd. Es weicht
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 225 –Ein teuflischer Plan
Frank Callahan
»Hast du Sorgen?« fragt Gregory Heavens seinen Vormann und legt ihm die Hand auf die Schulter.
Neil O’Conner wendet sich seinem Boß zu. Er lächelt, und dann fährt er sich mit gespreizten Fingerspitzen durch sein rotblondes Haar.
Er schüttelt den Kopf.
»No, Gregory«, antwortet er.
Die beiden Männer stehen am Pferdecorral und beobachten gespannt, wie ein Cowboy einen Mustang zuzureiten versucht.
Man könnte die beiden für Brüder halten, so sehr gleichen sie sich. Sie sind hochgewachsen und sehr schlank, braungebrannt, und beide haben blaue Augen. Nur in der Haarfarbe unterscheiden sie sich.
Der Rancher Gregory Heavens hat dichtes schwarzes Haar, das er sehr kurz geschnitten trägt.
»Du kommst mir in den letzten Wochen so merkwürdig vor«, beginnt Gregory wieder und beobachtet aufmerksam die Reaktion seines Vormanns.
Dieser stößt ein heiseres Lachen aus.
»Es ist nichts«, sagt er, und für Sekundenbruchteile sehen sie sich in die Augen.
Sie schlendern um den Corral und lachen, als der Cowboy nun aus dem Sattel geschleudert wird und in hohem Bogen durch die Luft fliegt.
»Du kannst jederzeit zu mir kommen, falls du dich einmal aussprechen willst«, sagt Gregory Heavens und sieht die Unmutsfalte, die auf Neils Stirn sichtbar wird. »Ich bin zwar dein Boß, Neil, aber auch dein Freund. So habe ich immer gedacht.«
»Okay, Boß«, knurrt Neil O’Conner. »Wenn ich dir mein Herz ausschütten will, melde ich mich! Okay…?«
Er sagt es sehr bestimmt, und für ihn ist dieses Thema damit beendet.
Mit einem Sprung schwingt sich der Vormann über das Gatter und ist mit wenigen Schritten bei dem schnaufenden und mit den Hufen scharrenden Pferd.
Es weicht vor ihm zurück, bäumt sich plötzlich auf, und Sekundenbruchteile später treffen die Hufe die Stelle, wo Neil gerade noch gestanden hat. Dieser aber hat sich mit einem Satz in Sicherheit gebracht.
»Komm zurück, Neil«, ruft der Rancher. »Das Pferd ist gefährlich, und ich kann in den nächsten Tagen und Wochen keinen Vormann mit gebrochenen Rippen brauchen.«
Neil O’Conner stößt einen wilden Schrei aus, und dann sitzt er schon im Sattel.
Der Mustang ist im ersten Moment überrascht und bleibt für einige Sekunden wie ein Standbild stehen, doch dann scheint er zu explodieren.
Er geht senkrecht mit allen vieren in die Luft, und als er wieder auf dem Boden ankommt, macht er einen richtigen Katzenbuckel. Doch Neil kann sich im Sattel halten. Er stößt dem Pferd die Stiefelabsätze in die Weichen, und dieses rast plötzlich los.
Und dann rammt das wilde Pferd die beiden Vorderhufe in den Boden und keilt nach hinten aus. Das kommt auch für Neil O’Conner zu überraschend, er wird aus dem Sattel geschleudert und fliegt einige Meter durch die Luft, dann schlägt er hart auf den Boden auf.
Gregory Heavens stößt einen Angstschrei aus, doch Neil erhebt sich sofort wieder. Leicht humpelnd erreicht er das Gatter und zieht sich hoch. Gerade rechtzeitig, denn schon ist der Mustang heran und will ihn rammen.
Gregory ist sofort bei seinem Freund, und dieser hilft ihm über das Gatter.
»Damned«, flucht Neil O’Conner und untersucht seinen rechten Fuß. »Ich habe das Biest unterschätzt. Es ist ein richtiger Satansbraten.«
Gregory lacht.
»Was hast du denn erwartet? Er ist nun einmal kein lammfrommer Gaul. Hast du dich verletzt…?«
Die Stimme des Ranchers wird ernst. Neil O’Conner schüttelt den Kopf. »Halb so schlimm, Gregory. Ich habe mir den Fuß nur leicht vertreten. Bis morgen wird es vergessen sein.«
Er wirft dem Mustang noch einen kurzen Blick zu. Das Pferd steht inmitten des Corrals und scharrt mit den Hufen.
Die beiden gleichaltrigen Männer überqueren den Ranchhof und betreten das geräumige und geschmackvoll eingerichtete Ranchgebäude.
»Whisky?« fragt der Rancher und holt eine halbvolle Flasche aus einem kleinen Wandschrank.
Neil nickt und reibt sich noch immer seinen Fuß. Gregory schenkt die Gläser voll.
Sie trinken sich zu.
»Reitest du mit in die Stadt?« fragt der Rancher, und Neil blickt interessiert auf. Langsam stellt er das leergetrunkene Glas auf den Tisch zurück.
»Okay«, lacht er dann. »Warum nicht? Ein wenig Abwechslung kann nicht schaden. Die Arbeit ist in den letzten Wochen hart genug gewesen.«
Gregory Heavens grinst, und sein Gesicht wirkt sehr jugendlich. Er fährt sich durch sein schwarzes Haar, und in seinen Augen blitzt es auf.
»Ich habe noch einige Vorbereitungen wegen des Verkaufs der großen Herde zu treffen. Und Jack Holm, der Viehverkäufer, will heute in die Stadt kommen.«
Die Männer erheben sich und verlassen das Haus. Sie satteln ihre Pferde und schwingen sich in die Sättel.
*
Dorothy Smith ist ein sehr hübsches Girl, und wenn sie über die Straße der kleinen Stadt geht, schauen ihr die Männer bewundernd nach. Sie hat langes, leicht rötliches Haar, ein schmales, ebenmäßiges Gesicht und grünblaue Augen. Ihre Figur läßt jedes Männerherz höher schlagen.
Sie ist sich dessen vollkommen bewußt, und es macht sie sehr selbstsicher.
Sie betritt den General-Store, und Norman Hill kommt ihr eilig entgegen.
»Was darf es heute sein, Miß Smith?« fragt er schmeichlerisch, und sie lächelt ihm zu. »Sie werden von Tag zu Tag hübscher«, schwärmt er. »Der Mann wird zu beneiden sein, der Sie einmal bekommt.«
Sie lacht nur, und dann gibt sie dem Storebesitzer eine Liste, auf der alles verzeichnet ist, was sie einkaufen will.
»Ich komme nachher wieder vorbei«, sagt sie mit ihrer glockenhellen Stimme. »Machen Sie bitte alles fertig.«
»Selbstverständlich, Miß Smith«, sagt Norman Hill und blickt ihr bewundernd nach, als sie den Laden verläßt.
Sie überquert die Straße und geht zu Mary Hanson, die sie immer besucht, wenn sie sich in der Stadt aufhält. Sie hört einen Cowboy pfeifen, doch sie reckt den Kopf nur noch höher.
Die beiden Freundinnen begrüßen sich sehr herzlich. Mary hat den Kaffeetisch schon gedeckt. Sie sitzen sich erzählend gegenüber und tauschen die letzten Neuigkeiten aus.
»Mit wem gehst du eigentlich auf den Sommerball?« fragt Mary neugierig, und sie sieht mit Genugtuung, daß Dorothy leicht errötet.
Dorothy zuckt mit den Achseln.
»Ich weiß es noch nicht. Bisher bin ich noch von keinem Gentleman eingeladen worden.«
Mary sieht sie ungläubig an.
»Das kannst du mir doch nicht weismachen«, sagt sie. »Du könntest an jedem Finger zehn haben, und jetzt…«
Dorothy unterbricht sie.
»Ich nehme an, daß mich heute noch jemand fragen wird!«
Sie lächelt sehr geheimnisvoll, und Mary sieht sie noch neugieriger an.
Dorothy blickt aus dem Fenster, und in diesem Moment sieht sie die beiden Reiter.
Es sind Gregory Heavens und Neil O’Conner.
Mary Hanson folgt dem Blick ihrer Freundin, und dann geht ein Lächeln über ihr Gesicht.
»Wer ist es denn von den beiden?« fragt sie leise, und Dorothys Gesicht wird schon wieder rot.
»Wenn ich das nur selbst wüßte«, antwortet sie. »Die beiden machen mir seit Wochen den Hof. Ehrlich gesagt, ich habe sie beide sehr gern. Ich kann mich nicht entscheiden.«
Mary sieht sie erstaunt an.
»Der Rancher und sein Vormann. Beide sind gutaussehend, knapp dreißig Jahre alt, und sie sind Freunde. Wenn das nur nicht ins Auge geht.«
Dorothy leert ihre Kaffeetasse.
»Ich muß weiter«, sagt sie und erhebt sich. »Ich besuche dich nächste Woche wieder. Vielleicht kann ich dir dann mehr erzählen und deine Neugierde stillen.«
Sie verabschieden sich.
Dorothy tritt aus dem Haus, und als sie den General-Store betreten will, wird sie angerufen.
Es ist Neil O’Conner, der herangeritten kommt und dann elastisch aus dem Sattel springt. »Hallo, Dorothy«, sagt er freundlich, und seine blauen Augen sind fest auf sie gerichtet. »Schön, daß ich dich treffe. So kann ich mir den weiten Ritt zu eurer Ranch ersparen.«
»Hallo, Neil«, sagt sie und reicht ihm die Hand. Er drückt sie zärtlich und hält sie für einige Augenblicke fest. Sie entzieht sie ihm.
»Was gibt es?« fragt sie und schaut ihn lächelnd an.
Er blickt in ihre Augen, und sie merkt seine Unsicherheit, seine Zweifel und seine Befürchtungen.
»Was ist?« fragt sie nochmals und nickt ihm aufmunternd zu.
»Es ist wegen des Sommerballs«, antwortet Neil dann und fühlt den dicken Kloß in seiner Kehle, der ihn am Weitersprechen hindert.
»Ja«, antwortet sie, und ihr Lächeln verstärkt sich.
Er sieht sie verlegen an.
»Ich weiß es«, sagt sie leise. »Dein Boß hat dich gebeten, mich für ihn einzuladen. So ist es doch, Neil…?«
Er starrt sie fassungslos an. Seine Mundwinkel zucken, und er fühlt sein Herz hart gegen die Rippen pochen.
Ihr Blick ist ernst auf ihn gerichtet.
»Und wie ist deine Antwort?« fragt er rauh und versucht verzweifelt, seine Beherrschung zu behalten.
Sie lacht hell auf.
»Sorry«, antwortet sie. »Du mußt deinem Boß absagen. Ich bin schon verabredet.«
Er blickt sich aus schmalen Augen an. Dann nickt er und tippt sich an den Stetson. Er will zu seinem Pferd gehen, doch sie hält ihn am Arm zurück.
»Interessiert es dich nicht, mit wem ich auf den Ball gehe?« fragt sie.
Er schüttelt den Kopf.
Jetzt wird sie ärgerlich und stampft heftig mit dem Fuß auf.
»Und ich sage es dir trotzdem. Ich gehe mit einem gewissen Neil O’Conner, der einen verdammt harten Dickschädel hat und der immer meint, nur der zweite Mann hinter seinem Freund und Boß zu sein.«
Sie sieht ihn wütend an. Ihre Augen funkeln, und sein Gesicht bekommt einen erstaunten Ausdruck.
»So, das mußte ich dir einmal sagen. Und wenn du im Laufe der Woche an unserer Ranch vorbeikommst, dann schaust du einen Sprung herein. Dann können wir alles weitere besprechen.«
Er will noch etwas sagen, doch sie läßt ihn einfach stehen.
Er sieht ihr verlegen und mit einem roten Kopf nach. Seine Augen blicken ungläubig, und langsam geht er zu seinem Pferd. Als er sich in den Sattel schwingen will, hört er Gregorys Stimme. Er wendet sich dem Freund zu.
»War das nicht gerade Dorothy?« fragt dieser und blickt ihn aufmerksam an.
Neil O’Conner nickt, und sein Gesicht bekommt plötzlich einen zufriedenen Ausdruck.
»Sie war es«, sagt er mit fester Stimme. »Ich habe Sie gerade für den Sommerball eingeladen.«
Gregory Heavens sieht ihn erstaunt an. Ein merkwürdiges Funkeln tritt in seine Augen, und sein Mund verzieht sich zu einem ärgerlichen Lächeln.
»Und…?« fragt er gespannt.
»Sie wird mit mir gehen«, sagt Neil fest. »Sorry, old friend, aber in diesem Jahr war ich schneller. Letztes Jahr hattest du das Vergnügen.«
Gregory lacht, doch es klingt recht gekünstelt.
»Nehmen wir noch einen Whisky?« fragt er und wartet die Antwort erst gar nicht ab, sondern geht schon auf den Saloon zu.
Neil O’Conner folgt ihm.
*
Wie eine hungrige Meute kommen sie auf den Ranchhof geritten, und ein Hauch von Gewalt und Gefahr geht von ihnen aus.
Mrs. Jean O’Conner und ihr Sohn James werden unsanft aus dem Schlaf gerissen. Schreie und Rufe unterbrechen die nächtliche Stille.
»Aufmachen«, brüllt eine tiefe Stimme. »Aufmachen, oder wir schlagen die Tür ein!«
Mrs. O’Conner hat sich rasch einen Mantel übergeworfen und tritt nun aus dem Haus.
Undeutlich erkennt sie mehrere Männer.
»Was wollt ihr?« fragt sie, ihre Stimme klingt kalt und beherrscht. »Warum wollt ihr die Türen meiner Ranch einschlagen? Kommt ihr jetzt schon mitten in der Nacht, um über harmlose Frauen herzufallen? Ihr seid doch nichts anderes als ein feiges und erbärmliches Gesindel.«
»So dürfen Sie nicht sprechen, Madam«, sagt Clark Ridger, der Sheriff, und tritt dabei einen Schritt vor.
»Wir suchen Ihren Mann, der vor wenigen Stunden die Postkutsche überfallen haben soll. Er wurde eindeutig erkannt, es gibt keine Zweifel. Sie werden uns gestatten, die Ranch zu durchsuchen.«
»Was – die Postkutsche überfallen?« stößt die erschrockene Frau hervor, und die Erregung läßt ihre Stimme nun doch zittern. »Reden Sie schon, Sheriff. Ich habe Sie immer für einen aufrichtigen Mann gehalten.«
»Genug geredet«, ertönt eine harte Männerstimme aus dem Hintergrund. »Wir werden jetzt die Ranch durchsuchen! Weit kann er nicht gekommen sein.«
Wie auf ein geheimes Kommando schwärmen die Männer aus und beginnen die Ranch zu durchsuchen. James O’Conner tritt ebenfalls aus dem Haus. Er hat die furchtbare Anklage gerade noch gehört.
»Er würde so etwas niemals tun!« sagt er fest und faßt seine Mutter unter die Arme. »Komm mit ins Haus, es wird schon alles gut werden. Du brauchst dich nicht zu ängstigen.«
Sie gehen ins Haus zurück, hören noch einige Zeit das Rumoren der Männer, vernehmen wütende Stimmen und dann die Hufschläge der abreitenden Rosse.
Jean O’Conner sieht ihrem Sohn fest in die Augen. Dieser hält ihrem Blick stand und streicht ihr dann über das silberglänzende Haar.
Sie lächelt ihm zu.
»Sag mir, daß es nicht wahr ist«, haucht sie. »Sag mir, daß das alles nur ein schrecklicher Irrtum ist!«
»Sicher, Mam«, antwortet er und versucht seiner Stimme einen festen Klang zu geben. »Es wird sich alles aufklären. Vielleicht hat dieser Bandit Daddy nur ähnlich gesehen, und du weißt doch genau, daß sie etwas gegen uns haben. Sie würden uns lieber heute als morgen aus dem Land jagen.«
Er sieht sie bitter an.
Aufstöhnend legt sie den Kopf in ihre Hände. Verzweifelt kämpft sie darum, ihre Beherrschung nicht zu verlieren.
»Ich werde mich jetzt anziehen«, sagt er dann rauh. »Ich werde in die Stadt reiten und mich dort genau erkundigen.«
Sie versucht zu lächeln, doch es gelingt ihr nicht. Ihre Augen blicken ernst, und schwere Sorgenfalten durchfurchen ihre Stirn.
Dann nickt sie. »Reite, James, aber sei vorsichtig! Achte gut auf dich. Versprich es mir.«
»Natürlich, Mam«, sagt er leise.
*
Jonathan O’Conner ist ein Mann von vielleicht fünfzig Jahren. Er ist noch sehr rüstig, und in seinem wettergegerbten Gesicht leuchten zwei klare, blaue Augen.
Der Mond sendet sein silbernes Licht über die Prärie, und Jonathan lenkt sein Pferd in Richtung der heimatlichen Ranch.
Er ist auf der Nordweide der kleinen Ranch gewesen und hat dort die kümmerlichen Reste der Herde begutachtet. Er stößt einen heiseren Fluch aus, wenn er an die Viehdiebe denkt, die seine letzte Herde immer wieder heimsuchen.
Er ist müde von dem anstrengenden Ritt und spürt das nagende Hungergefühl in seinen Eingeweiden.
»Gleich haben wir es geschafft, Sonny«, sagt er leise zu seinem Pferd und tätschelt es auf den schlanken Hals. »Du bekommst auch eine Extraportion Hafer. Du hast ihn dir redlich verdient.«
Jonathan O’Conner hört die Hufschläge, und er verhält sein Pferd. Dann sieht er den Reitertrupp.
Sein Pferd beginnt unruhig zu tänzeln. Jonathans Hand greift nach seinem Colt.
Wer mag das wohl sein, denkt er. Es ist doch schon spät in der Nacht… Viehdiebe, ist sein zweiter Gedanke.
Der Reitertrupp hält genau auf ihn zu. Was tun…? überlegt er, und dann gibt er seinem Pferd die Zügel frei.
Die Männer aber haben ihn gesehen. Sofort hallen erregte Stimmen zu ihm herüber. Die Reiter nehmen die Verfolgung auf, und anscheinend haben sie die ausgeruhteren Pferde, denn sie holen schnell auf.
Ein paar Schüsse peitschen durch die Nacht, und die Kugeln umpfeifen ihn wie lästige Insekten.
Jonathan O’Conner hat keine Chance. Er sieht es sehr rasch ein und hält sein Pferd an. Er wendet sich seinen Verfolgern zu und hebt die Hände in Schulterhöhe.
Seine Verfolger sind heran. Als er den Sheriff erkennt, atmet Jonathan erleichtert auf. Er nimmt die Hände herunter und schüttelt unwillig den Kopf, als die Männer mit gezogenen Waffen auf ihn zukommen.
»Ich bin es«, ruft er. »Jonathan O’Conner. Ihr könnt ruhig eure Kanonen wegstecken. Ich habe schon befürchtet, daß ein Rudel Viehdiebe hinter mir her ist.«
Er lacht, doch er blickt in die starren und ernsten Gesichter der Männer, die immer noch mit gezogenen Colts vor ihm stehen.
Clark Ridger, der Sheriff, tritt einen Schritt vor.
»Gib mir deinen Colt, Old Jonathan. Keine unvorsichtige Bewegung, es könnte sonst deine letzte gewesen sein. Und nun reich mir vorsichtig deinen Colt.«
Jonathan stiert den Sprecher ungläubig an. Seine Augenbrauen ziehen sich langsam zusammen, und eine Unmutsfalte entsteht auf seiner Stirn.
»Laß den Unfug, Sheriff«, sagt er mit heiserer Stimme. »Was soll das alles?«
»Du bist verhaftet!« schreit Clark Ridger mit schwerer Stimme. »Also versuche keine Tricks.«
Jonathan O’Conner zuckt hilflos mit den Achseln.
»Ich verstehe das nicht«, keucht er. »Was habt ihr mir denn vorzuwerfen? Sag es schon…« brüllt er plötzlich, als er in die schweigenden Gesichter der Männer blickt. »Verdammt nochmal! Ich habe in meinem ganzen Leben noch keiner Fliege etwas zuleide getan, und du willst mich verhaften. Ihr seid ja verrückt.«
»Spare dir deine Reden, bis du vor dem Richter stehst«, tönt eine harte Stimme, und ein großgewachsener Mann tritt näher. Er ist ungefähr so alt wie Jonathan. Er ist gut gekleidet, und es scheint, als habe er sich nur unter die Cowboys hier verirrt.
»William Clarence«, sagt Jonathan leise. »Sicherlich steckst du hinter dieser teuflischen Sache. Ich weiß schon lange, daß ich dir ein Dorn im Auge bin. Alle kleinen Ranches hast du bisher geschluckt, nur mich hast du noch nicht bekommen…«