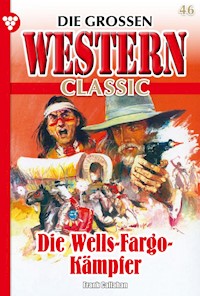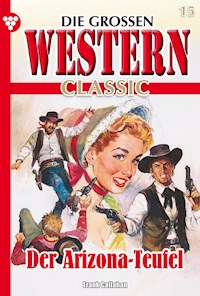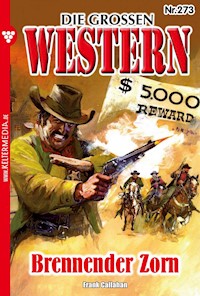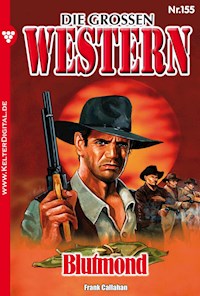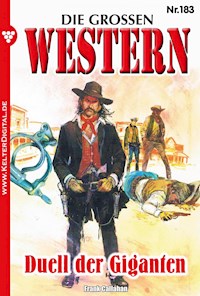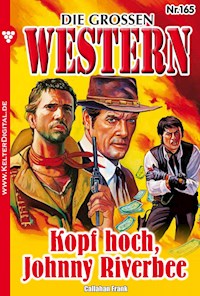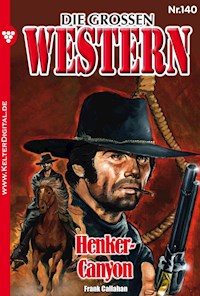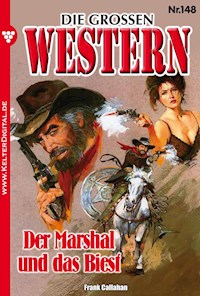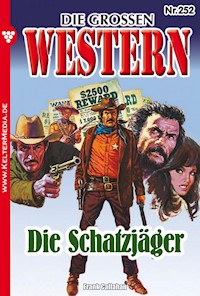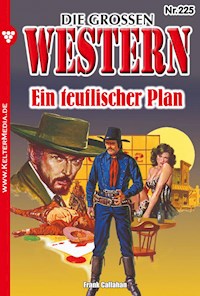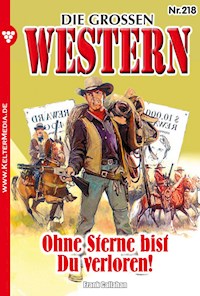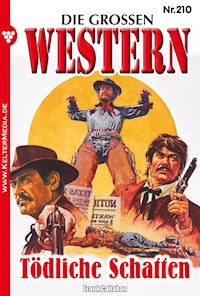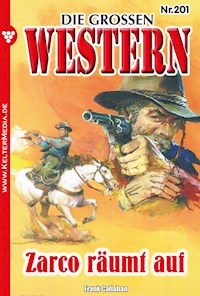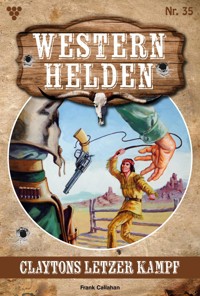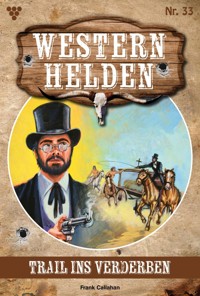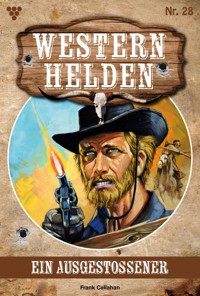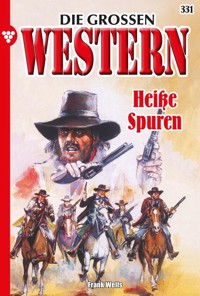
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Der Rauch eines Feuers weht so plötzlich zu Jeff Ryker hin, daß er den Kopf hebt und die neue Witterung in sich einsaugt. Ein Feuer mitten in der menschenleeren Wildnis unterhalb des Tonto-Rim, am hellen Mittag – das kann in diesem Indianerland nur bedeuten, daß komplette Narren es angezündet haben. Der Fuchswallach Tornado schnaubt leise und windet mit den Ohren. Jeff Ryker tätschelt ihm den schlanken Hals und brummt: »Schauen wir uns die Greenhorns an, altes Schaukelpferd. Wenn die Jicarillas den Rauch wittern, könnten die Knaben ihre Skalps loswerden.« In die scharfen Spähaugen des Mannes kommt ein seltsamer Glanz, als er dem prustenden Wallach den Kopf freigibt und weitertrabt. Jeff Ryker sitzt im Sattel wie eine Rothaut – so, als wäre er auf den Pferderücken hinaufgeboren worden. Meistens sieht das scharfgeschnittene Gesicht unter der rostfarbenen Haarbürste sehr friedlich aus. Es ist das kantige Gesicht eines Mannes, nicht die Spur hübsch, aber durch und durch männlich. Es ist nicht weit bis zu dem langgezogenen Talkessel, in dem das Feuer brennt. Und hier wartet eine wirkliche Überraschung auf Jeff Ryker, als er um die letzte Felsnase blickt. Es ist ein Brennfeuer, und mehrere Cowboys sind dabei, Rinder aus einer vielköpfigen Herde herauszufangen, sie zum Feuer zu schleppen und ihnen dort den Brand aufzudrücken. Jeff Ryker schätzt die Zahl der Rinder auf etwa dreihundert. Sie sind auf engstem Raum in einer Felsentasche zusammengedrängt. Zwei Cowboys arbeiten mit den Lassos und schleppen die gefangenen Tiere zum Brennfeuer, wo ein dritter Boy das Brenneisen schürt und es in das Fell der Rinder preßt. Dieses Brennfeuer gibt ihm zu denken. Normalerweise werden die Rinder schon als Mavericks gebrändet, und zwar jeweils beim Round-up im Herbst. Die Rinder aber, die hier in dem Kessel stehen, sind samt und sonders ausgewachsen, drei Jahre und älter. Der Stier zum Beispiel, den die beiden Cowboys eben mit ihren Lassos eingefangen haben und zum Feuer schleppen, ist ein prachtvolles Musterexemplar seiner Gattung. Ein riesiger Bulle mit weit ausladenden spitzen Hörnern, auf denen er einen Mann glatt aufspießen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 331 –Heiße Spuren
Frank Callahan
Der Rauch eines Feuers weht so plötzlich zu Jeff Ryker hin, daß er den Kopf hebt und die neue Witterung in sich einsaugt. Ein Feuer mitten in der menschenleeren Wildnis unterhalb des Tonto-Rim, am hellen Mittag – das kann in diesem Indianerland nur bedeuten, daß komplette Narren es angezündet haben.
Der Fuchswallach Tornado schnaubt leise und windet mit den Ohren. Jeff Ryker tätschelt ihm den schlanken Hals und brummt: »Schauen wir uns die Greenhorns an, altes Schaukelpferd. Wenn die Jicarillas den Rauch wittern, könnten die Knaben ihre Skalps loswerden.«
In die scharfen Spähaugen des Mannes kommt ein seltsamer Glanz, als er dem prustenden Wallach den Kopf freigibt und weitertrabt. Jeff Ryker sitzt im Sattel wie eine Rothaut – so, als wäre er auf den Pferderücken hinaufgeboren worden. Meistens sieht das scharfgeschnittene Gesicht unter der rostfarbenen Haarbürste sehr friedlich aus. Es ist das kantige Gesicht eines Mannes, nicht die Spur hübsch, aber durch und durch männlich.
Es ist nicht weit bis zu dem langgezogenen Talkessel, in dem das Feuer brennt. Und hier wartet eine wirkliche Überraschung auf Jeff Ryker, als er um die letzte Felsnase blickt. Es ist ein Brennfeuer, und mehrere Cowboys sind dabei, Rinder aus einer vielköpfigen Herde herauszufangen, sie zum Feuer zu schleppen und ihnen dort den Brand aufzudrücken.
Jeff Ryker schätzt die Zahl der Rinder auf etwa dreihundert. Sie sind auf engstem Raum in einer Felsentasche zusammengedrängt. Zwei Cowboys arbeiten mit den Lassos und schleppen die gefangenen Tiere zum Brennfeuer, wo ein dritter Boy das Brenneisen schürt und es in das Fell der Rinder preßt.
Dieses Brennfeuer gibt ihm zu denken. Normalerweise werden die Rinder schon als Mavericks gebrändet, und zwar jeweils beim Round-up im Herbst. Die Rinder aber, die hier in dem Kessel stehen, sind samt und sonders ausgewachsen, drei Jahre und älter. Der Stier zum Beispiel, den die beiden Cowboys eben mit ihren Lassos eingefangen haben und zum Feuer schleppen, ist ein prachtvolles Musterexemplar seiner Gattung. Ein riesiger Bulle mit weit ausladenden spitzen Hörnern, auf denen er einen Mann glatt aufspießen kann. Und trotz der Entfernung erkennt Jeff Ryker deutlich, daß der Stier schon ein Brandzeichen auf der Hinterhand trägt. Es sieht so aus wie ein scharfkantiges »S«.
Also Viehdiebe? Banditen, die an diesem entlegenen Platz ihre Beute mit einem neuen Brandzeichen versehen?
Jeff Ryker ist nicht der Mann, der wie die Katze um den heißen Brei schleicht. Sein Weg führt geradeaus, führt durch dieses Tal, vorbei am Brennfeuer. Nur eins tut er, ehe er gemächlich weitertrabt – mit der Miene eines sehr gleichgültigen schläfrigen Mannes. Er öffnet die unteren Knöpfe der Jacke und schiebt das Halfter mit dem Colt handgerecht.
*
Der Boy mit dem Brenneisen kehrt Jeff den Rücken zu. Er hat just frisches Holz auf das Feuer geworfen, und der Rauch steigt in dicken Schwaden auf, bis das Feuer sich knatternd durchsetzt. Die beiden anderen Boys im Sattel zerren den widerspenstigen Stier näher heran. Sie sind so sehr mit der schweren Arbeit beschäftigt, daß sie kein Auge für Jeff Ryker haben.
Sicher kommt er bis auf zehn Schritte an das Feuer heran. Das Bunchgras dämpft die Schritte Tornados, zumal der Stier wütend und mit den Hufen die Grasnarbe aufwühlt.
Der Mann mit dem Brenneisen rennt ums Feuer herum auf den Stier zu.
»Reißt ihn um!« ruft er mit einer heiseren Stimme. Es klingt so, als hätte er mit Glasscherben gegurgelt.
»Du hast gut reden, Guy!« schreit der andere zurück. »Das Biest wiegt bestimmt tausend Pfund!«
Guy schlägt einen eleganten Haken um die Hörner des Bullen und stößt das aufzischende glühende Eisen genau auf das alte Brandzeichen. Anstelle des Zickzack-S entsteht ein Blitz.
»Holt den nächsten. Ich denke…«
Guy macht kehrt, zum Feuer hin – und erstarrt mitten in der Drehung. Er schaut Jeff so überrascht und erstaunt an, als sehe er einen vom Himmel gefallenen Engel.
»Tausend Teufel…«
Alle Anzeichen einer peinlichen Überraschung stehen in dem düsteren klobigen Gesicht geschrieben. Die dunklen, sprechenden Augen des Mannes saugen sich an Jeffs mächtiger Gestalt fest. Das glühende Brenneisen pendelt in der Rechten hin und her. Besonders gern scheint Jeff Ryker hier nicht gesehen zu sein.
»Hallo, Amigos!« sagt er lächelnd. »Schwerer Job, was?«
Die beiden berittenen Cowboys kommen nebeneinander auf der anderen Seite des Feuers heran. Sie schwitzen, und der Schweiß zieht tiefe Furchen durch ihre schmutzigen Gesichter. Alle drei sind ziemlich stabil gebaut.
»Hallo. Wo kommst du denn her, Compadre?«
»White Mountains«, entgegnet Jeff. Das ist eine sehr unbestimmte Antwort, denn die White Mountains umfassen ein Gebiet von einigen hundert Quadratmeilen.
Die beiden Boys im Sattel regen sich nicht. Nur ihr Atem geht schnell von der Anstrengung. Guy sagt: »Und wohin soll die Reise gehen?«
Jeff zuckt die Achseln: »Ich weiß morgens nie, wo ich abends schlafe.« Er faßt in die Jackentasche – in die linke –, zieht den Tabaksbeutel und dreht eine Zigarette. Als er das Streichholz am Daumennagel anreißt, fragt er gleichgültig: »Wenn ihr rauchen wollt, Amigos…«
Sie wollen nicht rauchen. Sie wollen etwas anderes, und ihnen scheint dieser Augenblick genau richtig. Der Augenblick nämlich, in dem Jeff die Zigarette zwischen die Lippen schiebt und das brennende Streichholz hebt.
Nur ein schneller Blick des Einverständnisses geht zwischen den beiden Männern im Sattel hin und her. Dann zuckt die Hand des links neben Guy haltenden zur Hüfte hinab – zum Halfter.
Jeff Ryker tut drei Dinge gleichzeitig: Er läßt die Zigarette aus dem Mund kippen – und das Streichholz fallen, er ruft kurz und abgehackt: »Re!« – und sein Fuchswallach, der eben noch wie angenagelt gestanden hat, knickt plötzlich in allen vier Beinen ein und geht zu Boden. Genau so schnell oder noch schneller hat Jeff Ryker die Füße aus den Bügeln und segelt mit einem Hechtsprung schräg vorwärts aufs Feuer zu. Daß er dabei das Gewehr aus dem Scabbard gerissen hat, sieht keiner der drei Banditen. Weil das alles nämlich so furchtbar schnell geht, daß sie noch nichts begriffen haben, als Jeff schon wieder vom Boden hochschnellt und das Gewehr durchlädt und in den Hüftanschlag bringt.
Im letzten Augenblick zieht der Mann im Sattel seine Kanone herum und jagt einen überhasteten Schnappschuß aus dem Lauf. Er hat den Daumen wieder auf dem Hammer, als Jeff das Blei fliegen läßt.
Der Mann schreit auf, wird größer und größer im Sattel und kippt hintenüber, als sein Mustang erschreckt anspringt. Er wirbelt durch die Luft und kracht schwer mit dem Kopf vorn neben das Feuer.
Jeff lädt blitzschnell durch, schwenkt den Gewehrlauf und knurrt tief in der Kehle: »Nun, Amigos? Wer ist der nächste?«
Nein, keiner will der nächste sein. Ihre Hände gleiten wie von selbst in die Höhe, ganz ohne Kommando. Der Mann, der Guy heißt, läßt das Brenneisen fallen und schneidet eine Grimasse.
»Abschnallen!« befiehlt Jeff hart. »Du zuerst!«
Er deutet auf den Mann im Sattel. Der duckt sich ein wenig, und einen Augenblick tanzen zornige gelbe Flecke in seinen Augen. Dann löst er mit spitzen Fingern die Gürtelschnalle des Waffengurts und läßt ihn fallen.
»Jetzt das Gewehr!« sagt Jeff.
Er geht langsam auf die beiden Männer zu und läßt den krummbeinigen Guy nicht aus der Klammer seines Blicks. Guy weicht einen Schritt zurück und stöhnt leise vor sich hin. Ein Held ist er bestimmt nicht. Jeff reißt ihm den Waffengurt von den Hüften und schleudert ihn ins Feuer.
»Dein Name?« knurrt er.
»Ich… ich heiße Guy… Guy Torrow.« Jeff schwenkt zu dem anderen im Sattel. »Dein Name?«
»Geht dich ’nen Dreck an! Wenn du Affe glaubst, daß du damit durchkommst, bist du verdammt…«
Weiter kommt der Bandit nicht. Jeff ist mit einem langen Schritt neben ihm und reißt ihn aus dem Sattel. Seine Faust peitscht in das Gesicht des Mannes – einmal, zweimal… Dann baut er ihn vor sich auf und sagt: »Dann wehre dich!«
Ein dünner Blutfaden sickert von der Lippe des Mannes herab. Er keucht und zieht den Kopf ein. Jetzt nistet graue Furcht in seinen Augen. »Schon gut… Ich heiße Jill Quinn.«
Jeff macht scharf kehrt und starrt die beiden anderen an. »Ihr wolltet mich umlegen. Der da ist tot – rechnet euch aus, was euch passiert, wenn ihr mir noch mal über den Weg lauft! Ich vergesse nie ein Gesicht, das ich einmal gesehen habe.«
Guy Torrow wischt sich über das schweißbedeckte Gesicht. Er läßt kein Auge von Jeff. Plötzlich murmelt er: »Ich bin nicht beteiligt, Jeff. Ich will verdammt sein, wenn ich auch nur eine Hand gegen Sie aufheben würde.«
»Du kennst mich?«
»Ja, Mister Ryker. Jetzt ist es mir eingefallen, wo ich Sie gesehen habe. Vor drei Jahren war’s, in Camp Bowie. Sie waren als Scout bei den Lanzenreitern. Sie haben mir das Leben gerettet.«
»Ich…dir?«
»Yeah. Ich bin damals als Cowboy für eine Ranch weiter im Westen geritten. Sie haben uns gewarnt – eine Stunde, bevor die Apachen gekommen sind.«
Jeff antwortet nicht. Er pfeift kurz durch die Zähne, und sein Mustang, der immer noch reglos am gleichen Fleck liegt, kommt hoch und trabt zu ihm. Mit einer geschmeidigen Bewegung hebt sich Jeff Ryker in den Sattel, stößt das Gewehr in den Scabbard und trabt an. Er wirft keinen Blick auf das Feuer und die Banditen zurück.
*
Es ist ein Tag der Überraschungen. Diese erste hat Jeff Ryker nicht viel Kopfzerbrechen bereitet – die zweite gefällt ihm weniger gut.
Länger als eine Stunde führt ihn ein schmaler zerklüfteter Rinderpfad durch Canyons und Schluchten. Durch ein Land, das in seiner großartigen Schönheit einmalig ist. Und dann, als sich der Weg weitet und die Wände der schroffen Berghänge weiter zurücktreten, dann steht da plötzlich ein verwittertes schiefes Schild am Wege. Es ist das abgerissene Brett einer Kiste, von mehreren Kugellöchern durchbohrt. Der Name darauf ist verwaschen und kaum noch zu entziffern. In seinem ersten Buchstabe steckt ein abgebrochener Pfeil.
»Rondo«, bringt Jeff schließlich mit einiger Mühe heraus.
Rondo. Der Name einer Stadt, die sich in der Wildnis versteckt wie Dornröschen. Und blitzartig zuckt eine Gedankenverbindung durch Jeffs Kopf: Die Banditen dort oben in ihrem verschwiegenen Tal und dieses versteckte Nest gehören zusammen.
Ohne langes Überlegen reitet Jeff Ryker an dem schiefen Schild vorbei, um die nächste Biegung – sieht die fünf Häuser vor sich liegen.
Vor dem ersten Haus steigt Jeff Ryker langsam ab. Aber nicht etwa, weil eine hübsche Melodie an sein Ohr schlägt, gesungen von einer warmen Frauenstimme. Auch das ist eine Überraschung. Eine Frau hier? Sollte es doch keine Stadt der Gesetzlosen sein?
Es ist ein mexikanisches Lied. Jeff hat es noch nie gehört, obwohl er viel mit Mexikanern zusammengekommen ist und ihre Sprache so perfekt spricht, als wäre er drüben in der Provinz Sonora aufgewachsen und nicht in einem Militärfort unter rauhen Pferdesoldaten. Der Wallach schlabbert vergnügt im silbernen Wasser, während Jeff die schwere Pelzjacke auszieht und gegen die ärmellose Lederweste tauscht.
Er bückt sich zum Wasser hinunter und schickt unter dem vorgestreckten Arm hindurch einen vorsichtigen Blick auf die Reihe der Hütten. Das Lied ist verstummt. Ein Fensterflügel knarrt leise, und zwei dunkeläugige Señoritas beugen sich aus dem Fenster. Sie starren Jeff mit offenkundiger Neugier an, doch er tut, als sehe er sie gar nicht. Vor der Bar drüben erscheint ein kleiner drahtiger Mann mit olivgelber Hautfarbe und blauschwarzem Haar. Ein Mexiko-Boy oder ein Halfcast.
Jeff hält beide Hände ins Wasser, kniet nieder und wirft sich einige Hände voll des klaren kalten Wassers ins Gesicht. Er prustet dabei wie ein Mustang, und das scheint die beiden Señoritas sehr zu amüsieren, denn sie prusten plötzlich auch, allerdings vor Lachen.
Jeff wendet den Kopf und tut ganz erstaunt, als er die Señoritas anschaut. Er wischt mit dem Ärmel übers Gesicht, schüttelt sich wie ein Pudel und sagt im besten Mexikanisch: »Santa Madonna! Soviel Schönheit auf einmal ist mir noch nie begegnet«
Das Lachen verstummt jäh. Noch ein glutäugiger Blick – das Fenster klappt zu.
»Ob die mich für einen Menschenfresser halten?« brummt Jeff und kratzt sich über das stoppelige Kinn. Das bringt ihn auf eine Idee. Er holt Rasierzeug und Spiegel aus der Satteltasche, hockt sich neben den Creek und holt die Rasur nach, zu der er sich am frühen Morgen nicht die Zeit genommen hat.
Es dauert gar nicht lange, bis hinter ihm Schritte knirschen. Zwar zwickt es Jeff auf Rücken und Nacken, doch er wendet den Blick nicht vom Spiegel. Zwei Männer nähern sich und bleiben drei Schritte hinter ihm stehen.
»Sie sind fremd hier?« sagt der eine mit einer sanften, trägen Stimme. Sie klingt so, als müsse sich der Mann jedes Wort schwer abringen.
»Stimmt«, entgegnet Jeff, ohne zurückzuschauen.
»Woher kommen Sie, Señor?«
»Aus dem White-Mountains, Señor.«
»Und wohin wollen Sie, Señor?«
»Unter Menschen – irgendwohin. Nach Süden oder Osten – nur nicht nach Norden oder Westen.«
»Oh. Man ist hinter Ihnen her?«
Jeff läßt das scharfe Messer unterm Kinn entlanggleiten und seufzt: »Amigo mio, wo ich herkomme, schätzt man neugierige Fragen nicht. Und neugierige Frager genausowenig.«
Der Mann mit der trägen Stimme kichert leise. Aber es kling nicht halb so fröhlich, wie es klingen soll. »Señor, Sie befinden sich in unserer Stadt. Und in unserer Stadt stellen wir die Fragen – und Sie antworten!«
Jeff wedelt das Messer durchs Wasser und wischt den Schaum ab. Er wickelt Spiegel, Seife, Messer und Pinsel zusammen in das Tuch, erhebt sich und schaut die beiden Männer hinter sich an.
Messerwerfer! schießt es Jeff durch den Kopf.
Der Genosse des Halbbluts ist beinahe doppelt so groß.
Auch der Riese ist ein Halbblut, doch seine Abstammung ist noch schwerer festzustellen. Einer seiner Elternteile ist zweifellos Neger gewesen.
»Brüder«, lächelt Jeff, »ich habe Durst. Wie wär’s mit einem Drink für uns drei?«
Der Riese zeigt grinsend zwei Reihen prachtvoller Zähne. Eigentlich ist sein Gesicht, trotz der aufgeworfenen Lippen, gar nicht häßlich. Es ist jedenfalls regelmäßiger geschnitten als das des kleinen Mischblutes.
»Si, Señor!« sagt der Riese mit einem abgrundtiefen Baß. »Drink ist immer gut.«
»Shut up, Hercules!« zischt der Kleine. »Ich habe hier zu bestimmen, und wenn dieser großmäulige Bursche nicht pariert, wird er nie wieder Verlangen nach einem Drink haben! Ich habe Sie was gefragt, Fremder!«
»Und ich habe geantwortet, Mister!« schnappt Jeff. »Meine nächste Antwort lautet so!«
Und blitzschnell läßt er die Hand zum Colt fallen und zieht. Der olivgelbe kleine Bursche wird grau im Gesicht. Der Riese sperrt Mund und Nase auf und murmelt: »Hercules spielt nicht mit! Franco, es war deine Idee!«
Jeff läßt das Eisen im Halfter verschwinden und schiebt das Tuch mit den Rasiersachen, in die Satteltasche. Er sagt ganz kalt, steinern, ruhig: »Wir können es austragen, Gents – hier sofort! Mit dem Colt oder mit dem Messer oder den Fäusten. Ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen, klar? Wollt ihr jetzt einen Drink mit mir nehmen?«
Plötzlich erscheint ein Lächeln auf der Miene Francos, des Messerwerfers. Seine Hand, die Rechte, taucht auf und streckt sich Jeff entgegen. Und das Lächeln ist falsch wie das einer Klapperschlange. Falls Klapperschlangen überhaupt lächeln können…
»So soll es sein, Compadre!« sagt er. »Ich heiße Franco Maloca, und das ist Hercules.«
»So sieht er auch aus«, brummt Jeff und drückt die Hand Francos, Hercules zeigt wieder grinsend sein prachtvolles Raubtiergebiß und läßt seine schwere Hand krachend auf Jeffs Schulter fallen. Der wenigstens führt nichts Heimtückisches im Schilde. Was man von Franco Maloca gewiß nicht behaupten kann!
»Pilgern wir also zur Bar«, schlägt Jeff vor.
*
Auf dem Schild über der Bar steht »Parkers Inn«. Aber es ist ein altes Schild, schon von den Holzwürmern zernagt und von zahllosen Kugeln gelöchert. Der erste Besitzer mag Parker geheißen haben. Der jetzige wohl kaum noch.
Diese Vermutung Jeffs bewahrheitet sich, als er durch die Pendeltür tritt. Er hat seinen Fuchswallach nicht angebunden, sondern mit hängenden Zügeln neben den anderen Broncos stehenlassen. Als erster tritt Hercules über die Schwelle, von der Hoffnung auf einen kostenlosen Brandy beflügelt. Franco Maloca hat es nicht so eilig. Er schielt schnell noch einmal über die Schulter zurück, ob Jeff auch wirklich folgt.
Yeah – und das ist die nächste Überraschung für Jeff und ein Beweis dafür, wie klein die Welt ist. Hinter der Theke nämlich steht ein Mann wie eine Tonne so breit wie lang, mit kugelrundem Vollmondgesicht, dessen eine Hälfte blauschwarz gefärbt ist. Man kann ihn also nicht als Vollmond, sondern nur als Halbmond bezeichnen. Aber sein Name ist Blue Pep – und als Jeff Ryker ihn zuletzt gesehen hat, war gerade die Pulverladung explodiert, die Blues eine Gesichtshälfte so malerisch gefärbt hat.
»Mann!« keucht der fette Mann. »Wen sehen meine entzündeten Augen! Das darf nicht wahr sein! Jeff!«
Franco Maloca wirbelt herum, starrt zwischen Jeff und Blue Pep hin und her und säuselt: »Ihr kennt euch? Warum haben Sie nicht gleich gesagt, Jeff, daß Sie Pep besuchen wollen? Blue Peps Freunde sind auch meine Freunde!«
Jeff schiebt die Mütze aus der Stirn und schüttelt Blues Hand. Er kneift ein Auge zu. »Du wirst in keinen Sarg passen, wenn du dir das Essen weiter so gut schmecken läßt. Mann, damals bist du wenigstens noch allein in den Sattel gekommen. Aber heute bricht ein Pferd ja schon bei deinem Anblick zusammen!«
Blue Pep lacht donnernd und füllt ein Glas. »Da, Bruder – trink! Hell und damnation, wenn ich daran denke, wie ich dir an den Skalp wollte!«
»Well, Blue, auf dein Wohl! Und zwei Gläser für Hercules und Franco!«
»Welcher Wind hat dich hergepustet? Reitest du immer noch…«
»Nein, schon lange nicht mehr. Du weißt, daß ich es nirgends lange aushalte, Blue. Daran hat sich nichts geändert.«
Franco Maloca gleitet einen Schritt zurück und beobachtet Jeff und Blue Pep scharf. Pep füllt die Gläser und nickt bedächtig vor sich hin. »Sag mal, existiert eigentlich Moby O’Grady noch? War ein Pfundsbursche…«
»Nein, Blue. Ich habe ihn auf der Mesa begraben – vor zwei Jahren.«
»Hölle! Wer hat es getan?«
»Apachen. Er hat ungefähr zehn Pfeile geschluckt.«
Jeff hebt das Glas, nickt Hercules zu und sagt: »Der eine früher, der andere später, Cheerio!«
Während er trinkt, dröhnt am Ende der Straße Hufschlag auf. Mindestens fünf Reiter kommen dort – eher mehr als weniger. Und Blue Peps Gesicht bekommt plötzlich einen sehr nachdenklichen und besorgten Ausdruck.
Um Franco Malocas Lippen aber spielt ein teuflischspöttisches Grinsen…
*