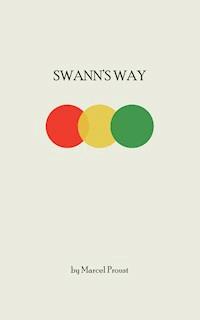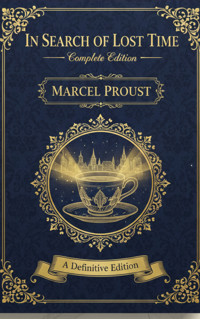Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Die Welt der Guermantes" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Der Roman spielt im Frankreich des Fin de siècle in der gehobenen Gesellschaft. Ein Ich-Erzähler berichtet von seinem Leben und vom Vorgang des Erinnerns. Der Ich-Erzähler stammt aus einer Familie des Pariser Bürgertums, die den Sommer üblicherweise bei Verwandten auf dem Land verbringt. Hier erlebt er eine glückliche Kindheit und lernt Personen kennen, die in seinem weiteren Leben eine Rolle spielen werden, etwa den Kunstliebhaber Swann, dessen Tochter Gilberte, oder die lokale Adelsfamilie, die Guermantes. Der Ich-Erzähler steigt in der Welt des Adels auf und besucht die Salons. Hier macht er sich über das leere Geplauder der Menschen lustig, aber er ist auch fasziniert und kann sich nicht von ihnen trennen, um sein Werk zu schaffen. Die politischen Affären seiner Zeit interessieren ihn kaum. Er bekommt nur mit, dass die Dreyfus-Affäre es manchen Personen erlaubt, gesellschaftlich aufzusteigen, während sie andere zum Abstieg zwingt. Marcel Proust (1871-1922) war ein französischer Schriftsteller und Kritiker. Prousts Hauptwerk ist Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (À la recherche du temps perdu) in sieben Bänden. Dieser monumentale Roman ist eines der bedeutendsten erzählenden Werke des 20. Jahrhunderts. Die Welt der Guermantes ist der dritte Teil dieses Werkes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1098
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Welt der Guermantes
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit: Die Herzogin von Guermantes (Band 1&2)
Übersetzer: Walter Benjamin, Franz Hessel
Inhaltsverzeichnis
I. Band
Inhaltsverzeichnis
Das Piepen der Vögel morgens kam Françoise abgeschmackt vor. Bei jedem Wort der »Bonnen« fuhr sie in die Höhe; es war ihr lästig, wenn sie ihre Schritte hörte, und sie fragte sich, was sie nur treiben! Wir waren umgezogen. Gewiß machten die Dienstboten, die sie in dem sechsten Stock über unserer früheren Wohnung hörte, nicht weniger Lärm; aber die kannte sie, mit ihrem Kommen und Gehn hatte sie sich angefreundet. Jetzt gab sie gequält sogar auf die Stille acht. Und da unser neues Viertel so still schien wie der Boulevard, an dem wir bisher wohnten, laut war, trieb – schwach, von fern gehört wie ein Orchestermotiv – das Lied eines Vorübergehenden der Françoise in ihrem Exil die Tränen in die Augen. Wohl hatte ich mich über sie lustig gemacht, als sie bekümmert war, ein Haus verlassen zu müssen, wo man »allerseits so geachtet« war, als sie mit Tränen ihre Koffer nach den Riten von Combray packte und das Haus, das unser Haus war, für das beste aller denkbaren Häuser erklärte; nun aber fühlte ich, der ich doch so leicht Neues aufnahm und Altes aufgab, mich unserer alten Dienerin näher, als ich sah, wie es sie nahezu krank machte, in einem Hause sich einrichten zu müssen, wo ihr von dem Pförtner, der uns noch nicht kannte, nicht die Achtung bezeigt wurde, die für ihre gute seelische Ernährung so notwendig war. Sie allein konnte mich verstehn, sicherlich nicht ihr junger Lakai: für ihn, der eben ganz und gar nicht aus Combray war, bedeutete umziehen und ein neues Viertel bewohnen etwas ähnliches wie Ferien haben; die Neuheit aller Dinge wirkte beruhigend auf ihn wie eine Reise; ihm war zu Mute wie auf dem Lande; ein Schnupfen gab ihm, wie ein Luftzug, den man am schlecht schließenden Waggonfenster bekommt, den köstlichen Eindruck, er habe fremdes Land gesehn; jedesmal, wenn er nieste, freute er sich, eine so feine Stellung gefunden zu haben; hatte er sich doch immer eine Herrschaft gewünscht, die viel reiste. So kümmerte ich mich denn nicht um ihn, sondern wandte mich an Françoise selbst; aber wie ich über ihre Tränen bei einem Umzug, der mich kalt ließ, gelacht hatte, blieb nun sie meiner Traurigkeit gegenüber eisig, weil sie sie teilte. Mit der angeblichen Empfindlichkeit der Nervösen wächst ihre Selbstsucht; sie können nicht ertragen, daß andere sich Beschwerden anmerken lassen, die sie bei sich mit wachsender Aufmerksamkeit verfolgen. Françoise, die von den eigenen nicht die geringste unbeachtet vorübergehn ließ, wandte den Kopf ab, wenn ich litt, damit ich nicht das Vergnügen habe, mein Leiden beklagt oder auch nur bemerkt zu sehn. So verhielt sie sich auch, sobald ich ihr von unserm neuen Haus sprechen wollte. Nach zwei Tagen mußte sie noch Kleider holen, die wir im alten Haus vergessen hatten; während ich nun noch vom Umzug her »Temperatur« hatte und wie eine Boa, die einen Ochsen verschlungen hat, mich qualvoll aufgeschwollen fühlte von dem Anblick einer langen Truhe, die meine Augen nicht »verdauen« wollten, sagte Françoise, als sie aus der alten Wohnung wiederkam, mit weiblicher Untreue, sie habe nicht atmen können auf unserm alten Boulevard, sie sei auf dem Nachhauseweg »ganz aus der Déroute gekommen«, nie habe sie so unbequeme Treppen gesehn, nicht für ein Kaiserreich würde sie da wieder wohnen wollen, Millionen könnte man ihr bieten (im Grunde gegenstandslose Hypothesen), alles (das heißt, was Küche und Gänge betraf) sei in unserm neuen Heim viel besser »aufgezogen«. Nun wird es Zeit zu sagen, daß dies – wir hatten es bezogen, weil meine Großmutter sich nicht sehr wohl fühlte und reinere Luft nötig hatte, ein Grund, den wir ihr wohlweislich verschwiegen – eine Wohnung war, die zu dem Hause Guermantes gehörte.
In dem Alter, in dem die Namen uns Bilder des Unkennbaren, das wir in sie gelegt haben, darbieten und uns zugleich wirklich vorhandene Orte bezeichnen, zwingen sie uns, Bild und Ort zu identifizieren. So kommt es, daß wir in einer Stätte eine Seele suchen, die sie gar nicht enthalten kann, aber wir können sie eben nicht mehr aus ihrem Namen vertreiben. Und darum geben die Namen nicht nur Städten und Flüssen eine Individualität (in der Art allegorischer Malerei), nicht nur das physische Universum malen sie bunt und vielfältig aus und bevölkern es mit Wundern, sondern auch das soziale; jedes Schloß, jedes berühmte Haus, oder jeder Palast bekommt seine Dame, seine Fee, wie die Wälder ihre Genien haben und ihre Gottheiten die Gewässer. Tief im Innersten ihres Namens verwandelt die Fee sich bisweilen, da sie dem Leben unserer Phantasie, von welchem sie sich nährt, gefallen will; so war die Atmosphäre, in der Frau von Guermantes für mich existierte, jahrelang nur der Widerschein eines Laterna-Magica-Bildes und eines Kirchenfensters gewesen; jetzt verlor sie diese Farben allmählich, und ganz andere Träume gaben ihr schäumige Feuchte von Gießbächen.
Allein die Fee vergeht, wenn wir uns der wirklichen Person nähern, der ihr Name entspricht, denn nun beginnt der Name die Person widerzuspiegeln, und die enthält nichts von der Fee; die Fee kann aufleben, wenn wir uns von der Person entfernen; bleiben wir aber, so stirbt die Fee endgültig und mit ihr der Name, wie die Familie Lusignan an dem Tage erlöschen muß, an dem die Fee Melusine verschwindet. Der Name, unter dessen vielen Übermalungsschichten wir schließlich als das eigentliche das schöne Bild einer Unbekannten hätten finden können, die wir nie kennenlernen, ist dann nur noch die einfache Paßphotographie, die wir uns nur vergegenwärtigen, um festzustellen, ob wir eine Person, der wir begegnen, grüßen müssen oder nicht. Aber manchmal gibt ein Eindruck vergangener Jahre – wie Phonographen, welche Klangfarbe und Stil verschiedener Künstler, die für sie spielten, registrieren – unserm Gedächtnis die Fähigkeit, einen Namen mit dem besondern Klang uns vernehmbar zu machen, den er damals für unser Ohr hatte: scheinbar ohne daß dieser Name ein anderer geworden sei, fühlen wir die Spanne, welche die wechselnden Träume, mit denen wir diese gleichbleibenden Silben erfüllten, voneinander trennt. Für einen Augenblick können wir aus dem neu vernommenen Klang von Vogelstimmen eines früheren Frühlings wie aus kleinen Farbentuben – die genaue vergessene geheimnisvolle frische Nuance jener Tage gewinnen, an die wir uns immer erinnern zu können glaubten, und doch hatten wir nur wie schlechte Maler unserm ganzen, auf eine große Leinwand gebreiteten früheren Leben die üblichen, immer gleichen Töne willkürlichen Gedächtnisses verliehen. Und jeder der Augenblicke, aus denen sie sich zusammensetzt, verwandte doch zu einer Originalschöpfung von einzigartiger Harmonie die Farben von damals, welche wir nicht mehr kennen. Mich entzücken sie immer noch, wenn mit einmal durch irgendeinen Zufall der Name Guermantes für einen Augenblick nach so viel Jahren wieder jenen ganz andern Klang bekommt, den er am Tage der Hochzeit von Fräulein Percepied für mich hatte: dann sehe ich wieder das süße, zu leuchtende, zu neue Lila im Sammetglanz der bauschenden Krawatte, welche die junge Herzogin trug und – wie unpflückbares wiedererblühtes Immergrün – ihre Augen, von blauem Lächeln durchsonnt. Und der Name Guermantes von damals ist auch wie einer der kleinen Ballons, in die man Sauerstoff oder irgendein anderes Gas einschließt; bring ich ihn zum Platzen, laß ich seinen Inhalt heraus, so atme ich wieder die Luft von Combray, die Luft jenes Jahres und Tages, vermengt mit dem Weißdornduft an der Ecke des Platzes im regenschweren Winde, der die Sonne bald vertrieb, bald auf den roten Wollteppich der Sakristei ausbreitete – der bekam dann die leuchtende, fast rosa Fleischfarbe von Geranium und eine sozusagen wagnerische Süße mitten in dem lauten Frohsinn, welche den Festen ihre Würde wahrt. Aber dies Erlebnis beschränkt sich nicht auf solche seltenen Minuten, in denen wir plötzlich aus den erstorbenen Silben ursprüngliches Wesen bebend aufsteigen und Form und Umriß gewinnen fühlen. Haben die Namen auch im taumelnden Wirbel des laufenden Lebens, wo sie nur noch rein praktisch gebraucht werden, alle Farbe verloren, wie ein prismatischer Kreisel, der sich zu schnell dreht und grau aussieht –, wenn wir träumend nachdenken und, um ins Vergangene zurückzufinden, die beständige Bewegung, die uns mitreißt, zu verlangsamen, aufzuheben versuchen, dann sehn wir nach und nach nebeneinander, doch alle deutlich unter sich geschieden, die Farbtöne auftauchen, die im Lauf unseres Daseins, einen nach dem andern, ein und derselbe Name uns darbot.
Zwar weiß ich nicht, welche Form in meinen Augen der Name Guermantes bekam, als meine Amme mich einwiegte mit dem alten Lied: Heil der Marquise von Guermantes – und sie wußte wohl so wenig wie heut ich selbst, zu wessen Ehren dieses Lied komponiert worden war – oder als ein paar Jahre später der alte Marschall von Guermantes zum Stolz meines Kindermädchens in den Champs-Elysées bei uns stehn blieb, ausrief: »Ein schönes Kind!« und dabei aus einer Bonbonniere ein Schokoladenplätzchen herausholte. Diese ersten Jahre meiner Kindheit sind nicht mehr in mir, sie sind mir ein Äußeres, über das ich wie über alles, was vor unserer Geburt gewesen ist, nur aus Berichten anderer etwas erfahren kann. Für später aber finde ich hintereinander in der Fortdauer dieses Namens in mir sieben oder acht verschiedene Figuren; die ersten waren die schönsten; nach und nach aber wurde mein Traum gezwungen, eine unhaltbare Stellung aufzugeben und verschanzte sich weiter diesseits, bis er auch von dort noch zurückweichen mußte. Und sooft Frau von Guermantes ihren Wohnort wechselte – auch er entstammte diesem Namen, den von Jahr zu Jahr Worte, welche ich hörte, von neuem befruchteten und dadurch meine Träumereien änderten –, spiegelte jeder neue Wohnort meine Träume in seinen Steinen, die wie die Oberfläche einer Wolke oder eines Sees rückzustrahlen begannen. Ein Wartturm – nur in der Fläche vorhanden, nur ein strahlendes Band orangegelben Lichtes –, von dem herab der Ritter und seine Dame über Leben und Tod der Vasallen entschieden, hatte, ganz am Ende jener »Gegend um Guermantes«, wo ich manchen schönen Nachmittag mit meinen Eltern dem Lauf der Vivonne folgte, dem bächereichen Lande Platz gemacht, wo die Herzogin mich den Forellenfang und die Namen der Blumen lehrte, die in violetten und rötlichen Trauben die niedern Mauern der Nachbargehöfte schmückten; sodann war es das Erbland, die herrliche Domäne gewesen, auf der das stolze Geschlecht Guermantes wie ein altgelber, wappengeschmückter Turm über Frankreich zu einer Zeit sich erhob, als der Himmel da noch leer war, wo später Notre-Dame von Paris und Notre-Dame von Chartres ragen sollten, als auf den Hügel von Laon noch nicht das Schiff der Kathedrale sich niedergelassen hatte wie die Arche der Sintflut auf den Gipfel des Ararat, voll von Gerechten und von Patriarchen, welche sich ängstlich in die Fenster lehnen, um zu sehn, ob Gottes Zorn nachgelassen hat, versorgt mit Mustern der Gewächse, die auf Erden sich vermehren sollten, und übervoll von Tieren, die sich schauend drängen bis oben in die Türme, auf deren Dächern friedliche Rinder sich ergehn und hinuntersehn auf die Ebenen der Champagne; es war die Zeit, da der Wanderer, der gegen Abend Beauvais verließ, noch nicht bei jeder Wegbiegung hinter sich her auf der Goldwand des Sonnenunterganges die schwarzverzweigten Flügel der Kathedrale nachkommen sah. Dies Guermantes war wie der Rahmen eines Romans, ein Phantasie-Land, das ich mir kaum vorstellen konnte und um so mehr zu entdecken wünschte, eine Enklave inmitten wirklicher Länder und Landstraßen, die plötzlich zwei Meilen von einem Bahnhof etwas Heraldisches bekamen; die Namen benachbarter Ortschaften waren mir gegenwärtig, als wären sie am Fuß des Parnasses oder des Helikon gelegen, wertvoll als materielle, topographische Bedingungen einer Wundererscheinung. Ich sah die Wappen wieder, die unter den Kirchenfenstern von Combray auf die Mauer gemalt sind; ihre Felder hatten mit jedem Jahrhundert neuen Feudalbesitz aufgenommen, den das erlauchte Haus durch Heirat oder Erwerb aus allen Ecken Deutschlands, Italiens und Frankreichs sich hatte zuströmen lassen; gewaltige Ländereien im Norden und mächtige Städte im Süden hatten sich vereint und miteinander Guermantes gebildet, hatten ihr eignes materielles Wesen aufgegeben und ihren grünen Turm oder ihr Silberschloß in das azurne Feld eingesetzt. Ich hatte von den berühmten Wandteppichen von Guermantes gehört und sah sie mittelalterlich, blau und etwas derb sich von dem amarantenen sagenhaften Namen abheben wie eine Wolke dort unten an dem altertümlichen Wald, wo so oft Childebert jagte; mir war, als könnte ich in die heimlichste Tiefe der Länder, in die Ferne der Jahrhunderte reisen und in ihr Mysterium eindringen, wenn ich nur einen Augenblick in Paris der Frau von Guermantes nahe kommen könnte, der Lehnsherrin der Stätte und der Dame vom See, als müßten ihre Mienen und Worte den örtlichen Zauber von Hochwald und Ufer besitzen und die gleichen Züge früherer Jahrhunderte wie der alte Landrechtkodex in ihrem Archiv. Dann aber hatte ich Saint-Loup kennen gelernt, und er hatte mir mitgeteilt, das Schloß heiße Guermantes erst seit dem siebzehnten Jahrhundert, in welchem seine Familie es erworben habe. Bis dahin hatte sie in der Nachbarschaft residiert, und ihr Titel kam nicht von dieser Gegend. Das Dorf Guermantes hatte seinen Namen vom Schloß erhalten, war erst nach ihm erbaut worden, und um die Fernsichten nicht zu zerstören, regelte ein in Kraft gebliebenes Servitut den Grundriß der Straßen und beschränkte die Höhe der Häuser. Die Wandteppiche waren von Boucher; ein kunstliebender Guermantes hatte sie im neunzehnten Jahrhundert gekauft und in einem recht häßlichen, mit Kattun und Plüsch ausgeputzten Salon neben mittelmäßigen Jagdbildern, die er selber gemalt hatte, aufgehängt. Durch diese Enthüllungen brachte Saint-Loup in das Schloß Elemente, die dem Namen Guermantes fremd waren und mir verwehrten, weiterhin einzig dem dröhnenden Klang der Silben das Mauerwerk der Bauten zu entnehmen. So war im Innern dieses Namens das Schloß mit seinem spiegelnden See erloschen, und um Frau von Guermantes erschien mir als ihre Stätte ihr Haus in Paris, das Haus Guermantes, durchschimmernd wie der Name: kein undurchsichtiges Element der Wirklichkeit unterbrach sein Leuchtbild oder trübte es. Wie Kirche nicht allein das Gotteshaus bezeichnet, sondern auch die Versammlung der Gläubigen, umfaßte das Haus Guermantes alle, die das Leben der Herzogin teilten, aber diese Personen, die ich nie gesehn, waren mir nur berühmte poetische Namen, und da sie wieder nur Personen kannten, die auch nur Namen waren, vergrößerten und schützten sie das Mysterium der Herzogin nur noch mehr und breiteten um sie einen weiten Glanzhof, der sich mir allenfalls ein wenig abschattete.
Dachte ich an die Feste, die sie gab, verlieh meine Vorstellung den Eingeladenen keine Körper, Bärte, Schuhe, kein banales oder auch nur auf menschlich vernünftige Art eigentümliches Wort, der Wirbel der Namen sammelte um Frau von Guermantes, die selber eine Meißener Porzellanstatuette war, weniger Stoffliches an als ein Geistermahl oder ein Gespensterball es getan hätten, und bewahrte ihrem gläsernen Haus die Durchsichtigkeit einer Vitrine. Als mir dann Saint-Loup Anekdoten vom Kaplan und von den Gärtnern seiner Kusine erzählt hatte, war das Haus Guermantes – wie ehemals etwa ein Louvre – eine Art Schloß geworden, das, als Erbsitz auch mitten in Paris, von seinen Ländereien umgeben blieb, auf denen die Herzogin kraft eines altertümlichen wunderlich überlebenden Rechtes noch feudale Privilegien ausübte. Und diese letzte Stätte war dann von selbst verschwunden, als wir dicht neben Frau von Villeparisis in eine Wohnung einzogen, die derjenigen der Frau von Guermantes benachbart und in einem Flügel ihres Hauses gelegen war. Alte Wohnstätten dieser Art gibt es wohl immer noch. Den »Schloßhof« umgeben – angeschwemmt von der steigenden demokratischen Welle oder als ein Vermächtnis älterer Zeiten, in denen die verschiedenen Gewerbe um den Standesherrn sich gruppierten, übrig gebliebene Läden, Werkstätten, ja sogar Schuster- und Schneiderbuden (wie sie denn auch an den Flanken der Dome kleben, soweit die Ästhetik der Baumeister sie nicht freigelegt hat), der Pförtner war Flickschuster, hielt Hühner und züchtete Blumen – und hinten im Wohnhaus, im eigentlichen »Hotel«, lebte eine »Gräfin«; wenn die, auf ihrem Hute etwas Kapuzinerkresse, die aus dem Pförtnergärtchen gepflückt schien, in ihrer alten Kalesche mit den beiden Pferden ausfuhr (auf dem Bock neben dem Kutscher einen Lakaien, der in jedem aristokratischen Hause des Viertels Karten abzugeben hatte), dann lächelte und winkte sie den Kindern des Pförtners und den bürgerlichen Mietern des Hauses zu, die gerade vorbeikamen, und ihre herablassende Liebenswürdigkeit und ihr nivellierender Dünkel machte diese nun einander gleich.
In dem Haus, in das wir einzogen, war die große Dame überm Hof eine elegante und noch junge Herzogin: Frau von Guermantes. Dank Françoise erfuhr ich ziemlich schnell Näheres über das Haus. Denn die Guermantes (Françoise bezeichnete sie meistens mit Worten wie »die unten« oder »die von unten«) beschäftigten sie beständig. Wenn sie morgens Mama frisierte, warf sie verstohlen – weil es ihr verboten, aber unwiderstehlich verlockend war – einen Blick in den Hof und sagte: »Zwei barmherzige Schwestern! Das ist sicher für unten« oder »Ach, die schönen Fasanen am Küchenfenster, da braucht man nicht zu fragen, von wo daß die herkommen, der Herzog wird auf Jagd gewesen sein«, und so gings fort bis abends; hörte sie, während sie mir meine Nachtsachen herausgab, Klavier spielen oder Widerhall eines Liedes, folgerte sie: »Sie haben unten Leute, da gehts lustig zu«, und in ihrem regelmäßigen Gesicht, unter dem jetzt weißen Haar erschien ein lebhaftes und ehrbares Lächeln aus ihrer Jugendzeit und ordnete ihre Züge zu einer zarten gezierten Harmonie, wie vor dem Kontertanze.
Aber der Augenblick im Leben der Guermantes, der Françoise am lebhaftesten interessierte, ihr die größte Befriedigung und zugleich den meisten Verdruß verschaffte, war, wenn beide Flügel des Hoftors aufgingen und die Herzogin in ihre Kalesche stieg. Dies geschah gewöhnlich kurz nachdem unsere Bedienten die feierliche Zeremonie vollzogen hatten, die sie ihr Frühstück nannten. Diese Handlung durfte niemand unterbrechen; während sie stattfand waren sie »Tabu«, selbst mein Vater hätte sich nicht erlaubt, nach ihnen zu klingeln, er wußte ja auch, es würde sich keiner von ihnen stören lassen, beim fünften Klingelzug so wenig wie beim ersten, und er würde ganz umsonst und obendrein zu seinem eigenen Schaden eine Ungehörigkeit begehn. Denn Françoise, die, seit sie eine alte Frau war, zu jeder Gelegenheit ihren besondern »Kopf« aufsetzte, hätte ihm unfehlbar den ganzen Tag ein Gesicht mit lauter roten keilförmigen Fleckchen vorgesetzt, die der Außenwelt ein allerdings schwer zu entzifferndes langes Verzeichnis ihrer Beschwerden entfalteten, tiefgehende Gründe ihrer Unzufriedenheit. Die entwickelte sie übrigens auch in Worten, aber »in die Kulisse gesprochen«, wir konnten kaum etwas verstehn. Sie nannte das: den lieben langen Tag »stille Messen lesen« und meinte, es quäle, kränke und plage uns sehr.
Waren die letzten Riten vollzogen, so schenkte Françoise, wie in der urchristlichen Kirche zelebrierender Priester und zugleich der Gläubigen einer, sich ein letztes Glas Wein ein, band die Serviette ab, wischte, während sie sie faltete, Wein- und Kaffeereste von den Lippen, schob die Serviette in ihren Ring, dankte mit leidendem Blick »ihrem« jungen Lakaien, der mit eifrigem Getu zu ihr sagte: »Nicht noch etwas Weintrauben gefällig, Madame? Sie sind ausgezeichnet«, – und ging gleich ans Fenster, um es zu öffnen, angeblich, weil es so heiß war »in dieser elenden Küche«. Während sie den Fenstergriff drehte und Luft schöpfte, warf sie zugleich geschickt einen scheinbar gleichgültigen Blick auf den hinteren Hof und vergewisserte sich verstohlen, daß die Herzogin noch nicht fertig war. Einen Augenblick brüteten ihre Blicke hochmütig und leidenschaftlich über dem angespannten Wagen, und hatte sie den Dingen dieser Erde diese kurze Beachtung geschenkt, hob sie die Blicke zum Himmel, dessen Reinheit sie schon im voraus erraten hatte, während sie sanfte Luft und Sonnenwärme spürte; dann sah sie nach dem Winkel des Daches, wo jeden Frühling gerade über dem Kamin meines Zimmers Tauben nisteten, gleich denen, die in ihrer Küche zu Combray gurrten.
»Ach Combray, Combray« rief sie (und der fast singende Tonfall ihrer Anrufung hätte zusammen mit der arlesianischen Reinheit der Züge bei Françoise auf eine südliche Heimat schließen und vermuten lassen, das verlorene Vaterland, um das sie weine, sei nur Adoptivvaterland. Aber das wäre wohl eine Täuschung gewesen, offenbar gibt es keine Provinz, die nicht ihren »Süden« hat. Und bei vielen Savoyarden und Bretonen findet man die weichen Umstellungen von Längen und Kürzen, die den Südländer kennzeichnen.) »Ach, Combray! Wann werde ich dich wiedersehn, mein armes Combray! Wann werde ich wieder den lieben langen Tag unter deinem Weißdorn und unserm guten Flieder verbringen, die Finken hören und die Vivonne, die rieselt wie wenn einer flüstert, statt der elenden Klingel unseres jungen Herrn, der keine halbe Stunde vergehn läßt, ohne mich diesen verteufelten Korridor entlang zu hetzen. Und dann findet er noch, ich komme nicht schnell genug, man soll ihn wohl hören, ehe er klingelt, und kommt man eine Minute zu spät, gleich »stößt« ihn der Zorn. Ach mein armes Combray! vielleicht seh ich dich erst wieder, wenn ich gestorben bin, wenn man mich wie einen Stein in das Grabloch wirft. Dann werde ich ihn nicht mehr riechen, deinen schönen schneeweißen Hagedorn. Aber noch im Todesschlaf werde ich, glaub ich, dies dreimal Klingeln hören, das mir schon das Leben zur Hölle gemacht hat.«
Aber da wurde sie unterbrochen. Der Westenschneider im Hof rief, er, der damals meiner Großmutter so gut gefallen hatte, als sie Frau von Villeparisis besuchte, und der in Françoises Gunst nicht weniger hoch stand. Als er unser Fenster aufgehn hörte, hatte er den Kopf gehoben und suchte schon eine Weile, die Aufmerksamkeit seiner Nachbarin auf sich zu ziehen, um ihr guten Tag zu sagen. Koketterie des jungen Mädchens, das Françoise einst gewesen war, verfeinerte alsbald das mürrische Gesicht unserer alten Köchin, das von den Jahren, von schlechter Laune und Herdfeuer schwer mitgenommen war, und in reizender Mischung von Zurückhaltung, Vertraulichkeit, Scham richtete sie an den Westenschneider einen zierlichen Gruß, antwortete ihm aber nicht laut, denn, übertrat sie schon Mamas Ermahnungen, wenn sie in den Hof sah, so hätte sie doch nicht gewagt, ihnen noch mehr zu trotzen und aus dem Fenster zu sprechen, das hätte ihr von Seiten der gnädigen Frau ein ganzes »Kapitel« eintragen können, wie sie es nannte. Sie zeigte ihm die angespannte Kalesche, als wollte sie sagen: »Schöne Pferde, was?«, murmelte aber dabei: »Alte Schindmähren!«; sie wußte, er werde die Hand an den Mund legen, um trotz leisem Sprechen verstanden zu werden und ihr antworten:
»Sie könnten auch so was haben, wenn Sie wollten, vielleicht noch eher als die da, aber Sie mögen das alles nicht.«
Und mit bescheiden ausweichender Bewegung, – man merkte ihr aber an, sie war entzückt –, andeutend: »Jeder wie er's versteht. Hier ist man für's Einfache«, schloß Françoise ihr Fenster aus Furcht, Mama könne kommen.
Wenn Jupien sagte, »Sie könnten mehr Pferde haben als die Guermantes«, meinte er uns, aber er hatte recht, »Sie« zu sagen, denn von gewissen Freuden rein persönlicher Eitelkeit abgesehn, zum Beispiel, der, ununterbrochen zu husten, bis das ganze Haus Angst vor Erkältung bekam, und dann mit aufreizendem Grinsen zu behaupten, sie sei nicht erkältet, lebte Françoise mit uns in Symbiose, wie Pflanzen, die ganz mit einem Tier vereinigt sind und sich von ihm ernähren lassen: für sie erbeutet, ißt und verdaut es die Nahrung und bietet sie ihnen in ihrem letzten ganz assimilierbaren Restbestand an; wir mußten mit unsern Tugenden, unserm Vermögen, unserer Lebensführung und gesellschaftlichen Stellung es übernehmen, für die kleinen Befriedigungen der Eitelkeit zu sorgen, die Françoise unbedingt zum Leben brauchte – wozu noch das Recht kam, den Kultus des Frühstücks nach altem Brauche frei auszuüben, einschließlich des nachfolgenden Schlucks frischer Luft am Fenster, dazu ein wenig Straßenbummel, wenn sie Besorgungen machte, und den Sonntagsausgang zu ihrer Nichte. So wird es verständlich, daß Françoise die ersten Tage im neuen Haus, wo noch nicht alle Ehrentitel meines Vaters bekannt waren, fast an einem Leiden hingesiecht wäre, das sie selbst Verdruß oder Zeitlang nannte, Verdruß im tatkräftigen Sinne, den er bei Corneille hat, Zeitlang, wie in den Briefen von Soldaten, die am Ende Selbstmord begehn, weil sie nach ihrer Braut oder ihrem Dorf zuviel »Zeitlang« haben. Françoises Verdruß wurde schnell geheilt und zwar von Jupien; er verschaffte ihr ein ebenso lebhaftes und dabei raffinierteres Vergnügen, als ihr etwa unser Entschluß, einen Wagen anzuschaffen, bereitet hätte. – »Sehr gute Gesellschaft, diese Jupien, sehr ordentliche Leute, es steht ihnen auf dem Gesicht geschrieben.« Jupien vermochte in der Tat allen verständlich zu machen und beizubringen, daß wir nur deshalb keine Wagen hätten, weil wir es nicht wollten. Françoises neuer Freund war wenig zu Hause, seit er einen Beamtenposten in einem Ministerium bekommen hatte. Erst war er zusammen mit dem »Mädel«, das meine Großmutter für seine Tochter gehalten hatte, Westenschneider gewesen; aber die Ausübung dieses Gewerbes wurde unvorteilhaft für ihn, als die Kleine, die als halbes Kind, damals als meine Großmutter Frau von Villeparisis einen Besuch machte, sehr gut einen Rock säumen konnte, der Damenschneiderei sich zugewandt hatte und Rockschneiderin geworden war. Erst hatte sie als Lehrmädchen bei einer Schneiderin eine Naht machen, einen Besatz säumen, einen Knopf oder Druckknopf annähen oder eine Taillenweite mit Nadeln einreihen müssen, war dann zweite und schließlich erste Arbeiterin geworden, hatte sich eine Kundschaft von Damen der besseren Gesellschaft erworben und arbeitete nun zu Hause, das heißt, in unserm Hof, meist mit einer oder zwei ihrer früheren Kolleginnen vom Atelier, die sie als Gehilfinnen anstellte. Seitdem war Jupiens Gegenwart weniger nützlich geworden. Wohl hatte die großgewordene Kleine noch oft Westen zu machen. Aber da ihre Freundinnen ihr halfen, brauchte sie weiter niemand. So hatte Jupien, ihr Onkel, sich denn um eine Anstellung beworben. Erst konnte er schon Mittags nach Hause kommen, dann, als er endgültig den ersetzte, dem er anfangs ausgeholfen hatte, nicht vor dem Abendessen. Seine »Ernennung« fand glücklicherweise erst einige Wochen nach unserm Einzug statt; so konnte er seine Liebenswürdigkeit lange genug spielen lassen, um Françoise über die ersten schweren Zeiten hinwegzuhelfen und ihr Kummer zu ersparen. Nebenbei bemerkt, ohne seine Nützlichkeit für Françoise als »Übergangsmittel« zu verkennen, muß ich gestehn, daß Jupien mir auf den ersten Blick nicht sehr gefallen hat. Auf ein paar Schritt Entfernung hoben seine Augen den Eindruck, den sonst die dicken Backen und die blühende Gesichtsfarbe gemacht hätten, ganz auf, sie flossen über von einem mitleidigen, trostlos verträumten Blick, man kam auf den Gedanken, er sei krank oder von einem schweren Trauerfall betroffen. Aber weit gefehlt! Wenn er sprach – und er drückte sich sehr gut aus –, wirkte er sogar geradezu kalt und spöttisch. Durch diese Disharmonie zwischen Blick und Wort entstand etwas Falsches, Liebloses, worunter er selbst zu leiden schien, er war verlegen wie ein Gast im einfachen Rock in einer Abendgesellschaft, wo alle andern im Frack sind, oder wie jemand, der einer Hoheit antworten soll, aber nicht weiß, wie sie anreden und, um die Schwierigkeit zu umgehn, seine Wendungen auf ein Mindestmaß beschränkt. Jupiens Ausdrucksweise – das eben Gesagte war ein reiner Vergleich – war hingegen sehr liebenswürdig. Im Zusammenhang vielleicht mit der Überflutung des ganzen Gesichts durch den Blick (den man nicht mehr beachtete, wenn man ihn kannte) entdeckte ich bald bei ihm eine seltene Fassungsgabe, die wie nur ganz wenige, die ich gekannt habe, von Natur literarisch war, in dem Sinne, daß er, vermutlich ohne jede eigentliche Bildung, nur mit Hilfe einiger hastig überflogener Bücher die scharfsinnigsten Wendungen der Sprache besaß oder sich angeeignet hatte. Die begabtesten Leute, die ich gekannt hatte, waren sehr jung gestorben. Daher war ich überzeugt, Jupien werde nicht lange leben. Er war gütig und mitleidig, seine Gefühle waren die zartesten und großmütigsten. Schnell hörte er auf, eine unentbehrliche Rolle im Leben Françoises zu spielen. Sie hatte gelernt, ihn zu ersetzen.
Kam auch nur ein Lieferant oder ein Bedienter mit einem Paket zu uns, wußte Françoise die paar Augenblicke, die er in der Küche auf Mamas Antwort wartete, geschickt auszunutzen; dabei schien sie sich gar nicht um ihn zu kümmern, wies ihm nur mit gelassener Miene einen Stuhl an und blieb bei ihrer Arbeit, aber selten ging er fort, ohne sich fest und dauernd eingeprägt zu haben: »wenn wirs nicht haben, so wollen wirs eben nicht haben.« Hielt sie übrigens sehr darauf, daß man wisse, wir seien reich, so war deshalb der blanke Reichtum, Reichtum ohne Tugend nicht das höchste Gut in Françoises Augen, aber Tugend ohne Reichtum war ebensowenig ihr Ideal. Reichtum war für sie eine notwendige Voraussetzung der Tugend, ohne ihn blieb die Tugend auch ohne Verdienst und Reiz. Sie trennte beide so wenig voneinander, daß sie schließlich einem die Eigenschaften des andern verlieh, die Tugend mit einigem Komfort versehn wissen wollte und dem Reichtum etwas Erbauliches zuerkannte.
Hatte sie dann das Fenster ziemlich rasch – sonst würde, scheint es, Mama sie »nach Noten ausgeschimpft« haben – zugemacht, begann Françoise seufzend den Küchentisch abzuräumen.
»Es gibt Guermantes, die wohnen rue de la Chaise,« sagte der Kammerdiener, »ich hatte einen Freund, der dort in Stellung war; er war zweiter Kutscher bei ihnen. Und ich kenne einen, nicht dieser Kamerad, sondern sein Schwager, der hat mit einem Piqueur des Barons von Guermantes zusammen gedient. Mir kanns gleich sein, es ist ja nicht mein Vater«, setzte er hinzu; er hatte die Gewohnheit, seine Rede mit den neuesten Witzen zu schmücken, wie er die Schlager des Jahres zu trällern pflegte.
Françoise hatte die müden Augen einer alternden Frau, die alles, was Combray betraf, in unbestimmter Ferne sahen; sie verstand den Witz nicht, der in den Worten lag, merkte aber, daß einer drin sein mußte, denn sie standen außer Zusammenhang mit dem andern, was der Diener gesagt hatte, und sie wußte, er war ein Witzbold. Sie setzte ein wohlwollendes verblüfftes Lächeln auf, als wollte sie sagen: immer derselbe, dieser Viktor. Übrigens war sie glücklich, sie wußte, derartiges mitanzuhören, hing von fern mit den achtbaren gesellschaftlichen Vergnügungen zusammen, für die man in allen Kreisen sich gern gut anzieht und eine Erkältung riskiert. Schließlich glaubte sie, in dem Kammerdiener einen Freund zu haben, denn immer wieder verriet er ihr mit Entrüstung, was die Republik wieder Schreckliches gegen den Klerus vorhatte. Françoise hatte noch nicht eingesehn, daß unsere schlimmsten Feinde nicht die sind, die uns widersprechen und uns zu überzeugen versuchen, sondern die, welche Nachrichten, die uns betrüben können, aufbauschen oder erfinden, dabei sich aber hüten, sie berechtigt erscheinen zu lassen, denn das würde unsern Kummer vermindern und könnte ein wenig Achtung für die Gegenpartei in uns wecken, die wollen sie uns aber, um uns desto schmerzlicher zu treffen, als entsetzliche Sieger zeigen.
»Die Herzogin muß mit alldem verbandelt sein«, nahm Françoise das Gespräch über die Guermantes aus der rue de la Chaise wieder auf, wie man ein Musikstück in Andante wiederholt. »Ich weiß nicht mehr, wer mir gesagt hat, daß einer von denen dem Herzog seine Kusine geheiratet hat. Jedenfalls ist es dieselbe ›Liniatur‹. Eine große Familie, die Guermantes!« Das sagte sie mit Ehrfurcht und begründete die Größe der Familie gleichzeitig mit der Zahl ihrer Mitglieder und dem Glanz ihres Ruhmes wie Pascal die Wahrheit der Religion mit der Vernunft und der Autorität der Heiligen Schrift. Sie hatte für beides nur das eine Wort ›groß‹, und so bildeten beide Dinge für sie eine Einheit; ihr Wortschatz hatte wie gewisse Steine fehlerhafte Stellen, die auch ihr Denken stellenweise verdunkelten.
»Ich frage mich, ob das nicht die sind, die ihr Schloß in Guermantes zehn Meilen von Combray haben, dann müssen sie auch mit der Kusine aus Algier verwandt sein.« Meine Mutter und ich hatten lange nicht gewußt, wen Françoise mit dieser Kusine aus Algier meine, bis wir herausbekamen, daß Françoise unter Algier die Stadt Angers verstand. So kann uns etwas Fernes bekannter sein, als etwas Nahes. Françoise kannte den Namen Algier von den scheußlichen Datteln her, die wir zu Neujahr geschickt bekamen, aber Angers war ihr unbekannt. Ihre Sprache war wie die französische und wie insbesondere die französischen Ortsbezeichnungen voll von Irrtümern. »Ich wollte darüber mit Ihrem Butler sprechen.– Wie sagt man doch zu dem?« unterbrach sie sich, als beschäftige sie eine Frage der Etikette, »ja richtig, Antoine sagt man zu ihm«, gab sie dann sich selbst zur Antwort, als ob Antoine ein Titel wäre. »Der hätte mir darüber was sagen können, aber er ist ein vornehmer Herr, ein großer Pedant, es ist, als wenn man ihm die Zunge abgeschnitten hätte oder als hätte er vergessen, sprechen zu lernen. Ach (hier wurde sie unaufrichtig), wenn ich nur weiß, was in meinem Topf kocht, kümmere ich mich nicht um die andern. Jedenfalls ist das nicht christlich von ihm. Und dann ist es keiner, der tapfer dran geht (aus dieser Würdigung hätte man schließen können, Françoise habe über Tapferkeit ihre Meinung geändert; in Combray nämlich behauptete sie, die mache die Männer zu reißenden Tieren. Aber das würde nicht stimmen: tapfer bedeutete hier nur arbeitsam). Man sagt auch, er stiehlt wie ein Rabe, aber man muß nicht jeden Tratsch glauben. Hier gehen von wegen der Portierloge alle Angestellten weg, die Portierleute sind eifersüchtig und hetzen die Herzogin auf. Aber man kann schon sagen, dieser Antoine ist ein Taugenichts und seine ›Antoinesse‹ taugt nicht mehr als er.« Um ein Femininum zu dem Namen Antoine zu finden, das die Frau des Butlers bezeichnete, hatte Françoise sich bei ihrer grammatikalischen Neuschöpfung wohl unbewußt an chanoine und chanoinesse gehalten. Das war sprachlich nicht schlecht. In der Nähe von Notre-Dame gibt es noch eine Straße, die rue Chanoinesse heißt; dieser Name war ihr (da sie nur von Stiftsdamen bewohnt wurde) von den Franzosen alter Zeit gegeben worden, die die richtigen Zeitgenossen Françoises waren. Gleich darauf lieferte Françoise übrigens wieder ein Beispiel dieser Femininbildung. Sie sagte: »Aber ganz gewiß gehört das Schloß Guermantes der Herzogin. Sie ist doch dortzuland die Frau ›mairesse‹; das ist schon etwas!«
»Ich glaube gern, daß das etwas ist«, sagte im Ton der Überzeugung der Lakai, er hatte die Ironie nicht gemerkt.
»Ach, was du denkst, mein Junge! Das soll etwas sein? Für Leute wie die ist das gar nichts, Bürgermeister und Bürgermeisterin zu sein. Wenn mir das Schloß Guermantes gehörte, mich bekäme man nicht oft in Paris zu sehn. Ich begreife auch nicht, daß Leute wie unsere Herrschaft darauf verfallen, in dieser elenden Stadt zu bleiben, statt nach Combray zu gehn, sobald sie frei sind und niemand sie zurückhält. Worauf warten sie noch, um sich zurückzuziehen, wo es ihnen doch an nichts mangelt? Etwa auf den Tod? Wenn ich nur trocken Brot zu essen hätte und Holz, um warm zu haben im Winter, ich wäre schon lange daheim in meines Bruders Häuschen zu Combray. Da unten, da fühlt man doch wenigstens, daß man lebt, hat nicht alle die Häuser vor der Nase, und nachts ist es so still, man hört mehr als zwei Meilen weit die Frösche singen.«
»Das muß wirklich schön sein, Madame«, rief der junge Lakai mit Begeisterung, als ob das mit den Fröschen eine Besonderheit von Combray sei wie in Venedig das Gondelfahren.
Er war, nebenbei bemerkt, noch nicht so lange im Haus wie der Kammerdiener und sprach mit Françoise über Dinge, die nicht ihn, sondern sie interessierten. Und Françoise, die ein Gesicht schnitt, wenn man sie als Köchin behandelte, hatte für den Lakaien, der von ihr als der »Gouvernante« sprach, ein besonderes Wohlwollen, wie es manche Fürsten zweiten Grades für artige junge Leute haben, die sie »Hoheit« anreden.
»Man weiß wenigstens, was man tut und in welcher Jahreszeit man lebt. Es ist nicht wie hier, wo es zu Ostern so wenig wie zu Weihnachten die armseligste Butterblume gibt, wo ich nicht einmal ein kleines Angelus läuten höre, wenn ich meine alten Knochen aus dem Bett schleppe. Da unten hört man jede Stunde, wenn es auch nur ein armseliges Glöckchen ist, aber du sagst dir: »Jetzt kommt mein Bruder vom Feld«; du siehst, wie der Tag sinkt, man läutet für das irdische Wohlergehn, du hast Zeit dich umzudrehen, eh du deine Lampe ansteckst. Hier wird es Tag und wird Nacht, man geht schlafen und weiß nicht besser als ein Tier, was man eigentlich getan hat.«
»Méséglise scheint auch sehr hübsch zu sein, Madame«, unterbrach der junge Lakai, für den das Gespräch eine etwas abstrakte Richtung nahm: er hatte uns zufällig bei Tisch von Méséglise sprechen hören.
»Oh! Méséglise!« sagte Françoise mit dem breiten Lächeln, das immer auf ihre Lippen kam, wenn man die Namen Méséglise, Combray oder Tansonville aussprach. Sie gehörten ganz und gar zu ihrem eigenen Dasein, und wenn sie ihr von außen begegneten, in einem Gespräch vorkamen, wurde sie munter, ähnlich wie Schüler, wenn der Lehrer beim Unterricht auf eine bekannte zeitgenössische Persönlichkeit anspielt, von der sie nie geglaubt hätten, ihr Name könne vom Katheder herab erklingen. Françoise hatte noch das besondere Vergnügen, daß diese Gegenden für sie etwas anderes als für die andern waren, alte Kameraden, mit denen man allerlei zusammen unternommen hatte; sie lächelte ihnen zu, als verstünden sie sie, denn sie fand in ihnen viel von sich selbst.
»Das kannst du wohl sagen, mein Kind, Méséglise ist recht hübsch«, begann sie dann wieder mit schlauem Lachen, »aber wo hast denn du was von Méséglise gehört?«
»Wo ich was von Méséglise gehört habe? Aber das ist doch ganz bekannt: man hat mir davon gesprochen, sogar öfter davon gesprochen«, antwortete er mit der verbrecherischen Ungenauigkeit derer, die, wenn wir objektiv feststellen wollen, wie wichtig etwas, das uns angeht, für die andern ist, mit ihrem Bescheid uns das unmöglich machen.
»Ihr könnt mir glauben, dort unter den Kirschbäumen ists besser als am Küchenherd.«
Sie sprach ihnen sogar von Eulalie und sagte, das sei eine gute Person gewesen. Françoise hatte vollständig vergessen, daß sie Eulalie Zeit ihres Lebens wenig geliebt hatte, wie alle, die zu Hause nichts zu essen haben, diese Hungerleider, die dann als rechte Tagediebe, wenn die Reichen ihnen etwas zukommen lassen, »sich mausig machen«. Jetzt litt sie nicht mehr darunter, daß Eulalie es so gut verstand, sich jede Woche von meiner Tante »was zustecken« zulassen. Das Lob der Tante aber sang sie unaufhörlich.
»Dann waren Sie also in Combray selbst bei einer Kusine unserer Gnädigen?« fragte der junge Lakai.
»Ja, bei Frau Octave, das war eine fromme Dame, liebe Kinder, bei der gab es immer etwas, und immer vom besten, Rebhühner, Fasanen, damit knauserte sie nicht, man konnte zu fünfen, zu sechsen zum Essen kommen, an Fleisch fehlte es nie und noch dazu beste Qualität und Weißwein und Rotwein, alles, was man wollte. Alles ging auf ihre Kosten, da konnte die Familie Monate bleiben, Jahre! Ihr könnt mirs glauben, hungrig ist man da nie fortgegangen. Wie der Herr Pfarrer es uns oft beigebracht hat: wenn eine Frau darauf rechnen kann, zum lieben Gott zu kommen, dann ists wahr und wahrhaftig Frau Octave. Die Arme, ich höre sie noch, wie sie mit ihrem Stimmchen sagte: »Françoise, Sie wissen ja, ich esse nichts, aber es soll bei mir für alle so gut zu essen geben, als ob ich mitäße.« Nein, für sie war es wahrhaftig nicht, was da gekocht wurde. Hättet sie sehn sollen. Sie wog nicht mehr als eine Tüte Kirschen, rein gar nichts. Sie wollte mir nicht glauben, hat nie zum Arzt gehen wollen. Ach, da unten wurde nicht so husch husch gegessen. Sie wollte, ihre Bedienten sollten gut genährt werden. Hier haben wir erst wieder heut morgen nicht mal Zeit gehabt, einen Bissen zu essen. Alles geht Hals über Kopf.«
Besonders die gerösteten Zwiebäcke, die mein Vater aß, brachten sie außer sich. Sie war überzeugt, er wolle die nur, um sich wichtig zu tun und ihr »Beine zu machen«.
»So was hab ich nie gesehn, muß ich sagen«, meinte der junge Lakai. Es klang, als habe er alles gesehn, als erstrecke sich seine tausendjährige Erfahrung über alle Länder und ihre Sitten, und darunter gäbe es nirgends die, Brot zu rösten. »Ja, ja,« brummelte der Butler, »das kann alles noch ganz anders werden, in Kanada sollen die Arbeiter streiken, und neulich hat der Minister zu unserm Herrn gesagt, daß er dafür zweihunderttausend Franken gekriegt hat.« Dem Butler lag es fern, ihn deshalb zu tadeln. Er selber war durchaus ehrlich, hielt aber alle Politiker für verdächtig, und in seinen Augen war, sich bestechen zu lassen, nicht so schlimm wie der kleinste Diebstahl. Er fragte sich nicht einmal, ob er denn dies historische Wort auch richtig verstanden habe, es kam ihm gar nicht unwahrscheinlich vor, daß der Schuldige es selbst zu meinem Vater gesagt habe, ohne daß dieser ihn vor die Tür setzte. Aber die Combrayer Philosophie hinderte Françoise, zu hoffen, die Streiks in Kanada könnten eine Rückwirkung auf das Zwiebackrösten haben. »Sehn Sie, solange die Welt Welt sein wird,« sagte sie, »wird es Herren geben, die uns herumhetzen, und Diener für ihre Launen.« Der Theorie vom beständigen Herumhetzen zum Trotz, sagte meine Mutter, die vermutlich für die Länge des Frühstücks andere Maße hatte als Françoise:
»Was die nur anstellen mögen, jetzt sitzen sie schon über zwei Stunden bei Tisch.«
Und sie klingelte schüchtern drei- oder viermal. Françoise, ihr Lakai und der Butler hörten das Klingeln wie ein Signal; noch dachten sie nicht daran zu kommen, aber immerhin war es wie das erste Stimmen der Instrumente, man merkte, das Konzert werde bald anfangen, es gebe nur noch ein paar Minuten Pause. Als dann das Klingeln sich häufiger wiederholte und dringender wurde, gaben unsere Bedienten schon mehr darauf acht: nun hatten sie wohl nicht mehr viel Zeit vor sich, die Wiederaufnahme der Arbeit stand nahe bevor; und als es dann einmal etwas nachhaltiger schellte, stießen sie einen Seufzer aus und faßten ihre Entschlüsse: der Lakai ging hinunter, eine Zigarette vor der Tür zu rauchen, Françoise stellte noch ein paar Betrachtungen über uns an, wie: »Die können keinen Augenblick stillsitzen« und ging dann hinauf in ihren sechsten Stock, ihre Sachen zu ordnen, während der Butler in meinem Zimmer sich Briefpapier suchte und rasch seine Privatkorrespondenz erledigte.
Trotz der hochmütigen Miene des herzoglichen Butlers hatte mir Françoise schon in den ersten Tagen mitteilen können, daß die Guermantes ihr Haus nicht auf Grund eines Rechtes aus unvordenklichen Zeiten bewohnten, sondern es neuerdings gemietet hatten und daß der Garten auf der Seite, die ich nicht kannte, ziemlich klein sei und allen anstoßenden Gärten ähnlich; schließlich erfuhr ich auch, zu sehn gäbe es da weder Lehnsherrngalgen noch Fischweiher, nicht Bannbackhaus noch Scheuer, weder Gerichtslaube, noch feste oder Zugbrücken, geschweige denn fliegende, so wenig wie Zollhaus, Kirchturm und Malhügel. Wie aber damals, als die Bucht von Balbec alles Geheimnisvolle für mich verloren hatte und eine Wassermasse geworden war, die man mit jeder beliebigen andern Salzwassermasse auf dem Globus auswechseln konnte, der Maler Elstir ihr plötzlich ein Eigenleben gegeben hatte, als er sagte, sie sei Whistlers opalener Golf in Silberblau, so bekam jetzt der Name Guermantes, dem Françoises Gewalt die letzte Stätte, die aus ihm hervorgegangen war, entrissen hatte, neuen Klang, als ein alter Freund meines Vaters uns eines Tages, an dem von der Herzogin die Rede war, erklärte: »Sie nimmt die erste Stelle im Faubourg Saint-Germain ein, sie hat das erste Haus des Faubourg.« Wohl war der erste Salon, das erste Haus des Faubourg Saint-Germain wenig neben all den Stätten, von denen ich geträumt hatte. Aber auch diese Stätte, die nun wohl die letzte war, behielt etwas, das bei aller Einschränkung doch mehr war als das Stoffliche, aus dem es bestand, besaß eine verborgene Besonderheit.
Und für mich war es eine Notwendigkeit geworden, in dem »Salon« der Frau von Guermantes und in ihren Freunden das Geheimnis ihres Namens suchen zu können, umsomehr als ich es in ihrer Person nicht fand, wenn ich sie morgens ausgehn und nachmittags ausfahren sah. Gewiß war sie mir schon in der Kirche von Combray blitzschnell verwandelt worden, die Farbe des Namens Guermantes und der Nachmittage am Ufer der Vivonne hatte nicht eingehn können in ihre undurchlässigen und spröden Wangen, und aus den Trümmern meines Traums war sie hervorgegangen wie Schwan und Weide, in die ein Gott oder eine Nymphe sich verwandelt haben und die von nun an den Gesetzen der Natur unterworfen bleiben, im Wasser gleiten oder im Winde wehen werden. Und doch hatten sich diese verlorenen Spiegelbilder, kaum daß ich sie aufgegeben, wiedergebildet wie die rosa und grünen Spiegelungen der untergegangenen Sonne hinter dem Ruder, das sie gebrochen hat, und in meinen einsamen Gedanken hatte der Name schnell das Erinnerungsbild des Gesichts sich zu eigen gemacht. Jetzt aber sah ich sie oft an ihrem Fenster, im Hof, auf der Straße; und gelang es mir nicht, den Namen Guermantes in ihr zu integrieren, zu denken, sie sei Frau von Guermantes, so gab ich für meinen Teil die Schuld daran meinem Geist, der unfähig sei, bis zum Ziel durchzuführen, was ich von ihm verlangte; sie aber, unsere Nachbarin, schien denselben Irrtum zu begehn, und das störte sie offenbar gar nicht, sie hatte keine meiner Skrupel, vermutete nicht einmal, daß es ein Irrtum sei. Frau von Guermantes bemühte sich sichtlich, in ihrer Kleidung der Mode zu folgen, als glaube sie, eine Frau wie alle andern geworden zu sein, und erstrebte eine Eleganz der Kleidung, in der beliebige Frauen es ihr gleichtun, sie vielleicht sogar übertreffen konnten; ich hatte gesehn, wie sie auf der Straße eine gut angezogene Schauspielerin mit Bewunderung betrachtete; und als erkenne sie das Urteil der Vorübergehenden an, deren Gewöhnlichkeit sie heraustreten ließ, indem sie ihr unzulängliches Dasein mitten unter ihnen harmlos spazieren führte, sah ich sie morgens, ehe sie ausging, vor dem Spiegel die ihrer unwürdige Rolle der eleganten Frau mit einer Überzeugung spielen, in der nichts Abgelöstes oder Ironisches lag, mit Leidenschaft, Verdruß und Eitelkeit wie eine Königin, die bei einer Hofaufführung die Rolle einer Zofe übernommen hat; wie in der Sage hatte sie ihre angeborene Größe ganz vergessen, sie sah nach, ob ihr Schleier gut sitze, glättete ihre Ärmel, richtete ihren Mantel, wie der göttliche Schwan alle Bewegungen seiner tierischen Art macht; seine rechts und links vom Schnabel aufgemalten Augen offen hat, ohne den Blick aufzutun, sich mit einemmal als richtiger Schwan auf einen Knopf oder einen Regenschirm wirft und sich nicht erinnert, daß er ein Gott ist. Aber wie der Reisende, den der erste Anblick einer Stadt enttäuscht, sich sagt, er müsse erst die Museen besuchen, mit Leuten aus dem Volk bekannt werden und in den Bibliotheken arbeiten, um den Reiz der Stadt zu erleben, so sagte ich mir, würde mich Frau von Guermantes empfangen, würde ich einer ihrer Freunde, dränge ich in ihr Dasein ein, ich würde erkennen, was unter der orangenfarben glänzenden Hülle ihr Name wirklich, objektiv für die andern enthalte; hatte doch der Freund meines Vaters gesagt, der Kreis Guermantes sei etwas ganz Besondres innerhalb des Faubourg Saint-Germain.
Das Leben, das ich dort vermutete, mußte einer von aller Erfahrung verschiedenen Quelle entstammen, ich konnte mir nicht vorstellen, daß auf den Abendgesellschaften Menschen zugegen wären, wie ich sie aus früherem Verkehr kannte, wirkliche Menschen; so eigentümlich dachte ich mir dies Leben. Sonst würden ja diese Menschen, die ihre Natur doch nicht mit einem Schlage ändern konnten, dort so reden, wie ich sie reden gehört hatte, ihre Partner würden sich dazu erniedrigen, in derselben menschlichen Sprache ihnen zu antworten; dann gäbe es auf einer Abendgesellschaft im ersten Salon des Faubourg Saint-Germain Augenblicke genau der Art, wie ich sie schon erlebt hatte und das war unmöglich. Allerdings stieß mein Geist auf gewisse Schwierigkeiten, und die Gegenwart des Leibes Jesu Christi in der Hostie schien mir kein dunkleres Mysterium als dieser erste Salon des Faubourg, der seltsamerweise auf dem rechten Seineufer lag und mir so nahe war, daß ich in meinem Zimmer hören konnte, wie morgens die Möbel in ihm geklopft wurden. Aber die Demarkationslinie, die mich vom Faubourg Saint-Germain trennte, schien mir nicht weniger wirklich, weil sie nur ideal war; für mich fing das Faubourg schon an mit der Matte im Korridor der Guermantes, von der meine Mutter, als einmal die Tür offenstand und wir sie da liegen sahen, zu sagen gewagt hatte, sie sei in recht schlechtem Zustand. Und dann: mußte ihr Eßzimmer, die dunkle Galerie mit den roten Plüschmöbeln, die ich manchmal aus unserm Küchenfenster sehn konnte, nicht den geheimnisvollen Zauber des Faubourg Saint-Germain für mich besitzen, unbedingt dazu gehören, geographisch darinnen liegen? Denn in diesem Eßzimmer empfangen zu werden, hieß, ins Faubourg Saint-Germain gehn, seine Luft atmen; die, welche, ehe man zu Tisch ging, neben Frau von Guermantes auf dem Ledersofa der Galerie saßen, waren alle aus dem Faubourg Saint-Germain. Gewiß konnte man auch außerhalb des Faubourg in gewissen Abendgesellschaften mitten unter dem gewöhnlichen Volk eleganter Leute bisweilen einen dieser Menschen majestätisch thronen sehn, die nur Namen sind und, wenn man versucht, sie sich vorzustellen, bald das Ansehn eines Turniers, bald das eines Domänenforstes annehmen. Aber hier im ersten Salon des Faubourg Saint-Germain, in der dunkeln Galerie waren nur sie. Sie waren die Säulen aus kostbarem Gestein, die den Tempel tragen. Selbst zu den vertraulichen kleinen Gastereien konnte Frau von Guermantes nur unter ihnen ihre Gäste wählen, und bei einem Abendessen von zwölf Personen, die sich um den gedeckten Tisch versammelten, waren sie, wie die goldenen Apostelstatuen der Sainte-Chapelle, symbolische geweihte Pfeiler vor dem Tisch des Herrn. Und in dem kleinen Garten zwischen den hohen Mauern hinterm Haus zu sein, wo Frau von Guermantes im Sommer nach Tisch Liköre und Limonaden auftragen ließ, dort zwischen neun und elf Uhr abends auf den Eisenstühlen – die mit ebenso großer Macht begabt waren wie das Ledersofa, – zu sitzen, ohne die eigenste Luft des Faubourg Saint-Germain zu atmen, war in meinen Augen so unmöglich wie Siesta halten in der Oase von Figuig, ohne damit in Afrika zu sein. Nur Einbildungskraft und Glaube unterscheiden gewisse Gegenstände und Wesen von andern und schaffen eine Atmosphäre. Ach, ich würde wohl nie in diesen malerischen Stätten, zwischen diesen Naturerscheinungen, diesen Sehenswürdigkeiten und Kunstgebilden des Faubourg Saint-Germain einen Schritt tun! Und so genügte es mir, zu erbeben, wenn ich vom hohen Meer und ohne Hoffnung, je dort zu landen, wie ein vorgebautes Minaret, wie eine erste Palme, ein erstes Stück fernländischen Gewerbes oder exotischer Pflanzenwelt, die abgenutzte Matte des Ufers sah.
Begann für mich das Haus Guermantes an der Tür des Flurs, so mochten sich nach der Meinung des Herzogs seine Nebengebäude viel weiter erstrecken, er hielt alle Mieter für Pächter, hörige Bauern oder Aufkäufer von Nationalgut, deren Meinung nicht mitzählt, er rasierte sich morgens im Nachthemd an seinem Fenster, ging in den Hof hinunter, je nach der Witterung, in Hemdsärmeln, im Pyjama, im buntkarrierten langhaarigen Rock oder in kurzen Mänteln, unter denen der Rock hervor sah, und ließ sich von einem seiner Bereiter ein neugekauftes Pferd vorführen. Mehr als einmal beschädigte das Pferd Jupiens Laden, und wenn der dann eine Entschädigung verlangte, entrüstete sich der Herzog. »Ganz abgesehn von allen Wohltaten der Herzogin im Hause und in der Gemeinde,« sagte Herr von Guermantes, »ist es eine Gemeinheit von diesem Individuum, etwas von uns zu verlangen.« Aber Jupien ließ sich nichts gefallen und schien von irgendwelchen »Wohltaten« der Herzogin nichts zu wissen. Tatsächlich war sie wohltätig gewesen, aber man denkt immer an das, was man für den einen getan hat, vergißt darüber den andern und erregt dadurch bei ihm nur um so größere Unzufriedenheit. Übrigens war auch von andern Gesichtspunkten als dem der Wohltätigkeit das Viertel – und zwar bis auf weite Entfernung – für den Herzog nur eine Verlängerung seines Hofes, eine ausgedehntere Rennbahn für seine Pferde. Hatte er gesehn, wie ein neues Pferd trabte, ließ er es anspannen und durch die nächsten Straßen fahren, der Bereiter mußte neben dem Wagen herlaufen, das Pferd am Zügel halten und es vor dem Herzog auf und abtraben lassen; Herr von Guermantes stand auf dem Trottoir, hochaufgerichtet, lang und mächtig, im hellen Mantel, die Zigarre im Munde, den Kopf erhoben und spähte durch sein Monokel bis zu dem Augenblick, in dem er auf den Sitz sprang, selbst kutschierte, um das Pferd auszuproben, und schließlich mit dem neuen Gespann abfuhr, um in den Champs-Elysées seine Mätresse zu treffen.
Zwei Paare pflegte Herr von Guermantes im Hof zu begrüßen, die mehr oder weniger zu seinen Kreisen gehörten, einen Vetter von ihm, der mit seiner Frau wie ein Arbeiterehepaar, das sich nicht um seine Kinder kümmern kann, ganz außer dem Hause lebte: sie ging in die »Schola«, Kontrapunkt und Fuge studieren, er in sein Atelier, Holzskulptur und gepreßte Lederarbeit zu machen, sodann Baron und Baronin von Norpois, beide immer schwarz gekleidet, sie wie eine Stuhlvermieterin, er wie ein Leichenträger; sie gingen einige Mal am Tage in die Kirche. Sie waren Neffe und Nichte des ehemaligen Botschafters, den wir kannten; einmal hatte mein Vater ihn an der Treppe getroffen und sich nicht denken können, wo er herkomme; eine so hervorragende Persönlichkeit, die mit den bedeutendsten Staatsmännern Europas in Beziehung stand und vermutlich wenig Wert auf eitle aristokratische Standesunterschiede legte, konnte doch wohl nicht mit diesen obskuren, klerikalen, engstirnigen Adligen umgehn. Sie wohnten erst seit kurzem im Hause; Jupien kam einmal in den Hof, dem Gatten der gerade Herrn von Guermantes begrüßen wollte, etwas zu sagen, und redete ihn, da er seinen Titel nicht genau kannte, »Herr Norpois« an.
»Herr Norpois, das ist ja glänzend! Nur Geduld! Bald wird dieser Mitmensch Sie Bürger Norpois anreden«, rief Herr von Guermantes dem Baron zu. Endlich konnte er seine üble Laune gegen Jupien austoben, der »Monsieur« zu ihm sagte und nicht »Monsieur le Duc«.
Als einmal Herr von Guermantes eine Auskunft brauchte, die mit dem Beruf meines Vaters zusammenhing, hatte er sich ihm selbst sehr liebenswürdig vorgestellt. Seitdem hatte er ihn oft um eine nachbarliche Gefälligkeit zu bitten, und sobald er ihn die Treppe herunterkommen sah – mein Vater war dann immer in Gedanken bei seiner Arbeit und vermied am liebsten jede Begegnung –, verließ der Herzog seine Stallknechte, kam über den Hof auf meinen Vater zu, rückte ihm mit der ererbten Dienstfertigkeit der ehemaligen Kammerdiener des Königs den Mantelkragen zurecht, faßte ihn an der Hand und behielt sie in seiner, er tätschelte sie ihm sogar, um mit der Schamlosigkeit einer Kurtisane ihm zu beweisen, er feilsche nicht mit der Berührung seiner kostbaren Haut, und ließ sein verdrossenes Opfer, das nur daran dachte, freizukommen, bis übers Hoftor hinaus nicht los. Eines Tages, als wir vorbeikamen, während er gerade mit seiner Frau ausfuhr, hatte er uns sehr tief gegrüßt, bei dieser Gelegenheit hatte er ihr wohl auch meinen Namen gesagt, aber ob sie sich dessen und meines Gesichtes noch erinnerte? Und dann war es auch eine recht klägliche Empfehlung, als einer ihrer Mieter bezeichnet zu werden! Wichtiger wäre es gewesen, die Herzogin bei Frau von Villeparisis zu treffen, die mich gerade durch meine Großmutter hatte auffordern lassen, sie zu besuchen; da sie wußte, daß ich die Absicht hatte, mich mit Literatur zu befassen, hatte sie hinzugefügt, ich würde bei ihr Schriftsteller treffen. Aber mein Vater fand, ich sei noch etwas zu jung, um in Gesellschaft zu gehn, und da ihm mein Gesundheitszustand immer Sorge machte, wollte er mir nicht noch unzweckmäßige Gelegenheiten zu neuen Ausgängen verschaffen.
Da einer der Lakaien von Frau von Guermantes oft mit Françoise plauderte, hörte ich die Namen einiger Salons, in denen sie verkehrte, aber vorstellen konnte ich sie mir nicht: sie waren ein Teil von ihrem Leben, jenem Leben, das ich nur durch ihren Namen hindurch sah; mußten sie mir daher nicht unfaßbar bleiben?
»Heut Abend werden bei der Prinzessin von Parma chinesische Schattenspiele aufgeführt«, sagte der Lakai, »aber wir gehn nicht hin, denn um fünf Uhr nimmt unsere gnädige Frau den Zug nach Chantilly, um zwei Tage bei dem Herzog von Aumale zu verbringen, nur die Zofe und der Kammerdiener kommen mit. Ich bleibe hier. Sie wird ärgerlich sein, die Prinzessin von Parma, mehr als viermal hat sie an die Frau Herzogin geschrieben.«
»Also dies Jahr gedenkt ihr nicht aufs Schloß Guermantes zu gehn?«
»Das erste Mal, daß wir nicht hingehn: wegen dem Herrn Herzog seinem Rheumatismus hat der Doktor verboten, daß man wieder hingeht, bevor die Heizung gelegt ist, aber vorher war man alle Jahre bis im Januar da. Ist die Heizung nicht fertig, dann wird die gnädige Frau einige Tage nach Cannes zu der Herzogin von Guise gehn, aber sicher ist es noch nicht.«
»Gehn Sie denn ins Theater?«
»Wir gehn manchmal in die Oper, manchmal auf die Abonnementsabende der Prinzessin von Parma, das ist alle acht Tage; was man da sieht, scheint sehr schick zu sein; es gibt Stücke, Opern, alles. Die Frau Herzogin hat kein Abonnement nehmen wollen, aber wir gehn abwechselnd in die Loge von der einen oder andern Freundin von Madame, oft in die Parterreloge der Fürstin Guermantes, das ist die Frau von unserm Herrn seinem Vetter. Und die Schwester vom Herzog von Bayern. – Und Sie, Sie gehn so einfach wieder nach Haus?« fragte der Lakai. Obwohl er sich mit den Guermantes gleichsetzte, hatte er doch von »Herrschaften« im allgemeinen eine diplomatische Vorstellung, die ihn veranlaßte, Françoise so achtungsvoll zu behandeln, als wäre sie bei einer Herzogin in Dienst. »Geht es Ihnen mit der Gesundheit gut, Madame?«
»Bis auf die verflixten Beine! Auf der Ebene, da geht es ja (auf der Ebene besagte: im Hof, auf der Straße, wo Françoise ganz gern spazieren ging, mit einem Wort: auf flachem Gelände) aber die verteufelten Treppen! Auf Wiedersehn, Herr Nachbar, vielleicht bekommt man Sie heut Abend noch zu sehn.«
Sie wollte gern noch weiter mit dem Lakaien plaudern, zumal er ihr mitgeteilt hatte, die Söhne der Herzöge hätten öfter den Fürsten-Titel und behielten ihn bis zum Tode des Vaters. Sicherlich wird der Kult des Adels, vermischt mit einem ihm feindlichen Geist der Empörung, dem er sich anpaßt, erblich aus der französischen Scholle geschöpft und muß im Volke sehr stark sein. Man konnte Françoise von dem Genie Napoleons oder von der drahtlosen Telegraphie sprechen, ohne ihre Aufmerksamkeit zu erregen, so etwas hörte sie, ohne auch nur einen Augenblick langsamer die Asche aus dem Kamin zu fegen oder den Tisch zu decken; wurden ihr aber solche Besonderheiten erzählt – und daß der jüngere Sohn des Herzogs von Guermantes im allgemeinen Fürst von Oléron hieß –, dann rief sie: »Das ist schön!« und blieb staunend wie vor einem Kirchenfenster stehn.
Von dem Kammerdiener des Fürsten von Agrigent, der sich mit ihr angefreundet hatte, da er häufig Briefe zur Herzogin brachte, erfuhr Françoise auch, man höre in der Gesellschaft viel von einer künftigen Ehe des Marquis von Saint-Loup mit Fräulein von Ambresac, es sei schon so gut wie entschieden.
Die Villa oder die Theaterloge, in die Frau von Guermantes ihr Leben umpflanzte, waren für mich nicht minder märchenhafte Stätten als ihre Wohnräume. Die Namen Guise, Parma, Guermantes-Bavière unterschieden die Badeorte, in die sie sich begab, von allen andern Badeorten, die täglichen Feste, welche die Spur ihres Wagens mit ihrem Hause verband, von allen andern Festen. Besagten sie mir, in diesen Badeorten, in diesen Festen bilde sich Stück um Stück das Leben der Frau von Guermantes, so gaben sie mir damit noch keine Aufklärung über sie. Diese Dinge gaben dem Leben der Herzogin immer neue Richtung, aber dadurch vertauschte es lediglich ein Geheimnis mit dem andern und von ihrem eigenen verflüchtigte sich damit nichts, es änderte nur seine Lage und blieb mitten im Strom des Lebens der andern durch eine Scheidewand geschützt, in ein Gefäß eingeschlossen. Die Herzogin konnte im Karneval am Ufer des Mittelmeers frühstücken, aber nur in der Villa der Frau von Guise, wo die Königin der Pariser Gesellschaft in ihrem weißen Piqué-Kleid mitten unter zahlreichen Fürstinnen nur ein Gast war wie alle andern, darum aber für mich nur noch bezaubernder, nur noch mehr sie selbst – wie eine Primadonna bei einem Solo nacheinander den Platz jeder ihrer Schwestern, der Tänzerinnen, einnimmt; sie konnte chinesische Schattenspiele ansehn, aber nur auf einer Abendgesellschaft bei der Prinzessin von Parma; sie konnte Trauerspiel oder Oper besuchen, aber nur in der Parterreloge der Fürstin Guermantes.
Wir lokalisieren im Körper eines Wesens alle Möglichkeiten seines Lebens, die Erinnerung an Menschen, die es gekannt hat, die es verläßt oder aufsucht. Hätte ich von Françoise erfahren, Frau von Guermantes werde zu Fuß zum Frühstück bei der Prinzessin Parma gehn und sah ich sie mittags in fleischfarbenem Atlas aus der Wohnung herunter kommen – das Gesicht überm Kleid in gleichem Farbton wie eine Wolke über der untergegangenen Sonne –, dann sah ich alle Freuden des Faubourg Saint-Germain vor mir in so kleinem Umfang vereint wie in einer Muschel und umfaßt von den schimmernden Schalen aus rosa Perlmutter.
+++
Mein Vater hatte im Ministerium einen Freund, einen gewissen A. J. Moreau. Um sich von den andern Moreaus zu unterscheiden, ließ er vor seinen Namen immer die beiden Anfangsbuchstaben setzen, und man nannte ihn kurz A. J. Dieser A. J. hatte, ich weiß nicht auf welche Weise, einen Parkettplatz zu einer Galavorstellung in der Oper bekommen; den schickte er meinem Vater, und da die Berma, die ich seit meiner Enttäuschung damals nicht wieder hatte spielen sehn, einen Akt aus Phèdre geben sollte, setzte meine Großmutter durch, daß mein Vater mir die Eintrittskarte gab.




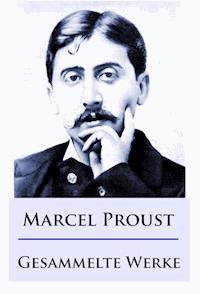

![In Search of Lost Time [volumes 1 to 7] - Marcel Proust - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/7bfeaa53b3db8b804e58de22616f49ec/w200_u90.jpg)