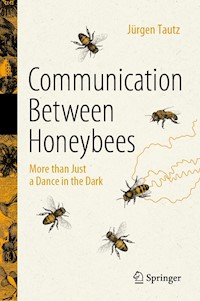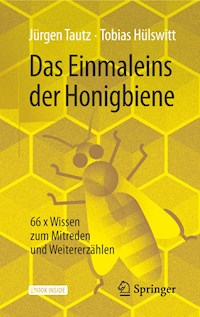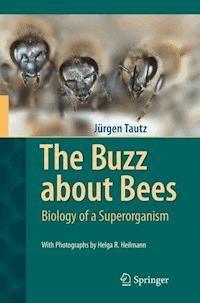9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Alles über unser Lieblingsinsekt
Wer Bienen beobachtet, schaut auf einzigartige Weise dem Leben beim Leben zu. Doch auch wenn es so aussieht, als herrsche bei den Bienen vor allem anarchische Krabbelei: Sie haben einen Plan, den sie mit erstaunlichem Geschick, faszinierenden Fähigkeiten und in bemerkenswerter Teamarbeit umsetzen. Wie dieses Leben in einem Bienenvolk funktioniert, davon erzählt dieses Buch. Es lädt ein zu einem Gang durch die Honigfabrik – eine Wunderwelt voll eigenwilliger Typen, cleverer Praktiken und verblüffender Regelwerke. Und es macht uns bewusst, dass der Mensch ohne die Bienen nicht überleben kann. Das Hardcover ist 2017 unter dem Titel »Die Honigfabrik« beim Gütersloher Verlagshaus erschienen.
Mit farbigem Bildteil.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Ähnliche
JÜRGEN TAUTZ, geboren 1949, ist ein international anerkannter Bienenexperte und eremitierter Professor am Biozentrum der Universität Würzburg. Er wurde für die populäre Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte vielfach ausgezeichnet.
DIEDRICH STEEN, geboren 1963, arbeitet als Programmleiter in einem Buchverlag. In seiner Familie werden seit mehr als 100 Jahren Bienen gehalten. Er selbst imkert seit 20 Jahren.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Jürgen Tautz und Diedrich Steen
DIE WUNDERWELTDER BIENEN
Ein Rundgang durch die Honigfabrik
Die deutsche Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Die Honigfabrik. Die Wunderwelt der Bienen – eine Betriebsbesichtigung« beim Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: Hafen Werbeagentur
Umschlagmotiv: Westend61 / GettyImages
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-25083-6V002
www.penguin-verlag.de
Gewidmet meinen Kindern Mona, Silke und Meikosowie meinen Enkeln Anton und Oskar(Jürgen Tautz)
Dirk Steen zum 80. Geburtstag(Diedrich Steen)
INHALT
EINLEITUNG
KAPITEL I
FENG SHUI IN DER FINSTERNIS –
DAS BETRIEBSGEBÄUDE UND DIE PRODUKTIONSMITTEL DES BIENENVOLKES
1. Vom Baum zur Beute
Beräuberte Höhlen
Erste imkerliche Betriebsweisen
Die Sache gewinnt Raum und bekommt einen Rahmen
Moderne Fabrikgebäude in der Honigproduktion
2. Nicht nur Lagerraum und Kinderstube – Netzwerktechnologie Wabe
Man nehme einen Verbundwerkstoff
Die Wabe als Kinderstube
Störungen im Haustelefon
KAPITEL II
SAISONARBEIT IM RHYTHMUS DER JAHRESZEITEN –
TEAMWORK IN DER HONIGFABRIK
1. Frauenpower im Bienenvolk – von dicken Mädchen, Geschwisterliebe und wütenden Amazonen
Winterbienen
Rudelkuscheln in der Kiste
Schluss mit Kuscheln und ran an den Speck
Hauswirtschaft und Kinderpflege
Climatronic in der Kinderstube
Bee-onik im Wachs und Wabenbau
In der Honigküche – die Honigmacherinnen
Hier kommt nicht jede rein – die Türsteherinnen
Spezialkräfte im Außendienst – die Spurbienen
Vielseitig, abgebrüht und kampferprobt – Sammlerinnen
Zu müde zum Angriff – vom Schlaf der Honigbienen
Toll, eine andere macht’s – Warum Bienen faul sein dürfen
2. Routenplaner im Blütenmeer: Der Bienentanz – mit altem Wissen neu gedacht
Mit welcher Genauigkeit sind die Tanzbewegungen messbar?
Immer der Nase nach!
Erst schickt man sie, dann zieht’s sie hin
Eine veränderte Sicht und die Folgen
3. Callboys für die Königin – die Drohnen
Halber Kerl statt ganzer Mann
Angriff der Spermabomber
Multikulti mit vaterlosen Gesellen
Epigenetik, oder: Warum Bienen sich ihre Schwestern backen
4. Monarchin mit beschränkter Macht – die Königin
Der Duft der Herrscherin
Wechsel in der Chefetage: Wie ein Bienenvolk die CEO auswechselt
5. Der Bien – Superorganismus mit Köpfchen
Wie Bienen die Welt erfahren – Klugheit mit dem siebten Sinn
Eine graubunte Welt in Zeitlupe – Wie Bienen sehen
Ein Kosmos aus Parfüm und Spannung – Wie Bienen riechen und was sie spüren
Lernen, planen, unterscheiden – Phänomene der Klugheit bei Bienen
Compañeras mit Tradition
KAPITEL III
HONIG IST NICHT ALLES, ABER OHNE HONIG IST ALLES NICHTS –
DIE PRODUKTPALETTE DER HONIGFABRIK
1. Gespritzt, geschwitzt und ausgespuckt – Was aus einer Biene so alles rauskommt
Schmerzhaft, aber gut gegen Rheuma – das Bienengift
Wunderpudding für die Königin – Gelee royale
Duftender Baustoff mit Leuchtkraft – Wachs
2. Abgeschabt und abgestaubt – Propolis, Pollen und Bienenbrot
Panzerband von Blütenknospen – das Propolis
Kraftnahrung aus dem Blütenmeer – der Pollen
3. Crème de la Crème – der Honig
Blütensaft und Läusepipi – Rohstoffe und wie Bienen an sie herankommen
Tanzen und arbeiten – Wie Bienen Nektar holen
Munkeln im Dunkeln – Wie Bienen sich zum Tanzen finden
Wie Imker bestimmen, was ins Glas kommt – Sortenhonige
Mit Geduld und Spucke – Wie aus Nektar Honig wird
Bienen unter Dampf – der Wassergehalt der Stockluft
Der Bienen Werk und Imkers Beitrag
Es geht rund – Honigschleudern
Es geht immer noch rund – die Honigbearbeitung
Wer nehmen will, muss geben können – Winterfütterung
KAPITEL IV
EINE TOCHTERFIRMA WIRD GEGRÜNDET –
DER SCHWARM
1. Es ist wie immer: Es sind die Triebe
2. Schwarmintelligenz – Wie Bienen umziehen
Späher werden ausgeschickt
Die Makler mühen sich
Pieplaute mit Sprengkraft
Jede muss alles können – die Plastizität des Bien
Kurz und bündig – Wie Imker die neue Wohnung organisieren
3. Zickenterror mit Todesfolge – Wie es am Stammsitz weitergeht
Es kann nur eine geben – Kampf um den Thron
Arm und obdachlos – die Nachschwärme
4. Der Imker als Spaßbremse
Wer arbeitet, kommt nicht auf dumme Gedanken – meistens nicht
Die Spaßbremse als Retter in der Not
Faule Eier im intakten Volk
Fummelei mit kleinsten Larven – Wie Königinnen gezüchtet werden
KAPITEL V
BETRIEBSSPIONAGE, RAUBÜBERFÄLLE UND ALIENS AUS ASIEN – BIENEN IM KAMPFMODUS
1. Unfreundliche Übernahmen – Wie Bienen sich beklauen
2. Die Biene und die Bestie
Ein Killer geht um die Welt
Vampire in der Bienenbrut – Was die Varroamilbe so gefährlich macht
Zusammen stark sein – Bienen und Menschen im Kampf gegen die Milbe
Was im Gefieder von Vögeln funktioniert, klappt auch im Bienenvolk
KAPITEL VI
TOD DER KÖNIGINNEN? –
BIENEN IM KAMPF UMS ÜBERLEBEN
1. Der Mythos vom großen Sterben der Honigbienen
Vom Nebenerwerb zum Hobby – Strukturwandel in der Imkerei in Deutschland
Bedrohtes Leben – Warum Bienen es dennoch schwer haben
2. Keine Entwarnung – Das große Sterben bleibt eine Möglichkeit
Industriell genutzte Bienenvölker – Bestäubungsimkerei in Amerika
Bienengesundheit – Der Mensch als Gefahr für den Superorganismus Bien
Honigbienen – die Raupenkiller der Zukunft?
3. Zurück in die Zukunft – alte Wege, neu entdeckt
Biene und Wald – Aus den Anfängen Neues lernen
Sehen die Bienen die Bäume vor lauter Wald nicht?
EPILOG:
BIENEN – EIN LEBENSGEFÜHL
Sind Bienen selbstlos? – Ein Gespräch
DANK
ANHANG
REGISTER
Bildteil
EINLEITUNG
Es könnte jetzt so schön sein. Abends nach der Arbeit noch ein paar Schritte hinters Haus, unter die Eichen, zu den Völkern. Den letzten Heimkehrerinnen zuschauen, wie sie taumelnd herabsinken und nektarschwer auf die Flugbretter plumpsen. Eine kurze Begrüßung durch eine Wächterin, dann hinein in den dunklen Stock, wo schon die Schwestern warten, um die kostbare Fracht aufzunehmen.
Und dann dieser Duft! Ende April blühen die Kirschbäume noch, Löwenzahn, Apfel, Pflaume, Birne – alles entfaltet jetzt seine Nektar versprechende Pracht oder steht kurz davor. Nach guten Flugtagen riecht es bei den Bienen wie an einer Zuckerwattebude auf dem Jahrmarkt. Das warme, süße, schwere Aroma eines nektarreichen Tages atmen, dazu das tieftönende Summen aus den Kästen hören. Alles ist gut.
Aber nichts ist gut, und ich mache mir Sorgen. Zuerst wollte der Winter einfach nicht zum Winter werden. Um Weihnachten herum noch zweistellige Tagestemperaturen, kein Nachtfrost. Die Königinnen hörten nicht auf, Eier zu legen. Die daraus schlüpfenden Larven mussten gefüttert werden. Die Zahl der Bienen in den Völkern blieb zwar hoch, aber der Futtervorrat für den Winter schmolz schnell. Wird er bis zur Weidenblüte im März reichen? Einige Imkerfreunde berichteten schon im Februar von verhungerten Völkern. Habe auch ich im Spätsommer zu wenig eingefüttert? Es gibt für Imkerinnen und Imker keinen beschämenderen Anblick als ein verhungertes Volk.
Anfang April dann endlich ein paar warme Tage. Die Futterlage verbessert sich, die Saalweide blüht, etwas Nektar kommt herein, die Königin legt jetzt bis zu 1.200 Eier täglich. Sie wird diese Zahl noch auf bis zu 2.000 Eier steigern. Jetzt muss das Wetter halten! Doch dann: Polare Kaltluft. Seit zehn Tagen schon. Werden die vielen Larven, die das Volk schon pflegt, durchkommen? Können die Ammenbienen sie ausreichend füttern und das Brutnest wärmen? Es friert nachts wieder! Wird der Futtervorrat reichen?
Am 1. Mai endlich die Wende. Das Hochdruckgebiet kommt, der Wetterwechsel ist angekündigt. Es ist Sonntagmorgen 10.00 Uhr, blauer Himmel, das Thermometer zeigt 12 Grad: In zwei Stunden werden es 15 Grad sein. Dann wird es für die Nektarsammlerinnen kein Halten mehr geben. Es kann losgehen!
So in etwa, liebe Leserinnen und Leser, haben im Frühjahr 2016 Imkerinnen und Imker an vielen Orten in Deutschland gedacht und gefühlt. Ja – gefühlt, denn der Umgang mit Bienen ist eine leidenschaftliche, eine emotionale Angelegenheit. Und das nicht nur in der aktuellen Wahrnehmung in den Medien, wenn es um Berichte vom Bienensterben und dem darauf unmittelbar bevorstehenden Untergang der Menschheit geht. Wer anfängt, Bienen zu halten und auch nach drei Jahren, wenn alle Anfängerdramen durchlebt sind, noch Bienenvölker hat, der hat keine Bienen mehr, sondern umgekehrt: Den haben die Bienen! Es gibt Imker, die mit über 100 Jahren noch Völker führen (DBJ 1/2017) – notfalls mit geländegängigem Rollator und dem auch schon etwas in die Jahre gekommenen Sohn als Sklaven zum Heben für die schweren Kästen.
Bienen zu halten ist so faszinierend, weil Bienen selbst die, die schon Jahrzehnte mit ihnen umgehen, immer noch zu überraschen wissen. »Das haben sie noch nie gemacht!« ist ein viel gehörter Ausdruck des Erstaunens, wenn Imker von ihren Erfahrungen berichten. Jedes Bienenvolk hat seinen eigenen Charakter, jedes Bienenjahr seinen eigenen Verlauf. Mit Bienen wird es nie langweilig! Der komplexe Organismus eines Bienenvolkes ist wie ein Buch, das man in jedem Jahr neu lesen kann und das bei jedem Lesen immer wieder andere, spannende Geschichten erzählt.
Wir möchten Sie mitnehmen in die Welt dieser Geschichten. Wir, das sind Diedrich Steen und Jürgen Tautz. Der eine, Verlagslektor und seit 20 Jahren Imker, der andere Doktor der Biologie, seit 27 Jahren Professor an der Universität Würzburg und einer der international renommiertesten Bienenforscher. Der eine wird Ihnen die Dinge erzählen, die er immer erzählt, wenn er auf Fragen antwortet wie: »Sag mal, ich hab’ gehört, du hast Bienen. Wie ist das eigentlich mit ….?« Der andere wird dafür sorgen, dass das Erzählte auch stimmt. Vor allem aber wird er das Praxiswissen des Imkers auf den spannenden Hintergrund von Wissenschaft und Forschung stellen. Diese Abschnitte erkennen Sie am Mikroskop vor den Überschriften und an der Punktierung am Seitenrand.
Gemeinsam laden wir Sie zu einer »Betriebsbesichtigung« ein, zu einem Gang durch die Honigfabrik. Wir werden die Fabrikhalle und die Produktionsmittel, das Personal, die Chefetage und die Produkte kennenlernen. Wir werden erfahren, wer wie mit wem zusammenarbeitet (oder auch nicht), wir werden von Faulpelzen und Schnorrern, aber auch von eifrigen Spezialisten hören und eintauchen in eine Welt voller verblüffender Regelwerke. Denn auch wenn es beim Blick in ein Bienenvolk so aussieht, als bestünde das Leben darin vor allem in einer anarchischen Krabbelei – Bienen wissen, was sie tun. Sie haben einen Plan, den sie mit erstaunlichem Geschick, faszinierenden Fähigkeiten und in beeindruckender Teamarbeit umsetzen.
Wir wählen das Bild der Honigfabrik, weil Bienenvölker aus der Perspektive des Imkers und der Imkerin genau das sind. Betriebe mit bis zu 50.000 Mitarbeiterinnen in der Honigproduktion und ein paar wenigen männlichen Saisonkräften. Bienen sehen das sicher etwas anders. Würde man eine fragen, ob sie in einer Honigfabrik tätig sei, würde sie vermutlich verständnislos mit den Fühlern wackeln. Honig zu produzieren ist für Bienen nicht Sinn und Ziel ihres Daseins. Sie wollen das Überleben und die Vermehrung ihres Volkes sichern. Honig ist dafür nur das Mittel, der Energielieferant und der Treibstoff. Erst Imker und Imkerinnen machen den Honig zum Zweck eines Bienenvolkes und Bienen damit zu Mitarbeiterinnen einer Honigfabrik.
Ist das unfair? Ein verwerflicher Eingriff in die natürlichen Abläufe eines Lebewesens, dem gegenwärtig so viel Sympathie zuteil wird? Es gibt Menschen, die das so sehen. Aber auch für Bienen gilt das, was für die meisten Tiere gilt, die sich in der Obhut des Menschen befinden: Wir haben sie zu Nutztieren gemacht. Bienen lassen sich nutzen, lassen sie sich aber auch benutzen? Oder sind es nicht vielmehr der Imker und die Imkerin, die sich den Bienen anpassen und deren Bedürfnisse sehr gut kennen müssen, wenn die Honigfabrik Erfolg haben soll? Wir werden sehen …
Ein paar Worte noch zur Absicht und zum Aufbau des Folgenden. Dieses Buch will erzählen, wie es in einem Bienenvolk so zugeht, und einen Eindruck vom spannenden Gesamtzusammenhang eines Bienenvolkes vermitteln. Es ist darum keine Imkerschule, mit der man die Bienenhaltung erlernen kann. Natürlich hoffen wir, dass Anfänger und Anfängerinnen und vielleicht sogar mancher schon erfahrene Imker hier Anregendes und Unterstützendes für die Ausübung ihres Hobbys finden. Vor allem aber soll dieses Buch all denen ein Verständnis von Bienen vermitteln, die sich für diese wunderbaren Insekten interessieren, auch weil ihnen deren Produkt, der Honig, so gut schmeckt.
Damit sich dieses Verständnis einstellt, sollten die Kapitel dieses Buches tatsächlich der Reihe nach gelesen werden, denn sie bauen aufeinander auf. So ist das Kapitel über das Schwärmen der Bienen spannender, wenn man vorher schon erfahren hat, wozu die Waben dienen und wie Bienen miteinander sprechen. Wer trotzdem hin und her springen möchte, findet am Ende ein Register, das erschließt, wo Informationen zu einzelnen Begriffen oder Sachverhalten zu finden sind. Der Hinweis »Bild« weist zusammen mit einer Nummer auf eine Abbildung im Bildteil dieses Buches hin, den Sie am Ende dieses Buches finden. Hier wird manches, von dem im Folgenden erzählt wird, etwas anschaulicher.
Und nun: Herzlich willkommen in der Honigfabrik und in der Wunderwelt der Bienen!
KAPITEL I
FENG SHUIINDER FINSTERNIS –
DAS BETRIEBSGEBÄUDE UND DIE PRODUKTIONSMITTEL DES BIENENVOLKES
1.Vom Baum zur Beute
Beräuberte Höhlen
Bienen wohnen in Höhlen, jedenfalls dann, wenn sie einer europäischen Rasse angehören. Wir Menschen mussten im Verlauf der Evolution erst raus aus den Höhlen, um als Homo sapiens, als angeblich kluge Menschenartige also, mehr oder weniger gut funktionierende Gemeinwesen zu bilden. Bienen ist das in ihren Höhlen in Felswänden, unter Steinen oder in hohlen Bäumen bereits gelungen, lange bevor der aufrechte Gang erfunden war. Eine Biene, die schon vor 45 Millionen Jahren von Blüte zu Blüte geflogen ist, hat man in einer Versteinerung aus dem Eozän gefunden. Man geht davon aus, dass Urformen der heute bekannten Bienen bereits den Dinosauriern nachgesetzt haben, wenn diese auf ihren Behausungen herumtrampelten.
Als vor etwa 1,7 Millionen Jahren dann die ersten Lebewesen der Gattung Homo in der Weltgeschichte auftraten, werden diese ziemlich schnell verstanden haben, dass die Bienen in ihren Höhlen einen köstlichen Schatz hüteten. Ein so kalorienreiches, vor allem aber ein so süßes Lebensmittel wie den Honig gab es in der Welt der Menschen damals nirgendwo sonst.
Wie man rankommt, hat man sich vielleicht von den Bären abgeguckt: Höhle aufreißen, Waben rausholen und nichts wie weg, bevor man vollkommen zerstochen ist. Denn auch die Bienen damals waren stachelbewehrt und verteidigten ihr Zuhause! Aber wer Honig will, der muss auch etwas aushalten können – und bereit sein, Risiken einzugehen. Es gibt eine steinzeitliche Zeichnung in den sogenannten »Spinnenhöhlen« bei der Gemeinde Bicorp in Spanien, die offenbar zeigt, wie eine Honigsammlerin sich an einer Art Strickleiter abseilt, um an den kostbaren Schatz eines Bienenvolkes zu kommen. Wie das ausgesehen haben könnte, kann man noch heute z.B. im Biosphärenreservat Nilgiris in Südindien beobachten. Die asiatischen Bienen bauen hier, anders als die europäischen, pro Volk eine einzelne frei hängende Wabe unter einem Felsvorsprung. Die Kattunayakan, ein dort lebendes indigenes Volk, ernten Honig, indem sich die Honigsammler an Bambusseilen abseilen und die Waben mit hakenbewehrten Stöcken abbrechen (Tourneret 2017, Routes, 57ff.).
Das ist nicht nur ziemlich halsbrecherisch, eine solche Art der Honigernte zerstört den Wabenbau eines Volkes und damit in der Regel auch das Volk selbst. Zumindest in den Gegenden der Welt, in denen es winterliche Vegetationspausen gibt. Denn Bienen benötigen den Honig hier auch als Nahrungsvorrat für den Winter. Honig ist die Energiereserve, die den Bienen die Möglichkeit verschafft, die Wärme zu erzeugen, die sie in der kalten Jahreszeit am Leben erhält. Wenn unsere steinzeitlichen Vorfahren den Völkern ihren Honig raubten, dürfte es darum in den meisten Fällen um das Volk geschehen gewesen sein. Ein ausgeplündertes Volk mit weitgehend zerstörtem Wabenbau konnte nicht überleben.
Erste imkerliche Betriebsweisen
Es hat darum nicht allzu lange gedauert, bis Menschen begriffen: Wer regelmäßig Honig essen will, der darf nicht nur stehlen, der muss auch etwas anbieten. Eine Höhle nämlich. So fing man an, aus Ton, Baumrinden oder aus mit Lehm bestrichenem Strohgeflecht im Wortsinne handliche Höhlen zu bauen, in die Bienenschwärme einziehen konnten. Das war noch keine Imkerei, wie sie heute betrieben wird, aber doch schon eine imkerliche »Betriebsweise«. Menschen suchten nicht mehr einfach Bienenwohnungen und stahlen den Bienen den Honig. Sie lockten die Bienen jetzt an bestimmte Orte, indem sie z.B. Tonröhren in Bäume dicht beieinander hängten. Bienenschwärme auf der Suche nach neuem Wohnraum fanden die leeren Tonröhren und zogen ein. Schon hatte der Imker ein neues Volk. Bezogen genug Schwärme die aufgehängten Röhren, konnte er bei einzelnen Völkern sogar darauf verzichten, den Honig zu ernten, und sie überwintern lassen. Im folgenden Jahr würden diese Bienen früh schwärmen und so dazu beitragen, dass die Zahl seiner Völker schnell wieder wuchs. Im Spätsommer konnte der Imker dann wieder von einem Teil der Bienenvölker den Honig ernten, den anderen Teil überwinterte er. Und im folgenden Jahr begann der Zyklus von neuem.
Eine imkerliche Betriebsweise, die diesem beschriebenen Ablauf folgt, ist die Korbimkerei. Sie war in Europa seit dem Mittelalter noch bis Ende des 19. Jahrhunderts weit verbreitet. Korbimker hatten es dabei nicht nur auf den Honig, sondern auch auf das Wachs der Bienen abgesehen. Dieses war zur Herstellung von Kerzen vor allem in Kirchen und Klöstern heiß begehrt. Heute wird die Korbimkerei noch in der Lüneburger Heide betrieben – allerdings von sehr wenigen Imkern und Imkerinnen. Die Korbimker starten im Frühjahr mit wenigen Völkern. Diese wachsen ab Februar allerdings sehr schnell, d.h. die Zahl der Bienen in den Körben nimmt zu. Bald wird es darin eng und der Schwarmtrieb der Bienen erwacht. Verlässt ein Schwarm den Korb, dann fängt der Imker ihn und quartiert die eingefangenen Bienen in einem leeren Korb ein, den der Schwarm in der Regel gerne annimmt. Schon hat der Imker ein neues Volk. So geht das von Ende April bis etwa Mitte Juli einige Male. Im Spätsommer, wenn die Heide blüht, hat der Heideimker ein Vielfaches an Völkern im Vergleich zum Frühjahr. Mit denen werden nun die Bienenzäune, überdachte »Regale«, die in den Heideflächen stehen, bestückt. Hier sammeln die Bienen den Heidehonig. Wenn die Heide abgeblüht ist, kann dieser geerntet werden.
Diese Ernte war in der Vergangenheit für die meisten Bienen recht oft eine todbringende Angelegenheit. Der Imker hob eine kleine Grube aus und verbrannte darin einen schwefelgetränkten Papierstreifen. Über die Grube und den aufsteigenden Schwefeldampf wurde der Bienenkorb gestellt. In kurzer Zeit waren die Bienen erstickt und die Honigwaben konnten herausgebrochen werden. Allerdings: Die Imker stellten den honigvollen und bienenbesetzten Korb in der Regel zuerst auf einen umgedrehten leeren und stießen diese Konstruktion hart auf den Boden. Die meisten Bienen fielen nun in den leeren Korb. Mit solchen wabenlosen Bienen konnten dann die Bienenvölker, die überwintern sollten, verstärkt werden, während die, die nicht von den Waben gefallen waren, abgeschwefelt wurden.
In jedem Fall wird auch bei dieser Art und Weise, mit Bienen umzugehen, der Wabenbau eines Volkes zerstört und das Volk selbst aufgelöst. Solange man auch das Wachs der Bienen ernten wollte, war das zumindest aus der Sicht der Imker kein Problem. Aber ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Rohmaterial für Kerzen als Handelsgut immer uninteressanter. Als es Anfang des 19. Jahrhunderts dem französischen Chemiker Eugène Chevreul gelang, Fettsäuren aus tierischen Fetten zu gewinnen, war bald das Stearin erfunden, der Stoff, aus dem die meisten Kerzen noch heute gemacht werden. Dann kam die Entwicklung des Paraffins hinzu und Ende des 19. Jahrhunderts erhellten schließlich Elektrizität und Glühbirnen die ersten Häuser. Gleichzeitig verlor auch der Honig als Wirtschaftsgut im 19. Jahrhundert immer mehr an Bedeutung. 1801 hatte Franz Carl Achard im schlesischen Cunern die erste Fabrik der Welt gegründet, die aus Rüben Zucker gewann. Wer Speisen süßen wollte, hatte bis dahin nur importierten und darum teuren Rohrzucker oder den mengenmäßig knappen und darum teuren Honig verwenden können. Bald schon konnte man nun auf den wesentlich billigeren raffinierten Zucker aus der Zuckerrübe zugreifen. War »Süße« bisher ein Luxus gewesen, den es nur in begüterten Haushalten – oder eben bei Imkern – regelmäßig gab, so wurde sie nun zu einem allgemein zugänglichen Konsumgut.
Imker mussten sich dieser neuen Situation anpassen. Wollten sie das Wachs aus den Völkern nicht wegwerfen, dann mussten sie eine Möglichkeit finden, den Honig zu ernten, ohne den Wabenbau eines Volkes zu zerstören. Und wer den Preisverfall des Honigs ausgleichen wollte, brauchte größere Honigernten, um mehr verkaufen zu können.
Es würde hier zu weit führen, die Entwicklung, die nun in Gang kam, nachzuzeichnen, zumal sie aus heutiger Sicht auch etwas chaotisch verlief. Denn das 19. Jahrhundert war auch das Jahrhundert, in dem die wissenschaftliche Naturbeobachtung ihren Siegeszug antrat. Die systematische Beobachtung der Abläufe in einem Bienenvolk war ein Teil der Bewegung. Es entstanden zahlreiche Vereine und Vereinigungen, die sich mit der wissenschaftlichen Erforschung der Bienen und der Verbesserung der imkerlichen Praxis beschäftigten. Vieles, was damals als wissenschaftlich bewiesen behauptet wurde, erwies sich später zwar als Humbug. Und manche Erfindung, die die imkerliche Praxis revolutionieren sollte, verschwand schnell in der Mottenkiste. Zwei Neuentwicklungen aber setzten sich durch und mündeten in die moderne Imkerei, wie wir sie heute kennen: Sie führten zur Bienenhaltung in Bienenkästen mit beweglichen Rähmchen, von Imkern »Beuten« genannt (vgl. Bild 1).
Die Sache gewinnt Raum und bekommt einen Rahmen
Schon Korbimker hatten beobachtet, dass Bienen Hilfen und Führung annehmen, wenn sie ihre Waben bauen. Steckte man Holzstäbe so durch die Wände eines Bienenkorbes, dass sie an einer Seite hinein und an der anderen wieder heraustraten, sodass im Hohlraum des Korbes so etwas wie Balken entstanden, dann hängten die Bienen die Waben daran auf. Sie begannen den Wabenbau an den Stäbchen und zogen die Wabe von dort nach unten weiter. Hatte der Imker seine Stäbchen schön parallel oben im Korb angebracht, dann bauten die Bienen die Waben parallel nach unten, ohne Kurven und Wachsbrücken zwischen den einzelnen Waben und mit geraden sogenannten »Wabengassen« dazwischen. Aus Körben mit einem solchen Wabenbau konnte man dann sogar einzelne volle Honigwaben brechen, ohne die anderen Waben zu ruinieren.
Zudem hatten findige Korbimker begonnen, rechteckige, stapelbare Bienenkörbe zu entwickeln. Bienenwohnungen konnten nun Etagen bekommen. Jede Etage war mit Hilfe eines Brettes von der anderen getrennt. In jedem Brett befand sich aber ein Loch, durch das die Bienen hindurchschlüpfen und zwischen den Räumen wechseln konnten. Nur ganz unten gab es ein Flugloch, durch das die Bienen nach draußen und wieder in den Stock kamen.
Nun gebrauchen Bienen die Wabe vor allem für zwei Dinge: In die Zellen der Wabe legt die Königin Eier, aus denen die jungen Bienen werden. Und zweitens lagern in den Zellen die Nahrungsvorräte – Honig und Blütenpollen. Wir werden später noch mehr darüber hören. Der Inhalt einer Wabe wird von Bienen zunächst in folgender Weise »organisiert«: In der Mitte befindet sich eine Fläche, in der die Zellen Brut beherbergen. Darüber gibt es einen schmalen »Pollenkranz«, wie Imker sagen, Zellen also, in denen Pollen untergebracht ist. Darüber wiederum befindet sich ein »Honigkranz«, Zellen mit Honig. Auf diese Weise haben die Bienen die Nahrung da, wo sie am meisten gebraucht wird: bei der Brut, die gefüttert werden muss (vgl. Bild 2). Wenn nun im Laufe der Zeit immer mehr Honig eingetragen wird, wandert das Brutnest – also die Brutflächen auf den nebeneinander hängenden Waben – nach und nach weiter nach unten, während darüber der Honigkranz immer breiter wird. Für unsere Imker mit den Etagenkörben bedeutete das: Entwickelte sich ein Volk gut, dann konnte man mit einem Raum anfangen und, während das Brutnest nach unten wanderte, den Kasten mit einem neuen Raum nach unten erweitern. Irgendwann war so viel Honig eingetragen, dass die Waben des oberen Raumes nur noch Honig enthielten. Dieser Honigraum wurde jetzt abgenommen, ohne dass der Imker das ganze Volk in Panik versetzen musste.
Es dauerte nicht lange, bis Stäbchentechnik und Etagenbauweise kreativ zusammengeführt wurden. Man baute flache Holzkästen, auf die oben ein Stäbchenrost gelegt wurde. Diese Kästen konnten gestapelt werden. Ganz unten bekamen sie ein Bodenbrett mit Flugloch. Immer, wenn der obere Kasten mit Honig gefüllt war, konnte der Honig geerntet werden. Der leere Kasten wurde dem Volk zurückgegeben, indem man ihn einfach als ersten auf das Bodenbrett stellte.
Entstanden war so ein hölzerner Bienenkasten mit mehreren Räumen, oder im imkerlichen Fachjargon: eine »Mehrraumbeute« mit geführtem Wabenbau. In diesen konnte schonender geimkert werden als in einem einzelnen Korb, weil man zur Honigernte nicht mehr das ganze Volk stören musste. Ein Problem blieb jedoch: Auch hier mussten die Waben von den Holzstäbchen und von den Wänden der Kästen geschnitten werden, wenn man den Honig ernten wollte.
Die Lösung für dieses Problem fanden dann Mitte des 19. Jahrhunderts der schlesische Pfarrer Johann Dzierzon und der aus Thüringen stammende Baron August von Berlepsch. Dzierzon legte keinen Rost auf seine Mehrraumbeuten, sondern lose Holzstäbchen. Jetzt konnte er die Waben von den Wänden schneiden, sie so lösen und an den Stäbchen hängend einzeln entnehmen. Berlepsch wollte die Schneiderei ganz vermeiden. Er ergänzte die Holzstäbchen um zwei Seiten- und eine Bodenleiste. Jetzt konnte er einen Holzrahmen in seine Kästen hängen, in den hinein die Bienen die Waben bauten, den sie aber – meistens – nicht mit der Seitenwand des Kastens verbanden. Erfunden waren das »Rähmchen« und damit die bewegliche Wabe!
Moderne Fabrikgebäude in der Honigproduktion
Bienenwohnungen mit mehreren Räumen und beweglichen Rähmchen, in die hinein die Bienen die Waben bauen – mit diesen beiden Erfindungen waren die Grundsteine auf dem Weg zur Imkerei, wie sie heute betrieben wird, gelegt. Jetzt ging es darum, das Gefundene zu verbessern. Wie groß durften oder mussten die Bienenwohnungen sein, damit sich ein Volk darin optimal entwickelte? Welche Fläche musste ein Rähmchen idealerweise haben? Wie sollten Bienenkasten und Rähmchen bemessen und konstruiert sein, damit sie für die Bienen ein geeigneter Lebensraum waren und zugleich leicht und wirtschaftlich beimkert werden konnten?
Ein wildes Experimentieren begann, das im Grunde bis in die Gegenwart kein Ende gefunden hat, stets aber begleitet war von nicht selten wüsten Beschimpfungen gegen alle, die es nicht so machten wie man selbst. Gegenwärtig gibt es weltweit etwa 80 verschiedene Rähmchenmaße. Und zu jedem dieser Rähmchenmaße gibt es nicht nur ein passendes Beutensystem, sondern auch Imker und Imkerinnen, die »ihren« Beutentyp und die damit einhergehende Betriebsweise für die allein seligmachende Art des Imkerns halten. Des Streitens ist also bis heute kein Ende.
International durchgesetzt hat sich aufs Ganze gesehen das Imkern in sogenannten »Magazinen«. Ein Magazin besteht aus einem Bodenbrett mit Flugloch. Darauf stellt man eine sogenannte »Zarge« und obendrauf kommt ein Deckel. Eine Zarge ist eine Kiste, die oben und unten offen ist und in die hinein die Rähmchen gehängt werden können. Magazine werden meistens entweder aus Holz oder aus Kunststoff gefertigt. Zwei Rähmchenmaße haben sich hierzulande durchgesetzt. Das sogenannte »Deutsch-Normalmaß« mit 37,0 x 23,3 cm Kantenlänge und das »Zandermaß« mit einer Kantenlänge von 42,0 x 22,0 cm. Wer mit dem erstgenannten Maß imkert, hat gewöhnlich elf Rähmchen in einer Zarge, wer mit Zander arbeitet, in der Regel neun. Im Deutsch-Normalmaß haben die Bienen je Zarge also etwas mehr Fläche zur Verfügung, dafür müssen Imker und Imkerinnen aber auch mehr Rähmchen handhaben.
Mit Zargen lassen sich nun die Honigfabriken bauen, um die es hier geht. Das Pfiffige an der Magazinimkerei ist nämlich, dass sich die Bienenwohnungen leicht vergrößern lassen. Hat ein Volk z.B. in einer Zarge überwintert, dann kann im Frühjahr, wenn das Volk größer wird, einfach eine weitere Zarge mit Rähmchen aufgestellt werden. Wenn dann die Blüte einsetzt und die Bienen Honig eintragen, kommt noch eine Zarge obendrauf, und wenn es ganz gut läuft und der Imker groß genug ist, einfach noch eine. In vier Zargen können im Juni dann schon bis zu 40.000 Bienen ihrer Tätigkeit nachgehen.
Obwohl aber die Völker riesig sind und die Wabenflächen enorm, bleibt dem Imker nichts verborgen. Denn der zweite Kniff des Imkerns in Magazinen ist, dass man die Zargen ja auch wieder abnehmen kann. So können Imkerinnen und Imker zu jeder Zeit jedes Rähmchen eines Volkes anschauen: Deckel ab, und die Rähmchen der obersten Zarge sind erreichbar, oberste Zarge ab, und die Rähmchen der nächsten Zarge können gezogen werden usw.
So haben also das Interesse und die Findigkeit der Menschen die Honighöhle in der Felswand zur Honigfabrik im Magazin entwickelt. Stand am Anfang der Beziehung zwischen Bienen und Menschen das zerstörerische Plündern eines Bienenvolkes, so ermöglicht die Magazinimkerei seine dauerhafte Pflege – und Nutzung. Möglich wurde dies, weil es gelungen ist, das wichtigste Betriebsmittel der Honigfabrik für den Imker zugänglich zu machen, ohne es zu zerstören: die Wabe.
2.Nicht nur Lagerraum und Kinderstube – Netzwerktechnologie Wabe
Bienen bauen ihr Betriebsmittel mit echter Schweißarbeit. Ab einem Alter von etwa zehn Tagen ist eine junge Arbeitsbiene in der Lage, aus acht Drüsenfeldern auf der Bauchseite des Hinterleibs kleine Wachsplättchen auszuscheiden. Wird die Biene älter, bilden sich die Wachsdrüsen zurück und die Biene wendet sich anderen Aufgaben im Stock zu. Allerdings: Auch zurückgebildete Wachsdrüsen können wieder reaktiviert werden. Im Schwarm z.B., wenn es darum geht, einen ganz neuen Wabenbau zu errichten, können auch ältere Bienen sich wieder den Bautrupps anschließen. Davon wird später noch ausführlicher die Rede sein.
Das Rohmaterial der Wabe, die kleinen ausgeschiedenen Plättchen, besteht aus mehr als 300 chemischen Einzelsubstanzen. Bei fast allen handelt es sich dabei um sogenannte Kohlenwasserstoffverbindungen [Hepburn 1986, Fröhlich et al. 2000)]. Einige dieser Moleküle sind klein und leicht flüchtig. Sie sorgen dafür, dass Wachs so angenehm riecht. Der überwiegende Teil der Wachsmoleküle besteht aber aus längeren Kohlenwasserstoffketten. Manche davon können bis zu 54 Kohlenstoffatome enthalten! Diese lang gestreckten großen Moleküle bedingen in ihrer räumlichen Anordnung und Vernetzung im Wesentlichen die physikalischen Eigenschaften des Wachses. Sind die Moleküle parallel angeordnet, liegt das Wachs nahezu kristallin vor und besitzt dabei einen energetisch günstigen Zustand.
Das von den Bienen ausgeschwitzte Wachs ist zunächst aber »amorph«, d.h., dass die Moleküle ungeordnet durcheinanderliegen. Solches Wachs ist schwer verbaubar und darum müssen die Bienen es bearbeiten. Das machen sie, indem sie dem Wachs Enzyme beigeben, es kneten und erwärmen. Bienen nehmen ihren schwitzenden Kolleginnen die Wachsplättchen also mit den Mundwerkzeugen ab, kauen die Plättchen einmal richtig durch und fügen Enzyme hinzu, die die langen Molekülketten spalten. Dadurch wird das Material geschmeidiger. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass es auf den Bauplätzen zwischen 30 und 40 Grad warm ist. Denn auch Wärme macht Wachs weicher und leichter bearbeitbar. Allerdings: Gerade darin liegt für die Bienen auch ein Problem.
Man nehme einen Verbundwerkstoff
Wachs ist ein sehr »lebendiger« Baustoff. Es altert nicht nur, indem flüchtige Bestandteile verschwinden. Es verändert seine Konsistenz auch aufgrund von Temperaturschwankungen: Bei Kälte wird es spröde und brüchig und bei zu großer Wärme flüssig. Gerade zu weiche Waben aber können eine für das Bienenvolk zentrale Funktion nicht mehr erfüllen: Sie sind nicht mehr in der Lage, als Vorratsspeicher zu dienen, weil sie das Honiggewicht nicht mehr tragen können. Bienen haben darum einen Trick entwickelt, wie sie die mechanische Belastbarkeit der Wabe erhöhen können: Sie machen aus Wachs und Propolis eine Art »Bienen-Spannbeton«. Propolis, das sogenannte »Kittkarz«, von dem im dritten Kapitel noch ausführlicher die Rede sein wird, ist ein von Bienen aus Baumharzen gebildetes Material. Sie bringen diesen Fremdstoff mit dem Wachs zusammen und erhalten so einen echten Verbundwerkstoff. Die Menge des eingesetzten Propolis und dessen genaue Verteilung im Wachs werden dabei von den Bienen an die jeweiligen Notwendigkeiten angepasst. In heißem Klima wird mehr Propolis verbaut als in kühleren Klimaten.
Bienen verstärken dabei einerseits die oberen Ränder der Wabenzellen mit einer dünnen Auflage aus Propolis. Auf diese Weise bilden die Zellränder ein stabilisierendes, in sich zusammenhängendes Netz. Wie massiv die Behandlung durch die Bienen die Eigenschaften dieser Stege beeinflusst, kann man zeigen, indem man die Biegefestigkeit von Stegen, die die Bienen errichtet haben, vergleicht mit der von Stegen, die aus geschmolzenem Stegmaterial in entsprechenden Gießformen hergestellt wurden. Die bienengebauten Stege sind deutlich starrer als die von Forschern aus dem gleichen Material erstellten »nachgemachten«. Es kommt für die Stabilität dieser Stege also offenbar nicht nur auf das Material an, sondern auch auf die Art und Weise, wie es verbaut wird. Bienen geben ihm eine innere Struktur, die wir im Experiment nicht nachbauen können. Sie haben da einen Trick, den wir noch nicht kennen.
Sehr wohl bekannt ist uns aber ein zweiter Trick, mit dem Bienen ihrem Wabenwerk Stabilität geben. Propolis wird nicht nur auf die Zellränder aufgebracht, es wird auch in die Wände der Zellen eingelagert, und zwar nach einem Muster, das wir Menschen als Ingenieurkniff bei der Herstellung von Spannbeton anwenden. Die Gefahr, infolge starker Temperaturschwankungen zu reißen, wird bei Spannbeton dadurch deutlich reduziert, dass man in den noch flüssigen Beton kurze Stücke Stahldraht einrührt, die dann ungeordnet im Beton liegen und diesem Stabilität gegen Dehnungsrisse verleihen. Exakt so gehen die Bienen vor. Das Wachs entspricht dem Beton und den Stahldrahtstücken entsprechen winzige Propoliswürstchen. Die räumliche Verteilung dieser Mini-Würstchen in den hauchdünnen Wachswänden der Wabenzellen lässt sich mit der aufwändigen sogenannten Raman-Spektroskopie zeigen (Strehle u.a. 2003). Hierbei wird auch sichtbar, dass sich Wachs und Propolis nicht vermischen, sondern als Substanzen getrennt bleiben.
Durch die Verwendung von Propolis und Wachs als Verbundwerkstoff erreicht die Bienenwabe eine mechanische Belastbarkeit, die etwa der eines Joghurtbechers entspricht: In 30 Gramm zur Wabe verbautem Wachs finden 2 Kilogramm Honig einen sicheren Lagerplatz.
Die Wabe als Kinderstube
Und nicht nur der Honig ist in den Waben gut aufgehoben. In den Zellen wächst der Nachwuchs heran. Die Wabe ist die Kinderstube eines Bienenvolkes. Die Königin setzt auf den Boden einer Zelle ein Ei ab. Sie »bestiftet« die Zelle, wie Imker sagen, denn ein Bienenei sieht aus wie ein klitzekleiner Stift (vgl. Bild 3). Gepflegt und von Ammenbienen mit Futter vorsorgt wird nach drei Tagen aus diesem Ei eine Larve, die nach weiteren sechs Tagen von den brutpflegenden Bienen unter einem Wachsdeckel eingeschlossen wird und sich verpuppt. 21 Tage nach der Eiablage schlüpft aus der Zelle eine Arbeiterin. Allerdings gibt es auf der Wabe nicht nur Zellen für Arbeiterinnenbrut, sondern auch solche für Drohnen, für die männlichen Bienen, von denen noch ausführlich die Rede sein wird. Drohnen sind etwas größer als Arbeiterinnen und darum ist auch der Durchmesser der Zellen, in denen sie heranwachsen, größer als der der Arbeiterinnenzellen. Es gibt darum auf Bienenwaben, wenn man die Bienen frei bauen lässt, immer zwei Zellenarten: sehr viele kleinere Zellen für Arbeiterinnenbrut und einige kleinere Flächen mit größeren Zellen für Drohnenbrut.
Imker und Imkerinnen schätzen es – aus Gründen, von denen ebenfalls später noch die Rede sein wird – nicht sehr, wenn auf einer Wabe in einem Rähmchen Arbeiterinnenzellen und Drohnenzellen zugleich auftreten. Darum führen sie mit Hilfe der Rähmchen nicht nur den Wabenbau, sondern nehmen auch Einfluss darauf, welche Zellen die Bienen auf der Wabe eines Rähmchens anlegen. Dies geschieht, indem sie, wenn ein Volk mit einer Zarge erweitert wird, nicht einfach leere Rähmchen in die Zarge hängen. Vielmehr kommt in jedes Rähmchen eine »Mittelwand«. Das ist eine Wachsplatte in der Größe des jeweils verwendeten Rähmchenmaßes. Sie wird auf Drähte, die in das Rähmchen gespannt werden, aufgelegt und durch ein kurzes Erhitzen der Drähte mittels eines Trafos fest mit den Drähten verbunden. Der Kniff ist nun, dass auf der Mittelwand die Zellstruktur von Arbeiterinnenzellen in Form kleiner Wachswülste bereits vorgeprägt ist. Die Bienen nehmen diesen »Bauplan« immer an und errichten auf einer Mittelwand nur Arbeiterinnenzellen. So entsteht aber nicht nur eine sehr regelmäßige Zellenstruktur. Da die Bienen auf der ganzen Fläche eines Rähmchen mit dem Errichten der Zellen beginnen können, geht der Wabenbau sehr schnell vonstatten. Und durch die Drähte, die die ausgebaute Wabe durchziehen, ist diese zudem stabiler (vgl. Bild 4).
Störungen im Haustelefon
Gerade diese Stabilität scheint den Bienen selbst aber nicht immer zu gefallen. Denn die Wabe ist nicht nur Lagerraum und Kinderstube, sie erfüllt noch eine dritte Funktion: Sie dient der Kommunikation im Bienenstock (Tautz&Lindauer 1999). Es ist ja in der Honigfabrik zappenduster! Außer am Bodenbrett, wo durch das Flugloch hindurch ein wenig Licht in die Honighöhle fällt, herrscht im Stock ein wimmeliges Gedränge in völliger Finsternis. Wie also soll man sich miteinander austauschen und Informationen weitergeben, wenn man die anderen nicht sehen kann und wenn man wie die Bienen nichts hört?
Eine Möglichkeit der Kommunikation besteht im Austausch chemischer Signale, oder einfacher: dadurch, dass bestimmte Duftstoffe mit Signalwirkung da sind oder eben nicht da sind. Tatsächlich kommunizieren Bienen über Gerüche und wir werden noch mehr davon hören. Daneben gilt: Wer nicht hören kann, muss fühlen!
Bienen haben sehr sensible Tastorgane an den Füßen und in den Beinen, mit denen sie unterschiedliche Schwingungen auf der Wabe spüren können (Sandeman et al. 1996). Auch das, was wir als Schall hören, wird von den Bienen als mechanische Schwingung wahrgenommen. Eine frisch geschlüpfte Königin beispielsweise kann einen tütenden Laut von sich geben, den der Imker hört, den die Bienen auf der Wabe aber nur spüren. Mit Hilfe der Vibration »sagt« die neue Prinzessin ihrem Volk: Ich bin da!
So ist die Wabe die Kommunikationsplattform im Bienenkasten und die Netzstruktur der mit Propolis verstärkten Zellränder, von der gerade die Rede war, ist das »Festnetz« im Haustelefon des Bienenvolkes (Tautz 2002). Wie es funktioniert, wird deutlich wenn man den Schwänzeltanz der Bienen, den wir später ebenfalls noch ausführlicher kennenlernen werden, genauer anschaut.
Bienen tanzen, um Informationen weiterzugeben. Jede tanzende Biene versucht dabei, Nachtänzerinnen zu rekrutieren. Je mehr Bienen »die Information tanzen«, desto schneller verbreitet sich diese im Volk.
Die Weise, in der Tänzerinnen auf sich aufmerksam machen, ist besonders raffiniert. Wir werden sie uns später noch genauer ansehen. Der Schwänzeltanz besteht, hier verkürzt gesagt, aus einer Laufphase und einer Schwänzelphase, die man auch Standphase nennen könnte. Denn in diesem Teil des Tanzes stehen die Bienen auf der Wabe fast still, heben unkoordiniert mal dieses, mal jenes ihrer sechs Beinchen und suchen damit jeweils einen neuen Halt. Dabei schieben sie sich ganz langsam vorwärts und schlagen ihren Körper bis zu 15-mal pro Sekunde nach den Seiten aus (Tautz et al. 1996).
So halten sie intensiven Kontakt zur Wabe und ziehen abwechselnd auf ihrer rechten und auf ihrer linken Seite an den Zellrändern. Diese werden dabei unter Spannung gebracht, in etwa so, wie wenn man ein Gummiband dehnt: Die leichtgewichtigen Bienen können mit einer Kraft von 4 Milli-Newton, das entspricht in etwa der Gewichtskraft, die fünf Arbeitsbienen auf die Waage bringen, an den Zellrändern ruckeln und sie dabei um etwa 2-tausendstel Millimeter auslenken (Storm 1998, Rohrseitz 1998). Das eigentliche Signal, mit dem die Tänzerin interessierte Nachtänzerinnen anlockt, besteht nun in kurzen Vibrationspulsen, die sie mit der Flugmuskulatur erzeugt. Diese Pulse haben eine Grundfrequenz von etwa 250 Hertz (Esch 1961). Die Tänzerin sendet sie exakt in den Momenten aus, in denen sie am stärksten an den Zellrändern zieht, also dann, wenn die Kraftankopplung maximal ist und der Vibrationsimpuls am klarsten über das Netztelefon weitergeleitet werden kann.
Man kann sich das alles zusammengefasst in etwa so vorstellen: Wenn wir eine Gitarrensaite auf den Ton »C« stimmen und ein Sänger oder eine Sängerin ein »C« singt, dann wird die Gitarrensaite angeregt über den Gitarrenkörper bald in diesem Ton mitschwingen. Ähnlich macht es die Tänzerin: In der Schwänzelphase spannt sie den Zellenrand wie eine Gitarrensaite und singt ihren Vibrationspuls mit der optimalen Frequenz von 250 Hz ins Telefon.
Nun entstehen bei der Erzeugung der Vibrationspulse durch die damit verbundenen Flügelschwingungen unvermeidlich auch Luftbewegungen, die sich als Luftschall messen lassen. Doch die Tänzerinnen locken im Dunkel des Stockes die Nachtänzerinnen nur durch die Untergrundschwingungen an und nicht durch den Luftschall oder andere physikalische Phänomene. Das wird deutlich, wenn man das Verhalten einer Tänzerin und einer Nachtänzerin beobachtet, die auf dem gleichen Tanzboden stehen, und zum anderen solche Pärchen betrachtet, die sich zwar genauso nah sind, sich aber auf mechanisch voneinander getrennten Böden aufhalten. Nur im ersten Fall lockt die Tänzerin die andere Biene heran, sodass diese ein Nachtanzverhalten zeigt (Abb. 1). Bienen, die sich auf einer anderen Wabe befinden, die einer Tänzerin also buchstäblich den Rücken zukehren, interessieren sich für diese nur dann, wenn sie sie zufällig mit ihren Antennen berühren. Sie brauchen also direkten Kontakt und erfahren über das Haustelefon nichts.
Abb. 1
A. Sitzen Tänzerin (jeweils links) und Tanzfolgerin (jeweils rechts) auf dem gleichen Untergrund, sprich hier der gleichen Wabe, erreichen sowohl Schallreize durch die Luft als auch Schwingungen des Untergrundes die Nachtänzerin, die daraufhin zur Tänzerin herangelockt wird.
B. Sitzen Tänzerin und Tanzfolgerin nicht auf dem gleichen Untergrund, erreicht von diesen Reizen nur der Schall die Nachtänzerin, die so nicht zur Tänzerin gelockt wird.
Das Wabentelefon funktioniert dann am besten, wenn die Tänze auf nicht verdeckelten Zellen stattfinden. Bei anderen Tanzböden ist das Telefonnetz gestört, weil es nicht frei schwingen kann. So erreichen Tänze auf verdeckelten Zellen, auf dem Holz der Rähmchen oder auch – wie wir später noch lesen werden – auf den Körpern von Bienen in der Schwarmtraube deutlich weniger Publikum.
Das Geheimnis der Abstimmung zwischen den Botschaften der Tänzerin und dem dafür genutzten Kommunikationsmedium liegt in der Impedanz des Zellrandnetzes. Impedanz bedeutet Widerstand: Je schwächer die Kraft sein kann, die in einer Struktur eine bestimmte Bewegung auslöst, desto geringer ist die Impedanz dieser Struktur. Die Impedanz, hier also das Leitungsvermögen, des Zellrandnetzes hängt ab von der Temperatur des Wachses, der Größe der Zellen und der Frequenz der Schwingungen, die im Netz ausgebreitet werden. Am stärksten ist die Abhängigkeit von der Frequenz der Signale. Die Impedanz ist am geringsten um eine Frequenz von 250 Hz herum. In diesem Frequenzbereich stehen also die Stärke der Vibration und das Leitungsvermögen des »Zellrandnetzwerks« in einem optimalen Verhältnis zueinander. Ob es sich bei den Zellen, auf denen getanzt wird, um die kleineren Arbeiterinnenzellen oder die größeren Drohnenzellen handelt, hat dabei erstaunlicher Weise nur einen sehr geringen Einfluss auf das Leitungsvermögen der Wabe. Einen deutlich stärkeren Einfluss hat die Temperatur: Je kälter das Wachs ist, desto größer ist die Impedanz des Zellrandnetzes, desto schlechter werden also die Schwingungen weitergeleitet. Im Winter, wenn es in der Honigfabrik auch frieren kann, ist die Leitung also weitestgehend tot. Aber auch umgekehrt gilt: Je wärmer das Wachs ist, desto weicher ist es und desto schwächer ist die Spannung der Zellränder, die die Tänzerin mit ihren Mini-Kräften erzeugen kann. Gerade darum ist es für die Bienen ja so wichtig, die Zellränder mit Propolis zu verstärken.
Überraschend ist, dass eine Füllung der Zellen mit Honig keinen Einfluss auf die Verbreitung der Schwingungssignale hat. Rein physikalisch verhält sich das Zellrandnetz so, als sei es freischwebend von den Zellwänden unabhängig. Nutzt der Imker starre, aus Plastik vorgeformte Mittelwände, die von den Bienen dann zu Waben ausgebaut werden, hat das darum ebenfalls keinen negativen Einfluss auf die Vibrations-Kommunikation über die Waben.
Es gibt nur zwei Umstände, unter denen die Schwingungsausbreitung zum Erliegen kommt: Sind die Zellen verdeckelt, wird das Zellrandnetz starr und kann keine Schwingungen mehr weiterleiten. Das Bienentelefon ist dann tot. Das gleiche gilt, wenn die Ränder einer Wabe vollständig mit dem Rähmchen verbunden sind. Imker können darum immer wieder beobachten, dass die Bienen genau das vermeiden. Gerne nagen sie Löcher und Ausbuchtungen vom Rand des Rähmchens her in die Wabe. Hier waren dann »Telefonnetz-Flicker-Bienen« am Werk, die dafür gesorgt haben, dass die Tanzfläche schön freischwingend und das Telefon intakt bleibt.
KAPITEL II
SAISONARBEITIM RHYTHMUSDER JAHRESZEITEN –
TEAMWORK IN DER HONIGFABRIK