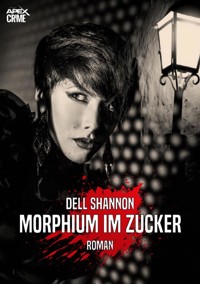6,99 €
Mehr erfahren.
Der rätselhafte Kriminalfall der 23jährigen Valerie Ellis aus Los Angeles beansprucht Lieutenant Mendozas äußerste Konzentration.
Wer war diese Frau? Was in aller Welt suchte sie in der Wüste von Arizona? Etwa Schmucksteine wie Bergkristall, Narrengold oder Achat? Oder half sie den illegalen Einwanderern aus Mexiko?
Und was war übrigens mit der Falsche Madeira?
Der Roman Die Wurzel alles Bösen von Dell Shannon (ein Pseudonym der US-amerikanischen Bestseller-Autorin Elizabeth Linington - * 11. März 1921; † 05. April 1988) erschien erstmals im Jahr 1965; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im Jahr 1968 (unter dem Titel Die Flasche Madeira).
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DELL SHANNON
Die Wurzel alles Bösen
Roman
Signum-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DIE WURZEL ALLES BÖSEN
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Das Buch
Der rätselhafte Kriminalfall der 23jährigen Valerie Ellis aus Los Angeles beansprucht Lieutenant Mendozas äußerste Konzentration.
Wer war diese Frau? Was in aller Welt suchte sie in der Wüste von Arizona? Etwa Schmucksteine wie Bergkristall, Narrengold oder Achat? Oder half sie den illegalen Einwanderern aus Mexiko?
Und was war übrigens mit der Falsche Madeira?
Der Roman Die Wurzel alles Bösen von Dell Shannon (ein Pseudonym der US-amerikanischen Bestseller-Autorin Elizabeth Linington - * 11. März 1921; † 05. April 1988) erschien erstmals im Jahr 1965; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte im Jahr 1968 (unter dem Titel Die Flasche Madeira).
Der Signum-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur.
DIE WURZEL ALLES BÖSEN
Erstes Kapitel
John Luis Mendoza und Teresa Ann Mendoza brüllten. Gemeinsam und laut schrien sie in die Nacht hinaus, und es war staunenswert, über welche Lungenkraft die beiden verfügten.
Nach einer Weile setzte sich Alison auf und sagte schläfrig: »Zum Teufel.«
Sie schwang die Beine über den Bettrand und suchte nach ihren Pantoffeln. Mendoza murmelte ein Schimpfwort.
»Na, komm’ ja schon«, sagte Alison gereizt und zog ihren Morgenmantel vom Stuhl.
»...unsinnig«, murmelte Mendoza.
Das Gebrüll im Zimmer nebenan verstärkte sich noch.
»Langsam glaube ich bald selber, dass du recht hast«, sagte Alison gähnend. Sie tastete sich zur Tür und knipste die Korridorlampe an. Er hörte ihre Stimme beruhigend auf die Zwillinge einreden.
Er machte die Augen wieder zu und versuchte nicht hinzuhören, aber es war hoffnungslos. Drei Minuten später stand er auf, knipste die Nachttischlampe an und ging zu Alison hinüber.
»Das 1st einfach unvernünftig«, sagte er. »In diesem Alter wissen sie gar nicht, wer gelaufen kommt, wenn sie zu brüllen anfangen. Wir haben doch in Gottesnamen genug Geld, um ein Kindermädchen einzustellen. Soll sie doch die ganze Nacht aufbleiben – im hinteren Schlafzimmer. Bei geschlossener Tür.«
Er nahm Alison Teresa Ann ab und sah ihr verzerrtes kleines Gesicht mit für den Augenblick nicht sehr großer Zuneigung an. Teresa Ann hatte dichtes schwarzes Lockenhaar und große, braune Augen, umrahmt von langen, schwarzen Wimpern, aber jetzt waren die Augen fest zusammengekniffen, der rosige Mund stand offen, und sie gab mörderische Schreie von sich. Resigniert ging Mendoza auf und ab und schaukelte sie.
»Lächerlich«, sagte er. »Wenn mir vor ein paar Jahren jemand erzählt hätte, dass ich nachts um halb drei wie irgendein ganz gewöhnlicher Pantoffelheld mit einem Säugling auf dem Arm herumwandern würde...!«
Alison ging an ihm vorbei, in entgegengesetzter Richtung, den kleinen John Luis schaukelnd.
»Das ist nicht gerade deine Stärke«, sagte sie ein wenig maliziös.
»Und alles so unnötig! Aber nein, du erinnerst dich an die vielen Schnulzenromane über das arme, kleine Waisenkind, das nur von den Dienstboten aufgezogen worden ist...! Caray, wie kann ein fünf Monate altes Kind soviel Lärm machen? Ist das bei allen so?«
»Bei den meisten«, sagte Alison. Sie mussten ihre Stimmen erheben, um den Krach zu übertönen. Sie setzte sich in einen Stuhl und schaukelte den kleinen John automatisch mit geschlossenen Augen. »Langsam glaube ich, dass du recht hast, Luis.«
»Natürlich hab’ ich recht.« Mein Gott, jetzt kann er es Art erst nachfühlen – wie eine Zeitbombe hat er gesagt! Und ob er recht gehabt hat! »Wie in Dreiteufelsnamen ertragen das Leute, die es sich nicht leisten können...«
»Du hast ja keine Ahnung, an was man sich alles gewöhnt«, meinte Alison gähnend, während sie ihren Sohn mit grimmiger Entschlossenheit hin- und herwiegte.
»Ich bin jedenfalls zu alt, um mich noch umzugewöhnen«, betonte Mendoza. »Ich muss nachts meinen Schlaf haben. Ich bin den ganzen Tag im Druck. Im Augenblick haben wir sowieso so viel Ärger mit dem Einbrecher.« Er starrte auf Teresas rotes Gesicht hinunter. »Obwohl ich ihn ja, von einem bestimmten Standpunkt aus, recht gut verstehen kann – er bringt nur Frauen um.«
Er gähnte.
»Te estás engañando a ti misma – du machst dir nur selbst etwas vor. Mit fünf Monaten wissen sie doch noch gar nicht, ob es Mama ist oder ein nettes Kindermädchen. Du kannst auch später noch die liebende Mutter spielen. Wenn sie endlich gelernt haben, nachts zu schlafen.«
»Ich glaube, ich muss dir recht geben«, sagte Alison, über ihrem Schreihals von Sohn schläfrig nickend. »Aber das hintere Schlafzimmer ist nicht als Kinderzimmer eingerichtet.«
»Eso basta!«, sagte Mendoza. »Dann hol eben wieder die Maler – klecks die hübschen Zirkustiere an die Wand – und das hier wird ein ganz neutrales zusätzliches Zimmer. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns ein Kindermädchen beschaffen, oder?« Er schaukelte Miss Teresa mit einigem Ungestüm.
»Ja«, sagt Alison. »Du hast vollkommen recht. Ich mach’ mich morgen gleich auf die Suche – wenn ich noch die Kraft dazu habe.«
»Heute. Es ist fast drei. Woher nehmen sie denn die Kraft?«
»Säuglinge haben sehr viel Energie«, sagte Alison müde. »Wenn sie gesund sind.«
»Diese beiden müssen die gesündesten Säuglinge von ganz Los Angeles sein«, sagte Mendoza bitter. »Wenn mir jemand erzählt hätte, dass ich – glaubst du, dass es etwas nützt, wenn wir Wiegenlieder singen?«
»Das haben wir doch schon versucht«, erinnerte ihn Alison. »Wir scheinen nicht besonders musikalisch zu sein – ich glaube, dass ich ganz gut singen kann, aber da schreien sie nur umso lauter. Vielleicht kenne ich nicht die richtigen Wiegenlieder.« Sie nahm John auf den andern Arm.
»Es muss doch Hunderte von netten und erfahrenen Kindermädchen geben.«
»Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich umsehen.«
»Heute noch«, sagte Mendoza. »So was macht mich einfach fertig, cara. Ich hab’ mich für einen recht stabilen Burschen gehalten, als ich jede Nacht acht Stunden schlafen durfte. Aber wenn diese zwei Zeitbomben jede Nacht um halb drei losgehen, spürt man seine Jährchen!«
»Gemacht«, antwortete Alison lammfromm. »Ich versprech’s dir. Wir können natürlich nicht irgendeine nehmen, aber eine gute Vermittlung müsste doch...«
»Ich will dir etwas sagen«, sagte Mendoza. »Es ist nur gut, dass wir in der Nähe keine Nachbarn haben, sonst würden sie sich bei der Polizei beschweren. Das wär was Feines, wenn ein ergrauter Kriminalbeamter wie ich wegen Ruhestörung angezeigt wird.«
Miss Teresa machte eine kurze Pause und brüllte dann mit solcher Lautstärke, dass er sie grimmig anstarrte.
»Ich muss mich verbessern«, sagte er. »Die gesündesten Säuglinge in ganz Kalifornien!«
Wie gewöhnlich schliefen die Zwillinge um fünf Uhr früh selig. Mendoza wurde um acht Uhr von einer schläfrigen und mitfühlenden Alison wachgerüttelt; bis er sich rasiert, angezogen und zwei Tassen Kaffee getrunken hatte, war er wieder halbwegs ein Mensch.
»Und du machst dich auf die Suche nach dem Kindermädchen«, ermahnte er sie.
»Ich hab’ doch gesagt, dass ich es verspreche. Ich geb’ ja schon nach«, antwortete Alison. »Du hast ganz recht, es ist unsinnig, es nicht zu tun, wenn wir es uns leisten können, jemand zu bezahlen.«
Als er um Viertel vor neun sein Büro betrat, maß ihn Hackett vom Scheitel bis zur Sohle, um dann zu grinsen.
»Das hab’ ich Ihnen doch gesagt, nicht wahr? Man übersteht’s, aber wie!« Er sprach vom reifen Standpunkt eines Vaters aus, dessen Sprössling den ersten Geburtstag schon hinter sich hatte und nun statt schlafloser Nächte andere Überraschungen lieferte.
Mendoza setzte sich an seinen Schreibtisch.
»Sie brauchen gar nicht so überheblich zu tun – Alison gibt nach.
Sie engagiert ein Kindermädchen. Ausgesprochener Quatsch, diese sentimentalen Einfälle – immerhin, und darauf habe ich ganz besonders hingewiesen – was soll denn mit mir werden? Wertvoller Beamter, kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Und warum ich mich in Dreiteufelsnamen überhaupt auf dieses ganze Theater eingelassen habe – wenn mir jemand vor ein paar Jahren erzählt hätte, dass ich...«
Hackett lachte.
»Früher oder später erwischt es uns alle... Wir haben möglicherweise eine Identifizierung der Toten aus der Garey Street. Vor ein paar Minuten hat einer angerufen. Er kommt her. Ein gewisser James Ellis. Klang ganz gewöhnlich und solid.«
»So? Das wäre ja schon ein Fortschritt.«
»Ich hab’ mir gedacht, dass Sie mit ihm sprechen könnten. Ich will mit Palliser noch einmal durchgehen, was wir über diesen Einbrecher wissen.«
»Na schön«, sagte Mendoza gähnend. Das mit dem Einbrecher war eine diffizile Sache, wie fast immer bei diesen Verbrechern. Er war, soviel sie bis jetzt wussten, in sieben Häuser eingedrungen – ohne Umschweife, am hellen Tag – hatte Frauen zu Hause allein angetroffen, vier davon überfallen, zwei vergewaltigt, und die anderen drei umgebracht, um anschließend mitzunehmen, was ihm gefiel. Die vier Überlebenden waren nicht unerheblich verletzt worden, hatten der Polizei aber eine genaue Beschreibung des Täters geben können. Es musste sich immer um denselben Mann handeln, aber damit kam man nicht weiter. Ein Neger, sagten die Überlebenden, hellbraun, fast einen Meter neunzig groß und breitschultrig, pockennarbige Haut. Alle schilderten schäbige Arbeitsbekleidung, dunkle Hose, khakifarbenes Hemd; eine Frau hatte ergänzend eine helle Schirmmütze erwähnt. Dine von diesen Frauen und zwei aus der Nachbarschaft der anderen hatten ihn entkommen sehen und erklärt, er steuere einen lädierten, alten hellblauen Kleinlastwagen, Marke Ford oder Chevrolet. Die vierte Frau, eine von den Vergewaltigten, war in psychiatrischer Behandlung und konnte keine vernünftigen oder brauchbaren Angaben machen.
Das alles zusammen klang, als wüssten sie eine ganze Menge über den Verbrecher, aber in Wirklichkeit reichte es bei weitem nicht. Im Verwaltungsbezirk Los Angeles gab es sehr viele Neger; ein gewisser Teil davon, größer, als man glauben mochte, bestand natürlich aus höheren Angestellten und Intellektuellen, von denen viele ein sehr gutes Einkommen hatten und in vornehmeren Wohnbezirken lebten. Aber es blieb die Mehrheit. Viele Weiße und Schwarze trugen khakifarbene Hemden und dunkle Hosen. Und es gab eine Unzahl von alten, blauen Kleinlastwagen.
Zurzeit gingen sie die Liste der Zulassungsstelle von Sacramento durch, in der alle derartigen im Verwaltungsbezirk Los Angeles zugelassenen Fahrzeuge registriert waren. Es gab natürlich keine Garantie dafür, dass der gesuchte Kleinlaster auf der Liste stand, keine Garantie, dass der Wagen wirklich in diesem Bezirk zugelassen worden war. Aber die Liste war äußerst umfangreich und um sie durchzugehen, brauchte man sehr viel Zeit und eine Menge Leute. Wenn sich nichts Interessantes zeigte, mussten sie in Sacramento umfassendere Register anfordern und von vorne anfangen. In der Zwischenzeit konnte man nur darauf hoffen, dass der Verbrecher nicht wieder von seinen Trieben geplagt wurde, bevor man ihm auf die Spur kam.
Solche Fälle waren schwer zu lösen. Mendoza gähnte und dachte an die Tote aus der Garey Street. Er interessierte sich dafür, weil die Sache aus dem Rahmen des Üblichen fiel.
Sie war am Montag früh gefunden worden; heute schrieb man Mittwoch. Ein entsetzter und aufgeregter Pater Michael Aloysius O’Callaghan hatte gemeldet, dass sie am Rand des Spielplatzes einer großen Bekenntnisschule von ein paar Kindern gefunden worden war. Beamte der Mordkommission waren hingefahren, um die Sache aufzunehmen, und auf den ersten, oberflächlichen Blick hin schien nichts Besonderes daran zu sein. Die Leiche einer jungen Frau, zwischen zwanzig und vierundzwanzig Jahren, einer verhältnismäßig gutaussehenden jungen Frau, als sie noch gelebt hatte, blond; keine Handtasche, keine äußerlich erkennbaren Verletzungen, und nirgends auch nur die kleinste Spur.
Jackett hatte damals grimmig erklärt: »Wahrscheinlich wieder so eine Rauschgiftparty. Das Mädel erwischt zu viel, und sie laden die Leiche einfach irgendwo ab.«
Mendoza hatte ihm recht gegeben. Garey Street gehörte nicht gerade zu den vornehmeren Bezirken. Solche Dinge gab es öfter: junge Leute, die sich trafen, um mit Heroin oder mit selbstgemachtem Schnaps zu experimentieren, wobei dann irgendjemand zu viel erwischte, und die anderen die Leiche in panischer Angst einfach irgendwo hinbrachten.
Den einzigen Vorbehalt machte er wegen der Fundstelle. Die Bekenntnisschule war sehr groß, und wie bei den städtischen Schulen hatte man den Spielplatz mit einem siebeneinhalb Meter hohen Maschendrahtzaun eingefriedet. Die Tore wurden nachts natürlich abgeschlossen. Es konnte nicht gerade einfach gewesen sein, eine Leiche über den Zaun zu befördern, und schließlich gab es ja alle möglichen Stellen, wo die Tote ohne alle Mühe hätte abgeladen werden können: in dunklen Gassen, Nebenstraßen, auf unbebauten Grundstudien,
Trotzdem war der Fall routinemäßig behandelt worden, bis Dr. Bainbridge den Obduktionsbericht heraufschickte. Die einigermaßen gutaussehende junge Blondine war nicht an einer Überdosis Heroin oder an Alkoholvergiftung gestorben. Sie war an einer Überdosis Kodein zugrunde gegangen und Bainbridge konnte sogar angeben, um welches Morphiumpräparat es sich handelte und welche Firma es herstellte.
Das erweckte Mendozas Neugierde. Viele Leute begingen Selbstmord mit Schlaftabletten, aber sie komplizierten die Sache nicht, indem sie sich an derart abgelegene Plätze verfügten. Es hatte sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen sorgfältig geplanten Mord gehandelt, und im Gegensatz zu vielen Kriminalromanen hatte die Mordkommission einer Großstadt mit solchen Fällen nicht oft zu tun.
»War sich dieser Ellis sicher?«, fragte er jetzt Hackett.
»Ein bisschen vorsichtig ist er schon gewesen«, meinte Hackett. »Er sagte, als er und seine Frau heute früh das Bild in der Zeitung gesehen hätten, wären sie beide der Meinung gewesen, dass sie es sein könnte – aber ein Toter sieht ja nicht immer so aus wie vorher im Leben. Sie wollten sofort herkommen.« Er warf einen Blick auf die Uhr. »Ich bin mit Palliser verabredet. Bis später.«
Er verließ das Zimmer, und eine Minute später steckte Sergeant Lake den Kopf zur Tür herein, um zu melden, dass Mr. und Mrs. Ellis eingetroffen seien.
James Ellis war ein stämmiger, kleiner Mann um die Fünfzig, gepflegt und konservativ gekleidet. Schütteres, graues Haar, ehrliche, blaue Augen, ein kantiges Kinn. Mrs. Ellis war das Gegenstück dazu: eine einfache ältere Frau, mit bekümmertem Gesicht, im Sonntagsstaat – seidenes Kleid, marineblauer Mantel und Hut.
Ellis war Bankkassier, ein sehr solider Mann.
Jetzt saß er in Mendozas Büro, immer noch blass und erschüttert, zwanzig Minuten nach seinem Besuch im Leichenschauhaus. Er atmete immer wieder tief ein und wischte sich aufgeregt die Stirn.
»Einfach furchtbar«, sagte er. »Eine schreckliche Tragödie. Die arme kleine Val.«
Mrs. Ellis weinte leise.
»Wir wollten doch wirklich helfen, Jamie, das weißt du. Ich glaube einfach nicht daran, dass sie wirklich schlecht war. Das Ganze ist eben zu einer recht ungünstigen Zeit passiert – sie konnte nicht – erst dreiundzwanzig, das ist so ungerecht. Das arme Kind.«
»Valerie Ellis«, sagte Mendoza. »Was können Sie mir über sie erzählen, Mr. Ellis? Sie war Ihre Nichte, sagten Sie.«
»Ja, Sir, das stimmt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wer ihr so etwas Entsetzliches antun konnte. Aber ich muss sagen, dass wir nicht allzu viel über sie wussten – na ja, wie sie lebte, mit wem sie Umgang hatte – in letzter Zeit. Na, Mabel, führ dich nicht so auf. Du weißt, dass wir uns Mühe gegeben haben. Aber sie...«, er wischte sich wieder die Stirn und sah Mendoza ernsthaft an. »Sie wollte plötzlich mit allen Bekannten nichts mehr zu tun haben, als es passierte, verstehen Sie? Wir haben natürlich sofort zu ihr gesagt, komm zu uns – die einzigen Verwandten, sie war damals erst neunzehn –, und unsere beiden Kinder sind schon verheiratet und selbständig, wissen Sie. Es war einfach nicht richtig, dass ein so junges Mädchen ganz allein lebt. Aber sie wollte nicht. Ich muss schon sagen, dass sie oft recht ungezügelt war...«
»Oh, aber Jamie, sie hätte doch nie etwas Böses getan! Freds Tochter...«
»Na, ich weiß nicht«, sagte Ellis langsam. »Junge Leute in diesem Alter kommen manchmal vom richtigen Weg ab und geraten in schlechte Gesellschaft. Es war wirklich traurig, aber in gewisser Weise trug schon Fred die Schuld. Ich sagte ihm das oft genug...«
»Mr. Ellis. Wenn Sie mir der Reihe nach erzählen könnten, was Sie wissen? Ich verstehe, dass Sie aufgeregt sind, aber...«
»Oh, natürlich. Entschuldigen Sie, Sir. Ich sehe schon, dass Sie nicht wissen, wovon ich rede.«
Ellis steckte sein zerknülltes Taschentuch weg, zog ein zweites, sauberes Tuch heraus und schnäuzte sich.
»Wirklich traurig«, sagte er. »Die kleine Val. Sie war so ein nettes Ding... Ich weiß nicht, ob Sie sich für diese Sachen interessieren, Lieutenant, Sie brauchen es mir nur sagen, wenn Sie nichts damit anfangen können. Zuerst werden Sie wohl wissen wollen, wo sie gewohnt hat. Soviel uns bekannt war, jedenfalls noch bis vergangene Woche, hatte sie eine Wohnung in der Mariposa Street in Hollywood.« Er nannte die Hausnummer. »Wir hatten ihr angeboten, sie bei uns aufzunehmen, und vielleicht hätten wir. uns mehr um sie kümmern sollen – die einzigen Verwandten, und sie war ja noch so jung. Aber...«
»Wir hätten es tun müssen«, sagte seine Frau. »Nur weil sie vielleicht ein bisschen unbesonnen war, umso mehr...«
Sie weinte wieder.
»Na ja, vielleicht, aber es war – schwierig«, sagte Ellis. »Ich will Ihnen erzählen, wie es gewesen ist, Lieutenant.« Er starrte bedrückt vor sich hin. »Sehen Sie, Fred – mein Bruder – war ein äußerst aktiver Mann. Nicht wie ich«, und er lächelte schwach. »Er hat viel Geld gemacht – Verkaufsleiter bei DeMarco und Spann, über fünfzehn Jahre, große Maschinenbaufirma, vielleicht kennen Sie sie. Er hatte ein hohes Einkommen, seit die kleine Val alt genug war, um das zu merken – und er gab das Geld aus. Immer wieder habe ich ihm gesagt, Fred, du musst etwas auf die Seite legen, für alle Fälle – verstehen Sie? Kauf doch Aktien, Pfandbriefe, oder leg dein Geld in Immobilien an – das ist das Vernünftigste, was man tun kann. Aber Fred sah das nicht ein – er war einfach nicht so gebaut.« Ellis schüttelte missbilligend den Kopf. »Sie haben sehr aufwendig gelebt. Ein Haus in Bel-Air, zwei Cadillacs, ein Dienstmädchen – er war durchaus kein Snob, Fred, und Amy, seine Frau auch nicht, sie haben uns zu ihren Partys eingeladen und so weiter, aber – Sie verstehen sicher, was ich meine. Entschuldigen Sie, ich komme so ins Reden, wollen Sie das überhaupt alles hören, ich weiß nicht ...«
Er war ein ernsthafter, unglücklicher, durchschnittlicher kleiner Mann.
»Alles, was Sie mir sagen können«, erwiderte Mendoza.
»Immer wieder hab’ ich ihm beibringen wollen, dass man kein solches Risiko eingehen darf – er hat auch nie Versicherungen abgeschlossen, es war, als sei er abergläubisch, als könne ihm das Unglück bringen. Entschuldigung, Sie wollen sicher nicht hören – die arme, kleine Val. Vielleicht hätten wir uns mehr Mühe geben sollen, ich weiß nicht, auch wenn sie grob war und – aber geschehen ist geschehen. Mabel, nimm dich zusammen... Es war vor vier Jahren, dass Fred und Amy mit dem Wagen tödlich verunglückt sind. Der andere war schuld, ein Betrunkener – aber das nützte Fred und Amy gar nichts. Diese verdammten Besoffenen! Fred war erst neunundvierzig – ausgesprochen tragisch. Tja, ich hätte es natürlich Voraussagen können, übrig blieb gar nichts. Ein Haufen Schulden, das Haus war nicht abgezahlt – der Wagen hatte natürlich Totalschaden – keine Versicherung. Bis alles abgerechnet war, konnten mit den Sicherungsbeträgen für das Haus gerade die Schulden bezahlt werden, und die kleine Val bekam überhaupt nichts. Sie war neunzehn, gerade im ersten Jahr in der Berkeley-Universität – kurz vorher hatte man sie in eine ganz vornehme Studentenverbindung aufgenommen. Und sie hat eben immer alles gehabt – Sie verstehen mich? Kleider, ihren eigenen Wagen, seit sie aus der Oberschule war, alles, was sie wollte. Und sie ist – einfach zusammengebrochen, könnte man wohl sagen, als sie plötzlich allein dastand.« Er sah seine Frau unglücklich von der Seite her an.
»Das ist vielleicht nur natürlich gewesen«, sagte sie. »Ein Mädchen in diesem Alter. Und sie war so verwöhnt! Sie musste die Universität verlassen, eine Stellung suchen und sich ihr Brot selbst verdienen.« Sie wischte sich die Augen. »Wir hatten nicht das Geld, um sie weiterstudieren zu lassen, aber wir haben ihr gesagt, dass sie bei uns immer ein Zuhause hat – das war eine Selbstverständlichkeit. Aber sie wollte nicht. Sie...«
»Sie war empfindlich?«, ergänzte Mendoza, als sie zögerte. »Voll Bitterkeit, weil sie nichts mehr hatte, nachdem sie, wie man sagen könnte, im Luxus aufgewachsen war?«
»Ja, genauso«, sagte Ellis. »Sie hat ein paar böse Worte gefunden, sie wolle keine Almosen annehmen und so weiter. Sie war schon recht verwöhnt, Mabel hat recht. Sie machte sich selbständig und – wir haben versucht, in Kontakt mit ihr zu bleiben, wir haben sie ab und zu zum Essen eingeladen. Aber andererseits, wissen Sie, Lieutenant, wie ich damals schon zu Mabel gesagt habe, es schadet jungen Leuten nichts, wenn sie auf eigenen Füßen stehen müssen, wenn sie lernen, was Geld verdienen heißt. Ganz im Gegenteil. Ich dachte mir, sie wird vielleicht vernünftig, wenn sie so auf sich selbst gestellt ist... Zuerst arbeitete sie bei Robinson, als Verkäuferin. Ich sagte zu ihr, besuch doch einen Kurs und sieh zu, dass du als Sekretärin unterkommst. Aber sie war so...«, er verstummte und starrte vor sich hin.
»Welche Stellungen hat sie sonst noch gehabt?« Mendoza machte sich Notizen. »Kennen Sie irgendwelche Bekannten von ihr?«
»Nein, Sir, leider nicht. Wir haben sie im letzten Jahr nicht oft gesehen. Ich erinnere mich, dass sie von einem Paul gesprochen hat, aber ich kenne weder seinen Familiennamen, noch weiß ich, was er treibt. Sie hat später am Broadway gearbeitet, und vor einem halben Jahr war sie Empfangsdame in einem Restaurant – Die schwarze Katze draußen in La Ciénega. Aber ich weiß nicht...«
»Soviel Sie wissen, war sie immer noch dort beschäftigt?«
»Tja«, sagte Ellis, »das ist es ja. Ich – ich glaube, wir müssen es Ihnen sagen. Herrgott noch mal – Freds Kleine – Val...«
»Ich glaube nie, dass sie schlecht war«, sagte Mrs. Ellis. »Vielleicht ist sie in schlechte Gesellschaft geraten, aber – natürlich müssen wir es ihnen sagen, James.«
»Ja. Ich hab’ ja vorhin schon erwähnt«, sagte Ellis, »dass wir uns bemüht haben, mit Val in Kontakt zu bleiben. Von Zeit zu Zeit war sie bei uns zum Essen. Manchmal kam sie auch zu Besuch – aber in den letzten paar Jahren hat sie meistens eine Ausrede gefunden. Sie war auch immer recht gelangweilt, wenn sie wirklich kam und blieb nicht lange. Na ja – ältere Leute, und sie war jung.« Er blinzelte verlegen. »Es ist so – sie hat uns nie erzählt, dass sie die Stellung im Restaurant aufgegeben hat, aber sie war ja auch ein paar Monate nicht bei uns gewesen. Es war ungefähr vor einer Woche, nicht wahr, Liebes, als du bei ihr vorbeigegangen bist...«
Mabel Ellis nickte ernst.
»Wir haben uns die ganze Zeit Sorgen gemacht, das werden Sie verstehen, Lieutenant. Es war am Dienstag vergangener Woche. Ich kam zufällig vorbei und dachte mir, hinterlässt ihr einen Zettel, sie soll doch am Sonntag zum Essen kommen. Alice und Jimmy hatten sich beide angesagt, mit den Kindern, und ich dachte – na ja, es war so um drei Uhr nachmittags, ich hatte natürlich nicht damit gerechnet, dass sie zu Hause ist. Aber sie war da. Sie – hat sich merkwürdig benommen. Sie wollte mich loswerden, das sah ich gleich – als erwarte sie jemanden, den ich nicht kennenlernen sollte. Denn als ich sie nach ihrer Stellung fragte, ob sie sie aufgegeben hätte, meinte sie – sie sagte, es klang recht wild und – ja, seltsam – sie sagte, oh, sie sei doch nicht so blöd und rackere sich jeden Tag acht Stunden lang ab... Mehr brachte ich nicht aus ihr heraus – sie klang – aber, wenn ich darüber nachdenke, kann ich einfach nicht glauben, dass sie wirklich schlecht war«, sagte Mrs. Ellis weinend. »Sie war so ein hübsches kleines Mädel. Oh, Jamie, sie ist doch nicht schlecht gewesen, oder?«
Zweites Kapitel
Mendoza nahm Dwyer mit und fuhr zur Mariposa Street in Hollywood. Es war zehn Uhr fünfzehn; hoffentlich war Alison gerade dabei, die Jagd nach einem Kindermädchen anzutreten. Bertha, die Haushaltshilfe, trat um zehn ihren Dienst an, und konnte die friedlich schlummernden Zwillinge im Auge behalten und die Katzen füttern... Es war doch wirklich das Letzte, sich mit den beiden herumzuärgern, wenn sie es sich leisten konnten, dafür jemand zu bezahlen.
Das Mietshaus in der Mariposa Street war alt und nicht sehr groß. Es konnte auf mindestens vierzig Jahre zurückblicken und' enthielt in zwei Stockwerken zwölf Wohnungen. Außen grober, gelber Putz, innen dunkel und nach Staub riechend. Sechs Wohnungen unten, sechs oben. Hausbriefkästen, in der Wand links von der Tür eingelassen, und auf der ersten Tür rechts war ein Messingschild mit der Aufschrift: Verwalterin angebracht.
»Hoffentlich ist sie nicht beim Einkaufen«, sagte Mendoza gähnend, als er die Klingel drückte.
Sie war nicht beim Einkaufen. Die Tür wurde Augenblicke später geöffnet und eine ältere Frau mit schwarzem, von grauen Strähnen durchzogenem Haar, das am Hinterkopf in einem strengen Knoten zusammengefasst war, starrte sie mit scharfen blauen Augen durch eine altmodische randlose Brille an.
»Ja?«
Mendoza erklärte, worum es sich handelte und zeigte seinen Ausweis vor. Die Frau trat einen Schritt zurück.
»Ermordet!«, rief sie. »Na, das ist doch die Höhe!« Ihre Stimme klang seltsam erfreut. »Da sieht man doch, dass ich nicht ins Spintisieren gekommen bin, was diese junge Dame angeht. Ich hab’ mir schon überlegt, ob ich sie rauswerfen soll. Was da so alles los war!«
»So? Wir würden sehr gerne hören, was Sie wissen, wir möchten aber auch ihre Wohnung sehen.«
»Natürlich. Um die Wahrheit zu sagen, ich bin selber schon neugierig geworden, und ich hab’ mir gedacht, das ist schließlich mein Recht, weil ich sozusagen für das ganze Haus verantwortlich bin – deswegen war ich neulich abends drüben und hab’ mich umgesehen. Mehr nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich da für ein paar Dinge ganz schön interessieren werden, meine Herren.« Ihre scharfen kleinen Augen funkelten fast; sie war maßlos interessiert. »Ja, ich wollte sie bitten, auszuziehen. Unmoralische Dinge kann ich hier nicht dulden. Mr. Bennington oben ist schon schlimm genug, aber schließlich leisten sich viele Männer Samstagabend eine Sauferei, und er will ja nur singen und herumbrüllen. Trotzdem sie war zu einem uralten Schreibtisch neben der Tür getreten und hatte in einer Schublade nach einem Schlüsselbund gesucht. Sie kam auf den Gang heraus und wählte einen Schlüssel aus. »Das ist ihre Tür, genau gegenüber. Weil ich so nah dran bin, hab’ ich sie beobachten können. Sie ist immer schon recht merkwürdig gewesen.«
»Wie lange wohnte sie hier?«, erkundigte sich Mendoza.
»Ungefähr eineinhalb Jahre. Ich misch’ mich bei den Mietern nicht ein, solange sie sich anständig aufführen, aber bei Miss Ellis hab’ ich so meine Zweifel gehabt. Keine feste Stellung, verstehen Sie? Eigentlich komisch – ein junges, alleinstehendes Mädel. Ich muss ja sagen, dass ich vor allem ein Auge auf die Männer gehabt habe, aber ich könnte nicht behaupten, dass mir da irgendetwas aufgefallen ist, Sie hat sich bei mir als Kunstgewerblerin ausgegeben, verstehen Sie, mit Heimarbeit. Na ja« – die Frau stieß ein hohes, wieherndes Lachen aus – »wie ich mich da drin umgesehen hab’, sind mir keine Künstlerfarben aufgefallen. Ein paarmal hat’s was gegeben...«
»Erzählen Sie uns davon«, sagte Mendoza. Die Wohnung war nach Art und Alter typisch: ein ordentlich großes Wohnzimmer mit beliebig verteilten, reichlich abgenutzten Möbelstücken, einer altmodischen Sitzcouch, mit blassgrünem Stoff bezogen, mit dazu passenden Sesseln, zwei Stühle mit geraden Lehnen, ein Schreibsekretär aus den zwanziger Jahren, ein abgetretener Teppich mit Blumenmuster. Durch eine Tür links erhaschte er einen Blick auf eine weißgekachelte Kochnische; die Tür auf der anderen Seite musste zum Schlafzimmer führen, von dem aus das Bad zugänglich war.
»Uff! Übrigens, ich heiße Montague, Mrs. Montague. Wenn sie wirklich ermordet worden ist, hat das bestimmt etwas mit dem Mann zu tun, der am Sonntagabend da war. Das erzählte ich Ihnen wohl am besten zuerst. Sehen Sie...«
»Sonntagabend?« Nach dem Obduktionsbericht war der Tod am Sonntag zwischen Mittag und Mitternacht eingetreten.
Mrs. Montague nickte gewichtig.
»Ich hab’ sie – die Ellis – am Vormittag so um zehn Uhr Weggehen sehen. Ich hab’ noch drüber nachgedacht und mir vorgenommen, dass ich sie abfange, wenn sie zurückkommt, und ihr sag’, dass sie ausziehen soll. Bis zum Letzten ist ja nicht mehr weit hin. Drum hab’ ich immer wieder hinausgehorcht, ob sie schon zurückkommt. Und so gegen halb neun am Abend hör’ ich jemand ins Haus kommen und zu der Tür da drüben gehen, und ich geh’ hinaus – dabei war’s gar nicht Miss Ellis, sondern ein Mann. Ich hab’ ihn nicht gekannt... Tja, ich weiß nicht, ob ich ihn wiedererkennen würde, im Korridor ist es ziemlich dunkel und ich hab’ ihn nur ganz kurz gesehen. Aber er hat einen Schlüssel gehabt – das ist mir aufgefallen. An einem Schlüsselbund. Und es war auch der richtige Schlüssel, weil er die Tür schon aufgesperrt hatte.«
»Sehr interessant.« Durchaus sogar. Der Mörder? Vermutlich hatte er Valerie Ellis Handtasche bei sich gehabt.
»Na, ich wollte ihn fragen, was er da treibt und wo Miss Ellis ist, aber ich bin gar nicht dazugekommen. So wie der sich aufgeführt hat, muss ich ihm einen schönen Schreck eingejagt haben. Er stand mit dem Rücken zu mir, verstehen Sie, und hatte die Tür gerade aufgesperrt gehabt, als ich ihn ansprach. Ich hab’ noch keine drei Worte herausgebracht, da ist er schon davongeflitzt wie eine Katze, der man auf den Schwanz getreten ist. Jetzt stelle ich mir’s natürlich so vor, dass er Angst gehabt hat, ich könnt’ ihn genau sehen und nachher eine Beschreibung geben. Jedenfalls ist er sofort zum Haus hinausgestürmt, und die Schlüssel hat er fallenlassen. Das sind sie, mir gehören sie nicht. Glauben Sie, dass es Miss Ellis’ Schlüssel sind?«
»Leicht möglich.« Mendoza war angenehm berührt. So etwas nannte man Glück. X, der hier auftrat, um ihre Wohnung zu durchsuchen und festzustellen, ob dort irgendetwas Belastendes gegen ihn aufbewahrt wurde, wurde aber in letzter Minute daran gehindert. Wie musste er sich verflucht haben, dass er die Schlüssel verloren hatte... Wenn es irgendeine Spur gab, war sie also noch vorhanden – Geistesabwesend streifte sein Blick das neue Fernsehgerät in einer Ecke. Riesengroßer Bildschirm.
»Sprechen Sie ruhig weiter«, sagte er zu der Hausverwalterin, »ich höre zu.«
Er ging hinüber und schaltete den Apparat ein.
»Na ja, Sie verstehen, so, wie Miss Ellis immer war, hat mich das nicht besonders überrascht. Warum ich nichts unternommen hab’? Ich hab’ doch nicht wissen können, dass man sie ermordet hat. Wenn ich gesagt hab’, dass es etwas gegeben hat, dann meine ich damit nichts Bestimmtes, sondern – es war einfach komisch. Dass sie keine feste Stellung hatte und so weiter. Von wegen Kunstgewerbe! Mir haben auch nicht alle Leute gefallen, die sie besucht haben. Ein paar Männer, und noch so ein Weibsbild – Maureen hat Miss Ellis sie genannt – die taugt bestimmt nichts. Mordsmäßig aufgedonnert.«
Dwyer war im Schlafzimmer verschwunden. Mendoza starrte auf den Bildschirm, und Mrs. Montague schnaufte verächtlich durch die Nase.
»Wenn sie auch angeblich zu Hause gearbeitet hat, sie war fast nie da. Sie ging oft weg – aber nicht immer zur selben Zeit. Sie war fast jeden Abend fort, wenn sie nicht gerade Besuch gehabt hat. Ich hab’ sie kommen und gehen hören, wissen Sie. Und dann ist sie auch immer weggefahren.«
»Weggefahren?« Es war ein Farbfernsehgerät, ein sehr teures Modell. Um die siebenhundert Dollar, dachte Mendoza. Er schaltete das Gerät ab.
»Sicher. Mitten drin war sie weg und ist zwei oder drei Tage fortgeblieben. Das ist ziemlich oft vorgekommen. Aber nicht in regelmäßigen Abständen, nein, Sir.«
»Was Sie nicht sagen. Haben Sie mit ihr einmal darüber gesprochen?«
»Ja. Das ist doch nur natürlich, oder? Aber sie ist gleich wütend geworden, hat mich eine alte, neugierige Schachtel genannt und gesagt, ich soll mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern.« Mrs. Montague schnaubte wieder. »Ein recht freches Ding... ich glaub’, dass einer von den Männern, die sie besucht haben, ihr fester Freund war, aber bestimmt weiß ich es nicht. Sehr oft sind immer diese zwei gemeinsam gekommen. Und das war auch komisch. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber einmal bin ich zufällig weggegangen, wie sie ins Haus kamen, und ich hab’ sie sagen hören, grüß dich, Paul. Der eine« – sie starrte Mendoza nachdenklich an – »sieht Ihnen tatsächlich ein bisschen ähnlich, Sir. Der andere ist größer und blond. Und abgesehen von dieser Maureen – sie war sehr oft da – war noch eine, eine Silberblonde, öfter hier, aber sie war derselbe Typ wie diese Maureen. Manchmal haben sie gefeiert und Lärm gemacht, wenn sie gesoffen haben. Ich hab’ ein paarmal an die Tür klopfen müssen. Na ja, wie gesagt, es war alles ziemlich komisch, und nachdem am Sonntagabend der fremde Kerl hier gewesen ist, dachte ich, dass ich ein Recht hab’, mich umzusehen. Und dann hab’ ich mir erst recht vorgenommen, sie ’rauszuwerfen...«
Sie hätte wieder von vorne angefangen, aber Mendoza schob sie hinaus. Auf der Schwelle lächelte sie maliziös und sagte: »Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich für ein paar Sachen recht interessieren.«
»Das glaub’ ich auch, Lieutenant«, sagte Dwyer von der Schlafzimmertür her, als die Wohnungstür ins Schloss fiel. »Wie sie sich auch ihr Brot verdient hat, sie hat sich allerhand leisten können.«
Das Mobiliar des Schlafzimmers war genauso abgenützt und alt, wie das im Wohnzimmer; eben das Übliche – billiges Doppelbett aus furniertem Holz mit durchgelegener Matratze, eine alte, lackierte Kommode, von der die Farbe abblätterte; ein gerader, lackierter Holzstuhl, ein alter Teppich, der für den Raum zu klein war. Dwyer steckte das Mundstück seiner kalten Pfeife in den Spalt der Schranktür und drückte sie auf.
»Wie Sie das immer ausdrücken, Lieutenant, considerar.«
»Gehen Sie vielleicht auch in die Abendschule? Ja, ich sehe schon, was Sie meinen.«
Der Kleiderschrank in diesem schäbigen Zimmer war vollgepfropft. Aber nicht mit den Sachen, die sich eine frühere Verkäuferin leisten konnte. Er nahm wahllos einen der Bügel heraus. Und, de paso, offenbar hatte sie die Ellises angelogen – zumindest, was den Posten im Restaurant anging. Soviel Mrs. Montague das beurteilen konnte, hatte sie schon seit eineinhalb Jahren keine feste Stellung gehabt. Das Etikett in diesem Abendkleid aus blauem Chiffon trug den Namen des sündteuren Luxusladens bei Robinson, Er erkannte es, weil er einmal in demselben Geschäft entsetzt, aber zu beschämt, um es zu zeigen, fünfzig Dollar für ein ganz einfaches Hauskleid für Alison bezahlt hatte.
Es gab Kostüme, Tageskleider, Schuhe haufenweise. In den breiten Schubladen der alten Kommode stapelte sich die teure Unterwäsche. Auf dem Frisiertisch im Badezimmer eine große Sammlung teurer Kosmetika, Cremes, Lotions, Badesalze.
»Meinen Sie, dass sie vielleicht eine gute Fee zu Besuch gehabt hat?«, sagte Dwyer ernsthaft.
»Beachtliche Leistung ohne Gehaltstüte.«
»Oder vielleicht einen Prinzen?«
»Möglich«, sagte Mendoza, »möglich... Die Leute vom Spurensicherungsdienst müssen ja bald da sein. Wird ja interessant werden, was die finden. Aber...«, er überlegte und rief sich das Gesicht der loten ins Gedächtnis. Lebendig und beseelt musste sie gut ausgesehen haben. Nicht hübsch. Anklang ans Skandinavische – ausgeprägte Backenknochen, breiter Mund, hochgewölbte Brauen. Gelblichblond, nicht gebleicht. Er stellte sich das Gesicht lebendig vor und sah, dass es keine Bedenken kannte. Ungezügelt hatten James Ellis und seine Frau gesagt.
Geistesabwesend meinte er: »Stimmt ja wirklich, dineros son calidad – Geld spricht.« Sie war mit Geld aufgewachsen – hatte nie sparen müssen. Alles, was sie wollte, hatten die Ellises gesagt. Und verwöhnt. Und dann, mit einem Schlag, kein Geld – auf eigenen Füßen – als Verkäuferin tätig. Den ganzen Tag andere Frauen sehen – Frauen ohne ihre Jugend, ohne ihr Äußeres – die sich alle die schonen Sachen kauften, die es für sie nicht mehr gab. Vor vier Jahren. Im Strafregister nachsehen, aber offenbar bis vor eineinhalb Jahren hatte sie nichts angestellt. Durfte man wirklich davon ausgehen? Hatte sie überhaupt in der Schwarzen Katze gearbeitet?
Er schleuderte ins Wohnzimmer. Das illegal verdiente Geld hatte sie für hübsche Sachen ausgegeben, ohne sich an ihrer Umgebung zu stören; sie war sicher kein häuslicher Typ gewesen. Vielleicht wäre die teure Wohnung als nächstes gekommen.
»Haben Sie eine Idee?«, fragte Dwyer, der ihn beobachtet hatte.
»Eine winzig kleine«, meinte Mendoza versonnen. »Leute, die sich ermorden lassen, bei denen ist, allgemein gesprochen, der Charakter mit im Spiel... das Durcheinander im Schrank, die Unterwäsche wahllos in die Schubladen geworfen, nicht zusammengefaltet, keine Schuhspanner...«
»Da komm’ ich nicht mit«, sagte Jim Dwyer.
»Sie hat wahllos zugegriffen«, meinte er geistesabwesend. »Sie war begierig auf alle Dinge, die sie einmal gehabt und dann verloren hatte. Sie kaufte, was sie sah – sobald das Geld da war. Nachher kümmerte sie sich nicht mehr darum. Sie musste die Sachen einfach besitzen. Sie war nachlässig – impulsiv. Eineinhalb Jahre... ja, vielleicht wäre als nächstes ein teures Appartement dran gewesen. Und – verdammt, ich hätte diese Mrs. Montague wegen der Garagen fragen sollen – vielleicht gibt es hinter dem Haus ein paar. Was Valerie wohl gefahren hat? Und wo, zum Teufel, bleiben Marx und Horder? Ich möcht’ mich hier gründlich umsehen, aber das kann ich erst – kümmern Sie sich um die Garage, Bert, stellen Sie fest, welche sie gemietet hat und ob ihr Wagen da ist. Wenn nicht, erkundigen Sie sich bei der Montague, was für ein Fahrzeug sie sich geleistet hat.«
Er ging hinaus zu seinem Ferrari und benützte das Autotelefon, um sein Büro anzurufen.
»Sie kommen schon«, sagte Sergeant Lake beruhigend. »Ich glaube, sie sind eben weggegangen, Lieutenant.«
Er ging um das Gebäude herum, wo Dwyer mit einem geliehenen Schlüsselbund am Vorhängeschloss der ersten einer Reihe von alten Holzgaragen herumarbeitete.
»Es könnte ja sein, dass da irgendwo ein Fingerabdruck dran war«, meinte er ruhig.
»Da haben schon zu viele dran herumgefummelt«, meinte Dwyer zu seiner Entschuldigung. »Die Montague sagt, dass die Ellis ein Dodge Cabriolet, Baujahr ‘59, zweitürig, weißlackiert, gehabt hat. Blödes Ding!« Aber der Schlüssel drehte sich endlich, und das Tor ging auf. Sie starrten das weiße Dodge Cabriolet an.