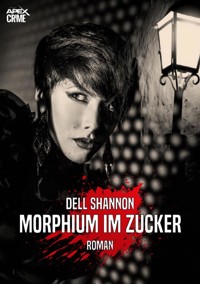
6,99 €
Mehr erfahren.
Ein Mann schleicht nachts durch dunkle Straßen... Er hat nur einen einzigen Gedanken: Hass!
Wen hasst er? Und aus welchem Grund? Der Mann weiß es nicht. Aber das eine weiß er: »Ich muss töten...!«
Lieutenant Mendoza von der Kriminalpolizei in Los Angeles steht vor einem Rätsel. In zehn Tagen vier Morde - alle offenbar ohne jegliches Motiv. Und das ist erst der Anfang...
Dell Shannon war eines der Pseudonyme der US-amerikanischen Schriftstellerin Barbara 'Elizabeth' Linnington (* 11. März 1921; † 5. April 1988). Sie schrieb außerdem unter den Pseudonymen Anne Blaisdell und Lesley Egan.
Der Roman Morphium im Zucker erschien erstmals im Jahr 1964; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1965.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DELL SHANNON
Morphium im Zucker
Roman
Apex Crime, Band 141
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
MORPHIUM IM ZUCKER
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Das Buch
Ein Mann schleicht nachts durch dunkle Straßen... Er hat nur einen einzigen Gedanken: Hass!
Wen hasst er? Und aus welchem Grund? Der Mann weiß es nicht. Aber das eine weiß er: »Ich muss töten...!«
Lieutenant Mendoza von der Kriminalpolizei in Los Angeles steht vor einem Rätsel. In zehn Tagen vier Morde - alle offenbar ohne jegliches Motiv. Und das ist erst der Anfang...
Dell Shannon war eines der Pseudonyme der US-amerikanischen Schriftstellerin Barbara 'Elizabeth' Linnington (* 11. März 1921; † 5. April 1988). Sie schrieb außerdem unter den Pseudonymen Anne Blaisdell und Lesley Egan.
Der Roman Morphium im Zucker erschien erstmals im Jahr 1964; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1965.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
MORPHIUM IM ZUCKER
Erstes Kapitel
»Einfach großartig«, sagte Alison, »dass man so ohne weiteres verreisen kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Máiri ist wirklich ein Goldstück. Was sagst du zu dem herrlichen Wetter?«
Sie richtete sich im Liegestuhl auf und sog gewissenhaft mit tiefen Atemzügen die frische Seeluft ein.
»Du machst dir ja doch Gedanken, weil in Norfolk keine Post für uns da war«, brummte Mendoza.
»Ganz und gar nicht«, meinte Alison. »Sie war eben nicht überzeugt, dass uns die Post dort erreicht und wird direkt ans Hotel auf den Bermudas schreiben.«
Mendoza gab nur einen Knurrlaut von sich.
»Schau dir doch wenigstens das Meer an oder... Seinen Urlaub soll man genießen!«
»Ich weiß, ich weiß«, erwiderte Mendoza ungeduldig. Er richtete sich auf, warf einen Blick auf den in der Julisonne glitzernden Atlantik, sagte beiläufig: »Qué bello!« und ließ sich wieder zurücksinken. »Wenn das Schiff nur nicht so langsam wäre! Vielleicht erwische ich eine Los Angeles Times auf den Bermudas.«
»Dabei bist du schon jahrelang nicht mehr in Urlaub gewesen«, fuhr Alison unbeirrt fort. »Jedes Mal, wenn du dir ein paar Tage freigenommen hattest, bist du mit irgendeiner Ausrede dahergekommen, hast dich im Büro herumgetrieben und überhaupt keine richtige Erholung gehabt. Das ist einfach albern...«
Mendoza drehte sich lässig auf die Seite und sah sie an, von ihrem zerzausten, schimmernden roten Haar bis zu den frechen grünen Sandalen, die im Farbton genau zu dem ärmellosen Leinenkleid passten.
»Es kommt einfach immer was dazwischen«, meinte er. »Aber du hast es ja schließlich fertiggebracht, mich zu verschleppen, querida.«
»Du könntest wenigstens ein bisschen mehr Spaß dran haben, mehr verlange ich gar nicht«, sagte Alison.
»Das tu ich, das tu ich.« Mendoza richtete sich auf und sah einem Mann nach, der gerade das Deck überquerte. »Na so was«, sagte er.
».Was ist denn?«
»Der Kerl sieht aus wie Benny Metzer. Wir haben erfahren, dass er jetzt auf den Vergnügungsdampfern arbeitet, seit wir ihm zu Hause das Handwerk gelegt haben. Ich will bloß mal schnell...«
»Du bleibst gefälligst liegen«, sagte Alison mit Entschiedenheit, »und lässt dir den Seewind ins Gesicht blasen. Man möchte meinen, du bist nur mit deinem Beruf verheiratet!«
Sie legte den Kopf auf die Seite und sah ihn an.
»Was ist denn los, Luis? In New York hat es dir doch gefallen. Seit wir auf dem Schiff sind, bist du die ganze Zeit - nervös. Seekrank kannst du nicht sein; sonst hätte es dich längst erwischt.«
»Herrgott noch mal«, sagte Mendoza, »es sind halt doch - drei Wochen. Ich weiß überhaupt nicht, was sich tut. Wenn ich nur erfahren könnte, ob Art mit dieser Leiche im Hotel weitergekommen ist. Eine ganz faule Sache. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich nicht hier sein dürfte, dass irgendetwas vorgeht...«
»Qué disparate!«, rief Alison lachend. »Ich weiß auch genau warum. Du bist nicht telepathisch veranlagt, sondern nur davon überzeugt, dass bei der Kriminalpolizei in Los Angeles nichts klappt, wenn du nicht in deinem Büro sitzt. Nichts als Einbildung!«
Unwillkürlich musste er lachen.
»Vielleicht hast du recht. Aber...«
Er stand auf. Mit Hose und Sporthemd kam er sich halb nackt vor. Er lief nicht gern ohne Krawatte und Jackett herum.
»Ich gehe spazieren«, verkündete er. »Hier wird man ja gemästet... Um Gottes willen! Nichts wie weg hier, da kommen sie schon wieder. Die Kitcheners.«
Alison kicherte.
»Zu komisch, wenn man dir zusieht, wie du Evadne ausweichst.«
Mendoza erklärte sich mit kurzen Worten für die Anwendung der Prügelstrafe bei Ehefrauen und ergriff die Flucht. Alison musste den Überfall der Kitcheners allein über sich ergehen lassen. Evadne Kitchener hatte sich mit ihrem dicklichen, kleinen Mann seit der Abfahrt an die Mendozas angeschlossen; sie behauptete, Mendoza als einen berühmten Schauspieler erkannt zu haben, der inkognito reise, und verfolgte ihn dauernd mit ihrem affektierten Lächeln, während ihr Mann Alison erzählte, wie lebenslustig die liebe Evadne sei.
»Ist Ihr charmanter Gatte nicht da?«, rief sie jetzt fröhlich. »So eine Enttäuschung! Hoffentlich gibt er sich nicht mit der ordinären Blondine an Ihrem Tisch ab. Ich habe langsam das Gefühl...«
»Er denkt die ganze Zeit darüber nach, wieviel Mörder er verhaften könnte statt hier herumzusitzen«, sagte Alison ernsthaft.
Evadne kreischte belustigt auf.
»Immer diese Witzchen! Gibt sich als Polizist aus, obwohl wir beide genau wissen, was der Gute in Wirklichkeit ist - aber wir verraten Sie nicht! Es ist viel zu aufregend...«
Mendoza wanderte missgestimmt über das Deck, ohne der funkelnden See einen Blick zu schenken. Er fragte sich, wie Art mit den Ermittlungen in dem bewussten Mordfall vorangekommen war. Und dann war ja auch noch dieses Eisenbahnunglück. Der Lokomotivführer hatte sehr schnell reagiert und das Schlimmste verhüten können. Niemand war ums Leben gekommen, aber eines stand fest: die Weiche war mit Absicht verstellt worden, und sie mussten aufklären, wer dafür verantwortlich war. Man hatte Fingerabdrücke sichern können, die aber im Archiv nicht registriert waren.
Na ja, Alison hatte wahrscheinlich ganz recht. Andere Leute gingen auch in Urlaub, niemand war unersetzlich. Aber seit er an Bord dieses blöden Schiffes gegangen war, hatte er das merkwürdige Gefühl, man brauche ihn zu Hause, irgendetwas Großes sei im Gange, so dass er kein Recht habe, auf der faulen Haut zu liegen und sich auf den Bermudas zu sonnen. Trottel, beschimpfte er sich, an der Reling stehend und sehnsüchtige Blicke in jene Richtung werfend, wo New York zu suchen war. Er hatte einfach Heimweh. Er wollte in seinem Büro sitzen, wo er hingehörte, wollte einen anständigen Anzug tragen, mit Hackett und seinen anderen Sergeants die neuesten Fälle besprechen. Entscheidungen treffen.
Was die übel zugerichtete Leiche in dem Hotelzimmer in der 3. Straße anging, so hatte man nicht allzu viel feststellen können. Der Arzt meinte zwar, als Tatwaffe käme ein ganz bestimmtes Messer in Frage, aber.... Die New Yorker Zeitungen brachten leider kaum Nachrichten von der Westküste, wenn es sich nicht gerade um eine nationale Katastrophe handelte. Morgen würden sie auf den Bermudas sein. Vielleicht hatte Art Zeit gehabt, ihnen ein paar Zeilen zu schreiben. Vielleicht gab es irgendwo eine Los Angeles Times.
Da vorne tauchten auch schon die Kitcheners auf, Alison zwischen sich. Sie wollten ihn sicher in die Bar schleppen. Mendoza überließ Alison ihrem Schicksal, tat so, als habe er die drei nicht gesehen, und hastete eine kleine Kajüt-Treppe hinunter. Sie führte zu einem der großen Salons: Mendoza suchte dort Unterschlupf.
Beinahe sofort fühlte er sich wohler. Hier saßen fast nur Männer beim Kartenspiel; in einer Ecke nahm der Mann, der wie Benny Metzer aussah, gerade mit vier anderen an einem Tisch Platz. Mendoza schlenderte hinüber. Der flache Hinterkopf, die hochgestellte linke Schulter, die fehlenden Ohrläppchen... klar war das Benny. In einem ganz teuren Sportanzug. Mendoza blieb in einiger Entfernung stehen und sah voll Bewunderung zu, als Benny, während er sich lebhaft mit seinen Begleitern unterhielt, die auf dem Tisch liegenden Spielkarten verschwinden ließ und sie durch ein mitgebrachtes Päckchen ersetzte. Während ein anderer abhob, trat Mendoza an den Tisch und schlug Benny auf die Schulter.
»Na so ein Zufall, alter Freund!«, sagte er mit übergroßer Herzlichkeit. »Stellen Sie mich doch vor und lassen Sie mich mittun. Ich hab’ grade Lust auf ein Spielchen!«
Benny zeigte die Zähne, als er ihn erkannte, einen Arm des Gesetzes, der hier nichts zu suchen hatte.
»Ich - klar, alter Freund«, sagte er gepresst. »Ich - meine Herren, darf ich Ihnen vorstellen...«
Ein wohlhabend aussehender, älterer Mann, der eine Vorliebe für farbenfrohe Kleidung zu haben schien, erklärte, alle Freunde Mr. Johnsons seien willkommen. Mendoza bedankte sich, beugte sich über Benny und zog das unpräparierte Spiel aus Bennys spezialgeschneiderter Jackettasche, während er hinzufügte: »Wir haben uns wirklich lange Zeit nicht mehr gesehen.«
Benny spürte die Hand in seiner Tasche und wand sich- in hilflosem Zorn. Mendoza zog sich einen Stuhl heran, nahm am Tisch Platz, ergriff die präparierten Karten und sagte: »Noch mal von vorn, meine Herren, wer hebt ab?« Er legte das unmarkierte Spiel vor seinem Nachbarn auf den Tisch und lächelte Benny an. Die anderen machten den Eindruck, als könnten sie sich einen kleinen Verlust leisten, und Benny Geld abzunehmen, konnte nur Spaß machen.
Er sah sich seine Karten an und überlegte, was wohl zu Hause im Büro gerade vorging.
Hackett kam ins Büro, stellte einen Pappkarton auf Sergeant Lakes Schreibtisch und meinte: »Bringen Sie doch das bitte gleich ins Labor rauf. Wenn nur Luis hier wäre. Vielleicht kämen wir dann endlich weiter.«
Lake sah ihn an und sagte: »Erzählen Sie mir bloß nicht...«
»Genau«, sagte Hackett. »Scheint derselbe zu sein. Vier in zehn Tagen. In den Zeitungen haben sie jetzt endlich einen Namen für ihn gefunden. Der Aufschlitzer. Stadt in Angst - etc. . Bei dem neuesten Opfer hat er offenbar wieder dasselbe Messer verwendet. Erkundigen Sie sich bei Bainbridge, aber für mich gibt es kaum Zweifel.«
»Mensch«, sagte Lake, »wieder eine Frau?«
Hackett schüttelte den Kopf.
»Ein vierzehnjähriger mexikanischer Junge. Ein braver Kerl, wenn man die Leute so hört. Auf dem Nachhauseweg von einem Pfadfindertreff en.«
»Mein Gott«, sagte Lake. »Ausgerechnet. Gerade ist eine neue Meldung gekommen.«
»Verdammt«, sagte Hackett. »Was war los?«
Lake blätterte in den Papieren auf seinem Schreibtisch.
»Der Anruf ist eben gekommen, von einem Streifenwagen. Ich wollte Palliser den Fall geben, weil sonst niemand da ist, aber - Ein Mann, tot in seiner Praxis aufgefunden. Ein Arzt, glaube ich. Erschossen. Man hat ihn gerade gefunden, drüben am Wilshire Boulevard.«
Hackett schrieb sich die Anschrift auf.
»Haben Sie einen Arzt hingeschickt und alles veranlasst?«
»Ja, gerade bevor Sie hereingekommen sind. Bainbridge und Marx und Horder zur Spurensicherung, außerdem Scarne.«
»Okay.« Hackett warf einen Blick in das Sergeant-Zimmer, in dem nur Palliser saß. Sein Schreibtisch war mit Akten übersät, und er studierte mit düsterer Miene ein Protokoll.
»Machen Sie mal Pause«, sagte Hackett. »Sehen Sie sich eine andere Leiche mit mir an. Ich muss die Sache wahrscheinlich an Sie abgeben, also ist es besser, wenn Sie von Anfang an dabei sind.«
Palliser hatte nichts einzuwenden.
»Mit dem Eisenbahnunglück kommen wir bestimmt nicht weiter«, prophezeite er, während sie zum Lift gingen. »Die Fingerabdrücke am Weichenhebel nützen uns gar nichts.«
»Sieht schlecht aus, was? Worauf haben Sie sich denn konzentriert?«
»Auf alles«, sagte Palliser mürrisch. »Wir haben ungefähr hundertfünfzig Fingerabdrücke von allen möglichen Verdächtigen genommen, aber keine Übereinstimmung gefunden, und es handelt sich sowieso nur um Leute, die bei der Southern Pacific oder irgendeiner anderen Eisenbahngesellschaft rausgeflogen sind. Das heißt noch lange nicht...«
Aber es war wichtig, den Täter zu ermitteln, dachte Hackett. Es hätte eine furchtbare Katastrophe geben können.
»Die Person, die gerade, als der Zug die Sun Valley-Kreuzung erreichte, den Weichenhebel betätigte, hatte offenbar damit gerechnet, dass der Zug auf ein kurzes Nebengeleis geraten und gegen die Rückwand einer Chemiefabrik prallen würde. Dank der schnellen Reaktion des Lokomotivführers, der die falsche Weichenstellung früh erkannt und sofort die Bremsen gezogen hatte, war der Zug noch vor dem Ende des Nebengeleises zum Stehen gekommen - vier Waggons hatten sich ineinandergeschoben, die Lokomotive war entgleist, und es hatte eine Reihe von Leichtverletzten gegeben.
Eine Person, die einmal bei der Eisenbahn gearbeitet hatte und sich in der Bedienung von Weichen auskannte... Das Schlimmste war natürlich, dass der Täter an Ort und Stelle gewesen sein musste, weil die Weiche zwanzig Minuten vorher für einen Güterzug, der ein paar Wagen abzuhängen hatte, in Betrieb genommen worden war. Der Bahnwärter hatte nichts gesehen, und bei dem Durcheinander nachher... Sie hatten die gesamten Unterlagen der örtlichen Eisenbahngesellschaften über frühere Angestellte durchgeackert und sich vor allem auf die Southern Pacific konzentriert, aber bisher ohne Erfolg.«
»Man kann sich ja ausrechnen, dass jetzt allerhand los ist«, sagte Hackett. »Im Sommer steigt die Ziffer immer.«
Und das galt seltsamerweise nicht nur' für Mordfälle, sondern auch für andere Verbrechen.
Sie fuhren hinüber zum Wilshire Boulevard, zu einem hübschen, kleinen Haus, das noch ziemlich neu aussah und grau gestrichen war. An einem schmiedeeisernen Pfosten am Gehsteig hing ein Schild: Dr. Francis Nestor, Chiropraktik.
Ein Streifenwagen war vor dem Haus geparkt, dahinter stand Dr. Bainbridges alter Chevrolet.
Die weißlackierte Eingangstür stand offen. Sie traten ein. Das Wartezimmer war sehr modern eingerichtet; grauer Teppich, eine niedrige, türkisfarbene Sitzbank, schwarze mit Kunststoff überzogene Stühle, eines jener modernen Gemälde, die nach Hacketts Meinung aus dem Kindergarten stammten. Auf der Bank saß eine Frau; sie wirkte benommen und ein wenig verängstigt.
»Aber das ist doch ganz unmöglich«, sagte sie kopfschüttelnd. »Frank ist tot. Ganz plötzlich. Einfach so.«
Der große, uniformierte Polizist neben ihr kam zu Hackett herüber, der sich und Palliser vorstellte.
»Gut, dass Sie hier sind, Sir. Ich heiße Bronson - ich muss wieder weiter. Das ist übrigens die Ehefrau. Tja, also es war so: dieser Mann - der Chiropraktiker - hatte gestern Abend einen Patienten herbestellt. Er hätte spätestens um Mitternacht zu Hause sein müssen, aber er blieb aus. Mrs. Nestor wird wahrscheinlich wach geblieben sein und sich Sorgen gemacht haben, vielleicht ist er ab und zu seine eigenen Wege gegangen, und sie dachte - na ja, jedenfalls hat sie sich erst vor einer Stunde entschlossen, etwas zu unternehmen. Sie fuhr hierher zu seiner Praxis. Die Eingangstür war abgesperrt, sie ging zum Seiteneingang und sah, dass die Tür aufgebrochen worden war. Sie hatte Angst, allein hineinzugehen, deshalb rief sie bei uns an, und ich wurde hergeschickt. Ja, und ich hab’ ihn gefunden, man hat ihn erschossen - eine Waffe ist nirgends zu sehen, deshalb...«
»Gut«, sagte Hackett. »Das wär’s? Warten Sie noch einen Augenblick. Zeigen Sie mir die Tür.« Er ging zu der Frau hinüber. »Mrs. Nestor?«
Sie hob den Kopf.
»Ja.«
»Wir sind von der Mordkommission. Wir wollen Ihnen ein paar Fragen stellen, aber erst später. Wollen Sie hierbleiben oder lieber nach Hause fahren?«
»Oh«, sagte sie. »Selbstverständlich. Nein, es ist schon in Ordnung, ich warte. Ich kann es nur immer noch nicht fassen. Es war einfach zu plötzlich.«
Mrs. Nestor war Anfang Dreißig, schätzte er, mit einem Durchschnittsgesicht; nicht übermäßig hübsch. Das Haar war von stumpfem Rotblond und in einer zu jugendlichen Frisur um ihr schmales, blasses Gesicht gelegt; sie trug wenig Make-up und hatte ein einfaches, sauberes, blaues Kleid an, keine Strümpfe, braune Schuhe und weiße Söckchen. Sie schien nicht geweint zu haben.
Der Polizist führte ihn durch die rückwärtige Tür hinaus in einen Vorraum mit mehreren Ausgängen.
»Hier herüber, Sir.«
Der Nebenausgang befand sich an der rechten Seite des Gebäudes. Die Tür war aufgebrochen, auf primitive Weise, vielleicht mit einer Stange oder auch mit einem Brecheisen. Das Haus stand zwischen zwei wesentlich größeren Gebäuden; auf dieser Seite, nur durch einen kleinen Parkplatz getrennt, stand ein großes Bürohaus. Dort würde sich nachts kaum jemand aufhalten.
Hackett seufzte.
»Okay, Sie fahren wohl am besten wieder weiter.«
Er ging wieder zurück zum Vorraum und erreichte, vorbei an zwei offenstehenden Untersuchungszimmern, das Arbeitszimmer, in dem sich ein Nussbaumschreibtisch mit Glasplatte, ein gepolsterter Drehstuhl, ein Bücherschrank und ein paar Sessel befanden. Der Boden war mit marmoriertem Kunststoff auslegt. Das ganze Haus und die Zimmer, die sie gesehen hatten, verrieten Wohlhabenheit. Dr. Nestor hatte sich offenbar einer sehr gutgehenden Praxis erfreuen dürfen.
»Wie sieht’s aus?«, fragte Hackett.!
Im Arbeitszimmer bemühten sich mehrere Männer, einander auszuweichen und keine Spuren zu verwischen, während sie ihrer Arbeit nachgingen. Dr. Bainbridge kauerte vor der Leiche. Scarne machte Blitzlichtaufnahmen. Marx sicherte Fingerabdrücke auf der Glasplatte, und Horder tat das gleiche an der Tür.
Bainbridge hob gereizt den Kopf.
»Ich bin gerade erst gekommen. Sie sehen doch, dass er erschossen worden ist. Wahrscheinlich Kleinkaliber. Bis die Obduktion durchgeführt ist, würde ich. sagen, grob geschätzt, zwischen - na ja, zwölf und sechzehn Stunden.«
Hackett schaute auf die Uhr.
»Das wäre zwischen acht und zwölf gestern Abend gewesen.«
Er beugte sich über die Leiche. Frank Nestor war ungefähr fünfunddreißig Jahre alt gewesen. Hackett fiel auf, dass er nicht ganz zu der einfachen, blassen Frau draußen im Wartezimmer gepasst hatte. Man sah auf den ersten Blick, dass Nestor ein sehr gut aussehender Mann gewesen war, ein Herzensbrecher, wie man das wohl nannte, nicht übermäßig groß, aber mit gutgeschnittenen, regelmäßigen Gesichtszügen, einem schmalen, schwarzen Schnurrbart und gewelltem, dunklem Haar. Er war auffällig gut gekleidet, beige Flanellhose, teures braunes Sportsakko, weißes Hemd, beige Seidenkrawatte mit braunem Muster; dazu eine goldene Krawattennadel mit einem Kopf aus geschnitztem Jade. Er lag auf dem Rücken vor dem Schreibtisch, beinahe parallel zu diesem. Ein Arm, der linke, war ausgestreckt und im Ellbogengelenk verdreht, so dass der Handrücken nach oben zeigte. Am Kleinfinger steckte ein schwerer, goldener Ring mit einem schwarzen Sternsaphir. Der andere Arm lag auf der Brust, die rechte Hand war zur Faust geballt.
Die Stirn zeigte ein kleines, kreisrundes Einschussloch. Bainbridge hatte recht, wahrscheinlich Kleinkaliber.
Marx sah auf und sagte: »Sieht eigentlich unkompliziert aus, Sergeant. Ein Einbruch, und der Kerl hat nicht damit gerechnet, dass jemand hier ist. Wir haben eine Stahlkassette gefunden. Seine Frau sagt, dass er Bargeld darin auf bewahrt hat.«
»Aha«, sagte Hackett. Die Kassette war offenbar in der linken oberen Schreibtischschublade aufbewahrt worden; diese stand offen, und die Kassette lag in der Nähe der Leiche. Der Deckel war aufgeklappt, und ein Schlüssel steckte im Schloss, an einem Ring zusammen mit anderen.
»Sein Wagen steht draußen auf dem Parkplatz«, meinte Marx.
Genauso sah es aus. Ein ganz simpler Einbruch. Der Verbrecher war auf Nestor gestoßen und hatte zum Revolver gegriffen, dann alles durchsucht, mit Nestors Schlüssel die Kassette geöffnet und die Flucht ergriffen. Aber andererseits musste man natürlich alle Möglichkeiten bedenken. Vielleicht hatte man dafür gesorgt, dass es so aussehen sollte.
Nestor war ein gut aussehender, sportlich wirkender Mann gewesen. Erfolg bei den Frauen? Seine Kleidung und Praxis wiesen ihn als wohlhabenden Arzt aus. Die einfache Frau draußen im Wartezimmer entsprach nicht dem Typ, den man sich als Ehefrau Nestors vorstellte. Vermutlich würde man bei näherer Betrachtung feststellen, dass er seine eigenen Wege gegangen war. Und vielleicht hatte sie die Eifersucht dazu getrieben... Oder irgendein betrogener Ehemann hatte keine andere Möglichkeit mehr gesehen... Man musste alles bedenken.
»Na schön«, sagte er. »John, vielleicht kümmern Sie sich inzwischen um den Schreibtisch, während ich Mrs. Nestor ein paar Fragen stelle.«
Zweites Kapitel
»Fühlen Sie sich imstande, einige Fragen zu beantworten, Mrs. Nestor?«
Hackett nahm ihr gegenüber Platz und zog sein Notizbuch aus der Tasche.
»Oh, ja«, sagte sie gehorsam. »Es war natürlich ein großer Schock für mich, weil es so plötzlich kam. Ich kann es immer noch nicht fassen.«
Ihre Augen waren grünlich-braun, seltsam trüb. Aber sie hatte wohl nicht geweint, dachte er. Das bewies allerdings nichts; bei manchen Leuten kamen die Tränen nicht so schnell.
»Ihr Mann scheint sehr viel Erfolg gehabt zu haben.«
Sie sah sich im Wartezimmer um.
»Oh, ja, das stimmt. Die Leute fanden ihn wohl sympathisch. Er machte einen sehr guten Eindruck und konnte überaus charmant sein. Er hat immer gesagt, er wüsste, dass er Erfolg haben wird. Er wollte unbedingt Arzt werden - ein richtiger Arzt, meine ich -, aber das Studium dauerte nicht so lange und war auch nicht so teuer. Ganz billig ist es freilich auch nicht, man muss jetzt vier Jahre studieren.«
»Wie lange hatte er die Praxis schon?«
»Ach, erst knapp über drei Jahre.«
Hackett, dem es auf diese Fragen noch gar nicht ankam, war überrascht. Die Miete für die Praxis musste ziemlich hoch sein.
»Und wie lange war er hier tätig?«
»Er hat hier angefangen. Er machte damals zum Glück eine Erbschaft und meinte, es sei besser, das Geld für die Praxis zu verwenden, weil die Leute von einer guten Fassade immer beeindruckt sind.«
»Ich verstehe. War gestern Abend noch eine Konsultation vorgesehen?«
Sie nickte.
»Er hat das öfter bei Leuten gemacht, die tagsüber keine Zeit hatten. Soviel ich weiß, war der Patient für acht Uhr bestellt.«
»Hat Ihr Mann Ihnen gesagt, wann er nach Hause kommen wird?«
»Nein.«
»Offenbar hatten Sie sich erst heute Morgen Sorgen gemacht«, sagte Hackett. »Es tut mir leid, dass ich Sie das fragen muss, Mrs. Nestor, aber lag es daran, dass er früher schon - nachts - fortgeblieben ist?«
Sie sah ihn nachdenklich an, als sähe sie ihn zum ersten Mal; ihr Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. Sie betupfte sich mit einem zusammengeknüllten Taschentuch die blassen Lippen und sagte nach kurzer Überlegung: »Ich verrate Ihnen wohl am besten gleich den Grund. Es ist nicht sehr erfreulich, aber ich verstehe, dass Sie das wissen müssen. Ich hoffe nur, dass das alles nicht in die Zeitungen kommt. Das wäre nicht sehr angenehm.«
Ihrer Sprache nach schien sie einigermaßen gebildet zu sein, aber Hackett hatte das Gefühl, dass sie irgendwie abgestumpft war.
»Ja, ich sage das nicht gern, aber er ist früher schon oft fortgeblieben, ohne mir Bescheid zu sagen.«
»Verstehe. Wissen Sie, ob er eine Freundin hatte?«
Hackett hätte sich am liebsten für dieses Klischee entschuldigt, aber wie sollte man es sonst ausdrücken?
»Ich kenne keinen Namen«, sagte sie. »Ich kannte Franks Freunde kaum. Schon seit langer Zeit nicht mehr. Ich erzähle Ihnen wohl am besten alles, wie es war, sonst kommt Ihnen das merkwürdig vor. Wissen Sie, mein Vater hatte viel Geld, und deshalb hat mich Frank geheiratet. Ich begriff das erst, als Vater starb und wir erfuhren, dass er das ganze Geld verloren hatte - wie das zugegangen war, weiß ich nicht genau. Frank ist - sehr wütend gewesen. Normalerweise hätte er mich wohl verlassen, aber er hatte sich an mich gewöhnt. Und ich sorgte dafür, dass er es zu Hause bequem hatte, dass gutes Essen auf den Tisch kam und so weiter. Außerdem, solange er eine Frau hatte, konnte ihn keine andere einfangen, wenn Sie mich verstehen. Es war bequem für ihn. Und Mr. Marlowe darf man auch nicht vergessen.«
»Wer ist Mr. Marlowe?«
Sie betupfte wieder ihre Lippen.
»Er war ein Freund meines Vaters. Als - bevor Frank so viel Erfolg hatte, kam er manchmal vorbei und machte mir kleine Geschenke -, er sargte jedenfalls dafür, dass wir genug zu essen hatten.« Ihr Tonfall verriet keine Bitterkeit. »Und er hat Frank das Geld für den Chiropraktik-Lehrgang gegeben. Selbstverständlich zahlte Frank es zurück.«
»Ich verstehe. Ihr Mann kam nicht immer zu einer bestimmten Zeit nach Hause?«
»Oh, Sie dürfen nicht glauben, dass wir je gestritten hätten«, meinte sie. »Das war so eine Art stiller Abmachung. Er kam an den meisten Abenden zum Essen nach Hause, oder er rief jedenfalls an. Ein paarmal in der Woche war er abends fort, und manchmal kam er überhaupt nicht heim, aber dann fuhr er sofort in die Praxis - von dort aus, wo er eben war. Er hatte hier einen Rasierapparat und frische Hemden, soviel ich weiß.«
»Aha. Warum haben Sie dann doch Bedenken bekommen, Mrs. Nestor?«
»Nun ja, als ich dahinterkam, dass er nicht in der Praxis war, machte ich mir Gedanken. Er ist nämlich immer pünktlich gewesen, weil es ihm sehr aufs Geld ankam. Und als Miss Corliss anrief und sagte, er sei nicht hier...«
»Miss Corliss?«
»Seine Sprechstundenhilfe. Sie rief mich an, um zu fragen, warum er nicht in der Praxis sei. Sie hatte keinen Schlüssel, und die Eingangstür war abgeschlossen. Ich wollte sie natürlich nicht merken lassen, dass ich nicht wusste, wo Frank war. Hoffentlich kommt das nicht alles in die Zeitung.«
Ihre tonlose Stimme begann Hackett auf die Nerven zu gehen.
»Ich sagte ihr, er fühle sich nicht wohl und könne nicht kommen; sie solle ruhig nach Hause gehen. Aber ich fand es merkwürdig, weil es so gar nicht zu ihm passte. Deshalb fuhr ich sofort hierher...«
»Warum, Mrs. Nestor? Offenbar war er doch nicht hier, das wussten Sie doch?«
»Das wusste ich natürlich. Ich war aber auf den Gedanken gekommen, dass er sich vielleicht entschlössen haben mochte, mich zu verlassen oder - dass er irgendwo hingefahren war und mir hier einen Zettel hinterlassen hatte. Ich wusste es nicht, aber es war möglich. Als ich seinen Wagen dann auf dem Parkplatz stehen sah, bekam ich doch Bedenken, und dann entdeckte ich, dass die Tür vom Nebeneingang aufgebrochen worden war. Ich wollte nicht allein hineingehen. Ich dachte - ich weiß nicht genau, was ich dachte, aber ich ging zum, Drugstore an der Ecke und rief die Polizei an.«
Hackett starrte sie prüfend an. Hatte sie ihn doch noch so sehr geliebt, dass sie eifersüchtig gewesen war? Hatte sie ihn genug gehasst, um ihn töten zu können?
Er nahm sich vor, im Labor bei ihr einen Paraffintest durchführen zu lassen, obwohl man sich auch darauf nicht immer verlassen konnte.
»Waren Sie gestern den ganzen Abend zu Hause?«, erkundigte er sich. »Allein?«
»Oh, ja.« Sie nannte ihm ihre Anschrift: Kenmore Avenue.
»Frank ist nach dem Essen weggefahren, gegen halb acht. Ich setzte mich eine Weile vor den Fernsehapparat, nähte ein bisschen, aber dann wurde mir klar, dass er erst spät heimkommen würde, deshalb ging ich zu Bett. Das war gegen halb elf. Erst heute früh merkte ich, dass er überhaupt nicht nach Hause gekommen war.«
Nach Hause, dachte Hackett. Du meine Güte!
»Haben Sie getrennte Schlafzimmer?«
»Nein, aber ich bin eingeschlafen, wissen Sie.«
Er sah sie wieder an. Es war zu früh, Schlussfolgerungen zu ziehen. Er wusste selbst nicht genau, was er von ihrer Geschichte halten sollte.
»Würden Sie mir bitte Ihren vollen Namen sagen?«
»Andrea Lilian Nestor. Mein Mädchenname war Wayne.«
Er bedankte sich.
»Das wäre zunächst alles, Mrs. Nestor. Wir melden uns wieder. Sie wollen sicher nach Hause. Haben Sie einen Wagen oder...«
»Nein«, sagte sie. »Ich habe keinen Führerschein.«
»Ich lasse einen Wagen kommen und Sie nach Hause bringen.«
»Das ist sehr freundlich von Ihnen«, sagte sie überrascht. »Es macht mir nichts aus, mit dem Bus zu fahren. Ich will nur sagen – ich nehme an, dass Sie eine Obduktion durchführen, aber soll ich irgendetwas unternehmen?«
»Für die...«
Die unverblümte Frage hatte ihn doch etwas aus der Fassung gebracht.
»Erst, wenn die Leiche offiziell freigegeben wird.«
»Oh. Ich verstehe. Danke. Ich glaube, ich werde ihn verbrennen lassen«, sagte Andrea Nestor nachdenklich.
Hackett kehrte in das Arbeitszimmer zurück. Er war ein bisschen erschüttert. Er erkundigte sich bei Marx, ob das Telefon schon nach Fingerabdrücken untersucht worden war, und rief an, um einen Wagen für Mrs. Nestor zu besorgen. Er hatte sich entschlossen, bevor er die Einbruchsgeschichte schluckte, sich Andrea Nestor und Frank Nestors Privatleben gründlich anzusehen.
Und der Aufschlitzer trieb sich auch noch immer frei herum. Vier in zehn Tagen. Furchtbar. Wenn Luis nur schon zu Hause wäre.
Zu Palliser sagte er: »Habt ihr irgendwas gefunden?«
»Nicht viel. Die Kartei ist nicht uninteressant.«
»So? Warum?«
»Na ja, es riecht doch hier nach Geld, oder?« Palliser machte eine ausgreifende Handbewegung, »Aber der Kartei nach hatte er nicht besonders viele Stammpatienten. Vielleicht kann ich es nicht beurteilen, aber ich würde schon sagen, dass eine solche Einrichtung auf eine viel größere Praxis deutet - vielleicht mindestens achtzig oder hundert Stammpatienten. In der Kartei sind genau sechsunddreißig erfasst, und von denen waren, nach dem Terminbuch zu schließen, nur zwanzig in regelmäßiger Behandlung. Für die Konsultation hat er sechs Dollar verlangt.«
»Was Sie nicht sagen«, meinte Hackett.
»Können wir ihn wegschaffen?«
Der Krankenwagen war eingetroffen; zwei Weißbekittelte steckten die Köpfe zur Tür herein. Bainbridge war schon gegangen.
Hackett sah auf die Leiche hinunter und sagte geistesabwesend: »Ja«, und dann: »Einen Moment mal.«
Er ging in die Hocke. Die rechte geschlossene Hand des Toten lag auf der Brust. Hackett hob sie hoch und drehte sie um. Zwischen Daumen und Zeigefinger war etwas eingeklemmt; es war nicht ganz einfach, den Griff der starren Finger zu lockern.
»Das glaub’ ich einfach nicht«, sagte er. »Wie bei Edgar Wallace!«
Palliser beugte sich vor, um genauer hinzusehen, und riss die Augen auf. Es war ein Knopf, ein ganz gewöhnlicher Knopf, dunkelgrau bis schwarz, mit vier kleinen Löchern. In einem davon hing noch ein Fadenrest. Ein Knopf mit einem Durchmesser von ungefähr eineinhalb Zentimetern.
Palliser richtete sich auf.
»Soll das vielleicht bedeuten, dass er sich auf den Mörder gestürzt und statt des Revolvers nur den Knopf erwischt hat? Das darf doch wohl nicht wahr sein!«
»Tja, möglich wär’s«, meinte Hackett. »Nur weil’s durchsichtig wirkt - Sie wissen genauso gut wie ich, dass meistens wirklich alles so ist, wie es aussieht.«
»Klar«, sagte Palliser. »Das geb’ ich zu. Wollen Sie die Kartei mitnehmen?«
»Ich sehe sie mir später hier an.«
Hackett warf einen Blick auf die Uhr, sagte zu den Weißbekittelten: »Okay, ab damit«, und schaute sich im Zimmer um. Im Augenblick war hier nicht viel anzufangen. Ganz plötzlich musste er an Roberto Reyes denken. Ein braver Junge. Gute Noten in der Schule. Der Pfarrer hatte vom unerforschlichen Ratschluss gesprochen.
Als Kriminalbeamter konnte man sich damit einfach nicht abfinden.
Im Augenblick, dachte er, würde er auf Andrea Nestor setzen, wenn es darum ging, dem Mörder einen Namen zu geben. Vielleicht kam auch ein eifersüchtiger Ehemann in Frage. Das musste man noch ermitteln. Aber die meiste Arbeit erwartete sie beim Aufschlitzer - das Zugunglück nicht zu vergessen.
»Los, gehen wir zum Essen«, sagte er zu Palliser. »Ich muss mich sowieso eine Weile auf diese Sache konzentrieren, Bert oder irgendein anderer kann inzwischen die Routineermittlungen wegen des Eisenbahnunglücks weiterführen. Ich bin übrigens ganz Ihrer Meinung. Wahrscheinlich kommt nichts Definitives dabei heraus. Aber der Aufschlitzer - eigentlich idiotisch. Wer kommt bloß auf solche Namen? Da müssen wir uns richtig anstrengen. Wir haben die Protokolle noch nicht alle gelesen...«
»Nein, nur die Times. Soll ich die Routinearbeit übernehmen?«
»Ich weiß noch nicht«, sagte Hackett. »Passen Sie auf, wir fahren schnell beim Büro vorbei und holen die Protokolle, dann setzen wir uns in Federicos Lokal zusammen. Okay? Es ist vielleicht besser, wenn Sie auch Bescheid wissen.«
Wenn Luis nur hier wäre! Vielleicht fiele ihm zu dem Aufschlitzer etwas ein. Aber das war wohl nur Wunschdenken, weil man mit ausgefallenen Ideen da nicht weiterkam. Geduld und Gründlichkeit, darauf kam es an.
Diese Frau. Ich glaube, ich lasse ihn verbrennen.
Er trank mit mürrischem Gesicht ungezuckerten Kaffee und schaute Palliser an, der die Protokolle las.
Das erste Opfer war der Stromer gewesen, den man in einem billigen Zimmer in einem schäbigen Hotel in der 3. Straße gefunden hatte. Man kannte nicht einmal seinen Familiennamen; ein Barmixer im Kneipenviertel hatte ihn als einen gewissen Mike identifiziert, der in allen Lokalen bekannt war, ein Säufer. Er war erstochen worden, und der Täter hatte die Leihe anschließend übel zugerichtet. Der Hotelportier vermochte nur eine sehr vage Beschreibung des Mannes zu geben, der das Zimmer gemietet hatte.
»Die Leute kommen und gehen, wissen Sie«, hatte er nervös erklärt. Die hingekritzelte Unterschrift im Meldebuch war fast unlesbar; sie konnte genauso gut Fred Rankin oder Frank Tomkin oder sonstwie lauten. Der Portier sagte aus, der Mann habe kein Gepäck bei sich gehabt. Selbstverständlich hatte man den Portier in die Zange genommen, genauso wie die Bewohner des ganzen Stockwerks. Der Erfolg war gleich Null. Man konnte sich an den Mann einfach nicht erinnern, außerdem hatte er das Zimmer erst zwölf Stunden vorher gemietet. Er war natürlich auch nicht zurückgekommen.
So stand die Sache, als Florence Dahl gefunden wurde. Die Frau nebenan hatte sie entdeckt und solchen Lärm geschlagen, dass der nächste Verkehrspolizist herbeigelaufen war. Man wusste ziemlich viel über Florence - sie war zahllose Male verhaftet und wegen Prostitution mit Geldstrafen belegt worden, aber damit wusste man immer noch nicht, wer sie getötet hatte. Florence war in den zwanzig Jahren, seit sie diesen Beruf ausübte, immer weiter abgerutscht und hatte jeden Kunden angenommen. Sie war in einer heruntergekommenen Pension in der Grand Avenue zu Hause gewesen, und ein paar Frauen vom selben Typ wie Florence, die im selben Stockwerk wohnten, hatten ein bisschen ausgepackt. Florence hätte in der Naht einen Mann mitgebracht, der furchtbar herumgebrüllt und geflucht habe. An den Wortlaut konnte man sich nicht erinnern, aber eine Frau bestand darauf, dass er gesagt habe: »Alle kommen mir nach«, was einfach keinen Sinn ergab, wie man es auch drehen und wenden wollte. Das war gegen neun Uhr gewesen; außer Florence waren nur die beiden Frauen und die Wirtin zu Hause. Es hätte nicht lange gedauert, dann wäre die Wirtin - so tolerant sie auch sonst sein mochte - zumindest nach einer Weile hinaufgegangen und hätte an die Tür geklopft. Er hatte zu brüllen aufgehört, und etwa zehn Minuten später war die Tür zu Florences Zimmer zugeworfen worden, und man hatte Schritte die Treppe hinunterpoltern hören.
Gesehen hatte ihn natürlich niemand.
Von da an gewann er an Bedeutung, weil Dr. Bainbridge und das Labor zwischen den beiden Morden eine Verbindung hergestellt hatten. Wegen des Messers und des modus operandi. Auh Florence war erstochen worden; ihre Leihe hatte starke Verunstaltungen aufgewiesen.
»Sieht nach einem sehr ungewöhnlichen Messer aus«, erklärte Bainbridge. »Wenn man die Wunden misst und so weiter, dürfte die Hälfte der Schneide sägeartig sein, Sie wissen schon, wie bei einem Brotmesser. Es entspricht auch nicht den gängigen Größen - ich glaube nicht, dass es sich um ein Fabrikprodukt handelt, aber das ist nur eine Vermutung von mir. Die Klinge ist ungefähr fünfundzwanzig Zentimeter lang und außergewöhnlich breit - etwa fünf bis sechs Zentimeter.«
»Das ist ja schon eher ein Säbel«, meinte Palliser, in die Unterlagen vertieft. Hackett gab ihm mit düsterer Miene recht. Weil er Diät halten musste, hatte er nur eine große Portion Salat gegessen und sich einen Kaffee genehmigt. Er stellte sich lieber erst gar nicht vor, was Angel, seine Frau, zum Mittagessen gekocht hatte.
Die Verhöre anlässlich des Mordes an Florence Dahl waren noch nicht beendet, als man Theodore Simms Leiche in einer Gasse bei der Flower Street, ganz in der Nähe der Innenstadt, fand. Er trug Ausweise bei sich, aber seine Mutter sagte, er müsse über fünf Dollar in der Brieftasche haben, und das Geld fehlte. Simms war gerade bei seiner Firma entlassen worden - ohne Schuld, das Unternehmen war in Schwierigkeiten - und befand sich auf Stellungssuche. Es gab keinen Zweifel, dass er als Nummer drei gelten musste - er war genauso zugerichtet wie die anderen drei, erstochen, verunstaltet.
Mehrere Leute konnten sich dunkel daran erinnern, dass er gegen neun Uhr abends in einem kleinen Lokal an der Flower Street gewesen sei. Der Kellner wusste Genaueres zu berichten; er gab zu Protokoll, Simms habe zwei Glas Bier getrunken, und sein Nachbar sei mit ihm ins Gespräch gekommen. Simms sei ziemlich einsilbig gewesen, und er habe auch nicht hören können, was der andere gesagt habe, aber sie seien gemeinsam weggegangen. Wie der andere ausgesehen habe?





























