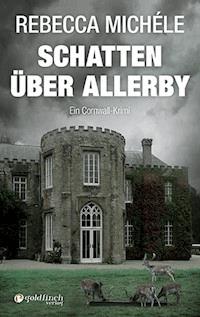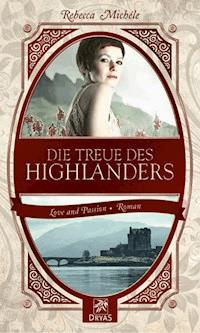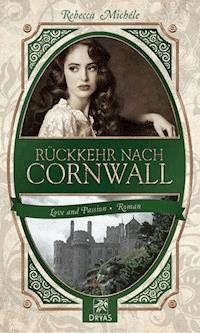Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Intrigen und Geheimnisse am englischen Hof: Der mitreißende historische Roman »Die zweite Königin« von Rebecca Michéle jetzt als eBook bei dotbooks. England im 16. Jahrhundert: Als Tochter einer zum Tode verurteilten Hexe droht auch Margret der Scheiterhaufen. Im letzten Moment rettet die Güte einer Fremden sie vor der Hinrichtung. Auf einem Gutshof in den Cotswolds führt sie fortan ein entbehrungsreiches, aber trotz allem sorgloses Leben als Magd. Doch in den Wirren um die Thronfolge Heinrichs VIII. gerät Margret plötzlich in einen Strudel aus Intrigen und politischer Machtgier: Ihre Ähnlichkeit mit Elisabeth I. droht ihr dabei ebenso zum Verhängnis zu werden wie ein wertvolles Medaillon ihrer Mutter – denn es birgt ein Geheimnis, das England in seinen Grundfesten erschüttern könnte … Jetzt als eBook kaufen und genießen: In ihrem historischen Roman »Die zweite Königin« verwebt Erfolgsautorin Rebecca Michéle grandios historische Ereignisse mit einer fesselnden fiktiven Geschichte. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
England im 16. Jahrhundert: Als Tochter einer zum Tode verurteilten Hexe droht auch Margret der Scheiterhaufen. Im letzten Moment rettet die Güte einer Fremden sie vor der Hinrichtung. Auf einem Gutshof in den Cotswolds führt sie fortan ein entbehrungsreiches, aber trotz allem sorgloses Leben als Magd. Doch in den Wirren um die Thronfolge Heinrichs VIII. gerät Margret plötzlich in einen Strudel aus Intrigen und politischer Machtgier: Ihre Ähnlichkeit mit Elisabeth I. droht ihr dabei ebenso zum Verhängnis zu werden wie ein wertvolles Medaillon ihrer Mutter – denn es birgt ein Geheimnis, das England in seinen Grundfesten erschüttern könnte …
Über die Autorin:
Rebecca Michéle, 1963 in Rottweil in Baden-Württemberg geboren, eroberte mit ihren historischen Liebesromanen eine große Leserschaft. In ihrer Freizeit trainiert die leidenschaftliche Turniertänzerin selbst Tänzer.
Bei dotbooks erschienen bereits Rebecca Michéles Romane:
»Irrwege ins Glück«
»Heiße Küsse im kalten Schnee«
»Rhythmus der Leidenschaft«
»Der Ruf des Schicksals«
»In den Armen des Fürsten«
»Die Melodie der Insel«
Die Website der Autorin: www.rebecca-michele.de
***
Überarbeitete eBook-Neuausgabe April 2019
Dieses Buch erschien bereits 1998 unter dem Titel »Das Ebenbild der Königin« im Eugen Salzer-Verlag
Copyright © der Originalausgabe 1998 Eugen Salzer-Verlag, Heilbronn
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Sabine Zürn
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Nejron Photo und AcantStudio
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ca)
ISBN 978-3-96148-421-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die zweite Königin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Rebecca Michéle
Die zweite Königin
Historischer Roman
dotbooks.
Für meine Mutter
Prolog
1536
Nebel waberte durch die noch dunklen Gassen von Winchcombe. Bereits zu dieser frühen Stunde waren viele Menschen unterwegs, denn heute war Markttag in dem kleinen Städtchen in den Hügeln der Cotswolds in der Grafschaft Gloucestershire. Kaufleute aus der ganzen Umgebung strömten durch die Tore in Richtung Marktplatz. Es wurde gehämmert und gezimmert, um die überdachten Stände rechtzeitig aufgebaut zu haben, und die ersten Waren wurden in den Buden ausgelegt, wo sie auf reges Interesse stoßen würden. Nach einem langen, harten Winter war es der erste Markt der Gegend, dementsprechend bestand großer Bedarf an Töpfer- und Holzwaren, Stoffen, Zierborten, Nähgarn und vielen anderen Dingen mehr. In Winchcombe lebten einige vermögende Familien, bei denen die Münzen locker im Beutel saßen. Aber auch Leute, die weder etwas verkaufen noch erwerben wollten, warteten ungeduldig auf den Sonnenaufgang. Nahe dem steinernen Kreuz, das seit über zweihundert Jahren den Marktplatz beherrschte, errichteten kräftige Männer einen Scheiterhaufen. Sie mussten sich beeilen, denn bei Tagesanbruch – so hieß es – würde man die Hexe hinrichten. Dieses Ereignis ließ den Markttag fast in den Hintergrund treten, denn seit zehn Jahren hatte es in Winchcombe keine Hexenverbrennung mehr gegeben. Zwar wurden regelmäßig Dieben die Hände abgehackt, Menschen an den Pranger gestellt und Mörder gehenkt oder gevierteilt, aber das Verbrennen einer Hexe war ein besonderes Schauspiel. Außerdem kannte jeder Einwohner die Verurteilte, doch es hatte niemand geahnt, dass sich die Frau seit Jahren mit dem Beelzebub eingelassen und dessen schändliches Werk in ihrer Stadt ausgeführt hatte.
Der Nebel lichtete sich rasch, ein leuchtender Morgen zog am Horizont herauf, und die Sonne strahlte von einem wolkenlosen Himmel. Immer mehr Menschen drängten sich in den Gassen rund um den Marktplatz, sodass für die Pferdekarren kaum noch ein Durchkommen war. Die Stadtwächter leiteten die ankommenden Kaufleute mit ihren Waren zu Plätzen außerhalb des Stadtkerns, wo sie warten sollten, bis die Hinrichtung vollzogen war und die Straßen wieder passierbar waren. Auswärtige, die nach dem Grund der Menschenansammlung fragten und von dem Ereignis erfuhren, strebten ebenfalls dem Scheiterhaufen zu. Ehe die Hinrichtung nicht vollzogen war, würden sie ohnehin keine Geschäfte machen.
Einer von ihnen war Edmund Cardingham. Obwohl er schon an die vierzig Jahre zählte, hatte er noch nie einer Hexenverbrennung beigewohnt. Er stellte seinen mit Schafwolle beladenen Karren an der ihm zugewiesenen Stelle ab und befahl seinem Burschen: »Du bleibst hier und passt auf die Wolle auf. Wage nicht, dich von der Stelle zu rühren, sonst bekommst du meinen Stock zu spüren!«
Unter der dröhnenden Stimme zuckte der junge, etwas einfältig wirkende Jem zusammen und versicherte, den Wagen keinen Moment aus den Augen zu lassen. Jem wusste, wie zornig sein Herr werden konnte, wenn jemand seine Befehle missachtete. Sein Rücken hatte mit Cardinghams Stock bereits Bekanntschaft gemacht.
»Komm, Weib! Die besten Plätze werden wahrscheinlich schon belegt sein.« Der Wollhändler reichte seiner Frau die Hand und half ihr beim Absteigen. »Wenn ich gewusst hätte, welches Spektakel heute geboten wird, wäre ich früher aufgebrochen.«
Die kleine, untersetzte Frau zögerte, dann sagte sie leise: »Edmund, ich möchte nicht mitkommen. Ich kann ein solch menschenunwürdiges Schauspiel nicht mitansehen. Es tut mir in der Seele weh.«
»Gut, wie du willst, Kate.« Cardingham verzog missbilligend die Mundwinkel. »Ich vergaß, dass du so zartbesaitet bist. Ich jedenfalls werde es mir nicht entgehen lassen. Wir haben sonst kaum Abwechslung, tagaus, tagein nur Schafe und Wolle! Da wird einem ein wenig Vergnügen doch gegönnt sein!«
»Ob das ein Vergnügen ist …«, murmelte Kate Cardingham, ihr Mann eilte aber bereits mit weit ausholenden Schritten in Richtung des Marktplatzes.
Auch Kate hatte noch nie eine Hexe brennen gesehen. Einmal, sie war acht oder neun Jahre alt gewesen, hatte es in ihrem Dorf eine Hexe gegeben. Die alte Frau war zuerst gesteinigt und dann im Fluss ertränkt worden. Kate war zufällig dazugekommen. Das entsetzte und von Schmerz gezeichnete Gesicht der Alten konnte sie bis heute nicht vergessen. Kate war eine gute Christin, glaubte an Gott, den Heiligen Geist und dessen Allmacht ebenso wie an die Qualen der Hölle, konnte sich aber nur schwer vorstellen, dass ganz normale Frauen mit dem Teufel im Bunde stehen sollten. War aber die Königin nicht der beste Beweis für die Existenz schwarzer Magie? Hatte sie nicht den König verhext, damit er sich von seiner rechtmäßig angetrauten Ehefrau trennte, sie verbannte, seine Tochter als Bastard brandmarkte und sich sogar vom Heiligen Vater in Rom lossagte? Der König war ein zutiefst gläubiger Mann, der einst für ein geistliches Leben vorgesehen gewesen war. Wäre sein älterer Bruder nicht so jung gestorben, wäre Heinrich heute Bischof oder gar Kardinal, stattdessen war er in die Fänge der Hexe Anna Boleyn geraten. Jetzt aber war es dem König mit Gottes Hilfe gelungen, sich aus diesem Bann zu befreien. Die Königin war im Tower von London eingesperrt und würde ihre gerechte Strafe erhalten. Es war wichtig, alle Hexen von dieser Erde zu tilgen. Sie, Kate, war nur eine Frau und viel zu unwissend, um das infrage zu stellen. Trotzdem wollte sie nicht zuschauen und lieber hier warten, bis es vorüber war. Ein vielstimmiger Aufschrei der Menge riss sie aus ihren Gedanken: »Die Hexe kommt!«
Kate blickte auf. Die Eskorte auf dem Weg zum Scheiterhaufen näherte sich. Auf einem Holzkarren kauerte eine Frau. Kate konnte ihr Gesicht nicht erkennen, nur die Flut flammend roter Haare, die ihr offen bis auf die Hüften fielen. Unwillkürlich bekreuzigte sich Kate und murmelte ein schnelles Gebet. Frauen mit solch auffällig roten Haaren waren häufig mit dem Teufel im Bunde, denn er hatte ihnen diese Farbe gegeben, um die Männer zu verführen.
Der Karren rumpelte an Kate vorbei. In diesem Moment hob die Verurteilte den Kopf, und ihre Blicke kreuzten sich. Wie damals bei der alten Frau standen auch dieser Verurteilten Qual, Schmerz und Hoffnungslosigkeit in den Augen, und noch etwas anderes sah Kate und schnappte hörbar nach Luft: Die Frau war hochschwanger!
Ohne nachzudenken, reihte sich Kate in den Menschenstrom ein, der dem Zug folgte. In unmittelbarer Nähe des Marktkreuzes erkannte sie Edmund. Sie drängte sich durch die Menge und trat an seine Seite. Mit einem Stirnrunzeln nahm er ihre Anwesenheit zur Kenntnis, kommentierte den Sinneswandel seiner Frau, der Hinrichtung nun doch beizuwohnen, aber nicht. Ein Raunen ging durch die Menge, als die Rothaarige vom Karren gezerrt wurde. Die Hexe war fast noch ein Kind, nicht älter als fünfzehn oder sechzehn Jahre. Sie war mit Schmutz bedeckt, das Haar verfilzt. Trotz der Spuren vorangegangener Folterungen war die zarte Schönheit der jungen Frau zu erkennen – und auch ihre Schwangerschaft.
»Seht her, sie bekommt ein Kind!«, rief eine Frau entsetzt.
»Bestimmt ein Produkt des Teufels!«
»Ja, ganz richtig!«, stimmte ihr eine andere zu. »Sie ist nicht verheiratet, wer als der Teufel selbst sollte den Bastard gezeugt haben?«
Die Henkershelfer mussten die Verurteilte mehr stützen, als dass sie selbst gehen konnte. Als sie einen Fuß auf die erste Stufe zum Scheiterhaufen setzte, johlte die Menschenmenge auf. Kate und Edmund reckten die Köpfe, um besser sehen zu können. Die Verurteilte war zusammengebrochen. Sie lag im Staub der Straße, die Hände auf ihren geschwollenen Leib gepresst. Sie schrie vor Schmerzen, das Gesicht zu einer Fratze verzerrt.
Die Wehen haben eingesetzt!, dachte Kate. Sie drängte sich durch die Menge der Gaffer und war gleichzeitig mit einem Priester bei der sich krümmenden Frau.
»Sie bekommt das Kind!«, rief Kate.
Der Priester betrachtete die Szene emotionslos und erwiderte bestimmt: »Wir müssen uns beeilen! Schnell«, er winkte den Henkershelfern zu, »bringt sie auf den Scheiterhaufen und entzündet das Feuer.«
Kate trat vor den Geistlichen, ihre Augen funkelten zornig. »Wollt Ihr zum Mörder eines unschuldigen Kindes werden?«
Der Priester runzelte unwillig die Stirn und sagte: »Was geht Euch das an? Wer seid Ihr überhaupt?«
»Mein Name tut nichts zur Sache, aber ich bin eine Christin, die weiß, dass das ungeborene Leben im Leib dieser Frau unschuldig und rein ist.«
»In einem Gerichtsverfahren wurde sie ordentlich verurteilt. Sie ist eine Hexe, und dieses Kind kann nur die Ausgeburt ihres schändlichen Treibens mit den Mächten der Finsternis sein.« Der Priester nickte den Schergen zu. »Packt sie!«
Zwei Männer wollten das Mädchen vom Boden aufheben, doch Kate stellte sich schützend über die Gebärende. Diese jammerte und krümmte sich immer mehr.
»Gab es eine Verhandlung, in der das Kind ebenfalls zum Tode verurteilt wurde?«, fragte Kate herausfordernd.
Verlegen sahen sich der inzwischen hinzugekommene Bürgermeister und der Priester an. Der Geistliche erwiderte: »Das ist nicht notwendig, und wir wollten die Hinrichtung vollziehen, bevor das Kind geboren wird.«
Kate, die die Unsicherheit in seiner Antwort bemerkte, sagte in einem Tonfall, der keine Widerrede duldete: »Es ist Gottes Wille, dass das Kind überlebt, darum wird es jetzt geboren. Es ist ein Zeichen!«
Jetzt war Edmund Cardingham an ihrer Seite. Er packte sie grob am Arm und zischte: »Bist du verrückt geworden? Das geht uns nichts an, lass die Männer also ihre Arbeit verrichten.«
»Nicht, bevor geklärt ist, ob es das Gesetz erlaubt, ein unschuldiges Kind zu verbrennen«, antwortete Kate und stemmte die Hände in die Seiten. Trotz ihrer geringen Körpergröße wirkte sie erhaben und entschlossen, dem Geschehen nicht einfach den Rücken zu kehren.
Edmund Cardingham ballte die Hände zu Fäusten. So unnachgiebig er seinen Knechten und Mägden gegenüber war – gegen seine Frau kam er nicht an. Wenn Kate sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, ruhte sie nicht eher, bis sie es erreicht hatte. Er müsste sie schon von hier forttragen, und diese Blöße wollte er sich vor all den Menschen nicht geben.
Kates Worte hatten nicht nur den Priester, sondern auch die Menschen, die ihren Disput verfolgten, nachdenklich gemacht.
Leise sagte der Bürgermeister: »Wir werden die Frau ihr Balg bekommen lassen und dann über dieses erneut zu Gericht sitzen.«
Er befahl zwei Schergen, die Gebärende in eine nahe gelegene Scheune zu bringen.
Cardingham blaffte seine Frau an: »Ein Balg mehr oder weniger auf dieser Welt – kommt es darauf an?«
Kate beachtete den Einwand ihres Mannes nicht und folgte den Schergen in die Scheune. Dort kniete sie sich zu dem Mädchen nieder, das rücksichtslos auf den blanken Boden geworfen worden war. Die Geburt stand unmittelbar bevor. Kate, die schon bei vielen Entbindungen mitgeholfen hatte und der das Glück, selbst einem Kind das Leben zu schenken, nie vergönnt gewesen war, erkannte, dass der Scheiterhaufen der armen Frau nichts mehr würde anhaben können. Die Qualen der Gefangenschaft und Folter hatten ihr junges Leben bereits zerstört, sie würde die Anstrengung der Geburt nicht überleben.
Das Kind war ein Mädchen, etwas klein und zart, aber gesund, auf dem Köpfchen einen Flaum hellroter Haare. Glücklich lächelte die junge Mutter und streckte die Hände nach ihrer Tochter aus. Kate legte ihr die Kleine in die Arme. Zärtlich küsste die Mutter ihr Kind auf die Stirn.
»Ich fürchte, ich habe keine Milch.« Das Mädchen sprach so leise, dass Kate das Ohr an seinen Mund legen musste.
»Ich werde eine Amme besorgen.« Die Worte waren kaum über ihre Lippen, als Kate bewusst wurde, welches Versprechen sie der Sterbenden gegeben hatte. In wenigen Tagen würde das Neugeborene denselben Weg wie seine Mutter beschreiten. Kate bezweifelte nicht, dass das Gericht auch das Kind zum Tode verurteilen würde.
Unter Aufbietung ihrer letzten Kräfte deutete die junge Frau auf ihren Ausschnitt und flüsterte: »Ich trage ein Medaillon auf meinem Herzen, der Vater des Kindes gab es mir zum Andenken. Bitte, nehmt es und gebt es meiner Tochter. Es ist das Einzige, das sie später an ihre Eltern erinnern wird.«
Kate nestelte das Schmuckstück hervor und nahm die Kette vom Hals des Mädchens ab.
»Ich werde dein Kind zu mir nehmen«, sagte sie. Diesen Entschluss hatte sie gerade getroffen. »Es wird es immer gut bei mir haben, das verspreche ich dir.«
Das Mädchen schloss die Augenlider, versuchte zu lächeln, dann tat sie ihren letzten Atemzug.
Kate nahm das kleine, schreiende Menschenbündel auf den Arm und verließ festen Schrittes die Scheune. Niemand hinderte sie daran, der Priester und der Bürgermeister sahen zur Seite. Auf ihren Mienen las Kate die Erleichterung, dass ihnen der Bastard keine weitere Arbeit bereitete. Entgegen seiner vorher getätigten Aussage war sich der Priester nämlich nicht sicher, ob die Gesetze es erlaubten, das Kind hinzurichten. Wenn diese unbekannte Frau das Bündel mit sich nahm – umso besser.
Der Auseinandersetzung mit ihrem Mann sah Kate gelassen entgegen. Ihr Haus war groß, die Dienerschaft zahlreich. Die Frau eines Pächters hatte erst vor zwei Wochen ein Kind bekommen, sie war sicher bereit, auch dieses Würmchen zu stillen. Gegenüber Edmund würde sich Kate wie immer durchsetzen. Wie sie es der Verstorbenen versprochen hatte: Das Kind würde in ihrem Haus ein Heim finden.
Sie verließen mit ihrem Wagen, in dem das Neugeborene einer ungewissen Zukunft entgegenschlief, den Marktflecken, ohne ihre Waren verkauft zu haben. Sie hatten die Stadtgrenze erreicht, als hinter ihnen das Feuer des Scheiterhaufens aufloderte. Die Zuschauer grölten, endlich bekamen sie ihr Schauspiel. Die Menge wusste nicht, dass eine Tote verbrannt wurde.
Zur selben Zeit stieg im viele Meilen entfernten London eine junge, dunkelhaarige Frau in einem roten Wams die Treppen zum Blutgerüst hinauf. Sie wirkte gefasst und nickte ihrem Henker zu, der ein scharfes französisches Schwert in seinen kräftigen Händen hielt. Dann wechselte Anna Boleyn mit dem Geistlichen ein paar leise Worte und küsste das Kreuz, das er ihr hinhielt. Nun wandte sie sich an die Menge, die sich schweigend um das Tower Green versammelt hatte. Sie sprach mit fester, klarer Stimme und bat alle um Verzeihung, denen sie Unrecht getan hatte. Sie zürne keinem, der sie angeklagt und gerichtet habe, sagte sie zum Schluss und reichte der Sitte entsprechend dem Henker eine Münze für seine Mühe. Ihre Mutter Lady Boleyn verband ihr die Augen, und alle sanken auf die Knie.
»Jesus Christus, dir empfehle ich meine Seele«, hörten die Leute sie sagen. »Großer Gott, habe Erbarmen mit meiner Seele.«
Mit einem Schlag durchtrennte das Schwert den schlanken Hals. Anna Boleyn, Königin der tausend Tage, hatte ihr junges Leben verloren.
Auf Schloss Hatfield nördlich von London kletterte ein kleines Mädchen mit rötlich blondem Haar auf den Fenstersims und sah in den schönen Frühlingsmorgen hinaus. Ihre Erzieherin Lady Bryan trat zu ihr und nahm das Kind fest in die Arme.
»Lady Bryan, wo ist meine Mutter?«, fragte die Kleine mit piepsiger Stimme. »Warum besucht sie mich nicht mehr?«
Die Erzieherin wischte sich heimlich eine Träne aus den Augen.
»Verehrte Prinzessin, Ihr habt keine Mutter mehr.«
»Aber jeder hat eine Mutter«, erwiderte das Kind ernst und bestimmt.
»Eure Mutter ist jetzt im Himmel und kommt nie wieder zurück.«
Mit dieser Aussage wollte sich das Mädchen nicht zufriedengeben. Die Stirn zornig gerunzelt, rief sie: »Meine Mutter wird mich bald besuchen kommen. Sie hat mich lieb!« Zur Unterstreichung ihrer Worte stampfte sie mit dem Fuß auf den Boden.
In diesem Moment ähnelte das Kind so sehr seinem Vater, dass Lady Bryan ein Schauer über den Rücken lief. Sie drückte das Mädchen fest an sich und weinte so bitterlich, dass die kleine Prinzessin Elisabeth ganz verwirrt war.
Man schrieb den 19. Mai im Jahre des Herrn 1536.
Kapitel 1
1548
Als Margret erwachte, musste sie sich zuerst besinnen, wo sie war. Ihre Finger lagen in der kalten Asche des Kamins, sie musste direkt vor der Feuerstelle eingeschlafen sein. Sie streckte ihre Gliedmaßen und sah sich um. Im Dämmerlicht des heraufziehenden Morgens sah Margret jemanden auf dem strohbedeckten steinernen Boden liegen. Es war ein sehr dicker älterer Mann – einer der Saufkumpane ihres Herrn.
Gestern hatte Edmund Cardingham wieder eines seiner Gelage veranstaltet und zwei Dutzend Männer eingeladen. Das Bier war in Strömen geflossen, und Margret hatte alle Hände voll zu tun gehabt, die Männer zu bedienen. Irgendwann in der Nacht begaben sich die Männer betrunken in die Zimmer oder sie kippten einfach in der Halle von den Bänken und fingen auf dem Boden an zu schnarchen. Margret, völlig erschöpft, wollte wohl noch das Kaminfeuer löschen, war dabei aber eingeschlafen. Seit Sonnenaufgang war sie auf den Beinen gewesen, hatte die Ställe ausgemistet, die Gästezimmer geputzt und der Köchin bei den Vorbereitungen des Festes geholfen. Mit Master Cardingham war vorerst nicht zu rechnen. Wenn er ausgiebig gezecht hatte, verließ er selten vor Mittag sein Bett.
Margret wischte sich die Asche von den Händen, rappelte sich auf und durchquerte die Halle. Männer lagen im Stroh, alle noch schlafend. Vorsichtig stieg sie über die Körper hinweg und verließ die Halle durch eine niedrige Tür an der Ostseite. Der Küchenhof war in dichten Nebel gehüllt. Mit dem Eimer holte sie aus dem Brunnen Wasser und wusch sich an Ort und Stelle das Gesicht. Das Wasser war eiskalt. Margret schauerte zuerst, fühlte sich dann aber munter. Tief atmete sie die frische Morgenluft ein. Erste Sonnenstrahlen brachen durch das neblige Grau. Endlich mal ein schöner Tag, dachte sie. In diesem Jahr kam der Frühling spät. Auf den Hügeln der Cotswolds war bis in den April hinein Schnee gelegen. Ab Anfang Mai hatte es dann ohne Unterlass geregnet, sodass manche Leute von einer zweiten Sintflut sprachen. Die Bauern jammerten über die unter Wasser stehenden Felder und über den Mangel an saftigem Gras, der Nahrungsgrundlage ihrer Schafe. Für Edmund Cardingham gab es keinen Grund zur Klage. Im letzten Herbst hatte er ausreichend Heu eingelagert, um seine Schafe über den langen Winter und das nasse Frühjahr zu bringen. Cardingham lebte von der Schafzucht und dem Verkauf der Wolle – und das nicht schlecht. Chaddlewood House war einer der größten Gutshöfe der Gegend. Das Hauptgebäude war vor etwa hundert Jahren aus dem typischen gelben Stein der Cotswolds erbaut worden. Dieses und drei weitere Gebäude mit jeweils zwei Stockwerken umschlossen einen Innenhof, der durch ein großes Tor betreten wurde. Die Räume des Herrn waren holzgetäfelt und verfügten über einen Kamin, die Scheiben der Fenster waren in Blei gefasst. Für einen Wollhändler aus der Mittelschicht war es ein äußerst prächtiges Haus. Edmund Cardingham war für seine Gastfreundschaft bekannt. Nach Margrets Ansicht waren die Gäste durchweg vierschrötige, derbe Saufbolde, die spielten und viel zu viel tranken. Stets musste sie die Männer bedienen und war schutzlos den lüsternen Blicken und oft auch ihren Zugriffen ausgesetzt. Besonders reizvoll erschien es ihnen, Margret an ihrem langen roten Haar festzuhalten, so derb, dass ihr Tränen des Schmerzes in die Augen stiegen. Dann forderten die Männer einen Kuss als Lösegeld. Margret fand das widerlich. Sie hatte sich bei ihrem Herrn über das Verhalten seiner Kumpane beklagt, aber Cardingham hatte sie kaum eines Blickes gewürdigt und nur gemeint, sie solle nicht so zimperlich sein. Überhaupt wechselte der Herr nur die notwendigsten Worte mit ihr und erteilte knappe, harsche Befehle. Margret war nicht in der Position, gegen Cardinghams Verhalten und das seiner Gäste aufzubegehren. Sie lebte unter seinem Dach, aß das, was er ihr gab, und er kam für ihre Kleidung auf. Margrets Tage waren mit Arbeit ausgefüllt, und nach Möglichkeit ging sie Edmund Cardingham aus dem Weg.
Margret trat in die Küche, das Feuer im Kamin loderte bereits hoch. Sie hielt ihre Hände über die Flammen, bis ihr allmählich warm wurde. Dann holte sie sich eine Schale mit Milch aus der angrenzenden Kammer, wärmte diese in einem Kessel über dem Feuer, schnitt sich eine Scheibe des dunklen Brotes ab und setzte sich mit ihrem Frühstück an den Holztisch. Sie konnte sich noch etwas Zeit lassen, bevor ihr Tagwerk begann.
Die Tür öffnete sich, und eine rundliche Frau kam herein.
»Margret, du bist schon auf?«
»Guten Morgen, Odilla«, erwiderte Margret freundlich. Sie mochte die Köchin gern, denn Odilla war immer wie eine Mutter zu ihr gewesen, die Margret niemals gehabt hatte.
Die Köchin lächelte, nahm von einem Regal ein Tablett und stellte es vor Margret auf den Tisch. Unter einem Tuch war etwas verborgen.
»Alles Gute zu deinem Geburtstag, mein Kind!«
Margret blickte erst verwundert, dann erfreut, als Odilla das Tuch wegnahm und ein kleiner, hellbrauner Kuchen zum Vorschein kam.
»Ich habe heute Geburtstag?«, fragte sie.
Odilla nickte. »Heute vor zwölf Jahren brachte dich die Herrin, Gott hab sie selig, in dieses Haus. Ich hoffe, der Kuchen schmeckt dir.«
»Das tut er bestimmt, aber nur, wenn du ihn mit mir teilst. Wann hast du Zeit gefunden, noch einen Kuchen zu backen? Wir hatten wegen der Gäste alle Hände voll zu tun.«
»Ach, das ging gestern so nebenher, du hast es gar nicht bemerkt«, antwortete die Köchin. »Bei den Mengen, die die Bande wieder einmal vertilgt hat, fällt es dem Herrn nicht auf, dass ich für dich etwas abgezweigt habe.«
Fröhlich griff Margret zu einem Messer und schnitt den Kuchen an. Langsam, jeden Bissen genießend, verzehrte jede gleich zwei Stücke.
»Odilla, erzähl mir noch mal von dem Tag, als ich nach Chaddlewood kam«, bat Margret die Köchin. Die Geschichte hatte sie zwar schon mehrmals gehört – Odilla war damals bereits im Haus gewesen –, doch Margret konnte nie genug davon bekommen, etwas über damals erfahren.
»Wie jedes Jahr, nicht wahr, Margret?« Odilla zwinkerte mit ihren schmalen hellen Augen. »An jenem Tag heute vor zwölf Jahren herrschte große Aufregung, als der Herr und die Herrin vorzeitig vom Markt in Winchcombe zurückkehrten. Vor dem späten Abend hatte niemand mit ihnen gerechnet, und der Herr hatte keinen einzigen Sack Wolle verkauft. Statt klingender Münzen brachten sie ein neugeborenes Mädchen mit. Gott sei es gedankt, dass wenige Tage zuvor eine der Pächterfrauen ein Kind bekommen hatte. So konnte der Säugling, also du, Margret, von dieser Frau gestillt und versorgt werden. Unserer Herrin war es leider versagt geblieben, ein Kind auszutragen. Damals war sie auch schon an die vierzig, viel zu alt, um noch auf ein eigenes Kind zu hoffen. In den folgenden Jahren verbrachte die Herrin so viel Zeit wie möglich mit dir. Sie behandelte dich wie ihr eigenes Kind und schenkte dir ihre ganze Liebe.« Odillas Augen schimmerten feucht, und sie seufzte. Die Köchin war Kate Cardingham zutiefst ergeben gewesen.
»Ich erinnere mich ein wenig an die Herrin«, murmelte Margret und drückte Odillas Hand, die von der unermüdlichen Arbeit schwielig war. »Schon damals beachtete der Herr mich kaum, aber wenn er mich ansah, dann lief mir immer ein Schauer über den Rücken.«
»Dem Herrn war es nicht recht, dass seine Frau dir ein Heim gab«, erklärte Odilla geduldig. »Er hatte aber nicht viel zu sagen. Vor der Heirat stand es nicht gut um das Gut. Erst durch die Mitgift der Herrin wurde Chaddlewood House zu dem, wie wir es heute kennen. Sie hat ihren Mann aber immer spüren lassen, dass er ohne ihr Geld in der Gosse liegen würde. Das wird wohl der Grund sein, dass der Herr bereits kurz nach dem Tod seiner Frau begann, ein solch ausschweifendes Leben zu führen.«
»Wann starb die Herrin?«, fragte Margret, obwohl sie auch dies wusste.
»Du warst noch keine drei Jahre alt, und dann war es mit dem angenehmen Leben für dich vorbei. Auf dem Totenbett hat der Herr seiner Frau wohl versprochen, immer gut für dich zu sorgen, aber kaum war sie unter der Erde, brachte er dich zu mir in die Küche.
›Will den Bastard nicht in meinen Räumen haben‹, sagte er. ›Sie kann bei den Dienstboten bleiben. Bald wird sie alt genug sein, um für ihr Essen zu arbeiten.‹
Seitdem bist du nicht mehr als eine Dienstmagd. Du weißt selbst, Margret, dass der Herr nicht viel mit dir zu tun haben möchte.«
Margret nickte. »Das ist mir gerade recht, und ich bin zufrieden, wie es ist, abgesehen von den Gästen, denen ich lieber aus dem Weg gehen würde.« Margret lächelte ein wenig bitter und fragte dann: »Hast du jemals erfahren, woher ich kam?«
Odilla schüttelte den Kopf. »Niemals, denn die Herrin erwähnte nie, was in Winchcombe geschehen war und warum sie dich nach Chaddlewood brachte. Sie war einfach nur glücklich, mit dir einen Ersatz für ein eigenes Kind zu haben. Nachdem sie tot war, traute sich niemand, den Herrn nach deiner Herkunft zu fragen.« Mitleidig sah die Köchin Margret an. »Du bist schon ein armes Würmchen. Wirst wohl nie erfahren, wer deine Eltern waren und was mit ihnen geschehen ist.«
Margret sprang auf, umarmte die ältere Frau und rief: »Mir fehlt es an nichts, und solange du da bist, vermisse ich auch keine Eltern. So viele Kinder werden zu Waisen, den meisten ergeht es viel schlechter als mir. Dafür danke ich Gott jeden Abend vor dem Schlafengehen.«
»Du bist ein gutes Mädchen«, erwiderte Odilla leise. »Gott wird dich immer begleiten, ihm kannst du vertrauen, dass er dir den richtigen Weg zeigt.«
Die traute Zweisamkeit war nun vorbei, denn die anderen Bediensteten kamen in die Küche, um mit ihrer Arbeit zu beginnen. Auch Margret und Odilla machten sich daran, das Frühstück für den Herrn und seine Gäste zuzubereiten. Eine Weile dachte Margret noch an die Worte der Köchin. So oft sie die Geschichte auch schon gehört hatte – das Rätsel ihrer Herkunft würde wohl nie gelöst werden.
Um die Mittagszeit war auch der letzte Gast davongeritten, und Margret konnte mit dem Säubern der Halle beginnen. Sie wischte gerade Erbrochenes auf, als Odilla zu ihr trat.
»Margret, der Herr möchte dich sprechen!« Sie war sichtlich aufgeregt.
»Mich?«, fragte Margret erstaunt.
»Du sollst sofort in sein Arbeitszimmer kommen«, stieß die Köchin hervor. »Beeil dich, Mädchen, der Herr ist sehr ungeduldig.«
Trotzdem lief Margret erst in die kleine Dachkammer hinauf, die sie mit vier anderen Mädchen teilte, und band sich eine frische Schürze über ihren Kittel. Einen Kamm besaß Margret nicht, so fuhr sie sich mit den Fingern durchs Haar, nahm es mit einem Faden zusammen und band ein Kopftuch darüber. Margret hoffte, ordentlich auszusehen. Einen Spiegel gab es in dieser Kammer nicht.
Wenig später klopfte sie an die Tür des Arbeitszimmers.
»Herein«, ertönte die tiefe Stimme des Herrn. Zögernd, den Blick gesenkt, trat Margret in den Raum mit den dunkel getäfelten Wänden.
Edmund Cardingham musterte das Mädchen aus zusammengekniffenen Augen. Groß war sie für ihr Alter und, obwohl noch ein halbes Kind, zeigte ihr Körper an den richtigen Stellen bereits wohlgeformte Rundungen. Sie war recht ansehnlich, das musste er zugeben, und gut, dass sie ihr rotes, lasterhaftes Haar mit einem Tuch bedeckt hatte.
»Setz dich, Margret.«
Margret wunderte sich immer mehr. Nie zuvor war sie aufgefordert worden, sich in seiner Gegenwart zu setzen. In ihrem Magen grummelte es unangenehm. Instinktiv spürte Margret, dass die plötzliche Freundlichkeit des Herrn einen besonderen Grund hatte, aber auch, dass sie nicht sicher war, ob sie diesen erfahren wollte. Sie setzte sich auf die Kante eines mit dunkelgrünem Samt gepolsterten Stuhls, faltete die Hände in ihrem Schoß und hielt den Blick weiter gesenkt.
Cardingham räusperte sich, dann sagte er: »Du fragst dich sicher, warum ich dich herkommen ließ?« Margret nickte. »Weißt du, dass heute ein besonderer Tag ist?«, fuhr er fort. »Heute vor zwölf Jahren bist du in diesem Haus aufgenommen worden.«
»Ihr kennt das genaue Datum?«, entfuhr es Margret. Sogleich überzog eine flammende Röte ihre Wangen.
»Diesen Tag werde ich niemals vergessen«, erwiderte Cardingham erstaunlich gelassen. »Es war der Wille meiner Frau, sich deiner anzunehmen, und in ihrer Todesstunde gab ich ihr das Versprechen, für dich zu sorgen. Das habe ich getan, nicht wahr, Mädchen?« Edmund Cardingham sah Margret eindringlich an, und sie nickte wortlos. Dann fuhr er fort, Margret hörte die Selbstgefälligkeit in seiner Stimme: »Du hast nie einen Grund gehabt, über etwas zu klagen. Ich gab dir immer genug zu essen, du hast ein dichtes Dach über dem Kopf und erhältst zweimal im Jahr ein neues Gewand. Wie man sieht, ist aus dir eine gut gewachsene junge Frau geworden, man könnte dich geradezu hübsch nennen.« Margrets Wangen nahmen die Farbe ihres Haares an, denn seine Worte waren ihr peinlich. Worauf wollte der Herr hinaus? Sie wagte nicht zu sprechen, Cardingham erwartete auch keine Antwort. Mit einem zufriedenen Lächeln lehnte er sich zurück und ließ die Katze aus dem Sack: »Somit bin ich der Ansicht, es ist an der Zeit, dass du für dich selbst sorgst. Du bedarfst meiner Unterstützung nicht länger und bist alt genug, dich anderswo als Magd zu verdingen.«
Margret erstarrte. Langsam hob sie den Blick und sagte leise: »Aber ... Herr, ich habe doch hier meine Arbeit. Seid Ihr mit mir nicht mehr zufrieden? Ich werde mich in Zukunft mehr anstrengen, ich verspreche es, aber bitte schickt mich nicht fort!«
Cardinghams Blick verfinsterte sich. Er hatte geahnt, dass sie Schwierigkeiten machen würde. Sie war schließlich der Ableger einer Hexe. Er musste sie loswerden, bevor das schändliche Erbe ihrer Mutter in ihr ausbrach. Es war allgemein bekannt, dass Mädchen, sobald sie zu Frauen heranwuchsen, die Fähigkeiten der schwarzen Magie entwickelten.
»Widersprich mir nicht!«, sagte er bestimmt. »Ich will dich in diesem Hause nicht mehr haben. Das Versprechen, das ich meiner Frau auf deren Sterbebett gab, habe ich erfüllt. Du bist jetzt beinahe erwachsen, und ich fühle ich mich für dich nicht länger verantwortlich.«
»Warum darf ich nicht bleiben?«, flüsterte Margret mit tränenerstickter Stimme. Vor diesem furchteinflößenden Mann wollte sie nicht weinen, konnte aber nicht verhindern, dass ihre Augen feucht wurden.
Cardingham sprang auf, trat hinter sie und riss ihr mit einem Ruck das Tuch vom Kopf. Dann packte er sie am Arm und zerrte sie vor den Spiegel, der über der Feuerstelle hing.
»Sieh genau hin, Mädchen! Das gleiche rote Haar wie deine Mutter, dieselben Augen! Nein, in meinem Haus will ich keinen Tag länger eine Hexe beherbergen!«
Im letzten Herbst war Margret von einem Ziegenbock in den Magen getreten worden. Es war ihre Schuld gewesen, denn sie hatte das störrische Tier geneckt. Den gleichen Schmerz wie damals spürte Magret nun auch bei Cardinghams Worten. Zum ersten Mal hatte er ihre Mutter erwähnt. Aus seinen Worten schloss Margret, dass er sie gekannt hatte. Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen, sah Cardingham offen an und fragte zaghaft: »Ihr sprecht von meiner Mutter. Wo ist sie? Was ist mir ihr geschehen? Sie war doch keine Hexe!«
Sam knurrte verächtlich: »Sie war eine Hexe, wie sie im Buche steht. Für ihr schändliches Tun erhielt sie die gerechte Strafe auf dem Scheiterhaufen.«
Der Boden unter Margrets Füßen schien zu schwanken. Halt suchend klammerte sie sich an den Kaminsims. Aus Cardinghams Miene las sie, dass er die Wahrheit sprach.
»Was ist geschehen?«, flüsterte sie heiser. »Ich habe ein Recht, die Wahrheit über meine Mutter zu erfahren.«
»Gut, ich will dir die Geschichte erzählen.« Cardingham seufzte. »Es war genau heute vor zwölf Jahren, als ich nach Winchcombe fuhr, um auf dem Markt meine Wolle zu verkaufen …«
Nun erfuhr Margret die Umstände, unter denen sie nach Chaddlewood House gekommen war. Je länger Edmund Cardingham sprach, desto elender fühlte sie sich. Unmissverständlich machte er ihr klar, dass er sie als Tochter des Teufels sah, und sie erkannte, dass es sinnlos war, ihn zu bitten, sie nicht aus dem Haus zu weisen. Der Herr wollte sie so schnell wie möglich loswerden.
»Nun weißt du alles«, endete er. »Du wirst noch heute mein Haus verlassen, allerdings wirst du nicht völlig mittellos sein. Den Schmuck, den deine Mutter meiner Frau aushändigte, habe ich für dich aufbewahrt. Er soll von deinem Vater stammen. Was ich davon halte, weißt du inzwischen, aber ich bin ja kein Unmensch.«
Aus einer Truhe nahm Cardingham einen in ein Tuch gewickelten Gegenstand und reicht ihn Margret.
Sie schlug das Tuch zurück. Ihr stockte der Atem, als sie den glänzenden Anhänger erblickte. Sie zweifelte nicht daran, dass es sich um echtes Gold handelte. In Form eines Kreuzes waren sechs blutrote Edelsteine in das edle Metall eingearbeitet. Das Schmuckstück war fast einen Fingerbreit dick, offenbar war es ein Medaillon.
»Kann man es öffnen?«, fragte sie.
Cardingham schüttelte den Kopf. »Ich habe es bereits versucht. Es sieht zwar aus wie ein Medaillon, einen Mechanismus zum Öffnen konnte ich aber nicht finden. Gib gut darauf acht, Mädchen, der Schmuck ist sehr wertvoll. Du kannst ihn verkaufen und von dem Geld deinen Lebensunterhalt bestreiten.«
»Verkaufen?« Margret drückte das Medaillon an ihre Brust. »Niemals! Ihr sagt, meine Mutter habe es von meinem Vater erhalten. So ist es das Einzige, das mich mit meinen Eltern verbindet.«
»Du kannst damit machen, was du willst.« Cardingham zuckte mit den Schultern. »Gebe Gott, dass du nicht dazu gezwungen sein wirst, das Schmuckstück zu veräußern. Nun geh, Mädchen! Trotz allem wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute. Sollte der Satan über dich kommen und dich auf den Weg deiner Mutter führen wollen, dann bitte Gott um Hilfe und vertraue auf seine Güte. Vielleicht ist deine Seele noch nicht restlos verloren.«
Mit einem Wink gab er ihr zu verstehen, dass sie gehen sollte. Margret rannte beinahe panisch aus dem Zimmer, zu aufgewühlt, um einen klaren Gedanken fassen zu können.
»Du sollst eine Hexe sein? Einen solchen Unsinn habe ich ja noch nie gehört!« Odilla sah das junge Mädchen fassungslos an. »Wie kommt der Herr nur auf einen solchen Gedanken?«
»Natürlich habe ich mit Magie nichts zu tun«, empörte sich Margret, »aber ich bin die Tochter einer Hexe, und der Herr meint, das böse Blut sei auch in mir.«
»Ausgerechnet an deinem Geburtstag schickt Cardingham dich fort!« Aus Odillas sonst gutmütigen Augen sprühten Funken der Wut. »Ich werde mit ihm sprechen! Ich werde …«
»Bitte nicht!« Margret hielt sie zurück. »Es hat keinen Sinn, er ist der Herr, und du riskierst nur, dass auch du gehen musst.«
Die Köchin zögerte. Sie sah ein, dass sie bei Cardingham nichts ausrichten würde. Hatte der Herr einmal einen Entschluss gefasst, konnte nichts und niemand ihn davon abbringen.
»Was willst du jetzt tun?«, fragte sie besorgt. »Du bist noch ein halbes Kind!«
»Ich kann arbeiten und fürchte mich nicht, hart anzupacken. Wie der Herr sagte: Ich werde mir eine Stellung als Magd suchen, große Häuser gibt es zahlreich in unserer Gegend. Den Anhänger werde ich aber niemals verkaufen!«
Odilla betrachtete das Schmuckstück und versuchte ebenfalls erfolglos, es zu öffnen.
»Ich verstehe nichts von Schmuck«, sagte sie, »denke aber, dass das Medaillon viel Geld einbringen könnte. Ich verstehe, dass du das einzige Erinnerungsstück an deine Eltern behalten willst. Möge Gott auf deinem künftigen Weg schützend seine Hand über dich halten, Margret.«
Kapitel 2
Eine Stunde später hatte Margret ihre wenigen Sachen zu einem Bündel geschnürt und war zum Gehen bereit. Die Verabschiedung zwischen ihr und Odilla verlief kurz und ohne Emotionen, diese hätten sie nur traurig gestimmt. Jem, der Stallbursche, musste für Cardingham in Winchcombe etwas erledigen und würde Margret dorthin mitnehmen. Margret war noch nie in der Stadt gewesen, denn Cardingham war immer nur mit Jem zu den zweimal im Jahr stattfindenden Markttagen gefahren. Nun wollte sie an den Ort, an dem ihre Mutter hingerichtet worden war. Vielleicht würde es ihr gelingen, mehr über die damaligen Umstände zu erfahren, oder sie fand jemanden, der ihre Mutter gekannt hatte. Von Odilla wusste Margret, dass Jem die Herrschaften damals kutschiert hatte, von ihm konnte sie aber nichts erfahren. Vor acht Jahren war Jem an den schwarzen Pocken erkrankt. Er hatte zwar überlebt, seitdem war er aber stumm, und auch sein Verstand hatte sich verwirrt. Auf Margrets Frage, ob er sich an den Tag vor zwölf Jahren erinnerte, reagierte Jem überhaupt nicht.
Während der Fahrt über die engen, gewundenen Wege durch die Hügel der Cotswolds dachte Margret nach. Am Morgen war sie als heimatloses Findelkind erwacht, und jetzt hatte sie zumindest einen Hinweis auf ihre Mutter. Aber die Gewissheit, von einer Hexe abzustammen, beunruhigte Margret mehr, als sie es sich Odilla gegenüber hatte anmerken lassen.
Als sie auf dem Marktplatz von Winchcombe vom Wagen stieg, dankte Margret Jem und verabschiedete sich freundlich. Er reagierte nicht, ihr Schicksal war ihm gleichgültig. Margret sah sich um. Ordentliche Häuser, zwei oder gar drei Stockwerke hoch, entweder aus dem gelben Stein der Gegend oder aus schwarz-weißem Fachwerk erbaut und mit spitzen Giebeln, drängten sich dicht an dicht um den Marktplatz herum. Der gedrungene quadratische Kirchturm überragte alle anderen Gebäude, und just in diesem Moment schlug die Stundenglocke. Margret zählte drei Schläge.
Das Haus des Bürgermeisters stach Margret ins Auge. Mit in Blei gefassten Fensterscheiben, die Rahmen mit kunstvollen Schnitzereien verziert und an der hölzernen Tür ein massiver Klopfer aus Messing, war es das prächtigste am Platz. Margret atmete tief ein, nahm ihren ganzen Mut zusammen und klopfte. Die Schläge hallten dumpf wider. Es dauerte nicht lange, bis sie Schritte hörte. Die Tür öffnete sich, und Margret stand einer älteren, streng dreinblickenden Frau gegenüber.
Sie warf einen flüchtigen Blick auf Margret, sagte harsch, »Wir geben nichts!«, und wollte die Tür wieder schließen.
»Einen Augenblick!«, rief Margret. »Ich möchte den Bürgermeister sprechen.«
Die Frau musterte das fremde Mädchen von Kopf bis Fuß. Ihr Blick war missbilligend. »Was willst du?«, blaffte sie.
»Ich möchte den Herrn Bürgermeister etwas fragen«, antwortete Margret und sah der Älteren furchtlos in die Augen. Diese stemmte die Hände in die Seiten und lachte. Es war aber kein fröhliches Lachen, sondern hochmütig und abwertend.
»Glaubst du wirklich, der Herr Bürgermeister würde mit jeder Dahergelaufenen sprechen? Er hat wichtige Geschäfte zu erledigen. Außerdem ist er nicht da. Wir erwarten ihn frühestens in vier Wochen von seiner Reise zurück.«
Noch während der letzten Worte warf die Frau die Tür wieder zu. Margret seufzte. Sie wollte lediglich in Erfahrung bringen, warum ihre Mutter als Hexe angeklagt worden war. Sie wandte sich um, ihr Blick fiel auf die Kirche. Der Pfarrer! Dieser hatte bestimmt einen wichtigen Part in dem Prozess innegehabt.
In der Kirche hatte Margret Glück. Der Geistliche begrüßte sie freundlich und war bereit, sich Margrets Geschichte und ihre Fragen anzuhören. Als sie geendet hatte, schüttelte er bedauernd den Kopf.
»Mädchen, es tut mir leid, dir nicht weiterhelfen zu können. Der Prozess war Jahre vor meiner Amtszeit in Winchcombe, ich habe aber davon gehört. Seitdem gab es keine weitere Hexenverbrennung in der Stadt.«
»Wisst Ihr, was meiner Mutter zur Last gelegt wurde?«
»Wahrscheinlich das Übliche: Vieh wurde krank oder starb, nachdem die Frau auf den Weiden gesehen wurde, Kinder wurden tot geboren, oder es gab Missernten. Ich bin sicher, mein Vorgänger und alle Beteiligten haben den Fall intensiv geprüft und nach den geltenden Gesetzen gehandelt.«
»Kennen Sie den Namen meiner Mutter?«
»Nein, und wenn ich dir einen Rat geben darf: Forsche nicht nach, Mädchen. Danke Gott, dass gute Christen dir ein Heim gegeben haben.«
Margret war enttäuscht. Ihre Hoffnung, in Winchcombe etwas über ihre Mutter zu erfahren, hatte sich zerschlagen.
»Dem Gerede nach hat deine Mutter in Sudeley Castle in der Küche gearbeitet«, fügte der Geistliche hinzu.
»Sudeley Castle?« Margret war dieser Name unbekannt. »Wer wohnt dort, und liegt das Schloss in der Nähe?«
Er sah sie überrascht an und fragte: » Du weißt nicht, dass die Königin in Sudeley lebt? Es liegt keine Meile von der Stadt entfernt.« Von welcher Königin sprach der Priester, fragte sich Margret. König Edward war noch viel zu jung, um eine Frau zu haben.
»Ich weiß kaum etwas über den König und die Königin«, murmelte sie verlegen. »Dort, wo ich bisher gelebt habe, wurde darüber nicht gesprochen.«
Der Priester runzelte die Stirn und sah Margret skeptisch an.
»Ich hoffe, du bist eine treue Untertanin von König Edward und eine gute Christin?«
»Das bin ich! Ich mag zwar arm und ungebildet sein, gehe aber jeden Sonntag in die Kirche und bete abends, bevor ich einschlafe. Würdet Ihr mir von dem Schloss, in dem meine Mutter gearbeitet hat, erzählen?«
Sie sah den Geistlichen so flehend an, dass dieser zu erklären begann: »Thomas Seymour, der Onkel des Königs, heiratete Königin Katherine, die Witwe unseres guten Königs Heinrich. Sie hat sich vom Hof zurückgezogen und lebt glücklich und zufrieden mit ihrem jungen Gemahl in Sudeley Castle. Häufig weilt Prinzessin Elisabeth bei ihnen. Katherine hat ein besonders herzliches Verhältnis zu der jungen Prinzessin.«
Für Margret waren das alles nur Namen, unter denen sie sich keine Menschen vorstellen konnte. Sie bedankte sich mit einem Knicks und sagte: »Ich werde nach Sudeley gehen. Vielleicht hat man dort Arbeit für mich.«