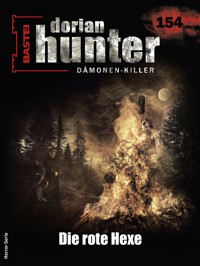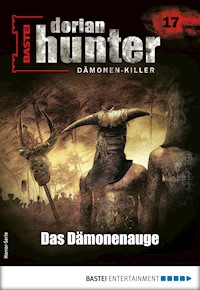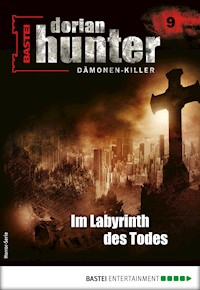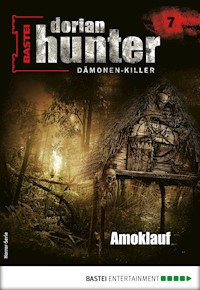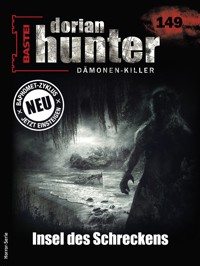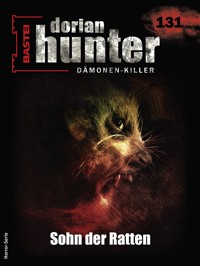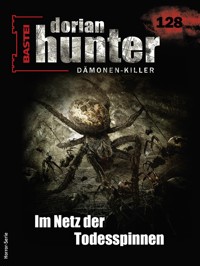1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
Ihre Beine gaben nach. Sie zitterte vor Grauen am ganzen Leib.
»Hilfe!«, schrie sie mit versagender Stimme.
Sie wandte sich nach links und verfing sich in einigen Ästen. Die Wölfe liefen auf sie zu. Einer schnappte nach ihrem rechten Bein und verbiss sich in den Jeans, ohne sie zu verletzen. Ein zweiter sprang sie von hinten an und riss sie zu Boden.
»Nicht! Bitte nicht!«, wimmerte Jutta.
Das Knurren der Wölfe wurde lauter. Einer zerrte an ihrer Bluse und riss sie in Stücke. Das junge Mädchen heulte auf, als sich scharfe Zähne in ihrem rechten Oberarm verbissen. Sie versuchte sich aufzurichten, doch in diesem Augenblick sprang ein Wolf auf ihren Rücken. Heißer Atem strich über ihren Nacken, dann spürte sie den Druck der spitzen Zähne, die sich leicht in ihren Hals verbissen.
Sie wagte sich nicht mehr zu bewegen und schloss die Augen. Das ist das Ende, dachte sie, dann wurde sie bewusstlos ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
DER WERWOLF UND DIE WEISSE FRAU
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen.
Bald kommt Dorian seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.
Als Rückzugsort in seinem Kampf bleibt Dorian neben der Jugendstilvilla in der Baring Road in London noch das Castillo Basajaun in Andorra, in dem er seine Mitstreiter um sich sammelt – darunter die ehemalige Hexe Coco Zamis, die aus Liebe zu Dorian die Seiten gewechselt hat. Kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Martin versteckt Coco diesen zum Schutz vor den Dämonen an einem Ort, den sie selbst vor Dorian geheimhält.
Bald darauf veranlassen die Erinnerungen an seine Existenz als Michele da Mosto Dorian, nach der Mumie des Dreimalgrößten Hermes Trismegistos zu forschen. Er findet jedoch »nur« den Steinzeitmenschen Unga, der Hermon einst gedient hat und der sich nach seinem Erwachen schnell den Gegebenheiten der Gegenwart anpasst.
Auf Island gewinnt Dorian den Kampf um das Erbe des Hermes Trismegistos und richtet sich in dessen Tempel ein. Wie es sein Vorgänger Grettir prophezeit hat, verspürt Dorian schon bald keinen Drang mehr, in sein altes Leben zurückzukehren, zumal er von seinen Freunden seit Monaten für tot gehalten wird: Nur Coco, die einen Doppelgänger von Dorian vernichtet hat, weiß, dass er, ausgestattet mit den Kräften des Hermes Trismegistos, die Gestalt des harmlosen Richard Steiner angenommen hat.
Kurz darauf erwachen in Dorian Erinnerungen an sein fünftes Leben als Tomotada: Wie damals ist der »Samurai des Teufels« auch heute wieder als Diener des Kokuo no Tokoyo alias Olivaro aktiv, der seinerseits von seinen Artgenossen, den Janusköpfen, verfolgt wird. Es gelingt Dorian, das Geheimnis des »erweckten« Tomotada zu ergründen. Es handelt sich um Tomotadas Sohn, der nach seinem Tod keine Ruhe fand, weil er seinen »Blütenstengel des Lebens«, seine Nabelschnur, vermisste. Dorian bringt diese Tomotada zurück, und der Samurai richtet sich selbst, indem er die Nabelschnur vernichtet. Aber damit ist die Bedrohung durch die Janusköpfe noch nicht eliminiert ...
DER WERWOLF UND DIE WEISSE FRAU
von Neal Davenport
Jutta Hauser pfiff vergnügt vor sich hin. Der schmale Waldweg war voller Löcher. Zu beiden Seiten wuchsen hohe Tannen und Fichten. Normalerweise fuhr Jutta über die gut ausgebaute Landstraße, doch heute hatte sie sich für den Waldweg entschieden, der eine Abkürzung zum Haus ihrer Eltern war.
Ma wird mit mir schimpfen, dachte das fünfzehnjährige blonde Mädchen. Um zehn Uhr hätte sie zu Hause sein sollen, jetzt war es kurz vor elf Uhr.
»Soll sie ruhig schimpfen«, sagte Jutta laut und kicherte. Dann lächelte sie versonnen, während sie an die vergangenen Stunden dachte. Endlich nach so vielen Wochen hatte Werner plötzlich Interesse für sie gezeigt. Es kam ihr noch immer wie ein Wunder vor.
Lachend betätigte sie die Klingel. Irgendetwas raschelte in einem Gebüsch. Jutta wich geschickt einem tiefen Loch aus, stieg vom Fahrrad ab, hob es über eine dicke Luftwurzel, schwang sich wieder in den Sattel und fuhr weiter.
Wieder raschelte es im Unterholz. Sie blickte nach rechts, konnte jedoch nichts erkennen.
1. Kapitel
Plötzlich fiel ihr die Warnung ihres Vaters ein. Er hatte ihr ausdrücklich verboten, den Waldweg während der Nacht zu benutzen. Vor ein paar Jahren war hier ein Mädchen ermordet worden.
Von einem Augenblick zum anderen war ihre gute Laune wie weggeblasen. Sie stieg stärker in die Pedale.
Ein unheimliches Heulen erschreckte Jutta. Ihr Herz schlug schneller. Der Schein der Fahrradlampe glitt über einen Strauch, dessen Zweige leicht bewegt wurden.
Hinter dem Strauch hat sich jemand versteckt, dachte Jutta entsetzt. Keuchend radelte sie vorbei.
Irgendwo zerbrach ein Ast. Das Mädchen wagte nicht, den Kopf umzuwenden. Der schmale Waldweg mit den unzähligen Löchern erforderte ihre ganze Aufmerksamkeit.
Vor Angst begann Jutta zu schwitzen. Bitte, lieber Gott, betete sie, lass mich gut nach Hause kommen!
Sie schrie entsetzt auf, als ein riesiger Hund auf den Weg sprang. Nein, es war kein Hund, wie sie sofort feststellte. Es war ein grauer Wolf, ein ungewöhnlich großes Tier. Die Schulterhöhe betrug etwa einhundertvierzig Zentimeter, die Länge ungefähr zwei Meter.
»Hilfe!«, brüllte Jutta und versuchte, am Wolf vorbeizukommen. Das Tier brummte wütend und sprang sie an. Verzweifelt versuchte sie das Gleichgewicht zu halten, doch es gelang ihr nicht. Sie kippte nach links, ließ das Fahrrad fallen und warf sich vorwärts.
Vor Angst war sie zu keinem klaren Gedanken mehr fähig. Die Fahrradlampe erlosch; nur der hoch stehende Mond erhellte noch ein wenig den düsteren Waldweg.
Keuchend lief sie weiter. Langsam gewöhnten sich ihre Augen an das diffuse Licht. Nach ein paar Schritten blieb sie stehen und presste beide Hände vor die Brust.
Vor sich sah sie fünf glühende Augenpaare – fünf Wölfe, die auf den Hinterbeinen saßen und sie bösartig anknurrten.
Juttas Beine gaben nach. Sie zitterte vor Grauen am ganzen Leib.
»Hilfe!«, schrie sie mit versagender Stimme.
Sie wandte sich nach links und verfing sich in einigen Ästen. Die Wölfe liefen auf sie zu. Einer schnappte nach ihrem rechten Bein und verbiss sich in den Jeans, ohne sie zu verletzen. Ein zweiter sprang sie von hinten an und riss sie zu Boden. »Nicht! Bitte nicht!«, wimmerte Jutta.
Das Knurren der Wölfe wurde lauter. Einer zerrte an ihrer Bluse und riss sie in Stücke. Das junge Mädchen heulte auf, als sich scharfe Zähne in ihrem rechten Oberarm verbissen. Sie versuchte sich aufzurichten, doch in diesem Augenblick sprang ein Wolf auf ihren Rücken. Heißer Atem strich über ihren Nacken, dann spürte sie den Druck der spitzen Zähne, die sich leicht in ihren Hals verbissen.
Sie wagte sich nicht mehr zu bewegen und schloss die Augen. Das ist das Ende, dachte das junge Mädchen, dann wurde sie bewusstlos.
Jutta wusste nicht, wie lange sie bewusstlos gewesen war. Zögernd öffnete sie die Augen. Sie lag noch immer bäuchlings auf dem Waldweg.
Ich lebe!, war ihr erster verwunderter Gedanke. Sie wagte kaum zu atmen. Es war ruhig um sie herum; nur der Wind bewegte leicht die Zweige der alten Bäume.
Vorsichtig hob das junge Mädchen den Kopf. Von den Wölfen war nichts mehr zu sehen. Sie setzte sich langsam auf und blickte sich um. Ihr Fahrrad lag vor einer Fichte. Als sie den rechten Arm bewegte, stöhnte sie leise. Ihr Oberarm schmerzte und war stark angeschwollen. Die weiße Bluse hing in Fetzen herunter. Jutta versuchte den rechten Arm zu heben, doch es gelang ihr nicht; er war wie gelähmt. Sie stand auf und schloss die Augen. Alles drehte sich um sie herum.
Einige Minuten blieb sie ruhig stehen, dann hob sie das Fahrrad auf und schob es vor sich her. Aufsteigen wollte sie nicht. Der Schmerz in ihrem Oberarm breitete sich rasch weiter aus. Jede Bewegung fiel ihr schwer.
Sie war froh, als sie den Wald hinter sich gelassen hatte. Nur noch eine sanft ansteigende Wiese musste sie überqueren, dann hatte sie das Haus ihrer Eltern erreicht.
Das Fahrrad wurde ihr zu schwer. Sie ließ es einfach fallen und taumelte über die Wiese. Jetzt schmerzte auch ihr rechter Unterarm, und sie hatte rasende Kopfschmerzen, die ihr die Tränen in die Augen trieben.
Jutta wusste nicht, wie sie das Haus erreicht hatte. Sie wunderte sich auch nicht, dass die Eingangstür weit offen stand. Sie wankte die Stufen hoch und torkelte in die Diele. Vor dem Spiegel blieb sie einen Augenblick stehen. Ihr schulterlanges blondes Haar war feucht, das Gesicht schmutzig. Die weiße Bluse war voll Blut, und der Oberarm schillerte bläulich.
Das Mädchen klammerte sich an einem Türstock fest. Ihr wurde übel. Mühsam unterdrückte sie den Brechreiz. Schwer atmend trat sie ins Wohnzimmer.
Der runde Tisch und zwei Stühle waren umgeworfen worden. Juttas Mutter lag bewusstlos auf der Couch. Ihr Kleid war über der Brust zerrissen, und ihr linker Oberarm wies einen Wolfsbiss auf.
»Ma«, sagte Jutta leise und kam näher. »Ma!«
Doch ihre Mutter bewegte sich nicht. Jutta stolperte über den Teppich und fiel der Länge nach hin. Wenige Sekunden später versuchte sie aufzustehen, doch sie war zu schwach dazu. Einen Augenblick hob sie den Kopf und sah ihren Vater, der ebenfalls von den Wölfen angefallen worden war; er lag vor dem Fernsehapparat.
»Vater«, flüsterte Jutta, dann schloss sie die Augen und wurde bewusstlos.
Drei Monate waren seit dem Tod des Schwarzen Samurais vergangen, drei Monate, in denen sich nichts ereignet hatte.
Mir war es mittels meines Ys-Spiegels gelungen, das Tor zu verschütten, durch das die Janusköpfe zur Erde gelangt waren. Aber deshalb war die Gefahr nicht gebannt, die von den Janusköpfen drohte. Ich konnte nur hoffen, dass es den Janusköpfen nicht so rasch gelang, ein neues Tor zu unserer Welt zu bauen. Wenn ich daran dachte, dass Olivaro quasi der gute Hirte seines Volkes war, dann konnte ich mir lebhaft vorstellen, wie die anderen waren.
Von Luguri hatte ich auch schon lange nichts mehr gehört. Das neue Oberhaupt der Schwarzen Familie hatte sich irgendwohin zurückgezogen und brütete sicherlich neue Teufeleien aus.
Nachdem ich Hermes Trismegistos' Nachfolge angetreten hatte, war ich hauptsächlich in der Maske Richard Steiners aufgetreten. Der Dämonenkiller Dorian Hunter war für die Welt tot; nur meine Gefährtin Coco Zamis, Unga, Don Chapman und Dula wussten, dass ich lebte. Anfangs war es mir als eine gute Idee vorgekommen, in der Maske Rudolf Steiners aufzutreten, doch jetzt wurde mir diese Gestalt immer lästiger. Ich war zwar so groß wie Dorian Hunter und auch so alt, aber sonst unterschied sich Richard Steiner grundlegend vom Dämonenkiller, der ich einmal gewesen war. Mein Körper war dünn – fast dürr. Steiner hatte einen blassen Teint, Sommersprossen und eine brandrote Haarmähne; das Gesicht war schmal, die Stirn hoch, und dazu trug er noch eine Nickelbrille, die aus einem Museum zu stammen schien. Ich musste bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten als ängstlicher Tollpatsch erscheinen, der sogar gelegentlich rot wurde. Mit einem Wort – ich war zu einem Feigling geworden; eine Rolle, die mir gar nicht behagte.
Das waren aber nicht die einzigen Schwierigkeiten. Vor allem musste ich befürchten, dass ich mich früher oder später verraten würde. Außerdem hatte ich Angst vor Phillip, dem Hermaphroditen, denn ich war sicher, dass er wusste, wer sich hinter der Maske Richard Steiners verbarg.
Irgendwann würde Phillip einmal eine Andeutung machen. Dazu kam noch Abi Flindt, der ständig hinter mir herschnüffelte. Er hatte sich in die fixe Idee verrannt, dass Coco und Richard Steiner den Dämonenkiller ermordet hatten.
Das Leben im Castillo Basajaun war äußerst langweilig. In den vergangenen Tagen waren Trevor Sullivan, dem Leiter der »Mystery Press«, und Unga Meldungen zugegangen, wonach Luguri im Bayerischen Wald einen großen Coup planen sollte. Bei der nächsten Gelegenheit wollte ich nach Island springen und mich mit Unga darüber unterhalten.
Ich hatte allein sein wollen und einen kurzen Spaziergang unternommen. Langsam kehrte ich zur Burg zurück, die in einem Seitental des Valira del Norte lag. Ich überquerte die schmale Steinbrücke, blieb kurz stehen und musterte die Burg.
Sie war 1550 erbaut worden und unterschied sich grundlegend von den anderen spanischen Burgen, die ich kannte. Einige Gebäude und die Ringmauer, die einst die Burg umgaben, waren schon längst zerfallen. Nun bestand die Burg nur noch aus einem gewaltigen u-förmigen Gebäude, dessen Vorderfront etwa achtzig Meter lang war.
Missmutig ging ich die Schotterstraße entlang, die genau auf das Burgtor zuführte. Das dicke Doppeltor war eisenbeschlagen. Der zwanzig Pfund schwere Türklopfer hatte die Form eines Drachens. Über dem Tor befanden sich ein Portal und Tympanon – ein hohes Giebelfeld mit Reliefs – links und rechts eindrucksvolle Portalwände. Die Reliefs stellten seltsame Fabelwesen, Tiermenschen und Szenen mit Hexen und Teufeln dar. Durch geringfügige Retuschen wurden wirkungsvolle Dämonenbanner daraus. Auch sonst waren überall an den Mauern und vor den Fenstern Dämonenbanner angebracht.
Vor dem Doppeltor blieb ich stehen und betätigte den Türklopfer. Ich musste ziemlich lange warten, bis endlich das rechte Tor geöffnet wurde.
Coco blickte mir lächelnd entgegen. Trotz der langen Zeit, die wir uns kannten, faszinierte mich ihr Aussehen immer wieder. Das Gesicht mit den hoch angesetzten Backenknochen und den fast schwarzen Augen war ungemein anziehend. Der zitronenfarbene Hosenanzug unterstrich die Länge ihrer Beine und ihre üppigen Brüste.
Ich nickte ihr grinsend zu. Meine Laune hatte sich bei ihrem Anblick etwas gebessert.
Aufmerksam blickte Coco ins Freie, dann schloss sie das Tor. Wir durchquerten die Halle mit den vierundzwanzig Säulen. Etwa die Hälfte der Säulen war glatt, die andere war voll schauriger Reliefs; ich bezeichnete sie als »Bestiensäulen«.
»Weshalb bist du so nachdenklich, Richard?«, fragte sie.
Gott sei Dank hatte sie Richard gesagt. In letzter Zeit hatte sie mich oft, vor allem, wenn wir allein waren, zärtlich »Richie« genannt. So dumm es auch klingen mag – ich war fast auf die Maske eifersüchtig, die ich jetzt trug.
»Später«, sagte ich ausweichend.
Sie warf mir einen fragenden Blick zu, sagte aber nichts. Ein vertrauliches Gespräch wagte ich nur auf unserem Zimmer zu führen. Ich hatte Angst, dass uns Abi Flindt belauschte. Der blonde Däne spionierte mir immer nach.
Wir stiegen die breite Steintreppe hoch, die in den ersten Stock führte, und durchquerten den langen Korridor mit der Ahnengalerie. Auf der einen Seite befanden sich die Porträts der Alicantes, auf der anderen die der Quintanos. Die Burg war von Fernandes de Alicante erbaut worden, nachdem er als reicher Mann aus der Neuen Welt zurückgekommen war. Bis 1768 blieb die Burg im Besitz dieser Familie. In diesem Jahr wurden die Alicantes vom Inquisitor Enrique Quintano getötet, der dann die Burg übernahm. Mir war es gelungen, den letzten der Hexenjäger – Isidor Quintano – zur Strecke zu bringen. Seither hatte sich einiges in der Burg verändert. Der neue Besitzer der Burg war nun mein alter Freund Jeff Parker, der sie der Magischen Bruderschaft zur Verfügung gestellt hatte. Es gab nun hier elektrisches Licht und Telefon, und ein Faxgerät war installiert worden; einige Räume waren in Büros und Labors umgebaut worden, doch trotz dieser Veränderungen war noch ziemlich viel im ursprünglichen Zustand geblieben. Dafür hatte Ira Marginter, die Restauratorin aus Köln gesorgt.
Ich ging in den linken Seitentrakt, in dem sich die Büros befanden. Mich interessierte, ob neue Nachrichten von Trevor Sullivan eingetroffen waren. Doch ich wurde enttäuscht; es lagen keine Nachrichten vor.
Als ich das Büro verließ, kam uns Tirso entgegen. Ich zuckte ängstlich zusammen und trat einen Schritt zurück. Das gehörte auch zu meiner Rolle als Richard Steiner.
In der Burg war ich Tirsos beliebtestes Angriffsziel. Der Zyklopenjunge verfügte über ungewöhnliche Fähigkeiten, die er besonders gern an mir erprobte, sehr zum Vergnügen der anderen.
Tirso war über einen Meter vierzig groß. Das war für einen fünfjährigen Jungen anormal. Sein Kopf war unbehaart. Das Gesicht wurde von nur einem Auge beherrscht. Ungewöhnlich war auch seine blaue Hautfarbe. In den vergangenen Monaten hatte der Junge seine telekinetischen Fähigkeiten weiter entwickelt.
»Hallo, Tirso!«, sagte ich leise und starrte den Zyklopenjungen misstrauisch an.
Tirso stieß ein helles Lachen aus. Sein Auge fixierte mich. In letzter Zeit hatte er eine Vorliebe für derbe Späße entwickelt, die ich süßsauer grinsend über mich hatte ergehen lassen müssen. Einmal hatte er mittels seiner Fähigkeiten meinen Gürtel und meine Hose geöffnet, und plötzlich hatte ich vor allen in Unterhosen dagestanden.
»Keine dummen Scherze, Tirso!«, sagte ich streng.
Doch er hörte nicht auf mich. Unsichtbare Hände schienen nach meiner Nickelbrille zu greifen, packten sie und zogen die Bügel über meine Ohren. Die Brille schwebte einen Meter von mir entfernt in der Luft. Verärgert kniff ich die Augen zusammen, da ich stark kurzsichtig war. Ich griff nach der Brille. Sofort schwebte sie ein Stück nach rechts, und meine Hände griffen ins Leere.
»Zum Teufel, Tirso!«, knurrte ich. »Gib mir sofort meine Brille!«
Doch der Zyklopenjunge dachte nicht daran. Was mich aber am meisten an diesen kindischen Späßen störte – das war Cocos Verhalten. Sie griff in den seltensten Fällen ein.
Halb blind rannte ich der in der Luft schwebenden Brille nach. Dabei bewegte ich mich so tollpatschig wie ein Seehund an Land. Natürlich übersah ich den Stuhl, den Tirso in den Korridor gestellt hatte, und natürlich flog ich auch darüber und blieb keuchend liegen.