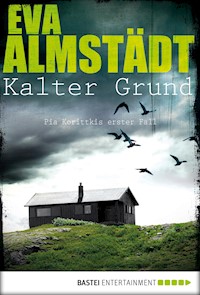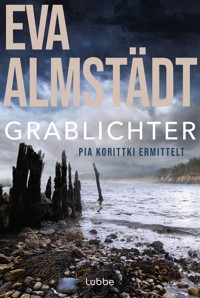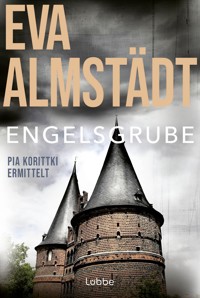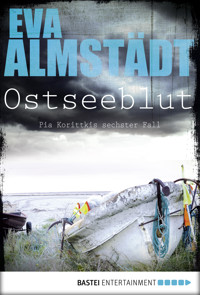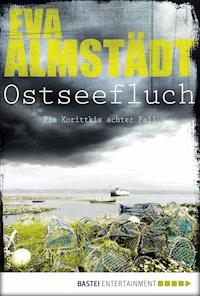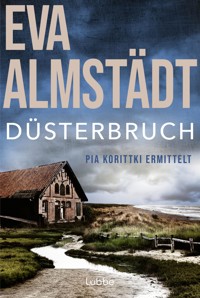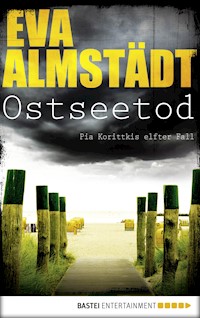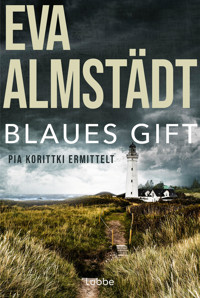11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie versprechen dir Schönheit und Jugend - doch der preis dafür ist tödlich ...
In Manhattan stürzt eine junge Frau von einer Feuertreppe. Das Gesicht der Toten ist das einer Greisin. Der Polizist Ryan Ferland ermittelt, doch die Schwester der Toten blockt alle Fragen ab. - Ein blinder Passagier wird von der Besatzung eines Containerschiffs entdeckt. Doch statt ihm zu helfen, übergibt man ihn an eine dubiose Hilfsorganisation. - Eine Ingenieurin macht in den indischen Labors eines internationalen Kosmetikkonzerns eine ungeheuerliche Entdeckung. Doch niemand glaubt ihr - bis etwas Unglaubliches passiert ...
Mit Dornteufel hat Bestsellerautorin Eva Almstädt einen packenden Thriller geschrieben, der den Leser bis zur letzten Seite nicht mehr loslässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Epilog
Nachwort
Über die Autorin
Eva Almstädt, 1965 in Hamburg geboren und dort auch aufgewachsen, absolvierte eine Ausbildung in den Fernsehproduktionsanstalten der Studio Hamburg GmbH und studierte Innenarchitektur in Hannover. Seit 2001 ist sie freie Autorin und sehr erfolgreich mit ihrer Reihe um die eigenwillige Kriminalkommissarin Pia Korittki, die in und um Lübeck ermittelt. Dornteufel ist Eva Almstädts erster Thriller.
Eva Almstädt
DORNTEUFEL
Thriller
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Karin Schmidt
Textredaktion: Dr. Arno Hoven
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven von © Ilona Wellmann / Trevillion Images
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-4570-1
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Prolog
MIDI-PYRÉNÉES, FRANKREICH
Der Fruchtkörper des Pilzes besaß einen dünnen Stiel mit einem eiförmigen Hut, der von gallertartigem Schleim überzogen war. Er hatte die Farbe von roher Leber. Wie viele seiner Art stellte auch dieser, ähnlich einer kleinen chemischen Fabrik, über zwanzig für ihn charakteristische Stoffe her.
Professor Eduard Konstantin hatte ein paar Exemplare des Pilzes von einem befreundeten Ethnologen aus Südamerika geschickt bekommen. Der Ethnologe war, während er mit einer indigenen Gruppe im Amazonasgebiet gelebt hatte, auf eine außergewöhnliche Heilmethode gestoßen. Zunächst ließen die Indios den Pilz auf der Haut sterbenskranker Menschen wachsen – allerdings nicht, um die Todgeweihten doch noch zu heilen, sondern um einen Wirkstoff zu erhalten, der sich auf diese Weise im Pilz bildete. Mit der gallertartigen Flüssigkeit, die der Fruchtkörper des Pilzes absonderte, rieb man anschließend menschliche Haut ein, an der sich sowohl eine heilende als auch eine dramatisch verjüngende Wirkung zeigte.
Professor Konstantin hatte inzwischen herausgefunden, dass der Pilz mithilfe eines Nährstoffes aus menschlichem Hautgewebe ein noch unbekanntes Enzym synthetisierte. Ein Enzym, dessen Einsatz die Kosmetik revolutionieren würde. Doch lange konnte er nicht mehr mit seinem einzigen, hirntoten Probanden experimentieren. Dessen Rücken war bereits vollständig von dem Myzel des Pilzes zerstört. Er hatte es auch mit Mäusen, Ratten, sogar mit einem Schwein versucht – ohne Erfolg. Er brauchte Menschen.
1. Kapitel
BIHAR, INDIEN
Das Metalltor schob sich langsam seitwärts, bis von der indischen Nacht nichts mehr zu sehen war. Es rastete mit einem endgültig klingenden Klacken ein. Julia Bruck stand in einer Schleuse, umgeben von fünf Meter hohen Wänden aus Beton und Stahl. Die Minuten schlichen dahin, und nichts passierte. Nach einer Weile hielt sie das Herumstehen nicht mehr aus und ging langsam auf und ab. Das Geräusch ihrer Schritte hallte von den harten Wandflächen wider. Entspannt bleiben, ermahnte sie sich. Das hier war nichts als eine kleine Machtdemonstration ihres neuen Auftraggebers.
Über die Forschungsmethoden des Kosmetikkonzerns Serail Almond und vor allem über den Umgang mit Mitarbeitern und Probanden kursierten ein paar hässliche Gerüchte. An die hatte sich Julia prompt erinnert, als auf der Herfahrt der gläserne Baukörper des Forschungszentrums in der Dunkelheit vor ihr aufgetaucht war. Wie das Facetten-Auge einer überdimensionalen Fliege hatte er ausgesehen, bläulich schimmernd – ein Fremdkörper zwischen den Feldern und Dörfern des indischen Bundesstaates Bihar. Beim Näherkommen waren ihr dann die hohen Mauern und die Masten mit den Scheinwerfern und Kameras aufgefallen, die das Forschungszentrum umgaben: eine moderne Festung mitten in Indien, rund achttausend Kilometer von Deutschland entfernt. Und nun die Prozedur mit der Schleuse … Na ja, wenn es ihr hier nicht gefiel, konnte sie ja jederzeit wieder gehen. Nur eben gerade jetzt nicht, da sie von Beton-und Stahlwänden eingeschlossen war.
Wahrscheinlich hatte dieser Tony Gallagher sie mit seiner Nervosität angesteckt. Die Reise von Frankfurt nach Neu-Delhi und der Anschlussflug nach Patna hatten insgesamt fünfzehn Stunden gedauert. Am Lok Nayak Jayaprakash Airport war Julia von Tony Gallagher mit einer konzerneigenen Limousine abgeholt worden. Als Ingenieurin für Versorgungstechnik war sie von ihrem Arbeitgeber, der ICL Thermocontrol GmbH, nach Indien geschickt worden, um die Klima- und Lüftungsanlage ihres Kunden, des Forschungszentrums von Serail Almond, zu sanieren und zu erweitern. Reinraum-Klimatechnik für Laborse war Julias Spezialgebiet.
Tony Gallagher, der Facility-Manager von Serail Almond India, war für dieses Projekt mitverantwortlich. Heute war er nicht gerade zu Smalltalk aufgelegt gewesen. Während der Fahrt in dem gepanzerten BMW hatte er die meiste Zeit aus dem Fenster gestarrt und dabei seine sommersprossigen Hände so stark geknetet, dass die Gelenke knackten. Der indische Bundesstaat Bihar, durch den sie fuhren, galt als einer der rückständigsten und ärmsten Indiens, hatte er ihr erklärt. Sowohl er als auch der indische Fahrer hatten eine Waffe getragen. In der Umgebung hier wimmele es von Räubern und Schlimmerem, war Gallaghers Kommentar zu Julias interessiertem Blick auf sein Schulterholster gewesen. Die nicht asphaltierte, vom Monsunregen ausgewaschene Straße war Julia bedrohlicher erschienen als die Aussicht, hier Ganoven in die Hände zu fallen. Auf sie wirkte der Verkehr in der Dunkelheit geradezu infernalisch: Von Rädern über unbeleuchtete Ochsenkarren bis hin zu motorisierten Fahrzeugen aller Art – einschließlich Doppelstock-Reisebussen – war hier eigentlich alles unterwegs, was fahren und etwas transportieren konnte. Nach eineinhalb Stunden war der Fahrer auf eine neu asphaltierte Straße abgebogen. Eine der Wohltaten von Serail Almond, vermutete Julia. Bis auf ein paar LKWs, die sie überholten, waren sie danach allein durch die Nacht gefahren.
Ein Lautsprecher knisterte. In der linken Wand der Schleuse befand sich ein Fenster. Dahinter leuchtete jetzt ein mattes Licht. Ein uniformierter Inder tauchte jenseits der Glasabtrennung auf und räusperte sich.
»Miss Bruck? Willkommen bei Serail Almond. Ihren Reisepass bitte.«
Julia zog ihren Ausweis aus der Tasche und legte ihn in eine ausfahrende Schublade.
Der Mann sah sich das Dokument aufmerksam an. »Und Ihr Mobiltelefon. Alle, wenn Sie mehrere haben.«
»Wie bitte?«
»Ist Vorschrift.« Er konnte sie anstarren, ohne zu zwinkern.
»Bekomme ich es zurück?«
»Privathandys sind hier nicht erlaubt.«
Sie war im Begriff, sich zu weigern, aber sie wollte raus aus der Schleuse. Also legte sie ihr Telefon ebenfalls in die Lade. Die Schublade glitt wieder rein, und es war verschwunden.
»Haben Sie ein Notebook, Palmtop, Blackberry oder Ähnliches bei sich?«, schnarrte es aus dem Lautsprecher.
»Was wollen Sie denn damit?« Bei den Firmen, für die sie sonst arbeitete, reichte es normalerweise aus, einen Einfuhrschein auszufüllen.
»Ist Vorschrift.«
»Ich brauche mein Notebook. Da sind alle meine privaten Daten drauf; das gebe ich nicht aus der Hand.«
»Ist Vorschrift.«
»Darüber wird man doch reden können. Lassen Sie mich jetzt rein! Oder soll ich wieder gehen?«
Seine Miene blieb ausdruckslos.
»Ist Ihr Vorgesetzter zu sprechen?«, fragte Julia gereizt. Sie hatte sich schon gedacht, dass es eine Umstellung sein würde, für einen Kunden wie Serail Almond zu arbeiten. Bisher war sie von ICL Thermocontrol als Klimatechnik-Ingenieurin eher in mittelständischen Unternehmen eingesetzt worden. Der Kosmetikkonzern Serail Almond hingegen war ein internationales Großunternehmen, das in Bihar eines der größten Hautforschungszentren der Welt unterhielt. Heute schon wissen, was die Haut morgen braucht, lautete Serail Almonds Unternehmensphilosophie. Mit sechzig Tochterunternehmen und so bekannten Marken wie Skin-o-via oder Canella Polar deckten sie sowohl den internationalen Massenmarkt als auch das Premiumsegment der Hautpflege ab. Julia hatte recherchiert – sie wusste das alles. Was sie jedoch nicht erfahren hatte, war die Vorgehensweise bei ihrer Ankunft: Was sie hier erlebte, erinnerte sie an eine Inhaftierung.
Der Pförtner griff zum Telefon und sprach mit jemandem, ohne dass Julia ein Wort davon verstehen konnte. Dann tat er so, als habe er etwas im Hintergrund seines Kabuffs zu tun.
»Was ist jetzt?«, fragte sie.
Keine Reaktion.
Sie klopfte gegen die Scheibe. »Hallo? Antworten Sie mir! Und wo ist eigentlich Mr. Gallagher abgeblieben?«
Er ignorierte sie und verließ den kleinen Raum durch eine Hintertür. Sie war wieder allein. Langsam kam es Julia so vor, als würden sich die Wände der Schleuse auf sie zubewegen. So in etwa musste sich ein Verurteilter fühlen, wenn er sein zukünftiges Gefängnis betrat. Hilflosigkeit, kombiniert mit … böser Vorahnung?
Sie wollte nur ein halbes Jahr als Expat in Indien verbringen. Nachdem sie vier Jahre lang als Ingenieurin bei ICL in Deutschland gearbeitet hatte, waren ihr wohl doch die Gene ihrer Eltern in die Quere gekommen: Fabian und Beatrice Bruck hatten als Varietékünstler die Welt bereist und nie einen festen Aufenthaltsort besessen. Ihr Vater entstammte einer waschechten Artistenfamilie; ihre Mutter hatte sich als junges Mädchen in den Mann und wohl auch in das Künstlerleben verliebt. Tragischerweise waren beide vor drei Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen, der nicht einmal etwas mit ihrem Beruf zu tun gehabt hatte. Julia vermisste sie sehr, doch das Artistenleben, den unsteten, abenteuerlustigen Lebensstil, hatte sie immer verabscheut. Zumindest glaubte sie das. Ihr oberstes Ziel war es gewesen, ein bürgerliches Leben zu führen und sich darauf verlassen zu können, dass ihr jeden Monat ein gutes Gehalt überwiesen wurde. Das war auch ein paar Jahre lang gut gegangen. Aber als sich die Chance ergeben hatte, die Abteilung zu wechseln und nach Indien zu gehen, war es passiert: Ihr Job in Deutschland war ihr mit einem Mal öde vorgekommen. Die Aussicht auf eine neue Aufgabe und vor allem auf das Leben in einem fremden Land hatten sie gereizt.
Das alles ging ihr in der Schleuse durch den Kopf, bevor sie sich die Frage stellte, warum sie sich jetzt so schrecklich hilflos fühlte. Wie schnell hatte sich die Situation ihrer Kontrolle entzogen? Sie rief noch mal nach dem Pförtner und forderte ihn auf, sie rein- oder rauszulassen. Nichts passierte. Die Blöße, an den Toren nach einem Griff oder Schalter zu suchen und womöglich daran zu rütteln, gab Julia sich nicht. Sie fühlte, dass sie beobachtet wurde. Da, wo man Lautsprecher installierte, waren auch Kameras nicht weit. Julia lehnte sich gegen die Wand, weil ihr die Füße und der Rücken wehtaten. Der Beton fühlte sich kühl an. Draußen herrschten trotz der nächtlichen Stunde noch Temperaturen von über zwanzig Grad, und auch die Luft in der Schleuse war warm. Wie konnte die Wand dann so kalt sein?
Ein Klicken ertönte. Das vordere Tor schob sich lautlos zur Seite, sodass der Nachthimmel und dann ein paar Palmen und ein von spiegelnden Fassaden eingefasster Innenhof sichtbar wurden. Zwei Männer standen vor der Schleuse. Julia ging vor Wut schnaubend auf sie zu. Einer von ihnen war Tony Gallagher, der Facility-Manager, der sie vom Flughafen abgeholt hatte. Er starrte nach oben und tat so, als würde er ein Sternbild betrachten. Der andere Mann hatte die Hände in die Hüften gestemmt und musterte sie aufmerksam, während sie auf ihn zuging.
»Miss Bruck, willkommen bei Serail Almond India.« Er sprach sie auf Englisch an, obwohl sein Akzent ihr sagte, dass er auch aus Deutschland kam. Lächelnd streckte er ihr die Hand entgegen. »Mein Name ist Robert Parminski. Chief Information Security Officer.«
Sie ergriff seine Rechte, erwiderte die Begrüßung und musterte ihn dabei. Er war ein großer, schlanker Mann mit eckiger Brille, der richtig gut ausgesehen hätte, wenn sein Haarschnitt weniger akkurat und seine Gesichtszüge etwas entspannter gewesen wären.
Julia holte tief Luft. »Erklären Sie mir bitte, warum ich Ihnen meinen privaten Computer und mein Handy aushändigen soll?«
»Wir lassen grundsätzlich keine Fremdgeräte auf das Gelände. Hat man Ihnen das nicht vorher gesagt, Miss Bruck?« Er sah sie mit durchdringendem Blick an. Die Iris seiner Augen waren dunkelgrau und wiesen Flecken auf – wie Granit.
»Nein. Nur, dass das Fotografieren nicht erlaubt ist.«
»Und Ihr Handy hat bestimmt eine Kamera-Funktion, oder? Sie bekommen von uns ein Mobiltelefon gestellt.« In seiner dunklen Anzughose und dem weißen Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln sah er so aus, als hätte er bis eben noch hinter seinem Schreibtisch gesessen. Sein vorgeschobenes Kinn, seine ganze Körperhaltung brachten zum Ausdruck, dass er nicht bereit war, auch nur einen Millimeter nachzugeben, egal, worum es ging.
»Auf dem Notebook sind alle meine privaten Daten. Ich fülle Ihnen gern einen Einfuhrschein mit Seriennummer und allem anderen aus – wenn gewünscht, in doppelter Ausführung. Aber das sollte genügen.«
»Tut es leider nicht. Ich bin IT Security Officer und für die Datensicherheit bei Serail Almond verantwortlich. Es gibt Bestimmungen, an die sich jeder Mitarbeiter halten muss. Wir werden auch Ihr Gepäck durchleuchten, um sicherzugehen, dass Sie keine unerlaubten technischen Geräte einführen.«
»Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass ich meine Sachen behalten kann?«
»Sie haben die Möglichkeit, uns Ihr Notebook zu überlassen, sodass wir es nach unseren Vorgaben mastern können. Was halten Sie davon?«
»Nichts.«
Julia und der Security Officer standen sich unnachgiebig gegenüber.
»Serail Almond hat berechtigte Sorgen, was Betriebsspionage angeht«, versuchte Gallagher zu vermitteln. »Da achtet man ganz besonders sorgfältig darauf, wen und was man hereinlässt.«
»Ich bin mir sicher, dass ich eingehend überprüft worden bin«, entgegnete Julia. »Mit Führungszeugnis und allem. Ich wäre doch gar nicht hier, wenn Sie meinetwegen irgendwelche Zweifel hegen würden.«
Robert Parminski musterte sie nun von ihrem Kopf – mit dem dunklen, aufgesteckten Haar, das nach der langen Reise feucht war und sich widerspenstig in ihrem Nacken kringelte – bis zu ihren nackten Füßen, deren Zehennägel rot lackiert waren und die in Riemchensandalen steckten. Dann sah er Julia ein wenig verblüfft an.
Sie wusste, was dieser Blick ausdrückte. Es war immer das Gleiche: Eine Ingenieurin der Versorgungstechnik stellten sich Männer anders vor.
»Sie sind natürlich überprüft worden«, bestätigte Parminski. »Das Angebot lautet: Sie bekommen ein Telefon von uns, und Ihren Rechner mastern wir, oder wir schließen ihn während Ihres Aufenthaltes sicher weg.«
Julia schluckte. Dies hier führte zu nichts. Ihr wurde klar, dass sie gegen die Vorschriften nichts ausrichten konnte. Doch allein die Art und Weise des Vorgehens machte sie wütend. Sie trat einen Schritt auf Parminski zu. Dass sie dabei zu ihm aufblicken musste, verdarb die psychologische Wirkung ein wenig. Sie war schon recht groß, doch er überragte sie noch um zehn Zentimeter. »Dann schließen Sie meinen Laptop weg, Mr. Parminski. Sie garantieren mir bestimmt, dass ich ihn einwandfrei zurückbekomme – persönlich.«
MANHATTAN, NEW YORK, USA
Die auch um elf Uhr abends noch belebte Walker Street in Chinatown, Manhattan, lag sechs Stockwerke unter ihnen. Die Frau war auf einem Absatz der Feuertreppe über das Geländer gestiegen und stand jetzt nur noch mit den Fersen auf der Kante des Podests. Ihre Hände, die aus den Ärmeln eines zu großen Kapuzenshirts guckten, klammerten sich krampfhaft um die Metallstange des Geländers, das sich hinter ihr befand. Sie hatte sich ein wenig vornübergebeugt und starrte hinunter. Um ihre schlanken Beine flatterte dünner Stoff. Es sah so aus, als hätte sie das Shirt über ein Sommerkleid oder ein Nachthemd gezogen. Plötzlich begann sie, ein bisschen hin- und herzuwippen – ihre Knie schienen immer wieder ein paar Zentimeter nachzugeben –, so als probe sie schon den Absprung.
»Ich komm jetzt zu Ihnen raus!«, rief Ryan Ferland, Detective 2nd Grade beim New York City Police Departement. Dann schwang er sein Bein über die Fensterbrüstung. Nicht, dass er große Lust hatte, auf einer vielleicht maroden Feuertreppe herumzuklettern, noch dazu im Februar, bei mickrigen vier Grad Lufttemperatur und Windstärke fünf. Es war ein Samstagabend, und neben dem Einsatzfahrzeug hatte sich eine erkleckliche Anzahl Schaulustiger auf der Straße eingefunden. Der dünne Metallrost bebte, als er mit beiden Füßen das Podest betrat. Der Wind draußen war eisig, aber sein Parka, seine Mütze und Handschuhe würden ihn einigermaßen warm halten, sollte das hier länger dauern. Der Körper der Frau musste vor Kälte schon taub und gefühllos sein.
Die Meldung, dass in einem Gebäude an der Walker Street, Ecke Baxter Street, eine Frau auf einer Feuertreppe im sechsten Stock stand und anscheinend herunterspringen wollte, war vor zehn Minuten über Funk eingegangen. Pech für ihn, dass er sich gerade in der Nähe befunden hatte. Pech auch, dass er der dienstälteste Detective seiner Abteilung beim NYPD war, der nicht unter Höhenangst litt. Aufgrund seines Gesundheitszustandes war er allerdings nicht gerade in Bestform: Sie hatten ihm vor ein paar Wochen ein malignes Melanom im Nacken entfernt, und die ärztliche Prognose lautete, dass seine Fünf-Jahres-Überlebenschance bei 40 Prozent lag. Das machte ihm zu schaffen – allerdings in diesem Augenblick mehr wegen der Frau an der Brüstung als um seinetwillen. Wenn er sich nicht richtig konzentrierte und einen Fehler beging, sodass er sie nicht retten könnte, würde er sich deswegen schuldig fühlen.
»Kommen Sie nicht näher!«, schrie die Frau ihn an, ohne ihn anzusehen. Sie war, der Stimme nach zu urteilen, noch nicht alt, Anfang bis Mitte zwanzig vielleicht.
Herrgott, da hatte sie ihr Leben noch vor sich. Er musste mit ihr reden. Vor allem musste er sich jetzt langsam mal daran erinnern, was man in so einem Fall sagen sollte. Da gab es Richtlinien, die er gelernt hatte. Doch sein Kopf war leer.
»Tun Sie’s nicht«, erwiderte er. »Es gibt immer eine Lösung.«
Na toll, wie überzeugend war das denn? Was wusste er schon über diese Frau und ihre Probleme? Sie drehte den Kopf und warf ihm einen Blick über die Schulter zu. Es war dunkel, und der Wind wehte ihr trotz der Kapuze, die sie trug, das lange Haar vors Gesicht. Er konnte nicht viel mehr davon erkennen als zwei weit aufgerissene Augen, die verzweifelt aussahen. Er registrierte, wie ihr schmaler Körper zuckte und sich eine Hand am Geländer lockerte. Noch schaffte sie es nicht, die Metallstange loszulassen, aber es fehlte nicht mehr viel.
»Sie können mich nicht daran hindern. Wenn Sie näher kommen, springe ich. Ich tu’s sowieso.«
»Sie hätten es längst hinter sich bringen können. Ihr Zögern ist ein Zeichen dafür, dass Sie es nicht wirklich wollen.«
»Glauben Sie etwa, dass das einfach ist?«
Der Wind blies so stark, dass er Mühe hatte, sie zu verstehen. Sie blickte jetzt wieder stur nach unten. Er sah nur die Kapuze, die flatternden Haarsträhnen und die schmalen, geröteten Hände an der Metallstange.
»Ich heiße übrigens Ryan«, sagte er. »Ich meine, wenn wir uns schon zusammen hier draußen den Arsch abfrieren, können wir uns ja gegenseitig ein wenig kennenlernen. Wer sind Sie?«
»Moira. Aber geben Sie sich nicht zu viel Mühe. Das lohnt sich nicht. Lassen Sie mich in Ruhe.«
»Wenn Sie tot sind, Moira, haben Sie alle Ruhe der Welt. Warum die letzten Minuten nicht noch nutzen?«
»Verschwinden Sie!« Sie heulte fast, aber er glaubte, dass sie insgeheim froh war, dass er hier in ihrer Nähe stand. Selbst kurz vor seinem Tod wollte der Mensch nicht allein sein. Er musste verhindern, dass sie sprang – mit den richtigen Worten. Er würde sie jedenfalls nicht festhalten können, wenn sie losließ. Unmöglich. Dann konnte er nur noch zusehen …
»Es gibt eine Lösung, Moira. Lassen Sie uns drinnen darüber reden. Geben Sie mir eine Chance.«
»Sie können mir nicht helfen«, entgegnete sie, ohne ihn anzusehen.
»Vielleicht doch. Was haben Sie zu verlieren?«
»Sie wissen gar nichts.«
»Kommen Sie rein! Erzählen Sie mir, was los ist.«
Sie schüttelte den Kopf und lehnte sich noch weiter nach vorn. »Da sind so viele Menschen«, sagte sie nach einer Weile. »Was wollen die alle von mir?«
»Dass Sie nicht springen.« Das war eine Lüge. Es gab immer Schaulustige, die darauf spekulierten, dass jemand sprang. Vielleicht wurden schon Wetten auf den Ausgang dieses Schauspiels abgeschlossen.
»Tun Sie mir einen Gefallen?« Sie drehte sich noch einmal kurz zu ihm um. Ihre Stimme klang flehend. »Sehen Sie mich nicht an.«
Ihre Finger lockerten sich wie im Zeitlupentempo. Sie zuckte noch einmal zurück, als bereue sie ihren Entschluss, und dann fiel sie hinab – lautlos, ohne einen Schrei. Sie verschwand aus seinem Blickfeld, als hätte es sie nie gegeben. Ferland trat zurück, schloss die Augen. Am liebsten hätte er die Hände gegen seine Ohren gedrückt, um nichts mehr hören zu müssen, doch hier oben kam außer dem Pfeifen des Windes sowieso nicht viel an. Sie hieß Moira, und sie hatte sich in den Tod gestürzt. Er konnte nichts mehr für sie tun.
»Komm wieder rein, Ryan.« Er fühlte die Hand seines Kollegen Flavio auf der Schulter. »Das war doch von vornherein ein verlorenes Spiel.«
Das sollte ihn jetzt wohl trösten? Große Klappe, aber im Ernstfall blieb doch immer alles an ihm hängen. Er würde sich Vorwürfe machen, die kurze Begegnung in Gedanken immer wieder durchspielen und nach seinem Fehler, nach seiner verpatzten Chance suchen. Der Hausmeister, der sie in die leer stehende Wohnung gelassen hatte, verschloss wieder sorgfältig das Fenster und betonte, dass er sich nicht vorstellen konnte, wie diese Frau überhaupt in die Wohnung gekommen sei: wahrscheinlich von außen hochgeklettert, diese Verrückten brächten ja alles fertig. Wie sie dort hochgekommen war? Er konnte sich das nicht erklären. Vielleicht war sie auf einen Müllcontainer geklettert, um den ersten Absatz der Feuertreppe zu erreichen? Also, seine Schuld war das gewiss nicht.
Sie gingen durch das schwach erleuchtete Treppenhaus hinunter, das nach Suppe und schmutzigen Babywindeln roch. Ferland versuchte, sich vor dem Anblick zu wappnen, den die Leiche der Frau gleich bieten würde. Nach einem Sturz aus dem sechsten Stock – bestimmt achtzehn Meter oder mehr – sah ein menschlicher Körper schrecklich aus. Die Haut eines Menschen war zwar zäh und hielt einer Menge Belastungen stand, aber die Wucht des Aufpralls war so stark, dass alle möglichen Knochen im Körper brachen und die inneren Organe zerrissen wurden. Manchmal war sogar die Aorta zerfetzt. Wie üblich würde er auch in diesem Fall im Bericht der Rechtsmedizin detailliert nachlesen können, welche Verletzungen die Selbstmörderin erlitten hatte.
Als sie aus dem Haupteingang traten, waren die Sanitäter und ein Notarzt bei ihr. Es dauerte nicht lange, da winkte einer der Männer ihn zu sich. »Nichts mehr zu machen. Das war’s für uns. Wir hauen ab.«
Ferland straffte die massigen Schultern und näherte sich der Toten. Die Blicke der Schaulustigen hinter der Absperrung prickelten in seinem Nacken. Ein paar Fragen waren noch nicht geklärt. Nicht nur die nach dem Motiv. An der Art der Brüche konnte man für gewöhnlich sehen, ob die Frau doch noch versucht hatte, den Sturz irgendwie abzufangen, was dafür sprechen würde, dass Moira ihren Entschluss im letzten Moment bereut hatte. Waren die Handgelenke und die Armknochen gebrochen?
Er beugte sich zum linken Arm herab, der im Licht eines eilig installierten Scheinwerfers gut zu sehen war. Ferland musste schlucken. Sein Verstand sagte ihm, dass sich ihr Daumen beim Aufprall durch den Handrücken gebohrt hatte. Weiter nichts. Sein Blick ging weiter zu den entblößten Beinen. Wie erwartet, zeichneten sich die Röhrenknochen als gut erkennbare Abdrücke weißlich unter der Haut ab, umrahmt von zahllosen Blutergüssen. Doch die Haut der Frau sah an den Beinen seltsam schlaff und fleckig aus. Das war ihm zwar schon häufiger zu Gesicht gekommen – aber nur, wenn sich eine Leiche länger unentdeckt in einer Wohnung befunden hatte. Moira hingegen war erst seit ein paar Minuten tot. Er sah an der Fassade des Gebäudes empor. Die schwarze Feuertreppe, auf der er eben noch mit ihr zusammen gestanden hatte, zog sich zickzackförmig vor der grauen Fassade empor: ein beliebtes Fotomotiv für New-York-Touristen. Über ihm spannte sich ein bewölkter Nachthimmel. Nichts, was zu trösten vermochte.
Ferland konzentrierte sich wieder auf die Fakten: Wenn jemand unfreiwillig fiel, versuchte er meistens noch, auf den Füßen zu landen; dann brachen nacheinander die Fußknochen, die Beine, die Hüften und die Wirbelsäule. Bei einer zu großen Fallhöhe gelang das meistens nicht mehr, und die Menschen kamen zuerst mit dem Kopf oder dem Rumpf auf. Ferland gab sich einen Ruck und ging um die Frau herum, um ihr ins Gesicht zu schauen. Er musste dem Tod ein Gesicht geben. Das kannte er schon von früheren Fällen. Noch schlimmer als der Anblick der Toten waren die Ungewissheit und das, was die Fantasie dann daraus machte.
Er umrundete die nach allen Seiten ausgestreckten, verdrehten Glieder und das dunkelrote Rinnsal, das langsam auf einen Gully zufloss. Ferland ging vor ihrem Kopf in die Hocke. Die Kapuze war verrutscht, bedeckte aber immer noch ihr dunkles Haar. Vor wenigen Minuten noch war es bestimmt so schön gewesen, dass es bei dem einen oder anderen Mann den Wunsch geweckt hätte, es zu streicheln. Nun nicht mehr. Es war totes Material. Er fasste eine Haarsträhne, hob sie an und wollte sie zur Seite legen, um ihr ins Gesicht zu sehen – doch Ferland erstarrte in der Bewegung.
Aufgrund ihrer Stimme und ihres schlanken Körpers hatte er eine junge Frau erwartet. Der Kontrast dazu – der Anblick, den sie bot – ließ ihn erstarren. Aus dem totenblassen, von Altersflecken überzogenen Gesicht starrten ihn zwischen faltigen Lidern zwei starre, hellbraune Augen an. Die Haut der Toten sah so runzelig und schuppig aus, dass sie ihn an die einer Echse erinnerte.
2. Kapitel
BIHAR, INDIEN
Eine etwa zwanzigjährige Inderin in einem leuchtend blauen Sari stand vor der Apartmenttür. Sie hatte die Handflächen zu der indischen Begrüßungsgeste aneinandergelegt und den Kopf leicht geneigt, während sie Julia erklärte, sie werde ihr beim Zurechtfinden in der neuen Umgebung behilflich sein. Ihr Name sei Leela Kumari, Assistentin von Mr. Gallagher, und sie würde Miss Bruck zum Frühstück abholen.
Anschließend führte sie Julia in einen weitläufigen Innenhof des Geländes von Serail Almond, wo das Garden Restaurant lag. Unter Sonnenschirmen und ein paar Kokospalmen befand sich ein Büfett, um das herum Tische und üppig gepolsterte Stühle standen. Leela steuerte zielstrebig auf einen zur Hälfte besetzten Tisch zu, winkte einem weiß livrierten Kellner, um Tee und Kaffee zu ordern, und stellte die anwesenden Mitarbeiter vor.
Julia hielt die Chance, vor der ersten Tasse Kaffee schon alle Namen mit den dazugehörigen Gesichtern zu behalten, für gering. Die Kollegen am Tisch waren genau wie sie bei der ICL Thermocontrol GmbH angestellt, die als Dienstleister für die Klima- und Reinlufttechnik bei Serail Almond verantwortlich war.
»Sie scheinen sich ja keine Sorgen um Ihr Cholesterin zu machen«, bemerkte Gundula Keller, eine rothaarige Schweizerin, als Julia vom Büfett zurückkehrte. Sie lächelte, aber eine ihrer schmalen Augenbrauen schnellte geringschätzig in die Höhe.
»Gunda ist unser Kaninchen«, warf ein Mann ein, der ihr als Milan Gorkic vorgestellt worden war. »Gemüse, Salat und Obst den ganzen Tag. Wenn sie zur Abwechslung mal was Anständiges essen würde, hätte sie bestimmt auch bessere Laune.« Er spießte ein vor Fett triefendes Würstchen mit der Gabel auf und biss hinein.
»Ich hoffe, dass mich das viele Salz zum Frühstück etwas munter macht«, sagte Julia. Auf ihrem Teller lag knusprig gebratener Speck, dessen köstlicher Duft ihr in die Nase stieg. »Ich bin erst um halb drei Uhr in der Nacht hier angekommen.«
»Aus Deutschland, nicht wahr? Woher kommen Sie da?« Milan tunkte das Fett auf seinem Teller mit einem angebissenen Brötchen auf.
»Aus Hamburg. Und Sie alle?«
»Slowenien«, antwortete Milan. »Aus der Nähe von Maribor.«
»Bern«, sagte Gundula.
»Mobile, Alabama«, nuschelte ein stämmiger Mann namens Barry, ohne von seinen Frühstücksflocken aufzusehen.
»Bangalore.« Leela lächelte kühl. Sie hatte nur einen Orangensaft vor sich stehen.
Nach etwa zehn Minuten sah sie auf ihre Uhr. »Wir müssen los, Miss Bruck. Gleich findet eine große Mitarbeiterversammlung statt, zu der Sie auch erwartet werden.«
Sie führte Julia unter blühenden Jacarandabäumen hindurch zu einem Gebäude, das in den Park ragte wie der Bug eines Kreuzfahrtschiffes. Sie betraten es über eine Art Gangway, die ein Wasserbassin überbrückte. Die Gebäude von Serail Almond glänzten unter der indischen Sonne so weiß-silbern wie die Tiegel ihrer Luxus-Kosmetiklinie.
Im Versammlungsraum wurde Julia von Leela nach vorn in die zweite Reihe dirigiert.
»Es ist eine Feier zum fünfzehnjährigen Bestehen dieses Forschungszentrums«, erklärte ihr Leela. »Direktor Coulter wird eine Rede halten.«
Der Saal füllte sich schnell. Nach einer Weile sah Julia auch ihre ICL-Kollegen im hinteren Bereich Platz nehmen. Die Stimmung schien ihr für eine Firmenveranstaltung am frühen Morgen seltsam aufgekratzt zu sein. Das Forschungszentrum von Serail Almond beschäftigte in Bihar mehr als neunhundert Mitarbeiter. Der Konzern, der hauptsächlich im Kosmetik-, aber auch im Pharmabereich tätig war, ließ hier in Indien mithilfe künstlicher menschlicher Haut forschen, durch die neue Wirkstoffe schneller zur Marktreife gelangen sollten. Serail Almond beschäftigte sich unter anderem mit der Entwicklung neuer Intensiv-Pflegeprodukte für »ewig jugendliche Haut«, so viel wusste Julia schon. Vielleicht hatten die Wissenschaftler ja Erfolg damit, bevor sie selbst alt und runzelig war. Solange man eine Pfirsichhaut hatte, konnte man über Leute lachen, die Geld für teure, aber zumeist wirkungslose Kosmetika verschwendeten. Doch irgendwann würde einem dieses Lachen im Halse stecken bleiben.
Ihr fiel auf, dass die Mitarbeiter, die sich hier versammelten, zum größten Teil jung, gesund und zufrieden aussahen. Nur einer im Saal wirkte nicht so, als habe er vor dem Frühstück schon ein paar Glückspillen eingeworfen: Robert Parminski, der Security Officer, stand mit verschränkten Armen neben einem Seiteneingang. Er strahlte dieselbe arrogante Unnahbarkeit aus wie in der Nacht zuvor. Manche Frau mochte sich von einem männlichen Gehabe dieser Art angezogen fühlen, doch Julia hielt sich für immun.
Während ihres Studiums waren auf fünfhundert Männer drei Frauen gekommen, und so glaubte sie, das andere Geschlecht durchschauen zu können. Zumindest wenn es sich dabei um Ingenieure und Techniker handelte, mit denen sie überdies sehr gut zurechtkam. Zu einigen Studienkollegen, mit denen sie in der Prüfungsphase quasi durch die Hölle gegangen war, hatte sie immer noch Kontakt. Außerdem wusste sie Männer zu genießen, sowohl beim Sex als auch bei interessanten Gesprächen. Aber vor einer länger andauernden Partnerschaft war sie bisher immer zurückgeschreckt: Ihre Unabhängigkeit, speziell die finanzielle, war ihr ungeheuer wichtig.
Schließlich erschien Norman Coulter, der Direktor und Bereichsleiter von Serail Almond India, und begrüßte die Anwesenden. In einer kleinen Ansprache drückte er seine Freude über fünfzehn Jahre Serail-Almond-Forschung in Indien und seine Zuversicht aus, dass die Arbeit hier weiterhin erfolgreich fortgeführt würde. Er übergab dann einer Mitarbeiterin das Wort, die mittels einer Slideshow das Forschungszentrum, die Philosophie und die aktuellen Projekte vorstellte. »Dieses Forschungszentrum trägt dazu bei, die Unternehmensstrategie von Serail Almond weiter voranzutreiben«, betonte sie. »Wir werden hier das große wissenschaftliche Potenzial Indiens nutzen!«
Die Präsentation vermittelte kaum mehr als das, was Julia eh schon auf der Website von Serail Almond erfahren hatte. Sie langweilte sich, und da sie in der Nacht nur wenig hatte schlafen können, fühlte sie sich immer müder. Plötzlich schreckte sie auf und drückte automatisch den Rücken durch, als ein Name laut genannt und Beifall geklatscht wurde. Sie musste wohl kurz weggedämmert sein. Anschließend verfolgte sie eher belustigt als beeindruckt, wie nacheinander Leute aufgerufen wurden, die jeweils Genannten aufstanden und verlegen um sich blickten, während die versammelten Mitarbeiter recht unmotiviert Beifall spendeten. Nach einer Weile vernahm sie ihren eigenen Namen, und im nächsten Moment spürte sie Leelas Finger zwischen ihren Rippen.
»Aufstehen«, befahl die Inderin mit unnachgiebigem Lächeln.
Julia erhob sich. Applaus an sich war ja keine schlechte Sache, aber sie hätte vorher doch gern eine Kleinigkeit geleistet, die diesen Beifall rechtfertigte. Als sie kurz zur Seite sah, fing sie Parminskis spöttischen Blick auf.
Nachdem die Veranstaltung zu Ende war, wurde Julia von Leela in ihr zukünftiges Büro geführt. Sie konnten kaum zwanzig Meter weit durch die gläsernen Gänge gehen, ohne irgendwelche Türen öffnen zu müssen. Überall benötigte man eine Keycard, den richtigen Code und den passenden Fingerabdruck für den Scan. Der vorläufige Besucherausweis, den man Julia gestern Nacht noch ausgehändigt hatte, war gerade mal so etwas wie ein Dokument ihrer Daseinsberechtigung, mit dem sie jedoch nirgendwohin gelangen konnte.
Als sie einmal neben einer Tür darauf wartete, dass Leela ihnen Einlass verschaffte, strich Julia neugierig mit dem Finger über die Blätter einer exotischen Blume, die künstlich aussah – wie beinahe alles hier. Leela warnte sie sofort, bloß nichts anzufassen: Die Pflanzen hier könnten giftig sein. Mit dieser Warnung im Hinterkopf erreichte Julia schließlich mit ihrer Führerin den Bürobereich, in dem die ICL-Mitarbeiter saßen. Offensichtlich besaß Leela keine gültige Keycard für den Zutritt, denn sie klingelte. Barry, der Amerikaner, den sie schon beim Frühstück getroffen hatten, öffnete die Tür, und Julia trat ein. Leela Kumari blieb jedoch an der Schwelle stehen, als sei dies die Grenze zum Feindesland. Sie erklärte, sie würde Julia um sechs wieder abholen, und verschwand.
»Ist das hier immer so?«, wollte Julia wissen, während sie ihren neuen Arbeitsplatz musterte. Sie befand sich in einem luftigen, sparsam eingerichteten Raum, in dem es keine angestammten Plätze gab. Zwischen Topfpalmen und mobilen Schallschutzwänden standen Schreibtische und fahrbare Rollcontainer. Automatische Jalousien filterten das Licht und warfen gestreifte Muster auf Teppichboden und Wände.
»Wie ist es denn hier?«, fragte Milan.
»Fürsorglich?« Bevormundend, dachte Julia. »Hier nimmt doch wohl niemand ernsthaft an, ich würde nachher nicht zurück in mein Apartment finden.«
»Solange Sie nur einen vorläufigen Besucherausweis haben, dürfen Sie sich nicht unbegleitet auf dem Gelände fortbewegen.«
»Genießen Sie die Fürsorge, solange sie andauert, also noch etwa …« Gundula warf einen Blick auf die Uhr an der Wand. »Zweiundzwanzig Stunden. Danach heißt es: Friss oder stirb.«
»Und was soll ich fressen?«
Gundula ignorierte einfach die Frage, blickte zu ihrem Computer und tippte auf der Tastatur herum.
Milan Gorkic wühlte zunächst in den Schubladen seines Bürocontainers, bevor er schließlich zu Julia aufblickte und antwortete: »Die wunderbare Welt von Serail Almond.«
Ein paar Augenblicke später wandte Gundula sich ihr wieder zu und gab ihr einen ersten Überblick über ihren Aufgabenbereich. »Sie übernehmen Tjorven Lundgrens Aufgaben. Haben Sie ihn eigentlich mal kennengelernt?«
»Nicht persönlich. Wir haben mal miteinander telefoniert, glaube ich.«
»Schade. Ein Schwede – sehr netter Kerl. Und ein fähiger Mann, aber leider auch ein Chaot. Ich fürchte, er hat Ihnen einen Haufen ungeordnete Arbeit hinterlassen.«
»Machen wir denn keine Übergabe?«, fragte Julia.
Gundula blinzelte. »Das geht nicht.«
Julia sah sie fragend an, erhielt jedoch keine Erklärung.
Nach ein paar Augenblicken unbehaglichen Schweigens merkte Milan an: »Tjorven ist schon seit drei Wochen weg.«
»Wurde er etwa fristlos entlassen?«, hakte Julia nach und fügte in Gedanken hinzu: Oder ist dieser Tjorven Lundgren tot umgefallen? Eine Weile blickte sie in verlegene Gesichter.
»Er ist ein Outdoor-Freak«, erwiderte schließlich Milan. »Zelten, wandern, mit den Einheimischen in Kontakt kommen und so. Nach einem langen Wochenende in der Pampa ist er nicht wieder zu Serail Almond zurückgekehrt.«
»Ist er einfach so abgehauen?«
»Er ist wie vom Erdboden verschwunden. Spurlos.«
MANHATTAN, NEW YORK, USA
»Wir können das auch mit einem Foto erledigen.« Der Polizist, der Rebecca Stern gegenübersaß, musterte sie mit kaltem Blick. »Das ist die normale Vorgehensweise bei Identifizierungen im OCME.«
In diesem Land liebte man Abkürzungen. Rebecca hatte vorab recherchiert, was in New York auf sie zukommen würde, und wusste daher, dass der Beamte das Office of the Chief Medical Examiner meinte, also die Rechtsmedizin. Er mochte sie nicht – das hatte sie schon bei der Begrüßung auf dem Flur gespürt: Ryan Ferlands kleine, helle Augen waren über ihren Körper geglitten wie über eine besonders dekadente Schaufensterdekoration. Doch im Unterschied zum Bummel durch die Straßen konnte er hier und jetzt nicht einfach weitergehen, sondern musste sich mit ihr beschäftigen. Er war Zeuge gewesen, als sich ihre Schwester Moira das Leben genommen hatte. Vielleicht war das der Grund, weshalb er sich ihr gegenüber so abweisend gab: Sie war die Schwester einer jungen, sorglos vor sich hin lebenden Frau, die einfach so in den Tod gesprungen war. Dafür hatte er als Polizist, der mit beiden Beinen im Leben stand und es in seinen übelsten Ausprägungen kannte, sicherlich kein Verständnis. Sie verstand es ja auch nicht.
Rebecca erinnerte sich, gelesen zu haben, dass die New Yorker Polizei fest in italienischer und irischer Hand war. Ryan Ferland gehörte offensichtlich der irischen Fraktion an. Er war von bulliger Statur, und sein hellrotes Haar sah aus wie kurz geschorene Drahtwolle. Seine Haut – oder zumindest die Teile davon, die von der schlecht sitzenden Uniform nicht verdeckt wurden – war von Malen und Sommersprossen übersät, und von seinen Handgelenken kräuselten sich rötliche Haare bis hin zu den Fingern.
»Ich muss Moira richtig sehen, sonst glaube ich nicht, dass sie tot ist«, erklärte Rebecca mit fester Stimme. Gleichwohl war die Versuchung groß, jetzt einen Rückzieher zu machen und einer Identifizierung über ein Foto auf einem Bildschirm zuzustimmen. Sie könnte in einer Viertelstunde hier raus sein und in Lower Manhattan in irgendeiner Bar einen Latte macchiato mit Sojamilch oder etwas Stärkeres trinken. Aber Moira war ihre Schwester gewesen. Sie hatte ihr nicht beigestanden, als es ihr schlecht ging. Sie hatte nicht mal gewusst, dass es so schlimm um Moira stand. Am Telefon hatte sie die Probleme ihrer Schwester heruntergespielt, und später, bei der Erinnerung an das Gespräch, ihre Sorgen um Moira verdrängt. Nun saß Rebecca hier, im Headquarter des NYPD am Police Plaza, und ihre Schwester lag tot in der Rechtsmedizin. Sie konnte ihr Versäumnis nicht wiedergutmachen. Niemals. Aber davor, Moira ein letztes Mal zu sehen, konnte und wollte sie sich nicht drücken. Vielleicht war es aber nur der Wunsch, sich selbst zu bestrafen? Und sie hatte das unangenehme Gefühl, dass Ryan Ferland genau das vermutete.
»Wie Sie wünschen, Ma’am.« Er erhob sich ächzend. Seine Körperhaltung, die herausgedrückte Brust, zeigte ihr, dass er mit dem Verlauf der Unterhaltung zufrieden war. »Ich begleite Sie. Wir fahren gemeinsam in die First Avenue. Sie kennen sich ja hier nicht aus. Woher kommen Sie noch mal?«
»Aus Paris«, antwortete Rebecca.
»Das ist weit. Ich dachte, Sie sind Amerikanerin?«
»Ursprünglich komme ich aus North Carolina.«
»Richtig. Wie Ihre Schwester Moira. Aufgewachsen sind Sie bei einer Tante in Raleigh, richtig?«
Sie nickte stumm; sie war nicht willens, weiter ihre Vergangenheit vor ihm auszubreiten. Er hatte, was Moira betraf, wohl seine Hausaufgaben gemacht. Sie hatte nicht erwartet, dass ein Cop aus New York so viel Interesse an einem Suizid zeigen würde. Was man so hörte, hatten die hier doch ganz andere Sorgen. Das ständige Geheul der Polizeisirenen – ebenso wie die gehetzten Passanten und hupenden Taxifahrer – war Rebecca schon nach wenigen Stunden auf die Nerven gegangen.
Noch während der Fahrt zu den OCME’s Headquarters wunderte sich Rebecca, dass Ferland sich die Zeit nahm, sie zu begleiten. Kurze Zeit später wurde ihr klar, warum er es tat.
»Die Lady hier ist extra aus Europa angereist, um ihre verstorbene Schwester ein letztes Mal zu sehen. Nicht auf einem Foto, sondern in echt«, erklärte er einem gehetzt und abweisend aussehenden Mitarbeiter des OCME.
»Das kann ich nicht entscheiden. Und es kann dauern. Sie sehen doch, was hier los ist!«
»Ich kenn doch den Weg«, sagte Ferland. »Lassen Sie uns einfach runtergehen. Irgendwer wird schon da sein, der uns dann weiterhilft.«
Der Mitarbeiter rollte mit den Augen. »Warten Sie!«, blaffte er und griff zum Telefon.
Ferland drehte sich halb zu Rebecca um und nickte ihr zu. Es sollte wohl beruhigend aussehen und so viel bedeuten wie: »Ich mach das schon, ich hab hier alles im Griff.«
Rebecca sank der Mut. Wenn man es den Menschen so schwer machte, die sterblichen Überreste ihrer Familienangehörigen zu sehen, hatte das ja vielleicht auch einen triftigen Grund. Und Moira half das alles sowieso nicht mehr. Es war zu spät. Viel zu spät. Sie war schon so weit, Ferland auf den Arm zu tippen und einen Rückzieher zu machen, als er plötzlich eine Frau laut ansprach, die eilig an ihnen vorbeilief.
»Martinez!«
Sie drehte sich zu ihm um und schaute erst irritiert drein, dann grinste sie. »Ferland, mein Lieblings-Cop. Was treibt dich denn hierher?«
»Die Lady hier, Miss Stern, muss unbedingt ihre gerade verstorbene Schwester sehen, aber sie lassen uns nicht zu ihr runter.«
»Und da meinst du, ich würde dir mal eben helfen?« Die Augen in ihrem dunkelhäutigen Gesicht glitzerten spöttisch, als sie Rebeccas Gestalt, den akkuraten Pagenkopf, den schwarzen Hosenanzug und den grauen Kaschmirmantel taxierte.
»Es dauert nicht lange«, versprach Ferland. »Wir wollen nur einmal runter für eine offizielle Identifizierung.«
Rebeccas Blick fiel auf das Namensschild, das an der Brust der Frau befestigt war: Gina Martinez – Identification Staff.
»Dann geht in mein Büro und wartet dort auf mich«, sagte Martinez und sah auf ihre Uhr. Warnend fügte sie hinzu: »Es kann aber eine halbe Stunde dauern.«
»Du bist ein Engel, Martinez.« Ferland bedeutete Rebecca mit dem Kopf, ihm zu folgen. Auf dem Weg in das Büro teilte er ihr mit: »Wenn wir den offiziellen Weg gehen, kann das nämlich noch viel länger dauern.«
Erneut fragte sich Rebecca, ob es normal war, dass ein Polizist so viel Zeit opferte, um bei einer simplen Identifizierung dabei zu sein.
Nach zwanzig Minuten holte Martinez sie und Ferland in ihrem Büro ab und geleitete sie dorthin, wo die Leichen der Verstorbenen aufbewahrt wurden. Während der Takt ihrer Schritte durch die langen Gänge hallte, dachte Rebecca, dass der heutige Tag viel Material für ihre nächsten Albträume liefern würde.
Martinez stieß schließlich eine doppelte Metalltür auf, und sie waren mittendrin im Reich der Toten.
Rebecca schreckte zurück. Es roch … Sie hätte darauf vorbereitet sein sollen, dachte sie. Es roch fast wie der Napf mit dem Katzenfutter, den sie eine Woche lang in ihrer Wohnung unter der Heizung hatte stehen lassen, als sie mal mit Noël nach Prag gereist war. Ihre Katze war derweil in einer Tierpension gewesen und mit einem Dachschaden wieder bei ihr eingezogen.
»Sorry, nicht gerade ordentlich hier«, entschuldigte sich Martinez und stieß eine Rollbahre zur Seite, auf der unter einem Tuch grün-grau angelaufene Füße hervorschauten.
Nachdem Rebecca dies gesehen hatte, zwang sie sich, ihren Blick stur auf Ferlands Nacken zu richten, und befahl ihren Gedanken, sich mit seiner Narbe zu beschäftigen, die unter seinem Haaransatz knallrot auf der hellen Haut leuchtete. Das Wundmal war noch nicht alt. Was war das? Eine Stichverletzung?
Mit dieser Taktik gelangte sie mit nicht mehr als einem leichten Unwohlsein im Magen vor eine Wand mit Edelstahlschubladen. Das flaue Gefühl war alles andere als eine Überraschung. Sie atmete flach und presste ihre Handtasche an sich. Gleich hast du es hinter dir, sagte sie sich. Alles klärt sich auf. Vielleicht war es gar nicht Moira, die hier lag. Solange sie ihre Schwester nicht tot gesehen hatte, gab es Hoffnung. Das alles war vielleicht nur ein Irrtum, der sich gleich aufklären würde. Diese Reise und der grauenhafte Ort hier: Das alles hatte doch nichts mit dem Leben von Rebecca Stern zu tun!
Die Mitarbeiterin des OCME zog mit geübtem Griff eine der Schubladen vor.
Rebecca bemerkte noch, wie Ferland neben sie trat. Hatte er Angst, sie würde im letzten Moment weglaufen? Oder umfallen? Sie zwang ihren Blick in die Richtung, wo der Kopf der Leiche liegen musste. Sie sah langes, dunkles Haar, das ein gräulich-blasses Gesicht umrahmte. Eine spitze Nase, schuppige, faltige Haut … Sehr alte Haut. »Das ist nicht meine Schwester!«, rief sie mit überschnappender Stimme, bevor ihre Knie nachgaben.
Rebecca blinzelte irritiert. Das Licht war zu hell. Und warum lag sie auf dieser Liege? Da tauchte Ferlands Kopf als riesiger Schatten vor ihr auf.
»Sind Sie okay?«, erkundigte er sich.
»Was ist passiert?«
»Sie sind umgefallen, Miss Stern. Kommt in den besten Familien vor.«
So viel Zartgefühl hatte sie ihm gar nicht zugetraut. Sie setzte sich auf und schwang ihre Beine über den Rand der Liege. Ihr war immer noch schwindelig, aber wenigstens roch es hier besser. Ihrer Kleidung entströmte noch schwach ein Hauch von Tod und Verwesung, aber der dominierende Geruch in diesem Raum war der nach Desinfektionsmitteln und angebranntem Kaffee. Jetzt einen Kaffee … Sie fühlte sich irgendwie erleichtert, fast euphorisch. Im nächsten Moment begriff sie, warum: Moira war nicht tot! Als Rebecca aufstehen wollte, legte sich eine Hand auf ihre Schulter und drückte sie zurück.
»Moment noch. Möchten Sie ein Glas Wasser?«, fragte Martinez.
»Nein, danke. Ich muss nur raus hier, dann geht es mir sofort besser.«
»Das geht uns allen so«, sagte Martinez ohne den Anflug eines Lächelns. »Aber einen Moment dauert es noch.« Sie saß vor einem Computerbildschirm und tippte etwas auf der Tastatur. »Bei der Toten handelt es sich nicht um Ihre Schwester Moira Stern, sagen Sie?«
»Hey, Sie ist noch gar nicht wieder ganz da«, beschwerte sich Ferland.
»Da liegt eine alte Frau, und Sie wollen mir weismachen, dass das meine Schwester Moira ist?«, brauste Rebecca auf. »Moira ist jünger als ich; sie ist erst zweiundzwanzig!«
»Der Verwesungsprozess ist möglicherweise schon so weit fortgeschritten …«, wandte Martinez nüchtern ein.
»Sie sah aber bereits ein paar Minuten nach ihrem Tod genauso aus«, hörte Rebecca Ferland sagen.
»Der Tod verändert einen Menschen stark«, entgegnete Martinez und sah Rebecca prüfend an. »Sie sollten sich ganz sicher sein. Hat Ihre Schwester irgendwelche unveränderlichen Kennzeichen?«
»Sie hat sich die Ohren anlegen lassen, als sie fünfzehn war. Da sind Narben hinter ihren Ohren, und es gibt eine am linken Knie. Ein Unfall mit Inlinern, als sie zwölf war.«
»Tätowierungen, Piercings, größere Operationsnarben?«
»Moiras Körper ist ihr Kapital, sie würde ihn niemals freiwillig verunstalten.«
»Warten Sie hier«, wies Martinez sie an und verließ den Raum. Ferland eilte hinterher.
Die Tür fiel mit einem Knall hinter ihm zu; und Rebecca blieb allein in einem fensterlosen Raum zurück, umgeben von drückender Stille. Sie stand auf und ging ein paar Schritte umher in der Hoffnung, auf diese Weise etwas von ihrer Anspannung loszuwerden. Die Tote, die sie gesehen hatte, konnte nicht Moira sein. Wieder hatte sie das faltige, schuppige Gesicht vor Augen – das Gesicht einer sehr alten Frau. Aber wo war dann Moira geblieben? Es musste eine Verwechslung sein, was durchaus vorstellbar war bei den vielen Toten in New York: den Opfern von Gewaltverbrechen, nicht identifizierten Toten, Menschen, die mit einer unklaren Todesursache verstorben waren. Wie sollte man Moiras Leiche, wenn sie denn überhaupt hier war, da jemals wiederfinden? Die wenigen Sachen, die man ihr kurz gezeigt hatte und die ihre Schwester getragen haben sollte, konnten Moiras gewesen sein – oder auch nicht. Sie hatten sich zu selten gesehen in letzter Zeit. Wie auch? Rebecca hatte einen anspruchsvollen und zeitraubenden Beruf und seit ein paar Monaten auch wieder einen festen Freund … Noël Almond zu treffen bedeutete meistens, sich in ein Flugzeug zu setzen; da reiste man nicht mal schnell in die USA, um sich Moiras Gejammer anzuhören. Verdammt. Sie war neunundzwanzig, Moira zweiundzwanzig, da dachte man doch, man habe noch alle Zeit der Welt, um sich irgendwann mal richtig auszusprechen!
Die Tür wurde aufgestoßen, und Martinez und Ferland betraten mit ernster Miene den Raum.
»Da sind Narben hinter den Ohrmuscheln«, berichtete Gina Martinez. »Außerdem hat die Tote eine etwa drei Zentimeter lange, senkrecht verlaufende Narbe auf dem linken Knie. Keine weiteren unveränderlichen Kennzeichen. Die Körperlänge beträgt hundertsiebenundsiebzig Zentimeter.« Sie maß Rebeccas hochgewachsene Gestalt mit einem kurzen Blick. »Und sie ist untergewichtig.«
»Das stimmt so weit alles«, sagte Rebecca schwach. »Aber warum sieht sie so schrecklich aus?«
Ryan Ferland verzog sein Gesicht zu einer zufriedenen Grimasse. »Ich sag doch. Das schreit nach einer Autopsie.«
3. Kapitel
BIHAR, INDIEN
Als Julia, gewissenhaft von Leela begleitet, zurück in ihr Apartment kam, standen ihre Koffer neben dem Schreibtisch. Sie hob den ersten aufs Bett und klappte ihn auf. Julia hatte keine technischen Geräte in ihren Koffern gehabt – keinen Fotoapparat, kein weiteres Mobiltelefon, nicht mal einen E-Book-Reader. Trotzdem waren ihre Sachen durchsucht worden, wie sie sogleich sah. Das Durchleuchten hatte offensichtlich nicht gereicht … Die Vorstellung, wie jemand in ihren Kleidungsstücken und persönlichen Dingen gewühlt hatte, gefiel ihr ganz und gar nicht.
Dann sah sie ein neues Mobiltelefon auf dem Schreibtisch, das offenbar für sie bestimmt war; daneben befand sich ein Zettel, auf dem der PIN-Code stand. Julia nahm es in die Hand und schaltete es ein. Sie hatte ihrer Freundin Sonja versprochen, sie anzurufen, sobald sie bei Serail Almond angekommen war. Das war gestern durch die Aktion in der Schleuse unmöglich geworden. Nun zögerte sie. Natürlich konnte man sie damit abhören, die Frage war nur, wozu? Sie dachte an die Mauer, die das Gelände umgab, die Prozedur in der Schleuse und das unnachgiebige und unnahbare Auftreten des Security Officers. Und wenn sie es mit ihrem Sicherheitswahn nicht dabei beließen? Schließlich hatten sie sich auch ungefragt Zugang zu ihrem Apartment verschafft.
Immerhin lag auf der Schreibtischplatte auch ihr Reisepass. Daneben hatte jemand, wie um zum Ausdruck zu bringen, dass Serail Almond alles sah, ihr Multifunktionswerkzeug gelegt. Sie besaß einen Leatherman Surge, der ihr bei ihrer Arbeit manchmal gute Dienste leistete. Den hatte sie während des Fluges natürlich im Koffer verstauen müssen. »Sie« hatten ihn beim Durchleuchten ihres Gepäcks natürlich gefunden – und sich vielleicht gewundert.
Julias Blick wanderte durch das funktionell eingerichtete Apartment. Es schien hier alles in Ordnung zu sein. Dann sah sie zur Decke und entdeckte den Rauchmelder, der nicht nach einem Standardgerät aussah. Eines der beiden Glasaugen war sicherlich dazu da, Rauch zu erkennen. Aber das zweite? Julia schnitt eine Grimasse und klappte einen Schraubendreher aus ihrem Leatherman heraus. Dann zog sie sich einen Stuhl heran, stieg darauf und schraubte den Deckel des Rauchmelders ab. Das zweite Glasauge sah aus wie das Objektiv einer Minikamera mit Fischauge. Sie wagten es, in ihrem Privatbereich … Wütend stach Julia mit der Spitze des Werkzeugs hinein; Glassplitter fielen zu Boden. Sie nahm sich vor, den Rauchmelder in Zukunft täglich zu kontrollieren und sich außerdem bei Parminski darüber zu beschweren. Sie atmete tief ein und aus, schraubte den Deckel wieder zu und stieg vom Stuhl. Anschließend verstaute sie ihren Reisepass im aufgetrennten Futter ihres Koffers, nahm das neue Handy und wählte Sonjas Nummer.
»Julia! Bist du jetzt erst angekommen?«
»Nein. Ich melde mich erst heute, weil sie mir gestern bei der Ankunft mein Telefon abgenommen haben.«
»Sie haben was? Wo bist du denn gelandet?«
»Ich musste Handy, Laptop und Reisepass abgeben. Und mein Gepäck wurde durchsucht. Um eine Leibesvisitation bin ich gerade noch herumgekommen.«
»Das wagt doch eh keiner.« Sie hörte, wie Sonja am anderen Ende der Welt lächelte.
»Ich kam mir so vor, als ginge ich in den Knast! Hast du nicht behauptet, dass Serail Almond ein fortschrittliches Unternehmen ist?«
»Es gibt bestimmt einen Grund dafür, dass die so vorsichtig sind. Hast du alles wiederbekommen?«
»Nicht alles.« Sie überlegte kurz, ob sie Sonja auch von der Kamera im Rauchmelder erzählen sollte, ließ es dann aber bleiben. »Und was machst du so?«, fragte sie, um von ihrem Ärger abzulenken.
»Ich war gestern mit meinem Bruder essen. Ich hab ihn ein bisschen ausgefragt, weil du jetzt auch für Serail Almond arbeitest. Stefan war in Plauderstimmung. Er sagte, dass sie bei Serail Almond kurz vor einem sensationellen Durchbruch stehen.«
»Vielleicht sind sie ja deswegen so paranoid? Du hast ihm aber nicht gesagt, dass ich hier arbeite?«, fragte Julia alarmiert.
»Kann sein, dass ich es erwähnt habe. Meinst du, das interessiert ihn?«
Das klang nicht gut. Stefan Wilson, Sonjas Bruder, war das jüngste Vorstandsmitglied von Serail Almond. »Ich hatte dich doch ausdrücklich gebeten, es ihm nicht zu sagen.«
»Er hat mir gar nicht richtig zugehört, Julia. Er ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt.«
Julia verdrehte die Augen. Egozentrisch war Stefan Wilson schon immer gewesen. Sie sollte sich nicht weiter aufregen. Bestimmt erinnerte er sich nicht einmal mehr an sie. Während des Flugs nach Indien hatte Julia in einem Wirtschaftsmagazin einen schmeichelhaften Artikel über ihn gelesen: Er hatte zunächst ein hochspezialisiertes, kleines Pharma-Unternehmen geführt, das er mithilfe des Erbes seines Vaters gegründet und aufgebaut hatte. Doch es sei für eine Firma zu risikoreich, hatte er dem Verfasser der Reportage erklärt, nur an ein oder zwei neuen Produkten zu forschen, da im Schnitt lediglich eine von zehn Neuentwicklungen überhaupt zur Marktreife gelange. Aus diesem Grund habe er sein Unternehmen an Serail Almond verkauft. Ihm war dadurch der Karrieresprung in den Vorstand eines internationalen Konzerns gelungen.
Ehrgeizig war er ja schon immer gewesen, dachte Julia, und ausschließlich auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Sie hatte sich als Vierzehnjährige Hals über Kopf in ihn verliebt. Er war Student gewesen und hatte sie, die Freundin seiner kleinen Schwester, nicht mehr beachtet als die Topfpflanzen auf der Fensterbank. Julia, die oft bei Sonja übernachtet hatte, war Zeugin seiner ausgedehnten Exkursionen ins Hamburger Nachtleben geworden – oder besser gesagt, seiner Ausfallerscheinungen an den Tagen danach. Sie hätte damals niemals gewagt, auf ihn zuzugehen. Mit vierzehn hatte sie, dünn und hochgewachsen wie sie war, mehr wie eine Giraffe als wie eine junge Frau ausgesehen. Und sie hatte sich »skurrilen« Interessen hingegeben, wie etwa den Naturwissenschaften, und kein Geld für Schminke oder teure Kleidung besessen.
Dann war Sonja eines Abends nicht wie abgesprochen gegen halb neun von der Musikstunde nach Hause gekommen. Sonjas Eltern befanden sich zu jener Zeit im Urlaub, und Stefan, der auf sie aufpassen sollte, war unauffindbar. Julia suchte daher alleine nach Sonja und entdeckte schließlich ihr Fahrrad und dann sie selbst in einem Straßengraben. Ihre Freundin war verletzt – ein Unfall mit Fahrerflucht. Julia verständigte den Rettungsdienst und wartete später im Krankenhaus, was die Untersuchungen ergeben würden. Für Sonja ging es noch glimpflich aus, sie hatte nur Rippenbrüche und eine Gehirnerschütterung erlitten. Julia erreichte die Eltern ihrer Freundin in Singapur und berichtete ihnen von dem Unfall, Stefan hingegen konnte sie zunächst nicht erreichen. Er tauchte erst kurz vor Mitternacht im Krankenhaus auf, als es Sonja schon wieder den Umständen entsprechend gut ging. Julia fuhr anschließend mit ihm zum Haus seiner Eltern. Sie übernachtete in den Ferien sowieso oft bei Sonja, weil ihre Eltern als Varietékünstler meistens irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs waren. Stefan hatte sie, im Haus angekommen, erst aus ihren vom Regen durchnässten Sachen und dann von ihrer Jungfräulichkeit befreit.
Das alles lag viele Jahre zurück und hatte nichts mit der Julia Bruck zu tun, die sie heute war. Sie arbeitete zwar für ICL Thermocontrol, die wiederum für Serail Almond India tätig war, aber sie hatte nicht vor, deswegen Stefan Wilson zu begegnen.
Das Telefonat mit Sonja endete mit einer atmosphärischen Störung, die nicht auf die Entfernung zwischen Hamburg und Bihar zurückzuführen war.
AN BORDDERAURORA
Kamal Said wusste nicht, wie spät es war. Er hatte seine Uhr in der griechischen Hafenstadt Patras einem italienischen LKW-Fahrer überlassen. Und der Schlepper hatte seine gesamten Ersparnisse bekommen.
Im Container herrschte Dunkelheit. War es Tag oder Nacht da draußen? Sah man die Sonne oder den Mond und die Sterne? Er wusste nur, dass die Aurora, ein Frachtschiff mit dem Heimathafen Velmerido, inzwischen ausgelaufen war. Er hörte den Schiffsmotor laut dröhnen und spürte die Vibration, weshalb er annahm, dass er sich recht weit unten im Schiffsrumpf befand. Außerdem wusste er, dass der Container, in dem er sich aufhielt, relativ früh verladen worden sein musste.
Navid schlief oder er war in Ohnmacht gefallen, was besser für ihn wäre, da er vorher offenkundig große Schmerzen verspürt hatte. Er hatte sich wahrscheinlich den Arm gebrochen und Hautabschürfungen erlitten, als er von einem LKW gestürzt war. Die Wunde musste sich ja entzünden – bei den schlechten hygienischen Verhältnissen, unter denen sie als Flüchtlinge lebten.
Doch Kamal konnte nicht viel für ihn tun; nicht hier, nicht in der Dunkelheit. Er hatte versucht, mit ihm zu reden, um ihn ein wenig abzulenken, was jedoch schwierig gewesen war, weil der Junge nicht Kamals Sprache beherrschte und auch nur ein paar Brocken Englisch konnte. Sein Feuerzeug zu benutzen, um Licht zu machen und sich Navids Wunde genauer anzusehen, traute er sich nicht, denn im Container stank es nach Benzin oder anderen leicht brennbaren Flüssigkeiten. Und seine Taschenlampe hatte schon am ersten Tag ihren Geist aufgegeben. Das Ganze war ein Himmelfahrtskommando. Wenn er sich wenigstens mit jemandem über die Gefahren und Hoffnungen, die mit diesem Teil der Flucht verbunden waren, hätte austauschen können … Doch sein Schicksalsgenosse stöhnte und jammerte die meiste Zeit, und wenn er mal still war, meinte Kamal seinen Blick im Nacken zu spüren. Und das war noch schlimmer.
BIHAR, INDIEN
Ein wenig unsicher betrat Julia zusammen mit Gundula Keller den Konferenzraum.
Jeden Donnerstagvormittag gab es ein Meeting der ICL Thermocontrol mit ihrem Kunden. Daran nahmen für gewöhnlich drei Mitarbeiter des Dienstleisters und vier von Serail Almond teil. Julia war heute als Nachfolgerin des vermissten Tjorven Lundgren das erste Mal bei diesem Jour fixe anwesend. Zwei der vier Mitarbeiter von Serail Almond kannte sie bereits: Es waren Tony Gallagher, der Facility-Manager, und Direktor Norman Coulter, der diesmal ausnahmsweise an der Sitzung teilnahm. Die beiden anderen – eine Frau und ein junger, ehrgeizig wirkender Inder namens Harish Prajapati, der Coulters Assistent war – wurden ihr bei der Begrüßung kurz vorgestellt; dann nahmen alle am Tisch Platz. Julia und ihre Kollegin setzten sich nebeneinander. Wenige Augenblicke später hetzte der sonst stets entspannt wirkende Barry als Letzter in den Raum. Nervös grüßte er die Anwesenden und ließ sich dann auf den anderen Stuhl neben Julia fallen.
Sie saßen in einem unterkühlten, fensterlosen Besprechungsraum bei Mineralwasser, Kaffee und frisch aufgeschnittenem Obst, das hier zu jeder Tages- und Nachtzeit für die Mitarbeiter bereitstand. Julia, die sich bereits einen groben Überblick über ihre zukünftige Arbeit verschafft hatte, schwante nichts Gutes. Warm war hier nur der Kaffee. Zumindest funktionierte zu diesem Zeitpunkt in allen Bereichen des Forschungszentrums die Klimaanlage. In den letzten Wochen hatte es jedoch immer wieder Probleme gegeben, vor allem im Trakt C und in der Verwaltung.
Darauf kam Norman Coulter gleich als ersten Tagesordnungspunkt zu sprechen. Im vergangenen Monat war in den Verwaltungsräumen dreimal die Klimaanlage ausgefallen. Einmal hatte es vier Tag gedauert, bis wieder alles funktionierte. Eine der Angestellten war wegen Kreislaufversagens auf die Krankenstation gekommen, fügte Harish Prajapati vorwurfsvoll hinzu. Gundula verteidigte die Arbeit von ICL, indem sie die Funktionsstörungen der Klimaanlage auf die ständig wiederkehrenden Stromausfälle zurückführte: ein weit verbreitetes Problem in Indien, dem man in sensiblen Bereichen, wie den Labors und den Server-Räumen, mit eigenen großen Generatoren begegnete. Sie schlug vor, die Notstromversorgung auch auf die Steuerung der Klimaanlagen der Trakte A und B auszuweiten. Das System sei sowieso viel zu groß dimensioniert. Coulter winkte ab. ICL solle im Störfall einfach nur schneller und effektiver reagieren, ergänzte die anwesende Serail-Almond-Mitarbeiterin bissig. Die Büroangestellten würden ein oder zwei Stunden ohne Klimaanlage gut überstehen, bei drei Tagen höre der Spaß zu dieser Jahreszeit aber auf. Barry wandte ein, dass die Leute in den Büros die Dauer des Ausfalls selbst mitverschuldet hätten, weil erst nach neunundvierzig Stunden eine Störung an ICL gemeldet worden sei. Sie diskutierten eine Weile über die fehlende Kommunikation zwischen ICL und Serail Almond: ein Thema, das anscheinend nicht zum ersten Mal zur Sprache kam, wie Julia bemerkte.
Die Serail-Almond-Mitarbeiter beklagten sich außerdem, dass Tjorven Lundgrens Arbeitsplatz zu lange unbesetzt und deshalb vieles unerledigt geblieben sei. Julia schlug ein kurzfristig anzusetzendes Treffen vor, um Versäumtes aufzuarbeiten. Dann kam sie auf ihr vorrangiges Anliegen zu sprechen: Die Konstruktionspläne der bestehenden Klimaanlage, die ICL von einer Vorgängerfirma übernommen hatte, seien, gelinde ausgedrückt, unvollständig. Vor einer Komplettsanierung müsse deswegen zunächst einmal eine lückenlose Bestandsaufnahme gemacht werden. Über die Anlage in Trakt C, dem ältesten Teilbereich, hätte sie im Grunde nur Pläne, die Lundgren wohl selbst nach eigenen Untersuchungen erstellt habe. Das war der Punkt, an dem sich Norman Coulter mit dem Hinweis auf einen wichtigen Termin verabschiedete und es seinem Assistenten Prajapati überließ, sich des Themas anzunehmen. Der beteuerte routiniert, da könne er leider rein gar nichts für ICL tun, aber das sei doch sicher no problem für so kompetente Ingenieure. Julia knirschte mit den Zähnen.
Als die Besprechung beendet war, beugte sich Barry zu ihr hinüber. »Tjorven hat das auch immer wieder versucht«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Entweder hüten sie solche Unterlagen wie die Kronjuwelen, oder die Pläne sind irgendwann mal aus Versehen im Altpapier gelandet …«
»Die müssen doch irgendwo abgespeichert gewesen sein. Ich dachte, hier sei alles perfekt.«
Barry zuckte lächelnd mit den Schultern. Julia drehte sich um und sah, dass Gundula sie aufmerksam beobachtete.
AN BORDDERAURORA
Er schien sich seit Stunden in diesem Dämmerzustand zwischen Wachsein und Schlaf zu befinden. Sein Kopf dröhnte.
Zumindest war Kamal jetzt auf einem Schiff in Richtung Großbritannien unterwegs. Thamesport, ihr Zielhafen, lag in der Nähe von London; jedenfalls hatte der Schlepper ihm das versichert. Seine Familie verließ sich auf ihn. Viereinhalb Monate waren vergangen, seit er seine Heimat Afghanistan verlassen hatte, in der Hoffnung, nach Griechenland und von dort auf ein Schiff zu gelangen, das ihn nach England bringen würde. Eine Cousine seines Vaters wohnte in London. Sie hatte versprochen, ihm zu helfen – nach allem, was der Familie Said zugestoßen war.