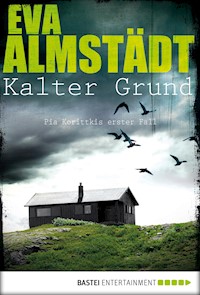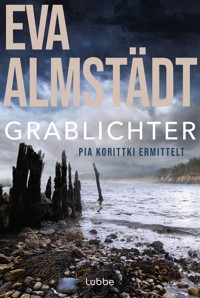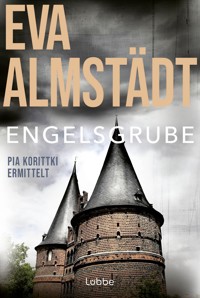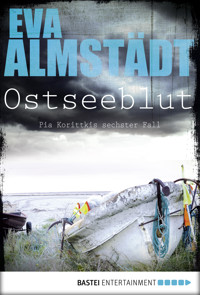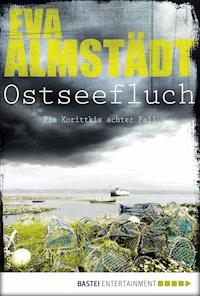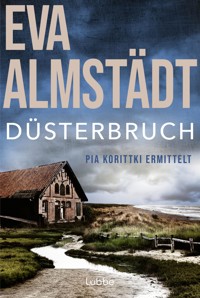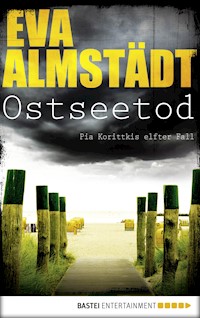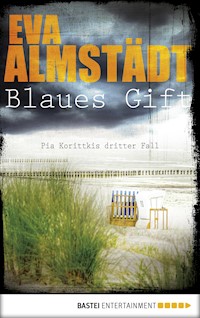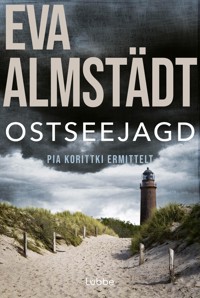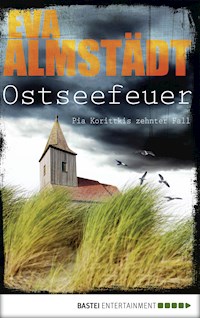
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Pia Korittki
- Sprache: Deutsch
"Nicht alle beten, die in die Kirche gehen." Deutsches Sprichwort
Der Pastor eines Ostseedorfes wird tot in der Sakristei aufgefunden - ermordet. Kommissarin Pia Korittki und ihr Team vom K1 in Lübeck übernehmen die Ermittlungen. Doch der Fall gestaltet sich schwierig, denn der Pastor scheint keine Feinde gehabt zu haben. Erst als ein zweiter Mord geschieht, beginnen die Fassaden zu bröckeln. Pia, die privat um das Sorgerecht für ihren Sohn Felix fürchten muss, kämpft plötzlich an allen Fronten. Denn im Dorf beginnt ein alter Aberglaube wieder aufzuleben: Es heißt, der Tod holt immer drei ...
Ein neuer Fall für Kommissarin Pia Korittki - Der zehnte Band der erfolgreichen Krimi-Reihe von Bestsellerautorin Eva Almstädt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Zitat
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Nachbemerkung
Eva Almstädt
OSTSEE-FEUER
Kriminalroman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Dorothee Cabras/Karin Schmidt
Titelillustration:
© shutterstock/dibrova; © shutterstock/Jurjen Veerman;
© shutterstock/anyaivanova
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-0646-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Denn ihr selbst wisset gewiß,daß der Tag des HERRN wird kommenwie ein Dieb in der Nacht.
1 Thess 5,2
1. Kapitel
Im Pfarrhaus hatte niemand bemerkt, dass sie gegangen war. Katharina Stöver fuhr an dem Wall mit den Heckenrosen entlang, der zu den vier Strandhäusern führte. Der Dünengürtel zeichnete sich als helleres Band gegen den Nachthimmel ab. Jenseits der Dünen erstreckte sich die Ostsee. Hinter sich wusste Katharina die vertrauten Wiesen und Felder, ihr Dorf und noch mehr Wiesen und Felder, bis Schleswig-Holstein im Westen wieder in der Nordsee versank.
Sie bog auf den Parkplatz ein. Wie erwartet stand nur der Mietwagen dort, mit dem Adrian hier angekommen war. Die anderen Strandhütten waren um diese Jahreszeit sicherlich unbewohnt. Katharina Stöver stieg aus. Sie musste einen Aufschrei unterdrücken, als das Licht des Dahmeshöveder Leuchtturms über sie hinwegstreifte.
Was tat sie hier? War das nicht vollkommen verrückt? Doch Matthias würde bis spät in die Nacht in seinem Arbeitszimmer sitzen, ihre Zwillinge pubertierten vor sich hin, und ihr erwachsener Sohn Gregor war mit seinen Gedanken sowieso überall, nur nicht in seinem Elternhaus. Wen interessierte es noch, ob sie mit Migräne im Bett lag, wenn kein Essen zu kochen und aufzutischen, keine Wäsche zu bügeln, kein Fahrdienst zu leisten war?
Sie zog den Reißverschluss ihrer Jacke zu und schlug den Weg zu den Strandhäusern ein. Katharina hatte nicht erwartet, dass es so dunkel sein würde. Umso intensiver roch sie das Meer, verrottende Algen und das Dünengras, das im Wind raschelte.
Links tauchte nun der Umriss der ersten Strandhütte auf. Rechts, weit hinten in den Dünen, sah sie den Lichtschein eines Feuers. Das kam ihr seltsam vor. Waren das Jugendliche, die an der Ostsee zusammen trinken und grillen wollten? Oder ein Obdachloser, der sich aufwärmte? Nein, der würde nicht den weiten Weg hier herauskommen, es sei denn, er hatte vor, in einem der Sommerhäuser Unterschlupf zu finden. Also hatte Adrian sich ein Feuerchen gemacht? In den Dünen ein Feuer zu entzünden war verboten. Wie typisch für Adrian, sich nicht daran zu halten.
Da war er ja schon. Ihr Herz klopfte schneller. Katharina wollte ihm zuwinken, doch ihr Arm sank wieder herab. War er das wirklich? Die Bewegungen des Menschen am Feuer hatten etwas … Verstohlenes. Als schaute er sich nervös über die Schulter. Hatte er sie gesehen? Und wenn es jemand anders war, wo war dann Adrian?
Die Strandhütten oberhalb des Weges sahen allesamt dunkel und verlassen aus. Auch der Pfad zum Strand hinunter war menschenleer gewesen. Sie war allein – und das da vorn war nicht Adrian. Der Fremde verharrte, als hätte er sie bemerkt. Einen Moment stand er reglos vor dem zuckenden Lichtschein. Sie hielt die Luft an. Erst sah es so aus, als käme er auf sie zu, doch dann ging er zielstrebig in Richtung Leuchtturm davon. Katharina hörte jenseits der Strandhäuser einen Motor aufheulen. Ein tiefes, unregelmäßiges Blubbern, das schwächer wurde und sich in der Ferne verlor.
Sie löste sich aus ihrer Erstarrung, um nach dem Feuer zu sehen. Als sie näher kam, stutzte sie. Es roch angebrannt und auch nach Grillfleisch. Katharina schluckte, weil sie noch nichts zum Abendbrot gegessen hatte. Also waren es doch Jugendliche gewesen? Und da lag etwas vor dem Feuer. War das ein Mensch?
Katharina lief hin und beugte sich zu dem reglosen Mann hinunter. Er trug einen Ledermantel, eine Wollmütze, Stiefel. Es war Adrian. Und er rührte sich nicht. Sein Gesicht schien im Licht der Flammen zu glühen. Er hatte die Augen geschlossen, doch die Lider zuckten. Sie sprach ihn an, fasste ihn an der Schulter, rüttelte ihn, aber er reagierte nicht. Sein Körper war warm, schwer und reglos. Wenn er so nah am Feuer liegen blieb, würde er Verbrennungen oder zumindest einen Kreislaufzusammenbruch erleiden. Sie packte ihn an Oberarm und Hüfte und rollte ihn ein Stück von den Flammen weg. Als sie weit genug vom Feuer entfernt waren, sank Katharina auf die Knie und rüttelte ihn.
»Wach auf, Adrian! Sag doch was! Irgendwas!«
Er stöhnte. Was war los mit ihm? War Adrian gestürzt, oder hatte er zu viel getrunken? Katharina strich ihm über die Wange. Er stöhnte wieder und versuchte, ihr etwas zu sagen. Sie roch Alkohol in seinem Atem.
»Ganz ruhig, Adrian«, murmelte sie. »Ich bin ja da.« Sie streichelte sein Gesicht. Ihre rechte Hand glitt höher, bis an den Rand der Wollmütze. Sie fühlte, dass ihre Finger nass wurden. Hastig hielt sie sie in den Lichtschein des Feuers. Sie waren klebrig, klebrig von Blut. Und da war noch etwas im Feuer: Unverkennbar lag mitten in der Glut ein Pferdekopf. Der untere Teil, Maul und Nüstern, war verkohlt. Das Tier schien die langen Zähne zu blecken. Darüber sah sie einen Streifen Fleisch und Gewebe, schmorende Haut und glimmendes Fell, über das die Flammen züngelten. Die Augenhöhlen dampften. Daher rührten dieser fettige Rauch und der Gestank.
Ihr wurde übel. Wie hatte sie bei dem Geruch nur ans Grillen denken können?
Es war kurz nach dreiundzwanzig Uhr, als es an der Tür klingelte. Pia Korittki, Kriminaloberkommissarin bei der Bezirkskriminalinspektion Lübeck, erwartete keinen Besuch. Ihr Freund Lars war bei seinen Eltern in Bremen und wollte dort auch übernachten. Sie hatte ihn quasi fortgeschickt, weil sie die letzten Dinge in ihrer alten Wohnung lieber allein zusammenpacken wollte. Der Umzug in die neue Wohnung an der Adlerstraße stand unmittelbar bevor. Genervt und leicht beunruhigt betätigte sie den Schalter der Gegensprechanlage.
»Pia? Entschuldige die Störung, ich wollte nur rasch schon mal Felix’ Buggy holen«, hörte sie Hinnerks Stimme.
»Hi, Hinnerk. Wollt ihr den wirklich haben? Den braucht er doch kaum noch.«
»Mascha meint, sie hätte ihn übers Wochenende lieber dabei.«
Pia drückte auf den Türöffner und ließ Hinnerk ins Haus. Er war der Vater ihres Sohnes, und das kommende Wochenende würde Felix bei ihm verbringen. Sie hatten sich schon vor Felix’ Geburt getrennt, und Hinnerk kümmerte sich jedes zweite Wochenende um den Jungen. Pia wollte das »Buggy-Thema« nicht über die Sprechanlage mit ihm diskutieren. Sie wollte jetzt eigentlich gar nicht diskutieren. Morgen früh kam der Umzugswagen, und sie lag nicht gerade gut in der Zeit.
»Meinst du nicht, dass du es uns überlassen solltest, ob Felix den Buggy braucht oder nicht?«, fragte Hinnerk, kaum dass er in der Wohnung stand. »Wieso glaubst du eigentlich immer, dass nur du weißt, was er braucht und was nicht?«
Pia hob abwehrend die Hände. »Kein Problem. Entscheidet ihr. Ich freu mich nur, wenn Felix gern läuft und sich bewegt und nicht die ganze Zeit reglos im Buggy sitzt.«
»Ach, soll das heißen, wir achten nicht auf genügend Bewegung?«
Sie hatte keinen Nerv auf diese albernen Streitereien. »Wenn du willst, nimm den Buggy gern mit. Er steht allerdings schon im Keller der neuen Wohnung. Ich war froh über jedes Teil, das ich vorab rüberschaffen konnte.« Sie hielt einen Schlüsselbund mit drei Schlüsseln daran hoch.
»Was? Mist!«
»Sorry. Aber da du schon mal hier bist … Magst du einen Moment mit in die Küche kommen, Hinnerk? Ich würde gern noch etwas mit dir besprechen.« Es war eine der wenigen Gelegenheiten, wo Felix mal nicht anwesend war. Kritische Themen in seiner Gegenwart anzusprechen war mittlerweile unmöglich, denn mit über zwei Jahren verstand er natürlich schon viel mehr, als er selbst ausdrücken konnte.
»Mascha wartet.«
»Im Auto?«
»Nein, zu Hause.«
Pia atmete tief durch. Sie musste einfach noch mal mit ihm reden. Zur Not eben hier im Flur. Sie konnte nicht tatenlos zusehen, wie Hinnerk und sie in einen Rechtsstreit hineingerieten, unter dem Felix wohl am meisten leiden würde. »Es geht um das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Müssen wir das wirklich auf dem Rechtsweg durchkämpfen? Ich finde, wir sollten wenigstens noch einmal versuchen, uns einvernehmlich zu einigen, schon um Felix’ willen.«
»Gern. Dann übertrag es mir einfach!«
Pia zuckte zurück. »Und was würdest du dann tun?«
Hinnerks Gesicht wurde ausdruckslos. »Dann kann Felix dauerhaft bei Mascha und mir wohnen, und du hättest ihn an jedem zweiten Wochenende.«
»Niemals«, entfuhr es Pia, und sie biss sich auf die Unterlippe.
»Tut mir leid, Pia. So sieht es nun mal aus. Du weißt, dass ich mit deiner Arbeit und der Art, wie du sie alleinerziehend mit einem Kind vereinbarst, ganz grundsätzlich ein Problem habe.« Er nahm Pia den Schlüsselbund für ihre neue Wohnung aus der Hand und wandte sich zur Tür. »Das Thema könnte schon längst durch sein. Vielleicht hättest du dann ja gar nicht umziehen müssen.« Er ließ den Blick spöttisch durch die kleine Dachwohnung gleiten. »Ich weiß ja, dass du das im Grunde gar nicht willst.«
»Natürlich will ich«, antwortete sie.
»Ich werfe dir die Schlüssel nachher in den Briefkasten.« Hinnerk schloss nachdrücklich hinter sich die Tür.
Pia ertappte sich bei einem Kraftausdruck, der ihre ganze Hilflosigkeit zum Ausdruck brachte. Immerhin hatte Felix das nicht gehört.
Nach einer Weile konnte Adrian sich aufsetzen. Katharina gab ihm ihr Halstuch, das er sich gegen die Wunde presste. Er wollte partout keinen Rettungswagen und keinen Arzt. Stattdessen musste sie ihm nach ein paar Minuten helfen, langsam aufzustehen. Halb stützend, halb schleppend brachte sie ihn zurück zu der Strandhütte.
Katharina musterte das alte Holzhaus. Es war kein sicherer Ort. Sogar ein Kind könnte hier einbrechen. Was, wenn der Mann, den sie gesehen hatte, später in der Nacht wiederkam? Ihr war auch nicht wohl bei dem Gedanken, Adrian allein in der Hütte zurückzulassen, selbst wenn niemand versuchen würde, hier einzudringen. Wer sollte Adrian helfen, wenn er wieder das Bewusstsein verlor? Wenn er plötzlich Krämpfe bekam oder die Kopfwunde nicht aufhörte zu bluten? Katharina verstand nicht viel von Medizin, aber sie vermutete, dass Adrian auch in den nächsten Stunden noch an so etwas wie einem Schädel-Hirn-Trauma sterben konnte. Sie hatte schon von Unfällen gehört, bei denen die Betroffenen sich eine Weile recht normal verhalten hatten und später doch ihren Verletzungen erlegen waren.
Nachdem Adrian sicher auf dem Sofa lag, verschloss sie sorgfältig die Tür und zog die Vorhänge zu. Weiß-blau, mit Segelschiffen und Möwen darauf – wie sie erkannte, als das Licht des Leuchtturms kurz dahinter aufleuchtete. Es waren noch dieselben Übergardinen wie vor über zwanzig Jahren.
Sie schaltete eine Lampe ein und betrachtete den großen, kräftigen Mann auf dem Sofa. Adrian war ihr fremd geworden. Er hielt die Augen geschlossen. Jetzt, da er nicht mehr am Feuer lag, sah sein Gesicht blass aus. Er wirkte erschöpft und zitterte trotz des dicken Mantels, den er immer noch trug. Sie deckte ihn mit einer alten Wolldecke zu und zog ihm die Stiefel aus. Ein seltsam intimer Moment nach den Jahren, in denen sie nie mehr als ein flüchtiges Nicken oder einen Händedruck getauscht hatten.
Katharina nahm sich einen Stuhl und setzte sich zu Adrian. »Blutet es noch?«
Er zog das Halstuch ein Stück herunter. Der Blutfleck war nicht viel größer geworden. Sie rückte die Stehlampe ein wenig näher heran, doch sie spendete kaum mehr als einen fahlen, gelben Lichtschein. Unter Adrians ehemals rotblondem, nun von Grau durchsetztem und vor Blut steifem Haar sah sie die Wunde. Ein bogenförmiger Hautriss, umgeben von einer ansehnlichen Beule, die blaurot und von Adern durchzogen schillerte.
»Ich glaube, das muss genäht werden. Außerdem solltest du deinen Kopf untersuchen lassen. Mit solchen Verletzungen ist nicht zu spaßen.«
»Morgen vielleicht.« Er schlug die Augen auf. »Alles ist gut, Kathi. Mach dir keine Sorgen!«
Wann hatte sie zuletzt jemand Kathi genannt? Die Erinnerungen kamen hoch. Die Sehnsucht und die alten Gefühle. Sie räusperte sich. »Ich kann dich hier so nicht allein lassen.«
»Dann bleib doch bei mir!«
»Und wovon träumst du nachts?«
»Von dir.« Er versuchte es mit einem Grinsen.
»Ich habe jemanden vom Feuer weglaufen sehen. Kurz bevor ich dich gefunden habe. Wer war das? Hat dich jemand niedergeschlagen?«
»Ich erinnere mich nicht.«
Sie erkannte Unbehagen in seinen Augen. Oder war es Angst? »Adrian, du musst doch wissen, was passiert ist. Was wolltest du überhaupt da draußen?«
»Ich hab ein Feuer in den Dünen gesehen und wollte nachschauen, was da los ist. Es war aber niemand da. Dachte ich. Dann hab ich mich umgedreht, und es wurde alles schwarz. Filmriss.«
»Ich glaube, du bist bewusstlos geschlagen worden«, beharrte Katharina.
Er zog die Decke höher. »Vielleicht bin ich auch nur hingefallen und irgendwo mit dem Kopf aufgeschlagen.«
»Ist dir jemand hier heraus gefolgt? Bist du deshalb in Mönkenbek aufgekreuzt, weil du Ärger hast?«
»Darf man nicht mal mehr seinen Bruder besuchen?«
»Und dieser Pferdekopf im Feuer?«
»Was? Wovon sprichst du?«
Er verschwieg ihr etwas. So war er immer schon gewesen. Er vertraute niemandem. Nicht einmal ihr. »Ich hab Motorgeräusche gehört. Gleich nachdem jemand vom Feuer weggelaufen war. Vielleicht ein Motorrad?«
Adrian sah sie durchdringend an. »Kein Wort darüber, Kathi! Verstanden?« Dann fasste er sich wieder an den Kopf und verzog das Gesicht.
»Ich kann dich immer noch zum Krankenhaus fahren.«
»Nein«, sagte er scharf.
»Da wärst du sicher, vor wem auch immer. Oder soll ich wenigstens unsere Ärztin anrufen? Ann-Christine Philipps. Sie würde bestimmt hier rauskommen.«
»Etwa die Tochter vom alten Philipps?«, spottete er. »Ihr seid vielleicht ein versipptes Pack. Nein, Kathi. Das ist nur eine Beule.«
»Und was ist mit der Polizei? Jemand hat dich angegriffen. Du könntest jetzt tot sein.«
»Keine Polizei.« Seine Hand umklammerte ihren Unterarm. »Und kein Wort, verstanden?«
Er tat ihr weh. Katharina löste seine Finger und stand auf. »Okay, Adrian. Es ist dein Leben.«
»Alles wird gut.« Er atmete ein paar Mal tief ein und aus. Dann versuchte er sein spöttisches Lächeln. »Du kannst ja morgen wiederkommen, Kathi, und schauen, ob ich noch lebe.«
2. Kapitel
Die Uhr zeigte schon drei Uhr nachts, als Pia den letzten Karton mit Kleinkram schloss. Ihre alte Wohnung lag im historischen Lübecker Gängeviertel. Wegen des engen Ganges, den man von der Straße aus passieren musste, und des Treppenhauses mit den ausgetretenen Stufen hatte sie für den eigentlichen Umzug Profis engagiert. Beim Hin- und Herräumen in der neuen Wohnung würden Lars und ein paar Kollegen mit anpacken. Lars hatte sie schon beim Streichen unterstützt und Lampen aufgehängt. Felix’ Kinderzimmer war von ihnen beiden mit einer Meereslandschaft, einer Pirateninsel und einem Himmel mit Schäfchenwolken bemalt worden. Es sah toll aus.
Mittlerweile war fast alles verstaut, bis auf Pias selbst gemalte Bilder, die sie nun beinahe widerstrebend aus dem Abstellraum unter der Dachschräge hervorzog. Sie waren zu groß, um sie in Kartons zu verstauen, zu schockierend für unbedarfte Betrachter. Und da sie eine Art Chronik ihrer beruflichen Erlebnisse darstellten, noch nicht zur Vernichtung freigegeben.
Pia betrachtete das erstbeste Bild. Es war das mit dem abgetrennten Arm in dem blauen Müllsack. Einer ihrer ersten Einsätze bei der Polizei. Damals war sie noch in der Ausbildung gewesen. Inzwischen arbeitete sie seit über fünf Jahren im Team der Lübecker Mordkommission. Sie liebte ihre Arbeit, doch es gab immer wieder Verbrechen und Schicksale, die sie bis in ihr Privatleben verfolgten. Um die Erlebnisse zu verarbeiten, hatte sie viele der Eindrücke mit Acrylfarben auf Leinwand gebannt. Wenn sie etwas erst mal gemalt hatte, verarbeitete sie es besser und träumte nicht mehr davon. Doch seit Felix’ Geburt hatte sie für derlei Freizeitaktivitäten keine Zeit mehr. Ihr Sohn sollte diese Bilder auf keinen Fall sehen. Aber jetzt musste sie irgendwo damit hin, bis sie sie in ihrer neuen Wohnung auf dem Dachboden einlagern konnte. Sie nahm sich vor, während des Umzugs aufzupassen. Lars hatte die Bilder auch noch nicht zu Gesicht bekommen. Er wusste zwar, dass sie existierten, aber etwas hielt Pia stets davon ab, sie ihm zu zeigen. Er würde es vielleicht nicht verstehen, wie er vieles von dem, was sie tat, nicht so recht nachvollziehen konnte.
Als Kind oder beinahe Jugendlicher hatte Lars schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Sein Vater war unschuldig unter Mordverdacht geraten. Daraufhin hatte in dem Ort, in dem sie gelebt hatten, eine Art Hetzjagd auf seine Familie stattgefunden, vor der sie sich nur durch einen Umzug hatten retten können. Und jetzt hatte er eine Freundin, die bei der Kriminalpolizei arbeitete. Sie lächelte reumütig. Wie hatte ihm das nur passieren können?
Pia lehnte die Leinwände mit der Vorderseite zur Wand und legte ein altes Laken darüber. Sie war zum Umfallen müde. Am Morgen würde sie sich als Erstes um die Bilder kümmern.
Pünktlich um acht Uhr stand der bestellte Umzugswagen vor der Tür. Genauer gesagt, vor dem Rohwedders Gang. Die Umzugsleute parkten draußen auf der Straße und mussten erst einmal den schmalen Gang, dann den Innenhof und das enge Treppenhaus mit den steilen Stiegen bewältigen, bevor sie in Pias Wohnung gelangten.
Um sechs Uhr abends, nachdem der Möbelwagen dreimal hin- und hergefahren war, stand das letzte Möbelstück an seinem neuen Platz, und in jedem Raum der Wohnung stapelten sich die dazugehörigen Kartons. Pias Eltern waren später hinzugekommen, ihre Mutter hatte die Küche eingeräumt, während Pia sich um Felix’ Zimmer gekümmert hatte.
»Du wirst das sicher alles noch mal nach deinen Vorstellungen einsortieren«, hatte ihre Mutter bemerkt, als sie Pia die neu bestückten Küchenschränke gezeigt hatte, »doch fürs Erste wirst du klarkommen.«
Pia hatte sich gefreut, sie umarmt, aber insgeheim bezweifelt, dass sie die wunderbare Ordnung je wieder ändern würde. Dazu fehlte ihr einfach das Interesse an solcherlei Haushaltsdingen.
Sogar ihre Kollegen Heinz Broders und Michael Gerlach waren für ein paar Stunden zum Helfen gekommen. Die beiden hatten sich umgesehen und gescherzt, dass Pia sich in der neuen Wohnung verlaufen würde, so groß, wie sie war. Jedenfalls im Vergleich zu ihrer alten. Und einen viel weiteren Weg zur Arbeit habe sie ja nun auch. Mit dem Fahrrad würde sie bestimmt zehn Minuten länger brauchen. Ob sie nun etwas mehr Ruhe vor ihrer Arbeitswut haben würden? Die beiden wurden übermütig. Ein sicheres Zeichen dafür, dass es in Lübeck und Umgebung gerade recht ruhig zuging, zumindest was Kapitaldelikte betraf.
»Soll ich noch mal Pizza bestellen?«, fragte Pia, als bis auf Lars alle gegangen waren.
»Untersteh dich! Jetzt wird geduscht, du schmeißt dich in einen netten Fummel, und wir gehen feiern.«
»Was? Mir tut jeder Knochen weh.«
»Nicht dran denken. Da hilft nur, in Bewegung zu bleiben«, sagte er.
»Was hast du denn vor?«
»Wir sind heute Abend bei Sebastian zum Geburtstag eingeladen. Schon seit Wochen.«
»Stimmt, da war was.« Pia seufzte. Sie war zum Umfallen müde.
»Sag nicht, du hast es vergessen!«
Pia erhob sich. »Natürlich nicht. Aber ich bin heute wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen.«
»Tatsächlich?« Lars zog sie an sich. Er war genauso verschwitzt wie sie und von der Schlepperei sicherlich nicht weniger angestrengt. »Ein bisschen heißes Wasser wirkt Wunder. Hast du deine schöne neue Dusche überhaupt schon ausprobiert?«
Feiern, auf denen sie kaum jemanden kannte, waren nicht gerade Pias Lieblingsbeschäftigung. In dem Lokal, in das Sebastian eingeladen hatte, war es zu voll, zu laut und zu stickig. Pia kannte zwar Lars’ Freund und dessen Freundin von zwei oder drei Treffen, aber die meisten der Gäste hatte sie noch nie gesehen. Und diese Party schien ihr auch nicht der richtige Ort und die richtige Gelegenheit zu sein, sie näher kennenzulernen.
Irgendwann sah Pia nicht mehr ein, warum die Raucher das Privileg frischer Luft allein genießen sollten, und stellte sich mit einer Flasche Bier in der Hand vor die Tür. Ein paar Meter weiter standen vier Leute zusammen, die sich untereinander offenbar gut kannten.
Ein Mann in einem Ledermantel fiel ihr besonders auf. Er überragte die Umstehenden um einen halben Kopf und war auffallend blass. Dunkle Ringe lagen unter seinen Augen. Er unterhielt die anderen mit einer sichtlich spannenden Schilderung. »… doch als ich ankam, war da niemand«, hörte Pia ihn sagen.
»Irgendjemand muss das Feuer doch angezündet haben?«
»Was brannte denn da?«, wollte eine der Frauen wissen, die er um sich versammelt hatte.
»Nur Treibholz und irgendwelches Zeug.«
»Müllbeseitigung?«
»Wer macht sich denn die Mühe, für so etwas extra an den Strand zu fahren?«
»Jemand, der keinen Garten hat«, sagte der Mann im Ledermantel. Und dann nachdenklicher: »Vielleicht sollte ich es ja sehen.«
»Und du hast nicht gemerkt, wie sich da einer an dich herangeschlichen hat?«, fragte sein Kumpel spöttisch.
Pia merkte auf.
»Es war dunkel. Der Kerl muss hinter mir in den Dünen gehockt haben. Und dann hat er mir mit irgendetwas eins über den Schädel gezogen.« Er fasste sich seitlich an den Kopf.
»Zeig doch mal!« Eine Frau mit dunklen Locken griff spielerisch nach seiner Mütze.
»Lass den Quatsch!« Er drückte ihren Arm weg.
»Wie lange bleibst du noch in der Gegend?«, fragte sie.
»In der Strandhütte? So lange, bis ich eine erfolgreiche Unterredung mit meinem Bruder hatte.«
Pia tat, als wäre nichts interessanter als ihre Bierflasche.
»Wenn du da draußen in Mönkenbek Angst bekommst, kannst du jederzeit zu mir kommen«, gurrte eine stark geschminkte Mittvierzigerin mit kurzem Haar.
»Oder du sagst Lars’ neuer Freundin Bescheid«, schlug der andere Mann vor. Pia zuckte zusammen. »Ah, da ist sie ja! Stimmt doch, oder?« Er grinste sie an.
»Ja, ich bin Lars’ Freundin.«
»Und Sie arbeiten bei der Polizei?«
Pia hasste es, wenn jemand sie schräg von der Seite auf ihren Job ansprach. Sie war stolz auf ihren Beruf, ab und zu redete sie sogar gern darüber, wenn es jemanden wirklich interessierte. Aber sie mochte es nicht, wenn damit eine gewisse Erwartung verbunden war, dass sie dieses oder jenes kommentierte, oder sie sich gar privat in polizeiliche Angelegenheiten einmischen sollte.
»Das stimmt. Und wo arbeiten Sie?«
Er verzog das Gesicht, drückte seine Zigarette aus und schnippte sie weg. »Eigentlich egal, oder? Wir sind ja zum Feiern hier. Ich hab nur vorhin gehört, was Sebastian über Lars’ neue Freundin erzählt hat.«
»Wenn Ihr Freund ein Problem hat, kann er sich jederzeit offiziell an die Polizei wenden. Rund um die Uhr.«
»Lass gut sein, Jan!«, sagte der Mann im Ledermantel.
»Ich finde es nur interessant«, entgegnete Jan und warf Pia noch einen langen Blick zu. Dann ließ er sich von den zwei Frauen wieder ins Lokal ziehen.
»Kommst du mit, Adrian?«, fragte die Kurzhaarige.
Er winkte ab. »Gleich, Caro. Ich rauch noch eine.«
Adrian hieß der Mann also.
Er stellte sich zu ihr an den Stehtisch. »Dem Jan fehlt manchmal das gewisse Feingefühl«, sagte er lächelnd. »Besonders, wenn er was getrunken hat. Der hat früher schon nichts vertragen.«
»Sie kommen auch aus der Gegend hier?«
»Ja, hört man nicht mehr, oder? Ich hatte mit achtzehn die geniale Weitsicht abzuhauen.«
»Viele kommen zurück.«
Er lachte auf. Kniff die Augen zusammen.
»Geht es Ihnen gut?«, fragte Pia. »Sie sehen so aus, als hätten Sie ganz schön was abbekommen.«
»Sie haben es also gehört? Ist halb so wild. Ich hab die Sache ein bisschen ausgeschmückt. Angeberei. Ich vermute, ich bin nur gestolpert und hab mir den Kopf angeschlagen. Keine Ahnung.«
»Ah ja.«
»Gucken Sie nicht so misstrauisch!«
Pia schluckte den Hinweis, dass ihre Skepsis beruflich bedingt sei, herunter. Sie war es schließlich, die darauf bestand, Privat- und Berufsleben auseinanderzuhalten. Entschlossen stellte sie die leere Bierflasche ab. »Sie wissen ja, wo Sie die Polizei finden«, sagte sie und ging wieder hinein.
3. Kapitel
In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte es Frost gegeben. Auf dem Bürgersteig und dem Kopfsteinpflaster der Dorfstraße war schon alles weggetaut, doch die von Maulwurfshügeln übersäte Wiese vor der Kirche glitzerte vor Raureif. Maulwürfe standen ja unter Naturschutz – und schienen das auch genau zu wissen. Was Ernst Fassbender nicht bereits alles versucht hatte, um sie loszuwerden. Lebendfallen, bis zum Flaschenhals vergrabene Weinflaschen, Autoabgase und Hundehaare … Ohne Ergebnis.
»Was soll’s! Wenn Maulwürfe da sind, ist der Boden um unsere Kirche herum wenigstens in Ordnung«, hatte der neue Pastor die Klagen des Küsters kommentiert. Die Zusammenarbeit mit ihm war, gelinde gesagt, schwierig.
Ernst Fassbender hoffte, dass zumindest die Kirchenheizung nicht endgültig den Geist aufgegeben hatte. Wie peinlich, wenn die Leute während des Gottesdienstes ihre Jacke anbehalten mussten.
Den Pastor kümmerte das wenig. Der Erhalt der mehr als siebenhundertfünfzig Jahre alten Dorfkirche schien ihm nicht so wichtig zu sein. War ihr alter Pastor Meier wirklich schon seit fast zwei Jahren im Ruhestand? Der hatte auch mal losgepoltert, wenn sie unter sich gewesen waren, doch danach war die Luft wieder rein gewesen. Matthias Stöver hingegen wirkte beinahe unnatürlich ausgeglichen. Ernst Fassbender wusste nie so recht, woran er bei ihm war. Stille Wasser sind ja bekanntlich tief. Man kann nicht bis auf den Grund sehen. Doch die Herzen der Gemeindemitglieder, vor allem die der jüngeren, flogen dem neuen Pastor nur so zu. Ernst Fassbender seufzte.
Mönkenbek rühmte sich neuerdings damit, eine »offene« Kirche zu unterhalten. Auch so eine Neuerung von Matthias Stöver. Der hatte ja auch nicht miterleben müssen, wie vor Jahren ein Altarkreuz und zwei alte Silberkelche aus dem achtzehnten Jahrhundert aus der Kirche gestohlen worden waren. Die Verdächtigungen und das Misstrauen, die das Ereignis im Dorf nach sich gezogen hatte. Immerhin hatten sie mit dem Kirchengemeinderat gegen den neuen Pastor durchgesetzt, dass stets pünktlich um achtzehn Uhr abgeschlossen wurde. Auf ein paar Leute im Dorf war eben noch Verlass.
Den einundzwanzig Zentimeter langen Schlüssel für den Haupteingang der Kirche bewahrten sie in einer Schublade in der Sakristei auf. So kam man zwar morgens nur durch die Sakristei in die Kirche hinein, aber wenigstens musste sich niemand mit dem überdimensionierten Schlüssel abschleppen.
Ernst Fassbender wollte mit klammen Fingern die Tür aufschließen, doch sie war gar nicht abgeschlossen, sondern nur zugezogen. Auch das war typisch für den neuen Pastor: diese Nachlässigkeit in Dingen, die er für nicht so wichtig erachtete. Die Tür zur Sakristei ächzte in den Angeln, egal, ob Fassbender sie ölte oder nicht. Aber wer glaubte ihm das? Muffiger Geruch schlug ihm entgegen. Ebenfalls wie immer, dachte er. Es roch nach feuchtem Stein und altem Eisen. Der Küster lauschte angespannt. Die Heizung surrte. Er tastete nach dem Lichtschalter, denn das kleine Fenster neben der Tür ließ kaum Licht in den Raum hinein. Das müsste auch mal wieder geputzt werden. Er würde der Hansen mal ordentlich Bescheid geben.
Die Neonröhre an der Decke flackerte auf, sprang dann zögernd an. Erst dachte er, das Muster des Perserteppichs, der auf dem Steinfußboden lag, spiele seinen Augen einen Streich. Doch das da war tatsächlich ein Mensch. Der Pastor lag bäuchlings hingestreckt, mit einem dunklen Fleck unter Kopf und Schultern. Er rührte sich nicht. War er … war Matthias Stöver … war er etwa tot?
Ernst Fassbender wollte sich zu der leblosen Gestalt hinunterbeugen. Irgendetwas tun. Doch er konnte sich nicht bewegen. In seinen Ohren rauschte es. Die klaffende Wunde am Hinterkopf des Pastors sprach eine unmissverständliche Sprache. Matthias Stöver, der Pastor von Mönkenbek, war tatsächlich tot. Ernst Fassbenders Atem ging flach und schnell. Die abgestandene Luft bedeutete nun etwas anderes. Sie rührte nicht nur von den Ausdünstungen der alten Kirche her. Der Küster wusste, wie der Tod roch. Von dem Geruch und dem Anblick schwindelte es ihn. Er tastete nach dem Türgriff hinter sich. Als er ihn zu fassen bekam, taumelte er zurück.
Draußen, vor der Tür der Sakristei, blendete ihn die Wintersonne. Fassbender atmete immer noch zu schnell. Er würde doch nicht … In Ermangelung einer Mauer oder eines Baumstamms, die ihm Halt geben könnten, sank er auf dem Weg in die Hocke und senkte den Kopf zwischen die Knie. Eine unwürdige Haltung für einen beinahe sechzig Jahre alten Küster, aber es half und war immer noch besser, als vor der Kirche in Ohnmacht zu fallen.
Matthias Stöver war tot. Er lag mit einer üblen Kopfverletzung auf dem Boden der Sakristei. In seiner Kirche. Die Erkenntnis drang mit voller Wucht wieder in Ernst Fassbenders Bewusstsein, als der erste Schwindel nachließ. Was war passiert? Konnte er sich nicht auch irren? Er richtete sich mit knackenden Kniegelenken auf. Der Norwegerpulli, den Stöver im Winter fast täglich trug, die krausen Haare mit der kahlen Stelle am Hinterkopf. Er war es – eindeutig. Sonst lief hier im Dorf niemand so herum. Eine seiner Gesundheitssandalen, Stein des Anstoßes in der Gemeinde, wenn er sie sogar zu Hochzeiten und Taufen unter dem Talar trug, hatte neben seinem Fuß in der grauen Wollsocke gelegen.
Niemand sollte seinen Pastor so sehen müssen, dachte der Küster. Egal, wie man zu dem Menschen in diesem Amt stand. Das musste er verhindern. Doch was sollte er tun? Als Erstes schauen, ob er vielleicht doch noch helfen konnte, auch wenn er sich sicher war, dass der Pastor tot war. Und dann musste er die Polizei und einen Arzt rufen, doch er hatte sein Mobiltelefon nicht dabei. Er war nicht so verrückt wie die Jüngeren, denen die Dinger quasi an den Händen klebten. Matthias Stöver hatte ihn mehrfach gebeten, tagsüber doch bitte jederzeit telefonisch erreichbar zu sein, aber Fassbender hatte die Anweisung immer wieder unterlaufen. Was früher nicht sein musste, brauchte heute auch kein Mensch. Pastor Meier und er waren doch auch so klargekommen. Bestens sogar. Heimlich fürchtete er, dass seine Frau Lotti ihn mit Anrufen verfolgen würde, gerade dann, wenn er mal ein wenig Ruhe vor ihr brauchte. Doch nun musste er nach Hause gehen, wenn er telefonieren wollte. Oder er klingelte bei der nächsten Nachbarin. Direkt hinter der Kirche wohnte die alte Elsa Grönwald. Das wäre ein gefundenes Fressen für die neugierige Klatschtante. Mit dem Entschluss, Elsa Grönwald diesen Gefallen nicht zu tun, kehrte langsam seine Kraft zurück. Mit wackeligen Schritten ging er noch einmal in die Sakristei.
Der Pastor lag immer noch bäuchlings vor dem kleinen Altar am Boden. Einer der Messingleuchter, die sonst an dem Schrank standen, in dem sie die Abendmahlskelche, die Taufschale, die Paramente und alles andere von Wert einschlossen, befand sich neben ihm am Boden. Die Oberkante des Leuchters war mit geronnenem schwarzen Blut, Gewebe und Knochensplittern verschmutzt. Er sollte nicht so genau hinsehen, sonst wurde ihm wieder schlecht. Ernst Fassbender traute sich nicht, dem Pastor an den Hals zu fassen. Stattdessen tastete er mit langem Arm an dessen Handgelenk nach dem Puls. Er zuckte zurück. Beinahe schmerzhaft kalt fühlte sich die Berührung an. Als hätte er seine Hand in Wasser getaucht. Wasser, das so tief war, dass man den Grund nicht sah.
Pia betrat am Sonntagmorgen mit einer großen Brötchentüte in der Hand ihre neue Küche.
»Weißt du, wo deine Mutter die Bodum-Kaffeekanne versteckt hat?«, fragte Lars, als er sie erblickte. Pia hatte gerade bei strahlendem Sonnenschein eine kleine Erkundungstour mit dem Fahrrad unternommen, um herauszufinden, wo sie frische Brötchen kaufen konnte. Lars bereitete, nur mit T-Shirt und Boxershorts bekleidet, das Frühstück vor. Er stellte soeben die Marmelade und den Käse auf den Tisch, der mit einem bunten Sammelsurium von Geschirr gedeckt war. Die Sonne schien durch das Küchenfenster auf Lars’ kräftige Arme und ließ die goldenen Härchen darauf schimmern. Sogar Frühstückseier hatte er gekocht. Ein schöner Anblick, nicht nur der Frühstückstisch. Der Kaffee fehlte allerdings noch, wie Pia aus Lars’ Frage schloss.
»Ich weiß nicht, ob die Kanne überhaupt schon ausgepackt ist«, sagte sie zweifelnd. »Ich hatte sie ja in der alten Wohnung bis zuletzt in Gebrauch, und dann hab ich sie in einer der Restekisten untergebracht.«
Lars stöhnte auf. »Pia, es gibt mindestens fünf Restekisten.«
»Sie ist bestimmt in der Kiste, auf der Reste – Küche steht. Aber wo kann die nur sein?«
»Keine Ahnung. Wir müssen uns wohl mit diesem Tee hier begnügen.« Lars hielt eine zerknautschte Schachtel mit Teebeuteln in die Höhe. »Lecker Kamille.«
Pia schüttelte sich. Ihr Mobiltelefon brummte.
»Oh, nein«, sagten beide fast gleichzeitig und sahen sich an.
»Ich geh für dich ran«, erbot sich Lars, »und behaupte, du bist unter einem Stapel Umzugskisten verschollen.«
Pia kontrollierte das Display. »Die Dienststelle. Ich muss das Gespräch annehmen.«
»Vielleicht will dir ja noch ein Kollege seine Hilfe beim Auspacken anbieten?«, schlug Lars wenig hoffnungsvoll vor. »Bei so einem Wetter bringt doch niemand seine Mitmenschen um.«
»Hast du eine Ahnung!« Sie meldete sich.
»Verdammt, Pia, hast du etwa noch geschlafen?«, bellte Manfred Rist, ihr Kollege und momentan der stellvertretende Leiter der Abteilung, ins Telefon. »Wir haben ’ne Leiche. Nicht natürlicher Tod. Kannst gleich direkt zum Fundort kommen, wenn’s dir nichts ausmacht.«
»Und wohin genau?«
Jemand im Hintergrund sagte etwas.
»Gerlach meint zwar, du bist noch mitten im Umzug, aber solange du irgendwelche Klamotten zum Anziehen findest, bist du verfügbar, oder?«
Charmebolzen, dachte Pia. Pech, dass ausgerechnet Manfred Rist den Leiter des K1, Horst-Egon Gabler, vertrat, während der in der Reha war. Und Pech nicht nur deshalb, weil Rist sich gern mal im Ton vergriff.
»Wo ist der Fundort?« Sie sah, wie Lars bei ihrem geschäftigen Tonfall, verbunden mit dem Reizwort, mit den Augen rollte.
»Mönkenbek heißt das Kaff, liegt in der Nähe von Grömitz. Gib’s einfach in dein Navi ein! Falls du schon eins hast.«
»Und wo genau?«, hakte Pia nach.
»Komm zur Kirche!« Er lachte ironisch auf. »Wolltest du doch am Sonntagvormittag bestimmt sowieso.«
»Ich fahre gleich los«, sagte sie, doch Rist hatte die Verbindung schon unterbrochen. Pia sah auf die Uhr. Es war halb zehn.
»Du musst los.« Es war eine Feststellung, keine Frage.
»Tut mir leid. Es geht nicht anders. Ich kann noch froh sein, dass der Leichenfund auf ein Vater-Wochenende von Felix gefallen ist.«
»Ich würde mich in so einer Situation um Felix kümmern. Das habe ich dir schon mehrfach angeboten.« Lars klang leicht genervt, was sie ihm nicht verübeln konnte.
»Darauf komme ich bestimmt mal zurück. Felix wird begeistert sein. Lass dich jetzt bitte nicht von mir vom Frühstück abhalten: Franzbrötchen, Croissants, Körnerbrötchen und … nun ja: Tee.« Sie schüttete die Brötchen in den Brotkorb und nahm sich ein Franzbrötchen heraus.
Lars bedachte sie mit einem Blick, der jedweden Toten sofort auferweckt hätte, und Pia vermutete, das lag nicht nur an der Aussicht auf den Kamillentee.
4. Kapitel
Während der Fahrt auf der A 1 in Richtung Norden dachte Pia an Lars und die letzte Nacht zurück. Wenn sie mit ihm zusammen war, fühlte sich alles irgendwie leichter an. Doch sie wusste aus einiger Erfahrung, wie trügerisch das Glück war. Dies hier war einfach zu gut, um von Dauer zu sein.
Vor Lars war Pia mit Hinnerk Joost zusammen gewesen, Felix’ Vater. Er hatte damals unglücklicherweise etwas mit ihrer Schwester Nele angefangen … Und Pia hatte sich auf eine Beziehung zu einem Kollegen eingelassen, die von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen war. Doch zu der Zeit waren ihre Liebschaften nur sie allein und den betreffenden Mann etwas angegangen. Jetzt hatte sie ein Kind. Pia wollte keinen Fehler mehr machen. Wenn Lars Probleme mit ihrem Beruf hatte, dann war es wohl besser, das Ganze wieder zu beenden, bevor Felix – und auch sie selbst – sich zu sehr an ihn gewöhnten. Lars sagte zwar, er komme inzwischen ganz gut mit der Tatsache klar, dass sie bei der Kripo arbeitete und es dabei mit Kapitaldelikten zu tun hatte, meistens Mord und Totschlag. Und damit, dass Situationen und Menschen, mit denen sie bei ihrer Arbeit konfrontiert wurde, sie hin und wieder verfolgten, manchmal sogar bis in ihre Träume. Aber das Thema »Beruf« kam trotzdem immer mal wieder zwischen ihnen auf, und zwar genau dann, wenn Pia es am wenigsten gebrauchen konnte. Wie zum Beispiel am vergangenen Abend, als Lars beim Auspacken einen flüchtigen Blick auf ihre selbst gemalten Bilder geworfen hatte. In seinem Gesicht hatte sich Erstaunen und dann Abwehr gespiegelt. Wollte er ihren beruflichen Alltag überhaupt in sein Leben hineinlassen? Dass sie wie heute an einem Sonntag losmusste, kam zwar nur selten vor, aber es war ein Teil ihres Jobs. Sie würde jetzt auch lieber mit Lars zusammen in ihrer neuen Küche gemütlich frühstücken.
War das tatsächlich so? Im Grunde wollte sie beides. Sie fühlte sich zwischen Privatleben und Beruf hin-und hergerissen. Wenn Pia ehrlich zu sich selbst war, war sie gerade höchst gespannt auf das, was sie in Mönkenbek erwartete. Sie mochte die Aufregung und das Gemeinschaftsgefühl unter den Kollegen, das sich immer dann in besonderem Maße einstellte, wenn sie als Team einen neuen Fall in Angriff nahmen.
Pia verließ in Lensahn die Autobahn, passierte ein paar Ortschaften und fuhr dann über eine weite, mit Windrädern gespickte Ebene in Richtung Ostsee. Der Himmel war klar und spannte sich in einem lichten Blau über dem Land. Die wenigen Bäume hatten sich im Wind gen Osten geneigt. Nach einiger Zeit tauchte der Ort Mönkenbek im Dunst vor ihr auf. Flach und lang gestreckt lag er da, ein typisches Straßendorf. Am nördlichen Ende ragte der Kirchturm in den Himmel, gedrungen wie der dicke, aber gespitzte Buntstift eines Vorschulkindes. Da war es. Pia spürte ein vertrautes Kribbeln bei der Frage, was sie dieses Mal wohl am Tatort erwartete.
Als sie von der Hauptstraße nach links zur Kirche abbog, sah sie schon das übliche Durcheinander an Polizeifahrzeugen und Privatwagen der Kollegen, die an diesem Sonntag größtenteils direkt von zu Hause hergekommen waren. Sogar ein paar Presseleute hatten schon Wind von dem Leichenfund bekommen und lungerten am Rande der Absperrung herum, versuchten, Schaulustigen, die ebenfalls zugegen waren, die mit Kunstpelz bezogenen Mikrofone unter die Nase zu halten. Ein Uniformierter, der den Zugang überwachte, führte Pia auf das abgesperrte Gelände. Das idyllische Ensemble, bestehend aus alter Dorfkirche, Kirchhof, Pfarrhaus und umliegenden Gehöften, sah durch das Menschen- und Fahrzeugaufgebot und die flatternden Absperrbänder so aus, als fände gerade ein Kirchenbasar statt. Mit sehr ernsten Besuchern allerdings. Der blau-silberne Mercedes-Bus der Kriminaltechnik stand mitten auf dem durchweichten Rasen zwischen zwei Grabsteinen. Der Fahrer war so weit wie möglich an die Südseite der Kirche herangerollt. Als Pia den Weg heraufkam, ging gerade ein Beamter in Schutzkleidung mit einem Alukoffer in der Hand auf die Sakristei zu und verschwand darin. Das konnte nur bedeuten, dass ein Mensch direkt in der Kirche zu Schaden gekommen war. Schöner Mist: Mehr Aufmerksamkeit durch die Presse gäbe es im nördlichsten Bundesland wohl nur bei einem Mord im Kieler Landtag oder in einem der von Promis bevölkerten Clubs in Kampen auf Sylt.
Manfred Rist stand an einen Baum gelehnt und sprach in sein Mobiltelefon. Sein Ersatz für handschriftliche Notizen, vermutete Pia. Als er sie sah, winkte er sie zu sich heran. »Na endlich! Bis auf Kürschner sind wir jetzt vollzählig.«
»Du rechnest nicht ernsthaft damit, dass Wilfried heute hier erscheint?«, fragte Pia ehrlich erstaunt.
»Wir brauchen jeden Mann. Das wird kein Sonntagsspaziergang!«
»Manfred, Wilfrieds Frau ist vor drei Tagen gestorben.« Interessierte sich Rist wirklich so wenig für die Angelegenheiten seiner Mitarbeiter, oder tat er nur so, weil es ihm gerade in den Kram passte?
»Stimmt. Da war was. Aber er hat sich nicht offiziell krankgemeldet.«
»Wahrscheinlich, weil er noch unter Schock steht und gerade andere Sachen im Kopf hat.«
»Sei’s drum! Immerhin bist du ja jetzt hier.« Er musterte sie kurz von Kopf bis zu den Stiefeln, an denen nasses Gras und Erdklumpen klebten, als könnte er nicht glauben, seine Kollegin sonntags an einem Tatort zu sehen. »Sprich du mit den Leuten von der Spurensicherung, Pia! Geh ihnen auf die Nerven, oder lass deinen Charme spielen! Was du besser kannst. Ich will über alles Bescheid wissen, was das K6 am Tatort gefunden hat. Und ich will es nicht erst in ihrem Bericht zu lesen bekommen.«
Pia nickte. Bei Manfred Rists allgemeiner »Beliebtheit«, auch außerhalb des K1, stand zu befürchten, dass ansonsten alles seinen vorschriftsmäßigen Gang ging. Und das würde sie wertvolle Zeit kosten.
»Wer ist das Opfer? Ist es schon identifiziert?«, fragte sie, bevor sie sich in Richtung Kirche begab.
»Überraschung«, sagte er sarkastisch. »Du wirst schon sehen.«
Pia legte die erforderliche Schutzkleidung an und ließ sich von einem der Kriminaltechniker an den Tatort begleiten.
Der Tote lag bäuchlings auf dem Boden der Sakristei, einem Anbau an das Kirchenschiff, nicht viel größer als eine Pferdebox. Der Raum hatte einen Zugang von draußen, und eine zweite Tür führte in den Altarraum der Kirche. Ein eilig installierter Scheinwerfer der Spurensicherungsleute leuchtete die Szenerie taghell aus, als wäre dies das Set für einen Film und gleich begännen die Dreharbeiten.
Der Mann, der am Boden lag, trug einen grob gestrickten Pullover, eine helle Cordhose und graue Wollsocken. Das Haar an seinem Hinterkopf war dunkel von geronnenem Blut. Die Haut des Schädels war mehrfach gerissen, Pia konnte zersplitterte Schädelknochen sehen. Mehrere Schläge, mit einer solchen Wucht ausgeführt, dass wahrscheinlich schon der erste tödlich gewesen ist, überlegte sie. Unter dem Kopf und der Schulter der Leiche hatte sich auf dem Perserteppich ein dunkelroter Blutfleck ausgebreitet. Sie räusperte sich. »Wissen wir schon, wer der Tote ist?«
»Es ist der Pastor«, antwortete der Kriminaltechniker. »Matthias Stöver ist sein Name.«
»Das hat uns gerade noch gefehlt!«, stieß Pia hervor. »Ein Geistlicher.«
»Macht doch eigentlich keinen Unterschied«, entgegnete der Kriminaltechniker. »Tot ist tot.«
»Ermittlungstechnisch gesehen, ja. Rein menschlich gesehen nicht: Wir werden uns mit den Gepflogenheiten und dem Who is Who der evangelischen Kirche beschäftigen müssen. Und die Schlagzeilen und die Aufmerksamkeit gibt es gratis dazu.«
»Die Spuren sind auch ein einziges Chaos«, sagte der Kollege vom K6 in einem Ton, als sorgte das für einen gewissen Ausgleich. »Der Küster hat den Pastor vorhin entdeckt; er ist ganz nah an ihn rangegangen, um seinen Puls zu fühlen, trotz der offensichtlich letalen Kopfwunde. Dann hat er die Dorfärztin hinzugerufen, die unser Opfer ebenfalls noch einmal kurz untersucht hat. Die Schutzpolizei ist erst ein paar Minuten später eingetroffen. Einer der Kollegen aus dem Streifenwagen hat die Sakristei dann auch noch betreten, um nachzuschauen, bevor er alles abgesperrt hat. Es ging hier zu wie in Venedig auf dem Markusplatz.«
»Ist das die mutmaßliche Tatwaffe?« Pia deutete auf einen umgestürzten Kerzenleuchter von etwa achtzig Zentimetern Länge, der ungefähr einen Meter vom Kopf der Leiche entfernt lag. Am oberen, scharfkantig aussehenden Rand klebten Blut, Gewebe und Haare.
»Wenn nicht, dann hat zumindest jemand das Ding so präpariert, dass es danach aussieht. Ob der Leuchter wirklich die Tatwaffe ist, wird nur der Rechtsmediziner zweifelsfrei klären können. Wir tüten ihm alles ein, was als Mordwaffe infrage kommt. Die Werkzeuge aus dem Schrank und, wenn es sein muss, sogar den Abendmahlskelch.«
»Was für Werkzeuge?«
»Hier liegt so allerlei Kram rum. Schraubendreher, Hammer, Zange. Das Werkzeug wird zum Beispiel zum Aufhängen der Erntekrone und des Adventskranzes benötigt. Außerdem: Dass in so einem alten Gebäude wie dieser Kirche immer mal wieder was gerichtet und repariert werden muss, kann man sich ja vorstellen.«
»Verstehe.« Pia riss den Blick vom Kopf der Leiche los. Die brutale und doch effiziente Verletzung übte eine Art Sogwirkung auf sie aus. »Schau hin!«, schien sie zu flüstern. »So schmal ist der Grad zwischen Sein und Nichtsein, zwischen einem warmen Bett mit deinem Geliebten und einem Sarg in einem kalten Erdgrab. Zwischen Leben und Tod. Dein Ende ist immer nur einen Hieb mit einem Kerzenleuchter weit entfernt. Und jeder, der für einen kurzen Moment hinter dir steht, kann ihn ausführen.«
In ihrem Nacken kribbelte es. Pia rieb sich die Oberarme, um wieder etwas Gefühl in ihren Körper zu bekommen. »Sonst irgendwelche Spuren, die uns für den Anfang weiterhelfen?«
»Hast du draußen neben dem Weg unsere Spur Nummer acht nicht gesehen? Ein halber Schuhabdruck im weichen Erdboden. Könnte was sein.«
Pia krauste die Stirn. »Es hat gestern nicht geregnet. Der Abdruck könnte auch schon älter sein.«
»Der ist noch keine zwölf Stunden alt. Wie aus dem Lehrbuch. Wir haben ihn gerade ausgegossen. Schuhgröße 43 bis 45, würde ich sagen. Derbes Profil, schwere Person. Passt zu dem Leuchter als Tatwaffe: Für den Schlag war eine gewisse Körperkraft erforderlich.«
»Der Leuchter sieht ebenfalls schwer aus, ja«, räumte Pia ein. »Dazu brauchte es Kraft. Oder aber starke Emotionen. Ich glaube, selbst eine zierliche Frau hätte das zuwege bringen können, vorausgesetzt, sie war zu allem entschlossen.«
»Eine zierliche Frau mit großen Füßen?«
Hauptkommissar Heinz Broders sah seine Kollegin Pia die Sakristei verlassen, als er gerade aus einem der Häuser hinter der Kirche trat. Wieder nichts. Der erste Anwohner, den er befragt hatte, hatte nichts gehört und nichts gesehen; im zweiten Haus hatte niemand geöffnet. Pia hatte es gut, mit den Kollegen vom K6 zusammenzuarbeiten, direkt an der Quelle, während er den Laufburschen spielen musste.
Normalerweise arbeiteten Pia und er als Team zusammen. Im Normalfall hätte sie auch jetzt mit ihm die Befragungen durchgeführt, aber da Wilfried Kürschners Frau gestorben war, fehlte ein Mitarbeiter im K 1. Rist, der sich aufspielte wie der Imperator der intergalaktischen Sternenflotte, hatte ihn deshalb allein losgeschickt, um die Anwohner in Sichtweite der Kirche zu befragen. Broders sah ja ein, dass es eine der ersten Arbeiten war, die erledigt werden mussten. Eine solche Befragung brachte nur so lange brauchbare Ergebnisse, wie die Erinnerungen der Leute frisch waren und sie noch keine Gelegenheit gehabt hatten, mit anderen über die Ereignisse zu sprechen.
Ein Mord in der Dorfkirche, und das am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst! Broders war kein Kirchgänger, aber wenn er einer wäre, hätte ihn dieses Zusammentreffen bestimmt auch aufgeregt.
Er näherte sich dem nächsten Haus, das unmittelbar hinter der Kirche stand. Roter Backstein, weiße Sprossenfenster, gerüschte Gardinen. Ein winziger Vorgarten, eingefasst von einer akkurat gestutzten Buchsbaumhecke. Ein paar Schneeglöckchen und Winterlinge im Rasen trotzten dem kalten Wind. Broders’ Blick fiel auf ein Fernglas auf einer der Fensterbänke. Er klingelte dieses Mal mit einer gewissen Erwartungsfreude.
Eine vermutlich hundertjährige Frau öffnete ihm die Tür. Sie war nur anderthalb Meter groß und hatte sich mit einem Rollator zur Tür geschoben. Von oben sah Broders fleckige Kopfhaut durch ihr flaumiges, weißes Haar schimmern.
»Frau Grönwald? Guten Morgen! Ich bin Hauptkommissar Heinz Broders. Darf ich kurz hereinkommen?«
»Ach nee, da könnte ja jeder kommen!« Sie musterte ihn, löste eine knotige Hand vom Rollatorgriff und hielt sie ihm entgegen. Er wollte sie höflich ergreifen, doch sie sagte scharf: »Ihren Polizeiausweis, wenn’s Ihnen nichts ausmacht.«
Heinz Broders reichte ihn ihr hin. Sie riss ihn ihm aus der Hand, zog ihre Brille herunter und betrachtete den Ausweis, indem sie ihn etwa fünf Zentimeter vor ihre hellblauen Augen hielt.
»Na gut, scheint ja zu stimmen. Oder ist es ’ne Fälschung? Man weiß ja nie heutzutage. Kommen Sie trotzdem rein! Ich kann Ihnen aber nichts anbieten. Sie nehmen wohl sowieso nichts an, oder?«
»Nein, nie«, flunkerte Broders und nahm auf einem zierlichen Sessel Platz, auf den sie flüchtig gewiesen hatte. Die Federung war stramm wie ein Trampolin, die Rückenlehne noch fester gepolstert. Entgegen seiner Erwartung blieb Frau Grönwald vor ihm stehen. Die kennt ihre mörderischen Polstermöbel ja auch, dachte Broders.
»Was ist da draußen passiert?«, fragte sie ohne Umschweife.
»In der Sakristei der Kirche liegt ein Toter.«
»Wie bitte? Sie müssen lauter sprechen!«
Er wiederholte den Satz.
»Ah. Das habe ich mir beinahe schon gedacht. In der Sakristei also, nicht in der Kirche … Wer ist es denn?«
»Das wissen wir noch nicht.« Lange würde er mit dieser Behauptung nicht mehr durchkommen. Vielleicht wusste sie auch längst, wer der Tote war. Wenn sie zum Beispiel mit dem Küster auf Du und Du stand.
»Erzählen Sie mir nichts! Hier kommt doch kein Fremder her, um in unserer Kirche das Zeitliche zu segnen. Außerdem ist sie über Nacht abgeschlossen. Schlimm genug, dass da tagsüber jeder reinkann. Das zieht das Gesindel an. Das kennen wir ja schon. Die Zeiten, in denen man auf dem Dorf sein Haus offen stehen lassen konnte, sind vorbei. Ich hab das schon mehrfach dem Kirchengemeinderat gesagt, aber die …«
»Haben Sie gestern Abend oder heute Morgen etwas beobachtet, das mit dem Todesfall in der Kirche in Zusammenhang stehen könnte?«, unterbrach Broders sie mit angestrengter Stimme. Es kam selten vor, dass jemand in seiner Gegenwart derart die Gesprächsführung an sich riss.
»Herrgott, sagen Sie doch ›Mord‹! Es war Mord, oder? Alles andere ergibt keinen Sinn.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»So viele Leute … So viel Aufhebens. Das würden Sie doch nicht machen, wenn da nur jemand einen Herzanfall erlitten hätte.« Sie kniff die Augen zusammen.
»Was Sie nicht sagen!«
»Ich bin vorbereitet. Ich zieh jetzt jeden Abend ein frisches Nachthemd an, wissen Sie.«
Broders merkte förmlich, wie ein Fragezeichen über seinem Kopf erschien. »Wieso?«
»Mein Nachbar, der Herbert Michelsen, ist tot. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Schlaf gestorben. Und der neue Pastor will ihn nicht vor Anfang nächster Woche unter die Erde bringen … Nicht, dass ich abergläubisch wäre, aber der holt bestimmt noch zwei nach.«
»Wie bitte?«
»Der Tod. Nun fragen sich natürlich alle, wer der Nächste ist. Ich bin zwar alt, aber noch fit. Ich tippe ja auf Friedrich Merten mit seiner hartnäckigen Bronchitis.«
»Also wirklich, Frau Grönwald! Das ist makaber.«
»Und sagen Sie, Herr Kommissar: Ist viel Blut geflossen in der Sakristei?« Sie lächelte ein böses kleines Lächeln, das ihre pergamentenen Züge noch stärker knittern ließ.
Allmählich war Broders von ihr beeindruckt. Ob er mit hundert wohl noch so drauf war? Er deutete auf das Fernglas neben den Begonien auf der Fensterbank. »Sie beobachten wohl gern die Vögel, Frau Grönwald?«
»Quatsch! Wenn man sich für Vögel interessiert, hat man es hinter sich. Dann ist man alt.« Sie schnaubte geringschätzig. »Ich informiere mich lieber, was meine Nachbarn so treiben.«
»Ah. Ich sehe, wir verstehen uns. Dann erzählen Sie mir doch einfach, was gestern Abend und heute Morgen um die Kirche herum passiert ist.«
»Schauen Sie raus! Was sehen Sie?«
»Den Kirchturm mit der Eingangstür, ein Stück vom Weg, zwei Grabsteine und einen Abschnitt dieser Straße. Und durchs andere Fenster ihre Nachbarhäuser.«
»Genau. Das von Paulsen und das von Michelsen. Da war noch nie was los, aber seit der alte Herbert Michelsen tot ist, schon gar nicht mehr.« Sie verzog das Gesicht. »Nicht gerade das, was man eine spannende Aussicht nennt, oder? Ich hab schon überlegt, in ein paar Jahren ins Stift nach Lübeck zu gehen, um etwas mehr Trubel um mich herum zu haben, aber dann denke ich: Die Menschen sind doch sowieso überall gleich.«
Broders nickte aufmunternd. Sie würde ihre fünf Minuten Ruhm auskosten und es so erzählen, wie sie es für richtig hielt, und wenn er Kopfstand vor ihr machte.
»Nachmittags waren zwei Touristinnen da, die sich die Kirche angeschaut haben.«
»Wissen Sie, wer das war?«
»Woher denn? Es waren fremde Frauen. Mittelalt, mitteldick, mit Fotoapparat und Reiseführer in der Hand. Ich glaube, aus dem Ausland.«
»Weshalb denken Sie das?«
»Fremdes Kennzeichen. Aber ich hab es nicht notiert. Leider. Ich wusste ja nicht, dass ich danach gefragt werde, sonst hätte ich es mir aufgeschrieben.«
»Gibt es hier ein Hotel?«
»Schon länger nicht mehr. Aber im Sommer vermieten hier viele ein oder zwei Zimmer oder Appartements an Feriengäste. Ansonsten muss man nach Grömitz oder Dahme gehen.«
»Okay, und weiter …«
»Ernst Fassbender, unser Küster, kam kurz vor dem Abendbrot und hat die Heizung angeschaltet, weil der Chor seine Generalprobe in der Kirche abhalten wollte.«
»Um wie viel Uhr war das?«
»Also, als er bei mir war, war es ungefähr Viertel vor sechs.«
»Bei Ihnen?«
»Er hat mir Bescheid gesagt, dass nachher Licht in der Kirche sein würde, wegen der Generalprobe des Männerchors, und ich deswegen nicht wieder bei ihm anzurufen brauche … Alles sei in bester Ordnung.« Sie schüttelte missbilligend den Kopf. »Beste Ordnung, das sieht man ja!«
»Warum hat er Ihnen Bescheid gesagt?«
»Ich hab ein Auge auf die Kirche. Hat ja sonst keiner mehr heutzutage. Ich hasse Verschwendung. Licht, das die ganze Nacht brennt … phh! Alles auf unsere Kosten.«
»Also gut. Was passierte dann?«
»Die Herren aus dem Chor sind kurz vor acht Uhr eingetrudelt. Ich hab sie aber nicht gezählt, weil ich Abendbrot essen wollte, bevor der Musikantenstadl anfing. Während der Chorprobe hatten sie Festtagsbeleuchtung an. Gegen zehn vor zehn haben sie einer nach dem anderen die Kirche wieder verlassen.«
»Haben Sie jemanden erkannt?«
»Ich hab nicht so drauf geachtet. Die waren nicht so interessant.«
Broders sah durch das Fernglas zur Kirchentür. Er könnte von hier aus sicher Gesichter erkennen, aber er wusste nicht, wie gut die Augen der alten Frau noch waren.
»Und den Pastor, haben Sie den auch gesehen?«
»Der singt zwar im Chor mit, doch er kommt immer durch die Sakristei rein und geht dort auch wieder hinaus. Und die Tür habe ich leider nicht im Blick«, sagte sie bedauernd.
»Was passierte dann?«
»Ich dachte mir, dass alle weg wären, weil auch die große Beleuchtung in der Kirche ausgeschaltet worden war. Nur ein Licht brannte drinnen noch. Ich habe mich geärgert, aber ich wollte nicht schon wieder beim Küster anrufen, Sie wissen schon …«
»Und danach?«, fragte Broders ungeduldig.
»Ich hab mir noch eine Quizsendung im Fernsehen angeschaut.«
Broders überflog seine Notizen. »War das alles an dem Abend?«
»Oh, nein! Kurz bevor ich zu Bett gehen wollte, sah ich noch mal jemanden.«
Broders merkte auf. »Wann war das?«
»Um kurz nach halb elf. Und um halb sechs in der Früh steh ich immer auf. Ich brauch nicht mehr so viel Schlaf, junger Mann.«
»Was genau haben Sie da spätabends gesehen?«
»Jemand ist um die Kirche herumgelaufen und dann in Richtung Feld gegangen. Er hat sich noch verstohlen in alle Richtungen umgesehen, bevor ich ihn aus den Augen verloren habe. Das ist verdächtig, oder?«
Broders nahm sich vor, auch noch zu prüfen, welche Krimis um diese Uhrzeit im Fernsehen gelaufen waren, die die Fantasie der alten Dame beflügelt haben könnten. »Wohin genau ist er gegangen?«
»Ich habe ihn leider aus dem Blick verloren.«
»Wie konnten Sie das überhaupt in der Dunkelheit sehen?«
»Unsere Kirche ist bis nachts um zwölf dekorativ beleuchtet. Das hat der Kirchengemeinderat beschlossen. So eine Verschwendung, aber da war es ja mal ganz nützlich.«
»Wie hat derjenige ausgesehen? Haben Sie ihn erkannt?«
»Erkannt leider nicht.« Sie schnalzte mit der Zunge. »Aber es war ein Mann. Ein kräftiger Mann.«
»Noch mehr? Was hatte er an?«
»Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das wirklich sagen soll.«
»Wie bitte? Sie sollen mir alles sagen, was Sie gesehen haben. Oder wollen Sie eine polizeiliche Ermittlung behindern?«
»Es war … Also, ich weiß nicht …« Sie spielte mit ihrer Halskette, an der ein großer Bernstein mit einem darin eingeschlossenen Insekt hing.
Das ängstliche Zögern nahm Broders ihr nicht ab. »Frau Grönwald, das ist wichtig.«
»Sie glauben mir ja sowieso nicht«, sagte sie kokett.
Broders sah sie mit einem Mal vor sich, wie sie wohl mit vierzehn gewesen war. Sie genoss es, ihn zappeln zu lassen. »Dann eben nicht.« Er erhob sich geschäftig, ploppte geradezu aus dem strammen Sessel hoch. Hatte auch Vorteile, so ein Seniorenmöbelstück. Das musste er sich merken. Und dieses Spielchen konnte er auch spielen. Er sah ja, dass sie förmlich darauf brannte, es ihm zu sagen. »Ich muss jetzt weiter. Wir haben viel zu tun.«
»Herr Kommissar, nun warten Sie doch! Der Mann, den ich an der Kirche gesehen habe …«
»Ja, Frau Grönwald?«
»Ob das der Mörder war?«
»Möglich wär’s.«
»Ich weiß nicht, ob ich es sagen soll. Sie glauben mir bestimmt nicht.«
»Warum sollte ich Ihnen nicht glauben?«
»Es war nämlich …« Sie setzte eine Miene auf, die sowohl unschuldig als auch durchtrieben war und mit der sie vor knapp hundert Jahren wahrscheinlich ihre Verehrer in den Wahnsinn getrieben hatte. »Es war ein Polizist.«
»Ein Polizist?«, echote Broders.
Sie nickte.
Halleluja.
5. Kapitel
Der nächste Schritt war der schwierigste: Pia und ihr Kollege Manfred Rist standen vor dem Pfarrhaus, um mit der Familie des Opfers zu sprechen. Die Frau des Pastors wusste schon, dass ihr Mann tot war. Die Ärztin hatte es ihr gleich nach der Untersuchung des Toten mitgeteilt. Falls Beruhigungsmittel oder andere Maßnahmen erforderlich gewesen waren, war Katharina Stöver zumindest in dieser Hinsicht in guten Händen gewesen. Drei Kinder gab es auch, vierzehnjährige Zwillinge, zwei Mädchen, und einen erwachsenen Sohn, der gerade zufällig da war, wie sie erfahren hatten. Pia und Rist sahen einander an, bevor sie klingelte. Sie wusste, dass er von ihr das Maß an Einfühlungsvermögen und Takt erwartete, das er nicht aufzubringen in der Lage war. In solchen Momenten hasste sie ihren Job.
Ein Mann Anfang zwanzig öffnete ihnen die Haustür. Es war offenbar Gregor Stöver, der in Kiel studierende Sohn des Pastors. Er war hochgewachsen, schlaksig, nachlässig gekleidet und hatte lockiges Haar und einen spärlichen Bart. Pia stellte sich und ihren Kollegen vor und erklärte, weshalb sie gekommen waren.
»Schon klar.« Er musterte sie.
Pia sprach ihm ihr Beileid aus. »Wir möchten mit Ihrer Mutter sprechen«, sagte sie dann.
Er zuckte mit den Schultern und geleitete sie in den ersten Stock des Pfarrhauses, wo sich die Wohnung der Pastorenfamilie befand. Das Gebäude war alt, die Dielen knarrten unter ihren Schritten. Der Flur, von dem die umliegenden Zimmer abgingen, war dunkel und schien leicht nach hinten abzufallen.