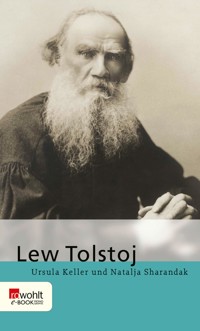20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als junger Mann schüchtern und gehemmt, lernte Dostojewskij erst mit über dreißig Jahren seine erste Ehefrau kennen: Maria Issajewa. »Ungeachtet dessen, dass wir miteinander recht unglücklich waren«, erinnerte sich der Schriftsteller nach ihrem Tod, »konnten wir doch nicht aufhören, einander zu lieben.« Noch zu ihren Lebzeiten begann er eine leidenschaftliche Affäre mit Apollinaria Suslowa, die zum Vorbild seiner »infernalischen« Frauenfiguren wurde. Doch die wohl wichtigste Frau in Dostojewskijs Leben war seine zweite Ehefrau Anna, die als junge Stenographin die Bekanntschaft des damals bereits berühmten Schriftstellers machte und bald zu einer unersetzlichen Mitarbeiterin, seiner Verlegerin und später Biografin wurde.
Zu anderen außergewöhnlichen und starken Frauen hatte Dostojewskij enge freundschaftliche Beziehungen, u.a. mit der Frauenrechtlerin Anna Filossofowa und mit Sofja Andrejewna Tolstaja, der Hausherrin eines der führenden Salons in Sankt Petersburg.
Auf der Grundlage von Erinnerungen, Briefen, Tagebüchern und neuen biographischen Forschungen beleuchtet diese Biografie erstmals, wie die Frauen Dostojewskijs Leben, seine Ansichten über die Rolle der Frau in der Gesellschaft und die Frauengestalten in seinen Werken beeinflusst haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Ursula Keller/Natalja Sharandak
Dostojewskij und die Frauen
Mit zahlreichen Abbildungen
Insel Verlag
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2022.
Originalausgabe© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2022
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Umschlagfoto: Amanda Elwell Photography/Arcangel, Malaga
eISBN 978-3-458-76875-3
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Vorwort
Prolog: Die Stenographin
1 Späte erste Liebe
»Ich entstamme einer russischen und frommen Familie.«
An der Lehranstalt des Ingenieurkorps in Sankt Petersburg
Debüt als Schriftsteller
Laune des Glücks
Der Petraschewskij-Kreis
Im toten Haus
2 Unglückselige Liaison: Maria Dmitrijewna Issajewa
Soldatenleben in Semipalatinsk
»Sie erschien in der traurigsten Zeit meines Lebens.«
»Ich komme um, wenn ich meinen Engel verliere.«
Dreieck der Liebe: Dostojewskij – Issajewa – Wergunow
3 Die Bürden des Ehelebens
»Wir leben irgendwie. Weder schlecht noch gut.«
»Ich bin vollkommen allein.« – Twer
Rückkehr ins Leben. Sankt Petersburg
Verliebte Freundschaft. Die Schauspielerin Alexandra Schubert
Dostojewskij und die Frauenfrage
»Ich fahre allein.« – Erste Reise nach Westeuropa
4 Die grausame Muse. Apollinaria Suslowa
Die Debütantin
Zwei Leidenschaften
Ein schweres Jahr
5 »Ich hoffte, noch einmal ein Herz zu finden …«
Suche nach Abenteuer. Marfa Brown
»Er braucht eine ganz andere Frau als mich.« – Anna Korwin-Krukowskaja
»Polja, meine Freundin, erlöse mich, rette mich!«
Ein Sommer in Ljublino
6 Eine moderne junge Frau. Anna Snitkina
Die Familie Snitkin
26 Tage
Ein gutes Herz
Alltag einer jungen Ehe
7 Vier Jahre auf Reisen
Dresdener Idylle
Die Prüfung: Roulettenburg
In der Schweiz
Aufbruch in die Heimat. Verbrannte Manuskripte
8 Wieder in Russland. Die literarische Ehefrau
Eine resolute Frau
Zeiten des Unglücks und des Glücks
Die erste russische Verlegerin
Die »russische Frau«
9 Die letzte Adresse
Habt Mitleid mit meinem Aljoscha
Der letzte Roman
Dostojewskij in den Salons von Freundinnen
10 Das letzte Jahr
Epilog
»Fjodor Dostojewskij war die Sonne meines Lebens«
»Es fällt Dir schwer, glücklich zu sein«
Bildteil
Anmerkungen
Bibliographie
Register
Bildnachweis
Informationen zum Buch
Vorwort
»Die Liebe ist so allmächtig, dass sie auch uns selbst verwandelt«, befand Fjodor Dostojewskij. In seinem Leben und in seinem Werk nahmen Liebesbeziehungen einen bedeutenden Platz ein. Die Frauen, die ihm im Laufe seiner Biographie innig verbunden waren, gelten als Prototypen der Frauengestalten in seinen Romanen.
In seinen späteren Jahren wusste Dostojewskij die Damenwelt mit seiner Persönlichkeit zu beeindrucken. Als junger Mann war er schüchtern und gehemmt, einmal fiel er gar in Ohnmacht, als er bei einer Abendgesellschaft einer jungen Dame mit prachtvollen Locken vorgestellt wurde.
Der erste Roman des fünfundzwanzigjährigen Leutnants a. D. und angehenden Schriftstellers, die in der Form eines Briefromans präsentierte anrührende Geschichte einer unerwiderten Liebe des kleinen Beamten Makar Dewuschkin zur jungen Waise Warenka Dobrosselowa, machte Fjodor Dostojewskij 1846 über Nacht berühmt und war sein Entreebillet in die führenden literarischen Salons Sankt Petersburgs. Dort verliebte er sich zum ersten Mal. Doch die vielumschwärmte Schönheit Awdotja Panajewa, eine der wichtigsten Salonièren jener Jahre, war für ihn unerreichbar.
Zu einigen außergewöhnlichen und starken Frauen hatte Dostojewskij eine enge freundschaftliche Beziehung – beispielsweise mit der Frauenrechtlerin Anna Filossofowa und mit Sofja Andrejewna Tolstaja, der Hausherrin eines der führenden Salons in Sankt Petersburg.
Drei Jahre nach seinem gefeierten literarischen Debüt wurde Dostojewskij vom zaristischen Regime zum politischen Schwerverbrecher erklärt. Mit zahlreichen Mitgliedern des Kreises um Michail Butaschewitsch-Petraschewskij, in dem diskutiert wurde, welches der richtige Weg zur Veränderung der sozialen Situation in Russland sei, wurde Dostojewskij 1849 zu vier Jahren Zwangsarbeit in Sibirien und anschließendem Militärdienst als gemeiner Soldat verurteilt.
In Semipalatinsk, einem entlegenen Garnisonsstädtchen in Sibirien, wo er nach seiner Entlassung aus der Katorga im Jahr 1854 als Soldat diente, lernte Dostojewskij mit über dreißig Jahren Maria Dmitrijewna Issajewa kennen. Die hübsche blonde Frau fesselte Dostojewskij mit ihrer lebendigen Art. Sie war einige Jahre jünger als er, gebildet – und verheiratet. Ihr Ehemann, ein kleiner Beamter, sprach dem Alkohol übermäßig zu und die Ehe war unglücklich.
Dostojewskij entbrannte mit aller Leidenschaft der späten ersten Liebe. Sie hingegen fühlte eher Mitleid für den vom Schicksal gebeutelten Menschen.
Nach dem Tod Zar Nikolajs I. im Februar 1855 begann unter der Regentschaft seines Sohns, Zar Alexander II., eine Epoche der Reformen, die die Bedingungen für aufgrund politischer Verbrechen Verurteilte erleichterte. Auch Dostojewskijs Leben nahm eine positive Wendung. Nach seiner Beförderung zum Unteroffizier, durch die er zumindest gewisse Freiheiten wiedererlangte, machte er Maria Issajewa, deren Ehemann im Sommer 1855 verstorben war, einen Heiratsantrag. Sie willigte ein, zog ihr Heiratsversprechen jedoch kurze Zeit später wieder zurück, da sie einen anderen liebe. Dieses schwierige Dreiecksverhältnis, in dem Dostojewskij zunächst seiner Liebe entsagte, um dem Glück Marias mit dem jungen Lehrer Nikolaj Wergunow nicht im Wege zu stehen, verarbeitete der Schriftsteller später in seinem Roman Erniedrigte und Beleidigte (1861). Im Oktober 1856 wurde Dostojewskij zum Fähnrich befördert, was eine Verbesserung der finanziellen Situation bedeutete und ebenso die Hoffnung auf Amnestie. Maria Issajewas Gefühle für Wergunow hatten sich zur selben Zeit merklich abgekühlt, und im Februar 1857 führte Dostojewskij sie schließlich doch zum Traualtar.
Der Ehe war indes kein Glück beschieden. Die finanziell angespannte Situation belastete das Zusammenleben ebenso wie die Tatsache, dass Maria Dmitrijewna aufgrund einer fortschreitenden Tuberkulose keine Kinder bekommen konnte. Und nicht zuletzt war Dostojewskijs erste Ehefrau eine starke Persönlichkeit und nicht bereit, ihr Leben ganz ihm zu widmen. Das schriftstellerische Werk ihres Ehemannes überzeugte Maria Dmitrijewna nicht sonderlich, ihre Vorliebe galt französischen Romanen.
Zehn Jahre nach seiner Verurteilung erhielt Dostojewskij 1859 von Zar Alexander II. die »allergnädigste Zustimmung« zur Niederlassung in Sankt Petersburg und konnte in seine Wahlheimat zurückkehren. Das feuchtkalte Klima der Hauptstadt war dem Gesundheitszustand Maria Dmitrijewnas nicht zuträglich und sie musste die Herbst- und Wintermonate in Moskau oder Wladimir verbringen. Die Ehe bestand mithin nur noch auf dem Papier.
Die Reformen Zar Alexanders II. betrafen auch das Pressewesen. Neue politisch-literarische Zeitschriften entstanden, in denen die aktuellen Themen jener Jahre diskutiert und neue literarische Werke veröffentlicht wurden. Auch Dostojewskij gründete mit seinem Bruder Michail eine Zeitschrift. Die Ankündigung des Journals mit dem Titel Die Zeit (Wremja) wurde zum Manifest seiner Idee von der messianischen Rolle des russischen Volkes, die zunehmend nationalistische Züge annahm. In einigen Artikeln bezog der Schriftsteller Position zur Frauenfrage, die in der Aufbruchstimmung der Reformen Alexanders II. weithin diskutiert wurde. Frauen waren im Russischen Reich nach wie vor politisch und ökonomisch rechtlos. Die bekanntesten Kräfte des demokratischen Lagers traten leidenschaftlich für die Emanzipation der Frau ein, so etwa der Publizist Michail Michailow oder der Schriftsteller Nikolaj Tschernyschewskij. Doch auch das Lager der Gegner, die die Bestimmung der Frau in der Rolle der Ehefrau und Mutter sahen, war groß und einflussreich.
Im Gegensatz zu den Vertretern der demokratischen Position vertrat Dostojewskij die Ansicht, dass die Gleichberechtigung der Frau mit dem Mann nicht allein durch die Veränderung der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse erreicht werden kann. Er betrachtete sie vielmehr von einem ethischen Standpunkt aus. Die Emanzipation der Frau, so war der Schriftsteller überzeugt, gehe »insgesamt einher mit der christlichen Menschenliebe«, die auch die Frau »zu beanspruchen berechtigt« sei. Wenn sich die Gesellschaft »dem Ideal der Humanität annähert«, werde sich auch die Einstellung der Frau gegenüber entsprechend verändern.
Die sanften und stolzen Frauenfiguren seiner Werke rebellieren gegen die Unterdrückung durch die Gesellschaft. Nastassja Filippowna, die »stolze Schönheit« mit »verletztem Herzen« aus Der Idiot (1868-1869), die als junges Mädchen von ihrem Ziehvater sexuell missbraucht wurde, rächt sich an den Männern für ihre verlorene Unschuld und Erniedrigung, wird aber am Ende doch erneut Opfer eines Mannes, der sie in einem Anfall von Eifersucht ermordet. Auch die sanfte Sonjetschka Marmeladowa aus Schuld und Sühne/Verbrechen und Strafe (1866) begehrt auf gegen die Ungerechtigkeit und Gleichgültigkeit der Gesellschaft, die sie zwingt, sich als Prostituierte zu verdingen, da sie keine andere Arbeit findet, um ihre im Elend lebende Familie zu ernähren. Die tiefreligiöse junge Frau hat keine Angst vor der Verachtung durch die sogenannten »anständigen Bürger«, sondern sieht sich allein Gott gegenüber als »große Sünderin«. Nastassja Filippowna ist zu stolz, das Mitgefühl, das Fürst Myschkin ihr entgegenbringt, anzunehmen. Ihr Tod ist Selbstbestrafung für ihre »Sünde« und damit bewusste Entscheidung. Sonjetschka Marmeladowa indes wird durch ihre aufopferungsvolle Liebe zum Mörder Raskolnikow zu einer anderen, ebenso wie ihre Liebe Raskolnikow zu einem anderen, besseren Menschen macht.
Nach langem Kampf wurden seit Ende der 1860er Jahre in einigen Städten des Russischen Reiches höhere Kurse für junge Frauen eröffnet. Dostojewskij befürwortete das Recht auf höhere Bildung, die »eine neue, erhabene gebildete und moralische Kraft« in die Gesellschaft bringen werde und dazu beitragen könne, die gesellschaftliche Stellung der Frauen zu verbessern. Zugleich jedoch hielt er es für »moralisch falsch«, wenn Frauen ihr erworbenes Wissen verwenden, um »mit der Gesellschaft um irgendwelche neuen Rechte zu kämpfen« und sich »für die Lösung irgendeiner Frauenfrage unserer Zeit« einzusetzen. Das Ziel der Bildung für Frauen müsse es sein, der Gesellschaft »nützlich zu sein«.
Ende der 1860er und Anfang der 1870er Jahre formierte sich der Typus einer gebildeten »neuen Frau«, die sich nicht mit der traditionellen weiblichen Rolle zufriedengeben wollte und nach Unabhängigkeit und Gleichberechtigung strebte, sich jedoch nicht wie die radikalen »Nihilistinnen« in ihrem Äußeren und Auftreten von der traditionellen Auffassung von Weiblichkeit lossagten.
Nastassja Filippownas Gegenspielerin Aglaja Jepantschina aus dem Roman Der Idiot ist eine solche moderne Frau. Sie versucht, aus ihrem »Nest« in Freiheit zu gelangen und der Welt »nützlich zu sein«. Sie liebt Fürst Myschkin, den sie für »den aufrichtigsten und wahrhaftigsten Menschen« hält, und ist bereit, die Frau dieses »Sonderlings« zu werden, da sie die Vorurteile der Gesellschaft überwunden hat. Durch den Bericht im Epilog erfährt man, dass sie schließlich einen polnischen Revolutionär heiratet und ihr Leben seinem Kampf für die Befreiung seiner Heimat verschreibt. Selbstbewusste moderne Frauenfiguren sind auch Katerina Achmakowa aus dem Roman Der Jüngling (1875), eine vorzüglich gebildete Frauenpersönlichkeit, die eine gleichberechtigte Beziehung führen will, und die Kursistin Warwara Snegirewa aus Die Brüder Karamasow (1880), eine ernste und zielstrebige junge Frau, die ihren Lebensunterhalt selbst verdient, indem sie Unterricht gibt.
Im April 1864 starb Dostojewskijs Ehefrau, Maria Dmitrijewna. »Ungeachtet dessen, dass wir miteinander recht unglücklich waren«, erinnerte sich der Schriftsteller später, »konnten wir doch nicht aufhören, einander zu lieben.« Maria Dmitrijewna beschäftigte sein Denken weiterhin und in den Protagonistinnen seiner Werke lässt sich ihr Abbild finden – etwa in der Natascha aus Erniedrigte und Beleidigte, in Katerina Iwanowna aus Schuld und Sühne/Verbrechen und Strafe sowie in der Nastassja Filippowna aus Der Idiot.
Noch zu Lebzeiten Maria Issajewas begann Dostojewskij eine leidenschaftliche Affäre mit Apollinaria Suslowa, seiner »unerquicklichen Muse«. Suslowa war fast zwanzig Jahre jünger als er und eine typische Vertreterin der neuen Generation von Frauen. Sie war literarisch ambitioniert und schrieb einige Erzählungen, die in der von Dostojewskij und seinem Bruder Michail herausgegebenen Zeitschrift Die Zeit erschienen. Die Beziehung war für beide qualvoll und wurde durch Dostojewskijs Spielsucht, die in jenen Jahren begann, zusätzlich belastet. Suslowa war nicht bereit, sich auf die ihr von ihm zugewiesene Rolle als Frau und Geliebte reduzieren zu lassen, was zu ständigen Konflikten führte. Trotz zweier Heiratsanträge des Schriftstellers ging die Beziehung 1865 schließlich unter gegenseitigen Vorwürfen unversöhnlich auseinander.
Dostojewskij war folglich auf Freiersfüßen und hoffte darauf, »ein Herz zu finden«, das seine Liebe beantwortete. Einige Zeit war er von der jungen Abenteurerin Marfa Brown fasziniert, die mit sechzehn von zu Hause ausgerissen war und ohne jegliche finanziellen Mittel auf der »Jagd nach Eindrücken« Europa bereist hatte. Dann begeisterte er sich für Anna Korwin-Krukowskaja, die Schwester von Sofja Kowalewskaja, die 1884 als weltweit erste Professorin für Mathematik an die Universität Stockholm berufen wurde. Wie Apollinaria Suslowa war Anna Korwin-Krukowskaja eine emanzipierte junge Dame mit literarischen Ambitionen. Der Schriftsteller war angetan von ihrer Schönheit und ihrem Verstand, doch sie spürte schon bald, dass er nicht bereit war, ihr jene Freiheiten zu geben, die sie verlangte. »Er braucht eine ganz andere Frau als mich«, erklärte sie der Schwester, nachdem sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hatte. »Seine Ehefrau muss sich ihm ganz und gar widmen.«
Die wohl wichtigste Frau im Leben Dostojewskijs war seine zweite Ehefrau, Anna Dostojewskaja. Im Gegensatz zu Anna Korwin-Krukowskaja war sie bereit, sich dem Schriftsteller und Menschen Dostojewskij ganz zu verschreiben, zugleich jedoch vermochte sie es, ihre geistige Unabhängigkeit zu bewahren. Auch Dostojewskaja war geprägt von den emanzipatorischen Ideen ihrer Zeit. Sie gehörte zur ersten Frauengeneration in Russland, die eine systematische Gymnasialausbildung genossen hatte. Nach dem Schulabschluss hatte sie, um ihr »eigenes Brot zu verdienen« und »durch die eigene Arbeit« materielle Unabhängigkeit zu erlangen, einen Beruf erlernt und war die beste Schülerin des Stenographie-Theoretikers Pawel Olchin.
Nach dem plötzlichen Tod seines Bruders Michail im Juli 1864 und der Einstellung der gemeinsam herausgegebenen Zeitschrift war Dostojewskijs finanzielle Lage desaströs. Er hatte einen Berg Schulden geerbt und sah keine andere Möglichkeit, als einen Vertrag über die Veröffentlichung einer dreibändigen Gesamtausgabe zu schließen, um wenigstens den drängendsten Teil davon zu begleichen. Diese sollte einen bisher unveröffentlichten Roman beinhalten, den Dostojewskij bis zu einer bestimmten Frist vorzulegen hatte. Als der Abgabetermin näher rückte, unterbrach Dostojewskij die Arbeit an seinem ersten großen Roman, Schuld und Sühne/Verbrechen und Strafe, und schrieb mit Unterstützung der jungen Stenographin Anna Snitkina im Oktober 1866 den Roman Der Spieler in weniger als einem Monat nieder. Schon vier Monate später wurde Anna im Februar 1867 Dostojewskijs zweite Ehefrau.
Kurze Zeit darauf trat das Ehepaar eine Reise nach Westeuropa an. Sie flohen vor den zahlreichen Gläubigern, die auf Rückzahlung der Schulden drängten. Doch im Ausland lauerte eine womöglich noch größere Gefahr – die Spieltische in den Casinos, deren Glücksverheißungen Dostojewskij immer wieder erlag. Die Spielsucht ihres Ehemannes bekam Anna Dostojewskaja buchstäblich am eigenen Leibe zu spüren. Er versetzte oft das gesamte Geld, und das neuvermählte Paar lebte unter misslichsten Bedingungen. Dostojewskij verpfändete die Kleidung seiner Ehefrau und alle Wertsachen – bis auf die Trauringe. Mit Hilfe der selbstlosen Unterstützung Anna Dostojewskajas gelang es dem Schriftsteller schließlich, seine Spielsucht zu besiegen. »Das ganze Leben lang werde ich mich daran erinnern und jedes Mal Dich, meinen Engel, segnen«, schreibt er ihr dankbar.
Drei Monate sollte die Reise dauern, doch erst 1871 kehrten die Dostojewskijs nach Russland zurück. Während des Aufenthalts entstanden wichtige Werke wie Der Idiot (1868-69) sowie erste Kapitel des Romans Die Dämonen/Böse Geister (1871-72), zwei Töchter erblickten das Licht der Welt, die erste starb kurz nach der Geburt.
Nach der Rückkehr ins heimatliche Russland begann die wohl glücklichste Zeit in Dostojewskijs Leben. Anna umgab ihn mit häuslicher Geborgenheit, die er für sein Schaffen brauchte, sie übernahm die Finanzen, verhandelte mit den Gläubigern und stellte sich und ihr Leben in den Dienst des Schriftstellers. Sie stenographierte seine Romane und übertrug dann in ihrer gut lesbaren, fast kalligraphischen Handschrift die Manuskripte, die Dostojewskij nochmals durchsah. Sie las die Druckfahnen Korrektur, übernahm ab 1873 eigenständig die Herausgabe von Dostojewskijs Werkausgaben und wurde so zur ersten russischen Verlegerin.
In der Aufgabe als Stenographin, Korrektorin und Verlegerin ihres Ehemannes sah Anna Dostojewskaja ihre Berufung. Sie war unmittelbar am Entstehen seiner vier großen philosophischen Romane beteiligt und deren erste Kritikerin. »Anna ist wahre Helferin und Trösterin für mich«, bekannte der Schriftsteller. Und ihr, seiner »wahren Helferin« widmete Dostojewskij dann auch seinen letzten Roman, Die Brüder Karamasow (1880), der sein Vermächtnis wurde.
Nach seinem unerwarteten Tod am 28. Januar/9. Februar 1881 stellte seine Witwe ihr Leben weiterhin in den Dienst seines literarischen Schaffens und gab als Verlegerin seine Werke heraus. In ihren letzten Lebensjahren schrieb sie ihre Erinnerungen nieder, deren Veröffentlichung im Jahr 1925 ein großer Erfolg war und die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden.
Auf Grundlage von Erinnerungen, Briefen, Tagebüchern und neuen biographischen Forschungen beleuchtet die vorliegende Schriftstellerbiographie, wie unterschiedliche Frauen Dostojewskijs Leben, seine Ansichten und die weiblichen Figuren in seinen Werken beeinflusst haben.
Prolog: Die Stenographin
Bei einem Besuch Anfang Oktober 1866 trifft der Literat Alexander Miljukow seinen Freund Fjodor Dostojewskij in bedrückter Stimmung an. Ein Jahr zuvor hatte sich der Schriftsteller gezwungen gesehen, einen Knebelvertrag mit dem für sein unlauteres Geschäftsgebaren bekannten Verleger Fjodor Stellowskij abzuschließen. In die Enge getrieben von den unablässigen Forderungen seiner zahlreichen Gläubiger, die dem säumigen Schuldner mit Pfändung seines Besitzes und Gefängnis drohten, hatte Dostojewskij, immerhin einer der bekanntesten Schriftsteller seiner Zeit, für 3000 Rubel die Rechte an all seinen bisher erschienenen Werken für eine dreibändige Gesamtausgabe an den Verleger abgetreten. Darüber hinaus hatte er sich verpflichtet, bis zum 1. November 1866 einen neuen Roman im Umfang von mindestens zehn Druckbogen, also knapp 200 Seiten, vorzulegen. Für den Fall, dass er diese Frist nicht einhalte, fielen, so war vertraglich vereinbart, die Rechte an sämtlichen Werken des Schriftstellers für die Dauer von neun Jahren an Stellowskij. Bis zu diesem folgenschweren Tag bleibt gerade einmal ein Monat.
»Haben Sie denn schon viel von diesem neuen Roman geschrieben?«, erkundigt sich Miljukow. Dostojewskij winkt erregt ab. »Nicht eine Zeile«, erwidert er deprimiert. »Dann diktieren Sie den Roman jemandem, der Stenographie beherrscht«, empfiehlt Miljukow. »Ich glaube, in einem Monat wäre es so zu schaffen, den Roman fertigzustellen.« Und er verspricht, ihm einen Stenographen zu vermitteln.
26 Tage vor Ablauf der im Vertrag genannten Frist klingelt am 4. Oktober 1866 kurz vor zwölf Uhr am Mittag eine bescheiden gekleidete junge Dame am Haus Ecke Malaja Meschtschanskaja Uliza (Kleine Kleinbürgerstraße) und Stoljarnyj Pereulok (Tischlergasse), in dem der Schriftsteller wohnt. Die zwanzigjährige Anna Grigorjewna Snitkina ist eine der besten Schülerinnen der Stenographiekurse von Professor Pawel Olchin. Eine betagte Bedienstete öffnet und führt Anna ins Arbeitszimmer des Schriftstellers, der sie bereits erwartet. »Die Einrichtung des Kabinetts war vollkommen gewöhnlich«, bemerkt sie erstaunt.
Der Hausherr wirkt angegriffen, mürrisch und leicht gereizt. Um die Fähigkeiten seiner jungen Besucherin, deren Namen er immer wieder vergisst, zu prüfen, diktiert er ihr einen Abschnitt aus seinem Roman Schuld und Sühne/Verbrechen und Strafe, der seit einigen Monaten in Fortsetzungen in der Zeitschrift Russischer Bote (Russkij westnik) erscheint, und ist ungehalten, als sie ihn unterbricht, weil er viel zu schnell diktiert. Dann beginnt Dostojewskij zu rauchen und bietet der jungen Frau eine Papirossa an, was diese durchaus als beleidigend empfinden könnte, steht es doch einer jungen Dame aus gutem Hause nicht an, zu rauchen. Auch dies ist eine Art Prüfung, die die zukünftige Mitarbeiterin mit Bravour besteht. Sie rauche nicht und empfinde es als peinlich, Frauen in der Öffentlichkeit rauchen zu sehen, erklärt Anna Grigorjewna. Wie zahlreiche seiner Zeitgenossen blickt der Schriftsteller skeptisch auf junge Frauen, die ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, denn es gilt in jenen Jahren für Damen der Gesellschaft als anstößig, einen Beruf auszuüben. Dostojewskij befürchtet, die ihm empfohlene Stenographin sei womöglich eine jener radikal gesinnten »neuen Frauen« der 1860er Jahre, eine »Nihilistin«, wie sie damals genannt werden, die ihrem Streben nach Gleichberechtigung der Geschlechter nicht zuletzt dadurch Ausdruck verleihen, dass sie sich durch ihr Gebaren gegen die vorgegebenen gesellschaftlichen Normen auflehnen. Dass seine junge Besucherin die angebotene Papirossa so entschieden ablehnt, beruhigt ihn.
Da er nicht in der Lage sei, sogleich mit der Arbeit zu beginnen, bittet er seine neue Stenographin, ihn um acht Uhr am Abend noch einmal aufzusuchen. Als Zeichen der Gewogenheit macht er ihr zum Abschied ein scherzhaftes Kompliment:
»Ich bin froh, dass Olchin mir eine junge Frau und keinen jungen Mann geschickt hat. Und wissen Sie auch, warum?«
»Nein, warum?«
»Nun, ein Mann hätte sicher früher oder später angefangen zu trinken, aber Sie werden das doch sicher nicht tun, hoffe ich?«
»Sie können sicher sein, dass ich ganz bestimmt nicht zu trinken anfangen werde«, antwortete die zukünftige Mitarbeiterin, die ihr Lachen kaum unterdrücken kann.
Als sie am Abend wieder die Stufen im heruntergekommenen Treppenhaus zu der Wohnung des Schriftstellers im zweiten Stock hinaufsteigt, ist Anna Snitkina nicht sicher, ob dieser befremdlich wirkende Mensch ihr nicht vielleicht mitteilen würde, dass er ihre Assistenz nun doch nicht benötige. Aber sie findet den Hausherrn verändert vor. Er ist umgänglicher als zuvor und erzählt ihr aus seinem Leben »mit solchen Einzelheiten, derart aufrichtig und vertraut«, dass Anna erstaunt ist. Am selben Abend beginnen sie mit der Arbeit.
Die Stenographin tritt in einer Zeit des Umbruchs in Dostojewskijs Leben. Mit Mitte vierzig will er es endlich in geordnete Bahnen bringen und nicht mehr »unter der Knute« der ständigen Geldnot arbeiten. Die gesamten ersten Tage ihrer Zusammenarbeit erzählt Dostojewskij aus seinem Leben und zieht Bilanz. Er beginnt, was seine junge Mitarbeiterin besonders erstaunt, mit dem schwärzesten Augenblick seiner Biographie, nämlich mit der Verurteilung zum Tode gemeinsam mit anderen Mitgliedern des sozialistisch gesinnten Kreises um Michail Petraschewskij. Am 22. Dezember 1849 sollte die Hinrichtung vollzogen werden, die sich als eine von Zar Nikolaj I. inszenierte grausame Farce erwies.
Weder Dostojewskij noch Anna Snitkina ahnen an jenem Tag, dass diese Begegnung ihrer beider Schicksal bestimmen wird. Dem von Geldsorgen geplagten Schriftsteller steht der Sinn nicht nach zärtlichen Gefühlen, und die junge, befangene Stenographin ist einzig daran interessiert, einen guten Eindruck bei ihrem Arbeitgeber zu hinterlassen, »um den großen Schritt von der Schülerin oder Kursistin zur selbständigen Frau in der von mir gewählten Tätigkeit zu machen«.
1
Späte erste Liebe
»Ich entstamme einer russischen und frommen Familie.«
Michail Andrejewitsch Dostojewskij, der Vater des Schriftstellers, entstammt einem alten verarmten Adelsgeschlecht aus dem Großfürstentum Litauen. Der Name der Vorfahren geht zurück auf das nahe der Stadt Brest gelegene Dorf Dostojewo und findet sich in den Gerichtsbüchern jener Zeit. Ende des 16. Jahrhunderts stand etwa eine gewisse Maria Stefanowna Dostojewskaja vor Gericht, da sie mit Hilfe des gedungenen Mörders ihren Ehemann Stanislaw Karlowitsch ermordet, ihren Stiefsohn Kristof Karlowitsch zu ermorden versucht und ein Testament gefälscht haben soll, um deren Besitz an sich zu bringen. Zugleich sind in der Chronik des Geschlechts auch berühmte historische Persönlichkeiten genannt: Beispielsweise stand ein Fjodor Dostojewskij als juristischer Berater Fürst Andrej Kurbskij zur Seite, dem einstigen Vertrauten und späteren Gegner Zar Iwan IV., des »Schrecklichen«. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts siedelte die Familie in die damals zur königlichen Republik Polen gehörende Ukraine über.
Michail Dostojewskij wird 1789 als ältester Sohn des Priesters Andrej Grigorjewitsch Dostojewskij geboren, der seit 1782 Dorfpope in Wojtowzy im Gouvernement Podolsk ist. Er soll ebenfalls Geistlicher werden und studiert am Priesterseminar in Schargorod. Nach einem Ukas Zar Alexanders I., der anordnete, dass 120 Priesterseminarstudenten zu Ärzten ausgebildet werden sollten, besteht der »zu den Wissenschaften geneigte« Seminarist die Aufnahmeexamina und beginnt 1809 als auf Staatskosten alimentierter Student das Studium an der Medizinisch-Chirurgischen Akademie in Moskau. Im Krieg gegen die Grande Armée Napoleons wird er 1812 mit anderen Studenten zur Arbeit in den Feldlazaretten beordert. Nach Abschluss seines Studiums wird er Regimentsarzt, später Stabsarzt in Moskau.
Anfang 1820 heiratet Michail Dostojewskij die um zehn Jahre jüngere Maria Fjodorowna Netschajewa. Im selben Jahr quittiert der lebenserfahrene und mit Orden ausgezeichnete Militärarzt den Dienst und tritt mit 31 Jahren im März 1821 eine neue Stellung als Oberarzt zweiter Klasse im Marienhospital an. Mit dem im Oktober 1820 erstgeborenen und nach dem Vater benannten Sohn Michail bezieht das Ehepaar dort eine Dienstwohnung, in der am 30. Oktober 1821 der zweite Sohn geboren und auf den Namen Fjodor getauft wird.
Das Marienhospital ist ein Krankenhaus für Arme und liegt am damaligen Stadtrand von Moskau. Diese Gegend wird »Armes Haus« genannt. Ganz in der Nähe befinden sich ein Heim für Findelkinder und ein Irrenhaus. Das von Maria Fjodorowna, der Zarenmutter Alexanders I., Anfang des 19. Jahrhunderts gegründete Armenkrankenhaus ist in einem Monumentalbau im Empirestil untergebracht, dessen hochherrschaftliche Architektur im scharfen Gegensatz zu seinen Patienten steht, vom Leben gebeutelte Randexistenzen der Gesellschaft, die in ihren hellbraunen Krankenhauskitteln gespenstergleich durch den Park spazieren. Den Kindern des Armenarztes ist es verboten, sich den Kranken zu nähern. Aber Fjodor übertritt dieses Verbot immer wieder und unterhält sich, wenn sich ihm die Gelegenheit bietet, heimlich mit den erniedrigten und beleidigten Patienten – besonders gern, wenn dies Knaben in seinem Alter sind.
»Ich entstamme einer russischen und frommen Familie«, schreibt Fjodor Dostojewskij später in seinem Tagebuch eines Schriftstellers, »und meine erste Erinnerung ist die Liebe meiner Eltern zu mir.«Die Dienstwohnung ist beengt und je größer die Familie wird – im Laufe der Jahre folgen den beiden Brüdern fünf Geschwister: 1822 wird die Schwester Warwara geboren, 1825 Andrej, 1829 Vera, 1831 Nikolaj und 1835 Alexandra –, desto weniger Platz gibt es für alle. Andrejs Erinnerungen zufolge, die die wichtigste Quelle zur Kindheit des Schriftstellers sind, besteht sie lediglich aus zwei Zimmern, einem recht großen Raum, der Saal genannt wird, und einem Wohnzimmer, in dem das durch eine Bretterwand abgetrennte elterliche Schlafzimmer untergebracht ist, sowie einem geräumigen Vorraum und der Küche. Das Kinderzimmer, das Michail und Fjodor sich teilen, ist eine fensterlose, im Vorraum ebenfalls durch eine Bretterwand abgeteilte Kammer. »Meine Eltern waren keine wohlhabenden, aber fleißige Menschen«, entsinnt sich der Schriftsteller. Obgleich die Familie ein bescheidenes Leben ohne Luxus führt, leben sieben Bedienstete im Haushalt, und man besitzt eine eigene Equipage, mit der der Hausherr zu seinen zahlreichen Patientenvisiten fährt, die ihm neben seinem Salär als angestellter Arzt einen auskömmlichen Verdienst sichern.
Im Alltag der Familie wird streng auf die Befolgung der Anstandsregeln und der patriarchalen Ordnung geachtet. Das Familienoberhaupt fordert, dass die von ihm festgelegten Grundsätze in seinem Hause eingehalten werden. Michail Dostojewskij ist ein unabhängiger Geist, gebildet und ein fürsorglicher Ehemann und Vater, zugleich aber ist er leicht reizbar, jähzornig und misstrauisch. Ein Tyrann, wie es in zahlreichen Biographien über den Schriftsteller heißt, ist er jedoch nicht. Alles, was er im Leben erreicht hat, erreichte er aus eigener Kraft. Er ist streng und fordernd gegen sich selbst und seine Kinder. »Vater hielt nicht gern Moralpredigten und wies nicht gern zurecht«, berichtet Andrej Dostojewskij, »aber er sagte immer wieder, dass er ein armer Mann sei und dass seine Kinder, insbesondere die Knaben, darauf vorbereitet sein sollten, für sich selbst im Leben Verantwortung zu übernehmen, da sie nach seinem Tode arm seien.« Um sie vor diesem Schicksal zu bewahren, sollen seine Söhne eine solide Ausbildung erhalten, um dann in Beruf und Gesellschaft ihren Weg zu gehen. Die gesamte von Disziplin geprägte Erziehung unterliegt dieser Prämisse.
Von früher Kindheit an werden die Geschwister zu Hause unterrichtet. Bereits im Alter von vier Jahren sitzen Michail, genannt Mischa, und Fjodor, genannt Fedja, über den Büchern: »›Lerne!‹, hielt Vater uns an«, erinnert sich der Schriftsteller. »Und dabei war es draußen so schön, so warm.« Als die Söhne älter sind, werden Privatlehrer engagiert. Russisch, Arithmetik und Religion unterrichtete der Diakon Chinkowskij, Französisch ein ehemaliger Kriegsgefangener der Grande Armée, der seinen Familiennamen von Suchard in einem Anagramm zu Draschussow russifiziert hatte. Der Vater übernimmt den Lateinunterricht, der jeden Abend zur schweren Bewährungsprobe für die Brüder wird. Es ist ihnen während des Unterrichts, der eine Stunde oder länger dauert, nicht nur untersagt, sich zu setzen, sondern sogar auch, sich nur an den Tisch zu lehnen. Mischa und Fedja fürchten diese Stunden sehr, denn der Vater ist »überaus anspruchsvoll und ungeduldig« und gerät beim kleinsten Fehler seiner Söhne in Wut, nennt sie faul und dumm und bricht den Unterricht bisweilen sogar ab, ohne die Lektion zu Ende gebracht zu haben. Bei aller Strenge jedoch werden die Kinder ohne übermäßige Härte erzogen: »Wir wurden nicht körperlich gezüchtigt«, hält Andrej Dostojewskij fest, »und mussten auch nicht in der Ecke stehen oder knien. Das Schlimmste war für uns, wenn Vater aufbrauste.« In jenen Jahren ist die körperliche Züchtigung von Kindern an der Tagesordnung. Dostojewskij ist einer der wenigen russischen Klassiker, der in Kindheit und Jugend keine Bekanntschaft mit der Knute gemacht hat.
Der Herr Papa achtet streng auf die Einhaltung der Regeln von »Anstand« und »Moral«. »Laute« und »anstößige« Spiele wie das russische Schlagballspiel Lapta sind den Söhnen untersagt. Auch ist es den Knaben verboten, allein auszugehen, denn dies hält der Vater ebenfalls für anstößig. »Ich erinnere mich nicht, dass meine Brüder auch nur ein einziges Mal ohne Begleitung spazieren gingen, … und dies, obgleich sie bis zum Alter von siebzehn bzw. sechzehn im Elternhaus lebten«, berichtet Andrej. Als Michail und Fjodor ihre Schulausbildung in einem privaten Pensionat fortsetzen, werden sie zu Beginn der Schulwoche mit der Equipage dorthin gefahren und zum Wochenende wieder abgeholt, damit die Jungen nicht in Versuchung kämen, allein durch die Stadt zu streifen. Sie erhalten auch kein Taschengeld. In dieser in sich geschlossenen kleinen Welt sind die jüngeren Schwestern und die Töchter des Krankenhauspersonals ihre einzige weibliche Gesellschaft.
Nach dem Kauf von Ländereien im Gouvernement Tula zu Beginn der 1830er Jahre verbringt die Familie die Sommermonate auf dem Land, und dort kommen die Brüder mit Bauernmädchen in Kontakt. Besonders Fjodor, »der Feurige«, wie er wegen seines aufbrausenden Wesens, seiner Empfindsamkeit und der Heftigkeit, mit der er seine Standpunkte vertritt, in der Familie genannt wird, bereitet den Eltern Sorge. »Fedja, beruhige dich, sonst wird es dir schlecht ergehen, und du musst die rote Soldatenmütze [des Strafregiments] tragen«, warnt ihn der Vater immer wieder, und sagt ihm damit, ohne es zu ahnen, die Zukunft voraus.
Durch seinen Dienst im Krankenhaus und als Privatarzt ist der Vater tagsüber kaum zu Hause, und die Erziehung und der Unterricht obliegen der Mutter. Sie hat, anders als das zu Schwermut neigende Familienoberhaupt, ein heiteres Wesen, ist gutherzig und zärtlich. Bei ihr dürfen die Kinder auch ausgelassen sein und herumtollen. Maria Fjodorowna Dostojewskaja ist die jüngste Tochter des Kaufmanns der 3. Gilde Fjodor Netschajew, an den sich die Enkel als einen »liebenden und verwöhnenden Großvater« erinnern. Marias Mutter, Warwara Kotelnizkaja, war die Tochter eines Geistlichen, der die berühmte Slawisch-Griechisch-Lateinische Akademie besucht hatte und als Korrektor der Synodal-Druckerei zahlreiche Bekanntschaften in den Kreisen der Literatur hatte. Sein Sohn Wassilij, Maria Dostojewskajas Onkel, ist Professor und Dekan der Medizinischen Fakultät der Moskauer Universität, und die Familie ist stolz auf seine Gelehrtheit. Die Wände seiner Wohnung im Zentrum Moskaus sind geschmückt mit Gemälden »herausragender Meister«, er besitzt eine umfangreiche Bibliothek mit seltenen Handschriften und Druckausgaben und eine Kollektion alter Münzen und »Kuriositäten«. Der kinderlose alte Herr liebt seine Großneffen. Die älteren drei sind stets zu Ostern, am höchsten Feiertag der russischen Orthodoxie, bei ihm zum Essen eingeladen, und nach dem Essen geht es auf den Jahrmarkt in der Nähe, wo in den Schaubuden Clowns für Heiterkeit sorgen, im Puppentheater Petruschka seine Späße macht und Kraftprotze bewundert werden können.
Die einer hochkultivierten Familie entstammende Gemahlin des Stabsarztes Dostojewskij liebt die Poesie und die Musik, begleitet sich beim Gesang russischer Romanzen selbst auf der Gitarre und beherrscht die Kunst des Schreibens, wovon ihre lyrischen und humorvollen Briefe zeugen.
Im September 1823 werden beim Maler Popow, einem Verwandten Maria Dostojewskajas, die Porträts des Ehepaars in Auftrag gegeben. Nach der Mode der Zeit ist Marias Antlitz an den Wangenknochen von seidigen Locken gerahmt, ein kaum wahrnehmbares Lächeln umspielt ihren Mund. Sie wirkt beseelt, klug, gutherzig. Ihr Gatte trägt den hohen, goldbestickten Kragen der Ziviluniform des Arztes, sein Backenbart ist akkurat frisiert, er sieht jung aus, sein Blick ist offen, aber zwischen den Augenbrauen haben sich bereits zwei tiefe Falten eingegraben.
Maria Dostojewskaja ist keineswegs das widerspruchslose Opfer ihres tyrannischen Ehemannes, als welches sie in zahleichen Biographien des Schriftstellers gezeichnet wird. Sie erkennt seine Autorität als Familienoberhaupt an, verleiht der »leidenschaftlichen Wahrheit ihrer Gefühle« ihm gegenüber jedoch Ausdruck, wenn sie der Ansicht ist, dass er Unrecht hat, heitert ihn auf in Augenblicken der Schwermut und kämpft gegen seinen Argwohn an. Der Briefwechsel der Ehegatten ist voll von tiefer Empfindsamkeit und legt Zeugnis ab von den Gefühlen, die sie verbanden. Auf seine Klage: »Vergiss mich nicht in meiner aufgewühlten Seelenlage«, antwortet sie: »Ich bitte Dich, mein Engel, mein Abgott, schone Dich um meiner Liebe willen.« Fjodor Dostojewskij erinnert sich voller Liebe an seine Mutter, Eigenschaften ihres Charakters finden sich in seinen Frauengestalten der »Sanften«, der Frauen »reinen Herzens«, vor denen man »unmöglich etwas zu verbergen vermag, zumindest nichts, das schmerzlich und verletzend auf der Seele liegt. Wer leidet, gehe tapfer und voller Hoffnung zu ihnen und habe keine Angst, ihnen zur Last zu fallen, da kaum jemand von uns weiß, wie unendlich groß die duldsame Liebe, das Mitgefühl und allumfassendes Verzeihen im weiblichen Herzen ist.«
Maria Dostojewskajas Schwester Alexandra ist der »gute Engel« der Familie. Sie lebt mit ihrem Ehemann, dem »namhaften Bürger« Alexander Kumanin, einem wohlhabenden Moskauer Kaufmann, in einem prächtigen Palais in der Bolschaja Ordynka im zentralen Bezirk Samoskworetschje, das mit seiner repräsentativen Imposanz in schroffem Gegensatz zur Dienstwohnung der Familie des Stabsarztes steht. Ihre Ehe ist kinderlos, deshalb wird Alexandra Taufpatin und Lieblingstante aller sieben Kinder ihrer Schwester und lässt der Familie Dostojewskij großzügige materielle Unterstützung zukommen.
In der bescheidenen Wohnung des Stabsarztes ist der wohlgefüllte Bücherschrank im Wohnzimmer der wichtigste Einrichtungsgegenstand. Die Eltern messen der literarischen Bildung ihrer Kinder großen Wert bei und bringen ihnen die dort gesammelten Werke nahe. Im Licht von zwei Talgkerzen sitzt die Familie an den Abenden zusammen, und Vater oder Mutter lesen vor. Fedja begeistert sich besonders für Nikolaj Karamsins Geschichte des russischen Staates. »Mit gerade einmal zehn Jahren kannte ich fast alle wichtigen Ereignisse der russischen Geschichte«, erinnert sich Fjodor Dostojewskij. Später ist dieses zwölfbändige Werk unverzichtbares Handbuch des Schriftstellers.
Die »Frömmigkeit« der Eltern findet ihren Ausdruck in der strikten Befolgung religiöser Riten, die auch den Kindern vermittelt wird. Das wichtigste Buch beim Erlernen des Lesens war Einhundert und vier Heiligengeschichten aus dem Alten und Neuen Testament, die russische Fassung der damals europaweit verbreiteten illustrierten Kinderbibel von Johann Hübner. An den Sonn- und Feiertagen besucht die Familie den Gottesdienst in der Kapelle des Krankenhauses, und einmal jährlich unternimmt die Mutter mit den Kindern eine Wallfahrt ins nördlich von Moskau gelegene Dreifaltigkeitskloster des heiligen Sergius, eins der wichtigsten geistlichen Zentren der russisch-orthodoxen Kirche. »Dort verbrachten wir zwei Tage, besuchten alle Gottesdienste und kehrten mit dort gekauftem Spielzeug zurück. Insgesamt dauerte diese Reise 5-6 Tage.«
1827 wird Michail Dostojewskij »für besondere Verdienste« zum Kollegienassessor befördert, was dem Aufstieg in den Erbadel gleichkommt. Da es zu aufwendig ist, seine adelige Herkunft anhand alter Familiendokumente nachzuweisen, lässt er sich mit seiner Familie der Einfachheit halber ins Adelsbuch des Gouvernements Moskau eintragen. Die Zugehörigkeit zum Adelsstand verleiht den Dostojewskijs das Recht auf Landbesitz, und zu Beginn der 1830er Jahre erwirbt das Familienoberhaupt ein Landgut mit den Dörfern Darowoje und Tscheremoschnja im Gouvernement Tula. Der Kauf ist allerdings nicht mit Glück gesegnet. Aufgrund anhaltender Dürreperioden sind die Ernteerträge niedrig, und ein Jahr nach dem Kauf wütet ein Brand in Darowoje. Für die Kinder, die hier die Sommermonate mit der Mutter verbringen, ist der Erwerb ein Gewinn. Hier können sie frei atmen. »Dieser kleine und unbedeutende Ort hat starke und tiefe Eindrücke bei mir hinterlassen, an die ich mich mein ganzes Leben erinnert habe«, schreibt Dostojewskij später.
Die Abwesenheit seiner Familie zu ertragen, fällt dem Vater, der in Moskau seinem Dienst nachgeht, nicht leicht. Er wird von Schwermut heimgesucht, die noch verstärkt wird durch den Verdacht, seine im achten Monat schwangere Frau sei ihm untreu und das Kind, das sie erwartet, nicht von ihm. Müde der ewigen Rechtfertigungen klagt die gekränkte Ehefrau: »Meine Liebe siehst Du nicht, und meine Gefühle verstehst Du nicht, blickst auf mich mit niederem Misstrauen, während ich nur durch meine Liebe atme. Und so vergehen Zeit und Jahre, Falten und Erbitterung legen sich aufs Gesicht, die Heiterkeit des angeborenen Charakters verwandelt sich in traurige Melancholie, und das ist mein Los, mein Lohn meiner untadeligen, leidenschaftlichen Liebe … Ich verfluche Dich nicht, hasse Dich nicht, sondern liebe und vergöttere Dich, und teile mit Dir, meinem Einzigen, alles was mir auf dem Herzen liegt.«
Nach der Geburt des letzten Kindes verschlechtert sich die Schwindsucht, unter der die Gattin des Stabsarztes bereits seit einiger Zeit leidet. Sie stirbt im Alter von sechsunddreißig Jahren am 27. Februar 1837. Der Witwer wird diesen Verlust nicht verwinden. Aufgrund von »Zittern« der linken Hand und sich verschlechternden Sehvermögens ist er im Alter von achtundvierzig Jahren gezwungen, die Beförderung abzulehnen und seinen Dienst zu quittieren, was den Verlust der Dienstwohnung nach sich zieht.
An der Lehranstalt des Ingenieurkorps in Sankt Petersburg
Ab Herbst 1834 setzen Mischa und Fedja ihre Schulausbildung im Internat von Leontij Tschermak fort, einer der besten Moskauer Privatschulen. Besonders Fjodor fällt es nicht leicht, sich auf das neue Leben einzustellen. »Er war ein ernster, nachdenklicher Knabe mit hellen Locken und blassem Gesicht«, so einer seiner Kameraden, der spätere Literat Wladimir Katschenowskij. »Spiele interessierten ihn nicht, in den Freistunden las er fast immer Bücher, und die übrige freie Zeit verbrachte er mit Gesprächen mit den älteren Zöglingen.« Die Lektüre ist die Leidenschaft der beiden Dostojewskij-Brüder. »Fedja las vor allem historische Werke, aber auch Romane, besonders begeisterte er sich in jener Zeit für Walter Scott, Mischa liebte die Poesie und schrieb selbst Gedichte«, erzählt der jüngere Bruder Andrej Dostojewskij. »Bei Puschkin kamen sie überein, und kannten, so glaube ich, fast alle seine Gedichte auswendig.«
Den Unterricht in den Fächern Russische Sprache und Literatur, Fremdsprachen, Physik und Mathematik sowie Zeichnen erteilen Lehrer von bester Reputation. Besondere Verehrung bringen die Dostojewskij-Brüder ihrem Russischlehrer Nikolaj Biljewitsch entgegen. Er hatte gemeinsam mit Nikolaj Gogol die Schule besucht, ist mit bekannten Schriftstellern befreundet, ist selbst literarisch für verschiedene Zeitschriften tätig und übersetzt die Werke Friedrich Schillers ins Russische.
Der die Literatur liebende Pädagoge wird zum Vorbild für die Brüder, und in ihnen entsteht der Wunsch, nach dem Abschluss des Gymnasiums selbst eine literarische Laufbahn einzuschlagen. Dostojewskij sen. indes hält das Schreiben von Gedichten für wertlos. Er hat für seine beiden ältesten Söhne den Dienst als Militär-Ingenieure vorgesehen, der damals als besonders erfolgversprechend gilt. Drei Monate nach dem Tod der Mutter fährt der Arzt mit Michail und Fjodor nach Sankt Petersburg, wo die beiden an der Lehranstalt des Ingenieurkorps eine technische Ausbildung erhalten sollen. Der erste Eindruck der Hauptstadt des Russischen Reiches auf den damals fünfzehnjährigen Fjodor ist bleibend. »Petersburg schien mir immer geheimnisvoll – warum, weiß ich nicht. Seit früher Jugend, als ich mich dort fast vollkommen einsam und verlassen wiederfand, empfand ich Furcht vor dieser Stadt«, gesteht der Schriftsteller später.
Für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung bringt der Stabsarzt Michail und Fjodor im Pensionat von Koronad Kostomarow unter und reist allein zurück nach Moskau. Es wird ein Abschied auf immer.
Statt des »Schönen und Erhabenen«, das die Brüder sich ersehnen, sind sie in Sankt Petersburg jäh mit der korrupten Realität des Lebens konfrontiert. Die Bewilligung der Staatskanzlei Zar Nikolajs I. für ein Studium der beiden Brüder an der Lehranstalt auf Staatskosten, so die Brüder die notwendige Aufnahmeprüfung erfolgreich ablegen, erweist sich als wertlos. Obgleich Fjodor Dostojewskij »mit Auszeichnung« besteht, wird ihm kein Studienplatz auf Staatskosten zuerkannt, da angeblich alle Plätze bereits vergeben seien. Wie es dazu kam, ist leicht erklärt: Dostojewskij sen. hatte es unterlassen, den für die Aufnahme Verantwortlichen an der Lehranstalt diskret den erwarteten Geldbetrag zukommen zu lassen. »Wir, die wir uns für jeden Rubel abmühen, müssen bezahlen, während die Söhne wohlhabender Väter ohne Zahlung aufgenommen werden«, empört sich Fjodor. Glücklicherweise ist das Ehepaar Kumanin bereit, die Studiengebühren des Neffen zu übernehmen. Dem älteren der beiden Brüder wird die Zulassung zum Studium aus gesundheitlichen Gründen ganz verweigert. Er wird in ein anderes Ingenieurkorps abgeordnet und nach Reval versetzt. Fjodor muss von seinem engsten Gefährten Abschied nehmen.
Am 16. Januar 1838 tritt Fjodor Dostojewskij in Uniform und Tschako sein Studium an der Lehranstalt des Ingenieurkorps an. Die Fachhochschule ist im Michaelsschloss untergebracht, der einstigen Residenz des Zaren Pawel I., der dort am 11. März 1801 in seinem Schlafgemach ermordet worden war. Der prachtvolle Palast ist nach dem Erzengel Michael, dem Schutzpatron der Romanows, benannt, wird aber aufgrund seiner Nutzung auch Ingenieursschloss genannt. Obgleich das Niveau der Lehre in den Fächern Russische Sprache und Literatur sowie Allgemeine Geschichte verglichen mit anderen militärischen Fachhochschulen hoch ist, herrscht auch hier die eiserne Disziplin und der Drill der Epoche Zar Nikolajs I., der seit früher Kindheit leidenschaftlich begeistert ist für militärische Exerzitien und Paraden. »In der gesamten Lehranstalt gab es keinen Zögling, dem militärische Haltung derart fremd war wie Fjodor Dostojewskij«, erinnert sich der Kommilitone Konstantin Trutowskij. »Die Uniform saß schlecht, Ranzen, Tschako, Gewehr wirkten an ihm wie eine Büßerkette, die er eine gewisse Zeit lang zu tragen gezwungen ist und die ihn bedrückt.«
Der Konduktor Dostojewskij erträgt mit Würde die Schikanen und Spöttereien, mit denen die neuen Semester von den älteren in der Lehranstalt begrüßt werden. Er ist verschlossen und zurückgezogen, nimmt nicht an den gemeinsamen Vergnügungen teil und zieht deshalb besonders viel Bosheit auf sich. Statt sich den anderen anzuschließen, zieht er es vor, in der freien Zeit an einem Tisch in der Fensternische des Eckschlafzimmers zu sitzen und zu lesen, von der aus man auf die Fontanka, einen Seitenarm der Newa, blickt. »Bisweilen konnte man Fjodor Michailowitsch dort bis in den späten Abend hinein am Tisch arbeiten sehen«, erinnert sich einer seiner Lehrer. »Er hatte eine Decke über das Hemd geworfen und schien gar nicht zu bemerken, dass es durchs Fenster, an dem er saß, stark zog.«
Die technischen Disziplinen langweilen Fjodor, er beschäftigt sich lieber mit der Literatur, liest Schiller und Shakespeare, Goethe und Balzac und die Werke vieler anderer Autoren. Unter allen Schriftstellern der Weltliteratur ist Nikolaj Gogol für ihn einer der größten. Von Fjodors literarischer Leidenschaft werden einige Kameraden »angesteckt«, und es bildet sich ein Zirkel von Literaturliebhabern: Der spätere Maler Konstantin Trutowskij, der 1847 das früheste, eindringliche Porträt des jungen Dostojewskij zeichnet und als Illustrator der Werke Alexander Puschkins, Nikolaj Gogols und Taras Schewtschenkos bekannt wurde; der spätere Literat Dmitrij Grigorowitsch und Iwan Bereshezkij. Mit Bereshezkij, einem begabten, eleganten jungen Mann aus wohlhabender Familie, der wie Dostojewskij ein »homme isolé« war, verbindet ihn die Verehrung für Friedrich Schiller und das Mitgefühl für die Schwachen und Schutzlosen. Ihre Freundschaft endet jäh. »Es gab hier jemanden, einen Freund, den ich sehr liebte«, schreibt Fjodor seinem Bruder. »Ich paukte Schiller auswendig, sprach durch ihn, war hingerissen von ihm. Und ich glaube, dass das Schicksal mir nichts in meinem Leben so zur rechten Zeit geschickt hat wie die Bekanntschaft mit diesem großen Dichter. Die Freundschaft mit Bereshezkij hat mir viel gegeben – sowohl Kummer als auch Genuss. Und nun werde ich für den Rest des Lebens schweigen; der Name Schiller aber wurde mir vertraut wie eine Zauberformel, der so viel Traumhaftes bewirkt.«
Eine weitere romantische Freundschaft verbindet Fjodor mit dem Idealisten Iwan Schidlowskij. Dieser ist älter als Dostojewskij, hat eine Stellung am Finanzministerium, leidet aufgrund einer unglücklichen Liebe und schreibt mystisch-dunkle Gedichte. Auch von Schidlowskij muss Dostojewskij schon früh Abschied nehmen, als dieser Petersburg verlässt; aber er wird sich sein Leben lang an diesen für ihn wichtigen Freund erinnern, der »abgrundtiefe Widersprüche in sich vereinigte: Er besaß großen Verstand und viel Talent, was aber keinen Ausdruck in einem niedergeschriebenen Wort gefunden hat und mit ihm gestorben ist. Schidlowskij verzichtete auf die Karriere als Beamter, trat in einen Orden ein und wurde Mönch, kam in Katorga und ließ sich aus dem Eisen seiner Ketten nach der Freilassung einen Ring schmieden, den er immer trug und auf dem Sterbebett schluckte.«
Zwei Jahre nach dem Tod der Mutter erhält der siebzehnjährige Fjodor im Juni 1839 die Nachricht, dass sein Vater gestorben ist. Nachdem er seinen Dienst quittiert, den jüngsten Sohn, wie zuvor dessen Brüder, im Internat von Tschermak und die älteren Töchter Warwara und Vera bei den Kumanins untergebracht hatte, war Michail Andrejewitsch mit den beiden jüngeren Kindern auf das Landgut Darowoje gezogen. »Nach seinem harten fünfundzwanzigjährigen Dienst fand der Vater sich plötzlich in zwei, drei Zimmern des Hauses auf dem Landgut eingesperrt wieder und hatte keinerlei Gesellschaft«, berichtet Andrej Dostojewskij. Einsamkeit und Trauer um seine Ehefrau setzen ihm zu. Er trinkt mehr, als ihm guttut, und beginnt ein Verhältnis mit der Hausmagd Katerina. Die Landwirtschaft liegt danieder, die Einkünfte sinken. Gleichwohl nimmt Michail Dostojewskij Anteil am Leben seines Sohnes Fjodor in Sankt Petersburg und versucht, dessen ständigen Bitten nachzukommen, ihm Geld für Stiefel, einen neuen Tschako und die Begleichung von Schulden zukommen zu lassen. Ende Mai schickt er Fjodor ein weiteres Mal die gewünschte Summe, mit der Bitte, sie »sparsam auszugeben«. »Lebe wohl, mein lieber Freund«, schreibt er ihm, »Herr, unser Gott, segne Dich, das wünscht Dir Dein Dich liebender Vater«, beschließt er diesen Brief. Zehn Tage später ist er tot.
Die Todesumstände des Stabsarztes a. D. Michail Dostojewskijsind bis heute ungeklärt. Gesichert ist lediglich, dass er am 6. Juni auf dem Weg von Darowoje nach Tscheremoschnja bei 40 Grad Hitze unerwartet und rasch verstarb. Die amtlich festgestellte Todesursache lautete »Tod durch apoplektischen Schlag auf dem Feld«. Andrej Dostojewskij indes berichtet in seinen Erinnerungen, der Vater sei von den auf dem Feld arbeitenden leibeigenen Bauern erschlagen worden. Unzufrieden mit ihrer Feldarbeit »geriet Vater in Wut und schrie die Bauern an«, heißt es dort. »Einer der Bauern, der dreisteste von allen, antwortete auf dieses Schreien mit grober Frechheit und rief dann, weil er es mit der Angst vor den Folgen seiner Frechheit bekam: ›Leute, sein letztes Stündlein hat geschlagen!‹, und mit diesem Ruf stürzten sich alle, insgesamt fünfzehn Personen, auf ihn und brachten Vater ums Leben … Wie die Geier reisten die Mitglieder einer sogenannten Untersuchungskommission aus Kaschira an, die selbstredend zuerst einmal in Erfahrung brachte, wie viel die Bauern für die Einstellung des Verfahrens bezahlen könnten. Ich weiß nicht, auf welche Summe sie sich einigten, ich weiß auch nicht, woher die Bauern die sicherlich nicht unbedeutende Summe genommen haben, ich weiß lediglich, dass die Untersuchungskommission zufrieden war. Vaters Leichnam wurde anatomiert und dabei kam man zum Ergebnis, der Tod sei aufgrund eines apoplektischen Schlags eingetreten.« Die Familie sei dieser offiziellen Version gefolgt, so Andrej Dostojewskij weiter, und habe die Bauern für den Tod des Vaters nicht zur Verantwortung gezogen, da sie nach einer Verurteilung wegen Mordes zur Katorga nach Sibirien geschickt worden wären, was den wirtschaftlichen Ruin der Hinterbliebenen bedeutet hätte.
Die Darstellung Andrej Dostojewskijs, dass der Vater ermordet worden ist, wurde lange Zeit von den Biographen übernommen. Michail Dostojewskij sen. wurde zu einem Despoten, Geizhals und hemmungslosen Trinker, in der Sowjetzeit darüber hinaus zu einem »grausamen Gutsbesitzer und Feudalherrn«. Zugleich wurde die Version der Ermordung Grundlage psychoanalytischer Mutmaßungen über Fjodor Dostojewskijs Seelenverfassung. In seinem 1928 publizierten Aufsatz Dostojewski und die Vatertötung legt Sigmund Freud dar, der junge Fjodor Dostojewskij habe sich in einer ambivalenten Hassliebe zum Vater unbewusst dessen Tod gewünscht. Dies habe in ihm lebenslange Schuldgefühle hervorgerufen, die schließlich Auslöser für die in späteren Jahren auftretende Epilepsie Dostojewskijs, gleichsam »als eine Selbstbestrafung für den Todeswunsch gegen den gehassten Vater« gewesen sei. Diese psychoanalytische These hat das Dostojewskij-Bild für lange Zeit geprägt. Wenngleich in den 1960er Jahren eine Untersuchung der historischen Dokumente nachzuweisen versuchte, dass Michail Dostojewskij eines natürlichen Todes gestorben sei, gelten die Umstände seines Todes bis heute als ungeklärt.
»Ich habe viele Tränen über Vaters Tod vergossen«, schreibt Fjodor seinem Bruder Michail am 16. August 1839. »Nunmehr ist unsere Situation noch furchtbarer, als sie es ohnehin schon war, wobei ich nicht von mir, sondern vom Rest der Familie spreche. Sage mir doch, ob es auf der Welt unglücklichere Menschen als unsere Geschwister gibt? Der Gedanke, dass sie nun von Fremden aufgezogen werden, bringt mich um.« Die »Fremden«, die sich der jüngeren Geschwister annehmen, ist das Ehepaar Kumanin. Dostojewskijs Lieblingsschwester Warwara heiratet 1840, von den Kumanins mit großzügiger Aussteuer versehen, den vierzigjährigen Witwer Pjotr Andrejewitsch Karepin.
Mit dem Tod des Vaters ist die mehr oder minder unbeschwerte Jugend Fjodors zu Ende. Der Verlust beider Eltern innerhalb von zwei Jahren zwingt den Siebzehnjährigen, vorzeitig erwachsen zu werden. Von nun an kann er nur mehr auf sich selbst zählen. »Ich glaube an mich selbst«, schreibt er seinem Bruder und Vertrauten Michail. »Der Mensch ist ein Geheimnis. Dieses muss man durchdringen, und möge dies auch ein ganzes Leben lang in Anspruch nehmen, so sage nicht, dass dies verlorene Zeit sei. Ich beschäftige mich mit diesem Rätsel, denn ich will ein Mensch sein.« Dafür müsse er frei sein und diesem Ziel sei er gewillt, alles unterzuordnen.
Debüt als Schriftsteller
Im August 1841 wird Dostojewskij zum Ingenieur-Fähnrich befördert. Dies ist zwar nur der unterste Offiziersrang, verleiht aber das Recht, außerhalb der Lehranstalt zu wohnen. Mit seinem Kommilitonen Adolf von Totleben mietet Dostojewskij eine in der Nähe des Ingenieurschlosses gelegene Wohnung in der Karawannaja Uliza im Zentrum der Stadt. An den Abenden schließt er sich in seinem Zimmer ein, raucht Pfeife und schreibt. Aus seinen Dramen Maria Stuart und Boris Godunow liest er seinen Freunden vor. Von diesen ersten literarischen Versuchen Dostojewskijs sind heute nur noch die Titel bekannt.
Das Schreiben ist jedoch nicht die einzige Beschäftigung des jungen Offiziers. Dostojewskij entdeckt das brodelnde Leben der Hauptstadt, besucht Theater, versäumt nicht eines der Konzerte des Pianisten Franz Liszt, der bei seinen Gastspielreisen durch Europa in der Hauptstadt des Russischen Reiches Station macht, und begeistert sich für die italienische Tänzerin Marie Taglioni, den Star des romantischen Balletts, die seit 1837 in Sankt Petersburg als erste Meisterin des Spitzentanzes Erfolge feiert. Mit seinen Freunden diniert er in Restaurants, nimmt an Offiziersfeiern teil und sucht sein Glück im Spiel. »In der ersten Zeit nach der Beförderung zum Offizier begeisterte sich mein Bruder sehr für das Kartenspiel, wobei der Abend mit Spielen wie Préférence und Whist begonnen wurde und unweigerlich mit Glücksspielen wie Pharo oder Stoß endete.«
Diese Arten des Zeitvertreibs kosten erhebliche Summen Geld. In diesen Jahren macht Dostojewskij erstmals Bekanntschaft mit der Welt der Pfandhäuser, Darlehen, Wechselbriefe und Zinsen. Der junge Arzt Alexander Riesenkampf