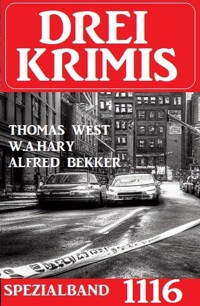
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Dieses Buch enthält folgende Krimis: (399) Thomas West: Routinejob mit Todesfolge W.A.Hary: Aus dem Kreis geschleudert Alfred Bekker: Der Mann mit der Seidenkrawatte Die Agentin Natalia Ustinov soll auf Nobel Cooper aufpassen, der aus einer Organisation aussteigen will, die sich mit allen möglichen illegalen Dingen beschäftigt. Diese Organisation will seine Aussage natürlich verhindern. Natalia hat alle Hände voll zu tun, Cooper zu beschützen. Kommissar Harry Kubinke und sein Kollege Rudi Meier erfahren von einem großangelegten Verschwörungsplan. Die Sicherheit der Bundeshauptstadt Berlin steht auf dem Spiel. Aber Kubinke und sein Team haben kaum einen Ansatzpunkt für Ermittlungen. Eine Teenagerin hat zuviel gehört und stirbt, ein dubioser Ex-Agent scheint mehr zu wissen, ein Profi-Killer tritt in Aktion und ein Mann mit einer Vorliebe für Seidenkrawatten glaubt, dass seine grausame Rechnung aufgehen wird…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Drei Krimis Spezialband 1116
Inhaltsverzeichnis
Drei Krimis Spezialband 1116
Copyright
Routine-Job mit Todesfolge
Aus dem Kreis geschleudert
Der Mann mit der Seidenkrawatte
Drei Krimis Spezialband 1116
von Alfred Bekker, W.A.Hary, Thomas West
Dieses Buch enthält folgende Krimis:
Thomas West: Routinejob mit Todesfolge
W.A.Hary: Aus dem Kreis geschleudert
Alfred Bekker: Der Mann mit der Seidenkrawatte
Die Agentin Natalia Ustinov soll auf Nobel Cooper aufpassen, der aus einer Organisation aussteigen will, die sich mit allen möglichen illegalen Dingen beschäftigt. Diese Organisation will seine Aussage natürlich verhindern. Natalia hat alle Hände voll zu tun, Cooper zu beschützen.
Kommissar Harry Kubinke und sein Kollege Rudi Meier erfahren von einem großangelegten Verschwörungsplan. Die Sicherheit der Bundeshauptstadt Berlin steht auf dem Spiel. Aber Kubinke und sein Team haben kaum einen Ansatzpunkt für Ermittlungen. Eine Teenagerin hat zuviel gehört und stirbt, ein dubioser Ex-Agent scheint mehr zu wissen, ein Profi-Killer tritt in Aktion und ein Mann mit einer Vorliebe für Seidenkrawatten glaubt, dass seine grausame Rechnung aufgehen wird…
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Routine-Job mit Todesfolge
Krimi von Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 112 Taschenbuchseiten.
Ein Terroranschlag in Kairo hatte neunzehn Todesopfer und über achtzig Verletzte gefordert – fast alle amerikanische Touristen. Der Hauptattentäter, der US-Staatsbürger George Brown, wurde von der ägyptischen Polizei gefasst, weitere Terroristen arabischer Herkunft konnten fliehen, der Drahtzieher, ein fundamentalistischer Scheich, untertauchen. Eine Auslieferung Browns an die USA wurde von der ägyptischen Regierung verweigert, aber man erteilt die Erlaubnis, den Täter zu verhören. Gemeinsam mit einem CIA-Agenten soll FBI Agent Jesse Trevellian die Vernehmung in Kairo durchführen. Er glaubt an einen einfachen Routine-Job, doch bald schon muss er gegen gefährliche, von Hass getriebene Terroristen um sein Leben kämpfen ...
1
Ein Kreisverkehr, ziemlich groß. Pkws, Trucks, Busse. Passanten vor Fassaden auf Bürgersteigen – vertraute Fassaden einer westlichen Großstadt, exotische Fassaden einer orientalischen Stadt. Auch die Verkehrsinsel irgendwie exotisch: Ein pyramidenartiger Brunnen im Zentrum; Wege, die wie Strahlen zum Straßenring führten und kleine Trapeze von Grünflächen durchtrennten. Auch dort Fußgänger, klein wie Ameisen; unmöglich, Einzelheiten ihrer Bekleidung zu benennen. Eine normale Straßenszene für eine Großstadt eigentlich, von einem Fenster zwanzig Meter über der Stadt gefilmt, ohne Ton. Im Vordergrund sah man Zinnen, rechts im Bild Palmen, und auf der anderen Seite des Kreisverkehrs ragten Minarette neben Hochhäusern in den Himmel. Und plötzlich ein Lichtblitz, eine Rauchwolke, und umherfliegende Trümmer.
Irgendjemand stieß einen Fluch aus, irgendjemand atmete geräuschvoll ein. Ich senkte den Blick, deckte meine Augen mit der Hand zu. Ich glaube, die meisten anderen machten es genauso.
„Neunzehn Tote, dreiundachtzig Verletzte“, sagte Jonathan McKee in einem Tonfall, dessen ruhige Sachlichkeit den Schrecken dessen, was meine Augen eben gesehen hatten, noch vertieften.
„Vier Monate her“, fuhr der Chef fort. „Vor drei Wochen haben die ägyptischen Behörden einen der Haupttäter gefasst.“
Es war mein erster Tag nach drei Wochen kanadischer Wildnis, nach drei Wochen Naturromantik und Naturrealismus – Ungeziefer, Schlangen und Bären zum Beispiel – drei Wochen auf unwegsamen Pfaden zwischen dem Winnipeg See und der Hudson Bay.
„Himmel, hört das denn nie auf?“, stöhnte Jennifer Johnson.
Am Abend zuvor hatte Milo mich vom Flughafen abgeholt, eine dreiviertel Stunde zuvor war er an der vertrauten Straßenecke zu mir in den Sportwagen gestiegen, eine halbe Stunde zuvor hatte ich zum ersten Mal seit drei Wochen wieder das Büro meines Chefs betreten. Und jetzt diese Bilder. Es war zum Davonlaufen. Und es war mein Job, sie auszuhalten.
„Nein“, murmelte ich. „Scheinbar hört das nie auf.“
Mr. McKee spulte das Videoband zurück. „Ich weiß nicht, ob Ihnen die Täter aufgefallen sind, Gentlemen, schauen wir uns den Streifen noch mal an.“
„Ist das die Aufnahme, die man damals zehnmal am Tag auf allen Fernsehkanälen zu sehen bekam?“, wollte Milo wissen.
„Richtig. Die Täter haben den Anschlag vom neunten Stock eines Hotels am Kreisverkehr gefilmt.“
„Ich erinnere mich gut“, sagte Medina. „Ein arabischer Sender hat die Bilder als erster gebracht. Der Pöbel in der Altstadt von Kairo und in Bethlehem hat auf der Straße getanzt.“
Mein Gedächtnis sträubte sich – und rückte trotzdem die Schlagzeile der New York Post heraus, die sich mir an jenem Dienstag vor vier Monaten eingebrannt hatte: Krieg gegen US-Bürger! Wer stoppt die Teufel?
Viele Opfer aus der Touristengruppe vor der Moschee waren US-Amerikaner gewesen, die meisten von ihnen Juden.
„Sehen Sie genau hin, Gentlemen.“ Die Leinwand an der Stirnseite des Raumes flammte erneut auf, der Beamer unter der Decke ließ die Straßenszene wieder lebendig werden. Neunzehn Menschen waren noch am Leben, dreiundachtzig noch unverletzt.
„Könnte man die Zeit zurückdrehen, wie ein Videoband“, murmelte Jennifer neben mir.
Wieder Pkws, Trucks, Busse, wieder Palmen, orientalische Fassaden, Minarette – und jetzt nahm ich die westlichen Touristen bewusster wahr: Sie strömten aus dem Doppelportal einer Moschee. Ihr Bus wartete knapp dreißig Meter nach dem Kreisverkehr in einer Parkbucht. Seine Türen standen offen, in kleinen oder größeren Gruppen näherte sich ihm die Menge der Touristen auf einem schmalen Weg. Die ersten kletterten bereits in das Fahrzeug.
„Sehen Sie den weißen Kleinbus?“ Jonathan McKee hielt das Bild an, deutete mit einem Leuchtmarker auf den Wagen am Straßenrand der anderen Fahrbahnseite. „Ein Datsun.“
Er ließ den Film weiterlaufen. Der Kleinbus scherte aus einer Parklücke auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wendete in einer scharfen Kurve, und blieb direkt hinter dem Reisebus stehen. Ein Mann stieg aus.
„Das ist er.“ Wieder schaltete der Chef auf Standbild. „George Ruben Brown, siebenundzwanzig Jahre alt, in Louisville, Kentucky, zur Schule gegangen, Studium der Elektrotechnik und des Maschinenbaus in Chicago.“
„Ein US-Amerikaner unter islamistischen Terroristen ...!“ Orry pfiff durch die Szene.
„Hatten wir schon, wie Sie wissen“, sagte der Chef. „Bekanntlich gibt es ja nichts Neues unter der Sonne.“
Ich war nicht sicher, ob Mr. McKee hundertprozentig Recht hatte: Der junge Walker aus Kalifornien war zwar fanatischer Moslem geworden und kämpfte auf Seiten der Taliban, sprengte aber keine Mitbürger in die Luft. Der mörderische McVeigh tötete in Oklahoma City zwar über zweihundert Amerikaner mit einer Bombe, war aber kein fanatischer Moslem.
„Der Junge muss in den Monaten nach dem elften September konvertiert sein“, sagte Clive Caravaggio. „Jedenfalls glaubt das seine Mutter. Seit Dezember 2001 hat er sich nicht mehr bei ihr gemeldet.“
Der Chef vergrößerte das Standbild. Ein breitschultriger Mann wurde erkennbar – braun gebranntes Gesicht, Sonnenbrille, rotbrauner Vollbart, rotbraunes Haar bis zu den Schultern.
„Diese Bilder einem Fernsehsender zu schicken war reine Dummheit oder Selbstüberschätzung. Aber wo ist da schon der Unterschied?“ Jonathan D. McKee ließ den Film weiterlaufen. „Die Kollegen in Kairo begriffen schnell, dass sie es mit keinem Araber zu tun hatten.“
Jetzt sah man den Mann über die Straße rennen. Auf der anderen Seite schwang er sich auf den Rücksitz eines langsam vorbeirollenden Motorrads, die Maschine beschleunigte. Drei Herzschläge später der Lichtblitz, umherfliegende Trümmer- und Leichenteile, Rauchschwaden.
„Oh, Shit!“, rief Jay Kronburg.
„Schon bevor ägyptische Sicherheitsbehörden die Bilder sahen, fragten sie sich, warum der Täter sich nicht selbst mit in die Luft gesprengt hat, wie es sonst bei diesen Fanatikern üblich ist.“ Der Chef schaltete Beamer und Videogerät aus. „Tja, und dann die Filmaufnahmen – sie bestätigten ihren Verdacht. Ein Ausländer war der Täter.“
„Orientalisch sieht Georg Brown weiß Gott nicht aus“, sagte Jay. „Trotz des Bartes.“
„Kriegen wir ihn?“, wollte Leslie Morell wissen.
„Leider nicht.“ Jonathan McKee ließ sich auf einem freien Stuhl nieder. „Das State Department hat seine Auslieferung natürlich sofort nach der Festnahme beantragt. Immerhin sind US-Staatsbürger angegriffen worden und ums Leben gekommen.“
Der Chef sah mich an, wölbte die weißen Brauen, und plötzlich ahnte ich, wo ich die nächsten Tage verbringen würde. „Dürfen wir ihn wenigstens vernehmen?“, fragte ich. Wahrscheinlich wollte ich meine Vorahnung so schnell wie mögliche widerlegt hören. Aber daraus wurde nichts.
„Ja, Jesse. Ein Spezialist der CIA und ein FBI-Agent werden nach Kairo fliegen und mit Brown sprechen. Auch die Verhörprotokolle dürfen wir einsehen.“
„Darf ich einen Tipp abgeben?“ Milo grinste müde. „Washington hat bei uns angefragt.“
„Ich bewundere Ihren Instinkt, Milo.“ Mr. McKee schmunzelte. „Stimmt. Das Hauptquartier hat angefragt. Nun wissen Sie selbst, dass uns die Arbeit geradezu erdrückt in diesen Wochen, Gentlemen.“
Sein Blick wanderte von einem zum anderen. „Jeder von Ihnen ist mit mehr als nur einem Fall beschäftigt.“ Sein grauen Augen blieben an mir hängen.
Plötzlich hörte ich die Hudson Bay rauschen, Nordwind fegte durch Birken- und Eichenwipfel, und über die Flammen eines Lagerfeuers lächelte mich eine Frau an. „Ich nicht, Sir“, sagte ich. „Bin gestern erst aus dem Urlaub zurückgekommen.“
„Stimmt genau, Jesse.“ Jonathan McKee schmunzelte nicht mehr. “Und? Würden Sie den Auftrag übernehmen?“
Mein Blick traf den meines Partners. Endlich wieder Seite an Seite mit Milo den Job zu tun, für den ich nun mal geboren wurde, war der einzige Trost gewesen im Abschiedsschmerz von Urlaub, kanadischer Wildnis und jener Frau. Und jetzt Kairo?
„Was soll’s, Sir. Arbeit ist dazu da, um erledigt zu werden, schätze ich ...“
2
„Schade eigentlich.“ Milo zuckte mit den Schultern. „Freu mich schon das ganze Wochenende endlich wieder in einem angemessenen Wagen durch den Big Apple zu pirschen –“ Die Lifttür schob sich auseinander. „– und jetzt schicken sie dich an den Nil.“
„Ach? Du hast meinen Sportwagen vermisst? Na, wenigstens den!“
„Dachtest du etwa, ich würde dich vermissen?“ Milo schlenderte in den Lift, er mimte den Verblüfften. „Woher denn! Es sind diese spartanischen Dienstwagen, die ich satt habe, kapierst du? Ich will es wieder kitzeln spüren im Bauch, ich will wieder aus einem roten Flitzer den Damen unseres Städtchens zuwinken ...!“
Mit einem Stapel Unterlagen und ein paar Zeitungen unter dem Arm und ein paar CD-Roms in der Tasche trat ich neben Milo in den Aufzug.
„Kairo ist noch mal wie Urlaub. Gönn mir doch den soften Übergang vom Urlaub in den Job. Und gönn dir noch ein paar Tage Vorfreude auf meinen Sportwagen. Wenn ich Ende der Woche aus Kairo zurück bin, darfst du meinen Schlitten waschen – ist das eine Perspektive oder nicht?“
„Ich weiß nicht, wie ich dir jemals danken soll!“ Milo machte Anstalten, vor mir auf die Knie zu fallen. So albern gebärdete er sich eigentlich nur, wenn er besonders gut drauf war; oder wenn ein langweiliger Auftrag auf ihn wartete.
Wir fuhren in unser Büro im sechsundzwanzigsten Stock hinauf. „Gib zu, du platzt schier vor Ungeduld, willst mir doch endlich erzählen, wie du einen Grizzly verführt und eine Indianerin k.o. geschlagen hast.“ Milo hielt mir die Tür auf.
Unser Büro. Drei Wochen lang hatte ich keinen Gedanken daran verschwendet. Keinen!
Ich ließ den Unterlagenstapel auf meinen Schreibtisch fallen. Milo warf seinen PC an, ziemlich hektisch war er. „Aber leider bin ich den ganzen Tag in Manhattan unterwegs“, sagte er. „Einwanderungsbehörde, Zollamt, und in der Lower East Side sind ein paar schräge Vögel zu überprüfen.“
Er schaltete den Drucker ein, zog seine SIG-Sauer. „Wie wäre es, wenn wir heute Abend italienisch essen gehen? Das >Mezzogiorno< hat uns lange nicht gesehen. Luigi wird sich freuen, dich mal wieder zu Gesicht zu kriegen. Und dann darfst du mir endlich von kanadischen Braunbären, Frauen und Sonnenuntergänge vorschwärmen“
„Und wenn ich was Besseres vorhabe?“ Ich ließ mich in meinen Bürosessel fallen, legte die Beine auf den Schreibtisch.
„Gib dir keine Mühe“, grinste Milo. „Mich provozierst du nicht.“ Er riss eine Patronenschachtel auf und begann das Magazin seiner Dienstwaffe zu füllen. „Das Beste für Dich heute Abend ist es, mit mir essen zu gehen. Und solltest du tatsächlich schon was vorhaben –“, er zwinkerte mir zu. „– dann bring das Zweitbeste einfach mit.“
Er versenkte seine Dienstwaffe im Holster an seinem Gürtel. „Ich freue mich immer eine interessante Frau kennenzulernen.“
„Ich werde drüber nachdenken, hab ja sonst nichts zu tun.
„Ernst beiseite, Jesse. Passt mir nicht, dass sie dich nach Kairo schicken.“
„Ach?“
„Hab so ein saublödes Gefühl, kann’ s gar nicht richtig in Worte fassen.“ Mit dem Knie knallte er die Schreibtischschublade zu. „Der Job am Nil scheint mir nicht ungefährlich zu sein. Punkt.“
„Unsinn, reine Routine.“
„Na, hoffen wir’s.“ Schon war Milo an der Tür und winkte. „Bis heute Abend, Special Agent Trevellian. Und dass Sie mir die Akten nicht mit Kaffee bekleckern! Sind Staatseigentum.“
Ich schnappte die New York Times und warf sie nach ihm. Sie traf die zufallende Tür. Irgendwie war es doch schön, wieder zu Hause zu sein.
3
„Schneller, Daddy! Schneller!“ So weit schwang sie zurück, dass sie für einen Augenblick Daddys Schuhspitzen sehen konnte. Dann fühlte sie wieder seine Hände auf ihrem Rücken, seine großen, starken Hände. „Höher, Daddy! Noch höher!“
Die großen, starken Hände stießen sie an. Weg waren seine Schuhspitzen, der Boden unter ihr flog dahin, der Sandkasten, das Karussell, die Bäume, der Zaun, die Straße, die Baumwipfel, dann der blaue Himmel. „Yea, Daddy! Yea, das ist schön!“
Irgendetwas tanzte in ihrem kleinen Bauch, etwas, das kitzelte. Und zurück ging es: Baumwipfel, Zaun, Karussell, Sandkasten, Daddys Schuhspitzen, und wieder seine Hände. „Noch höher, Daddy! Noch höher!“
„Kommt nicht infrage! Du wirst mir noch von der Schaukel fallen!“
„Dann fängst du mich eben auf!“ Sandkasten und Karussell glitten erneut unter ihr vorbei, und hinauf ging es über die Baumwipfel in den Himmel. Ein blauer Pick-up hielt auf der Straße hinter Daddys Silberwagen.
Und hinunter ging es – wie schön das kitzelte im Bauch! Die Kette rasselte, die Scharniere quietschten, das wuchtige Holzgestell aus nur grob bearbeiteten Eichenstämmen knarrte, und dann wieder Daddys Hände, und dann wieder hinauf.
„Erzähl, Daddy! Erzähl die Geschichte von Little Suzy und dem Räuber!“
„Während du schaukelst?“ Daddy zierte sich, das kannte sie schon.
„Höher! Erzähl! Schneller!“
„Also gut. Little Suzy ist vier Jahre alt ...“
„Bald fünf“, krähte sie, fiel gegen seine Hände, rauschte wieder nach oben. „Yea ...!“
„... sie geht mit ihrem Daddy in die große Stadt. Wie hoch sind dort die Häuser, und wie viele Menschen gehen dort auf den Bürgersteigen! Wie viele Autos fahren auf der Straße, und wie breit ist der Fluss ...!“
Und Daddy erzählt, und Little Suzy ist glücklich, und Daddys Hände stoßen sie himmelwärts, und Little Suzy ist glücklich. Sie schwingt Richtung Straße und Himmel, fällt zu Daddys Schuhspitzen zurück und auf seine starken Hände.
Ein Mann steigt aus dem blauen Pick-up, er trägt einen grauen Overall. Er ist ziemlich groß und ziemlich dünn.
Daddy erzählt, wie Little Suzy und er in der großen Stadt den großen Zoo besuchen, wie sie auf einem Schiff den Potomac herunterfahren, bis Little Suzy nur noch Wasser sehen kann, nur noch Meer. Daddy erzählt, wie Little Suzy und er mit dem Fahrstuhl bis zum Dach des höchsten Hauses der großen Stadt hinauffahren, wie sie das Weiße Haus des Präsidenten besuchen, und wie Daddy danach mal eben zu einer Telefonzelle gehen muss.
Little Suzy wartet ein paar Schritte neben der Telefonzelle, ein Wagen hält am Straßenrand, öffnet die Beifahrertür, winkt mit einer Tafel Schokolade. Komm zu mir, Little Suzy, sagt er, fahr mit mir, Little Suzy.
„Er sieht lieb aus“, erzählt Daddy. „Man sieht ihm nicht an, dass er ein Räuber ist.“
„Ein böser Räuber!“, ruft Little Suzy. Vom Himmel schwingt sie zurück gegen Daddys starke Hand, und von Daddys starker Hand zurück in den Himmel.
Der Mann im grauen Overall schraubt an einem Schild am Zaun vor dem Spielplatz herum. Er ist kein Schwarzer, wie Mr. Reynolds, der Englisch-Lehrer von Robby, aber seine Haut ist doch dunkler als Daddys Haut. Er hat kurzes, schwarzes Lockenhaar, lange Koteletten und einen sehr schmalen Backen- und Kinnbart.
„’Fahr doch mit mir, Little Suzy’, sagt der Mann, dem man nicht ansieht, dass er ein böser Räuber ist“, erzählt Daddy. „’Ich habe ganz viel Schokolade’. Und was sagt Little Suzy da?“, fragt Daddy, während er sie erneut dem Himmel entgegenstößt.
„Nein!“, brüllt Little Suzy auf der Schaukel, und Dad brüllt mit, und noch einmal: „Nein!“
„Sehr gut, Little Suzy“, sagt Daddy. „Und wenn der Räuber, der so lieb aussieht, trotzdem weiter winkt und mit dir redet?“
„Dann rufe ich meinen Daddy“, sagt Little Suzy, und schreit ganz laut: „Daddy!“
Der Mann im grauen Overall ist fertig mit seiner Arbeit, er geht zurück zu seinem Pick-up, aber nicht direkt: Er dreht eine Schleife um Daddys Silberwagen, geht dahinter in die Hocke, taucht drei Atemzüge später wieder auf und steigt in seinen Pick-up. Little Suzy glaubt, er hat sich die Schuhe zubinden müssen.
„Und wenn Daddy oder Mommy nicht gleich kommen, was macht Little Suzy dann?“, will Daddy wissen.
Die Schaukel schwebt über Sandkasten, Karussell und den davonfahrenden Pick-up. „Dann schreie ich ganz laut: ‚Ein Räuber! Hilfe, Hilfe, ein Räuber!’“ Und sie schreien gemeinsam: „Ein Räuber! Hilfe, Hilfe, ein Räuber!“
Später stiegen sie in Daddys Silberwagen, das schönste Auto von Rushville und ganz Virginia. Zeit für’s Kino. „Man sieht es ihnen nicht an, Daddy?“
„Was meinst du, Honey?“ Daddy rangierte den Wagen aus der Parkbucht und sah auf die Uhr. Dachte er schon wieder an seine Arbeit?
„Man sieht den bösen Räubern nicht an, dass sie böse Räuber sind, hast du gesagt.“
„Ja, Honey, leider. Oft sieht man es ihnen nicht an ...“
4
Gar nicht einfach, sich in die übliche Routine zu stürzen, wenn man am Tag zuvor noch in den Wäldern Nordkanadas einen Schwarm Wildgänse der aufgehenden Sonne entgegenfliegen sah; und dabei – ich gestehe – eine süße Frau in den Armen hielt.
Ja, so war es gewesen: Wir hielten uns fest, und wie die Kinder versuchten wir die unweigerliche Trennung hinauszuschieben; Minute für Minute hinauszuschieben, Sekunde für Sekunde. Aber was erzähle ich Ihnen ...
Jedenfalls brauchte ich eine geschlagene Stunde, bis ich meine Unterlagen und Datenträger in zwei Stapel sortiert hatte: Einen mit den Ermittlungsberichten zu dem Terroranschlag in Kairo, den anderen mit vertraulichen Dokumenten der CIA und einem ausführlichen Dossier über George Brown und seine Familie.
Letzterer stammte übrigens zum größeren Teil von der NSA, dem Inlandsgeheimdienst. Ich begann mit den Polizeiberichten aus Kairo.
Mit zweihundert Kilogramm Sprengstoff war das weiße Fahrzeug vollgepackt gewesen. Doppelt so viele Todesopfer hätte es gegeben, wäre es dem Attentäter gelungen die tödliche Ladung an der Längsseite des Busses zu stoppen.
Die Kollegen aus Kairo hatten Hinweise darauf, dass der Sprengstoff aus Beständen der ägyptischen Armee stammte. Ein Offizier, den man verdächtigte, es gestohlen zu haben, wurde bei der Verhaftung erschossen, ein zweiter konnte fliehen.
An Stellen wie diesen blieben die Berichte merkwürdig im Ungefähren.
Den Motorradfahrer hatten die Kollegen in Kairo immerhin identifiziert – ein gewisser Massud al-Rashed. Ein Foto von schlechter Qualität lag dem Bericht bei.
Der Mann sah aus, wie diese Leute halt aussehen: bärtig, schwarzhaarig, von dunklem Teint. Orientalisch eben. Trotz der unscharfen Aufnahme fielen mir die Augen des Mannes auf: Sie hatten etwas Stechendes, Starres.
Al-Rashed hatte sich nach dem Bombenanschlag in Richtung Hindukusch absetzen können. Agenten des israelischen Mossad wollten ihn im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet gesehen haben.
Nichts Genaues, schon gar keine Hinweise auf Verbindungsleute in den Vereinigten Staaten. Ich griff zum nächsten Blatt.
Auf der Suche nach den Drahtziehern des Anschlags waren die ägyptischen Behörden auf eine Spur gestoßen, die zu einem fundamentalistischen Scheich führte. Einer von der Sorte, die beim Freitagsgebet offen zur Gewalt aufriefen. Der Bericht enthielt ein paar Zitate aus seinen Predigten. Unappetitlich.
Saif al-Jaqub hieß der Fanatiker, er unterhielt Kontakte zu al-Qaida. Allein die Indizien dafür umfassten dreiundzwanzig Seiten. Al-Jaqub residierte bis zu jenem Massenmord am Kreisverkehr in einer kleinen Moschee in der Altstadt von Kairo. Seit der Bluttat war er spurlos verschwunden.
Interessanter Mann, unheimlicher Mann – ich legte sein Foto und seine Vita zur Seite.
Unter achtundzwanzig Verdächtigen, die Kairos Sicherheitsbehörden wegen des Anschlags festgenommen hatten – allesamt Mitglieder radikaler Moslem-Bruderschaften – hatten zwei Drittel mehr oder weniger intensiven Kontakt zu Saif al-Jaqub. Einer davon entpuppte sich gar als sein Privatsekretär – ein gewisser Abdul Shallah.
Allmählich wurde es spannend. In meinem Sakko fischte ich nach meinem Notizbuch. Wer kann sich schon all die fremdartigen Namen merken?
Telefonisch orderte ich eine Kanne Kaffee bei Mandy. Bevor die Sehnsucht nach Kanada und nach einer gewissen Lady meiner Trekking-Group sich erneut in meinem Hirn einnisten konnte, versenkte ich mich wieder in die Papierflut.
Die Verhörprotokolle waren schwer zu lesen. Ein ägyptischer Protokollant, der sich nach dem Feierabend sehnt, spickt sein Protokoll mit Abkürzungen und arabischen Spezialbegriffen; einem amerikanischen Übersetzer, dem eine durchgezechte Nacht in den Knochen steckt, bleibt gar nichts anderes übrig, als den englischen Text mit Fragezeichen und Fußnoten zu spicken oder aber seiner Fantasie freien Lauf zu lassen.
So ungefähr müssen Sie sich das vorstellen. Es wird halt überall nur mit Wasser gekocht.
Immerhin erfuhr ich, dass George Brown und Abdul Shallah nicht nur Kommilitonen und Hausgenossen, sondern auch enge Freunde waren. Shallah hatte in Chicago studiert und er hatte gestanden, mit Brown ein halbes Jahr in einem Ausbildungslager der al-Qaida verbracht zu haben. Außerdem räumte er ein, den Anschlag logistisch vorbereitet zu haben. Ich fragte mich, mit welchen Verhörmethoden die Ägypter zu derartigen Geständnissen kamen. Shallah war so gut wie tot.
Aber weg mit solchen Fragen. George Brown gestand überhaupt nichts. Weder seine Täterschaft, noch seine Beziehungen zu jenem Terrorscheich, und schon gar nicht dessen Aufenthaltsort.
Er schwieg eisern – jedenfalls vermittelten die Verhörprotokolle diesen Eindruck – abgesehen von den stereotyp wiederholten Forderungen nach Kontakten zum US-Konsulat und einem amerikanischen Anwalt. Auf fast jeder Seite las ich dergleichen. Ein zäher Bursche, weiß Gott.
Am späten Vormittag fuhr ich zwei Stockwerke nach unten und holte mir eine Thermoskanne Kaffee ab. Die braune Brühe brachte meine Lebensgeister in Schwung.
Weiter ging es, drei Pfund Verhörprotokolle lagen noch vor mir.
Die Ägypter konfrontierten Brown mit Hinweisen der CIA auf eine Terrorzelle in den USA – Brown schwieg. Sie konfrontierten ihn mit angeblichen Aussagen Shallahs, wonach Brown allein schuldig und einsamer Drahtzieher des Bombenschlags sei – Brown schwieg. Sie konfrontierten ihn mit seiner zu erwartenden Hinrichtung – George Brown schwieg.
Ich schob die erste CD ins Laufwerk. Sie enthielt Bilddateien: Fotos des zerstörten Busses und des Platzes und Bürgersteiges zwischen dem Wrack und der Moschee: Blechfetzen, Tote, Glassplitter, Leichenteile, und mittendrin Rettungskräfte, die sich um Schwerverletzte bemühten.
Ich fand eine Datei mit Fotos von George Brown – Frontalaufnahmen, Profilaufnahmen. Im Bartgestrüpp sah man wulstige Lippen, seine rotbraunen Augenbrauen wuchsen über dem Nasenrücken zusammen. Mit dem langen, auf die Schultern fallenden Haar und den leuchtenden, wasserblauen Augen erinnerte er mich an alte Kitschbilder, die Jesus von Nazareth mit viel Öl, heroischer Miene und weichen Farben auf Leinwand bannten.
Verzeihen Sie, es war einfach so.
Später stand ich am Fenster und blickte über die Skyline Manhattans und in die Straßenschluchten der Steinwüste unter mir, die seit so vielen Jahren mein Zuhause war. Bald würde ich in einem Gebäude im Zentrum Kairos sitzen und einem jungen Landsmann mit einer Menge Blut an den Händen in die Augen sehen.
Ich konnte es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Und ich fragte mich, was einem amerikanischen Jungen widerfahren musste, bis er in ein Ausbildungslager von Terroristen ging und bis er seine eigenen Landsleute in die Luft sprengte ...
5
Gegen sechs holte Milo mich ab. Wir fuhren ein Stück den Broadway hinauf und dann rechts ins nördliche China Town hinein. Im Parkhaus an der Leonard Street, Ecke Lafayette Street stellte ich meinen Sportwagen ab.
Etwas mehr als eine halbe Meile ist es von dort aus bis in die Spring Street, wo unsere Stammpizzeria liegt. Wir gingen zu Fuß, ich wollte es so.
War schön nach drei Wochen Waldboden wieder heimatlichen Asphalt unter den Schuhsohlen zu spüren, war schön den Verkehrslärm rasseln zu hören, Fassaden statt Bäume oder Berge rechts und links in den Himmel ragen zu sehen und die ersten Neonreklamen an lauten Kreuzungen, statt der ersten Sterne über stillen Buchten und Seen aufleuchten zu sehen.
Verstehen Sie das? Ich auch nicht.
Milo erzählte mehr oder weniger lustlos von seinem Auftrag – er und ein Dutzend Kollegen verfolgten die Spuren illegal eingewanderter Männer aus dem Orient. Die CIA hatte Hinweise auf Terrorzellen, die im Begriff waren, sich in den Metropolen der Vereinigten Staaten zu bilden.
Spürbar begeisterter berichtete er von einer Frau mit dem schönen Namen Beatrice, die er Wochen zuvor in einem Nachtclub in der East Side kennengelernt hatte, und mit der er seitdem fast jeden zweiten Tag durch den Central Park ritt. Die Lady besaß ein Gestüt und war Reitlehrerin.
Das wäre die Gelegenheit gewesen von jener Lehrerin in Detroit zu erzählen. Ich ließ es bleiben. Wir hatten uns vorgenommen, einander zu vergessen.
Die Neonreklame über dem Eingang des >Mezzogiorno< tauchte im Geflimmer auf, rückte näher, lud ein. Hinein in die gute Stube unserer Stammpizzeria. Luigi, der Wirt, führte uns zu einem der beiden Tische am Fenster, an denen wir meistens saßen, erkundigte sich höflich nach meinem Ergehen, machte ein paar Scherze, brachte die Karte, und so weiter.
Auch das war ein Stück nach Hause kommen.
Als wir dann unseren Chianti schlürften und Weißbrot mit Kräuterbutter dazu kauten, bedauerte ich, New York City in zwei Tagen wieder verlassen zu müssen.
„Los, erzähl“, forderte Milo mich auf. Also berichtete ich von meiner Trekking-Tour durch die Wildnis der kanadischen Wälder, von den neun anderen Zivilisationsflüchtlingen, mit denen ich unterwegs war, von unserem Scout, einem Halbindianer aus Saint Louis. Von Nächten unter freiem Himmel erzählte ich, von langen Märschen durch Urwald und Steppe, von Orkas, die ich in der Hudson-Bay über Wellenfurchen springen sah, von Elchen an Flussufern, von Schwarzbären, die ich von fern über Lichtungen laufen sah.
Jene Sommerliebe, von der ich mich so schweren Herzens getrennt hatte – die Lehrerin aus Detroit – erwähnte ich mit keinem Wort. Keine Ahnung, warum nicht. Vielleicht, um die nur oberflächlich schlafende Wehmut nicht zu wecken.
„Einen Grizzly habe ich nicht zu Gesicht bekommen“, sagte ich nach dem Hauptgang. „Jedenfalls keinen vollständigen.“ Ich griff in die Sakkotasche und holte das Geschenk heraus, das ich für meinem Partner mitgebracht hatte. „Für dich.“
Milo spitzte die Lippen, zog überrascht die Brauen hoch und betrachtete das kleine, in buntes Papier gewickelte Päckchen. „Womit habe ich das verdient?“
„Überhaupt nicht, aber ich wollte dir noch mal eine Chance geben.“
Milo wickelte das Mitbringsel aus dem Papier – ein schwarzes Ledersäckchen kam zum Vorschein. Er schnürte es auf und zog eine Kette aus Grizzlykrallen heraus. „Wow!“ Er hielt den Indianerschmuck in Augenhöhe, drehte und wendete ihn, legte ihn sich schließlich über den Krawattenknoten. “Danke!”
“Kein Feind kann dir schaden, wenn du das trägst, keine Kugel dich töten“. Ich hob mein Glas. Verwundert sah Milo mich an. „Hat mir der alte Cree-Schamane prophezeit, dem ich die Kette abgekauft hatte. Er behauptete übrigens den Grizzly selbst erlegt zu haben.“
Wir lachten, und ich legte Milo die Kette um den Hals. Luigi und sein Kellner kamen, um meinen Partner zu bewundern, neugierige Blicke von den anderen Tischen.
„Hoffentlich hast du für dich auch so einen Schutz-Zauber besorgt“, sagte Milo.
„Wozu? Ich mach nur einen kleinen Ausflug nach Kairo, und wenn ich zurück komme, wird das Ding ja sowieso in meiner Nähe sein.“ Genau das sagte ich.
Ein paar Tage später dachte ich daran, und fand es weiß Gott nicht mehr witzig.
6
Da saßen sie nun, unter dem warmen Licht der Küchenlampe an dem großen, runden Tisch, alle die wichtig waren in Little Suzys kleiner Welt: Die großen Geschwister Debby und Robby und Jenny und Marc; und Daddy und Mommy natürlich; und der Mittelpunkt ihrer Welt: Little Suzy selbst.
Schön, sie alle um sich zu haben. Schön, zu Hause zu sein.
Schön, wenn Daddy zu Hause ist, vor allem. Daddy war öfter unterwegs als zu Hause.
Little Suzy summte ein Lied, während sie im Pudding herum stocherte; ein Lied, dass sie heute im Kindergarten gelernt hatte.
„Ins Bett, Prinzessin“, sagte Mommy nach dem Essen.
„Daddy, du musst mir eine Geschichte erzählen, sonst kann ich nicht schlafen“, sagte die Prinzessin.
„Daddy hat keine Zeit, er muss noch mal ins Büro.“ Daddys Büro lag in einem riesigen Haus ein paar Meilen entfernt von Rushville.
„Immer musst du ins Büro“, schmollte Little Suzy.
Daddy kam zu ihr, Daddy nahm sie in die Arme, Daddy kitzelte und küsste sie. Little Suzy kicherte und war glücklich.
Daddy fuhr ins Büro, die Familie verteilte sich im Haus. Mommy setzte sich zu Little Suzy an den Bettrand und erzählte ihr die Gute-Nacht-Geschichte. Eine Geschichte von Big Old Arnie – eine Figur, die Little Suzys Fantasie entstammte – der in einer Rakete um die Welt raste, jeden Abend die Sterne zählte, ob auch keiner geklaut worden war, und den Schlaf kleiner Mädchen bewachte.
Zum Schluss beteten sie. „Lieber Gott“, betete Little Suzy, „pass auf Daddy auf. Sieh zu, dass er heil nach Hause kommt, und vor allem nicht abstürzt, wenn er bald mit dem Flugzeug wegfliegt. Am besten machst du, dass er gar nicht wegfliegt. Amen.“
Mommy sang, bis Little Suzy die Augen zufielen. Mommy ging auf Zehenspitzen hinaus.
Irgendwann wachte Little Suzy auf. Es war so unheimlich dunkel. Durch die Ritzen in den Jalousien glitten hin und wieder Lichtbalken vorbei, wenn draußen auf der Straße ein Auto vorbeifuhr. Zu jedem Lichtbalken fiel ihr eine Geschichte ein.
Ein Lichtbalken schließlich glitt nicht vorbei. Grell blieb er an der Decke über der Tür stehen. Ein Motor brummte draußen auf der Straße; ein Motor, dessen Gebrumm sich genauso wenig in der Ferne verlieren wollte, wie der Lichtbalken seiner Scheinwerfer im dunklen Zimmer.
„Daddy?“
Little Suzy schlang die Arme um Arnie, ihren großen, schwarzen Teddy. Sie drückte ihn an sich, das tat gut. Nur wollte der Lichtbalken nicht verschwinden, und das Motorengeräusch sich nicht entfernen.
Arnie in den Armen stand sie auf, lief barfuß zum Fenster, spähte durch die Ritzen der Jalousien. Ein dunkler Pick-up stand unten gegenüber der Garteneinfahrt. Ihr Herzchen klopfte. Im Schein der Straßenbeleuchtung glaubte sie einen dünnen Mann hinter dem Steuer sitzen zu sehen. Hatte er nicht sogar einen schmalen Kinnbart?
„Daddy!“
So schnell sie konnte, lief sie aus ihrem Zimmer, lief den Gang hinunter bis zur Treppe, stieß die Tür vor der Treppe auf – die Tür ins Schlafzimmer von Mommy und Daddy.
Licht flammte auf, Daddy war längst zu Hause. Little Suzy sprang ins Bett, kuschelte sich an ihn, weinte.
„Was ist denn los, Honey?“ Daddys verschlafene Stimme. Zärtlich streichelte er ihren Rücken.
„Ein Räuber ...“, schluchzte sie. „Der vom Spielplatz ...“
„Hast du ihr schon wieder eine dieser Geschichten erzählt?“, sagte Mommy.
„Kann schon sein.“
„Bullshit! Sie hat davon geträumt, siehst du mal, was du anrichtest. Sie hat Angst!“
„Irgendwie muss man die Kids doch vorbereiten“, sagte Daddy. „Irgendwie muss man sie doch warnen. Die Welt ist nun mal so, wie sie ist.“
Little Suzy begriff nicht, was Mommy und Daddy da redeten.
7
Auf dem Weg vom >Mezzogiorno< zum Parkhaus an der Leonard Street – diesmal nahmen wir ein Taxi – geschah etwas Merkwürdiges. Das Taxi hielt vor einer Ampel auf dem Broadway. Eine Menge Fußgänger drängten sich auf dem Zebrastreifen, so viele, als wollten zehn Schulklassen auf einmal die Straße überqueren.
Die Ampel sprang auf Grün, aber nichts ging mehr: Die Fußgänger dachten nicht daran, die Straße freizugeben. Trotz der Trennscheibe hörten wir den Fahrer fluchen. Ein Hupkonzert erhob sich.
Die Menge der Fußgänger – überwiegend junge Leute, fiel mir plötzlich auf – bewegte sich überhaupt nicht von der Stelle. Wie auf ein Kommando gingen sie auf einmal alle in die Knie, einige legten sich sogar auf die Straße, und alle deuteten sie zur Menschentraube auf dem Bürgersteig.
Auch dort Dutzende von Kids im Licht der Schaufenster und Straßenbeleuchtung. Die hingen irgendwie mit denen auf dem Zebrastreifen zusammen, wie die Spitze einer Brandung von der anderen Straßenseite, und an der Hausfassade brach sie sich.
Die Menge auf dem Bürgersteig hatte sich geteilt, gab den Blick auf zwei große, beleuchtete Schaufenster frei, und jeder einzelne aus ihr deutete dorthin, wo auch die Leute auf dem Bürgersteig hinzeigten – auf die beiden Schaufenster.
Es waren Schaufenster eines Bestatters. Ein paar Särge und etliche Urnen waren darin mit Kerzenleuchtern und Blumengestecken arrangiert.
Der ganze Spuk dauerte nicht länger als zwei Minuten. Danach löste sich die Menge auf, das Hupkonzert legte sich, der Verkehr rollte weiter.
„Um Himmels Willen! Was war das denn?“, rief ich.
„Ein Flash Mob. Noch nicht gehört?“ Milo wirkte nicht sonderlich amüsiert plötzlich. „Verbreitet sich seit drei Wochen um die ganze Welt, die Sitte. Aus heiterem Himmel rotten sich hundert oder zweihundert Leute zusammen, treffen sich an einer Brücke in London, ziehen einen Schuh aus, und während sie auf den Knien über die Brücke kriechen, schlagen sie mit dem Schuh auf den Asphalt ...“
„Wie bitte ...?“
„... oder dreihundert Leute strömen wie aus dem Nichts auf einem Bahnhof in Toronto zusammen, recken die Arme nach oben und deuteten auf die Bahnhofsuhr, auf der es genau fünf vor zwölf ist, und sechzig Sekunden später ist alles vorbei. Wird über Handy oder E-Mail organisiert.“
„Nicht zu fassen.“ Ich schüttelte den Kopf. „Und was soll das?“
„Leute verschrecken, oder just for fun.“ Wir schwiegen den Rest der Fahrt.
Auch an diese Begebenheit erinnerte ich mich in den folgenden Tagen. Wie ein böses Omen erschien sie mir im Rückblick.
8
Eine abscheuliche Nacht folgte. Ich träumte, ich stünde vor eine Moschee, legte den Kopf in den Nacken und starrte zum Minarett hinauf. „Gott ist groß!“, brüllte der Muezzin. Und: „Lauf, was du kannst, Jesse, sonst stirbst du!“ Auf Englisch rief er das.
Auf einmal merkte ich, dass ich eine Kette aus Grizzly-Klauen trug, und dass der Muezzin blonde Haare hatte.
Es war Milo. „Lauf, Jesse, lauf!“, brüllte er.
Ich lief los – das heißt, ich wollte loslaufen, doch meine Beine schienen durch noch nicht vollständig erstarrten Beton zu waten. Ich kam kaum vom Fleck.
Panik presste mir den Brustkorb zusammen, irgendjemand zerrte von hinten an der Kette mit den Grizzly-Klauen, zerrte und zerrte, schnürte sie zusammen, bis ich keine Luft mehr bekam. Die Krallenspitzen drangen in das Fleisch meines Halses ein, die Lederschnur schnürte mir die Kehle zu.
Auf einmal wusste ich mit schmerzhafter Klarheit, dass es vorbei war, dass es aus war, und ich sterben würde, ja, sterben. Vergeblich versuchte ich die spitzen Klauen zu fassen. Irgendwie gelang es mir wenigstens, mich umzudrehen, um dem Tod in die Augen zu sehen.
Ich sah – in George Browns Gesicht.
Erschrocken fuhr ich hoch, stöhnte, wischte mir den Schweiß von der Stirn. Ein Blick auf den Wecker – 5.43 Uhr. Ungefähr die Zeit, zu der die Morgensonne über Kanadas Wäldern mich in den letzten Wochen geweckt hatte.
Ich stand auf, ging zum Fenster, schob die Jalousie nach oben. Die Baumgruppen und Wäldchen im Central Park sahen aus, wie Korallenriffe in einem Meer aus Dunst. Über der glitzernden Skyline Manhattans stand ein Stern wie ein rötlicher Scheinwerfer.
Ein Stern! Trotz der vielen Lichter!
Der Mars, schätzte ich. In der New York Times hatte ich gelesen, dass er der Erde zurzeit so nah stand, wie es erst wieder im Jahr 2287 der Fall sein würde. Ausgerechnet der Mars, der römische Kriegsgott. Herzlichen Glückwunsch!
Ich machte mir einen Kaffee und briet ein paar Eier. Nach Dusche und Frühstück schlug ich die Unterlagen auf, die ich mit nach Hause genommen hatte. „George Brown“, stand auf dem Deckblatt. „Geboren am 5. November 1976.“
Ich glaube, ich hatte das Deckblatt schon in der Hand, um umzublättern. Aus irgendeinem Grund ließ ich es bleiben, stand auf und ging in mein Schlafzimmer ans Fenster.
Der Mars verblasste bereits, die Dunstschwaden über dem Central Park lösten sich auf, im Osten erhob sich die Morgensonne über dem Horizont aus Hochhausgipfeln. Die ersten Jogger bewegten sich über die Parkwege. Von meinem Fenster aus sahen die Wege aus wie graue Risse in einem grünen Glas und die Jogger wie Obstfliegen auf einer angefaulten Melone.
Später las ich Milo an unser Straßenecke auf. Schweigend fuhren wir über den Broadway und hörten die Acht-Uhr-Nachrichten, jedenfalls hörte Milo sie.
Als WCBS anschließend den neusten Song von Everett brachte – ich stehe auf diesen weißen Burschen mit der schwarzen Stimme – sagte Milo: „Was ist los, Jesse? Du siehst schlecht aus irgendwie.“
Ich antwortete erst an der nächsten roten Ampel. „Hast du heute Nacht den Mars am Himmel gesehen?“
Er schmunzelte. „Beatrice wollte, dass ich ihn mir ansehe. Sie glaubt, die rote Funzel am Himmel bedeutet Mord und Totschlag.“ Er sah mich von der Seite an und grinste. „Weiber ...“
9
Ein vorletzter Kuss in den Nacken, ein letzter auf die Stirn, und einer auf beide Augen, aber der zählte nicht. Arme hüllten Little Suzy ein, Arme, wie eine schwere Heizdecke. Daddys Arme.
„Immer musst du weg.“ Little Suzy schmollte. Mommy zog die Brauen und den rechten Mundwinkel hoch.
„Das ist so bei Vätern“, sagte Daddy. „Sie müssen Geld verdienen, damit deine Schwestern und Brüder in die Schule gehen können, damit ihr ein Dach über dem Kopf und was zu essen habt. So ist die Welt, Honey, so war sie schon immer.“ Er zwickte sie in die Nase, lächelte, stand auf und küsste Mommy.
Und ging.
Da war so ein Drehkreuz, da ging Daddy durch. Sie stellten seine Tasche auf ein Laufband, die Tasche verschwand in einem Kasten aus Metall. Sie strichen ihm mit einem Ding über Beine, Rücken und Brust, das wie ein Handspiegel aussah.
Später standen sie Hand in Hand auf der Besucherterrasse und sahen zu, wie Daddys Flugzeug in den blauen Himmel hinaufstieg. Wolken schwebten unter der blauen Himmelskuppel, eine sah aus wie ein riesiger Baum. Little Suzy stellte sich vor, wie Daddy zu diesem Baum hinauffliegt, in seine Krone klettert und einen goldenen Apfel pflückt, den er ihr mitbringen würde, wenn er zurück nach Hause kam.
Zurück nach Hause.
Irgendwie tröstete sie diese Vorstellung. Daddys Flugzeug verwandelte sich in ein silbrig gleißendes Fischchen inmitten des unendlichen Himmelblaus, und kurz darauf war es untergetaucht, war verschwunden, war einfach weg.
Schade. Aber würde ja wiederkommen – mit einem goldenen Apfel. (Oh Gott, Little Suzy! Meinst du wirklich, er wird zurückkommen?)
Mommy nahm sie an der Hand. Sie gingen in die Flughalle, sie gingen ins Parkhaus, sie gingen hinauf in das Deck, wo Daddys Silberwagen stand, das schönste Auto von ganz Rushville, ja von ganz Virginia.
Mommy ließ die Zentralverriegelung aufspringen, zog die Hintertür auf. Little Suzy wollte loslaufen, wollte auf den Kindersitz auf der Rückbank klettern. Sie konnte es nicht.
Sie konnte es nicht?
Nein, da stand ein blauer Pick-up nur wenige Schritte vom schönsten Auto Virginias entfernt. Little Suzy musste ihn anstarren, sie musste einfach; und einige Atemzüge lang war ihr Herzchen ein Spatz, der in den Fängen einer Katze hing und mit den Flügeln schlug.
Aus großen Augen starrte sie das Fahrzeug an, viele Herzschläge lang. Mommy zog die Brauen hoch.
Little Suzy drehte sich um. Wo der blaue Pick-up stand, konnte der böse Räuber nicht weit sein; der große, dürre Mann mit den Koteletten und dem dünnen Kinnbart. Dem Mann, dem man nicht ansah, wie böse er war.
Doch sie konnte niemanden entdecken.
„Was ist denn?“ Mommy kam zu ihr, ging neben ihr in die Hocke. „Was ist los, little Suzy?“
„Ich hab Angst.“
„Brauchst keine Angst haben.“ Mommy umarmte sie, schlang ihre warmen Arme um Little Suzys kleinen Leib. „Gott passt auf deinen Daddy auf, seine Maschine kann gar nicht abstürzen ...“
10
Briefing beim Chef, Mandys Kaffee, ein paar Worte mit den Kollegen und danach allein im Büro. Allein mit dem Dossier zu George Brown und seiner Familie.
Sein Vater John, Jahrgang 1952, war Berufssoldat gewesen. In Vietnam als Hubschrauberpilot verwundet und hochdekoriert, verbrachte er sein halbes Leben auf irgendwelchen US-Stützpunkten im Ausland: Italien, Deutschland, Indonesien. 1991 kam er im ersten Golfkrieg ums Leben, als sein Hubschrauber in das Feuer der eigenen Truppen geriet.
Tragische Geschichte.
George Browns Mutter Paula war britische Staatsbürgerin, Schottin, um es genau zu sagen. Sie hatte einige Jahre lang als Köchin für die Royal Navy gearbeitete. Bei einem NATO-Manöver im Mittelmeerraum lernte das Paar sich kennen. Es heiratete in Glasgow, lebte drei Jahre auf einer Militärbasis in Süditalien, wo George Brown und seine Schwester auch geboren wurden.
1983 wurden die Brown-Sprösslinge schulpflichtig, und die Army versetzte ihren Vater auf eine Heimatbasis in der Nähe von Washington D.C.
Das Dossier enthielt einen ganzen Stapel von Zeugnissen aus der Schulzeit des Attentäters. Alles in allem war er immer ein gleichbleibend guter Schüler gewesen, vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern. Das College schloss er sogar mit Auszeichnung ab.
Ich fand ein paar Belobigungen, eine Menge Urkunden über Siege seiner Football-Mannschaft, deren Kapitän er im College von Louisville und in der Universität von Chicago gewesen war. Die Schuldokumente enthielten nicht den geringsten Hinweis auf eine mögliche Entwicklung zu einem fanatischen Gewalttäter. Ganz im Gegenteil. Kein Bruch, kein Ausrutscher, keine Krise, nichts. Nicht einmal in dem Jahr, in dem sein Vater starb.
Ein All-American-Boy also? Sah ganz danach aus. In dieses Bild des Durchschnittsjungen passte sogar der einzige Tadel, den er während seiner Highschool-Zeit kassierte: Er hatte ein M-16 Gewehr mit in die Schule gebracht und gemeinsam mit ein paar Mitschülern außerhalb des Schulgeländes auf streunende Katzen geschossen.
Einer Anmerkung der CIA zu dieser Episode entnahm ich, dass Brown junior wie sein Vater ein Waffennarr war.
Nun gut, auch diese Vorliebe ist unter männlichen US-Amerikanern keine Ausnahme; leider nicht.
Über die Studienzeit gaben die Unterlagen nicht viel her. Studium der Elektrotechnik und des Maschinenbaus in Chicago, wie gesagt. Dort hatte er mindestens zwei Kommilitonen aus Nahost. Einer hieß Muhammed Bin Kawina, den zweiten glaubte die NSA als Abdul Shallah identifizieren zu können.
Im Jahr 1999 landete George Brown zum ersten Mal für zwei Tage in einer Gefängniszelle und für den Rest seines Lebens in den Akten der Polizei von Washington State: Teilnahme an den wilden Demonstrationen während des WTO-Gipfels in Seattle.
Merkwürdig: Zu Beginn des Jahres 2001 belegte er Orientalistik. Kommentar der CIA: „Vermutlich wollte Brown Arabisch lernen.“ Warum? Der Bericht schwieg sich aus.
Im gleichen Jahr folgte eine Reise nach Jordanien, eine nach Ägypten. Letzter Anruf bei der Mutter in Louisville am zweiten Weihnachtsfeiertag, in den Wochen davor wahrscheinlich der Übertritt zum Islam.
Danach verlor sich seine Spur. Was trieb George Brown im Jahre 2002? Was 2003 in den Monaten vor dem Bombenanschlag?
Ich lud mir noch mal die Fotos des Jungen auf die Festplatte, überflog noch einmal die Ermittlungsergebnisse der ägyptischen Polizei, und stand danach ziemlich ratlos am Fenster meines Büros.
Was für ein Mensch war dieser junge Mann aus Louisville, Kentucky?
Sicher – während der Pubertät verlor er seinen Vater, und sicher: Er war kritisch genug, vielleicht auch wütend genug, um nach Seattle zu reisen und gegen die Politik der Weltwährungsfonds und der globalen Wirtschaftskapitäne zu protestieren. Aber reichte so etwas aus, um zum Massenmörder zu werden?
Ich fragte mich, welche Kraft in der Welt stark genug sein mochte, um aus einem an sich unauffälligen amerikanischen Jungen einen islamistischen Terroristen zu machen.
Das Telefon schreckte mich aus meinen Grübeleien auf. Ich ging zum Schreibtisch und nahm ab. Mandy war am Apparat. „Mr. McKee lässt ausrichten, dass Mr. Aboud angekommen ist.“
„Aboud?“ Ich begriff nicht sofort.
„Simon Aboud, der Kollege aus Langley. Er wird Sie doch nach Kairo begleiten, wussten Sie das noch gar nicht, Jesse?“ Mandy wirkte ein wenig irritiert.
„Doch, sicher, Mandy. Mir war nur der Name entfallen“, sagte ich. „Danke, ich komme gleich.“
Mr. McKee hatte von einem Spezialisten der CIA gesprochen. Hatte er auch den Namen erwähnt? Ich wusste es nicht mehr.
Jene Lehrerin aus Detroit übrigens hieß Jessica Lewis. Das wusste ich noch genau. Und dass ihre Küsse nach süßem Wein schmeckten, wusste ich auch.
Ein Blick auf die Uhr: Kurz nach eins. Hielt ich mich tatsächlich schon geschlagene vier Stunden in meinem Büro auf?
Ich räumte die Unterlagen zusammen, schloss sie weg, machte mich auf den Weg in Jonathan McKees Büro.
11
Wenn man nicht zufällig wusste, was Simon Aboud für einen Job machte, hätte man ihn ohne Weiteres für einen Steuerbeamten oder einen Bibliothekar halten können oder für einen Wirtschaftsprofessor oder für einen Arzt oder für den Chefredakteur einer Computerzeitschrift, oder, oder ...
Niemals jedenfalls für einen CIA-Agenten.
Mittelgroß war er und ein wenig korpulent. Mit seinem reichlich lichten und an den Schläfen angegrauten Haar und seiner nicht eben fabrikneuen Hornbrille sah er irgendwie, nun ja, sagen wir: unsportlich aus.
Sein Händedruck war fest, sein fleischiges Gesicht freundlich, seine Stimme dunkel und die dunklen Augen hinter den dicken Brillengläsern hellwach.
„Haben Sie das Dossier über Brown schon gelesen, Jesse?“, fragte er gleich nach der Begrüßung.
„Ich bin noch dabei, aber das Wesentliche habe ich gelesen.“
„Und?“ Wir saßen am Konferenztisch des Chefs. Ich erinnerte mich gehört zu haben, dass Aboud Spezialist für Orientalistik war. Man konnte also davon ausgehen, dass er einigermaßen fließend Arabisch sprach und mit islamischer Tradition und Geschichte vertraut war. Was er sonst noch alles auf dem Kasten hatte, wusste zu diesem Zeitpunkt nicht einmal der Chef.
„Ich frage mich, was aus einem durchschnittlichen amerikanischen Jungen einen fanatischen Mörder macht“, sagte ich.
„Kein Schicksal, kein Gott, keine gesellschaftlichen Einflüsse.“ Aboud redete wie einer, der sich seiner Sache sicher war, und zwar absolut sicher. „Nur eine einzige Kraft schafft so was.“ Er klopfte sich mit der Faust gegen die Brust. „Der freie Wille eines Menschen.“
„An solchen Fragen haben sich schon ganze Generationen von Soziologen und Psychologen die Zähnen ausgebissen, Gentlemen“, meldete Mr. McKee sich zu Wort. „Ihre Antworten wechselten mit den Herbstmoden. Unsere Branche dagegen hatte im Wandel der Zeiten immer die gleiche Aufgabe: Männer wie Brown vor ihre Richter zu bringen ...“
„... und ihre Taten wenn möglich zu verhindern“, unterbrach ihn der CIA-Mann. „Und dazu, mein lieber Jonathan, ist Jesses Frage unumgänglich: Wir müssen nach den Motiven solcher Massenmörder fragen!“
„Ich habe das Dossier ebenfalls gelesen.“ Mr. McKee blieb gelassen. „Was mich viel mehr interessiert ist die Frage, ob Brown Hintermänner in den Vereinigten Staaten hat.“
„Davon sind wir in Langley überzeugt.“ Simon Aboud vergaß seinen Eifer. „Nicht nur Hintermänner, sogar gut organisierte kleine Terrorzellen bei uns in den Staaten sind es, die Leute wie ihn rekrutieren. Ohne ihre Logistik und Informationskanäle hätte er weder seine Reisen in den Nahen Osten unternehmen können, noch wäre die Touristengruppe so gezielt ausgewählt worden.“
„Warum schaffen wir es nicht, Leute von ihnen für unsere Arbeit zu rekrutieren?“, sagte der Chef leise und ohne einen von uns anzublicken.
Aboud ging nicht darauf ein, und ich auch nicht. „Ihr glaubt, die Opfer seien schon vor ihrer Abreise nach Kairo ausspioniert worden?“ Diese Neuigkeit überraschte mich.
„Ja.“ Aboud nickte, seine Augen bekamen etwas Lauerndes. „Einige Agenten von uns sind in Boston verdächtigen Männern aus dem Jemen auf der Spur gewesen. Sie haben das Telefon eines jordanischen Studenten abgehört, der Kontakt mit diesen Männern hatte. Dieser Jordanier führte in den Monaten vor dem Bombenanschlag achtzehn Telefonate mit einem Reisebüro in Washington, das für mindestens sieben der Opfer den Flug nach Kairo und das Hotel gebucht hat.“
„Und was ist aus dem Studenten und den Jemeniten geworden?“, erkundigte sich Mr. McKee.
Aboud senkte den Blick und zuckte mit den Schultern. „Wie vom Erdboden verschwunden. Seit dem Anschlag.“
Eine etwas peinliche Pause trat ein. Zum ersten Mal, seit ich mit Aboud im selben Raum war, wirkte er nicht mehr ganz so selbstbewusst.
Der Chef räusperte sich. „Für uns von der Bundespolizei geht es bei Browns Vernehmung in erster Linie um seine möglichen Kontakte zu Terrorzellen in den USA. Das ist mit dem Hauptquartier und der Heimatschutzbehörde so abgesprochen.“
„Ich weiß“, sagte Aboud. „Wir in Langley sehen das ähnlich. Allerdings kommt für uns noch ein zweiter Punkt hinzu, und der ist mit dem Pentagon abgesprochen.“
„Nämlich?“ Der verschwörerische Unterton in Abouds Stimme machte mich nervös.
„Wir haben Hinweise darauf, dass Islamisten, die der al-Qaida nahestehen, einen Anschlag auf Beamte nordamerikanischer Sicherheitsbehörden planen, und wir glauben, dass Brown in diesen Plänen eine Schlüsselrolle spielt.“
12
Anschließend saß Aboud zwei Stunden lang mir gegenüber an Milos Schreibtisch. Wir gingen die Unterlagen noch einmal gemeinsam durch – Polizeiberichte, Verhörprotokolle, Personendossiers, Laborberichte; bis wir den Eindruck hatten auf dem gleichen Informationsstand zu sein.
„Ihr in Langley glaubt also, dass Terroristen aus Browns Umfeld es auf uns abgesehen haben?“ Ich stellte die Frage, als wir am frühen Abend im Lift zur Tiefgarage hinunter fuhren. Abouds Warnung ließ mir keine Ruhe.
„Korrekt, Jesse. Euer Hauptquartier weiß Bescheid.“
„Nicht, dass ich neugierig bin, aber was beabsichtigen deine und meine Häuptlinge dagegen zu unternehmen?“ Die Aufzugstüren schoben sich auseinander. Die Tiefgarage dehnte sich vor uns aus. Jonathan McKee, Milo und Mandy warteten bereits neben einem Dienstwagen. „Es geht immerhin um meine Haut“, sagte ich.
„Keine Sorge, Kollege.“ Schwer legte sich seine Hand auf meine Schulter. „Wir haben ein paar unserer besten Agenten aus Jordanien, Syrien und dem Sudan in Kairo zusammengezogen. Und von eurer Firma drücken sich auch ein paar Undercover-Leute in der Altstadt herum.“
„Wie beruhigend.“ Ungefähr von diesem Augenblick an wollte es mir nicht mehr gelingen, die bevorstehenden Reise nach Kairo unter der Rubrik Routinejob abzubuchen.
Es folgte ein Arbeitsessen auf Staatskosten. Keine Ahnung, warum Mr. McKee das damals arrangierte. Ein Signal Richtung Langley, nehme ich an, eine kleine Geste, die seinen Wunsch nach guter Zusammenarbeit zum Ausdruck bringen sollte. Er hat eben Stil, mein Chef.
Milo steuerte den grauen Mercury in Mr. McKees Lieblingsrestaurants in der Warren Street – 'München' hieß es. Raten Sie mal, welche Küche man dort pflegte.
Richtig.
Ein kluger Schachzug des Chefs, Mandy mitzunehmen. Natürlich waren ihm die wohlgefälligen Blicke aufgefallen, mit denen Simon Aboud nach ihr spähte, und außerdem erwies sich Mr. McKees Sekretärin mal wieder als Meisterin des Small Talks.
Gemeinsam mit Milo verwickelten sie den Spezialisten aus Langley in Plaudereien, die ihn nicht nur sein Lieblingsthema vorübergehend vergessen ließen – Krieg gegen den Terror –, sondern ihm so manche persönliche Information entlockten.
So erfuhren wir bei Schweinshaxe, Sauerkraut, Knödeln und hellem Bier – nur unser Kollege von der CIA trank Wasser –, dass Simon Abouds Vater ein Ingenieur aus Beirut und seine Mutter Krankenschwester und Tochter eines Viehzüchters aus San Antonio, Texas, war.
Außerdem ließ er raus, dass er sieben Jahre lang für die US-Navy gearbeitet hatte – als „Sonderoffizier für Spezialeinsätze“, wie er sich ausdrückte – bevor ihn die CIA engagierte.
Und einmal ins Reden gekommen, begann er von arabischer Kultur und Geschichte zu schwärmen. „Wir hätten keine vernünftige Mathematik ohne sie, unsere Naturwissenschaften wären ohne sie nicht halb so weit entwickelt, wie sie es sind“, behauptete Aboud. „Wissen Sie zum Beispiel, woher unser Begriff ‚Algebra’ stammt, Jesse?“
Ich wusste es nicht, und Milo und der Chef hatten glücklicherweise auch keinen Tipp.
„Von dem arabischen Wort ‚al-gabr’. Das bedeutet ‚Einrenken getrennter Teile’, verstehen Sie, Gentlemen? Mohammed verlangt in der vierten Sure des Korans, dass ein Mann, wenn er stirbt und drei Töchter hinterlässt, den Töchtern zwei Drittel seines Besitzes vererbt, seinen noch lebenden Eltern ein Drittel und seiner Witwe ein Achtel. Nun knacken Sie mal eine solche Nuss, Gentlemen! So kam die Menschheit zur höheren Mathematik!“
Ähnliches wusste er von der Astronomie zu sagen, die von den Moslems in Bagdad und Granada entwickelt wurde, um den genauen Beginn der täglichen fünf Gebetszeiten festlegen zu können.
„Ohne diese hochkultivierten Männer aus Damaskus und Bagdad und Kairo wüssten wir so gut wie nichts von Aristoteles und Euklid. Und heute versetzen ihre Nachkommen die Welt als lebende Bomben in Angst und Schrecken ...“ Seine Miene verfinsterte sich.
„Einige wenige ihrer Nachkommen“, korrigierte Mandy.
Aboud überhörte das. „Einer dieser bewundernswerten Gelehrten hat im elften Jahrhundert die Grundlagen der modernen Optik und der Geometrie gelegt und die erste Lochkamera gebaut, stellen Sie sich das vor, Gentlemen! Ein gewisser, wie hieß er gleich ...?“
„Al Hazen“, sagte Mandy in aller Gelassenheit.
Simon machte große Augen. „Stimmt. Woher wissen Sie das, Ma’am.“ Seine Stimme war ganz belegt vor Ehrfurcht.
„Nun –“ Mandy zuckte mit den Schultern. „Frauen lesen hin und wieder auch mal ein Buch.“
Unserem Spezialisten war der Wind aus den Segeln genommen, und Mandy erzählte von einem Roman um einen mittelalterlichen arabischen Mediziner.
Als wir das Restaurant mit dem schönen Namen 'München' verließen, schoben wir uns an einem Tisch vorbei, an dem ein vielleicht fünfjähriges Mädchen mit seinen Eltern und Geschwistern saß. Mir war schon während des Essens aufgefallen, dass Simon und die Kleine einander anlächelten und zuzwinkerten. Jetzt griff er in seine Hosentasche, fischte ein Bonbon heraus und legte es vor sie auf den Tisch.
„Ich mag Kinder,“ raunte er mir im Rausgehen zu. „Hab selbst fünf. Die Jüngste ist in ihrem Alter.“
Wir fuhren zurück zur Federal Plaza. In der Tiefgarage vor meinem Sportwagen trennten wir uns. „Morgen früh, acht Uhr“, sagte der Chef zum Abschied. „Milo wird Sie beide zum Kennedy-Airport bringen.“
13
Über den Broadway fuhren Milo und ich durch das abendliche Manhattan. Dämmerung lag über den Straßenschluchten, die ersten Lichter flammten auf. Scheinwerfer jetzt auch im Rückspiegel. „Was hältst du von ihm?“, fragte ich meinen Partner.
„Von Aboud?“ Milo schmunzelte und zog die Brauen hoch. „Sympathisch. Jedenfalls das Gesicht, das er uns heute Abend gezeigt hat ist mir sympathisch. Aber ich schätze, er hat noch ein paar andere Gesichter auf Lager.“
„Du glaubst, er spielt falsch?“ Die Straßenecke, an der Milo gewöhnlich aussteigt, schob sich in mein Blickfeld. Ich setzte den Blinker nach rechts. Ein schwarzer Golf im Rückspiegel, vielleicht hundertfünfzig Meter entfernt, blinkte ebenfalls. Ich fragte mich, ob es Zufall war, dass er uns bereits seit dem Federal Building folgte.
„Du meinst, ob er uns was vormacht? So würde ich das nicht nennen, Jesse.“ Milo löste seinen Gurt. „Er ist nur CIA-Agent, vergiss es nicht, und er scheint ein Meister seines Fachs zu sein.“
Ich hielt, Milo stieg aus, winkte noch einmal kurz und schlug dann die Tür zu. Im Rückspiegel sah ich, wie er sich unter die Passanten mischte. Ich rangierte mein rotes Luxusgerät aus der Parklücke. Im Seitenspiegel sah ich den schwarzen Golf in zweiter Reihe parken, immer noch hundert, hundertfünfzig Meter hinter mir. Zeitgleich fädelten wir uns in den Verkehr ein.
Von nun an ließ ich den schwarzen Wagen nicht mehr aus den Augen.
Rechts schob sich die Lincoln Plaza in mein Blickfeld. Ich fuhr an der Avery Fisher Hall vorbei, erreichte den Lincoln Square.
Hinter fünf oder sechs anderen Wagen schwamm noch immer das Scheinwerferpaar des Golfs im Rückspiegel.
Am Lincoln Square bog ich scharf nach rechts ab in die Fünfundsechzigste hinein – der Golf folgte mir. Er folgte mir sogar ein Stück in den Central Park hinein, statt vorher nach Süden oder Norden abzuzweigen. Über die Sechsundsechzigste steuerte ich wieder aus dem Park heraus. Der Golf blieb hundertfünfzig Meter hinter mir.
Ich ging ein wenig vom Gas, das Fahrzeug kam näher. Rechts rein in die Columbia Avenue, der Golf hinterher. Hinein in die Achtundsechzigste und wieder Richtung Park. Der Golf folgte mir. Vier Fahrzeuge trennten uns.
„Genug jetzt.“ Ich stieg auf die Bremse, schaltete die Warnblinkanlage ein, stieß die Tür auf. Reifen quietschten hinter mir. „Jetzt schaust du mir in die Augen, Baby!“ Ich sprang aus dem Sportwagen, rannte los.





























