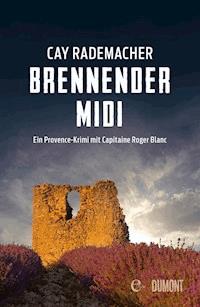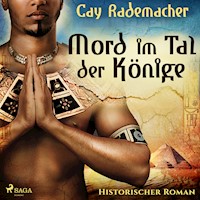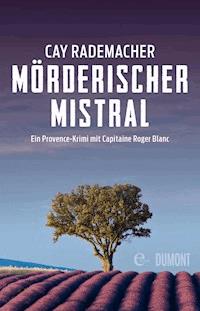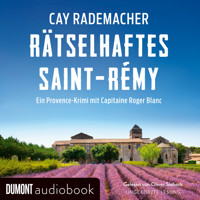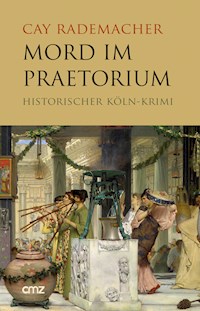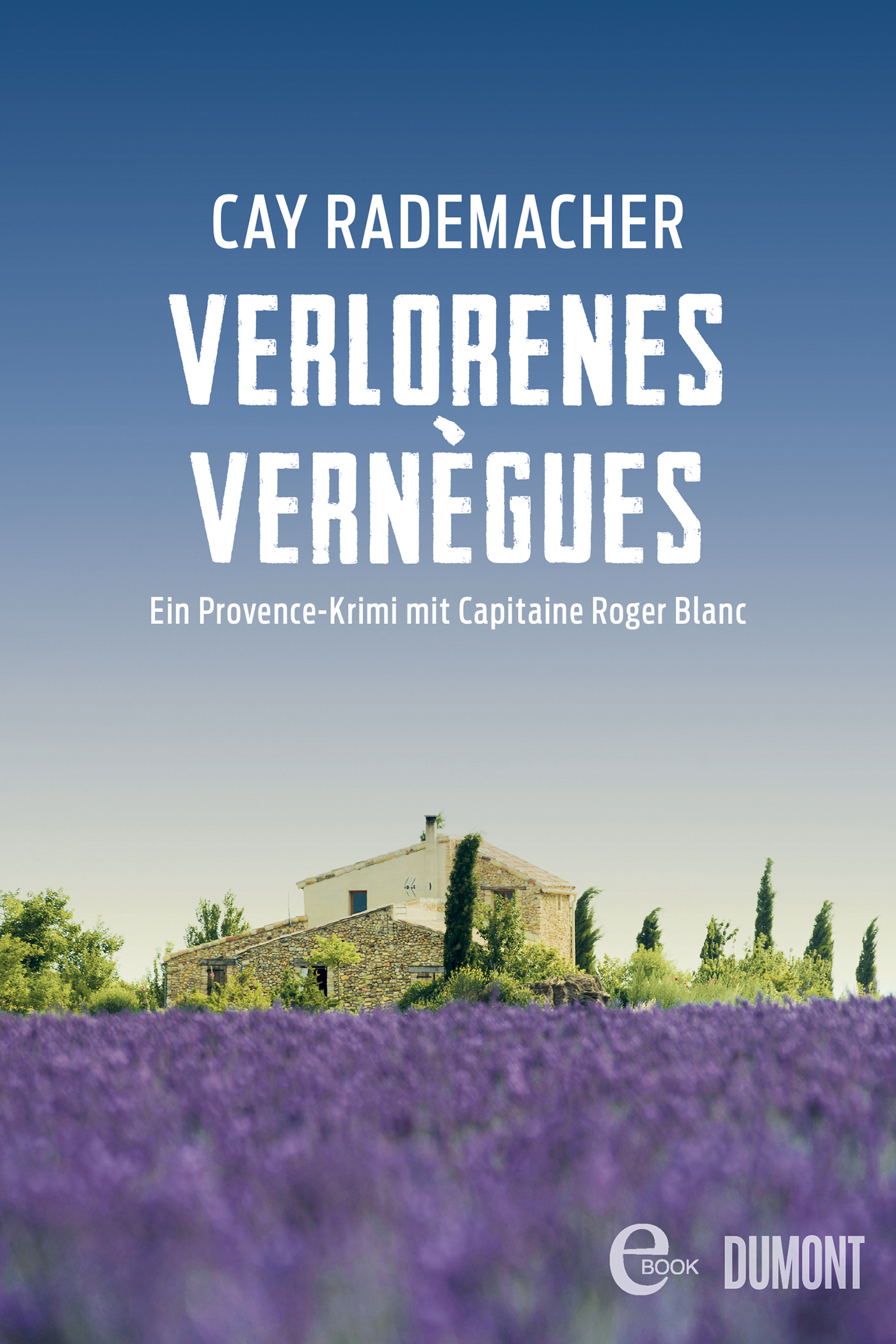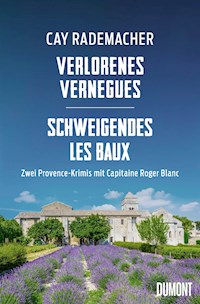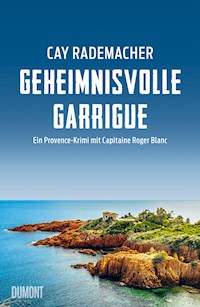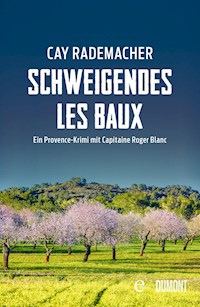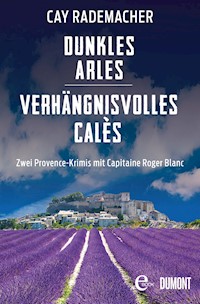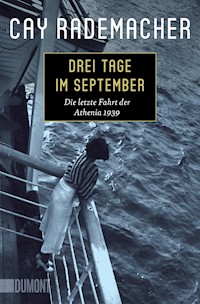
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sie war das letzte Schiff, das Europa im Frieden verließ und das erste, das im Zweiten Weltkrieg von einem deutschen U-Boot versenkt wurde: Auf der Athenia waren über tausend Passagiere auf dem Weg von Glasgow nach Montreal, darunter amerikanische Touristen, polnische und deutsche Juden, andere Verfolgte der Naziherrschaft und britische Geschäftsleute. Der Kommandant von U30 hielt das Schiff für einen Truppentransporter und schoss 118 Passagiere ertranken. In einer Reihe von Einzelszenen deckt Cay Rademacher erstaunliche Zusammenhänge der Tragödie auf: So befand sich die kleine Tochter des Filmregisseurs Ernst Lubitsch unter den Passagieren der Athenia. Um die amerikanischen Überlebenden zu betreuen, schickte der US-Botschafter in London seinen Sohn nach Glasgow: Sein Name ist John F. Kennedy . . . Es sind die zahlreichen präzise und lebendig geschilderten Details, die die Geschichte einer Katastrophe zum genauen Abbild einer Zeit und ihrer Atmosphäre werden lassen. In der Welt der Athenia fängt Cay Rademacher ein Spiegelbild Europas am Rande des Abgrunds ein und entfaltet ein spektakuläres Panorama der ersten Tage des Zweiten Weltkrieges.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die Athenia war das letzte Schiff, das Europa im Frieden verließ und das erste, das im Zweiten Weltkrieg von einem deutschen U-Boot versenkt wurde. An Bord des englischen Ozeanliners drängten sich über tausend Passagiere, die nach Montreal fahren wollten: amerikanische Touristen, deutsche und österreichische Juden, polnische und tschechische Verfolgte der Naziherrschaft, britische Geschäftsleute, Wissenschaftler und Familien. Der Kommandant von U30 jedoch hielt das Schiff für einen Truppentransporter und schoss – 118 Passagiere ertranken.
In einer Reihe von Einzelszenen deckt Cay Rademacher erstaunliche Zusammenhänge der Tragödie auf: So reist die kleine Tochter des Filmregisseurs Ernst Lubitsch ohne ihre Eltern auf der Athenia. Um die amerikanischen Überlebenden zu betreuen, schickt der US-Botschafter in London seinen Sohn nach Glasgow: Sein Name ist John F. Kennedy … Im Schicksal der Athenia fängt Cay Rademacher ein Spiegelbild Europas am Rande des Abgrunds ein und entfaltet ein spektakuläres Panorama der ersten Tage des Zweiten Weltkrieges.
© in medias res
Cay Rademacher, geboren 1965, ist freier Journalist und Autor. Seine Provence-Serie umfasst neun Fälle, zuletzt erschien ›Geheimnisvolle Garrigue‹ (2022). Bei DuMont veröffentlichte er auch seine Romane aus dem Hamburg der Nachkriegszeit: ›Der Trümmermörder‹ (2011), ›Der Schieber‹ (2012) und ›Der Fälscher‹ (2013). Außerdem erschienen die Kriminalromane ›Ein letzter Sommer in Méjean‹ (2019), ›Stille Nacht in der Provence‹ (2020) und ›Die Passage nach Maskat‹ (2022). Cay Rademacher lebt mit seiner Familie bei Salon-de-Provence in Frankreich.
Cay Rademacher
DREI TAGE IM SEPTEMBER
Die letzte Fahrt der Athenia 1939
Von Cay Rademacher sind bei DuMont außerdem erschienen:
Der Trümmermörder
Der Schieber
Der Fälscher
Mörderischer Mistral
Tödliche Camargue
Brennender Midi
Gefährliche Côte Bleue
Dunkles Arles
Verhängnisvolles Calès
Verlorenes Vernègues
Schweigendes Les Baux
Geheimnisvolle Garrigue
Ein letzter Sommer in Méjean
Stille Nacht in der Provence
Die Passage nach Maskat
eBook 2023
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
© 2009 mare Verlag
Umschlaggestaltung nach Vorlage der Originalausgabe: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © The Mariner’s Museum and Park
Karte: © Peter Palm, Berlin
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8297-7
www.dumont-buchverlag.de
Für Françoiseund Leo, Julie, Anouk
NACHT ÜBER DER SEE
Sonntag, 3. September 1939, an Bord der Athenia, 19.38 Uhr*[* Alle Uhrzeiten, sofern nicht anders angegeben, sind Greenwich Mean Time (GMT), also Uhrzeit in Großbritannien. In Deutschland ist die Uhr gegenüber GMT um eine Stunde vorgerückt: 19.38 Uhr GMT entspricht 20.38 Uhr in Deutschland.] Edith Lustig schlendert über das Promenadendeck des britischen Oceanliners und hat noch eine Minute zu leben. Die 27 Jahre alte Deutsche, die einige Tage zuvor beim Ausfüllen der Passagierliste »Hausfrau« als Beruf angegeben hat, wandert an der Backbordseite entlang, irgendwo zwischen dem Heck und der Mitte des Schiffes. Vielleicht denkt sie über ihre Vergangenheit nach – und über ihre Zukunft. Denn zusammen mit ihrem Mann Dr. Egon Lustig ist sie geflohen.
Beide sind Juden, sind gerade noch aus dem nationalsozialistischen Deutschland entkommen. Zunächst sind sie nach Großbritannien gelangt, das letzte Quartier des Ehepaares lag in der Great Russell Street im Herzen Londons, nur ein paar Minuten Fußweg östlich des Piccadilly Circus und der Bond Street mit ihren exquisiten Geschäften. Doch dort wollen sie nicht bleiben: Edith und Egon Lustig haben eine Passage dritter Klasse nach Kanada ergattert – und die Athenia soll sie nun nach Übersee bringen.
Womöglich sind die Gedanken von Edith Lustig in diesem Augenblick aber eher banal: Das Schiff stampft mit 15 Knoten durch den Atlantik, die irische Küste liegt bereits rund 400 Kilometer zurück. Der Wind weht nicht zu stark, doch spürbar. Der Dampfer rollt in den Wogen – und nicht wenige Reisende verspüren Unwohlsein.
Nicht undenkbar auch, dass Edith Lustigs Überlegungen romantisch sind: Sie ist jung, und die Neue Welt wartet auf das Ehepaar. Sie steht an Bord eines komfortablen Schiffes, irgendwo an Deck singen Kinder, der Mond glitzert schwach. Die Sonne ist vor einer halben Stunde versunken, im Osten ist der Himmel schwarz. Im Westen jedoch – wohin die Reise gehen soll, und vielleicht ist das ein Symbol – leuchtet noch der Horizont im letzten Licht.
Doch welche Gedanken auch immer Edith Lustig bewegen mögen, niemand wird sie je erfahren. Denn in wenigen Sekunden werden unter ihren Füßen 350 Kilogramm Sprengstoff explodieren.
Die Athenia ist kein berühmtes Schiff. Kein Riesendampfer wie die Queen Mary. Kein eleganter Liner wie die Normandie oder die Bremen. Kein schwimmender Palast, wo sich in Restaurants und Bordbars Politiker und Millionäre, Hollywoodstars und Adelige begegnen.
Die Athenia ist nur rund halb so lang und halb so schnell wie die Queen Mary, der größte Liner des Zeitalters, dafür zuverlässig, unauffällig, preiswert. Seit 16 Jahren bringt sie Reisende von Großbritannien nach Kanada: Auswanderer, Touristen, Familien vor allem. Viele schätzen die unaufgeregte Freundlichkeit und den Service an Bord. Reisende, die einmal eine Fahrt mitgemacht haben, buchen ihre nächste Passage oft wieder auf der Athenia.
Niemand würde sich heute noch an diesen Dampfer erinnern, der so ist wie Hunderte andere, die in den dreißiger Jahren den Atlantik kreuzen – wenn die Athenia nicht zufällig das letzte Schiff gewesen wäre, das noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges Großbritannien verlassen hat.
Und wenn nicht ein tragisches Schicksal auf sie gewartet hätte.
An jenem Abend des 3. September befehdet sich seit gut acht Stunden halb Europa. Zwei Tage zuvor hat Deutschland Polen überfallen. Am Morgen des 3. September sind die Regierungen von Großbritannien und Frankreich ihrem osteuropäischen Verbündeten zu Hilfe geeilt: Die beiden Mächte haben Hitlerdeutschland den Krieg erklärt.
Die Athenia hat Liverpool am 2. September 1939 um 16.30 Uhr verlassen – weniger als 19 Stunden vor der britischen Kriegserklärung. Viele andere Schiffe sind bereits wegen des unabwendbar scheinenden Konfliktes in den Häfen geblieben. Die Athenia jedoch wagt sich auf den Atlantik.
Und sie trägt mehr Menschen an Bord als je zuvor.
315 Frauen und Männer zählt die Besatzung: Offiziere und Matrosen, Ingenieure, Heizer, Funker und andere Spezialisten für den Betrieb des Schiffes. Stewards und Stewardessen, Friseure, Krankenschwestern und Dutzende weitere Angestellte kümmern sich um das Wohl der Reisenden. Die Crew stammt aus England, Schottland und Kanada. Die jüngsten Stewardgehilfen sind 14 Jahre alt, die erfahrensten Seeleute haben ihren 60. Geburtstag überschritten.
1102 Passagiere sind für diese Passage gebucht – rund 200 mehr, als die Athenia offiziell aufnehmen darf. Überall sind sie untergekommen: in engen Kabinen, den Kajüten der Besatzungsmitglieder, in hastig umgebauten Rauchsalons. Manche vollen Quartiere sind Massenunterkünfte für Männer oder für Frauen und Kinder, sodass viele Familien nachts und auch tagsüber etliche Stunden voneinander getrennt sind.
Die Reisenden spiegeln die aus den Fugen geratende Welt. Prominente und Namenlose, Reiche und Arme, Menschen mit großer Zukunft und solche, denen die Zukunft geraubt worden ist: britische und kanadische Kaufleute auf Geschäftsreise; amerikanische Touristen, die in panischer Hast entfliehen, bevor ihre europäischen Ausflugsziele im Krieg versinken; Wissenschaftler, deren Kongress von der politischen Krise vorzeitig beendet worden ist; und Flüchtlinge wie das Ehepaar Lustig. Deutsche und Österreicher, manche unter ihnen Juden, andere nicht, dazu Tschechen und Polen, deren Länder von der Wehrmacht bedroht oder bereits besetzt sind.
Die Familie Kucharczuk aus dem polnischen Trosteniec (heute in der Ukraine) etwa drängt sich in einer Kabine der dritten Klasse: Mutter, Vater, drei Söhne, zwei Töchter, das älteste Kind 20 Jahre alt, das jüngste zwei. Vorgestern ist ihre Heimat von deutschen Soldaten überfallen worden. Sie sind gerade noch hinausgekommen mit einem Einwanderungsvisum nach Kanada.
Einige Kabinen weiter hat die 16-jährige Hildegard Ehrlich aus Wien Quartier gefunden. Ihre Eltern sind jüdischen Glaubens und vertreten sozialistische Überzeugungen – was es doppelt gefährlich machte, nach dem »Anschluss« in Österreich auszuharren. Der Vater ist Wirtschaftswissenschaftler, die Mutter arbeitete als Sekretärin bei einer Krankenkasse. Die einzige Tochter Hildegard wurde 1938 nach London geschickt, wo eine Tante bereits seit längerem als Modezeichnerin arbeitet und wohin schon ihre Großmutter geflohen war. Das junge Mädchen besucht das Internat St. Mary’s School in Westcliff-on-Sea in der Grafschaft Essex.
»Denn obwohl es mir sehr gut geht, so bin ich aber den ganzen Tag allein mit mir, ich müsste es nicht, aber ich habe so viel zu tun, dass es nicht anders geht«, schreibt sie etwas atemlos einer in Wien zurückgebliebenen Freundin.
Anfang Mai 1938 erhielten ihre Eltern ein Visum und reisten direkt von Wien an die Küste und von dort mit dem Cunard-Liner Samaria in die USA. An Freunde aus Österreich schickten sie einen letzten Gruß. Auf einer von jedermann – und damit auch von Beamten der Gestapo – lesbaren Postkarte schrieben sie noch von Bord des Dampfers und schwärmten von »unserer herrlichen Urlaubsfahrt«.
Tatsächlich aber ist es eine Reise ins Exil: Das Ehepaar Ehrlich lässt sich in New York nieder. Nun soll die Tochter von Großbritannien aus allein nachkommen.
Nur ein paar Meter Luftlinie und Stahlplatten trennen die Flüchtlinge von David Cass-Beggs. Der 30 Jahre alte Brite ist Dozent an der School of Technology in Oxford, hat nun aber für ein Jahr einen Lehrauftrag an der Universität von Toronto übernommen. Er geht mit seiner Frau Barbara und seiner dreijährigen Tochter Rosemary auf Reisen – doch weil die Athenia überbucht ist, kann er nicht mit ihnen zusammen eine Kabine beziehen.
David Cass-Beggs findet sich in der dritten Klasse auf dem D-Deck wieder, steuerbord achtern, nur einige Meter über der Wasserlinie. Er teilt sich den engen Verschlag mit drei Männern. Seiner Frau, einer 35-jährigen Musikerin, und seiner Tochter ist eine andere Kabine auf dem gleichen Deck zugeteilt worden, die sie sich mit einem weiteren Mutter-Tochter-Paar teilen müssen. Die kleine Rosemary spielt vor dem Einschlafen noch mit ihren beiden Stofftieren, einem blauen Teddybären und einem Panda, den sie einen Monat zuvor bei ihrer Geburtstagsfeier von der Großmutter geschenkt bekommen hat.
Für die 14 Jahre alte Florence Kelly aus Maple Heights in Ohio ist die Reise ein großes Abenteuer. Mit ihrer Mutter hat sie seit Ende Mai Verwandte auf der Isle of Man, in England und Schottland besucht und Europa bereist. Ihr Vater ist in den USA geblieben, weil ihm seine Firma Fisher Foods nicht so lange freigegeben hat.
Im August bereits hat er Frau und Tochter ein Telegramm geschickt und sie gebeten, früher als geplant aus der Alten Welt wieder abzureisen, da ein Krieg drohe. Doch weil Tausende amerikanische Touristen mit dieser Sorge die Reisebüros stürmten, ist keine Passage zu bekommen. Mutter und Tochter Kelly nehmen schließlich das Schiff, das sie ursprünglich gebucht haben: die Athenia.
Der sieben Jahre alte Philip Gunyon spricht gerade sein Abendgebet: »Thank you, God, for everything.«
Er teilt sich mit seiner jüngeren Schwester Barbara, dem jüngsten Bruder Andrew und seiner 37 Jahre alten Mutter Andreana Gunyon eine Dreibettkabine. (Die Mutter hat die vergangene Nacht zusammengerollt am Fußende des Bettes geschlafen, in dem der zweijährige Andrew ruht.) Der Vater ist Ingenieur bei der Firma Mather and Platt. Lange hat er mit seiner kanadischen Frau und den Kindern im japanischen Kobe gelebt, doch dort ist ihm die immer aggressivere, nationalistischere Politik der Regierung in Tokio schließlich so unerträglich geworden, dass er 1938 nach Großbritannien zurückgekehrt ist. Seither leben die Gunyons in Northwood im Großraum London.
Der Vater allerdings ist in diesem Sommer für seine Firma nach Brasilien gegangen – Andreana Gunyon reist allein mit den Kindern. Sie hat sich bereits für das Dinner im Speisesaal umgekleidet: langer Rock und blaue Bluse, mit deren großen schwarzen Knöpfen der kleine Philip gerne spielt. Nun legt sie den Kindern ihre Puppen und Stofftiere – zwei Hasen, einen Hund und eine Ente – in den Arm, steht auf und verlässt die Kabine. Die Kinder bleiben allein zurück.
Viel tiefer im Schiffsbauch, schon unterhalb der Wasserlinie, sieht Professor John H. Lawrence von der University of California im Frachtraum Nummer 3 zusammen mit einem Matrosen nach seinen Skiern. Der Mediziner – Bruder des Atomforschers Ernest O. Lawrence, dem gut zwei Monate später der Nobelpreis für Physik zugesprochen wird – war Gast auf einem wissenschaftlichen Kongress in Dundee, der jedoch wegen der heraufziehenden Krise abgebrochen werden musste.
Die Rückfahrt hatte er auf der luxuriösen Britannic gebucht – doch die durfte den Hafen schon nicht mehr verlassen. Mit Glück hat Lawrence eine Passage auf der Athenia ergattert – und reist nun, statt in einer bequemen Kabine, im Rauchsalon, der zu einer provisorischen Unterkunft umgebaut worden ist.
Der Professor macht sich Sorgen, ob die Skier, die er während seines Europa-Aufenthaltes in Norwegen erstanden hat, auch von der Britannic zur Athenia transportiert worden sind. Der Matrose führt ihn in den düsteren Frachtraum – und Lawrence sieht nur Koffer und Taschen, aufgestapelt zu einem mehr als mannshohen Haufen. Mit Erlaubnis des Seemanns klettert er auf diesen Gepäckberg und findet oben tatsächlich die Skier. Vorsichtig bringt er sie herunter und nimmt dem Matrosen das Versprechen ab, künftig besonders gut auf die empfindlichen Sportgeräte aufzupassen.
Ebenfalls auf der ersten Etappe der langen Reise von Europa bis nach Kalifornien ist Consuela Strohmeier. Die ältere, energische, grauhaarige Deutschamerikanerin gehört, auch wenn das kaum jemand vermuten würde, zum inneren Zirkel der glamourösen Welt von Hollywood. Sie ist das Kindermädchen von Nicola Lubitsch, der Tochter des berühmten Filmregisseurs.
Die Kleine, noch kein Jahr alt, war von ihrer Mutter auf eine Englandreise mitgenommen worden. Der Krieg hat sie überrascht: Frau Lubitsch hat keine Passage für sich mehr buchen können, doch für ihr Kind und das Kindermädchen zwei Plätze erkämpft. Nun sitzt Consuela Strohmeier in ihrer Kabine und bringt das Baby zu Bett.
Dutzende Kinder sind an Bord der Athenia. Ein Mädchen begeht gerade mit ihrer Familie und neuen Bordfreunden ihren neunten Geburtstag im Speisesaal der Tourist Class, der mittleren der drei Kabinenklassen auf der Athenia. Die Kleine ist auf einen Tisch gehoben worden und lässt sich dort feiern.
Leise klirren irgendwo Gläser. Lautlos huschen Stewards zwischen den Tischen herum und tragen die Gänge auf. In der Dining Lounge geht es feierlich zu, viele Damen tragen Abendkleider. An seinem Tisch plaudert James Cook, der erfahrene Kapitän der Athenia, mit Sir Richard Lake und seiner Gattin. Sir Richard, der fast 80 Jahre alte ehemalige Gouverneur der kanadischen Provinz Saskatchewan, und Lady Lake, eine freundliche, füllige, matronenhafte ältere Dame, haben selbstverständlich am Kapitänstisch einen Platz bekommen. Schließlich ist dies ein britisches Schiff – und in Großbritannien gelten noch immer die feinen Regeln von Familienname und Abstammung. Und so sind Sir Richard und seine Gattin die gesellschaftlich ranghöchsten Gäste an Bord.
Ein paar Plätze weiter nimmt in diesem Augenblick auch Gustave Anderson sein Dinner ein. Der Reiseagent aus Illinois, ein kräftiger, blonder, langsam kahl werdender Mann, begleitet seit 15 Jahren Gruppen amerikanischer Touristen nach Europa. Stets fährt er dabei auf der Athenia. So ist er an Bord bekannt wie kein zweiter Reisender. Anderson ist ein geborener Entertainer. Oft unterhält er seine Passagiere mit Liedern und Sketchen oder organisiert Feiern und Spiele.
Wohl nie zuvor sind seine Ablenkungskünste so gefragt wie auf dieser Fahrt. Der drohende, schließlich ausgebrochene Krieg hat nicht nur viele Menschen an Bord getrieben, die sonst nie einen Fuß auf die Athenia gesetzt hätten, er ist auch auf dem Schiff geradezu körperlich spürbar: Matrosen haben alle Bullaugen mit Stoff oder Pappe von innen verklebt, damit kein Licht aus einem Salon oder einer Kabine nach draußen dringt. An Deck ist es dunkel, denn die Bordbeleuchtung ist abgeschaltet. Wie ein riesiger schwarzer Schatten gleitet die Athenia durch die hereinbrechende Nacht. Kein deutsches U-Boot, das womöglich schon im Atlantik kreuzt, soll den Oceanliner entdecken können.
Doch diese Tarnung ist vergebens – irgendwo backbord voraus in den Wogen des Atlantiks lauert bereits ein grauer Jäger …
Es ist 19.39 Uhr, als der Matrose, der hoch über dem Deck im Krähennest des vorderen Mastes Ausguck hält, plötzlich einen gellenden Warnschrei ausstößt: Eine weiße, schaumige Blasenbahn rast durch das dunkle Wasser. Die Luftspur eines Torpedos.
Er rauscht auf die Backbordseite der Athenia zu – genau auf jene Stelle, an der Edith Lustig gerade einen Decksspaziergang macht.
DER STURM ZIEHT AUF
Montag, 12. Juni 1939, Trosteniec, Polen. Spirydon Kucharczuk ist 41 Jahre alt – noch nicht zu alt, um seine Heimat zu verlassen und einen Neuanfang in der Fremde zu wagen. Er hat Angst vor den Deutschen.
Bald, so liest er in der Zeitung, könnte Hitler Polen überfallen. Die Regierung in Berlin fordert immer aggressiver Konzessionen: Danzig, die in der Mehrheit von Deutschen bewohnte Hafenstadt an der polnischen Küste, die seit Ende des Ersten Weltkriegs einen autonomen Status unter Verwaltung des Völkerbundes hat, soll dem Reich »angeschlossen« werden. Und nach Ostpreußen will Hitler eine Eisenbahnlinie sowie eine Autobahn bauen lassen – quer durch Polen, das zwischen dem Reich und Ostpreußen liegt. Berlin verlangt einen Weg durch den »polnischen Korridor«. Das ist für die Regierung in Warschau eine unerfüllbare Forderung, will sie nicht ihr Staatsgebiet zerschneiden lassen.
So hat sich Spirydon Kucharczuk Ausreisepapiere besorgt, die er an diesem Tag bei der Stadtverwaltung abholt: Pässe und Visa für sich, seine 40-jährige Frau Eudokia und die Kinder Jan (20), Neonela (18), Stefan (15), Aleksandra (8) und den erst zwei Jahre alten Jakeb. Die Kucharczuks wollen von ihrem Dorf, das nahe der Grenze zur UdSSR liegt, nach Kanada auswandern.
Kurz darauf machen sie sich mit dem Zug auf quer durch Europa. Das erste Ziel: Großbritannien. Sie haben eine Passage dritter Klasse auf einem Überseedampfer gebucht und müssen spätestens am 1. September in Liverpool sein.
Dort wird die Athenia auf sie warten.
Dienstag, 15. August 1939, Nachtzug von Wilhelmshaven nach München. Der 19 Jahre alte Oberfunkmaat Georg Högel hat Heimaturlaub. Der Marinesoldat – jung, gutaussehend, ein begabter Zeichner – kann nicht schlafen. Irgendwo im Zug lernt er drei etwa gleichaltrige Mädchen kennen, zwei Österreicherinnen (seit dem sogenannten Anschluss von 1938 auch deutsche Staatsbürgerinnen) und eine Münchnerin. Er unterhält sich angeregt mit ihnen, spricht dabei vielleicht auch über seinen Dienst.
Georg Högel ist Funker auf dem U-Boot U-30.
Mittwoch, 16. August 1939, an Bord des U-Boot-Versorgungsschiffes Hecht, Marinepier, Hafen, Kiel. Karl Dönitz trägt in geheimer Runde deutschen Marineoffizieren vor, dass sie in wenigen Tagen die mächtigste Flotte der Welt angreifen werden: die Royal Navy.
Kommodore Dönitz ist seit 1935 der FdU, der »Führer der U-Boote«. (Unter dem Titel »Befehlshaber der U-Boote«, BdU, wird er bald in der Marine zur legendären Gestalt werden, doch wird ihm diese Bezeichnung erst am 19. September 1939 verliehen.) Ein schmaler Mann mit blauen Augen, der in einem Monat seinen 48. Geburtstag feiern wird. Später werden ihm alliierte Psychologen einen weit überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten von 138 bescheinigen, ihn »wach« und »scharfsinnig« nennen. Seit einem halben Menschenalter ist der Abkömmling einer Berliner Bürgerfamilie verheiratet, hat drei erwachsene Kinder; er spielt passabel Querflöte und sammelt erlesenes Porzellan. Ein kultivierter Mensch. Einerseits.
Andererseits ist er zeit seines Lebens in der Marine gewesen, seit er, der beide Eltern früh verlor, am 1. April 1910 als Seekadett in die damals noch Kaiserliche Kriegsmarine eingetreten ist. U-Boote ist er schon im Ersten Weltkrieg gefahren, hat acht Feindfahrten mitgemacht und es bis zum Kapitän gebracht.
Die U-Boot-Fahrer, die er nun seit vier Jahren kommandiert, drillt er hart, aber sie sind ihm bedingungslos ergeben. Dönitz verachtet den Dünkel der Offiziere, die eine bessere Behandlung, die besseres Essen und andere Privilegien gegenüber den einfachen Diensträngen verlangen. Die Hierarchie ist bei den U-Boot-Besatzungen so klar wie irgendwo sonst in der Wehrmacht, doch in den Lebensumständen an Bord der beengten Einheiten unterscheidet sich ein Kapitän kaum vom jüngsten Matrosen. Dönitz’ Männer bilden eine verschworene Gemeinschaft, sie sehen sich selbst als Elite der Marine. Er sei, sagt Dönitz, »mit Leib und Seele U-Boot-Mann«.
Doch er hat nicht nur Freunde unter seinen Kameraden.
»Man muss das ganze Offizierskorps von vornherein so einstellen, dass es sich mit Verantwortung für den nationalsozialistischen Staat in seiner Geschlossenheit mitverantwortlich fühlt. Der Offizier ist der Exponent des Staates; das Geschwätz, der Offizier ist unpolitisch, ist barer Unsinn«, wird er einmal verkünden – und er glaubt daran.
»Hitlerjunge Dönitz« schmähen ihn manche Soldaten wegen seiner Nähe zur NSDAP. Allerdings spotten sie nur hinter vorgehaltener Hand, denn er ist einer der einflussreichsten Offiziere – und in den nächsten, dramatischen Tagen wird er noch mehr Macht gewinnen. Auf Kosten seines Vorgesetzten, der an Bord der Hecht dem Vortrag des FdU lauscht.
Großadmiral Erich Raeder, klein, agil, selbstbewusst, mit einem IQ von 134, doch auch spröde und unnahbar, ist 15 Jahre älter als Dönitz. 1928, also noch zu Zeiten der Weimarer Republik, ist er zum Leiter der Marine berufen worden. Auch er ist zeit seines Lebens Berufsoffizier gewesen, stammt aus kultivierter Familie, hat im Ersten Weltkrieg gekämpft – und darüber später Fachbücher verfasst, die ihm eine Ehrendoktorwürde eingebracht haben.
Das NSDAP-Organ Völkischer Beobachter wird ihn später als den »ersten und nächsten seemännischen Mitarbeiter des Führers« rühmen. Seit 1938 ist er, dank eines Hitler-Erlasses, im Rang einem Reichsminister gleichgestellt.
Und doch: Raeder, streng christlich geprägt, hält zu den Machthabern stets eine gewisse Distanz. Er klammert sich an das von Dönitz geschmähte Leitbild vom »unpolitischen Offizier«; er glaubt, dass er rein soldatisch dem Regime dienen kann und sich ihm doch anderweitig nicht verpflichten muss. Propagandaminister Joseph Goebbels mag Raeder nicht, das werden jedenfalls Zeugen nach 1945 aussagen. Goebbels unterstellt Raeder gar, er sei »gegen die Partei«.
Raeder misstraut dem ehrgeizigen, klugen, wohl auch zynischen Dönitz. Der habe, wird er nach dem Zweiten Weltkrieg zu Protokoll geben, eine »manierierte und nicht immer taktvolle Art«, habe »starke politische Neigungen« und leide unter »Eitelkeit«. »Unsere Beziehungen waren sehr kühl.«
Nun muss er sich anhören, wie Dönitz jenen Krieg zu führen gedenkt, auf den Adolf Hitler rücksichtslos zusteuert.
Seit viereinhalb Jahren brechen die Nationalsozialisten internationale Verträge: Am 9. März 1935 hatte Berlin den Wiederaufbau der Luftwaffe verkündet, eine Woche darauf die Wehrpflicht eingeführt. Beides war Deutschland nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg durch den Versailler Vertrag verboten worden. Doch Frankreich und Großbritannien reagierten auf diese Provokation nur mit Protestnoten.
Von 1936 bis 1939 kämpften deutsche Soldaten aufseiten Francos im Spanischen Bürgerkrieg. Am 12. März 1938 überschritt die Wehrmacht die Grenze zu Österreich. Einen Tag später ließ Hitler den sogenannten Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich verkünden. Die Reaktionen der Westmächte waren für Hitler stets unbedrohlich. Dann kooperierten sie sogar.
Auf der Münchner Konferenz vom 28. bis 30. September 1938 akzeptierten Großbritannien und Frankreich Hitlers Forderung, dass die Tschechoslowakei, ihr Verbündeter, das Sudetenland an Deutschland herausgeben sollte. Und als am 15. März 1939 die Wehrmacht auch noch den Rest des Staates besetzte, ein militärischer Überfall ohne jegliche Legitimität, blieben London und Paris wiederum untätig.
Nun will Hitler Polen annektieren.
Am 3. April 1939 erging an die Oberbefehlshaber der Streitkräfte Hitlers Weisung für den »Fall Weiß«: die »endgültige Abrechnung« mit dem östlichen Nachbarstaat. Detailliert wird darin für Bodentruppen und Luftwaffe der Überfall – der »überraschende Angriffsbeginn« – angeordnet.
Hitler hat kein Interesse, den Krieg noch länger hinauszuzögern. Seinen ranghöchsten Offizieren, unter ihnen auch Raeder, ist deshalb seit dieser Weisung klar, dass ein Angriff erfolgen soll. Nur zwei Fragen bleiben offen: Wann genau soll er beginnen? Und wird Polen der einzige Gegner sein?
Die Kriegsmarine, die Hitler nie sonderlich hoch geschätzt hat, spielt in diesen Überlegungen eine untergeordnete Rolle. Die Flotte, so lautet der Befehl, soll vor allem in der Ostsee kämpfen mit dem obersten Ziel der »Vernichtung bzw. Ausschaltung der polnischen Seestreitkräfte«.
Außerdem ordnet Hitler an: »In der Nordsee und im Skagerrak sind die Maßnahmen zu treffen, die zur vorsorglichen Sicherung gegen ein überraschendes Eingreifen der Westmächte in den Konflikt geboten erscheinen. Sie haben sich auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Ihre Unauffälligkeit muss gewährleistet sein. Es kommt hierbei entscheidend darauf an, jegliche Handlungen zu vermeiden, die die politische Haltung der Westmächte verschärfen könnten.«
Denn Hitler hofft, dass, genau wie bei allen aggressiven Aktionen des nationalsozialistischen Regimes seit 1935, auch diesmal wieder Großbritannien und Frankreich im letzten Augenblick vor einem Kampf zurückschrecken werden.
Und doch ist gerade das die Hauptsorge an jenem Sommertag an Bord der Hecht: Nicht der beschlossene Überfall auf Polen steht zur Diskussion, dessen Legitimität und Durchführbarkeit die »unpolitischen« Offiziere um Raeder nicht anzweifeln und die »politischen« wie Dönitz erst recht nicht – sondern ein möglicher Krieg mit Großbritannien.
In einem solchen Fall müsste nämlich die schwächste Teilstreitkraft des Deutschen Reiches gegen den stärksten Gegner antreten. Kein moralisches Problem für Raeder und seinen Führungsstab, wohl aber ein militärisches Dilemma.
Unter der Flagge der Royal Navy fahren 15 Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer – die Deutschen verfügen 1939 über zwei einsatzbereite »Westentaschenschlachtschiffe«, die Admiral Graf Spee und die Deutschland, zwei sehr viel kleinere Einheiten. Beobachter in England nannten die Schiffe so (pocket battleships) wegen ihrer vergleichsweise geringen Größe und starken Artillerie. Vier weitere Schlachtschiffe, unter anderen die Bismarck, sowie ein Westentaschenschlachtschiff liegen zur Reparatur oder noch nicht fertiggestellt in der Werft.
Deprimierend aus Sicht Raeders ist auch das Verhältnis bei anderen Schiffstypen: Großbritannien verfügt über sieben Flugzeugträger, Deutschland über keinen; 54 britischen Kreuzern stehen neun deutsche gegenüber, 184 Zerstörern bloß 22 eigene Einheiten. Nur in einem Bereich sieht das anders aus – bei den U-Booten.
Mit 58 U-Booten ist die Royal Navy zwar auch unter Wasser die stärkste Flotte der Welt, doch ist die Überlegenheit hier theoretischer Natur. Denn auch die deutsche Kriegsmarine hat 57 U-Boote in Dienst gestellt.
Am 18. Juni 1935 hatten Deutschland und Großbritannien das Londoner Flottenabkommen geschlossen. Hitler, der vor allem in Osteuropa seinen Wahntraum vom »Lebensraum« durch militärische Angriffe verwirklichen will, möchte Großbritannien möglichst lange aus dem von ihm geplanten Konflikt heraushalten. Da für einen Landkrieg gen Osten eine starke Marine unwichtig ist, macht Hitler London gegenüber diesbezüglich gerne Zugeständnisse.
Im Abkommen von 1935 verpflichtet sich das Deutsche Reich, die eigene Flotte bei Großkampfschiffen höchstens im Verhältnis von 35 zu 100 im Vergleich zur Royal Navy aufzubauen. Die Kriegsmarine sollte bestenfalls ein Drittel jener Stärke aufweisen, welche die britische hatte.
Zu den wenigen Briten, die das Londoner Abkommen kritisch sahen, gehörte Winston Churchill, der allerdings zu jener Zeit nicht Mitglied der Regierung war. Er nannte die euphorischen Reaktionen seiner Landsleute auf den Vertrag einen »Gipfel der Leichtgläubigkeit«.
Bei nur einem Schiffstyp hatten sich Hitlers Emissäre eine Parität zwischen deutscher und britischer Flotte ausbedungen. Bei dem einzigen Schiffstyp, mit dem man die Inselnation Großbritannien lebensbedrohlich gefährden konnte.
Bei den U-Booten.
So wie Großbritannien mit der Tschechoslowakei verbündet war, so ist es nun mit Polen verbündet. Und warum soll London sich nicht, wie im Jahr zuvor, im letzten Augenblick aus dem drohenden Krieg schleichen? Aus einem Konflikt zudem, der, da er in Osteuropa ausgetragen wird, keine lebenswichtigen Interessen Londons berührt?
Allerdings hat die Regierung Seiner Majestät das Ende der Appeasement-Politik verkündet und ein massives Aufrüstungsprogramm begonnen. Ist das nicht eine deutliche Warnung, dass London diesmal bereit ist für den Kampf?
Am 15. August 1939 hatte Raeder Dönitz und die anderen Offiziere zur hastig anberaumten Besprechung auf dem Versorgungsschiff Hecht befohlen. Denn Hitler hatte ihm zuvor eröffnet, er plane den Angriff auf Polen für den 26. August. Auch die Kriegsmarine müsse an diesem Tag bereit sein.
Dönitz trifft erst am 16. August auf der Hecht ein – der Befehl hat ihn im Urlaub überrascht. Eilig ist er angereist.
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass Raeder, der ein Minimum an Distanz zum NS-Regime zu wahren versucht, in diesen spannungsgeladenen Tagen ein glühenderer Gefolgsmann Hitlers ist als der »politische« Dönitz.
Raeder nämlich glaubt Hitlers Versicherungen, dass Großbritannien und Frankreich auch diesmal wieder vor einem Krieg zurückschrecken werden.
Ganz anders Dönitz: Der sieht, dass Hitlers Angriffspolitik eine, wie er später schreiben wird, »schwere Spannung« zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem Empire ausgelöst hat. Spätestens seit dem Frühjahr 1939 glaubt er, dass ein Krieg gegen Großbritannien unvermeidlich ist. Er veröffentlicht über den zukünftigen U-Boot-Krieg sogar eine Monografie, in der er, wenn auch nicht in allen Einzelheiten, doch klar sein Ziel benennt: einen Kampf zur See gegen Großbritannien. (Der Geheimdienst Seiner Majestät nimmt dieses Werk übrigens nicht zur Kenntnis und wird sich erst 1942 ein Exemplar besorgen – zu einem Zeitpunkt, da die Pläne des FdU längst in die Tat umgesetzt worden sind.)
Dönitz hatte es auch durchgesetzt, dass vom 12. bis zum 14. Mai 1939 erstmals deutsche U-Boote zu Manövern in den Atlantik ausliefen. Bislang hatten Hitler und Raeder derartige Kriegsspiele nahe vor den britischen Heimatgewässern verboten, um London nicht zu provozieren.
Doch selbst nach diesem Manöver war Raeder von einer Unterredung mit Hitler zurückgekehrt und hatte Dönitz mitgeteilt: »Er (Hitler) werde dafür sorgen, dass es keinesfalls zu einem Krieg mit England kommt. Denn das wäre ›Finis Germaniae‹. (Deutschlands Ende) Die U-Boot-Offiziere sollten beruhigt sein.«
Das sind sie aber nicht.
Nun trägt Dönitz die Lage vor: Der Krieg gegen Polen sei beschlossene Sache. Doch müsse man nur gegen das Nachbarland – und das bedeute für die Kriegsmarine: ausschließlich in der Ostsee – kämpfen? Der FdU, der Führer der U-Boote, das wird jedem an Bord der Hecht klar, glaubt nicht daran.
Da sei der Faktor Sowjetunion, den niemand kalkulieren könne. Stalin hat sich bis zu jenem Tag nicht entschieden, ob er eher mit den Westmächten oder eher mit Hitler Bündnisse abschließen soll. Er verhandelt mit beiden Blöcken. Muss die Kriegsmarine also damit rechnen, bei einer Eskalation des Konfliktes auch gegen die Rote Flotte anzutreten? Aber selbst das, immerhin, würde »nur« die Ostsee betreffen.
Was werden die Westmächte unternehmen? Treten Großbritannien und Frankreich in die Auseinandersetzung ein, dann sind deren beide Flotten zusammen der Hitlerdeutschlands etwa zehnfach überlegen.
»Die deutsche Kriegsmarine«, wird Raeder später ebenso pathetisch wie schicksalsergeben seine Haltung in seinen Memoiren beschreiben, werde »dann kämpfend und in Ehren untergehen«.
Für Dönitz aber gibt es noch eine andere Option: den Sieg. Wenn Großbritannien und Frankreich zu Gegnern werden, verwandeln sich Nordsee, Ärmelkanal und Atlantik in ein Kriegsszenario. Eine gut 100 Millionen Quadratkilometer große Wasserwüste, ein Kampfschauplatz vom Wattenmeer bis dicht vor die amerikanische Ostküste, von den eisigen Breiten Grönlands und Nordnorwegens über den Äquator hinaus bis zum Kap Horn und zum Ende Afrikas, ein Schlachtfeld, das ein Fünftel der Erdoberfläche bedeckt.
Aber nicht nur das – sondern auch ein Transportweg, ohne den Großbritannien kollabieren würde.
Die britische Handelsflotte ist mit etwa 3000 Schiffen und insgesamt 21 Millionen Bruttoregistertonnen (BRT) die größte der Welt – fast ein Drittel aller Passagierschiffe und Frachter auf den Meeren fahren unter dem Union Jack. (Die deutsche Handelsflotte stellt mit etwa 4,5 Millionen BRT sieben Prozent der globalen Kapazität.) Drei von vier Schiffen, die den Atlantik kreuzen, laufen britische Häfen an.
Fast alle seine Exporte verlassen das Inselreich auf Schiffen. Dazu wird die Hälfte der Nahrung über See importiert, viele Rohstoffe und 100 Prozent des Öls. Kappt man die maritimen Verbindungen Großbritanniens, dann hungert die Nation aus.
Und genau das ist die Strategie von Dönitz.
Er will vor allem mit U-Booten in Nordsee, Ärmelkanal und Atlantik angreifen – und zwar die Handelsschiffe Großbritanniens.
Zivile Schiffe sind unbewaffnet. Sie sind langsam: Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer erreichen Geschwindigkeiten von 25 bis über 30 Knoten. (Ein Knoten entspricht gut 1,8 Kilometern pro Stunde.) Sie können damit U-Booten, die maximal etwa 17 Knoten Fahrt machen, relativ leicht entkommen. Die meisten Frachter, Tanker und Passagierschiffe hingegen laufen um die 15 Knoten – werden sie von einem U-Boot entdeckt, gibt es für sie kein Entkommen.
Versenkt die deutsche Kriegsmarine Handelsschiffe, trifft sie Großbritannien mit verhältnismäßig geringem eigenen Risiko gleich doppelt: Fracht, welche die Insel erreichen soll, wird vernichtet. Und die Schiffe, die neue Fracht transportieren könnten, sinken auf den Meeresgrund.
Das erste deutsche U-Boot, die Forelle, wurde 1902 von Krupp gebaut und zwei Jahre darauf an Russland verkauft. Die Admiräle des Kaisers übernahmen erst 1906 die erste Einheit – Deutschland war die letzte Seemacht, die tauchfähige Kriegsschiffe aufstellte.
Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges besaß das Deutsche Kaiserreich nur die fünftgrößte U-Boot-Flotte der Welt. Trotzdem versenkten kaiserliche U-Boot-Kapitäne insgesamt 12 Millionen BRT Handelsschiffe. Darüber wurden sie zum Mythos auf beiden Seiten der Front.
In Großbritannien und den USA galten die U-Boot-Fahrer, die aus getauchten Schiffen – aus dem »Hinterhalt« – Passagierschiffe und Frachter versenkten, als tückische Krieger und moderne Inkarnationen finsterster Piraterie.
Im Deutschen Kaiserreich hingegen waren sie die Seeleute, die von der mächtigen Royal Navy niemals besiegt worden waren. Hätte es im Ersten Weltkrieg mehr U-Boote gegeben, so die Ansicht, hätten sie Großbritannien »erwürgt« – und Deutschland den Sieg gebracht.
So aber verlor das Kaiserreich den Krieg – und seine Flotte mit ihm.
Im Versailler Friedensvertrag verboten die Alliierten unter anderem den Bau neuer U-Boote und zwangen das Reich auch, alle einsatzbereiten Einheiten herauszugeben.
Doch auch die demokratischen Regierungen der Weimarer Republik dachten nicht daran, auf diese Waffe zu verzichten. Mit Wissen und finanziert von Berlin gründete Krupp 1922 in den Niederlanden das »Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw« (IVS), wo bald 40 deutsche Ingenieure heimlich neue U-Boote entwickelten. 1927 war das erste fertiggestellt und wurde an die Türkei verkauft. Danach produzierte IVS U-Boote in Einzelteilen – Akkumulatoren, Periskope, Dieselmotoren – und schmuggelte sie von den Niederlanden nach Deutschland, wo sie zunächst an geheimen Orten lagerten.
Und nur eine Woche nach der Unterzeichnung des Londoner Flottenabkommens präsentierte die NS-Regierung der Welt das erste neue U-Boot der Kriegsmarine. Rund sechs Monate später verfügte Hitlerdeutschland – dank der heimlich in den Niederlanden vorfabrizierten Teile – bereits über 14 einsatzfähige Einheiten.
Raeder hatte Dönitz, der ja im Ersten Weltkrieg Erfahrungen auf U-Booten gesammelt hatte, 1935 mit dem Au fbau der neuen Waffengattung beauftragt – und der hatte sich wie besessen in die Aufgabe gestürzt. In den folgenden Jahren hatte Dönitz, während nach und nach immer mehr U-Boote in Dienst gestellt wurden, über 1000 Offiziere und Mannschaften rekrutiert. Unermüdlich bildete er sie aus, ließ sie Manöver fahren, Tauchgänge absolvieren, Torpedos schießen. Schnell formte sich bei den U-Boot-Besatzungen ein Korpsgeist aus, sie waren eine Flotte in der Flotte und Dönitz bedingungslos loyal ergeben.
300 U-Boote, so fordert es der FdU seit 1935, seien nötig, um Großbritanniens überseeische Lebensadern zu kappen. Und doch kann Dönitz, als er nun auf der Hecht vorträgt, nur auf gut ein Sechstel dieser Zahl zurückgreifen. Und von diesen sind nur 20 so groß, dass sie von deutschen Häfen aus den Atlantik erreichen und dort die britische Schifffahrt bedrohen können.
Trotzdem schickt er diese 20 U-Boote in einen Einsatz, den er eigentlich für 300 vorgesehen hat.
Alle U-Boote, so verfügt Dönitz, sollen in den nächsten Tagen heimlich ihre Häfen verlassen. Kurs: Nordatlantik. Dort sollen sie abseits der Schifffahrtsrouten auf den Tag X lauern. Wird der Überfall auf Polen zum Krieg mit Großbritannien führen, dann könnten die Einheiten sofort über die Handelsschiffe des Gegners herfallen – vor allem über jene, die, vom Krieg überrascht, noch keinerlei Schutzmaßnahmen getroffen hätten.
Kleinere U-Boote sollen in Nord- und Ostsee stationiert werden. Die beiden Westentaschenschlachtschiffe, die zu schwach wären, sich der Royal Navy in offener Schlacht zu stellen, sollen unter höchster Geheimhaltung losdampfen und im Atlantik Jagd auf britische Schiffe machen.
Dieser Plan geht weit über das rein defensive, möglichst wenig provokative Vorgehen hinaus, das Hitler im Befehl zum »Fall Weiß« gefordert hat. Dönitz will die Kriegsmarine rücksichtslos zum Angriff treiben. Gegen Großbritannien. Und zwar vom ersten Tag des Krieges an.
Und Raeder?
Die Motive des Oberbefehlshabers der Marine sind an jenem warmen Sommertag des Jahres 1939 nicht klar: Sind seine Vertrauensbekenntnisse zu Hitler und dessen Fähigkeiten, die Westmächte aus dem kommenden Konflikt herauszuhalten, nur vorgeschoben? Glaubt auch er längst, wie Dönitz, an einen unvermeidlichen Konflikt mit der Royal Navy, will das aber nicht so offen bekennen wie der forschere Untergebene?
Vielleicht treibt Raeder aber auch eine andere Angst: die vor der Revolution. Im Ersten Weltkrieg lagen die vom Kaiser geliebten Schlachtschiffe die meiste Zeit untätig im Hafen. Erst diese erzwungene Langeweile, so sieht es Raeder, habe die Matrosen empfänglich gemacht für sozialistische und kommunistische Ideen. Und das erst habe den Kieler Matrosenaufstand von 1918 ausgelöst, der letztlich das Signal war für das Ende des Kaiserreiches.
Raeder, der seit 1921 jeden Angehörigen der Marine entlassen hatte, den er »linker« Haltung verdächtigte, muss eine Art zweites Kiel befürchten. Die beiden Westentaschenschlachtschiffe und die großen U-Boote können in der engen Ostsee kaum militärisch wirkungsvoll eingesetzt werden. Sollen sie, wie von Hitler befohlen, gegenüber Großbritannien vor allem abwartend-passiv bleiben, bedeutet das, dass sie so gut wie nie ihre schützenden Häfen verlassen. Wieder würde eine deutsche Kriegsflotte untätig an der Pier liegen. Beschwört das nicht eine neue Revolutionsgefahr herauf?
Was auch immer sein Motiv ist – Raeder stimmt an jenem Tag dem Plan von Dönitz zu: Angriffspositionen im Atlantik einnehmen!
Zu den Offizieren, die an Bord der Hecht den Ausführungen von Dönitz lauschen, gehört auch Oberleutnant Fritz-Julius Lemp: 26 Jahre alt, ein mittelgroßer, breitschultriger Mann mit braunen Augen und einem runden, fröhlichen Gesicht. Er wurde am 19. Februar 1913 im chinesischen Tsingtau als Sohn eines dort stationierten Heeresoffiziers geboren. 1931 ging er als Abiturient zur Kriegsmarine, seit 1936 dient er auf U-Booten. Am 28. November 1938 übernahm er sein erstes Kommando. Er ist der jüngste Kapitän eines atlantiktauglichen U-Bootes der Kriegsmarine. Es ist U-30.
Samstag, 19. August 1939, Haus von Georg Högel, München, gegen Mittag. Die Familie des jungen Funkers ist bei Tisch, als ein Bote mit einem Telegramm an der Tür erscheint: Heimaturlaub abgebrochen; der Herr Oberfunkmaat habe sich bis morgen, 24.00 Uhr wieder an Bord von U-30 einzufinden.
Eine Begründung für diesen Befehl gibt es nicht.
Samstag, 19. August 1939, Marinehafen, Wilhelmshaven, später Abend. Die Admiral Graf Spee legt von der Pier ab. Keine Musikkapellen, kein Fahnenschwenken, keinerlei Zeremonie. Ein paar Minuten später löst sich auch das unauffällige Versorgungsschiff Altmark vom Kai. Der Frachter folgt dem großen Kampfschiff und hat Dieselöl, Lebensmittel und Ersatzteile an Bord. Denn die Admiral Graf Spee soll monatelang auf See bleiben.
Ihr Ziel: der Südatlantik.
Heimlich dampfen die beiden Schiffe aus Wilhelmshaven. Auf der Nordsee nehmen sie Fahrt auf. Es sind die ersten Marineeinheiten, die für den erwarteten Krieg gegen Großbritannien ausgeschickt werden – früher, als von London erwartet. Kein Schiff Seiner Majestät, kein Aufklärungsflugzeug sichtet die Admiral Graf Spee.
Sonntag, 20. August 1939, D-Zug von München nach Wilhelmshaven. Georg Högel sitzt schon wieder in dem Zug, der über Würzburg, Bebra und Göttingen langsam nach Norden rattert. Sein Vater hat ihn am Morgen auf dem Bahnsteig verabschiedet. Beide ahnen, dass eine politische Krise bevorsteht, sonst wäre der Soldat nicht zurückbefohlen worden. Aber welche?
Als der Zug in Hannover einfährt, entdeckt Högel einen Bordkameraden von U-30, der dort zusteigt: den 22 Jahre alten Maschinenmaat Adolf Schmidt.
Die beiden setzen sich zusammen und reden. Nein, sagt Schmidt, er habe kein Telegramm erhalten; sein Urlaub ende sowieso an diesem Tag. Doch seltsam: Als er sich am Bahnhof von seiner Schwester verabschiedet habe, hatte die Tränen in den Augen.
Dienstag, 22. August 1939, Marinehafen, Wilhelmshaven, 3.00 Uhr (2.00 Uhr GMT). Die Pfiffe der Bootsmannsmaatenpfeifen gellen über die Flure der Baracken am Hafen. Georg Högel, Adolf Schmidt und die meisten anderen Seeleute von U-30 schrecken hoch. Für wenige Stunden haben sie in den Betten der Stuben geschlafen, ein letztes Mal an Land. Am Vortag – Högel und Schmidt sind, bepackt mit ihren Koffern, im Laufschritt kurz vor Mitternacht am Sonntagabend angekommen – haben sie das U-Boot mit Vorräten vollgestopft, dann sind sie für einige Stunden auf die Jade ausgelaufen.
Ein Flugzeug hat U-30 dort umkreist und Funksignale gesendet. Högel und die anderen Funker haben diese Sendungen aufgefangen und ihre Peilsender justiert: Sie haben bestimmt, aus welcher Richtung die Signale gesendet wurden. Mit Funkpeilungen können U-Boot-Besatzungen auch mitten auf dem Ozean ihre Position relativ genau bestimmen.
Um 4.00 Uhr läuft U-30 aus. Kapitän Lemp hat sich kurz zuvor persönlich vom FdU verabschiedet. Dönitz warnte ihn noch vor »bewaffneten Hilfskreuzern«, welche Großbritannien möglicherweise schon aufs Meer geschickt habe: Frachtschiffe, die mit Geschützen ausgerüstet seien und einem über Wasser heranfahrenden Boot gefährlich werden könnten.
Seit Tagen schleichen sich nun deutsche Marineeinheiten nachts aus den Häfen, Kurs Atlantik oder Nordsee. Nicht nur eines der beiden Westentaschenschlachtschiffe ist schon unterwegs – auch 14 U-Boote sind bereits der Auslauforder gefolgt. Noch hat die Royal Navy keines der Schiffe entdeckt.
U-30 fährt über Wasser. Ein Arado-Wasserflugzeug der Marine kreist über den Köpfen der Männer, die währenddessen die am Turm aufgemalte Kennnummer »30« übermalen und das Hoheitszeichen – einen metallenen Adler mit Hakenkreuz in den Fängen – abschrauben. Das U-Boot soll nicht mehr so leicht als deutsches Schiff identifiziert werden können.
Gegen 12.00 Uhr fliegt der Pilot der Arado tief über sie hinweg, wackelt zur Verabschiedung mit den Flügeln und dreht ab.
U-30 ist allein auf See.
Nun führt Lemp 43 Mann auf eine über 1000 Kilometer lange geheime Reise: Auf Nordkurs soll er gehen, soll parallel zur dänischen, dann zur norwegischen Küste – aber weit außerhalb der Dreimeilenzone – bis fast zum Polarkreis vorstoßen. Dort wird er Westkurs nehmen und den Inselgruppen der Shetlands und der Färöer ausweichen. Dann ist er im Atlantik.
Dönitz hat U-30 dort ein »Operationsgebiet« zwischen dem 54. und 57. nördlichen Breitengrad und dem 12. bis 19. westlichen Längengrad zugeteilt: ein etwa 320 mal 290 Kilometer messendes Stück Ozean rund 270 Kilometer westlich von Schottlands Küste. Etwas nördlich dieses Gebiets soll Kapitän Lemp im »Wartegebiet U« der kommenden Dinge harren.
U-30 gehört mit U-27, U-28, U-29, U-33 und U-34 zur 2. U-Flottille »Saltzwedel«. Es hat die nördlichste Position aller U-Boote dieser Flottille zugewiesen bekommen.
Erst wenn der Kriegsbefehl per Funk kommen wird, soll Lemp vom Warte- ins Operationsgebiet kreuzen – und fortan jedes britische Schiff versenken, das er sichtet.
Doch Lemp darf, sollte es zum Krieg kommen, trotzdem nicht ohne Vorwarnung schießen. Britische Kriegsschiffe kann er zwar jederzeit angreifen. In der Prisenordnung, also in mehreren internationalen Verträgen, ist die Versenkung eines Handelsschiffes jedoch strengen Regeln unterworfen worden. Hitler besteht auf peinlichster Einhaltung dieses Reglements, denn er möchte verhindern, dass durch die voreilige Zerstörung eines zivilen Schiffes neutrale Staaten, vor allem die USA, gegen Deutschland aufgebracht werden.
Sollte Lemp ein Passagierschiff oder einen Frachter erblicken, muss er zunächst sicher sein, dass es tatsächlich unter dem Union Jack fährt und nicht unter neutraler Flagge. Das gegnerische Schiff muss er sodann durch Funk-, Flaggen- oder Scheinwerfersignale zum Stopp auffordern. Dann soll ein Kommando per Schlauchboot vom U-Boot zum Handelsschiff übersetzen und die Fracht durchsuchen. Besatzung und Passagiere des angehaltenen Schiffes müssen Zeit haben, die Rettungsboote zu besteigen. Und Lemp soll schließlich auch noch dafür sorgen, dass die Zivilisten sicher das Land erreichen – zumindest soll er ihnen den Weg zur nächsten Küste weisen.
Ein enormes Risiko für Lemp und die anderen Kapitäne. Um ein Schiff anzuhalten, muss das U-Boot auftauchen. Dann jedoch ist es verwundbar. Frachter und erst recht schnellere Passagierschiffe könnten ihn durch ein plötzliches Manöver rammen und versenken. Durch Funk kann ein Angegriffener zudem schnelle britische Kampfschiffe wie Zerstörer heranrufen oder gar Flugzeuge, die mit Bomben oder Bordgeschützen eine tödliche Gefahr sind.
Dönitz, der Hitlers Weisung respektieren muss, hat deshalb seine U-Boote abseits der Hauptschifffahrtsrouten positioniert, die wie unsichtbare Straßen den Atlantik kreuzen. So werden sie zwar nur relativ wenige Dampfer sichten – dafür gehen sie aber auch nur ein überschaubares Risiko ein, wenn sie einen anhalten. Denn es ist relativ unwahrscheinlich, dass britische Kampfschiffe außerhalb dieser Routen patrouillieren.
Zudem soll sich kein U-Boot der britischen Küste auf weniger als 180 Kilometer nähern. So bleiben sie außerhalb der Reichweite vieler von Landflughäfen startender Kampfflieger. Ihr bester Schutz ist jedoch die Überraschung – die Admiräle der Royal Navy dürfen nicht ahnen, dass deutsche U-Boote praktisch schon vor ihrer Haustür auf der Lauer liegen.
Deshalb gilt der vordringliche Befehl: Nicht entdeckt werden!
Kurz vor der sommerlichen Morgendämmerung gleitet U-30 aus seinem Heimathafen. Der graue, zigarrenförmige Rumpf – 64,51 Meter lang und 5,85 Meter breit – liegt tief im Wasser, Wogen schwappen über Stahl und das 8,8-cm-Geschütz auf dem Vordeck. Die meisten Besatzungsmitglieder verschwinden im Innern des Schiffes, nur Kapitän Lemp und vier Mann Ausguck stehen auf dem Turm, blicken nach anderen Schiffen, nach Tonnen, Bojen und weiteren Fahrwassermarkierungen, rufen gelegentlich Anweisungen an die Rudergänger und Maschinisten im Rumpf hinunter. Der Turm ist kaum mehr als ein aufgestellter Stahlzylinder, stromlinienförmig abgeflacht wie ein nach oben gerichteter Flügel. Periskope und Funkantennen ragen dort heraus wie Stachel.
Lemp, selbst von den Piers aus zunächst noch im Halbdunkel deutlich als Kapitän zu erkennen, weil er, wie es Tradition ist in der Kriegsmarine, als einziger Mann an Bord eine weiße und keine dunkle Schirmmütze trägt, steht im Turm etwa fünf Meter über der Wasserlinie. U-30 ist ein grauer Schatten im Meer. Selbst aufgetaucht ist ein U-Boot auf einige hundert Meter Entfernung kaum auszumachen, vor allem bei schlechten Sichtverhältnissen. Zuerst kann man an Land die weiße Mütze nicht mehr sehen, bald verschwindet das ganze U-Boot.
Die niedrige Silhouette schützt das Schiff vor Entdeckungen, doch Lemp und seine Männer haben Schwierigkeiten, den Ozean abzusuchen. Ihr Horizont ist begrenzt – und wird noch viel eingeschränkter sein, wenn sie einmal den Atlantik erreicht haben werden. Denn dort stürmen Wellen heran, die bis über die Spitze des dann wild schwankenden Turmes spülen, und die Männer werden nichts sehen als Wasserwände und Gischt.
915 Tonnen Wasser verdrängt U-30, weniger als ein kleines Frachtschiff. Doch es erreicht über Wasser maximal 17 Knoten, getaucht immer noch acht. Und es kann mit den 67 Tonnen Diesel in seinen Tanks bei sparsamer »Marschfahrt« von 12 Knoten ungefähr 8000 Kilometer weit fahren, fast zweimal quer durch den Nordatlantik. Das zumindest ist die Theorie.
Doch U-30 ist ein U-Boot vom Typ VII-A, der ersten Modellreihe, welche die Kriegsmarine nach dem Ersten Weltkrieg für den Einsatz im Atlantik konzipiert hat. Es ist nach ungefähr zehnmonatiger Bauzeit am 8. Oktober 1936 in Dienst gestellt worden. Auf der AG Weser Werft in Bremen wurde das Boot mit der Baunummer 911 im traditionellen Verfahren zusammengesetzt: Zuerst wurde der Rumpf geschweißt, erst dann wurden durch Luken alle anderen Komponenten in das Schiff hineingebaut, selbst die großen Dieselmotoren, die Teil für Teil ins Innere gehievt werden mussten.
Die Dieselmotoren jedoch sind die Schwachstelle von U-30. Die Boote des Typs VII-A gelten Offizieren als pannenanfällig. Zudem verbrauchen sie viel Kraftstoff. Erreicht U-30 nach langer Hinfahrt endlich sein atlantisches Einsatzgebiet, wird es dort nur ungefähr zwei Wochen patrouillieren können, dann muss es zurückkehren.
Dönitz ließ deshalb nur zehn Einheiten dieser Serie bauen, dann wurde der Typ VII-B eingeführt, dessen Tanks doppelt so viel Diesel fassen. Und danach ist die Kriegsmarine zum Typ VII-C übergegangen, der weitere technische Verbesserungen erhalten hat und bald zum Standardboot werden wird.
Der jüngste deutsche U-Boot-Kapitän auf Atlantikkurs steht also bereits am ersten Tag seiner Fahrt unter ungeheurem Druck. Lemp läuft zu einem geheimen Einsatz aus, bei dem ihn niemand entdecken darf. Und von dem noch niemand wissen wird, was er bringt: Wird er eine ereignislose Reise haben? Oder wird er in den Krieg gegen einen schier übermächtigen Gegner ziehen?
U-30 fährt in den Tag hinein – über Wasser. Denn »Untersee«-Boote sind eher »Tauch«-Boote. Nur bei gefährlichen Angriffen oder wenn sie selbst attackiert werden, geben Kapitäne den Befehl, unter Wasser zu gehen. Denn dort ist ein U-Boot nicht nur langsamer als an der Oberfläche, es kann auch kaum mehr als 48 Stunden in der Tiefe verharren. Spätestens dann ist die Luft an Bord, die nicht erneuert werden kann, erstickend. Und die Batterien sind erschöpft, welche statt der stärkeren, doch Abgase erzeugenden und Luft verbrauchenden Dieselmotoren die Maschinen antreiben.
2320 PS leisten die wuchtigen Dieselmaschinen, die im Innern dröhnen, knapp das Dreifache dessen, was die für die Unterwasserfahrt vorgesehenen Elektromotoren aufbringen. Rund die Hälfte der 43 Mann Besatzung kümmert sich ausschließlich um die lauten, wartungsintensiven Anlagen – etwa der Maschinenobergefreite Adolf Schmidt, der seit sechs Jahren in der Kriegsmarine dient.
Jeder an Bord ist freiwillig bei den U-Booten, jeder ein Spezialist auf seinem Gebiet. Georg Högel etwa als Funker ist der Einzige, der von nun an Kontakt halten wird zwischen U-30 auf seiner heimlichen Mission und dem Hauptquartier von Dönitz, einer Baracke an einer Straße mit dem unheilschwangeren Namen »Toter Weg« in Wilhelmshaven.
»Wind Südwest. Stärke 2–3. Welle: Stärke 2. Fahrt vom Wetter kaum beeinträchtigt«, notiert Lemp später im Kriegstagebuch, dem Logbuch des Schiffes. Dunst liegt über der Nordsee. Manchmal ziehen Nebelbänke auf.
U-30 verschwindet außer Sicht.
Dienstag, 22. August 1939, Hafen, Montreal, Kanada. Der Passagierdampfer Athenia legt ab und nimmt Kurs auf den Atlantik. Nächstes Ziel: Glasgow. Seit 16 Jahren pendelt das unauffällige Schiff der Donaldson Atlantic Line zwischen Kanada und Großbritannien.
Diesmal jedoch wird die Routine von Nervosität überlagert. Seit Wochen sind nun schon in der Presse Spekulationen über einen Krieg mit Deutschland zu lesen. Wie stark etwa sind die Festungsanlagen an der deutsch-französischen Grenze, der Westwall und die Maginot-Linie? Wie lange mag Polen gegen einen Angriff der Wehrmacht bestehen? Und: Welche Gefahr geht von deutschen U-Booten aus?
Unter den Matrosen auf den britischen Handelsschiffen jedenfalls laufen schon Gerüchte um, dass draußen auf dem Atlantik irgendwo die gefährlichen U-Boote lauern. Niemand aber weiß Genaueres.
ZEHN TAGE IM AUGUST
Dienstag, 22. August 1939, Flughafen Tempelhof, Berlin, 21.00 Uhr Berliner Zeit (20.00 Uhr GMT). Die viermotorige Focke-Wulf FW 200 Condor rollt zur Startbahn. An Bord des Passagierflugzeuges: der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop mit einer kleinen Delegation. Sein Ziel: Moskau.
In der Maschine sitzt auch Paul-Otto Schmidt, der 40 Jahre alte Chefdolmetscher des Auswärtigen Amtes. Diese unangekündigte Reise hat ihn überrascht. Er ist per Befehl seines Vorgesetzten aus dem Urlaub geholt und mit einem Sonderflugzeug nach Berlin befördert worden.
Stalin, die Sowjetunion, der Kommunismus – verkörpern sie nicht, neben »dem Weltjudentum«, das schlechthin Böse in der nationalsozialistischen Ideologie? Hat Hitler nicht dem östlichen Riesenreich in seinem Werk Mein Kampf den Krieg angedroht?
Doch nun, so erfährt Schmidt, reisen sie überstürzt nach Moskau, um mit Stalin einen Beistandspakt auszuhandeln.
Tatsächlich nutzt der sowjetische Machthaber die durch Hitler verursachte internationale Krise ebenso geschickt wie skrupellos zur Verbesserung seiner eigenen Position. Wochenlang hat Stalin mit Großbritannien und Frankreich verhandelt. Die Westmächte, darauf bedacht, gegen Nazi-Deutschland neue Verbündete zu gewinnen, senden hochrangige Diplomaten nach Moskau.
Doch Stalin verlangt viel: Paris und London müssten akzeptieren, dass die Sowjetunion Osteuropa und das Baltikum als »Interessensphäre« zugesprochen bekomme, als Großregion, in der sie beliebig in die Politik eingreifen, ja Grenzen gewaltsam verschieben könnte. So fordert Stalin unter anderem, dass Polen, sollte die Sowjetunion gegen Deutschland kämpfen, der Roten Armee ein Durchmarschrecht einräumen müsse.
Dies ist für die Regierung in Warschau unakzeptabel. Soll Polen, aus Angst vor der Wehrmacht, die nicht minder gefürchtete Rote Armee freiwillig ins eigene Land lassen? Und sollen die Westmächte, um das verbündete Polen nicht an Deutschland zu verraten, einem Verrat an die Sowjetunion zustimmen? Niemals.
Am 21. August 1939 sind die Verhandlungen in Moskau gescheitert – und Stalin signalisiert noch am selben Tag über die deutsche Botschaft in seiner Hauptstadt, dass er nun mit Hitler zu verhandeln gedenke.
Der schickt Ribbentrop sofort los. Hitler und sein Außenminister sind euphorisch. Zwar denkt er nicht einen Augenblick daran, dauerhaft mit der Sowjetunion in Frieden zu leben. Doch zunächst will er Polen erobern, die Sowjetunion soll später folgen. Gelingt es ihm, mit Stalin ein Abkommen zu arrangieren, dann hat Deutschland, so Hitlers Überlegung, freie Hand. Es wird nicht, wie im Ersten Weltkrieg, zugleich von großen Mächten im Westen und im Osten attackiert.
Die FW 200 fliegt von Berlin aus Kurs Ostsee, um den polnischen Luftraum zu umgehen. Kurz vor Mitternacht landet der Pilot die Maschine auf dem Flugplatz im ostpreußischen Königsberg. Hier wollen die Deutschen im Park-Hotel übernachten.
Ribbentrop kritzelt erregt Seite um Seite mit Notizen für die bevorstehende Verhandlung voll. Die ganze Nacht über ist er wach. Immer wieder telefoniert er mit Mitarbeitern im Auswärtigen Amt. Und immer wieder auch lässt er sich nach Berchtesgaden durchstellen. Dort, auf dem Obersalzberg, wohnt Hitler den Sommer über. Ribbentrop empfängt von ihm letzte Anweisungen.
Paul-Otto Schmidt und seine Kollegen verbringen derweil die Nachtstunden in der Bar des Hotels. Sollte Hitler ein Abkommen mit Stalin erringen, das ist ihnen klar, wird er Polen überfallen. Dann aber, das glauben die erfahrenen Diplomaten, werden London und Paris ihre Kriegsdrohungen wahr machen.
Es ist kurz nach Mitternacht, als Paul-Otto Schmidt mit den anderen in sentimentaler Stimmung anstößt: Sie feiern den Abschied vom Frieden.
Mittwoch, 23. August 1939, Lincoln’s Inn Fields, London, 16.00 Uhr. Die junge amerikanische Schauspielerin Judith Evelyn flaniert mit einer Freundin durch das alte Viertel der Metropole. Evelyn probt eigentlich eine Show am Embassy Theatre in London. Die beiden Frauen sind nun jedoch verwirrt, fast geschockt. Am Morgen haben sie in der Zeitung die Schlagzeile gelesen: »Russian-German Pact Signed«.
Judith Evelyn fürchtet, dass es bald Krieg geben wird. Aber wann? Wird sie rechtzeitig aus Europa entkommen können? Die Konsulate der USA in Europa weisen Bürger der Vereinigten Staaten an, so schnell wie möglich in die Heimat zurückzukehren. Und wer in der Alten Welt bleiben wolle, der solle sich bei den Konsulaten melden und den Grund seines Aufenthaltes benennen.
Zufällig stehen sie und ihre Freundin schließlich vor dem Public Record Office in der Chancery Lane – und beide beschließen, das 1egendäre Domesday Book aus dem 11. Jahrhundert zu betrachten, jenes älteste englische Buch, das fast alle damaligen Städte und Ortschaften verzeichnet und das im Public Record Office aufbewahrt wird. Eigentlich endet die Öffnungszeit genau in jener Minute, doch ein freundlicher Polizist macht sich zum Fürsprecher der Frauen, sodass der Wärter sie schließlich noch einlässt.
Als sie ihm nach wenigen Minuten danken, erwähnt Evelyns Freundin, dass wohl bald viele britische Kunstwerke aus den Museen verschwinden und an sichere Orte gebracht werden würden. Wohin denn das Domesday Book gelangen werde?
»Vielleicht nach Devon«, antwortet der Wächter, »vielleicht nach Essex – oder vielleicht gar nach Berlin.«
Kreml, Moskau, gegen 21.00 Uhr Moskauer Zeit (18.00 Uhr GMT). Stalin lässt Hitler hochleben. Kurz zuvor haben in seinem Beisein der sowjetische Außenminister Wjatscheslaw Molotow und sein deutscher Kollege Ribbentrop nach nur wenigen Verhandlungsstunden den »Nichtangriffsvertrag zwischen Deutschland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken« unterzeichnet. Das Reich und die UdSSR verpflichten sich darin in Artikel 2 feierlich, sich »jeder aggressiven Handlung und jeden Angriffs gegeneinander zu enthalten«.
Doch das ist nicht alles.
In einem Geheimprotokoll zum Vertrag besiegeln Ribbentrop und Molotow im Namen ihrer Regierungen auch das Schicksal großer Teile Europas. »Im Falle einer territorialen und politischen Neuordnung«, so lautet die ominöse Formulierung, stecken beide Mächte »Einflusssphären« ab. Die UdSSR erhält vom Reich freie Hand, wenn sie im Baltikum, in Finnland und in Teilen Südosteuropas Eroberungen machen will. Dafür darf Hitler Polen überfallen. Mehr noch: Stalin will sich am Feldzug beteiligen.
Für »das polnische Staatsgebiet« vereinbaren Ribbentrop und Molotow eine Demarkationslinie, bis zu der im Krieg ihre jeweiligen Armeen vorstoßen sollen, eine Linie »ungefähr (entlang) dem Lauf der Flüsse Narew, Weichsel und San«.
»Ich weiß, wie sehr das deutsche Volk seinen Führer liebt«, ruft Stalin nun aus und hebt sein Glas. »Ich möchte daher auf sein Wohl trinken!«
»Führer-Sperrgebiet« Obersalzberg, Bertechsgaden, etwa 21.00 Uhr Berliner Zeit (20.00 Uhr GMT). Hitler hat nach der sogenannten Machtergreifung 1933 den Berghof oberhalb von Berchtesgaden zur zweiten Reichskanzlei ausgebaut. Mehrere Monate im Jahr residiert er in dem Komplex, in dessen »Großer Halle« sich eine riesige Panoramascheibe komplett versenken lässt, um Licht und Luft hereinzulassen. Am Berghang erheben sich unweit dieses Anwesens die Villen von Martin Bormann, Albert Speer und Hermann Göring, ein Gästehaus der Reichsregierung, eine Kaserne der SS und andere Gebäude.
Hitler hat Raeder und die anderen ranghöchsten Offiziere einbestellt. Es geht um Polen. Am 26. August, so verkündet er ihnen, werde am frühen Morgen der Angriff beginnen. Alle Streitkräfte müssten vorbereitet sein.
Mitten in die Besprechung platzt ein Bote herein, der Hitler einen Zettel überreicht. Es ist eine Nachricht von Ribbentrop: Der Pakt mit der Sowjetunion ist unterzeichnet.
Hitlers Gesicht wird hochrot. »Ich hab sie!«, ruft er triumphierend, dann noch einmal: »Ich hab sie!«
Er schlägt mit der Faust auf den Tisch. Dann verkündet er seinen Offizieren die Nachricht und weist sie an, in ihren Planungen einen Krieg mit der Roten Armee fortan nicht mehr durchzuspielen. Es gehe allein gegen Polen – und vielleicht gegen die Westmächte.
Noch immer mag der mächtigste Mann des Regimes nicht glauben, dass Großbritannien und Frankreich in den Krieg ziehen werden. Nun erst recht nicht.
Dabei hat die britische Regierung, sobald sie durch ihre Diplomaten von Ribbentrops überraschendem Besuch in Moskau unterrichtet worden ist, ihrerseits ihren Botschafter in Deutschland alarmiert. Der eilt von Berlin nach Berchtesgaden, obwohl zu jener Stunde nicht einmal der Vertrag unterzeichnet, geschweige denn das geheime Zusatzprotokoll bekannt ist.
Hitler empfängt den Botschafter, der ihm einen persönlichen Brief des britischen Premierministers Neville Chamberlain überreicht: »Wie das deutsch-sowjetische Abkommen auch immer beschaffen sein mag«, führt Chamberlain aus, »es kann nichts an der Verpflichtung Großbritanniens gegenüber Polen ändern. (…) Es ist behauptet worden, dass, wenn die britische Regierung im Jahre 1914 ihre Stellungnahme klarer zu erkennen gegeben hätte, die große Katastrophe vermieden worden wäre. (…) (D)ie britische Regierung ist jedenfalls diesmal entschlossen, es nicht wieder zu einem so tragischen Missverständnis kommen zu lassen. (…) Es wäre eine gefährliche Illusion zu glauben, dass der Krieg, wenn er erst einmal begonnen hat, frühzeitig zum Abschluss gelangen kann.«
Das sind deutliche Worte. Und sie mögen Hitler an jenem Abend beunruhigen – doch an seinem Entschluss ändern sie nichts. Denn als zu später Stunde Polarlichter über den Himmel flackern, ein außergewöhnliches Ereignis so weit im Süden, da erscheint ihm dies wie ein Omen. »Das sieht nach viel Blut aus«, vernehmen die Offiziere. »Dieses Mal wird es nicht ohne Gewalt abgehen.«
Admiralty House, Whitehall, London, etwa 21.00 Uhr. Seit gut drei Wochen ist Sir Alfred Dudley Pickman Rogers Pound Senior Admiral der Royal Navy, der ranghöchste Offizier der mächtigsten Flotte der Welt. Ein Mann mit einem Gehirntumor und starker Arthritis in der linken Hüfte. Er ist vor allem deshalb auf diese Position berufen worden, weil alle anderen Admiräle der Flotte in noch schlechterem Gesundheitszustand sind als er. (Allerdings ist sein Gehirntumor nur wenigen Marineärzten bekannt, die den Befund der Regierung verschweigen.)
Pound, der in sechs Tagen seinen 62. Geburtstag feiern wird, habe, so wird es später der offizielle Marinehistoriker Seiner Majestät formulieren, »keine geistigen Interessen« und sei »nicht besonders geschickt im Umgang mit Menschen«. Er ist »zu sehr einer extremen Zentralisierung verhaftet und hat eine Schwäche für Terminpläne und Untersuchungskommissionen«.
Ein Offizier verzeichnet in seinem Tagebuch lakonisch, dass Pound bei Generalstabstreffen »neunzig Prozent der Zeit schlief und in den verbleibenden zehn Prozent (…) nicht genau wusste, worüber er eigentlich redete«.