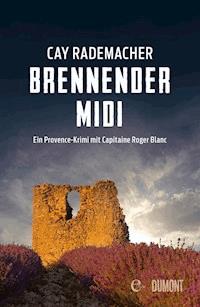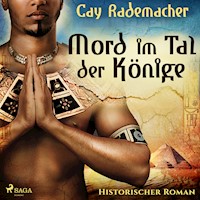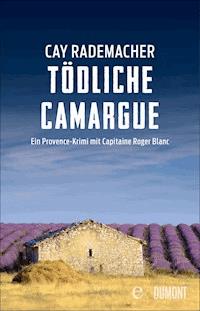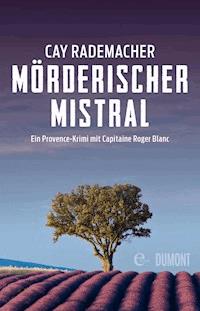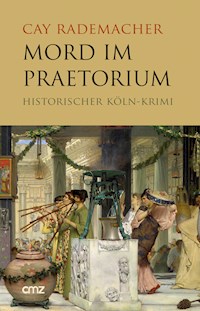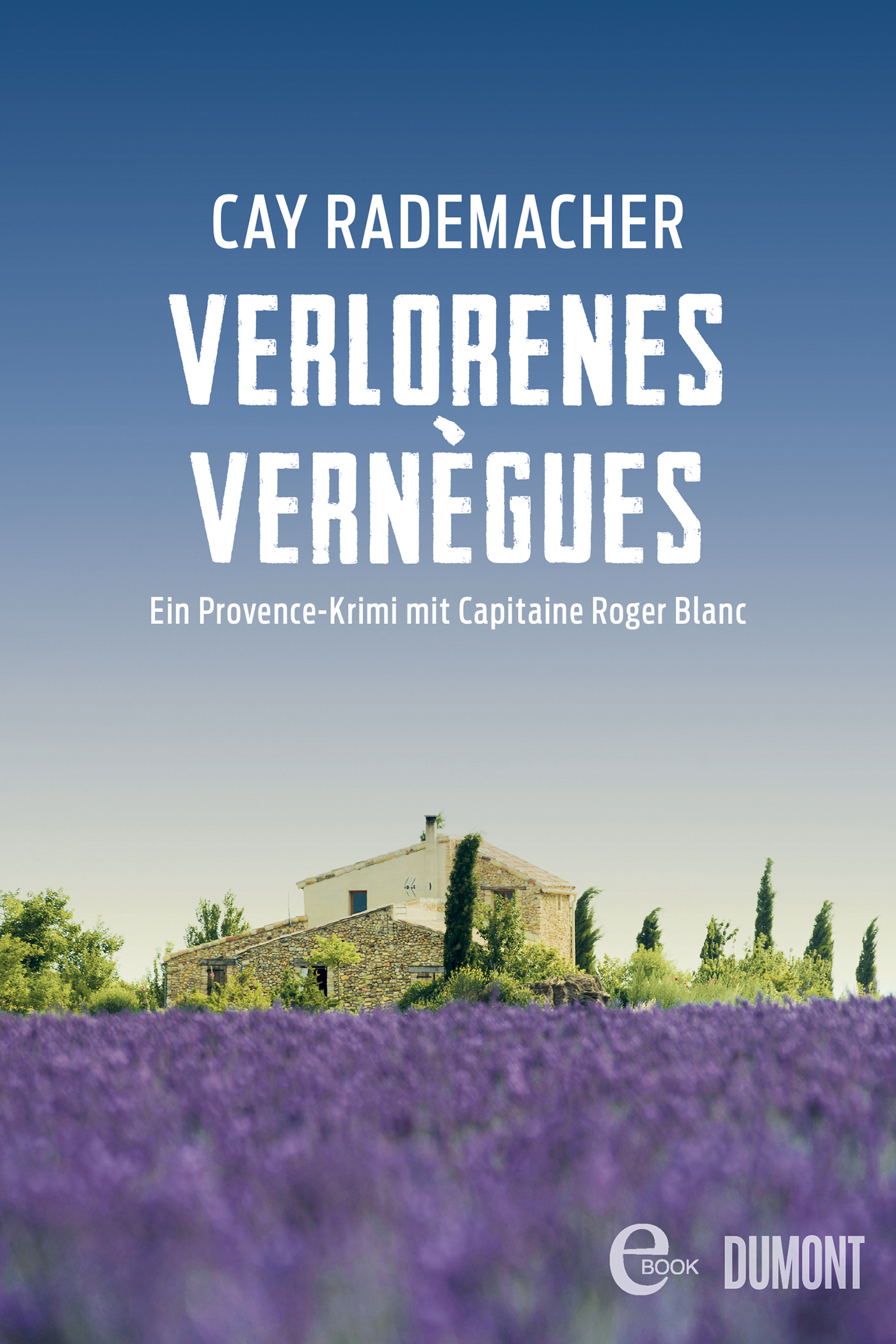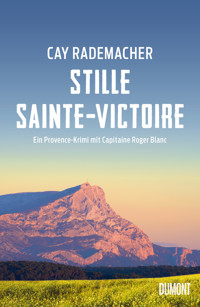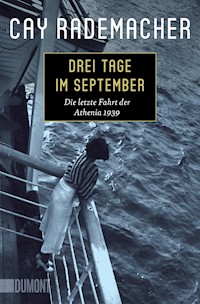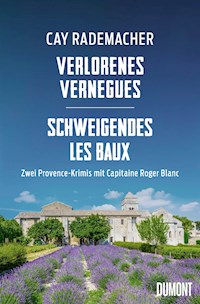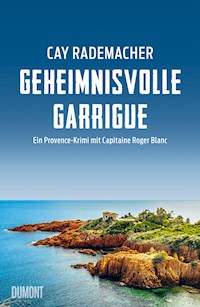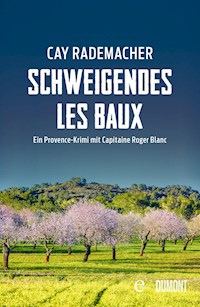9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Schneeweiße Provence, unheimliche Santons und knisternde Spannung Die Ehe von Andreas und Nicola Kantor ist in Routine erstarrt. Da bietet ihnen ein Freund überraschend an, den Winter in seinem Ferienhaus in Miramas-le-Vieux zu verbringen. Weihnachten in der Provence, nur sie beide ... Bald finden sie sich in einem malerischen, halb vergessenen mittelalterlichen Ort wieder. Das Haus ist romantisch, die wenigen Nachbarn sind freundlich. Doch bereits in der ersten Nacht fällt Schnee in einer Landschaft, in der fast nie Schnee fällt. Langsam, aber unerbittlich wird Miramas-le-Vieux von der Außenwelt abgeschnitten. Als Andreas am Morgen allein aus dem eingeschneiten Haus tritt, entdeckt er ein eingestürztes Kellergewölbe und in dessen Trümmern: einen verfallenen Sarg mit einem Skelett darin. In Panik läuft er auf der Suche nach Hilfe durchs Dorf. Seltsamerweise reagiert niemand auf sein Rufen – bis er endlich auf Milène Tanguy stößt, eine Künstlerin, die Santons anfertigt, die provenzalischen Krippenfiguren. Gemeinsam eilen sie zurück zum Gewölbe. Doch der Tote ist spurlos verschwunden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Die Ehe von Andreas und Nicola Kantor ist in Routine erstarrt. Da bietet ihnen ein Freund überraschend an, den Winter in seinem Ferienhaus in Miramas-le-Vieux zu verbringen. Weihnachten in der Provence, nur sie beide … Bald finden sie sich in einem malerischen, halb vergessenen mittelalterlichen Ort wieder. Das Haus ist romantisch, die wenigen Nachbarn sind freundlich. Doch bereits in der ersten Nacht fällt Schnee in einer Landschaft, in der fast nie Schnee fällt. Langsam, aber unerbittlich wird Miramas-le-Vieux von der Außenwelt abgeschnitten. Als Andreas am Morgen allein aus dem eingeschneiten Haus tritt, entdeckt er ein eingestürztes Kellergewölbe und in dessen Trümmern: einen verfallenen Sarg mit einem Skelett darin. In Panik läuft er auf der Suche nach Hilfe durchs Dorf. Seltsamerweise reagiert niemand auf sein Rufen – bis er endlich auf Milène Tanguy stößt, eine Künstlerin, die Santons anfertigt, die provenzalischen Krippenfiguren. Gemeinsam eilen sie zurück zum Gewölbe. Doch der Tote ist spurlos verschwunden …
© in medias res
CAY RADEMACHER, geboren 1965, ist freier Journalist und Autor. Bei DuMont erschienen seine Kriminalromane aus dem Hamburg der Nachkriegszeit: ›Der Trümmermörder‹ (2011), ›Der Schieber‹ (2012) und ›Der Fälscher‹ (2013). Seine Provence-Krimiserie umfasst: ›Mörderischer Mistral‹ (2014), ›Tödliche Camargue‹ (2015), ›Brennender Midi‹ (2016), ›Gefährliche Côte Bleue‹ (2017), ›Dunkles Arles‹ (2018), ›Verhängnisvolles Calès‹ (2019) und ›Verlorenes Vernègues‹ (2020). Außerdem erschien 2019 der Kriminalroman ›Ein letzter Sommer in Méjean‹. Cay Rademacher lebt mit seiner Familie in der Nähe von Salon-de-Provence in Frankreich.
Cay Rademacher
Stille Nachtin der Provence
Kriminalroman
Von Cay Rademacher sind bei DuMont außerdem erschienen:
Der Trümmermörder
Der Schieber
Der Fälscher
Mörderischer Mistral
Tödliche Camargue
Brennender Midi
Gefährliche Côte Bleue
Dunkles Arles
Verhängnisvolles Calès
Verlorenes Vernègues
Ein letzter Sommer in Méjean
eBook 2020
© 2020 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagillustration: depositphotos/numismarty
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7036-3
www.dumont-buchverlag.de
Prolog
Eine Sommernacht
Der Tote im Sarg war so schwer, dass ihnen schon nach ein paar Augenblicken die Schultern schmerzten und das Holz in ihre Handflächen schnitt. Das auf den Deckel genagelte silberne Kreuz glänzte im Mondlicht. Der Sarg passte kaum in den Wagen, die Heckklappe schloss nicht mehr richtig, sie mussten sie mit einem Strick festbinden. Trotzdem hatten sie Angst, dass ihre makabre Ladung in den engen, steilen Kurven aus dem Auto rutschen und auf die Straße schlagen würde. Auch wenn es hier nicht viele Schlafende gab, die von diesem Lärm hätten geweckt werden können. Sie waren erleichtert, als das Ziel erreicht war. Wie viel Zeit war verstrichen? Wie viele Stunden blieben ihnen noch? Zum Glück waren die Nächte im August schon wieder ziemlich lang.
Der Himmel war hoch und so schwarz, als gäbe es keine Atmosphäre mehr auf der Erde, als würden sie schutzlos durch die ewige Dunkelheit des Alls kreisen. Zahllose Sterne glitzerten wie winzige Wunderkerzen; war das da vorne der Große Wagen? Normalerweise konnte man nur im Winter so viele Sterne sehen, nicht im Sommer, wenn die Hitze das Wasser aus dem Mittelmeer und dem Étang de Berre dunsten ließ. Doch der Mistral hatte in den vergangenen Tagen die Luft klar geblasen. Der Mond stand im Zenit, eine bleiche Welt, auf der man mit bloßem Auge Meer und Berge zu erkennen glaubte. Winzige, rasend schnelle Schatten huschten durch das Dämmerlicht: Fledermäuse auf der Jagd.
Im bläulichen Schimmer des Mondes brauchten sie keine Taschenlampe, und die Autoscheinwerfer blieben ausgeschaltet, immerhin das. Sie hielten auf einer steilen, sich nach rechts windenden Gasse an und stellten den Motor ab. Die Stille flutete zurück, jeder konnte den Atem des anderen hören. Als sie den Sarg aus dem Auto zogen, kratzte er irgendwo über Blech, und es kam ihnen so vor, als würden die uralten Mauern der Ruinen ein Echo durch das halb verlassene Dorf schicken. Es war wieder mild geworden, seitdem der Wind sich am letzten Abend verweht hatte. Jeder Atemzug schmeckte süß nach Rosen und Lavendel, die in einem Garten weiter unten im Tal blühten. Hier oben hatte niemand einen Garten angelegt, dafür war der felsige Boden zu karg. Viele Häuser waren verfallen, schwarze Blöcke, schwärzer als die Nacht. Über ihnen ragte eine Mauer der zerstörten Burg auf, eine riesige, gezackte Wand, die einen Teil des Firmaments verbarg. Vor Jahrhunderten hatten die einstigen Bewohner Keller in den Berg geschlagen, die heute eingefallen waren und die niemand mehr kannte.
Fast niemand …
Das unterirdische Gewölbe im Schatten der Burgmauer war nicht sehr groß, vermutlich war es einst eine Vorratskammer hinter einem Wohnhaus gewesen: eine Grube, kaum zwei Meter lang und einen Meter breit, vielleicht anderthalb Meter tief, überdacht von einem Gewölbe, das schon im Mittelalter gemauert worden war. Ein paar in den Felsen gehauene Stufen führten hinab, eine Steinplatte blockierte den Zugang.
Das ideale Grab.
Sie schleppten den Sarg hinunter. Unter der Last gab einer von ihnen aufstöhnend nach, und die schwere hölzerne Kiste schlug dumpf auf eine Stufe, es hallte in der Kammer. Sie hielten den Atem an und lauschten. Nichts. Also weiter. Endlich hatten sie den Sarg an seinen Platz geschoben, er füllte die Kammer beinahe vollständig aus, sodass sie über seinen Deckel zurückrutschen mussten, um bis zur Treppe zu gelangen.
Nun holten sie Steine und Geröll herbei. Der Hügel, auf dem die alte Stadt erbaut worden war, war ein riesiger Sandsteinfelsen, dessen Flanken von Regen und Frost zermürbt worden waren. In den Ruinen und verwilderten Höfen lagen überall Brocken herum, man musste sie nur einsammeln und auf die Stufen und das Gewölbe schichten. Als die Sonne schon so dicht unter dem Horizont stand, dass der Himmel in rosa- und orangefarbenen Schleiern leuchtete, war von der Felsenkammer nichts mehr zu erkennen, man sah bloß noch von Steinen bedeckten Boden, fast so wie überall in den Ruinen von Miramas-le-Vieux.
Jemand bekreuzigte sich und flüsterte: »Ein schönes Grab.«
Das waren die einzigen Worte in dieser Nacht.
19.Dezember
Miramas-le-Vieux
Andreas Kantor betrachtete die Burg über der düsteren alten Stadt auf dem Hügel. Ein kalter Ostwind trieb graue Wolken über den Himmel, so niedrig, dass sie die Mauern umspülten wie Wellen. Die mittelalterliche Festung war aus sorgfältig behauenen, gelblichen Steinen gefügt. Aber irgendein längst vergessener Krieg oder ein Erdbeben oder einfach die Zeit hatte sie verwüstet: Die Mauer war an manchen Stellen geborsten, ihre Krone war zu einer unregelmäßig gezackten Linie verfallen, und dahinter war nichts als Luft, kein Turm, kein Palast, keine Kapelle. Die Festung und die Häuser des verlassen wirkenden Städtchens bekrönten einen steilen, felsigen Berg, der hundert, vielleicht zweihundert Meter hoch war, schätzte Andreas, der aber nicht gut war mit solchen Schätzungen. Wie er überhaupt nicht gut war mit Zahlen, mit Entfernungen, Maßen, Kalkulationen, mit Geld und Summen und Bilanzen, aber daran wollte er jetzt lieber nicht denken. Er hatte seinen Wagen, das einzige Auto hier, auf einem Parkplatz abgestellt, eine steinige, kahle Fläche am Ende der einzigen schmalen Landstraße, die bis vor den Hügel von Miramas-le-Vieux führte – aber nicht weiter hinauf, denn eine Schranke versperrte den Weg.
Andreas streckte seinen nach der langen Fahrt schmerzenden Körper, machte rollende Bewegungen mit den Schultern, lockerte die Muskeln. Früher hatte er nie solche Beschwerden gehabt, jetzt fühlte er sich nach ein paar Stunden Autofahrt wie durchgeprügelt.
Weihnachten in der Provence.
Was hatte er erwartet? Blauen Himmel, Zypressenalleen und Olivenhaine, eine gnädige Sonne, mildes Licht und Mittagswärme, ein funkelndes Glas Rosé auf der steinernen Terrasse eines restaurierten alten Weinguts? Aber auch im Midi ging die Sonne Mitte Dezember schon kurz nach fünf Uhr nachmittags unter. Ihre letzten Strahlen fielen jetzt wie weiße Lichtschleier durch die Wolkendecke.
Andreas blickte auf Gestrüpp und Wälder, auf Eichen und Pinien, auf einen riesigen Teppich dunkelgrüner, beinahe schwarzer Kronen, der den Berg von Miramas-le-Vieux umgab. Hier und dort taten sich Lücken darin auf, als wäre der Stoff zerschlissen: winterkahle Gärten, verwilderte Felder und zwei oder drei Olivenhaine mit Reihen knotig gewachsener Bäume, die ihn unwillkürlich an die Kreuze eines Massengrabs erinnerten. Der Erdboden zwischen ihren Stämmen war schwarz-rot und sah mürbe aus, es musste seit Tagen, vielleicht Wochen nicht mehr geregnet haben. Doch die Luft schmeckte nach Schnee, und ihm kam es so vor, als würde mit jeder Minute, die die hinter den Wolken verborgene Sonne tiefer sank, die Temperatur um ein Grad fallen. Er schlug den Kragen seiner schwarzen Trekkingjacke hoch.
»Müssen wir etwa unsere Koffer zu Fuß da raufschleppen?« Nicola hatte die Beifahrertür geöffnet, war aber noch sitzen geblieben. Sie blickte hoch zu Miramas-le-Vieux und ihm nicht in die Augen.
Andreas war geistesgegenwärtig genug, die scharfe Erwiderung, die sich ihm schon wie von selbst aufdrängte, gerade noch rechtzeitig hinunterzuschlucken. »Ich bin sicher, es sind nur ein paar Schritte bis zum Haus, Schatz«, antwortete er.
Sie waren mitten in der Nacht aus Deutschland aufgebrochen, um die Provence noch bei Tageslicht zu erreichen. Schnee in der Eifel. Schneeregen in den Vogesen. Regen im Tal der Rhône. Erst hinter Orange hatten die Niederschläge aufgehört, und er hatte einen Scherz gemacht – einen schwachen, zugegebenermaßen –, dass mit der Provence die Sonne kommen würde, aber Nicola hatte geschwiegen, selbstverständlich hatte sie geschwiegen, was hätte sie auch dazu sagen sollen? Sie waren im Rhythmus des gerade neu erstandenen Tesla gefahren: ein paar Hundert Kilometer Autobahn, dann eine Stunde an die Ladesäule, pappiges Raststättenessen, einen Espresso, dann die nächsten Kilometer, die nächste Ladesäule, der nächste Espresso. Andreas war stolz auf den Tesla, ein Auto wie ein Raumschiff: schnell, lautlos, klar. Leider war ihm erst auf dieser, ihrer ersten gemeinsamen langen Fahrt bewusst geworden, dass früher das Brummen des Dieselmotors die Stille zwischen Nicola und ihm ausgefüllt, zumindest erträglich gemacht hatte. Im hermetisch stillen Elektrowagen hingegen schienen die wenigen Worte, zu denen sie sich aufgerafft hatten, einfach verschluckt zu werden, bevor einem auch nur eine passende Antwort einfallen konnte.
Andreas war erschöpft, noch erschöpfter als sonst, doch er spürte: Wenn er jetzt, nach dieser endlosen, schweigsamen Fahrt, auch noch einen Streit begann, dann könnten sie gleich wieder nach Deutschland zurückkehren – falls Nicola dann überhaupt noch Lust hatte, ein zweites Mal so viele Stunden neben ihm auszuharren.
»Ich trage den Koffer, du kannst die kleine Tasche nehmen«, sagte er und eilte um das Auto. Er reichte ihr die Hand, damit sie leichter aussteigen konnte. Nicola blickte ihn einen Moment lang überrascht an, zögerte, dann griff sie nach seiner Rechten und erhob sich. Andreas hoffte, dass sie nicht spürte, wie er erzitterte, als er ihre Hand auf seiner spürte. Nicola war fünfzig Jahre alt, nicht einmal vier Wochen jünger als er, sie war klein, ihr Leib war noch immer schlank und biegsam. Sie hatte dunkle Augen und trug ihre schwarzen Haare noch genauso offen wie zu ihrer Zeit an der Universität, als sie sich kennengelernt hatten. Zwei, drei graue Strähnen schimmerten jetzt darin, aber ansonsten hatte sie sich nicht verändert, fand er. Andreas hätte jetzt gern ihre Hand umfasst und Nicola zu sich gezogen, hätte gern sein Gesicht in ihren duftenden Haaren vergraben, hätte sie gern so fest umarmt, dass er ihre Brüste auf seiner Brust spürte.
Keine gute Idee.
Ihre Hand glitt von seiner Hand wie Wasser. Sie öffnete den Kofferraum, atmete tief durch, als müsste sie sich einem Kampf stellen, und sagte: »Dann wollen wir mal.« Sie zwang sich zu einem Lächeln.
Andreas erkannte, wie viel Mühe es sie kostete, aber besser ein angestrengtes Lächeln als gar keines. Er lächelte zurück.
Am Ende des Parkplatzes, nahe an der Schranke, stand ein großes, grün gestrichenes eisernes Kreuz auf einem Sockel aus gelbem Stein. Ein Bildnis der Heiligen Jungfrau war wie ein metallener Scherenschnitt mitten in das Kreuz gesetzt worden. Einst tat wohl eine Inschrift kund, wer dieses Monument errichtet hatte, und warum. Doch die Plakette war verschwunden, nur eine leere Fläche im Sockel verriet noch, dass sie in längst verwehten Jahren hier angebracht gewesen war. Auf dem Platz war niemand zu sehen, auf der Gasse dahinter auch nicht. Sein Kollege Martin hatte Andreas vor dieser Stille gewarnt, aber er war trotzdem überrascht, dass sie nun wirklich keine Seele bemerkten.
Martin – Oberstudienrat, zweimal geschieden, dreimal verheiratet, vier Kinder, wie er gerne verkündete – war ein Bonvivant, der Frankreich liebte. Er hatte vor weniger als einem Jahr ein Ferienhaus in Miramas-le-Vieux erworben, ein Gemäuer aus dem sechzehnten Jahrhundert, das bereits irgendein Vorbesitzer renoviert hatte. Martin hatte eigentlich mit einem Teil seiner unübersichtlichen Familie die Weihnachtsferien hier verbringen wollen, doch dann hatte sich Ehefrau Nummer drei den Fuß so kompliziert gebrochen, dass sie operiert werden musste. Martin hatte im Lehrerzimmer herumgefragt, ob nicht irgendjemand Lust hätte, nach Miramas-le-Vieux zu fahren. Er suchte einen »Housekeeper«, wie er das nannte, jemanden, der im Winter heizte, der aufpasste, dass die Leitungen nicht einfroren und platzten, dass die Dachschindeln nicht vom Mistral hinuntergeweht wurden, dass kein loser Fensterladen im Wind schlug, bis er splitterte, kurz: Wer über Weihnachten dorthin zog, der musste nicht einmal etwas dafür bezahlen.
Es war ein Gefallen, gewissermaßen, sagte sich Andreas, ein Gefallen für den lieben Kollegen Martin. Und dass die Sache gratis war, war bloß ein angenehmer Nebeneffekt. Er hatte sich noch im Lehrerzimmer spontan gemeldet, beinahe kam er sich so vor wie einer seiner Schüler. Hatte zudem einfließen lassen, dass er seinen letzten Kurs bereits am achtzehnten Dezember geben müsse und also noch vor Beginn der eigentlichen Urlaubszeit im Süden sein könne. »Falls in deinem Haus tatsächlich was zu reparieren ist, dann können wir das erledigen, bevor die Baumärkte schließen.«
Und so waren sie für die Weihnachtszeit an dieses Haus gekommen und blickten nun auf eine schwere Wolkendecke und schmeckten Schnee statt Rosé unter einem blauen Himmel. Das fing ja gut an. Andreas unterdrückte einen Seufzer, eigentlich konnte es doch jetzt nur noch besser werden, oder?
Sie gingen die Straße hoch und zwängten sich links an der Schranke vorbei. Ein Vorhängeschloss blockierte den Balken, aber einige Autos parkten weiter oben am Rand der engen Gasse, also mussten doch ein paar Menschen auch im Winter in Miramas-le-Vieux leben, und die hatten wohl alle einen Schlüssel zur Schranke, um bis zu ihren Häusern zu fahren. Davon hatte Martin nichts gesagt. Was er aber erzählt hatte, war: Die mittelalterliche Stadt war im neunzehnten Jahrhundert aufgegeben worden, weil man eine wichtige Eisenbahnlinie von Paris bis ans Mittelmeer nicht über den Berg von Miramas-le-Vieux legen wollte, sondern durch die Ebene unterhalb des Orts. So war vor hundertfünfzig Jahren im Flachland ein neues Miramas neben der Linie entstanden, weil die Bewohner den Schienen und also den Versprechungen der Moderne entgegengezogen waren. Ein Versprechen, das in gewisser Weise gehalten worden war, denn heute konnte man von dort in viereinhalb Stunden mit dem TGV Paris erreichen. Die alte Stadt auf dem Hügel hingegen ließen die Bewohner mehr als hundert Jahre lang achtlos verfallen – bis vor einiger Zeit ein paar Lebenskünstler damit begonnen hatten, eine Handvoll Eiscafés, Restaurants und Galerien in den Ruinen einzurichten. Danach waren auch manche Häuser wieder renoviert worden, doch mindestens die Hälfte des Ortes war noch immer ein Trümmerfeld. »Im Sommer ist inzwischen viel los, im Winter wohnen hier aber keine zwanzig Leute«, hatte Martin verraten und mit den Augen gezwinkert. »Du und Nicola, hier könnt ihr endlich mal ganz allein sein.«
Genau das war es, was Andreas gerade auch dachte, nur war ihm dabei leider nicht nach Augenzwinkern zumute.
Sie folgten der Straße ein Stück den Berg hoch, in der Rechten trug er den Koffer, der doch schwerer war, als er gedacht hatte, und einen Zettel in der Linken, auf dem ihm sein Kollege eine Wegbeschreibung skizziert hatte. Noch war ihnen niemand begegnet. Sie hatten die ersten Häuser erreicht, eigentlich sahen sie ganz gepflegt aus, doch die Fensterläden waren geschlossen, und nirgendwo drang ein Lichtschimmer auf die nun langsam dunkler werdende Straße, nicht mal aus den Gebäuden, vor denen Autos parkten. Es stank nach Katzenpisse; er hörte, wie Nicola scharf durchatmete. Dann fand er den Weg, den Martin ihm beschrieben hatte: links von der Gasse abzweigend, sehr steil den Hügel hoch. Das Pflaster war schief, die Steine sahen aus, als wären sie im Mittelalter in den Boden geschlagen worden und als hätte sich seither niemand mehr die Mühe gemacht, den Weg auszubessern. Andreas blickte auf, verdammt, wie schwer dieser Koffer und wie lang dieser Weg war! Doch sie hatten es schon ein Stück weit den Hügel hinaufgeschafft, über ihnen ragte die Burgmauer nun viel gewaltiger auf, zehn, zwanzig Meter war sie wohl hoch, ein Abschnitt des Weges war bereits in ihrem Schatten versunken. Nun erst erkannte er, dass in die Mauer ein Torbogen eingelassen worden war, ein Halbkreis aus Stein, allerdings ohne Tor, ohne Fallgitter, dahinter nur der erste Stern, der am violett verfärbten Himmel glitzerte.
Endlich öffnete sich der steile Weg auf eine asphaltierte Straße hin: Rue Frédéric Mistral, ziemlich pompöser Name, Nobelpreisträger, aber eigentlich bloß eine Art Gasse, die, sich nach links windend, den Berg weiter hinaufführte, doch glücklicherweise nun im flacheren Winkel. Er blickte zurück in die Ebene, auf Eichenwälder und einzelne Gehöfte, deren Fenster einladend gelb leuchteten, aus den Kaminen stiegen graue Rauchfahnen. In der Ferne glänzte die südliche Hälfte der Wasserfläche des Étang de Berre im Abendlicht. Die nördliche Hälfte hingegen war grau; es sah aus, als würde es dort aus einer der niedrigen Wolken regnen oder sogar schneien.
Zu ihrer Rechten waren ein paar Häuser an die Felswand gequetscht. Sie erreichten keuchend das letzte Haus dieser Reihe, dahinter gab es nur noch Felsen und den Aufstieg zur Burg.
»Wir sind da«, verkündete Andreas schwer atmend. »Hübsch, nicht wahr?«
Nicola sah aus, als wollte sie darauf etwas erwidern, hätte sich dann aber eines Besseren besonnen.
Das Haus wirkte, als wäre es altersschwach und müsste sich an den Felsen lehnen, es war ein wenig schief, schmal, aus grob zurechtgehauenen Sandsteinen gemauert; nur eine Hälfte der Fassade war hellgelb verputzt, als wäre einem Vorbesitzer mitten in der Arbeit die Lust vergangen. Oder das Geld, dachte Andreas bitter, er konnte das nachfühlen. Die hölzernen Fensterläden und der Türladen waren ochsenblutrot gestrichen und unbeschädigt, wie er erleichtert bemerkte, der Wind hatte sie nicht zerschlagen, das war eine von Martins größten Sorgen gewesen. Er stellte den Koffer ab und wartete, bis sich sein Puls etwas beruhigt hatte. Dann fischte er einen schweren Eisenschlüssel, beinahe so lang wie sein Unterarm, aus der Tasche, die Nicola getragen hatte, und steckte ihn ins altertümliche Türschloss. Er musste etwas daran rütteln, auch diesen Trick hatte ihm sein Kollege verraten, dann gab der eingerostete Mechanismus nach, und die Tür ließ sich öffnen.
Sie traten in einen winzigen Flur. Andreas tastete die Wand ab, bis er einen Lichtschalter fand, einer von den alten Schaltern aus Porzellan, die man drehen musste und die man als sündhaft teure Replik bei Manufactum kaufen konnte. Andreas hätte gern die Wohnung in Hamburg damit ausgerüstet, aber Nicola hatte sich geweigert, Lichtschalter zu erstehen, die so viel kosteten wie Armbanduhren, und selbstverständlich wäre es Wahnsinn gewesen, das sah selbst er ein. Er drehte den Schalter, bis er ein leises Klacken hörte. Halb erwartete er, dass gar nichts geschah oder dass irgendwo im Innern des düsteren Hauses eine Sicherung funkensprühend ihren Geist aufgab. Doch stattdessen flammte eine Reihe LED-Spots auf, die den Flur am Eingang in schmeichlerisches Licht tauchten. Eine Decke aus Holzbalken, weiß gekalkt. Die Wände waren mit einer hellgelben Farbe verputzt, die sich, als er sie berührte, wie Wachs anfühlte. Auf dem Boden lagen kleine, dunkelrote Fliesen, vielleicht sogar noch die Originale aus dem sechzehnten Jahrhundert, die bloß neu verfugt worden waren.
Sie wandten sich nach rechts in die Stube: eine gelb geflieste Küche, mit Kacheln, auf die Olivenzweige und Lavendelblüten gemalt waren, was überraschenderweise überhaupt nicht kitschig wirkte. Ein Gasherd, ein moderner Kühlschrank, ein vom Alter eingedunkelter, solider Holztisch, vier Stühle, viel mehr Platz gab es hier nicht. Drei Wände waren in der warmen Wachsfarbe gehalten, die Rückseite war der nackte Fels, an den das ganze Haus gebaut war. In der rechten Ecke des Raums war ein Kamin vor die Felswand gemauert worden, vor dem ein abgewetztes Sofa stand. Es gab nur ein Fenster, das zur Gasse wies und einen Blick auf die Wälder und einen Zipfel des Étang de Berre bot. Jenseits der Wohnküche gab es nur noch eine fensterlose Kammer mit Tür, eine Art Schuppen mit einem altersschwachen Holztor oder vielleicht eine Garage für ein Auto, das allerdings deutlich kleiner als ihr Tesla hätte sein müssen, um dort hineinzupassen.
Nicola stieg vor ihm die hölzerne Treppe ins Obergeschoss hoch. Ihr Lächeln war endlich echt, sie blickte sich neugierig um, das Haus begann ihr offenbar zu gefallen. Sie war wütend gewesen, als Andreas an jenem Nachmittag von der Schule zurückgekommen war und ihr verkündet hatte, dass er für Martin den Housekeeper spielen wolle.
»Du entscheidest immer alles allein, nie fragst du mich!«, hatte sie gerufen. »Wozu gibt es Handys? Wenn wir denn schon zwei teure Handys haben …« Tatsächlich hatte er die beiden iPhones für seine Frau und sich auch spontan gekauft, ohne Nicola um ihre Meinung zu bitten. Das Ganze war dann leider zu einem ihrer inzwischen recht häufigen Kräche eskaliert, das volle Programm mit Türenschlagen, und am Ende hatte er sich statt im Ehebett auf der Wohnzimmercouch wiedergefunden.
Doch nun schien Nicola ihm diese Szene verziehen, sie zumindest verdrängt zu haben. Sie schien die kleine Stiege zu mögen, die hölzernen Decken, die warmen Töne von Böden und Wänden. Andreas folgte ihr und wurde mit jeder Sekunde zuversichtlicher. Oben gab es ein Bad, sogar mit einer emaillierten Eisenwanne, die auf löwenköpfigen Füßen stand. Und daneben lagen zwei Schlafzimmer, winzig, sauber, uralte Fliesen am Boden, Holz an der niedrigen Decke, die wunderbar wachsweiche Farbe an den Wänden, der Felsen im Rücken. Nicola stellte ihre Tasche im größeren der beiden Schlafzimmer ab und öffnete eine Tür, die von dort aus auf das Flachdach des Anbaus führte. Es war zu einer Terrasse ausgebaut worden, mit schmiedeeisernem Geländer und Sonnendach. Andreas trat hinaus und sah zwei Liegestühle, die durch eine Plastikfolie geschützt waren. Sein Kollege, oder vielleicht schon der Vorbesitzer, hatte zwei Kunstwerke aufgestellt: einen kitschigen, dicken Engel aus weiß gestrichenem Beton und einen Storch, der aus Blechteilen zusammengelötet war.
»Hübsch«, wiederholte Andreas und hörte selbst, dass er nun zuversichtlicher klang. Seine Frau widersprach ihm nicht.
Er ging hinein, weil ihm auf der Terrasse kalt wurde. Im Schlafzimmer stand ein hölzernes Doppelbett – aber nur eins vierzig breit, schätzte er. Umso besser. So würden Nicola und er eng beieinanderliegen müssen. Ein Bauernschrank aus dunklem Nussholz stand vor der Felswand. Bevor Andreas die Tür öffnete, um die Sachen aus dem Koffer dort zu verstauen, betrachtete er sich unauffällig im alten Spiegel der Tür, der an manchen Stellen schon stumpf geworden war. Er war nicht besonders groß, aber schlank – es lohnte sich, zweimal die Woche ins Hallenbad zu gehen, um einen Kilometer abzureißen. Er hatte Bekannte in seinem Alter, die waren deutlich stärker aus dem Leim gegangen. Seine Haare waren ein bisschen dünner geworden, er hatte jetzt Geheimratsecken, und an den Schläfen waren sie nicht länger schwarz, sondern grau, aber er fand, dass das auch noch ganz passabel aussah. Außerdem brauchte er keine Brille, hundertfünfundzwanzig Prozent Sehschärfe, seine Schüler waren immer wieder erstaunt, dass er mitlesen konnte, wenn sie ihre Klausuren schrieben und er durch die Reihen ging.
Seine Schüler …
Französisch und Englisch, er liebte seine Fächer, wirklich, seit fünfundzwanzig Jahren unterrichtete er sie an dem Gymnasium, wo er selbst einst Schüler gewesen war. Doch irgendwann – Andreas hätte nicht sagen können, wann eigentlich genau – war es ihm immer schwerer gefallen, vor seine Klassen zu treten. Zuerst war es ungefähr so gewesen, als würde er durch eine gegenläufige Strömung durchs Wasser waten müssen, wenn er nach der Pause zu seinem Raum schritt. Inzwischen jedoch fühlte er sich wie ein Soldat, der in den Schützengraben zurückkommandiert wurde. Vor vier Tagen hatte er mitten im Unterricht einfach aufgehört zu reden und erschöpft aus dem Fenster gestarrt. Zwölfte Jahrgangsstufe, ein toller Kurs, zum Glück für ihn. Die Schüler hatten ein paar Augenblicke höflich darauf gewartet, dass er fortfuhr, schließlich hatte sich Lara erhoben, die Kurssprecherin, und zögernd gefragt: »Herr Kantor? Fühlen Sie sich nicht gut?«
Ein wunderschönes, kluges Mädchen, das ihn besorgt anblickte, so war er wieder zu sich gekommen. Er hatte irgendeine Entschuldigung gemurmelt, sich ein Lächeln abgerungen und mit Camus weitergemacht, und die Unterrichtsstunde hatte sich schier endlos gedehnt. Andreas blickte aufs Bett. Plötzlich kamen ihm seine Gedanken von vorhin lächerlich vor, all die Träume, die er in Deutschland mit dem Provence-Urlaub verbunden hatte, nur Nicola und er, viel Zeit, kein Stress … Die Tage hier im Süden – und danach die Wochen, Monate, Jahre, die noch kommen würden, in Hamburg oder wo auch immer – würden ihm nicht Nicolas verführerisches Lächeln zurückbringen, sondern stattdessen mehr und mehr verstörte Blicke wie die seiner besten Schülerin.
Nicola stand noch immer auf der Terrasse, durch die Tür fuhr ein eisiger Luftstrom hinein, und Andreas glaubte, dass sie so lange dort draußen ausharrte, bis er das Schlafzimmer verließ, weil vielleicht auch sie ganz genau wusste, was ihm gerade durch den Kopf ging. Wenn er schon ausgebrannt war, dann konnte er ja auch Feuer machen, dachte er in einem Anflug von Zynismus.
»Ich kümmere mich mal um den Kamin«, rief er. »Martin hat behauptet, es liegt Holz im Garten.«
»Garten« war übertrieben. Andreas stolperte die enge Treppe hinunter bis in den Flur, wo sich nach links eine Tür zu einer Art Hof öffnete, einem nur wenige Quadratmeter großen Dreieck, das sich unter der Felswand erstreckte. Ihn fröstelte, als er hinaustrat. Die Luft war feucht und roch nach Moos. Der Boden war zu steinig, um irgendetwas anzupflanzen. Sein Kollege hatte ein hölzernes Hochbeet aufgestellt, in dem im Sommer vielleicht irgendwelche Kräuter blühten, jetzt aber nur noch unbestimmbare vertrocknete Stängel und Blätter auf der krümeligen schwarzen Erde lagen. Eine etwa zwei Meter hohe Mauer schloss den Hof zur Gasse hin ab, eine kleine, grün gestrichene Eisenpforte war dort eingelassen. Neben dieser Pforte hatte Martin Holzscheite gestapelt. Etwas glitzerte auf dem Holz. Andreas dachte einen Moment lang an Glassplitter, doch als er das Holz berührte, löste sich das Glitzern auf. Eine Schneeflocke. Einzelne Flocken fielen vom Himmel, zu wenige, als dass er sie im Dämmerlicht hätte erkennen können. Nur dort, wo sie auf dem Boden aufkamen, leuchteten sie für einen letzten Augenblick auf, bevor sie vergingen.
Andreas nahm einen Arm voll Scheite und schleppte seine Last hinein bis vor den Kamin. Er hatte einige der schönsten Winter seiner Kindheit auf dem Bauernhof der Großeltern in der Eifel verbracht, sodass er wusste, wie man ein Kaminfeuer entzündete, ohne dass gleich das ganze Haus verqualmt wurde. Nach kurzer Zeit loderten die Flammen auf, und der Rauch zog tatsächlich durch den Schornstein ab. Gut. Auch das war eine Sorge von Martin gewesen: dass Vögel ein Nest auf dem Kamin gebaut und diesen blockiert hätten. Schon bildete sich Andreas ein, dass es wärmer wurde im Haus.
Irgendwann kam Nicola von oben herunter und setzte sich neben Andreas auf einen Stuhl. Sie hielt ihre Hände in Richtung der Flammen. »Das tut gut«, sagte sie.
»In ein paar Stunden ist das ganze Haus warm«, erwiderte er. »So groß ist es ja zum Glück nicht.«
Seine Frau deutete auf den blanken Felsen, der die Rückseite des Hauses bildete. »Ich habe den Eindruck, die Kälte kriecht direkt aus dem Stein, wie ein Gespenst. Irgendwie gruselig.«
»Du hast zu viel gegoogelt«, sagte Andreas. Er ahnte, dass seine Frau sich nicht vor dem nackten Felsen fürchtete, dass ihr zudem dieses Haus gefiel und dass sie diese Bemerkung nicht gemacht hätte, wenn sich das Gebäude in irgendeinem anderen Ort befunden hätte. Doch Nicola musste alles nachprüfen, eine Berufskrankheit, ausgelöst von zweieinhalb Jahrzehnten Arbeit als Journalistin. So wie er ständig ins Dozieren kam, als stünde er vor einem Leistungskurs, so sah sie selbst im Alltäglichsten die nächste Story. Als sich Nicola also erst einmal an den Gedanken gewöhnt hatte, dass sie Weihnachten in der Provence verbringen könnten – sie hatte eigentlich geplant, über die Feiertage in Hamburg zu bleiben –, da hatte sie angefangen, über Miramas-le-Vieux Recherchen anzustellen. Eine halb verfallene mittelalterliche Stadt in Südfrankreich ohne Museum oder sonstige Sehenswürdigkeit, was gab es da schon zu recherchieren, hatte Andreas gedacht. Hätte er mal besser selbst im Internet nachgeschaut, bevor er das erste Mal mit seiner Frau über das Ferienhaus gesprochen hatte.
Tatsächlich musste man nur »Miramas-le-Vieux« in die Suchmaschine eintippen, schon gab es Hunderte Treffer, vor allem von amerikanischen und französischen Nachrichtenseiten: »The David Brown Affair«, »L’Affaire David Brown«.
David Brown war ein einundzwanzigjähriger Student der George Mason University nahe Washington, der sich vor zwei Jahren ein paar Monate freigenommen hatte, um durch Europa zu trampen. Im Netz gab es Fotos und sogar mehrere kurze, offenbar private Videos von ihm: fröhlich lächelnd, sportlich, dunkelblonde Haare, dunkelblonder, kurzer Bart, Augen wie Robert Redford, beide Arme voll mit Tier-Tattoos, die für die Indianer magische Bedeutung hatten: Puma, Kojote, Adler, Klapperschlange. Geschützt hatten ihn diese Totemtiere aber offenbar nicht, denn während seiner Europareise war der Junge auf einmal spurlos verschwunden.
In Miramas-le-Vieux.
Ausgerechnet in diesem Kaff war er zumindest zum letzten Mal von einem Zeugen lebend gesehen worden. Seither: nichts. David Brown war verschollen, als hätte es ihn nie gegeben. Eine Zeitlang hatten amerikanische und französische Reporter den Ort deshalb mit morbidem Interesse beobachtet. Aber selbst die Gendarmerie, die mit großem Aufgebot jedes Haus und jede Ruine durchsucht hatte, war auf keine einzige brauchbare Spur gestoßen. Irgendwann hatte sich die Öffentlichkeit anderen Verbrechen zugewandt, schließlich herrschte daran nie Mangel. Doch weil in Miramas-le-Vieux seither offenbar nichts Bemerkenswertes mehr geschehen war, war diese zwei Jahre alte, halb vergessene Affäre immer noch das Erste, was einem Google servierte. Und deshalb war für Nicola die Kälte, die aus dem Felsen kam, nicht einfach frostig, sondern gespenstisch.
Andreas wollte nicht, dass sie von düsteren Gedanken heimgesucht wurde, zumindest nicht von noch mehr düsteren Gedanken, als sie sowieso schon quälten, also sprang er vom Stuhl auf, als wäre er selbst voller Energie. »Lass uns einen Spaziergang durch den Ort machen«, schlug er vor. »Hoffentlich finden wir ein Restaurant, das auch im Dezember geöffnet ist.«
»Die Küche sieht eigentlich gut aus«, entgegnete Nicola zögernd. »Und wir haben ja noch Sachen aus Deutschland mitgebracht. Es ist … gemütlich hier.«
Was sie damit eigentlich sagen wollte: Es war billiger, in der Küche Fertiggerichte vom heimischen Supermarkt zu kochen als im Restaurant zu speisen. Und natürlich hatte Nicola recht. Doch Andreas küsste sie auf die Wange, lächelte und sagte bloß: »Ach, komm!«
Draußen war es dunkel, kein Stern mehr zu sehen, der Himmel musste voller Wolken sein. Vom Meer her wehten Böen, feucht und kalt. Schneeflocken taumelten durch die gelben Lichtkegel der zu weit auseinanderstehenden Straßenlaternen. Noch zerflossen sie innerhalb weniger Augenblicke auf dem Boden, doch Andreas fragte sich, wie tief das Quecksilber wohl diese Nacht fallen mochte. Zwischen den hellen Inseln der Laternen war die Gasse so finster, dass sie manchmal tatsächlich die Hände ausstreckten, um nicht irgendwo gegen eine Mauer zu laufen. Er fand es komisch und hätte einen Witz gerissen, wenn er nicht bemerkt hätte, wie Nicola jedes Mal den Atem anhielt, wenn sie dunkle Passagen durchquerten. Er nahm ihre Hand, sie ließ es geschehen. Sie hatte keine Handschuhe mitgenommen, ihre Finger waren eiskalt.
Nun glomm Licht in manchen Häusern, quoll durch windschiefe Fensterläden bis auf die Gasse; einmal hörten sie die künstliche Lachsalve einer Fernsehshow, als irgendwo ein Fenster geöffnet und rasch wieder geschlossen wurde. Sie gingen an einem Restaurant vorbei, alles dunkel, das Schild innen an der Eingangstür kaum zu entziffern: »Fermeture Annuelle«. Auf den Straßen war niemand zu sehen, keine Autoscheinwerfer durchschnitten die Nacht.
Sie wanderten die Rue Frédéric Mistral den Hügel hinunter. Sie führte, so erkannte Andreas langsam, als eine Art Hauptstraße im Bogen durch die ganze Stadt, hinauf zur Burgruine, hinunter bis zur Landstraße. Das Sträßchen wurde irgendwann etwas breiter, dort standen Häuser zu beiden Seiten. Plötzlich fanden sie sich vor einem alten Stadttor wieder – einem steinernen Bogen, der sich über die Rue Frédéric Mistral wölbte und sich links und rechts an massiven Hauswänden abstützte. Der Bogen trug eine Art Aussichtsplattform, auf der ein moderner, großer Flaggenmast stand. Eine Trikolore, so groß wie die Dächer mancher Häuser, knatterte im Wind. Rechts ging eine enge, steile Steintreppe hinauf.
Sie erklommen den Torbogen. Die bewaldete Ebene und der Étang der Berre unter ihnen waren nur noch zu ahnen. Andreas kam es so vor, als wäre das Schneetreiben stärker geworden und als würde man unten inzwischen helle Flecken ausmachen, dort wo der Schnee vielleicht in Lichtungen oder im Windschatten einsamer Gehöfte schon liegen geblieben war.
»Hoffentlich ist es in England nicht so kalt«, sagte Nicola.
»Da regnet es doch immer bloß.«
»Du und deine Klischees. Es wäre mir lieber, Chiara wäre jetzt hier.«
Ihre Tochter hatte dieses Jahr Abitur gemacht und studierte nun in Cambridge. Bei einer Mutter, die Gesellschaftskolumnen und heitere Texte für ein Frauenmagazin schrieb, und einem Vater, der moderne Sprachen unterrichtete, konnte nur irgendeine irrwitzige Genmutation dafür verantwortlich sein, dass das Kind aus dieser Verbindung ausgerechnet in Mathematik brillant war. So brillant, dass sie ein Stipendium an der fernen Eliteuniversität ergattert hatte, das wenigstens die Hälfte der atemberaubenden Studiengebühren abdeckte. Sie waren unglaublich stolz auf sie und hatten erst nach und nach realisiert, wie still ihre nun kindlose Eigentumswohnung auf einmal geworden war. Und dann hatte Chiara auch noch vor ein paar Wochen verkündet, dass sie die Feiertage lieber »bei Freunden« (von denen Andreas noch nicht einmal die Vornamen kannte) irgendwo in Kent verbringen wollte. Er glaubte ihr zwar, dass es ihr in England sehr gut gefiel, hatte aber trotzdem den Verdacht, dass Chiara auch deshalb auf der Insel blieb, um nicht nach Hamburg zurückkehren zu müssen. Die letzten Jahre waren zwischen Nicola und ihm nicht mehr so rosig gewesen, und Chiara war ein kluges Mädchen.
Er hätte das Gespräch an diesem, ihrem ersten Urlaubsabend gern in eine andere Richtung gelenkt. Nicht weil er nicht gern über ihre Tochter sprach, sondern weil er nicht über Cambridge sprechen wollte. Zu spät.
»In zwei Wochen ist wieder unsere Hälfte der Studiengebühren fällig«, sagte Nicola und blickte dabei, direkt an der steinernen Brüstung stehend, in die Ferne, als könnte sie irgendwo in der Nacht noch etwas erkennen.
»Das schaffen wir schon«, versicherte Andreas und unterdrückte einen Seufzer.
»Den Spruch kannst du dir wirklich sparen. Wie du dir überhaupt das Sparen angewöhnen könntest.«