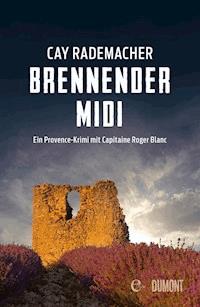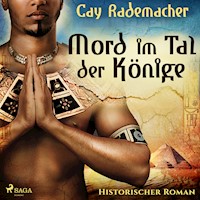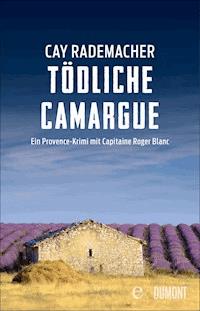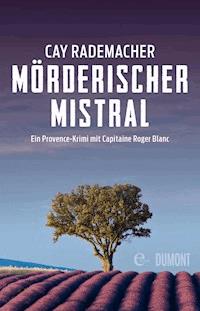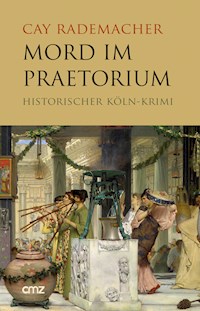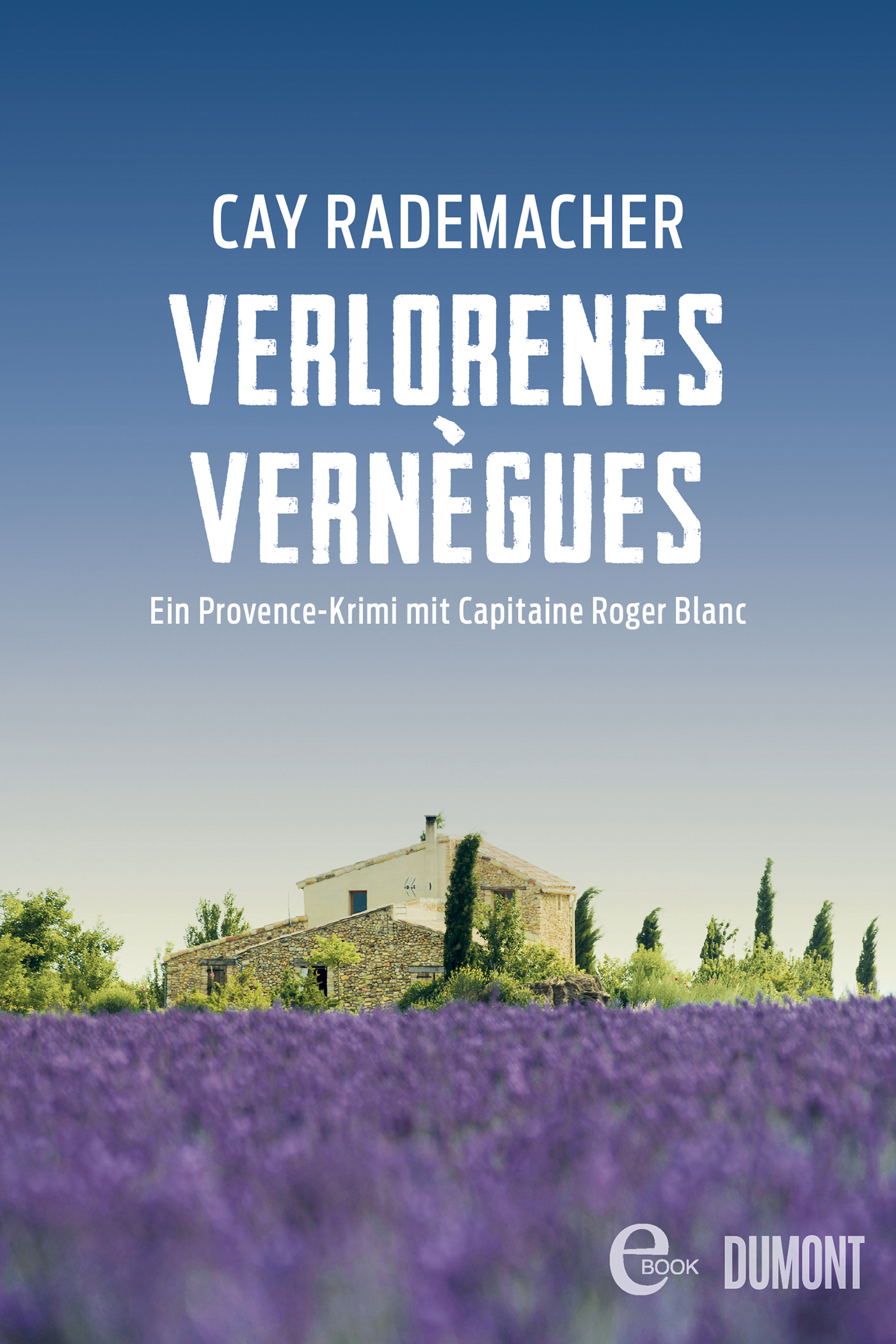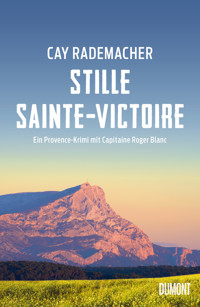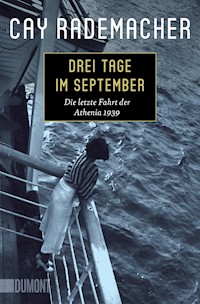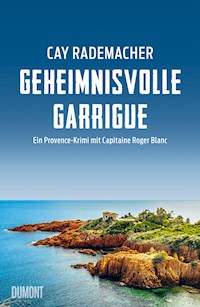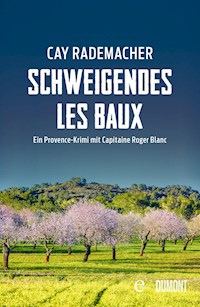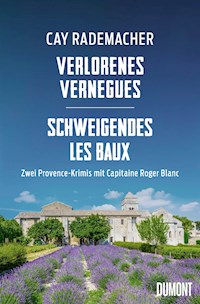
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Provence-Krimi Sammelband
- Sprache: Deutsch
Ein Rudel Wölfe in einer Geisterstadt mitten in der Provence und düstere Verbrechen zwischen blühenden Mandelbäumen – Zwei Frankreich-Krimis mit Capitaine Roger Blanc in einem eBook! »Verlorenes Vernègues« Anfang Januar in der Provence. Mitten in der Nacht wird Capitaine Blanc zu einem rätselhaften Einsatz in die Geisterstadt Vieux Vernègues gerufen, einem mittelalterlichen Ort, der durch ein Erdbeben vor gut hundert Jahren zerstört wurde. Alarmiert wurde die Gendarmerie, weil ein Wolfsrudel die Gegend unsicher macht. Diese Tiere stehen unter strengstem Naturschutz, doch die Angst ist stärker: Schafhirten, Jäger und sogar der Bürgermeister scheren sich nicht um die Gesetze und greifen zu den Waffen. Blanc und seine Kollegen merken zudem bald, dass noch weitere Gestalten nachts durch die Wälder streifen und seltsame Dinge tun. Jeder misstraut jedem, und alle fürchten den Wolf – eine explosive Lage, die schließlich außer Kontrolle gerät. Denn tatsächlich wird bald ein Toter zwischen den Ruinen gefunden … »Schweigendes Les Baux« Es wird langsam Frühling in der Provence, die Mandelbäume blühen – und Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen. Beim Besuch einer Kunstausstellung in den Carrières de Lumières wurde ein Mann ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer Privatdetektiv. Erst wenige Tage zuvor wurde er von einem wohlhabenden Besitzer eines Mandelhofs engagiert, weil ein Bild aus seiner umfangreichen Kunstsammlung gestohlen worden war. Hängt der Mord damit zusammen? Kurz darauf stößt Blanc auf ein grausames Verbrechen aus der Vergangenheit: Damals wurde eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten Dramen der französischen Kriminalgeschichte; der Mörder ist in der Provence untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord geschieht, wird klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe gekommen sein muss … Mord in der Provence – Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues Band 8: Schweigendes Les Baux Band 9: Geheimnisvolle Garrigue Band 10: Stille Sainte-Victoire Band 11: Unheilvolles Lançon Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1126
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über die Bücher:
Ein Rudel Wölfe in einer Geisterstadt mitten in der Provence und düstere Verbrechen zwischen blühenden Mandelbäumen – Zwei Frankreich-Krimis mit Capitaine Roger Blanc in einem eBook!
»Verlorenes Vernègues«
Anfang Januar in der Provence. Mitten in der Nacht wird Capitaine Blanc zu einem rätselhaften Einsatz in die Geisterstadt Vieux Vernègues gerufen, einem mittelalterlichen Ort, der durch ein Erdbeben vor gut hundert Jahren zerstört wurde. Alarmiert wurde die Gendarmerie, weil ein Wolfsrudel die Gegend unsicher macht. Diese Tiere stehen unter strengstem Naturschutz, doch die Angst ist stärker: Schafhirten, Jäger und sogar der Bürgermeister scheren sich nicht um die Gesetze und greifen zu den Waffen. Blanc und seine Kollegen merken zudem bald, dass noch weitere Gestalten nachts durch die Wälder streifen und seltsame Dinge tun. Jeder misstraut jedem, und alle fürchten den Wolf – eine explosive Lage, die schließlich außer Kontrolle gerät. Denn tatsächlich wird bald ein Toter zwischen den Ruinen gefunden …
»Schweigendes Les Baux«
Es wird langsam Frühling in der Provence, die Mandelbäume blühen – und Capitaine Roger Blanc wird nach Les Baux gerufen. Beim Besuch einer Kunstausstellung in den Carrières de Lumières wurde ein Mann ausgeraubt und brutal ermordet. Wie sich zeigt, war das Opfer Privatdetektiv. Erst wenige Tage zuvor wurde er von einem wohlhabenden Besitzer eines Mandelhofs engagiert, weil ein Bild aus seiner umfangreichen Kunstsammlung gestohlen worden war. Hängt der Mord damit zusammen? Kurz darauf stößt Blanc auf ein grausames Verbrechen aus der Vergangenheit: Damals wurde eine ganze Familie ausgelöscht, es war eines der blutigsten Dramen der französischen Kriminalgeschichte; der Mörder ist in der Provence untergetaucht – und nie wieder hat jemand eine Spur von ihm gefunden. Bis jetzt. Als ein weiterer Mord geschieht, wird klar, dass Blanc dem Täter sehr nahe gekommen sein muss …
Über den Autor
© in medias res
Cay Rademacher, geboren 1965, ist freier Journalist und Autor. Bei DuMont erschienen seine Kriminalromane aus dem Hamburg der Nachkriegszeit: ›Der Trümmermörder‹ (2011), ›Der Schieber‹ (2012) und ›Der Fälscher‹ (2013). Seine Provence-Serie mit Capitaine Roger Blanc umfasst acht Fälle, zuletzt kam ›Schweigendes Les Baux‹ (2021) heraus. Außerdem schrieb er die Kriminalromane ›Ein letzter Sommer in Méjean‹ (2019) und ›Stille Nacht in der Provence‹ (2020). Cay Rademacher lebt mit seiner Familie in der Nähe von Salon-de-Provence in Frankreich.
CAY RADEMACHER
VERLORENES VERNÈGUES
SCHWEIGENDES LES BAUX
Zwei Provence-Krimis mit Capitaine Roger Blanc
Vollständige eBook-Ausgabe der im DuMont Buchverlag erschienenen Werke ›Verlorenes Vernègues‹ (© 2020) und ›Schweigendes Les Baux‹ (© 2021)
E-Book 2022
© 2022 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: DuMont Buchverlag, Köln
Umschlagabbildung: © Adobe Stock / dudlajzov
Karte: Kartografie Angelika Solibieda, Cartomedia-Karlsruhe
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book: 978-3-8321-8256-4
www.dumont-buchverlag.de
CAY RADEMACHER
VERLORENESVERNÈGUES
Ein Provence-Krimimit Capitaine Roger Blanc
Puisnay Roy fait son pere mettre a mort,Apres conflit de mort tres inhonneste:Escrit trouvé, soubson donra remort,Quand loup chassé pose sus la conchette.Michel de Nostre Dame / Nostradamus
Wölfe in der Geisterstadt
Zwischen den Ruinen von Vieux Vernègues war es so still wie in einer Gruft. Capitaine Roger Blanc ging langsam durch das verwüstete Dorf. Er kletterte über den Stumpf einer ginsterüberwucherten Wand und erreichte eine Treppe, die in eine Felsenkammer hinunterführte. Die Stufen waren ausgetreten und manche tückisch glatt, andere waren geborsten, wieder andere hatten Risse. Zu beiden Seiten der Treppe wuchsen junge Eichen. Ihre Stämme waren wie dünne Säulen, ihre Kronen rauschten fünf, sechs Meter über Blanc im eisigen Wind, die winzigen Blätter schimmerten hellgrün. An einigen Ästen hingen noch braunschwarze, eisverkrustete Eicheln. Blanc kamen die beiden Bäume, die sich über die Ruine wölbten, wie das Portal zu einer verbotenen Welt vor.
Vorsichtig stieg er die Treppe hinunter in einen halb eingestürzten Keller. Über ihm spannte sich ein Ziegelgewölbe. Dort klaffte ein Riss, als hätte Gott mit einer Axt hineingeschlagen. Durch die Lücke sickerte die Morgensonne und beleuchtete einen Balken im Mauerwerk, der von Sinterkristallen überzogen war. Die Tür darunter war längst verwittert, auf dem Boden lagen bloß noch Holzreste im grauen Sand. Die Luft schmeckte muffig nach feuchter Erde.
Er wartete, bis sich seine Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten, und blickte sich um. Niemand zu sehen. Keine Geräusche. Er kletterte wieder hinaus und musterte die Umgebung: Überall ragten Ruinen auf, fahlgrau im Morgendämmer, konturlos. Die massigen Ecksteine eines alten Hauses erhoben sich fünf Meter hoch aus einem Schuttfeld. Eine steinerne Wendeltreppe, die nirgendwo mehr hinführte, wurde von Rosmarin- und Thymiansträuchern überwuchert. Unter dem Raureif leuchteten, nur wenige Meter neben ihm, weiße und schwarzgraue Steinfliesen, sie waren wunderbarerweise so sauber, als wären sie erst gestern verlegt worden.
Blanc legte den Kopf in den Nacken. Die Ruinen von Vieux Vernègues standen an der Flanke eines Bergs, der sich einige Meter über ihm zu einem Plateau abflachte. Dort war einst eine Burg errichtet worden. Er blickte hinauf zu ihren Mauern aus Tausenden sorgfältig gesetzten, kopfgroßen Steinen, die erst in unfassbarer Höhe in einer Zinnenreihe endeten. Doch auch diese solide Mauer war an vielen Stellen geborsten – und dahinter war bloß Luft. Kein Turm ragte mehr dort auf, kein Palast, nichts. Nur ein einziger gotischer Bogen krümmte sich wie ein gichtiger Riesenfinger ins Leere. Sein schwarzer Schatten fiel auf Trümmerhaufen, die längst von struppigen Büschen und Brombeeren überwachsen waren.
»Wir sollten hier nicht allzu lange stehenbleiben«, sagte Blancs Kollege Lieutenant Marius Tonon halblaut. Er rieb sich die Hände warm und deutete dann unbehaglich auf den Riss im Gewölbe. »Ein Souvenir vom Erdbeben. Dieser Keller kann jeden Moment einstürzen.«
Blanc nickte und ging weiter bergan. Vieux Vernègues. Eine Stadt wie Dutzende in der Provence: ein Hügel, darauf eine Burg, eine Kirche, ein Rathaus, eine Handvoll ehrwürdiger Häuser. Nur dass Vieux Vernègues eine Stadt der toten Seelen war, eine Geisterstadt, in der Eichen und Feigenbäume Mauerstümpfe aufsprengten, Efeu die Ruinen erstickte und in der bloß noch Füchse und Ratten lebten. Ein Erdbeben hatte sich den Ort geholt. Blanc fühlte sich, als würde er durch die Relikte eines mykenischen Palastes stapfen. Doch diese archaisch anmutenden Bauten waren zu Trümmern zerfallen, als schon Autos durch die Provence fuhren und sogar die ersten Flugzeuge brummten, als es schon Telefone gab und Strom und Zeitungen und Fotoapparate.
Erdbeben. Als Capitaine Roger Blanc, der damals den Süden weder gekannt noch gemocht hatte, vor sieben Monaten in den Midi versetzt worden war, da hatte er an Hitze und Rosé gedacht, an Lavendel und Oliven, an die Marseiller Mafia. Aber an Erdbeben? Das waren Katastrophen aus dem Fernsehen.
Und nun schritt er an aufgerissenen Bauten und geborstenen Türmen vorbei und musste aufpassen, dass er nicht irgendwo in ein Loch trat und womöglich mehrere Meter tief in einen halb verschütteten Keller stürzte.
Er hielt inne, damit Marius, der kein großer Freund körperlicher Aktivitäten war, Luft schnappen konnte. Der Schutt deprimierte Blanc, daher wandte er den Blick ab und ließ ihn über ein weites Tal wandern. Der Berg von Vieux Vernègues war fast vierhundert Meter hoch. Auf einem nahen Hügel badete ein anderes Dorf in der Morgensonne: Lambesc. Ein mittelalterliches Dorf wie Vieux Vernègues, in der mistralklaren Luft hatte es den Anschein, als könnte er es mit der ausgestreckten Hand beinahe berühren. Dieses Dorf war ebenfalls alt – jedoch makellos. Warum bloß? Waren Erdbeben nicht gigantische Katastrophen? Warum war dann Vieux Vernègues eine Wüstenei, während ein paar Tausend Meter weiter östlich in Lambesc nicht ein einziger Stein aus einer Fassade gestürzt zu sein schien? Hatten die Menschen in Lambesc vor Jahrhunderten ihre Häuser erdbebensicher gebaut und die von Vieux Vernègues nicht und waren dafür bestraft worden? Oder waren Beben wie Tornados, die willkürlich eine Fläche verwüsteten und die daneben unbeschadet ließen? Er atmete tief durch. Es duftete nach nassem, satten Boden, zwischen Vieux Vernègues und Lambesc lagen dunkle Eichenwälder, fette Weiden und winterkahle Rebstöcke in einem weiten Tal. Dunst stand über den nächsten Hügeln. In bläulicher Ferne schimmerte der gekrümmte Riesenrücken der Montagne Sainte-Victoire bei Aix-en-Provence, auf der anderen Seite leuchtete der Étang de Berre und dahinter glänzte vielleicht das Mittelmeer, oder vielleicht war das auch nur seine Einbildung, weil sich so früh am Morgen der Horizont in eine silberne Linie verwandelt hatte.
»Ich komme mir vor wie im Mittelalter«, murmelte Blanc.
»Du bist im 21. Jahrhundert«, brummte Marius, wischte sich den Schweiß von der Stirn und deutete auf das Tal. »Ich kann mich noch daran erinnern, wie die Leute hier vor fünfundzwanzig Jahren auf Demonstrationen ›Non au TGV!‹ skandiert haben. Ich musste als Flic damals für Ordnung sorgen. Aber eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus, oder?« Er deutete auf eine mehr als einen Kilometer lange Brücke aus hellem Beton, die sich wie ein Aquädukt quer durch das Tal unterhalb von Vieux Vernègues spannte. Ihre siebenundzwanzig Stelzen wirkten wie ein gigantischer Zaun, der die weite Senke in zwei Hälften teilte. Ein Schnellzug rauschte in diesem Augenblick über die Brücke, danach ein Grollen und Rumpeln, es donnerte wie bei einem Jet, war aber nach kaum zwanzig Sekunden verweht. Tiefe Stille flutete zurück ins Tal.
Und dann durchzog ein Heulen diese Stille.
Das Heulen eines Wolfes.
Es war Sonntag, der 5. Januar. Der letzte Tag der Weihnachtsferien, des Innehaltens zwischen den Jahren. Zeit der Besinnung. Zeit für die Tochter. Astrid hatte Blanc über die Feiertage besucht, eine junge Frau von zwanzig Jahren, eine Pariserin, die Snapchat und Instagram brauchte wie Blanc Sonne und frische Luft. Zwischen dem schlafenden Baby mit dem noch von der Geburt zerknautschten Gesicht, das er stolz in seinen Armen gewiegt hatte, und dieser weltgewandten jungen Dame lagen zwei neblige Jahrzehnte, in denen er irgendwie kaum mitbekommen hatte, wie Astrid erwachsen geworden war. Doch dann war sie zu ihm gereist, um die kurzen Tage des Jahreswechsels mit ihm zu verbringen. Sie hatten mit Jacques, dem Hund, der Blanc zugelaufen war, lange Spaziergänge unternommen, auf dem Markt von Aix-en-Provence eingekauft und waren über die legendäre halb zerstörte Brücke von Avignon flaniert. Und sie hatten geredet und geredet, die Tage hindurch und auch noch die halben Nächte. Es war, als wollten sie beide aufholen, was sie in den letzten zwanzig Jahren versäumt hatten. Was ich versäumt habe, korrigierte sich Blanc in Gedanken, denn er hatte es vermasselt.
An diesem Sonntagabend musste Astrid nach Paris zurückfliegen. Blanc hatte Bereitschaftsdienst gehabt und gehofft, dass er mit Marius einige ereignislose Stunden auf der Gendarmerie-Station von Gadet sitzen und schon nachmittags zurückkehren könnte, um noch ein paar letzte Momente mit seiner Tochter zu verbringen.
Doch dann war noch vor dem Morgengrauen ein Notruf eingegangen: Ein Schäfer war nachts in Vieux Vernègues überfallen worden. Von einem Wolf.
»Das ist ein mieser Scherz«, schimpfte Blanc, als er seinen fast zwei Meter langen Leib im eiskalten Mégane der Gendarmerie zusammenfaltete.
»Um fünf Uhr morgens macht niemand einen Scherz«, erwiderte Marius, der sich auf den Beifahrersitz wuchtete und die Rückenlehne so weit zurückdrehte, dass er beinahe lag. »Putain, es war bloß eine Frage der Zeit, bis uns die Wölfe auch hier erwischen.«
»Auch hier? Wo denn sonst noch?«
»In den Alpen, in der Haute-Provence, sogar im Umland von Aix und Salon – die Biester sind wieder überall.« Sein Kollege schloss schläfrig die Augen und sagte gelangweilt: »Letztens sind zwei Wölfe um Viertel nach neun Uhr morgens einige Hundert Meter neben dem Krankenhaus von Manosque zum Frühstück auf eine Schafweide spaziert. Wölfe haben Schafe und Ziegen mitten in der Camargue getötet, und nahe am Weingut Calissanne ist beinahe eine ganze Herde massakriert worden. Neulich gab es sogar einen Angriff in Berre, direkt neben den Raffinerien.«
Calissanne, Berre, das war so nah bei seiner alten Ölmühle in Sainte-Françoise-la-Vallée, dass er beim Joggen schon gelegentlich bis dorthin gelaufen war, dachte Blanc beunruhigt. Doch dann fand er seine Sorgen lächerlich. »Was haben wir damit zu schaffen? Jeden Morgen höre ich das Geballere der Jäger aus den Wäldern. Sollen die sich doch um die Wölfe kümmern!«
Marius brachte die Energie auf, ein Auge zu öffnen und ihm einen mitleidigen Blick zuzuwerfen. »Du kennst doch die Typen, die morgens in der Bar National in Tarnanzügen vor ihrem Pastis hocken. Die knallen mit Schrotflinten auf gezüchtete Fasane, die in Käfigen gehalten werden, bis man sie zur Jagdsaison freilässt. Und selbst diese tollpatschigen Vögel verfehlen sie meistens. Wenn du solche Kerle auf ein Rudel Wölfe loslässt, dann ergeht es denen nicht besser als den Lämmern von Calissanne.«
»Also ruft man die Gendarmerie.«
»Keine Angst, du musst nicht mit deiner Pistole auf Wolfsjagd gehen. Die Tiere stehen ja unter Naturschutz, also kümmert sich Vater Staat um alles. Wir müssen bloß den Schaden begutachten und ein Protokoll schreiben. Damit geht der Schäfer zur Präfektur und bekommt für jedes gerissene Tier eine Entschädigung. Wenn du mich fragst: Ob der Schäfer sein niedliches Lämmchen nun zum Schlachter trägt oder einem Wolf überlässt, er macht so oder so ein gutes Geschäft.«
»Aber wenn er zum Schlachter geht, müssen wir nicht um fünf Uhr morgens im kalten Streifenwagen hocken.« Blanc blickte aufmerksamer nach draußen. Wölfe. Er schüttelte fassungslos den Kopf. Der Mistral blies, die Luft schmeckte nach Frost, auf dem Asphalt glitzerten Eiskristalle im Scheinwerferlicht. Er ließ die Seitenscheibe trotzdem fingerbreit hinab, damit ihn der kalte Hauch endlich richtig aufweckte. Die Straße war eng und wand sich hinter Salon-de-Provence in Serpentinen hügelan. Der Wald zu beiden Seiten war wie eine riesige Woge aus schwarzer Tinte, eine auf- und absinkende düstere Masse. Aus der Nacht schallte der scharfe, kurze Jagdruf einer Eule. Ein zweiter Raubvogel antwortete. Und nur Sekunden später glaubte Blanc, das verzweifelte Fiepen einer Maus zu vernehmen, ein Laut, der abrupt endete. Tiefe Stille. Er fuhr die Scheibe wieder hoch.
»Wo kommen alle diese Wölfe her?«, fragte er. »Ich dachte, die seien längst ausgestorben.«
»Das sind Emigranten aus Italien. Seit unsere Regierung vor mehr als zwanzig Jahren im Mercantour in den Seealpen den Nationalpark eingerichtet hat, wandern die Tiere wieder ein. Wölfe sind klug. Sie haben begriffen, dass sie hier nicht mehr gejagt werden. Und du weißt selbst, wie herrlich Lammfleisch schmeckt. Also wagen sie sich Jahr für Jahr ein paar Kilometer weiter vor. Irgendwann werden sie durch die Straßen von Marseille streifen.«
»Ich wusste, dass diese Sache auch etwas Gutes hat.«
Die schwarzen Wogen zu beiden Seiten ebbten ab. Die Straße führte noch immer bergauf, doch das Land um sie herum lichtete sich. Im Scheinwerferlicht tauchten lange Reihen kahler Weinstöcke auf. »Ist es noch weit?«, fragte Blanc.
Marius kurbelte die Rücklehne wieder in eine aufrechte Position. »Wir sind gleich da. Vieux Vernègues liegt nur zehn Kilometer hinter Salon im Massif des Costes, aber du denkst, du hast die Provence verlassen. Diese Hügelkette erstreckt sich zwar zwischen Lubéron und Alpilles, ist aber viel weniger bekannt. Keine Hollywoodstars, keine Oligarchen, keine Scheichs. Keine restaurierten Landhäuser, deren Fotos du in Pariser Architekturmagazinen wiederfindest. Traumhaft.«
»Wenn es so schön ist, warum haben es dann die Millionäre noch nicht entdeckt?«
»Nenn es das ›kollektive Unbewusste‹. Vielleicht spüren die Leute instinktiv, dass das Massiv gar nicht so massiv ist und du dem Boden unter deinen Füßen nicht trauen kannst. 1909 hat es in der Provence das letzte große Erdbeben gegeben. In Salon ist ein Burgturm einfach umgekippt, selbst in Avignon haben noch die Wände gewackelt. Aber das Epizentrum lag unter dem Massif des Costes, und das lag auch schon mal im Mittelalter hier und wer weiß wie oft davor schon. Vieux Vernègues sah jedenfalls nach dem Beben aus, als hätte Assad es bombardiert. Die überlebenden Einwohner haben ein neues Vernègues lieber tiefer im Tal wieder aufgebaut, weil die Bergspitze so heftig gebebt hat. Die Ruinen oben haben sie den Füchsen überlassen. Putain, in der Provence wird jede miese alte Scheune von irgendeinem reichen Schnösel renoviert, aber da steht ein ganzes mittelalterliches Dorf auf einem malerischen Gipfel, und niemand geht mehr hin. Niemand! Die haben nicht einmal ein Museum aus Vieux Vernègues gemacht wie in Vaison-la-Romaine oben am Mont Ventoux. Vieux Vernègues ist einfach bloß eine Geisterstadt.«
»Der Schäfer, der uns zu Hilfe gerufen hat, scheint mir kein Geist zu sein.«
»Das Gipfelplateau von Vieux Vernègues ist so groß wie fünf oder sechs Fußballfelder. Die normalen Häuser des Dorfes standen am Hang, ganz oben durfte nur der Herr Ritter wohnen. Die Adelsfamilie war übrigens mit dem Marquis de Sade verwandt. Vielleicht hatte Gott einfach irgendwann die Schnauze voll vom perversen Treiben und hat ihnen ein Beben geschickt. Na, jedenfalls steht diese Burg am östlichen Ende des Plateaus. Am nördlichen Ende erhob sich einst eine Windmühle. Du kannst heute noch den Stumpf des Turms sehen. Und zwischen Burg und Mühle erstreckt sich eine Weide: Gras, ein paar Felsen, und zum Rand hin, wo das Plateau in die Tiefe abfällt, wachsen Bäume und Büsche. Die schützen dich vor dem Mistral und sind eine Art natürlicher Zaun, der die Schafe von nächtlichen Irrläufen abhält. Deshalb treiben Hirten im Winter gern ihre Herden dorthin, da ist es grün, geschützt und sicher. Zumindest bis zu dieser Nacht war es dort sicher.«
Sie folgten einer Straße, die immer schmaler und kurviger wurde, bis sie irgendwann vor einer Schranke endete. Blanc stellte den Mégane auf einem nicht asphaltierten Parkplatz daneben ab, der zerfurcht war wie ein schlecht gepflügtes Feld. Kein weiteres Auto stand hier, keine Straßenlaterne glomm. Sie stiegen einen Feldweg hoch, die Lichtstrahlen ihrer Taschenlampen zuckten über Sträucher. Im ersten grauen Dämmerlicht tauchten bald gezackte Gebilde auf, die Blanc im Näherkommen als Ruinen erkannte, die aus Brombeerbüschen aufragten.
»Willkommen in Vieux Vernègues«, brummte Marius.
Im Osten leuchtete der Himmel beinahe durchsichtig weiß, die Bergrücken am Horizont tauchten blau aus der Nacht. Sie schalteten die Lampen aus. Mit Sonnenaufgang wurde der Mistral stärker, der Wind rauschte in den Eichen, im Gesträuch raschelte es, und niemand konnte sagen, ob es die Böen waren oder kleine Tiere, die vor Blanc und Marius flohen.
Und schließlich hörten sie das Heulen.
Es war ein langgezogener, hoher, trauriger Ton, der schier endlose Sekunden durch das Tal hallte, bevor ihn der Mistral schließlich verwehte. Es war, als hätten alle Tiere den Atem angehalten.
»Merde«, flüsterte Blanc und holte tief Luft. »So etwas kenne ich nur aus dem Kino.«
»Vielleicht war es ja bloß ein schlecht gelaunter Hund«, sagte Marius.
Blanc erwiderte nichts. Einen Moment lang hatte er einen tiefen, archaischen Schrecken verspürt. War es möglich, dass sich Angst über zahllose Generationen hinweg vererbte? Dass sich die jahrtausendealte Furcht des Menschen vor dem Wolf in die Gene gegraben hatte? Sodass selbst ein Gendarm des 21. Jahrhunderts von derselben Furcht gepackt wurde wie der Jäger, der im Neolithikum durch diese Hügel gestreift war?
Sie lauschten. Nichts. Marius fuchtelte irgendwann mit der Hand durch die Luft, als wollte er einen Gestank vertreiben. »Lass uns weitergehen und diesen verdammten Job erledigen.«
Sie streiften vorsichtig hügelan durch die zerstörte Stadt. Blanc bestand darauf, in Keller hinunterzusteigen und um Mauerreste herumzugehen – er wollte nicht, dass sich irgendwo in den Trümmern ein Wolf verbarg und sie womöglich von hinten angriff. Seine Hand lag auf dem Pistolengriff. Doch er bemerkte kein Tier, nicht einmal einen Fuchs. Endlich standen sie oben. Die gewaltigen Burgmauern boten ihnen einen Moment lang Schutz vor dem Mistral. Im Dämmerlicht sah Blanc eine Eiche, die aus dem gemauerten Ring einer mittelalterlichen Zisterne hinauswuchs, die tief in den Felsen getrieben worden war. Sie stapften durch die Ruinen der Festung, bis der Mistral sie wieder peitschte und sie über das Gipfelplateau blickten: Gras, dazwischen graue Felsgrate, als sei die Wiese eine zerschlissene Decke, die den Bergrücken nur unvollständig bedeckte. Gebüsch zu beiden Seiten und in zweihundert oder dreihundert Metern Entfernung der geköpfte Windmühlenturm, ein stumpfer Zylinder, der Blanc unwillkürlich an die römischen Gräber neben der Via Appia erinnerte, ein Flashback zurück in jene Zeit, als er noch eine gute Ehe geführt und schöne Reisen gemacht hatte. Am südlichen Abhang des Plateaus hatte die Moderne einen Teil dieser archaischen Welt erobert: Blanc sah drei filigrane Metallgestelle mit Radarmuscheln und Antennen, die Konstruktionen waren so hoch wie ein dreistöckiges Haus.
»Ich habe nie herausgefunden, ob diese Antennen zum Flughafen Marseille gehören oder ob hier die Kampfpiloten von der Base Aérienne in Salon angefunkt werden«, erklärte Marius, der seinem Blick gefolgt war. »Es hat auf jeden Fall was mit Flugzeugen zu tun. Doch was auch immer das für eine Installation ist, sie scheint nicht besonders wichtig zu sein. Sie wird von niemandem bewacht.«
»Also gibt es keinen Sicherheitsmann, den wir als Zeugen befragen können«, folgerte Blanc. »Und es gibt keine Überwachungskameras?«
»Mach dir um Zeugen und Filmaufnahmen keine Sorgen, die Sache klärt sich auch so.« Marius deutete nach vorn.
Am rechten Rand des Plateaus stand ein fast zehn Meter hoher, dicker Stamm, das Holz verdreht wie ein Korkenzieher, schwarz und verwittert, mit roten Streifen, als hätte der Baum geblutet. Doch selbst Blanc konnte erkennen, dass dieser Baum längst tot war, das Skelett eines uralten Olivenbaumes ohne Zweige, ohne Blätter, ohne Früchte. Zu seinen Füßen war ein Lager aufgeschlagen worden: ein grünes Igluzelt, eine als Windschutz aufgespannte Plastikplane, am knotigen Stamm lehnte ein altes grünes Mountainbike mit Decathlon-Schriftzug. Vor dem Zelt glomm ein Lagerfeuer in einem Kreis aus Steinen. Eine dünne graue Spirale stieg von dort auf und wurde vom Mistral verweht. Die glimmenden Holzscheite dufteten würzig. Blanc atmete tief ein. Da war aber noch ein anderer Geruch in der Luft.
Blut.
Er sah sich misstrauisch um. Endlich erkannte er zwei Gestalten am hinteren Ende des Plateaus, nahe am Mühlenstumpf. Zwei Männer, dachte er. Und zwischen ihm und den Männern erkannte er seltsam unförmige Gebilde auf der Wiese, mal hier, mal dort, vielleicht ein Dutzend – als hätte man achtlos Bettwäsche in großen Haufen auf den Boden geworfen, Bettwäsche, die einmal weiß gewesen war. Jetzt waren diese Haufen schmutzig-grau.
Und sie waren an manchen Stellen rot, sehr rot.
Als sie näher kamen, versuchte Blanc, so flach wie möglich zu atmen. Die unförmigen Haufen waren die Kadaver von Schafen. Die Tiere waren alle auf dieselbe Art gestorben: ihre Kehlen waren zerrissen, aus den zerfetzten Schlagadern hatte sich Blut über ihre Felle und den Boden ergossen. Es stank nach Eisen und schon ein wenig süßlich nach Verwesung, obwohl die Luft in der Nacht doch eiskalt gewesen war. Blanc zählte drei ausgewachsene Muttertiere und acht Lämmer, mager und klein. Sie trugen dichte Winterwolle, auf ihre Flanken hatte jemand mit roter Sprühfarbe FL und jeweils eine zwei- oder dreistellige Zahl gesprüht. Die meisten Schafe wiesen schreckliche Halswunden auf, waren ansonsten aber anscheinend unverletzt. Nur ein ausgewachsenes Tier und zwei Lämmer waren zusätzlich an Bauch und Brust aufgerissen worden, Blut und Reste zerstörter Eingeweide quollen aus diesen Verletzungen. Manche Schafe blickten im Tod hin zum Rand des Plateaus, andere zur Burg oder zum Mühlenstumpf. Erst nach und nach glaubte Blanc, so etwas wie ein Muster zu erkennen: alle Opfer lagen auf jenem Teil der Wiese, der sich leicht absenkte und etwa hundert Meter vom alten Olivenbaum entfernt war. Vom Lager dort aus war diese Senke, zumal bei Dunkelheit, kaum noch auszumachen, vermutete er.
»Kluger Wolf«, murmelte Blanc so leise, dass Marius ihn nicht hörte.
Einer der beiden Schäfer kam nun auf sie zu: verwittertes Gesicht, dichte graue Haare, sehnige, altersfleckige Hände, nicht einmal eins siebzig groß, die Bewegungen so geschmeidig, dass man sofort wusste, dieser Mann hatte sein ganzes Leben draußen verbracht. Blanc schätzte ihn auf Mitte sechzig und vermutete, dass er stärker und schneller war als die meisten Männer Mitte zwanzig. Er hatte einen alten, aber gut eingefetteten Karabiner und eine lederne Jagdtasche um die Schulter geschlungen und trug eine Jeans, grobe Wanderschuhe und ein rot-schwarz kariertes Flanellhemd. Keine Mütze, keine Jacke, keine Handschuhe. Ob der Kerl unter seinem Flanellhemd noch einen Pullover trug? Oder war dem einfach nicht kalt?
»Frédéric Locez«, stellte er sich vor. »Aber nennen Sie mich einfach Fred.« Sein Händedruck war fest, die Innenfläche seiner Rechten so hart und rau wie altes Holz, um seine beinahe schwarzen Augen lag ein Spinnennetz von Fältchen.
Blanc erwiderte den Gruß und stellte Marius und sich vor. »Tut mir leid um Ihre Tiere, Fred«, fuhr er fort. »So etwas habe ich noch nie gesehen. Elf tote Schafe.«
»Zwölf«, korrigierte ihn Locez und wies auf eine Stelle der Wiese, die dunkel glänzte. »Es fehlt noch ein Lamm. Vermutlich hat es sich ein Wolf von dort geholt und mit ins Unterholz gezerrt. Von dem Tier werde ich wohl nichts mehr finden.«
»Sie sind sicher, dass es ein Wolf war?«
»Ein Kaninchen war es jedenfalls nicht.« Locez schüttelte traurig den Kopf. »Haben Sie das Geheul eben nicht gehört? Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, mon Capitaine, Sie sind ein Städter, das sieht man schon auf hundert Meter. Sie kennen Wölfe nur vom Zoobesuch mit den Kindern. Ich habe in diesem Winter aber schon dreiundzwanzig Merinos an den Wolf verloren. Außerdem habe ich die Wölfe diese Nacht gesehen.«
»Sie haben die Tiere gesehen?«, mischte sich Marius ein.
»Der Mond steht zu drei Vierteln am Himmel. Die Luft ist klar. Wenn sich Ihre Augen erst einmal daran gewöhnt haben, können Sie im Mondlicht sogar Strafzettel schreiben, mon Lieutenant«, erwiderte Locez und lachte, trotz allem.
Der zweite Schäfer näherte sich ihnen. Schäferin, korrigierte sich Blanc dann erstaunt. Beinahe die gleichen kurzen grauen Haare, der gleiche kompakte, muskulöse Körper, die gleiche Kluft in Jeans und Flanellhemd wie Fred Locez, doch ohne Zweifel eine Frau.
»Une femme-homme«, flüsterte Marius, »nimm dich vor der in Acht.«
Mit ihrer Linken umklammerte sie – wie es Blanc schien: mit eisenhartem Griff – das lederne Halsband eines massigen, weißen Hundes, der ihr bis zur Hüfte reichte. Der Hund grollte die beiden Gendarmen feindselig an.
»Das ist Emir«, erklärte Fred, »unser Hütehund aus den Pyrenäen. Der mag keinen Wolf, und er mag auch keine Fremden. Wie jeder Patou, da kann man nichts machen. Und das ist meine Frau Clotilde.«
Zuerst der Hund, dann die Frau, dachte Blanc, das ist ja mal eine galante Vorstellung. Er schüttelte ihr die Hand – mit weit vorgestrecktem Arm, er wollte dem riesigen Hund nicht zu nahe kommen. Der Patou hatte ein Fell wie ein Eisbär, und wahrscheinlich konnten es auch seine Kiefer mit denen eines Bären aufnehmen.
»Sie habe ich schon mal gesehen«, begrüßte Clotilde Locez Marius, dann blickte sie Blanc in die Augen. »Aber Sie sind ein Neuer.«
»Ich bin vor mehr als einem halben Jahr in die Provence versetzt worden, Madame.«
»Sag ich doch: ein Neuer. Das ist Ihr erster Winter hier. Eh bien, jetzt wissen Sie, wie das hier ist. Ich wollte Sie mir nur mal ansehen. Emir sollte Ihre Witterung aufnehmen, dann erkennt er Sie beim nächsten Mal und greift Sie nicht an. Zumindest nicht sofort. So, der Hund und ich kümmern uns mal besser um die Herde. Um die Tiere, die noch leben, meine ich. Fred erklärt Ihnen alles. Ist ja nicht das erste Mal.« Sie spuckte auf den Boden, drehte sich um, ohne eine Antwort abzuwarten, und zog den gewaltigen Hund mit sich. Erst jetzt bemerkte Blanc, dass sich im Schatten des zerstörten Mühlenturms Dutzende Schafe so dicht wie möglich ans Mauerwerk drängten, alle Tiere waren still und rührten sich nicht. Er war nicht traurig, Hund und Herrin davongehen zu sehen, und atmete erleichtert auf.
»Bon«, sagte Marius, »dann wollen wir mal.« Er hatte ein rosafarbenes Heft mit Herzen und Ponys auf dem Einband aus seiner alten Lederjacke gezogen. Blanc und Locez blickten ihn verwundert an. »Habe ich beim Aufräumen im alten Kinderzimmer gefunden«, erklärte Marius. »Das war das Hausaufgabenheft meiner Tochter, aber sie hat eigentlich nie etwas hineingeschrieben. Langsam verstehe ich, warum ihre Noten uns nie glücklich gemacht haben.«
Locez starrte auf das rosafarbene Heft. Blanc sah dem Schäfer an, dass er sich nicht ernstgenommen fühlte. »Das hat alles seine Richtigkeit«, versicherte er schnell.
Der Schäfer seufzte. »Clotilde und ich waren im Zelt«, begann er und deutete zum alten Olivenbaum. »Die Tiere standen auf diesem Teil des Plateaus, den hatten sie noch nicht abgeweidet. Emir war bei ihnen. Und wir hatten Lichter aufgestellt.«
»Lichter?«, fragte Blanc.
Locez kramte in seiner Jagdtasche und fischte eine längliche Leuchte aus Plastik heraus, mit einer Spitze unten, um sie in den Boden zu rammen, und einem handgroßen Solarkollektor oben, der die Lampe tagsüber auflud.
»Eine Gartenleuchte aus dem Baumarkt«, sagte Blanc verwundert.
»Ich lebe zwar auf dem Land, aber trotzdem im einundzwanzigsten Jahrhundert, mon Capitaine«, erwiderte Locez gleichmütig. »Warum soll ein Schäfer keine Solarzellen nutzen? Ich habe mir hundert Stück im Baumarkt besorgt. Die stelle ich jede Nacht in einem weiten Kreis um meine Herde. Das ist so eine Art Zaun aus Licht. Die Schafe reißen nicht aus. Und kein Räuber greift die Herde an. Dachte ich.« Er stopfte die Lampe wieder in die Tasche.
»Der Wolf hatte keine Angst vor dem Licht?«, fragte Marius.
»Die Wölfe. Es waren mindestens vier. Und, ja, die Biester haben vor gar nichts mehr Angst, schon gar nicht vor meinen Lampen.« Locez deutete auf eine Stelle im Buschwerk am Rande des Plateaus, etwa einhundert Meter vom Zelt entfernt. »Mitten in der Nacht hat Emir wie verrückt angeschlagen. Es war ungefähr ein Uhr. Clotilde und ich sind aufgesprungen und aus dem Zelt gestürzt. Wissen Sie, wir sind schon dreimal von Wölfen angegriffen worden. Aber nicht hier. Hier auf dem Hügel, haben wir gedacht, sind wir sicher. Die Wölfe schleichen sich nicht durch die Ruinen von Vieux Vernègues bis zu uns hinauf. Vieux Vernègues stinkt nach Tod. Erdbeben kann man riechen, wissen Sie? Eh merde. Wir sind zu Emir gerannt, ich hatte meinen Karabiner dabei.« Er klopfte auf die Waffe. »Tatsächlich: Da stand ein Wolf am Rand des Gebüschs. Clotilde und ich konnten ihn im Mondlicht deutlich erkennen. Ein erwachsener Rüde, so groß, wie der war! Emir ist nicht auf ihn losgegangen, er hat nur gebellt. Ich habe mein Gewehr entsichert.« Er blickte Blanc an und schüttelte dann in der Erinnerung den Kopf, verwundert und noch immer erschrocken. »Wissen Sie, was ein Schäfer und sein Hund machen, wenn Sie einen Wolf sehen, mon Capitaine? Sie stellen sich zwischen das Raubtier und die Herde: vor mir der Wolf, hinter mir die Schafe. Wir schützen die Tiere. Das machen wir immer so, das machen alle, das ist praktisch wie ein Instinkt. Eh bien, Emir, Clotilde und ich haben uns also in einer Reihe zwischen die Schafe und diesen Wolf postiert. Er war noch mindestens zwanzig, dreißig Meter entfernt, er ist am Rand des Gebüschs hin- und hergelaufen, aber er ist nicht näher gekommen. Ich habe meinen Karabiner gehoben und angelegt, es war schwierig, im Mondlicht einen Wolf anzuvisieren, der sich so rasch bewegt und dann …« Locez schüttelte schon wieder den Kopf. Dann drehte sich der Schäfer auf einmal um seine Achse und deutete auf die Büsche am gegenüberliegenden Ende des Plateaus. »Dann sind mindestens drei Wölfe von dort herausgebrochen«, vollendete er mit leiser Stimme. »Und danach ging alles so wahnsinnig schnell …« Er schluckte und sammelte sich, bevor er fortfahren konnte. »Es war ein Hinterhalt, mon Capitaine! Ein Wolf hat den Hund und uns auf diese Seite des Plateaus gelockt. Der Wolf wusste genau, dass wir uns zwischen ihn und die Schafe stellen würden. Er hat gewartet, bis wir auch wirklich dort waren, wo er uns haben wollte – und dann ist sein Rudel in unserem Rücken von der anderen Seite des Plateaus aus dem Versteck gekommen! Jetzt waren die Schafe zwischen uns und den anderen Wölfen vollkommen schutzlos. Ich konnte nicht einmal schießen, meine eigenen Tiere waren im Weg! Wir sind wie verrückt losgerannt. Doch bis wir auf der anderen Seite des Plateaus waren, war es für zwölf Tiere schon zu spät.«
In Blancs Ohren klang das wie eine Geschichte von Jack London. Wolfsrudel. Nächtlicher Überfall. Hinterhalt. Wir sind doch nicht am Yukon, sagte er sich. Doch die blutbesudelten Schafskadaver bewiesen, dass etwas Schreckliches in dieser Nacht geschehen sein musste. »Allen toten Tieren sind die Kehlen zerbissen worden?«, vergewisserte er sich.
Locez nickte. »So jagen Wölfe: ein Biss in die Kehle.« Er deutete auf einen der drei aufgebrochenen Tierkörper. »Wölfe mögen weder Fell noch Knochen, eigentlich nicht mal Muskelfleisch. Ist ein Tier verendet, arbeiten sie sich so schnell wie möglich durch den Bauch bis zu den Innereien vor. Die verschlingen sie. Sie hatten nicht viel Zeit, bis wir heran waren. Sonst sähen die anderen toten Schafe wohl auch so aus.«
»Dann wollen wir mal«, verkündete Marius. Er zog sein altertümliches Handy aus der Tasche und schoss Fotos von den verendeten Tieren. Zwischen dem Fotografieren zeichnete er eine Art Lageplan des Plateaus in sein Notizheft und trug die Position jedes gerissenen Schafes darin ein.
Blanc sah ihm eine Zeit lang schweigend zu, dann wandte er sich wieder an Locez: »Fred, werden Sie dafür gut entschädigt?«
»Korrekt«, erwiderte er. »Ich habe im Winter meine Herde auf drei Weiden rund um Vieux Vernègues verteilt, auf dem Plateau hier steht die kleinste. Etwa hundert von den siebenhundertachtzig Merinos, die ich insgesamt habe. Jetzt sind es ein paar weniger.« Er ging bis zu einem Lamm und zeigte mit dem Finger auf die gesprühten Buchstaben und Zahlen an dessen Flanke: FL 780. »Das war mein jüngstes Lamm.«
»Sie markieren alle Tiere so?«
»Wir brauchen keine Brandeisen, wir sind ja keine Barbaren. Man darf bloß nach der Schur nicht mit den Zahlen durcheinanderkommen, wenn man die Tiere neu einsprühen muss.« Er lachte kurz, dann wurde er wieder ernst. »Jedes Schaf bringt mir zweihundert Euro – aber nur, wenn es ausgewachsen ist. Für ein Lamm gibt es bloß ein paar Euro. Sehen Sie: Wenn Sie einen Apfelbaum haben und jemand hackt den ab, dann ist das zwar gut und schön, wenn Ihnen der Staat für den Baum eine Entschädigung zahlt. Aber Sie können trotzdem im nächsten Herbst keine Äpfel mehr ernten, und dafür zahlt ihnen niemand eine Entschädigung. Genauso ist das bei einem Schäfer, wenn sich der Wolf die Lämmer holt: Wir können nicht mehr ernten. Selbst Schafe, die einen Wolfsangriff überlebt haben, werden danach unfruchtbar. Der Schock, verstehen Sie?«
Blanc überschlug das rasch im Geist, siebenhundertachtzig Schafe, jedes zu zweihundert Euro … Er musste sich beherrschen, um nicht anerkennend durch die Zähne zu pfeifen. Sieh an, ein armer Schäfer.
Locez schüttelte verärgert den Kopf, er hatte seine Gedanken erraten. »Ich fühle mich beschissen, wenn ich das Geld auf der Präfektur abhole. Ich bin Schäfer, ich ziehe meine Tiere groß. Ich will kein Bittsteller bei irgendeiner Behörde sein! Verdammte Wölfe!«
»Sie haben vorhin gesagt, dass dies nicht der erste Angriff war?«
»Es ist Anfang Januar, und ich habe schon dreiundzwanzig Tiere verloren. Das ganze letzte Jahr waren es nur vierzehn. Und davor keines. Mein Vater hat kein einziges Lamm an einen Wolf verloren, und mein Großvater auch nicht. Mon Dieu, wer hätte gedacht, dass die Wölfe zurückkehren?!«
Blanc deutete auf den Karabiner des Schäfers. »Sie können sich doch wehren. Und Sie haben einen Hund.«
Locez fuhr sich durch die Haare. »Deshalb habe ich ja nur ein paar Tiere verloren. Es gibt Kollegen, denen gehen mehr als hundert Schafe im Jahr davon.« Er atmete tief durch. »Wissen Sie, wie groß der Abstand zwischen dem Leithammel und den Nachzüglern ist, wenn Sie eine Herde von fast achthundert Tieren von einer Weide zur anderen treiben?«
Blanc zuckte mit den Achseln. »Hundert Meter?«, riet er.
»Einen Kilometer.« Locez nickte bestätigend. »Ein Kilometer, ein Karabiner, ein Hund – das funktioniert nicht. Sie können nicht überall sein. Und nachts, wenn die Herde eng zusammengetrieben wird, eh bien, Sie sehen es ja. Ein paar Kollegen ziehen jede Nacht einen Elektrozaun um die Schafe, aber selbst der hält die Wölfe nicht ab. Wir werden tags und nachts angegriffen, wir haben überhaupt keine Ruhe mehr.«
»Sie könnten sich mehr Hütehunde anschaffen.«
»Ein Rudel Patous ist schlimmer als ein Rudel Wölfe!« Der Schäfer schüttelte entschieden den Kopf. »Patous wollen auch fressen. In den Alpen sind inzwischen in vielen Tälern die Murmeltiere ausgerottet worden, irgendwovon muss sich ein Hund ja ernähren. Außerdem sind es aggressive Tiere. Ein Patou geht auf Wanderer und Radfahrer los, die ihrer Herde zufällig nahe kommen. Und der begnügt sich nicht damit, Ihnen einmal in die Waden zu zwicken, mon Capitaine. Wenn der Hund jemanden ins Krankenhaus beißt, dann bin ich dran. Deshalb muss jeder Schäfer jeden Patou auf der Präfektur registrieren lassen, das ist wie ein Waffenschein. Und ich bin doch nicht Schäfer geworden, um Papierkram zu erledigen!«
»Sieht dann wohl so aus, als könnten Sie nichts machen.«
»Selbstverständlich kann man was machen!«, explodierte Locez. »Genau das, was man jahrhundertelang gemacht hat: Wir knallen die Wölfe ab! Diese verrückten Ökos mit ihrem Naturschutz. Der Staat schützt heute die Wölfe und nicht die Menschen, ist das nicht Wahnsinn? Früher war es besser: Kein Wolf, kein Karabiner, kein gerissenes Schaf, und Sie wären auch auf der warmen Gendarmerie-Station geblieben.«
Marius kehrte von seinem Rundgang ums Plateau zurück. Er klappte sein Notizheft zu. »Ich habe alles aufgenommen«, erklärte er, »wir können heim zu Maman. Wir schreiben den Rapport, Sie bekommen eine Kopie, Fred. Und nächste Woche haben Sie die Entschädigung vom Staat auf Ihrem Konto.«
Locez schnaubte. »Ich weiß ja, dass Sie nur Ihren Job tun. Aber wenn mich nicht einmal die Gendarmerie schützen kann, dann muss ich das beim nächsten Mal halt selbst erledigen.« Er tippte leicht auf seinen Karabiner, nickte zum Abschied und drehte sich um.
»Lass uns zurückfahren, bevor ich mir die Eier abfriere«, sagte Marius. Er klang ganz zufrieden mit sich.
Blanc sah der davonstapfenden Gestalt hinterher. Lachfalten um die Augen. Hände wie aus Eisen. Immer draußen. Schon Vater und Großvater Schäfer. Aber jetzt hat der Mann ein Dutzend Schafe verloren, und er hat ein Gewehr, und er wird schießen, irgendwann. »Ich will mich noch ein wenig umsehen«, murmelte er.
»Wozu? Die Sache ist eigentlich nicht komplizierter, als wenn ein Besoffener mit dem Auto vor einen Baum knallt. Das ist zwar hässlich, und es fließt Blut, aber niemand muss komplexe Ermittlungen einleiten.«
»Locez hatte vorhin Recht: Ich bin Städter. Was weiß ich schon von Wölfen? Ich will verstehen, was hier letzte Nacht passiert ist.«
»Warum willst du nicht ahnungslos bleiben? Wir haben bloß einmal im Monat Nachtdienst. Sollten die Wölfe tatsächlich noch mal hier aufkreuzen, dann müssen sich andere Kollegen darum kümmern. Mit ein bisschen Glück müssen wir nie wieder nachts durch diese Ruinen stapfen.«
Blanc schüttelte zweifelnd den Kopf. »Da wäre ich mir nicht so sicher«, erwiderte er leise.
Der Mistral war noch stärker geworden, achtzig, hundert Stundenkilometer in den Böen, schätzte Blanc, er hatte inzwischen seine Erfahrung mit diesem Wind gemacht. Und trotzdem hatte er weder an Mütze noch Handschuhe gedacht, als er frühmorgens hastig nach Vieux Vernègues aufgebrochen war. Er klappte den Kragen seiner alten Lederjacke hoch und verkroch sich so tief wie möglich darin. Der Himmel leuchtete inzwischen wie blaue Aquarellfarbe. Am östlichen Horizont hatte der Große Künstler ein wenig Rosa und Orange beigemischt. Eine Fernsicht, als könnte man im Norden den Eiffelturm erkennen. Paris. Familie. Nicht dran denken. Marius fischte schon eine Sonnenbrille aus seiner Manteltasche. An die hatte Blanc auch nicht gedacht. Ich werde vom Blinzeln noch Fältchen kriegen wie dieser Schäfer, dachte er, eh merde.
Sie gingen langsam Richtung Burg zurück. Die beiden Mauern, die das Erdbeben nicht umgeworfen hatte, formten ein riesiges V. Der gotische Steinbogen in ihrem Innern wirkte so fragil, als könnte ihn die nächste Mistralböe umblasen, und wahrscheinlich würde der Wind sich auch irgendwann dieses stolze Relikt der Burgherren von Vieux Vernègues holen. Der Mistral rauschte im Ginster, der über den Steinhaufen wucherte, krümmte eine junge Feige, die Zweige tanzten auf und nieder, doch …
Die Zweige bewegten sich gegen die Windrichtung.
»Da ist was«, flüsterte Blanc. Er griff nach seiner SIG Sauer. Marius hatte ebenfalls schon seine Waffe gezogen.
»Das ist kein Wolf«, gab Marius eine Sekunde später leise zurück. »Sondern ein Mensch.«
Blanc entspannte sich – bis er sah, dass sein Kollege trotzdem die Pistole in der Hand behalten hatte. »Möchte wissen, was dieser Typ da zu suchen hat«, zischte Marius.
Sie gingen vorsichtig näher, Blanc bemühte sich, lautlos aufzutreten. Sie waren jetzt mitten in der alten Burg, zu beiden Seiten ragten Schutthügel auf. Endlich war er so nahe, dass er Einzelheiten im Schatten der hohen Mauer erkennen konnte. Was immer das für ein Typ sein mochte, er wirkte nicht gerade gefährlich: vielleicht fünfzig Jahre alt, untersetzt, graue Haare in wirrer Frisur, eine Brille mit Linsen wie zwei Glasbausteine, dünner grauer Bart. Und er trug einen braunen Cordanzug.
»Mon Dieu«, flüsterte Blanc und blickte Marius an. »Selbst du würdest so etwas nicht mehr anziehen.«
»Was soll das heißen: ›selbst du‹? Cord hält warm, und braun steht jedem.« Aber auch Marius steckte die Waffe weg.
Blanc beobachtete den Mann, der sie immer noch nicht bemerkt hatte, obwohl sie nun kaum zwei Meter vor ihm standen. Er schien intensiv auf einen Punkt am Himmel zu starren, irgendwo dicht über der Kuppe des nächstgelegenen Hügels. Blanc versuchte, seinem Blick zu folgen, doch da war nichts, nicht einmal eine Wolke. Der Mann hielt ein ziegelsteingroßes Gerät mit einer langen Antenne in der Linken, vielleicht ein Funkgerät oder eine Fernsteuerung oder irgendein Messgerät. Blanc dachte an die Antennen vom Rand des Plateaus. Ob das so eine Art Techniker war?
»Bonjour!«, rief er.
Der Mann zuckte zusammen, blinzelte in ihre Richtung, dann hob er die Hand zu einem zögerlichen Gruß. »Haben Sie mich erschreckt! Ist es verboten, dass ich zwischen den Ruinen herumklettere?«, fragte er. »Wollen Sie mich jetzt verhaften?«
»Woher wissen Sie, dass wir Flics sind?«, fragte Blanc verwundert, Marius und er trugen Zivil.
»Von der Burgmauer aus hat man einen Blick auf den Parkplatz. Da steht ein Auto der Gendarmerie. Der Rest ist nicht schwer zu erraten.« Der Mann schüttelte ihnen die Hände. Blanc stellte Marius und sich vor.
»Ich bin Doktor Maurice Fouquart, was kann ich für Sie tun?«, erwiderte der Mann.
»Sie sind Arzt?«
»Ich bin Ufologe.«
Blanc schwieg für einen Moment. Wölfe, die einen Hinterhalt legten. Ein Ufologe in einer Burgruine. Er wünschte, jemand anderes hätte in dieser Nacht Dienst gehabt.
»Ich wusste nicht, dass man in Ufologie promovieren kann«, beendete Marius die Stille gerade noch rechtzeitig, bevor sie peinlich lang werden konnte.
»Ich bin Astrophysiker an der Universität Grenoble. Ich habe mich aber vor einiger Zeit beurlauben lassen, um mich ganz meinen Studien zu widmen.«
»Über Ufos?«
»Bei meinen Forschungen an der Uni bin ich irgendwann zu dem Schluss gelangt, dass es extraterrestrisches Leben gibt. Das ist so sicher wie die kosmische Hintergrundstrahlung.«
»Kosmische Hintergrundstrahlung, selbstverständlich«, sagte Marius.
Fouquarts Augen waren so klar und hellblau wie der Morgenhimmel. Er lächelte. Der ganze Mann war plötzlich voller Energie. »Deshalb bin ich von Grenoble hierhergezogen!«, rief er. »Wissen Sie, wie viele Ufo-Sichtungen aus der Provence gemeldet wurden?« Er wartete nicht ernstlich auf eine Antwort. »Einhundertfünfundsiebzig Phänomene seit 1965! Ufo-Sichtungen oder Kornkreise, manche Fälle sind durch Fotos gut belegt. Alles wird von MUFON France dokumentiert, der französischen Sektion internationaler Ufologen.«
Der glaubt tatsächlich daran, dachte Blanc nicht ohne Bewunderung. Ein Mann, der für seine Überzeugung brannte. Fouquart hatte Charisma, oder vielleicht war es auch nur der Faktor Wahnsinn. »Und Sie haben diese Nacht Ufos gesucht, ausgerechnet in Vieux Vernègues?«, hakte er nach.
Der Astrophysiker nickte eifrig. »Es gab eine Sichtung!«, verkündete er. »In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember ist ein Autofahrer mit seiner Frau und dem gemeinsamen Baby die Route Départementale 15 zwischen Salon und Lambesc entlanggefahren, nur ein paar Kilometer südlich von hier. Der Mann war total nüchtern, ein Luftfahrttechniker, der bei Airbus Helicopters in Marignane arbeitet, ein Experte gewissermaßen. Eh bien. Dieser Mann sieht also plötzlich vier orangefarbene Lichter: Leuchtbälle am sternenklaren Himmel, die in gleichem Abstand in Gegenrichtung zu ihm fliegen, sechs, sieben Kilometer von ihm entfernt. Sie nähern sich rasch bis auf etwa einen Kilometer. Der Autofahrer wird nervös, er weiß nicht, was er da vor sich hat, er hält am Randstreifen und schaltet das Warnlicht ein. Und was passiert da? Ein Lichtball schert aus der Formation aus und fliegt zu ihm! Der Mann gerät in Panik und flieht mit dem Wagen. Das einzelne Licht gliedert sich wieder in die Formation ein, die Lichter rasen Richtung Norden weiter und verschwinden.«
Fouquart blickte sie triumphierend an, als wäre ihm soeben ein genialer mathematischer Beweis geglückt.
Doch Blanc dachte nur: Die orangefarbenen Lichter kamen direkt vom Planeten Champagner angeflogen. Heiligabend, Weihnachtsfeier, der Typ hat gut getrunken, auch wenn er das Gegenteil behauptet hatte, was für ein Glück, dass er danach nicht gegen einen Baum gekracht ist mit Frau und Baby an Bord, mon Dieu. Er ließ sich aber nichts anmerken und nickte bloß. »Und jetzt halten Sie nach diesen Lichtern Ausschau, Doktor Fouquart? Sie waren die ganze Nacht auf den Beinen?« Marius und er beschrieben das Drama, das sich vor wenigen Stunden auf dem Plateau abgespielt hatte. Der Forscher blickte sie verwundert an. »Wölfe? Also, davon habe ich nichts mitbekommen. Die Schafe habe ich mal gehört, ja, die haben geblökt. Und ein Hund hat wie verrückt gebellt. Aber da war ich weiter unten am Hügel, ich hatte mich unter einem Gewölbe versteckt, damit die Außerirdischen mich nicht sehen. Ich war in der ganzen Nacht nicht einmal oben auf dem Plateau. Da hat man freie Sicht, da wäre ich doch sofort entdeckt worden.«
Blanc warf Marius einen gelinde verzweifelten Blick zu. »Sie haben also nichts gesehen?«
»Doch, doch, ich habe etwas gesehen. Genau genommen habe ich es sogar gefilmt«, erwiderte Fouquart eifrig. Er hantierte an dem Kasten mit der Antenne herum. Aus der Burgruine erklang plötzlich ein hohes Sirren – und dann flog eine schwarze Minidrohne heran, die der Astrophysiker vor seinen Füßen landen ließ. Sie war kaum größer als die Revell-Modellflugzeuge aus Plastik, die Blanc in seiner Kindheit zusammengeklebt hatte. »Die Drohne ist klein, aber ich habe eine lichtstarke Kamera montiert«, erklärte er stolz. Dann zeigte er ihnen die Fernsteuerung, in die ein winziger Monitor eingesetzt war. »Ich habe diese Nacht ein Licht dokumentiert!«, rief er.
Blanc und Marius beugten sich über den Schirm. Man hörte das Rauschen des Mistrals aus einem winzigen Lautsprecher des Geräts, sonst keinen Ton. Auf dem Bild war alles schwarz. Mit viel Fantasie ließ sich vielleicht eine Ruine ausmachen oder ein Baum, aber vielleicht war die Qualität des kleinen Monitors auch einfach bloß schlecht. Plötzlich war ein stecknadelkopfkleines, weißes Licht zu sehen, das von rechts nach links durch das Bild schwebte und verschwand.
»Das habe ich zufällig aufgenommen, als die Drohne in Höhe der Burg flog. Sie hat nach unten gefilmt, Richtung Straße.«
»Ein Auto?«, warf Marius zweifelnd ein.
»Nein, die Drohne war auf den Bereich jenseits der Schranke gerichtet. Da kommt man nur noch zu Fuß weiter.«
»Also ein nächtlicher Wanderer mit einer Taschenlampe«, vermutete Blanc. »Oder Fred, der Schäfer, der eine seiner Campingleuchten herumträgt.«
Fouquart schüttelte triumphierend den Kopf. »Für einen Fußgänger bewegt sich das Licht viel zu schnell!«
»Ein Motorrad?«, fragte Blanc.
»Haben Sie Motorenlärm auf der Aufnahme gehört? Eben! Das Licht war lautlos, ganz genau wie bei der Sichtung am 24. Dezember! Lautlos und schnell!« Fouquart starrte stolz und beinahe zärtlich auf seine Drohne.
»Waren diese Lichter am Heiligabend nicht orange? Und flogen die nicht hoch am Himmel, statt über einen Wanderweg zu gleiten?«, fragte Marius freundlich.
Fouquart wedelte ungeduldig mit der Rechten. »Das ist unerheblich. Ich werde diese Bilder nachher am Computer vergrößern und analysieren. Wir werden alle noch eine Überraschung erleben.«
»Und sonst haben Sie in dieser Nacht nichts bemerkt, Doktor Fouquart?«
»Reicht das denn nicht, mon Capitaine?«
Marius und Blanc ließen den Astrophysiker in der Burg zurück. Fouquart packte die Drohne in einen mit Schaumstoff ausgepolsterten Aluminiumkoffer, den er unter einem Mauerstumpf abgestellt hatte. Blanc stapfte durch die Ruinen hügelabwärts, bis er hoffte, außer Hörweite zu sein. »Ein Spinner«, sagte er halblaut. »Da schleicht ein Wolfsrudel durch die Gegend, und dieser Typ filmt das weiße Licht von Raumschiff Enterprise.«
»Putain, der kann von Glück sagen, dass es ihm nicht so ergangen ist wie den Schafen!«, erwiderte Marius.
»Wahrscheinlich hat sein Cordanzug die Wölfe abgeschreckt«, brummte Blanc. »Eins ist sicher: Wenn dieser Herr Professor nicht mal mitbekommt, wie neben ihm ein Massaker verübt wird, dann wird der auch die kleinen grünen Männchen übersehen, selbst wenn sie direkt vor ihm landen.«
»Das müssen diese gruseligen Ruinen sein«, vermutete Marius. »Wahrscheinlich gibt es da irgendeine Aura. Das macht die Wölfe irre und die Menschen auch.«
Sie standen endlich wieder neben dem Streifenwagen. In diesem Augenblick bog ein cremefarbener Einser BMW auf den Parkplatz. Blanc wunderte sich, wie viele Leute sich zu dieser frühen Stunde an dem gottverlassenen Ort einfanden. Eine Frau stieg aus: Anfang fünfzig, mittelgroß, sportliche Figur, dichte, schwarze Haare, ein Pony wie mit dem Skalpell gezogen. Sie trug eine Brille mit schwarzem Kunststoffrahmen, ein Designerstück und sicherlich sehr teuer, doch das Gestell war zu groß für ihre schmalen Züge und ließ sie deshalb unnahbar und streng wirken. Wahrscheinlich war dieser Effekt gewollt, dachte Blanc und sah die Frau unauffällig an. Trotz cremefarbenem BMW und Designerbrille trug sie jedoch eine dunkelgrüne Outdoorjacke und eine Outdoorhose mit vielen Taschen, Trekkingschuhe mit hohem Schaft und Handschuhe aus irgendeinem glänzenden Hightechmaterial. Sie öffnete den winzigen Kofferraum ihres Coupés und holte eine Ledertasche heraus, die aussah wie die Taschen, mit denen Landärzte früher ihre Runden gedreht hatten, nur dass dieses Modell hier größer war. Sie nickte den Gendarmen einen kühlen, desinteressierten Gruß zu und ging zielstrebig Richtung Ruinen.
»Pardon, Madame!«, rief Blanc, einer plötzlichen Eingebung folgend. Er holte sie ein, zückte seinen Ausweis und stellte sich vor. »Sind Sie Tierärztin?« Er fragte sich, woher eine Veterinärin schon so früh von dem Drama auf dem Plateau gehört haben konnte.
»Ich sehe leidenschaftlich gern Krimis im Fernsehen, mon Capitaine. Da stellen die Flics gemeinhin klügere Fragen.« Ihre Stimme war autoritär. »Mich hat noch nie zuvor jemand für eine Tierärztin gehalten. Was wollen Sie überhaupt hier?«
»Wir ermitteln bei«, Blanc wog seine Worte ab, »bei einem Unfall. Niemand hat Sie also gerufen? Sie wissen nicht, was sich oben auf dem Plateau ereignet hat?«
Sie schüttelte den Kopf. »Und wenn es kein Erdbeben ist, dann interessiert es mich auch nicht.« Sie reichte ihm und Marius die Hand. »Ich bin Marie-Claire Martin«, stellte sie sich vor. »Ich bin Seismologin.«
»Sie erforschen Erdbeben?«, fragte Marius erstaunt.
»Für mich ist Vieux Vernègues das, was wahrscheinlich ein erschossener Unbekannter für Sie ist, mon Lieutenant: ein interessanter Fall«, erwiderte sie spöttisch. »Ich forsche an der Universität hauptsächlich über Schadensabschätzung. Welche Art von Beben wird welche Art von Schaden verursachen. Erdbeben ist nämlich nicht gleich Erdbeben, Messieurs. Insofern ist Vieux Vernègues ein gutes Studienobjekt.« Sie deutete hoch zu den Ruinen.
»Während Lambesc unzerstört geblieben ist«, warf Blanc ein. Sonnenlicht badete jetzt das Tal. Die Nachbarstadt sah aus wie die perfekte provenzalische Idylle.
»Interessant, nicht wahr?« Doktor Martin wirkte nun eine Winzigkeit weniger streng, weil sie erkannte, dass sie doch nicht vor zwei Volltrotteln stand. »Das Beben damals ist am 11. Juni 1909 um 21.19 Uhr ausgebrochen, direkt nach einem Regenschauer, überall blieben die Kirchturmuhren stehen. Wir haben die alten Daten an der Universität analysiert: 6,2 auf der Richterskala, das ist stark, aber auch nicht extrem. Aber Sie sehen ja, was aus Vieux Vernègues geworden ist. Ein Wunder, dass es seinerzeit hier nur zwei Tote gegeben hat. Aber insgesamt sind an diesem Abend in der Provence sechsundvierzig Menschen von Trümmern erschlagen worden, es gab zweihundertfünfzig Verletzte, dreitausend Gebäude wurden beschädigt oder zerstört. Die Schäden betrugen mehr als zwei Milliarden Francs. Zwei Milliarden, das klingt heute wie nichts, unsere Politiker geben das an einem Tag aus. Aber damals war das eine enorme Summe. In beiden Weltkriegen zusammen hat es im Midi nicht solche Schäden gegeben wie in diesen etwa siebenundzwanzig Sekunden 1909.«
Doktor Martin forderte sie mit einer Geste auf, ihr zu folgen. Sie ging mit energischen Schritten den Weg hinauf und machte sich nicht die Mühe, sich umzublicken. Eine Frau, die gewohnt ist, dass man ihr gehorcht, dachte Blanc amüsiert. Die Seismologin führte sie bis zu einem eingestürzten Haus, wo sie durch eine Fensterhöhle auf das Tal und auf das neu aufgebaute Vernègues am Fuß des Berges blicken konnten. »Als Vieux Vernègues 1909 zerstört wurde, lebten dort dreihundert Menschen«, fuhr sie fort. »Im neuen Vernègues da unten leben eintausendsiebenhundert Bürger, beinahe eine Versechsfachung! Salon-de-Provence liegt bloß zehn Kilometer entfernt von hier. Damals war das eine verschlafene Kleinstadt mit wenigen Tausend Einwohnern. Heute sind es etwas weniger als fünfzigtausend, dazu Industrie, ein Krankenhaus, Autobahnzufahrten. Und sehen Sie sich diese TGV-Brücke an, einen Kilometer lang und praktisch im Vorgarten von Vernègues! Also, Messieurs, wenn die Erde hier wieder bebte, ganz so wie 1909, wie sähen die Schäden wohl diesmal aus?« Doktor Martin blickte sie zufrieden an, als wünschte sie sich, dass sich diese verdammte Erde endlich wieder zu einem Zittern aufraffen möge.
Blanc fragte deshalb aus Höflichkeit: »Wird es denn wieder beben, Madame?«
»Es bebt doch schon!«, antwortete sie. »9. November 2016, 3,9 auf der Richterskala, Epizentrum in fünf Kilometern Tiefe. 27. Februar 2018, 3,5 auf der Richterskala, Epizentrum im Meeresboden nur sechzig Kilometer vor Marseille. Keine Schäden«, setzte sie etwas missmutig hinzu. »Aber eigentlich rumort der Boden hier jeden Tag. Das Beben vor Marseille war das zehnte über Stärke 3,0 in Umgebung der Metropole seit 1962. Zehn in weniger als sechzig Jahren! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich bei einem Erdbeben in der Provence gewissermaßen live dabei bin. Wir haben in der ganzen Region nur ein einziges festes Seismometer installiert, im Keller des Lycée Georges Duby. Das Gerät ist zwar so empfindlich, dass es zum Beispiel das Erdbeben von Fukushima am anderen Ende der Welt aufgezeichnet hat, aber eine Messstation allein reicht einfach nicht. Also postiere ich für mein Forschungsprojekt mobile Geräte genau über dem alten Epizentrum. Ich habe gestern Abend ein paar neue Messinstrumente zwischen den Ruinen aufgestellt. Heute hole ich mir die Daten ab.« Sie deutete auf ihre Ledertasche.
»Warum stellen Sie Ihre Messinstrumente nachts auf?«, wollte Blanc wissen.
»Wenn ich sie schon tagsüber aufstelle, dann kriegen sie Beine. Wanderer und Jogger können einfach ihre Finger nicht davon lassen; möchte wissen, warum die meine Sachen immer mitnehmen. Man kann ja ein seismologisches Messinstrument schlecht auf dem Flohmarkt verkaufen. Na, jedenfalls kann ich meine Geräte erst dann aufstellen, wenn niemand sonst mehr durch die Landschaft streift. Und ich muss früh wieder da sein, um sie einzusammeln.«
»Doktor Martin«, sagte Blanc liebenswürdig, »wann waren Sie gestern in Vieux Vernègues?«
»Um einundzwanzig Uhr und drei Minuten.«
»Das wissen Sie aber sehr genau.«
»Die Messinstrumente registrieren auch die Uhrzeit, mon Capitaine. Ich habe die Geräte nach und nach zwischen den Ruinen verteilt. Das letzte habe ich um dreiundzwanzig Uhr achtundvierzig aktiviert.«
Blanc erklärte Doktor Martin, was in der Nacht vorgefallen war. Sie schien nicht sonderlich betroffen zu sein. Vielleicht, vermutete Blanc, konnten ein paar gerissene Schafe niemanden erschüttern, der beruflich mit ganz anderen Katastrophen zu tun hatte. »Haben Sie die Schäfer und ihre Herde gestern Nacht bemerkt?«
»Aus der Entfernung. Ich bin bloß für ein paar Wochen hier, bis meine Messreihen abgeschlossen sind. Über Airbnb habe ich mir ein Zimmer im neuen Vernègues besorgt. Da bin ich Fred über den Weg gelaufen. Und was wichtiger ist: Da bin ich seinem Hund über den Weg gelaufen. Diese Erfahrung muss ich nicht wiederholen. Ich habe letzte Nacht einen Apparat in der Burgruine aufgestellt, aber näher bin ich der Herde nicht gekommen. Und ich war so leise und vorsichtig, dass mich der liebe Emir nicht bemerkt hat.«
»Haben Sie, während Sie die Geräte in den Ruinen verteilt haben, Wölfe bemerkt?«
»Würde ich dann noch vor Ihnen stehen, mon Capitaine?«
»Haben Sie jemals bei Ihrer Arbeit in Vieux Vernègues Wölfe gesehen?«, hakte Marius nach.
Sie schüttelte den Kopf und blickte ihn milde tadelnd an. »Dann würde ich wohl kaum Nacht für Nacht meine Sachen aufstellen.«
»Wir haben heute ganz früh am Morgen einen Wolf heulen gehört«, sagte Blanc.
»Oder einen Hund«, warf Marius ein.
Doktor Martin zuckte mit den Achseln. »Da war ich vielleicht noch in meinem Zimmer. Oder im Auto. Ich habe jedenfalls nichts gehört.«
Blanc dachte an die flimmernden Bilder auf dem Monitor der Fernsteuerung des Ufologen. »Sind Sie mit einer Taschenlampe nachts den Weg hoch zu den Ruinen gegangen?«
Die Seismologin schüttelte den Kopf. »Das war nicht nötig. Der Mond war ziemlich hell.«
»Haben Sie denn ein Licht bemerkt?«, fragte Marius.
Sie lachte. »Wölfe, Lichter … Wenn man Sie so hört, muss man denken, letzte Nacht hat es hier einen Krieg gegeben! Nein, tut mir leid, als ich da oben war, war alles ruhig.«
»Aber ist Ihnen denn wenigstens Monsieur Fouquart aufgefallen?« Blanc lächelte sie an. »Ein Mann ungefähr in Ihrem Alter. Er hatte eine Drohne bei sich. Recht auffällige graue Haare und …
»Einstein im Cordanzug. Ja, ich kenne Maurice.«
»Haben Sie ihn letzte Nacht gesehen? Haben Sie einander vielleicht bei«, Blanc zögerte und suchte nach der rechten Formulierung, »bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten geholfen? Beim Tragen der Messinstrumente, so etwas in der Art?«
Doktor Martin schnaubte. »Ich kenne Maurice, aber ich habe ihn letzte Nacht nicht gesehen. Und das, was Maurice mit sich herumträgt, würde ich nicht einmal mit Gummihandschuhen anfassen. Meine Vorstellung von Wissenschaft unterscheidet sich doch sehr von seiner Vorstellung. Ich traue nur Zahlen, Fakten, Messwerten. Er aber will in Vieux Vernègues mit seiner lächerlichen Drohne einen Jedi-Ritter filmen. Das ist schierer Hokuspokus. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss hoch, um meine Instrumente einzusammeln, bevor hier die ersten Jogger aufkreuzen.«
Blanc blickte ihr nach. »Ich bin sicher, diese Dame registriert ein Zittern im Boden, das keiner von uns spüren würde. Aber von Menschen und Tieren bekommt sie nicht sehr viel mit.«
»Hast du gehört, wie sie über den Ufologen gesprochen hat? Als könnte sie ihm die Augen auskratzen«, bemerkte Marius.
»Doktor Martin hat uns nicht gesagt, an welcher Universität sie forscht«, sagte Blanc. Dann deutete er auf ihren BMW. »Ihr Nummernschild zeigt die 38, Département Isère.«
Marius lächelte. »Hauptstadt Grenoble. Da ist die Universität, an der unser Ufologe in einem früheren Leben mal Astrophysiker war.«
Sie stiegen in den Mégane. Blanc hatte es nun eilig, zurückzukommen. Astrid wartete. »Was hältst du von der Sache?«, fragte er Marius, während er losfuhr.
»Ich halte nichts von der Sache, ich halte mich fest. Auf der Straße liegt noch Eis. Wenn du noch stärker auf die Tube drückst, landen wir im Graben. Und dann holen uns vielleicht die Wölfe.«
»Du glaubst also wirklich, dass es ein ganzes Rudel war? Mit einem Hinterhalt?«, vergewisserte sich Blanc und ging seinem Kollegen zuliebe etwas vom Gas.
»Manchmal reißt ein einsamer Wolf ein Schaf. Aber gleich ein Dutzend?« Marius schüttelte entschieden den Kopf. »Kein einsamer Streuner holt sich so viele Lämmer auf einmal. Und dann denk an den Patou: Der hätte einen einzelnen Angreifer zum Frühstück verspeist. Nein, das war ein Rudel. Aber darum werden sich andere kümmern. Sie haben bei der Präfektur Spezialisten für Wölfe.«
»Doch wie lange wird das dauern, bis jemand auf der Präfektur etwas unternimmt? Die Wölfe machen mir keine Sorgen, sondern die Menschen«, erwiderte Blanc. »Fred ist bewaffnet und wütend. Er will die Sache selbst erledigen, aber ein Schäfer alleine wird garantiert nicht mit einem Rudel fertig. Sollten die Wölfe hier länger jagen, dann wird es noch mehr wütende Leute geben wie ihn. Und sie werden alle Gewehre haben.«
Marius lachte. »Du hast doch nicht etwa Angst, dass sie sich gegenseitig abschießen?«
Blanc nickte ernsthaft. »Doch, ganz genau. Wenn Fred schon letzte Nacht auf den Wolf angelegt und geschossen hätte …«
»… hätte Fouquart eine unheimliche Begegnung der dritten Art mit einer Gewehrkugel gehabt, und Doktor Martin hätte vor Schreck gebebt«, vollendete Marius. »Ich verstehe deine Sorge. Aber Schäfer dürfen seit einigen Jahren bewaffnet sein, eben seit es wieder Wölfe gibt. Wenn wir Locez jetzt prophylaktisch sein Gewehr wegnehmen, damit er nicht versehentlich einen durchgeknallten Ufologen erledigt, dann wird er seine Knarre vom Präfekten persönlich zurückbekommen. Und die einzigen beiden Typen, die dann gewaltigen Ärger haben, sitzen gerade in diesem Auto.«