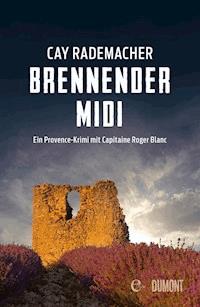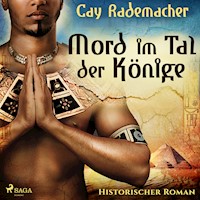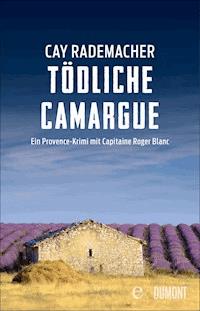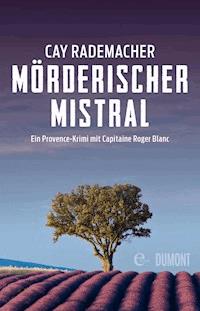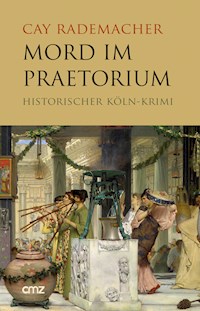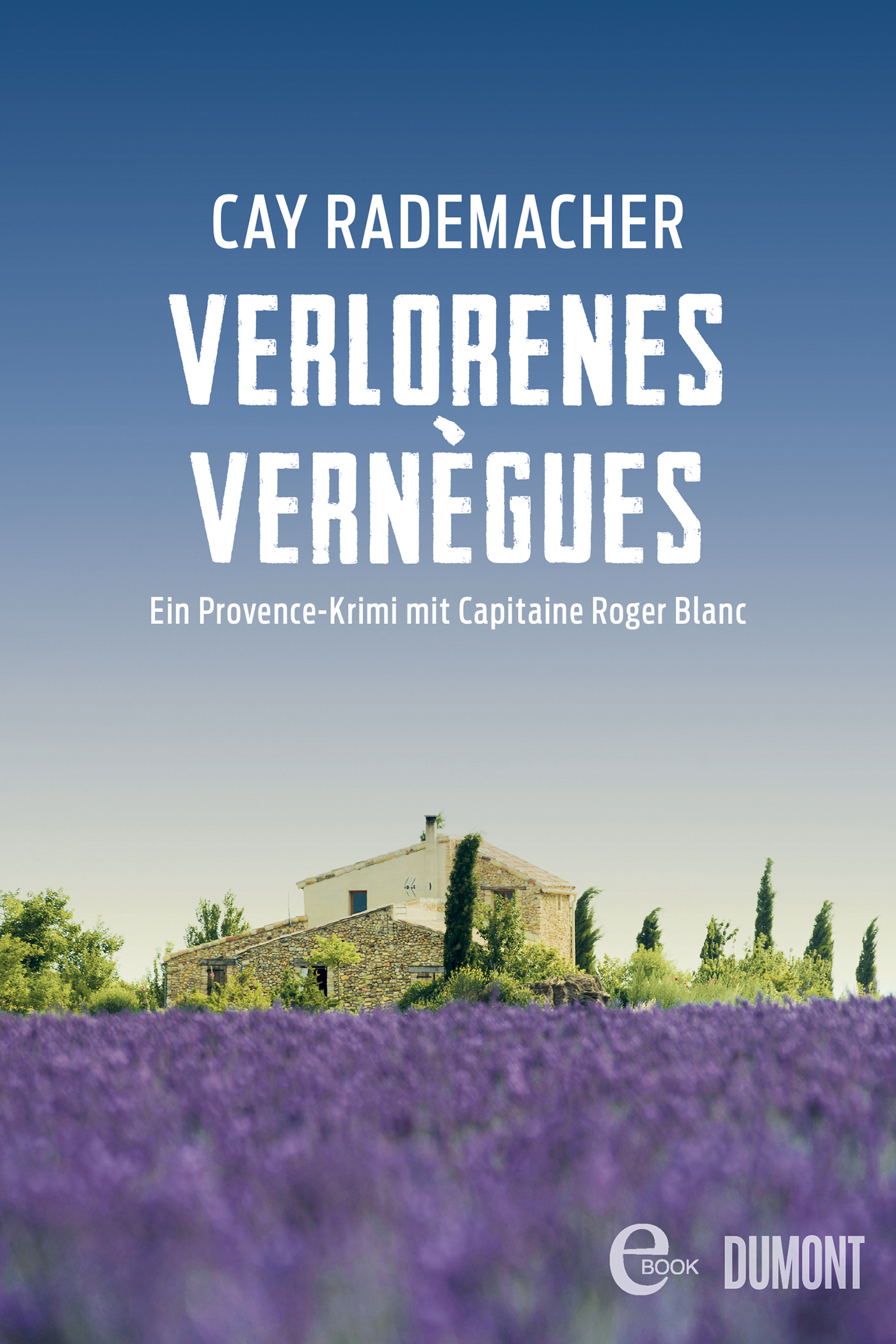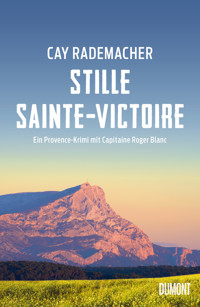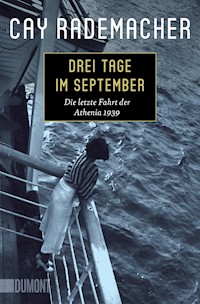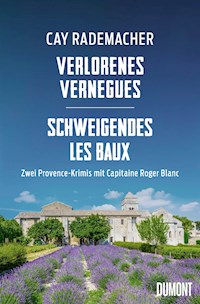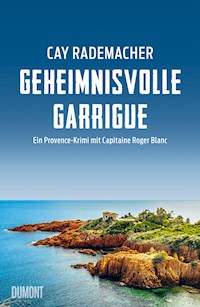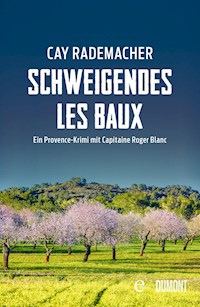14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Provence-Krimi Sammelband
- Sprache: Deutsch
Mysteriöse Vermisstenfälle in der weiten, wilden Garrigue und eine toter Zwillingbruder im Schatten der Sainte-Victoire! »Geheimnisvolle Garrigue« Eine junge Frau verschwindet spurlos, und die Gendarmerie findet nur ihren linken Schuh – auffällig platziert. Genauso war es schon vor 23 Jahren, als am selben Ort vier Frauen verschwanden. Diese Verbrechensserie wurde niemals aufgeklärt. Schlägt der Täter von einst jetzt wieder zu? Wie konnte er während der pandemiebedingten Ausgangssperre niemandem aufgefallen sein? Capitaine Blanc und seinen Kollegen kommt nach und nach ein schrecklicher Verdacht: Was, wenn es einer der ihren ist? »Stille Sainte-Victoire« Ein Bauingenieur aus Lyon wird tot aufgefunden, augenscheinlich wurde er Opfer eines Verbrechens. Die Ermittlungen geraten schnell ins Stocken, denn niemand scheint ein Motiv für die Tat zu haben. Bei seinem Zwillingsbruder, einem berühmten Paläontologen, der seit Jahren Dinosaurierknochen an der Sainte-Victoire entdeckt, sieht es jedoch anders aus. Ein schrecklicher Irrtum des Täters? Schon bald haben Capitaine Blanc und seine Kollegen mehr Verdächtige, als ihnen lieb ist … Mord in der Provence - Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues Band 8: Schweigendes Les Baux Band 9: Geheimnisvolle Garrigue Band 10: Stille Sainte-Victoire Band 11: Unheilvolles Lançon Band 12: Rätselhaftes Saint-Rémy Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1066
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über die Bücher:
Mysteriöse Vermisstenfälle in der weiten, wilden Garrigue und eine toter Zwillingbruder im Schatten der Sainte-Victoire!
»Geheimnisvolle Garrigue«
Eine junge Frau verschwindet spurlos, und die Gendarmerie findet nur ihren linken Schuh – auffällig platziert. Genauso war es schon vor 23Jahren, als am selben Ort vier Frauen verschwanden. Diese Verbrechensserie wurde niemals aufgeklärt. Schlägt der Täter von einst jetzt wieder zu? Wie konnte er während der pandemiebedingten Ausgangssperre niemandem aufgefallen sein? Capitaine Blanc und seinen Kollegen kommt nach und nach ein schrecklicher Verdacht: Was, wenn es einer der ihren ist?
»Stille Sainte-Victoire«
Ein Bauingenieur aus Lyon wird tot aufgefunden, augenscheinlich wurde er Opfer eines Verbrechens. Die Ermittlungen geraten schnell ins Stocken, denn niemand scheint ein Motiv für die Tat zu haben. Bei seinem Zwillingsbruder, einem berühmten Paläontologen, der seit Jahren Dinosaurierknochen an der Sainte-Victoire entdeckt, sieht es jedoch anders aus. Ein schrecklicher Irrtum des Täters? Schon bald haben Capitaine Blanc und seine Kollegen mehr Verdächtige, als ihnen lieb ist …
Mord in der Provence – Capitaine Roger Blanc ermittelt:
Band 1: Mörderischer Mistral
Band 2: Tödliche Camargue
Band 3: Brennender Midi
Band 4: Gefährliche Côte Bleue
Band 5: Dunkles Arles
Band 6: Verhängnisvolles Calès
Band 7: Verlorenes Vernègues
Band 8: Schweigendes Les Baux
Band 9: Geheimnisvolle Garrigue
Band 10: Stille Sainte-Victoire
Band 11: Unheilvolles Lançon
Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Über den Autor
© in medias res
Cay Rademacher, geboren 1965, ist freier Journalist und Autor. Seine Provence-Serie umfasst bisher elf Fälle, zuletzt ›Unheilvolles Lançon‹ (2024). Bei DuMont erschienen auch seine Romane aus dem Hamburg der Nachkriegszeit: ›Der Trümmermörder‹ (2011), Der Schieber‹ (2012) und ›Der Fälscher‹ (2013). Außerdem veröffentlichte er die Kriminalromane ›Ein letzter Sommer in Méjean‹ (2019), ›Stille Nacht in der Provence‹ (2020) und ›Die Passage nach Maskat‹ (2022) sowie das Sachbuch ›Drei Tage im September‹ (2023). Cay Rademacher lebt mit seiner Familie bei Salon-de-Provence in Frankreich.
CAY RADEMACHER
GEHEIMNISVOLLE GARRIGUE
STILLE SAINTE-VICTOIRE
Zwei Provence-Krimis mit Capitaine Roger Blanc
Vollständige E-Book-Ausgabe der im DuMont Buchverlag erschienenen Werke ›Geheimnisvolle Garrigue‹ (© 2022) und ›Stille Sainte-Victoire‹ (© 2023)
E-Book 2024
© 2024 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: DuMont Buchverlag, Köln
Umschlagabbildung: © Adobe Stock/Art Media Factory
Karte in ›Stille Sainte-Victoire‹: Kartografie Angelika Solibieda, Cartomedia-Karlsruhe
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book: 978-3-7558-1043-8
www.dumont-buchverlag.de
CAY RADEMACHER
GEHEIMNISVOLLEGARRIGUE
Ein Provence-Krimimit Capitaine Roger Blanc
Rien n’est plusdangereux qu’un homme qui ne trouve pas ses mots.
Der Fluss in die Unterwelt
Die Luft über dem Tunnel du Rove war so klar, als würde kein Mensch mehr auf der Erde leben. Die Morgensonne leuchtete weich auf die nahen Dächer von Marignane, verwandelte das stille Wasser des Étang de Bolmon am Horizont in flüssiges Gold; ein schmeichlerisches Licht, drei Monate entfernt vom gnadenlos grellen Leuchten, mit dem sie im Sommer die Provence ausdörren würde. Ein Graureiher segelte lautlos dicht über das Wasser, seine Federn hatten die Farbe von Asche. Winzige Wellenlinien riffelten den flaschengrün schimmernden Kanal, vielleicht von einem unmerklichen Wind modelliert, wahrscheinlicher jedoch von einer verborgenen Strömung – einer Strömung, die es gar nicht geben dürfte, dachte Capitaine Roger Blanc, weil sie gegen alle Naturgesetze zu verstoßen schien.
Er stand am Ufer eines Kanals, der mitten in der Stadt Marignane aus einem steilen Berg trat und in gerader Linie bis zum Étang de Bolmon führte, einem flachen See, den nur ein schmaler Damm vom viel größeren Étang de Berre trennte. Doch das Wasser zu Blancs Füßen strömte nicht etwa vom Berg fort Richtung Horizont, so wie ein Fluss, der einem Hügel entspringt – sondern es strömte auf den Berg zu und verschwand dort in einem riesigen finsteren Tunnel. Auf Blanc wirkte das, als würde das Wasser vom Schlund der Unterwelt angesaugt.
Ausgerechnet hier war wenige Stunden zuvor eine junge Frau spurlos verschwunden.
Beinahe spurlos.
Der Tag hatte schon schlecht begonnen: Sonntag, 15.März, Kommunalwahlen in Frankreich, alle Gendarmen waren wie immer mobilisiert worden, um die Wahllokale zu schützen. Nur dass diesmal nichts wie immer war. Die Seuche beherrschte das Land, Covid-19, in den Krankenhäusern erstickten die Patienten. Die Kinder durften ab morgen nicht mehr zur Schule gehen, damit sich die Pandemie nicht noch rascher ausbreitete. Blanc hatte Gerüchte gehört, dass der Präsident die Nation in den Ausnahmezustand versetzen würde, und wer wusste schon, was dann geschah? Vielleicht würde es ihnen allen so ergehen wie seinem Kollegen Lieutenant Marius Tonon, denn der steckte schon seit beinahe zwei Wochen in häuslicher Quarantäne. Er hatte sich vielleicht schon im Februar angesteckt, vielleicht auch nicht, niemand wusste das so genau, denn es gab zu wenige Tests. So wie es auch nicht genügend Alkohollösung gab, um sich die Hände zu desinfizieren. So wie es auch nicht genügend Masken gab, für niemanden.
Blanc hatte den Morgen über in Caillouteaux Dienst geschoben, wo man das Wahllokal in der Kantine der Grundschule eingerichtet hatte. Für die Wahlhelfer hatte es irgendwie doch noch Masken und Desinfektionslösung gegeben, nicht jedoch für die Flics vor dem Gebäude. Zum Glück war die Ansteckungsgefahr nicht sonderlich groß gewesen, denn die meisten Bürger waren aus Angst vor dem Virus erst gar nicht erschienen.
Kurz vor Mittag hatte es plötzlich Alarm in der Gendarmerie-Station von Gadet gegeben: Eine junge Frau namens Laetitia Fabre wurde seit dem frühen Morgen vermisst. Für Blanc war es, trotz dieser beunruhigenden Meldung, eine Erleichterung gewesen, als ihn sein Chef Commandant Nkoulou von dem langweiligen Job am Wahllokal abzog und ihn mit den Ermittlungen betraute.
Laetitia Fabre hatte mit ihrem Mountainbike eine Runde durch die Region gedreht, ihr war die Seuche offenbar egal gewesen, doch sie war bislang nicht zurückgekehrt. Eine zweiundzwanzigjährige Studentin an der Kedge Business School in Marseille; ihr Freund hatte den Beamten ein Foto der jungen Frau geschickt. Blanc hatte das Bild lange auf dem Handy betrachtet. Laetitia Fabre war mittelgroß, schlank, sie hatte braune lange Haare, trug eine dünne Brille – der Typ Frau, bei dem erst auf den zweiten Blick auffiel, wie hübsch sie war. Laetitia wohnte zusammen mit ihrem jüngeren Bruder noch bei der verwitweten Mutter in Pélissanne. Es waren aber weder Mutter noch Bruder, die sie vermisst gemeldet hatten – das hatte Yves-Laurent Sylvain getan, der klügste und ehrgeizigste der jungen Brigadiers, die auf der Station von Gadet Dienst taten. Denn Sylvain war der Freund der Vermissten.
Sylvain hatte sich bei Nkoulou gemeldet. Laetitia Fabre, so sagte er, hätte spätestens um zehn Uhr von ihrer Tour zurück sein müssen. Sie hatte die Nacht bei ihrer Mutter verbracht, er in der Wohnung seiner Eltern. Sie hatte sich auf der Gendarmerie-Station von Gadet melden wollen, um gemeinsam mit ihrem Freund wählen zu gehen. Jetzt war es zwölf Uhr, Laetitia Fabre war weder in Gadet noch bei ihren Eltern aufgetaucht, und wenn Sylvain sie auf dem Handy anrief, wurde er sofort an die Mailbox weitergeleitet.
Kurz nachdem Sylvain die Vermisstenanzeige aufgegeben hatte, ein Kollege tippte noch die Daten in den Computer, war die Meldung einer Streife eingegangen. Ein älterer Mann, der seinen Hund ausführte, hatte ein Mountainbike – genau das Modell, das Laetitia fuhr – in einem verwilderten Grünstreifen gefunden, an einer Stelle, wo man gar nicht mit dem Fahrrad hätte hinfahren können. An einer Stelle, deren Betreten verboten war.
Am Tunnel du Rove in Marignane.
Blanc hatte seiner Kollegin Sous-Lieutenant Fabienne Souillard das Steuer des Streifenwagens überlassen, damit er auf der zwanzigminütigen Fahrt bis Marignane auf seinem alten Smartphone wenigstens ein paar Informationen zu dem Ort finden konnte, an den sie gerufen wurden. Der Tunnel du Rove war ein Projekt wie aus einem Roman von Jules Verne. Damit die schwerfälligen Frachtkähne, die über die Rhône Marseille mit dem Norden verbanden, nicht länger die gefährliche letzte Etappe über das Mittelmeer auf sich nehmen mussten, hatten Ingenieure eine wahnwitzige Abkürzung ersonnen: Die Binnenschiffe sollten vom Étang de Berre, dem Étang de Bolmon und dem Tunnel du Rove aus unter der mehrere Hundert Meter hohen schroffen Hügelkette Chaîne de l’Estaque hindurch direkt bis nach Marseille fahren. Und so wühlten sich ab 1911 Arbeiter aus Italien, Spanien, Portugal, später auch Kriegsgefangene aus Deutschland und Österreich mit Spitzhacken und Dynamit von Marignane und Marseille aus durch die Chaîne de l’Estaque. Hunderte starben unter den Bergen, niemand hatte sich je die Mühe gemacht, die Opfer zu zählen, niemand hatte ihnen je ein Denkmal errichtet oder auch nur einen würdigen Friedhof. 1926 war der Tunnel du Rove vollendet: mehr als sieben Kilometer lang, die steinernen Bögen des Gewölbes zweiundzwanzig Meter weit und über fünfzehn Meter hoch, vier Meter tief war das trübe Wasser – es war der längste Kanaltunnel der Welt. Schiffe fuhren von nun an durch den Berg bis zum Großen Blau – bis in einer Frühsommernacht 1963 tief im Innern Tausende Tonnen Gestein das Gewölbe zerschmetterten und in den Kanal stürzten. Seither hatte niemand je das Geld, die Kraft oder einfach nur den Mut gehabt, diese Barriere zu beseitigen. Und so hatte sich der Tunnel du Rove in den Styx der Provence verwandelt, einen Unterweltfluss, der vom Étang de Berre aus in die Schwärze der Berge floss, ein vergessenes Gewässer, das nichts mehr nützte und das jedermann mied. Das technische Wunder von einst war nun bloß noch ein Monument gescheiterter Träume. Kein Boot, kein Schwimmer durfte sich auf dem Kanal in den Berg hineinwagen, kein Wanderer an seinen schmalen, tückisch brüchigen Ufern entlanggehen.
Blanc fragte sich, was eine zweiundzwanzigjährige Business-School-Studentin mitten in einer Pandemie an so einem Ort verloren haben könnte. Er hatte Brigadier Sylvain befohlen, im Streifenwagen mitzufahren, um ihn unter Kontrolle zu behalten. Der junge Beamte saß auf der Rückbank, er war kaum älter als Laetitia. Er hatte blonde Haare, rosige Haut, sanfte Züge, ein Mann, dem eine Priestersoutane oder eine Pfadfinderkluft besser gestanden hätte als die blaue Uniform der Gendarmerie. Blanc musterte ihn unauffällig im Rückspiegel. Sylvain, der sonst so lieb und harmlos wirkte, war rot und schwitzte. Er knetete unablässig seine Hände. Nervös, dachte Blanc, Sylvain ist nervös. Aber das war nicht alles. Der Mann war seltsamerweise auch verlegen, vermutete er, so als ob er sich für etwas schämte.
»Fuhr Mademoiselle Fabre mit ihrem Mountainbike öfter durch Marignane?«, fragte Blanc und wandte sich während der Fahrt nach hinten.
»Hin und wieder«, antwortete Sylvain fahrig.
»In Marignane liegt der Flughafen Marseille. Daneben stehen die riesigen Werkshallen von Airbus Helicopter. Warum fuhr Mademoiselle Fabre ausgerechnet dort herum?«, mischte sich Fabienne ein. »Es ist nicht gerade der schönste Ort der Provence.«
»Aber einer der flachsten.« Sylvain rang sich zu einem gequälten Lächeln durch. »Ich habe Laetitia schon hundertmal gesagt, sie soll sich ein richtiges Rennrad kaufen. Sie hasst es nämlich, mit ihrem Mountainbike Berge hochzufahren. Sie rast jedes Wochenende wie eine Verrückte über Nebenstraßen. Sie steigt schon in der Morgendämmerung aufs Rad. Sonntagmorgens fährt dort kaum ein Auto, da ist es ungefährlich.« Er merkte, was er gesagt hatte, und seine Stimme verlor sich. Dann räusperte sich Sylvain und fuhr fort: »Jedenfalls fährt Laetitia am liebsten um den Étang de Berre herum, Vitrolles, La-Fare-les-Oliviers und eben Marignane. Da ist es topfeben. Marignane ist übrigens gar nicht so hässlich. Der Eingang zum Tunnel du Rove liegt mitten in einem Wohnviertel, schicke Lage, total ruhig.«
Schickes Wohnviertel, dachte Blanc, total ruhig, eh merde. Das bedeutete wahrscheinlich: keine Zeugen. In solchen Gegenden sah niemals jemand irgendetwas. Er sagte nichts mehr und starrte aus der Frontscheibe, bis sie Marignane erreicht hatten. Fabienne wirkte, als müsste sie sich auf den Verkehr konzentrieren, obwohl kaum ein anderer Wagen zu sehen war. Das Schweigen war wie ein Gewicht, die Fahrt nach Marignane lang wie eine Weltreise. Ein zweiundzwanzigjähriges Mädchen, dachte Blanc, korrigierte sich: eine Frau selbstverständlich. Und doch … Seine Tochter Astrid war zwanzig, und sie war doch gewissermaßen auch noch ein Mädchen, oder? Wenn Astrids Fahrrad irgendwo in einem Gebüsch gefunden worden wäre … Blanc schüttelte sich unwillkürlich. Professionell bleiben, ermahnte er sich, und vielleicht klärt sich das alles rasch auf, und es ist ganz harmlos. Hoffentlich ist alles ganz harmlos. Es muss harmlos sein, merde.
Sie parkten in der Rue Robert Schuman, einer schmalen, geraden, mindestens einen Kilometer langen Straße mit staubigem Randstreifen, zernarbtem Asphalt, fehlenden Markierungen – als hätte sich nie jemand die Mühe gemacht, sie zu vollenden. Doch an ihrer linken Seite reihten sich Grundstücksmauern nahezu nahtlos aneinander, lauter kleine Burgen, ockerfarben, rot, rosa oder grau verputzt, die Tore aus eingefärbtem Aluminium, Edelstahl oder Holz, alle geschlossen. Darüber erkannte Blanc Dächer und Veranden von Villen, bei denen sich die Besitzer sehr wohl die Mühe gemacht hatten, sie bis zur letzten Dachschindel zu Ende zu bauen. Ein gepflegtes Viertel, die Häuser stammten aus den Siebziger- oder Achtzigerjahren, nicht wirklich alt, aber auch nicht mehr modern. Und nirgendwo war ein Bewohner zu sehen.
Auf der anderen Seite der Rue Robert Schuman erstreckte sich ein schmaler, verwilderter Grünstreifen. Gräser hoch wie Weizen, Disteln, Ginster, dazwischen ein Trampelpfad. Blanc entdeckte ein Warnschild mitten im Gestrüpp, die Schrift schreiend rot: Danger! Accès Interdit – Risque du Chute.
Chute, dachte Blanc, »Absturz«, wo sollte man hier abstürzen? Die Navigationsapp seines Handys zeigte ihm, dass er nur ein paar Meter neben dem Kanal stehen musste, er bemerkte auch den Geruch von Süßwasser, aber er sah nur Villen auf der einen und Wildnis auf der anderen Straßenseite. Zwischen den Gräsern blitzte ein seltsam eckiges, mannshohes metallenes Messgerät. Sie gingen dorthin. Sixense stand auf dem Sockel des Geräts, was ihn auch nicht klüger machte. Einige orangefarbene Holzpflöcke steckten zu beiden Seiten im weichen Erdboden, wo sich ein fünfzig Meter langer Riss auftat. Und da erst erkannte Blanc, dass der Grünstreifen die Kante eines sehr steilen Abhangs verbarg – eines Abhangs, der offenbar jederzeit in die Tiefe rutschen konnte. Das Gerät und die Holzpflöcke waren nichts anderes als eine Art Alarmanlage, die wahrscheinlich mit einer Zentrale verbunden war und ein Zeichen geben sollte, wenn sich Hunderte Tonnen Erdreich und Sand in Bewegung setzten. Denn hinter dem Gestrüpp und den Warnschildern versteckte sich der Kanal, der zum Tunnel du Rove führte.
Blanc fand sich plötzlich an einer wohl dreißig Meter in die Tiefe fallenden Böschung wieder, so steil, dass jeder, der sie hinuntergehen wollte, sich im Boden festkrallen musste. Verkrüppelte Kiefern, Wacholdersträucher und Brombeeren wuchsen aus der abfallenden Flanke, Büschel mit hohem Bambus hatten mal hier, mal dort ein paar Quadratmeter erobert und bewegten sich sanft im Wind. Direkt vor ihm ragte ein schwarzer, knotiger toter Baum in den Himmel. Weit unter Blanc war der alte Kanal ein gerader, in rissigen Beton gefasster Wasserlauf, mehr als zwanzig Meter breit. Das Wasser war trüb und grün. Sein Blick folgte einem Reiher, der wie ein lautloser Geist über den Kanal glitt. Einst waren zu seinen beiden Seiten aus Beton schmale Uferstreifen gegossen worden, vielleicht für Treidlerpferde, vermutete Blanc, die früher Frachtkähne zogen. Doch diese Betonwege waren längst von Schlamm überkrustet, aus dem Sträucher wuchsen.
Zu seiner Rechten verlor sich der Kanal irgendwann im goldenen Dunst, dort, wo Étang de Bolmon und Étang de Berre lagen. Etwa hundert Meter links von ihm verschwand er in einem Portal, das wie ein Eisenbahntunnel aussah, so als seien das hier ursprünglich einmal Schienenstränge gewesen, die durch irgendeine seltsame Katastrophe überspült worden waren. Das Portal war ein gewaltiger Bogen in einem grün überwucherten Felshang, ein Gewölbe aus Steinen mit wuchtigen eckigen Vorbauten zu beiden Seiten. Die Steine waren sorgfältig zurecht gehauen, manche waren sicherlich so groß wie der Oberkörper eines Mannes. Sie schimmerten grau unter einem Schleier aus Grünspan hindurch. Von seinem Standpunkt aus am oberen Rand der Böschung konnte Blanc nur wenige Meter tief in den Tunnel hineinblicken. Dort war das Gewölbe schwarz von Feuchtigkeit und versintert, von der Decke hingen zahllose kaum mehr als fingerlange bräunliche Stalagtiten.
»Wie gruselig«, murmelte Fabienne.
Blanc warf ihr einen warnenden Blick zu und deutete unauffällig zu Sylvain hin, der auf der Straße stehen geblieben war und zwei Gendarmen ein Handzeichen gab, die ein Stück weit die Rue Robert Schuman hinunter im Schatten eines Baumes gewartet hatten. Blanc blickte genauer hin. Ein älterer Mann stand bei den beiden Kollegen, zu seinen Füßen hatte sich ein Hund undefinierbarer Rasse zusammengerollt, vielleicht erschöpft vom Spaziergang oder der Sonne, oder vielleicht war ihm auch einfach bloß langweilig. Ein paar Meter hinter den Gendarmen und dem Hundehalter lehnte ein schwarzes Mountainbike an der Stange eines Warnschildes, als hätte jemand es dort nachlässig abgestellt.
»Dann wollen wir mal«, sagte er und straffte sich. Blanc begrüßte die Beamten und den älteren Mann, der sich als Jacques Bameule vorstellte. »Monsieur Bameule, wann ist Ihnen das Fahrrad aufgefallen?«
»Das ist mir gewissermaßen zweimal aufgefallen, am frühen Morgen und vor einer Stunde wieder.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte Fabienne. Sie hatte ihr iPhone gezückt und nahm das Gespräch auf. Blanc hatte einen alten Block in der Hand und machte sich Notizen.
»Eh bien.« Bameule kratzte sich verlegen auf dem kahlen Kopf. Er war mittelgroß und ziemlich massig, über seine Oberlippe wölbte sich ein schon lange nicht mehr gestutzter schwarzer Schnauzbart, die Haut auf seinem Schädel und seinen Unterarmen sah aus wie altes Leder. Er roch nach Zigaretten. Blanc schätzte ihn auf etwa siebzig Jahre, ein Mann, der sein ganzes Leben im Freien gearbeitet haben musste und nun seine Rente genoss.
»Eigentlich bleibe ich in diesen Tagen am liebsten zu Hause.« Bameule deutete auf eine der Villen, die hinter einer hellrosafarbenen Mauer kaum zu sehen war. »Mein Arzt hat es mir geraten, weil ich es auf der Lunge habe. Ich soll nicht unter Leute gehen, bis diese Covid-Seuche abgeflaut ist. Aber Poupet muss halt ab und zu vor die Tür.« Die ältere Hündin hob müde den Kopf, als sie ihren Namen hörte, und rollte sich dann mit einem leisen Knurren wieder zusammen. »Also war ich morgens draußen.«
»Wann genau?«, unterbrach ihn Blanc.
»Gegen sieben Uhr, vielleicht auch Viertel nach sieben, es war auf jeden Fall noch nicht richtig hell. Ich habe das Fahrrad gesehen, das am Schild lehnte, und mich kurz gewundert, aber auch nicht sehr. Da macht halt jemand eine Pinkelpause und ist hinter dem Busch verschwunden, habe ich gedacht. Na, um elf musste Poupet wieder raus – und da stand das Fahrrad immer noch da. Das hat mich stutzig gemacht. Ich bin näher heran und habe gesehen, dass es nicht mal abgeschlossen war. Also habe ich mich ein wenig im Unterholz umgesehen, doch da war niemand. Aber nur ein paar Meter hinter dem Schild, an dem das Fahrrad lehnt, fällt die Böschung ja steil ab zum Kanal. Und da ich das Fahrrad schon in der Dämmerung gesehen hatte, habe ich mir gedacht, vielleicht ist sein Fahrer bei dem schlechten Licht am frühen Morgen zu nah an die Böschung getreten und ist abgestürzt. Aus dem Kanal da unten kommt man nicht mehr so leicht raus, wenn man erst einmal reingefallen ist. Also war es besser, ich rufe die Gendarmerie an.«
»Das haben Sie sehr gut gemacht, Monsieur Bameule«, versicherte Blanc. »Haben Sie das Fahrrad angefasst?«
Der alte Mann kratzte sich schon wieder am Kopf. »Das weiß ich nicht mehr. Kann sein, kann auch nicht sein. Ich habe es mir auf jeden Fall näher angesehen. Aber ich habe es nicht bewegt! Das stand die ganze Zeit genau da, wo es jetzt noch steht.«
»Ist Ihnen sonst noch irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen?«, hakte Fabienne nach.
Bameule überlegte lange, bevor er antwortete. »Beim ersten Mal, als ich mit Poupet draußen war, habe ich einen Augenblick lang geglaubt, dass ich ein Licht gesehen habe.«
»Ein Licht?«
»Na, wie eine Taschenlampe.« Er deutete vage Richtung Kanal. »Irgendwo da unten.«
»Auf dem Wasser?«, fragte Blanc. »Oder im Tunnel? Oder am Hang?«
»Das weiß ich nicht. Morgens ist der Kanal wie eine schwarze Schlucht, da sieht man nichts. Und einmal kurz war da ein Licht. Nicht im Tunnel, das glaube ich nicht. Vielleicht auf dem Wasser. Aber nur ganz kurz. Kann aber auch sein, dass es die Spiegelung einer Straßenlaterne war.«
Blanc wandte sich Sylvain zu, der vor dem Mountainbike in die Knie gegangen war, um es genauer zu untersuchen, ohne es jedoch anzufassen. »Nun?«
Sylvain war blass geworden und deutete auf den Rahmen. »Da ist ein langer Kratzer im Lack. Laetitias Rad hat genau so einen Kratzer, genau an dieser Stelle. Sie ist vor einem halben Jahr mal damit gestürzt.« Seine Stimme war kaum noch zu verstehen.
Blanc und Fabienne wechselten einen Blick. »Dann rufen wir wohl besser die Kriminaltechniker«, sagte Blanc seufzend. »Sie sollen das Fahrrad mitnehmen und im Labor auf Spuren untersuchen.« Er nickte Fabienne zu, die bereits ihr Handy am Ohr hatte. »Sag ihnen, dass sie sich so viele Leute nehmen sollen, wie sie auftreiben können. Wir müssen die ganze Böschung absuchen.«
»Und den Kanal«, ergänzte Fabienne düster. »Ich alarmiere auch die Taucher.«
Blanc deutete auf Sylvain. »Geben Sie den Kriminaltechnikern bitte auch die Adresse von Laetitia Fabre. Sie sollen einen Kollegen vorbeischicken, der von einem Kleidungsstück eine DNA-Probe nimmt, mit der wir die Spuren auf dem Fahrrad vergleichen können. Apropos Fahrrad: Das Mountainbike hat kein Licht. Sie sagten, dass Ihre Freundin schon in der Dämmerung losfährt. Wie hat sie da etwas sehen können?«
Der junge Brigadier strich sich mit einer unbewussten Geste über die Wange. »Laetitia steckt sich immer LED-Lampen an den Helm. Vorne eine mit einem weißen Lichtstrahl, hinten eine, die rot blinkt.«
Blanc wandte sich an den Rentner. »Welche Farbe hatte das Licht, das sie gesehen hatten?«
Der alte Mann sah unsicher auf den Kanal, als würde dort irgendwo die Antwort schwimmen. »Eh bien, es war hell. Weiß, würde ich sagen, oder grünlich. Eher grün, ja. Also, rot geblinkt hat es auf jeden Fall nicht.«
Blanc bedankte sich bei Bameule, der erleichtert zu sein schien, dass er sich wieder hinter seiner Grundstücksmauer vor den Viren verschanzen durfte. »Bleiben Sie beim Fahrrad, bis die Kollegen von der Spurensicherung da sind«, befahl Blanc den beiden Gendarmen. »Wir sehen uns schon mal am Kanal um.«
»Falls wir uns beim Abstieg nicht den Hals brechen«, ergänzte Fabienne und sah skeptisch in die Tiefe.
»Es gibt da eine Treppe, mon Capitaine«, erklärte der ältere der beiden Uniformierten. »Sie beginnt direkt vor dem Portal zum Tunnel. Sie ist ziemlich versteckt, gehen Sie einfach durch die Büsche. Aber seien Sie vorsichtig: Die Stufen sind schmal!«
Sie kehrten zum Streifenwagen zurück, um ihre Taschenlampen zu holen. Kurz darauf standen Blanc und seine beiden Kollegen auf der ersten Stufe einer vom Regen und von der Zeit zermürbten Betontreppe, die unmittelbar vor dem Tunnelportal steil bis zum Treidlergang hinunterführte. Disteln und Brombeeren hatten ungefähr die Hälfte der Treppe zugewuchert; leere Bierflaschen und weggeworfene Feuerzeuge bewiesen jedoch, dass die Gendarmen nicht die Ersten waren, die diesen Weg entdeckt hatten.
Sie stiegen vorsichtig hinab. Je tiefer sie hinunterkamen, desto intensiver wurde der Geruch nach Süßwasser und desto leiser wurden die Geräusche von oben. Wenn, was selten genug vorkam, mal ein Auto über die Rue Robert Schuman fuhr, hörte man dessen Motor kaum noch, und man sah nichts anderes mehr außer dem verwilderten Abhang, dem Kanal, dem riesigen Tunnel und dem hellen Himmel weit über sich. Vögel zwitscherten, und irgendwann, beinahe schon auf der untersten Stufe, vernahm Blanc noch einen anderen Laut: den von Wassertropfen. Unablässig klatschten sie aus dem feuchten Gewölbe auf den Kanal, ein leises Plätschern. Manchmal blitzten einzelne fallende Tropfen für einen Sekundenbruchteil auf, wenn sie zufällig ein Sonnenstrahl traf. Blanc musste an Bameules Aussage denken: Ob das jenes Licht gewesen sein mochte, das der Rentner gesehen hatte?
Als er unten angekommen war, erblickte Blanc links neben der Treppe eine Art Betonkammer, feucht und dunkel wie ein alter Bunker. Ein zerstörter Kinderwagen lag zwischen den Spuren erloschener Lagerfeuer auf dem Boden. Blanc nahm seine Maglite und leuchtete hinein, dann atmete er erleichtert auf: kein Körper einer jungen Frau, kein Blut, nichts.
Von unten wirkte das Portal noch gewaltiger, ein Gewölbe wie eine Fabrikhalle und so tief, dass es sich nach Hunderten Metern in der Schwärze verlor. Eine verschweißte Stahltür, die in einem Beton- und Eisenrahmen steckte, sperrte den Treidlergang ab, sodass man von diesem schmalen Weg aus eigentlich nicht in den Tunnel hineingehen konnte. Doch eine Reihe leuchtend bunter Graffiti in seinem Innern ließ darauf schließen, dass diese Sperre sehr wohl irgendwie überwunden werden konnte. Allerdings war der Treidlergang dahinter nach wenigen Metern ins Wasser gestürzt, und dort endete auch die letzte gesprayte Zeichnung. Am gegenüberliegenden Ufer schien der Betonstreifen am Tunnelrand jedoch tiefer in den Berg hineinzuführen.
Blanc seufzte und deutete auf eine zweite schmale Treppe, die am gegenüberliegenden Hang bis zum Tunnel führte. »Wir gehen hoch, klettern über den Tunneleingang und gehen dort wieder runter«, befahl er.
»Das Fahrrad ist aber an diesem Ufer gefunden worden«, gab Fabienne zu bedenken.
Blanc hob bedauernd die Hände. »Irgendwie müssen wir in diesen verdammten Tunnel hinein.«
Ein paar Minuten später standen sie auf der anderen Seite wieder vor einer in ihrem Rahmen verschweißten Stahltür. Danger Passage Interdit stand auf einem Warnschild, die Buchstaben waren verwittert, das letzte Wort hatte ein Sprayer zudem fast gänzlich zugesprüht.
»D’accord«, sagte Blanc und steckte die Taschenlampe in den Gürtel, um beide Hände frei zu haben. »Brigadier Sylvain, machen Sie eine Räuberleiter für mich.«
Er schwang sich mit Sylvains Hilfe auf den oberen Rand der Absperrung, Fabienne folgte ihm. Gemeinsam zogen sie den jungen Beamten nach, dann sprangen sie jenseits der Barriere auf den Gang hinunter.
Es stank jetzt nach Schimmel, ab und zu klatschte Blanc ein Tropfen auf die Haare. Außer dem Plätschern gab es nun keinen anderen Laut mehr. Auf dem rissigen Beton des Treidlergangs stand hier und da braunes Wasser in großen Pfützen. Kabel und eiserne Klammern ragten aus der gemauerten Wand und alle paar Meter kopfgroße verrostete Ringe, in denen einst vielleicht Bootsleinen festgemacht worden waren. In kleinen Wandnischen standen steinerne, von der Feuchtigkeit zerfressene Poller. Sie wirkten wie die Sockel längst verschwundener antiker Götterstatuen. Auf dem Boden hatte das über die Jahre auf immer dieselben Stellen tropfende Wasser bereits winzige gelbweißliche Sinterhügel gebildet, die aussahen wie zerlaufener Käse. Mit jedem Schritt wurde es dunkler. Blanc ging vorsichtig über den schmalen Betonweg voran. Wie mochte es früher gewesen sein, als die Treidler ihre schweren Lastkähne sieben elend lange Kilometer durch den Berg zogen? Gab es Fackeln? Petroleumfunzeln? Oder schon von Anfang an elektrisches Licht? Sie hatten nun nichts als ihre Taschenlampen.
Nach einigen Hundert Metern gelangten sie an eine Stelle, wo der Treidlergang auf etwa zwanzig Metern kollabiert war. Dort waren stattdessen relativ modern aussehende Stahlträger in die Wand gesetzt worden, sie sahen aus wie übergroße Regalhalter – nur dass es dort kein Brett gab.
»Merde«, murmelte Blanc. Er nahm die Taschenlampe zwischen die Zähne und stieg vorsichtig vom zerbröselten Ende des Treidlergangs auf den ersten Stahlträger. Er trat darauf und nickte den anderen zu: Das Eisen hielt sein Gewicht. Er klammerte sich mit beiden Händen an der feuchtigkeitsschmierigen Wand fest und balancierte dann in großen Schritten von Träger zu Träger, bis er wieder auf dem Treidlergang stand, die Taschenlampe aus dem Mund zog und tief durchatmete.
»D’accord«, rief er Fabienne und Sylvain zu. »Das ist stabiler, als es wirkt.«
»Das sah aus wie eine Zirkusnummer«, erwiderte Fabienne, doch sie schien durchaus Spaß daran zu haben, dieses Hindernis zu überwinden. Sylvain sagte nichts, ging als Letzter, sprang dann aber schnell und sicher von Eisenträger zu Eisenträger. Entweder ist der Brigadier ein sehr guter Turner, oder er macht das nicht zum ersten Mal, dachte Blanc unwillkürlich.
Der Tunnel schimmerte nun grau, an den Seiten schwarz, voraus finster. Wenn Blanc sich im Gehen umblickte, war die Öffnung nur noch ein kleiner halbrunder Fleck Licht, der immer winziger wurde. Die drei zitternden Lichter ihrer Taschenlampen reichten irgendwann nicht einmal mehr, um das immense Gewölbe auszuleuchten. Bald schritten sie durch nahezu vollständige Finsternis. Es war so schwarz, dass Blanc das Gefühl hatte, es wäre Tinte in der Luft, die er mit jedem Atemzug mühsam einsog. Er wusste nicht, wie lange sie so durch die Dunkelheit schritten. Und sie entdeckten keine Spur der verschwundenen Frau.
Irgendwann endete der Kanal abrupt bei einem Wall aus Felsbrocken und Schutt. Blanc leuchtete das graue Geröll mit seiner Maglite ab. Es war eine gewaltige Barriere quer im Tunnel, höher als das Wasser, höher als der Treidlergang. Er richtete den Strahl nach oben: Die Trümmer ragten nicht bis ganz nach oben, das Gewölbe schien noch intakt zu sein.
»Das müssen die kleineren Brocken des Felssturzes sein«, sagte Fabienne. Sie hatte unwillkürlich angefangen zu flüstern. »Sie sind wahrscheinlich bis zu diesem Ort gerutscht. Der eigentliche Felssturz muss noch tiefer im Berg liegen.«
»Sehen wir uns das auch noch an, und dann lasst uns hier wieder verschwinden«, erwiderte Blanc. Er glaubte nicht, dass sie so tief im Tunnel eine Spur der Vermissten finden würden, aber er wollte sichergehen, nichts zu übersehen.
Sie kletterten langsam und leise fluchend auf das Geröll. Es füllte den Tunnel ungefähr bis zwei, drei Meter unter dem Scheitelpunkt des Gewölbes. Sie gelangten auf diesem Schutt noch ein paar Dutzend Meter tiefer in den Berg. Dann ragte eine moderne, aus groben Blöcken gefügte Mauer vor ihnen auf, die den Tunnel schließlich vollständig absperrte. Ein paar rostzerfressene Eisengitter steckten in der Konstruktion, ihr Zweck war Blanc nicht klar.
»Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man kurz nach dem Felssturz die Stelle gesichert hat, damit nicht noch weitere Gewölbeabschnitte kollabieren«, erklärte Sylvain und leuchtete mit seiner Taschenlampe die Sperre an. »Das muss es wohl sein. Die Mauer stützt das Gewölbe und verhindert, dass sich die Steine vom Felssturz dahinter bewegen. Hier geht es jedenfalls nicht mehr weiter.«
Fabienne stieß einen leisen Pfiff aus. »Roxane und ich sind in einer Umweltinitiative«, sagte sie. »Wir kämpfen seit Jahren dafür, dass der Tunnel du Rove wieder aufgemacht wird. Nicht für Schiffe, sondern damit frisches Meerwasser in den Étang de Berre strömt, das ist gut für die Natur. Egal, wer in Paris regiert, alle Regierungen haben sich geweigert, den Tunnel wieder freizuräumen. Ich habe immer geglaubt, den Typen in der Hauptstadt ist das hier scheißegal, und die wollen einfach nur kein Geld ausgeben. Aber jetzt begreife ich, was für eine Riesenarbeit es wäre, alles fortzuschaffen. Das würde Jahre dauern!«
Blanc strich mit der Taschenlampe über die Mauer, den Schutt, das Gewölbe. Wenn man wirklich diesen Tunnel wieder öffnen wollte, dann beneidete er die Arbeiter nicht, die man in den Berg schickte.
»Wir können umkehren«, meinte er, »hier gibt es nichts zu sehen.«
Sie machten sich auf den Rückweg, schneller diesmal. In der Ferne leuchtete Sonnenlicht durch das Portal, ein Lichtpunkt, der sich mit jedem Schritt aufblähte. Endlich konnten sie die Taschenlampen wieder ausschalten. Sie kletterten über die Absperrung und standen schließlich wieder im Freien auf dem Treidlergang am Fuß der steilen Treppe.
»Dann eben zurück ans andere Ufer, und von dort aus suchen wir es Richtung Étang de Bolmon ab«, kommandierte Blanc. Er zwang sich, tief durchzuatmen. Es war anstrengender, als er vermutet hatte, den Tunnel zu begehen. Wie seltsam, dachte er, während er wieder oberhalb des Portals auf die andere Seite kletterte. Direkt unter ihm schimmerte das Kanalwasser grün. Doch wenn er in die Ferne blickte, leuchtete es tiefblau. Wo ging die eine Farbe in die andere über? Unmöglich, das zu sagen. Er stieg hinunter und musste vorsichtig vorangehen. Auf dem Betonboden lagen uralte Eisenreste, rostrot zerfressen und bizarr geformt wie abstrakte Skulpturen. Ein von der Zeit zernarbter Poller wurde von einem Brombeerstrauch umschlungen.
Etwa hundert Schritte vor dem Tunneleingang war der Treidlergang auf knapp zehn Metern zerstört. Zerbrochene Betonplatten ragten wie kariöse Zähne aus der Böschung, darunter sah er braunes weiches Erdreich. Keine Fußspuren, registrierte Blanc automatisch. Doch auf einer der zerbrochenen Betonplatten entdeckte er auf einmal einen Schuh – so neu und sauber, als wäre er ein Ausstellungsstück.
»Nike Air«, sagte Fabienne, »meine Frau ist ganz verrückt nach diesen Dingern.«
Blanc ging in die Knie, rührte den Schuh jedoch nicht an. Er war schwarz und rosafarben, die Sohle war weiß und auffallend dick, an der Seite leuchtete der Swoosh der Marke. Ein Damensportschuh. Er sah genauer hin: ein linker Schuh. Er blickte sich um, sah unter die nächsten Büsche, auf den feuchten Erdboden, sogar in den Kanal, denn ein paar Zentimeter tief war die Böschung unter Wasser zu erkennen, bevor sie sich im grünlichen Schimmer verlor. Nirgendwo war das rechte Gegenstück zu sehen. Schließlich drehte sich Blanc zu Sylvain um, weil er ihn fragen wollte, ob ihm dieser Schuh womöglich bekannt vorkam. Als er das Gesicht des jungen Brigadiers sah, musste er die Frage nicht mehr stellen.
»Vor ein paar Wochen waren Laetitia und ich im Village des Marques in Miramas. Da hat sie sich im Nike-Shop genau so ein Paar gekauft«, sagte Sylvain leise.
»Die Kriminaltechniker werden ihn sich vornehmen«, erwiderte Blanc. »Es tut mir leid, Brigadier.«
Sylvain starrte ihn an, Verzweiflung verzerrte seine jungenhaften Züge. »Verstehen Sie denn nicht, mon Capitaine?«
»Was soll ich verstehen?«
»Es ist ein linker Schuh! Am Tunnel du Rove!«
»Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Brigadier.«
»Ein Mörder … Jemand, den wir nie gefasst haben. Nach so vielen Jahren schlägt er wieder zu!«
Fabienne und Blanc sprangen zu ihm und griffen ihm unter die Arme, weil Sylvain plötzlich so heftig taumelte, dass sie Angst hatten, er könnte in den Kanal stürzen.
»Nehmen Sie sich zusammen, Sylvain«, beschwor ihn Fabienne. »Noch wissen wir gar nichts. Vielleicht klärt sich alles ganz schnell auf, und heute Abend lachen Laetitia und Sie über die ganze Aufregung.«
Sylvain blickte von einem zum anderen und schüttelte schließlich resigniert den Kopf. »Haben Sie denn nie mit den Disparues du Rove zu tun gehabt? Ich habe den Fall auf der Gendarmerie-Schule durchgenommen.«
Blanc und Fabienne wechselten unauffällig einen ratlosen Blick.
»Wir werden es später im Computer der Gendarmerie nachprüfen«, versprach Fabienne.
Disparues du Rove, dachte Blanc, die »Verschwundenen von Rove«, nie gehört, aber das klang überhaupt nicht gut. »Was wissen Sie darüber, Brigadier?« Er hörte selbst, dass seine Stimme auf einmal gepresst klang.
»Das ist, glaube ich, dreiundzwanzig Jahre her.« Sylvain sprach nun so leise, dass sie sich zu ihm beugen mussten, um ihn zu verstehen. »Damals sind im Verlauf von zwei oder drei Monaten vier junge Frauen in Marignane spurlos verschwunden. Besser gesagt: nahezu spurlos. Von jeder Frau hat man ihren linken Schuh am Ufer des Kanals gefunden, stets nahe am Portal des Tunnels. Nichts sonst. Keine anderen Habseligkeiten, keine Kleidungsstücke, keine Fingerabdrücke, keine …«, er zögerte, »… keine Körper. Die Frauen waren einfach fort, als hätte es sie nie gegeben. Selbstverständlich haben die Gendarmen damals den Kanal und den Tunnel abgesucht und die ganze Stadt auf den Kopf gestellt. Nichts. Soweit ich mich erinnern kann, haben die Beamten seinerzeit nicht einmal einen Verdächtigen gehabt. In der Zeitung hießen die Opfer irgendwann Les Disparues du Rove, und die älteren Leute in Marignane erinnern sich garantiert noch daran.«
»Das ist dreiundzwanzig Jahre her?«, vergewisserte sich Blanc. Er hatte längst Notizblock und Stift gezückt. »Die Serie hörte damals einfach auf, dreiundzwanzig Jahre lang geschieht nichts, und plötzlich …« Er sprach nicht weiter, weil Sylvain sein Gesicht in den Händen verbarg.
»Sie sollten wieder nach oben gehen«, meinte Fabienne und nahm ihn behutsam am Arm. »Wir bleiben hier und kümmern uns um alles.«
Sylvain wischte sich über die Augen und schüttelte den Kopf. »Ich bleibe auch hier. Wissen Sie«, er versuchte sich an einem Lächeln, scheiterte aber recht kläglich, »als Kind war ich mit meinen Eltern nur ein einziges Mal am Kanal, obwohl wir in Marignane wohnen. Da war ich sechs oder sieben Jahre alt, es war ein schöner Tag, wir gingen spazieren. Irgendwie sind wir bis zum Wasser hinuntergestiegen, ich erinnere mich nicht mehr, ob es auf dieser steilen Treppe war oder anderswo. Jedenfalls bin ich vorausgelaufen, Richtung Tunnel, wie Jungen das halt so tun. Da hat mein Vater mich angebrüllt, wie er mich nie zuvor angebrüllt hat. Keinen Schritt weiter! Ich habe es damals gar nicht verstanden, ich hatte nur Angst – weil ich gesehen habe, dass mein Vater Angst hatte. Man konnte es an seinen Augen erkennen. Er hat mir dann erklärt, ich erinnere mich noch genau an seine Worte, dass ›in dieser Höhle Monster leben, die dich für immer ins Wasser zerren‹. Aber ich habe gespürt, dass er lügt. Erst Jahre später, auf der Gendarmerie-Schule, habe ich den wahren Grund verstanden: Mein Vater hatte Angst wegen der Disparues du Rove, obwohl diese Verbrechensserie ein Jahr vor meiner Geburt passiert ist. Aber die Angst war einfach immer noch da. Wir sind danach jedenfalls nie wieder zum Tunnel gegangen.«
Sie harrten noch etwa eine Viertelstunde am Kanal aus, ohne dass jemand ein Wort sprach. Blanc betrachtete den Sportschuh. Gab es etwas Harmloseres? Und doch schien er etwas unsichtbar Böses auszustrahlen. Sein Blick ging zum Tunnelportal. Die Sonne musste weitergewandert sein, aber sie war vom Ufer des Kanals aus nicht zu sehen. Nachmittag, schätzte er, es war schon mindestens fünfzehn, sechzehn Uhr, er wollte es gar nicht so genau wissen. Bald würde die Dämmerung einsetzen, die Bäume und Büsche warfen schon lange Schatten über die Böschung, der Gesang der Vögel verstummte allmählich. Und der Tunnel war ein riesiges schwarzes Loch, er konnte nicht einmal mehr zehn Meter tief hineinblicken. Der Tunnel.
Wie seltsam, dachte er, das Fahrrad von Laetitia Fabre stand an diesem Ufer, ebenso ihr Schuh. Aber man konnte nur am gegenüberliegenden Ufer in den Tunnel hineingehen, und das auch nur ein paar Hundert Meter, dann kamen die Stahlträger. Er fragte sich, wie ein Entführer eine junge Frau über dieses Hindernis tragen könnte oder ein Mörder einen leblosen Körper oder ob womöglich die Verschwundene selbst, mit nur einem Schuh am Fuß, darüber hätte gelangen können. Menschen schafften Sachen, die unmöglich schienen. Und doch …
Endlich kamen die Kriminaltechniker, eine Prozession weiß gekleideter Astronauten, die hintereinander die steile Treppe hinunterschritten. Die vorderste Gestalt nahm unten die Gesichtsmaske seines Schutzanzugs ab. Blanc erkannte Saad Ben-Rouijal, der das Labor im Untergeschoss der Gendarmerie-Station von Gadet leitete. Er schüttelte ihm die Hand und erklärte ihm, was er bislang wusste.
»Zwei Kollegen kümmern sich oben um das Mountainbike«, erwiderte Ben-Rouijal. Mit seiner behandschuhten Rechten schob er die Brille, die ihm von der Nasenspitze zu rutschen drohte, wieder hoch. Nicht hoch bis zur Nasenwurzel, sondern nur so weit zurück auf die Nasenspitze, dass sie gerade eben nicht mehr hinunterrutschte. Blanc irritierte das, er zwang sich, nicht darauf zu starren.
Ben-Rouijal blickte sich um und schüttelte nachdenklich den Kopf. »Unzugängliches Terrain, Buschwerk, herumliegender Müll, schlechtes Licht, ein trübes Gewässer – hier gibt es wirklich alles, was wir Spurensucher nicht mögen.«
»Immerhin haben Sie schon zwei Spuren, das Fahrrad und diesen Schuh.« Blanc deutete auf den Nike, der gerade von einem von Ben-Rouijals Kollegen von allen Seiten fotografiert wurde.
»Diese beiden Spuren sollten wir finden. Die hat uns jemand auf dem Präsentierteller hingestellt.« Ben-Rouijal hustete. Seine Stimme war von den Chemikalien seines Labors mürbe worden. Er war ein Mann, der seinen Job mehr liebte, als ihm guttat. »Die Frage ist, ob wir hier etwas finden werden, das wir nicht finden sollten.«
»Wir haben Taucher und Spürhunde angefordert«, erklärte Blanc.
»Die werden wir auch brauchen. Wir fangen schon mal an.«
Die Kriminaltechniker legten zwei Leitern über die gegenüberliegende Barriere zum Tunnel, zwei Spezialisten verschwanden mit starken Handlampen in seinem Innern. Bald sah man nur noch die tanzenden Lichtkegel. Blanc erinnerte sich an die Aussage des Rentners: Wenn jemand weit genug in diesen Tunnel vorgedrungen war, dann war womöglich selbst die stärkste professionelle Lampe von draußen nur noch als gelegentliches Glimmen zu sehen. Ein paar andere weiß gekleidete Gestalten schwärmten über die Böschung aus. Sie wirkten unbeholfen, wie sie sich mühsam an Ästen und Wurzelwerk festhielten, während sie Zentimeter um Zentimeter den Boden absuchten. Blanc hatte einen Moment den Eindruck, als wäre dieser Tunnel der Ground Zero des Coronavirus und all die Frauen und Männer in ihren weißen Schutzanzügen würden einen Erreger suchen, der die Menschheit bedrohte. Absurd. Er zwang sich, Sylvain aufmunternd auf die Schulter zu klopfen.
»Wir finden schon was«, sagte er und wusste doch selbst, wie falsch das klang.
Er hörte den Lärm eines Außenbordmotors und sah auf. Ein Schlauchboot der Gendarmerie rauschte aus Richtung des Étang de Berre über den Kanal heran. Der Uniformierte am Steuer nahm das Gas zurück, die Bugwelle schlug seufzend gegen das Ufer. Nahe der Tunnelöffnung ragte eine verrostete Eisenleiter vom Treidlergang bis ins Wasser. Die Reste eines Fischernetzes hingen dort fest. Blanc winkte und deutete auf die Leiter. Der Bootsführer steuerte das Zodiac vorsichtig bis dorthin. Vor ihm saßen vier Taucher. Einer packte die Leiter, sodass das Schlauchboot nicht abtrieb, nachdem der Motor ausgestellt worden war. Blanc begrüßte die Kollegen und wies sie ein. Währenddessen machten sich die Taucher fertig, setzten Flaschen und Masken auf, überprüften Uhren und Unterwasserlampen.
»Wir beginnen dort, wo Sie den Schuh gefunden haben, mon Capitaine«, erklärte der Bootsführer. »Und dann arbeitet sich ein Zweierteam Richtung Tunnel vor, das andere Richtung Étang de Berre. Erwarten Sie keine Wunder von uns. Hier draußen haben wir selbst in nur vier Meter Tiefe kaum mehr als zehn Zentimeter Sicht, das Wasser ist einfach zu trüb. Und erst im Tunnel … Da müssen sich die Taucher praktisch blind vorantasten. Der Boden ist verschlammt, und vermutlich liegt da unten auch ziemlich viel Müll. Hier können Sie eine ganze Stadt versenken, und wir würden die womöglich nicht finden.«
»Tun Sie, was Sie können. Viel Glück!«
Der Bootsführer nickte und warf den Motor wieder an. Er steuerte das Schlauchboot bis zu der Stelle, an der der Turnschuh gefunden worden war. Ein Kriminaltechniker hatte ihn inzwischen in einen Plastikbeutel gepackt und nach oben gebracht, doch ein cavalier jaune, eine mit einer »1« markierte gelbe Plastiktafel, zeigte seine Position an. Die Taucher glitten von den Wülsten des Zodiacs nahezu lautlos in den Kanal. Ihre Lampen formten grünlich schimmernde Blasen im Wasser, die rasch kleiner wurden und schließlich verglommen. Nur die Ströme der Luftbläschen aus ihren Atemgeräten, die bis zur Oberfläche sprudelten, verrieten noch, wo sie sich befanden. Die Männer bewegten sich nur um Zentimeter voran. Ein Schwarm von unterarmlangen grauen Muges, Meeräschen, schwamm dicht unter der Oberfläche, sie zogen gemächliche Kreise, ihre Mäuler und die Seitenlinien ihrer Körper leuchteten weiß durch das trübe Nass. Blanc hatte plötzlich das Bild von Laetitia Fabre vor sich und sah ihren Körper irgendwo unter Wasser und diese Fische, die daran … Nicht verrückt machen, sagte er sich, mach dich bloß nicht verrückt. Er warf Sylvain einen raschen Blick zu, um seinen Zustand zu kontrollieren. Der junge Brigadier war seit Ankunft der Kriminaltechniker in eine Art Starre verfallen. Er stand reglos auf einer Treppenstufe und beobachtete den langsamen Marsch der weißen Gestalten, so als wüsste er nicht, ob er hoffen oder eher fürchten sollte, dass sie etwas fanden, und als würde ihn diese Unsicherheit paralysieren.
»Die Kollegen schicken uns noch mehr Taucher vorbei«, sagte Fabienne, die zu ihm getreten war. Sie deutete den Kanal hinunter, der inzwischen von dem langen Schatten der Böschung in Dämmer getaucht wurde. Trotzdem sah man ein kleines Boot in der Ferne, das langsam näher kam. Seltsam, dachte Blanc, dass man keinen Außenbordmotor hörte.
»Merde«, rief er plötzlich, »das ist niemand von uns!«
Spurensuche
Ein Mann saß in einem aufblasbaren blauen Kajak, das er mit wuchtigen Zügen vorantrieb, bis er, noch immer mindestens fünfzig Meter entfernt, sein Paddel quer über das schmale Boot legte. Dann nahm er einen metallisch schimmernden länglichen Gegenstand in die Hand.
»Haben Sie ein Fernglas?«, fragte Blanc einen maskierten Kriminaltechniker, der zufällig in der Nähe arbeitete. Falls der Mann von dieser Bitte überrascht war, so ließ er es sich nicht anmerken. Wortlos stapfte er zu einem großen Hartschalenkoffer aus Plastik, in dem die Kollegen von der Spurensicherung ihre Instrumente transportierten. Er kam mit einem wuchtigen gummiarmierten Fernglas zurück. »Lassen Sie es nicht fallen, das ist teuer.«
Für wen hielt ihn dieser Kerl? Blanc lag eine scharfe Antwort auf der Zunge, doch dann fiel ihm wieder ein, dass Kriminaltechniker grundsätzlich alle Nichtkriminaltechniker für Trottel hielten, die tollpatschig Tatorte verwüsteten. Vermutlich traute man nach ein paar Jahren in diesem Job seinen Mitmenschen gar nichts mehr zu.
»Danke«, antwortete er, »ich passe darauf auf wie auf meine Kinder.«
Er hob das Glas an die Augen und fokussierte es auf den Kajakfahrer. Ein Mann mit raspelkurzen schwarzen Haaren, er schien ziemlich groß zu sein, vielleicht vierzig bis fünfzig Jahre alt. Er konzentrierte sich ganz auf sein Tun, womöglich hatte er die Flics deshalb noch nicht bemerkt. Er hantierte mit einer Teleskopstange, vermutlich aus Aluminium, die er nun zu beachtlicher Länge auseinanderzog, drei, vier Meter, schätzte Blanc. An einem Ende des Geräts befand sich eine Art Greifzange, am anderen ragten zwei Hebel hervor, mit denen man diese Zange öffnen und schließen konnte. Dann tauchte der Mann die Stange tief ins Wasser.
Blanc reichte Fabienne das Fernglas. »Sieh dir das an. Ich glaube, dieser Typ sucht den Kanalgrund ab.«
Seine Kollegin blickte durch die Linsen. »Jetzt zieht er die Stange wieder hoch. Er hat etwas in der Zange, Müll oder Schrott oder so was«, berichtete sie.
»Brigadier!«, rief Blanc. Er wollte, dass Sylvain aus seiner Starre erwachte. »Laufen Sie bis zu diesem Monsieur und fordern Sie ihn auf, an Land zu kommen. Sofort. Ich will wissen, wer er ist und was er hier zu suchen hat!«
Ein paar Minuten später brachte Sylvain den Mann zu ihnen, der mindestens einen Meter neunzig groß und massig war. Er steckte in einem schwarzen Neoprenanzug, der Beine und Unterleib komplett umschloss, am Oberkörper aber so geschnitten war wie ein Unterhemd, sodass Schultern und Arme unbedeckt waren. Obwohl es noch so früh im Jahr war, war die Haut des Mannes bereits von der Sonne gebräunt. Seine furchterregenden Muskeln waren mit Tätowierungen verziert, auf dem rechten Unterarm erkannte Blanc erstaunt ein altmodisch aussehendes Flugzeug und darunter in geschwungener Schrift den Text: Blériot – 1909.
Er zeigte ihm seinen Gendarmerieausweis und stellte sich sowie seine Kollegen vor. »Wie heißen Sie?«
»Romain Trossero. Habe ich etwas falsch gemacht?« Er hatte eine dunkle, eigentlich angenehme Stimme, doch in ihr schwang ein schriller Ton mit: Angst. Trossero blickte misstrauisch zu den weiß gekleideten Gestalten am Hang hinüber. »Was ist hier passiert?«
»Beantworten Sie bitte zuerst meine Fragen, danach beantworte ich vielleicht Ihre«, erwiderte Blanc. »Was suchen Sie in diesem Kanal?«
»Einen Canard.«
Blanc starrte Trossero an und fragte sich, ob der Kerl sich über ihn lustig machte. Canard, Ente, du mich auch, dachte er. Doch irgendwie wirkte der Mann nicht wie jemand, der gerade einen Scherz gemacht hatte.
Trossero stutzte, hob entschuldigend die Hände und lachte kurz und gezwungen auf. »Pardon, ich bin so in meiner Welt, dass ich immer denke, jeder versteht sofort, was ich meine. Canard hieß das erste Wasserflugzeug der Welt.«
»Wasserflugzeug?«, fragte Fabienne nach. Blanc hörte ihr an, dass auch sie sich nicht ganz ernst genommen fühlte.
Trossero deutete mit einer vagen Geste Richtung Étang de Berre. »Haben Sie wirklich noch nie von Henri Fabre gehört? Den kennt doch hier jeder, Straßen sind nach ihm benannt.«
»Ein Dichter?«, riet Fabienne.
»Ein Erfinder!« Trossero schien seine Angst vergessen zu haben, seine Augen leuchteten plötzlich vor Begeisterung. »Henri Fabre hatte eine Firma in Martigues, das Werksgebäude steht noch, heute ist da ein Restaurant drin. Dort hat Fabre das erste Wasserflugzeug der Welt gebaut, er nannte es Canard. Erstflug am 29.März 1910 über den Étang de Berre von Martigues bis La Mède, achthundert Meter, aber die Gebrüder Wright sind anfangs ja auch nicht viel weiter gehüpft.«
»Und das suchen Sie ausgerechnet hier? Mit einer fernbedienbaren Zange?«, vergewisserte sich Blanc ungläubig.
»Fabre hat Dutzende Flugzeuge gebaut, der Mann ist übrigens erst 1984 gestorben, er wurde mehr als hundert Jahre alt. Heute sind nur noch zwei Canards erhalten, eine Maschine steht bei Paris, die andere ist im Flughafen Marseille ausgestellt, drüben in Marignane. Sie sehen: Der Canard ist eine Rarität. Fabre hat über die Jahre einige Maschinen im Étang de Berre verloren. Sie sind abgestürzt oder bei der Landung zerbrochen, und manchmal sind Einzelteile wie Propeller oder sogar ganze Motoren ins Wasser gefallen. Ich habe die alten Firmenunterlagen studiert. 1928 hat ein Pilot mal versucht, seine Canard auf dem Kanal zu landen. Er ist in der Luft vom plötzlich einsetzenden Mistral überrascht worden, er hätte es niemals unbeschadet bis nach Martigues zurück geschafft. Zwischen den steilen Böschungen des Kanals hat er gehofft, vor den Böen sicher zu sein, doch bei der Landung hat er das Flugzeug ziemlich schwer beschädigt. Ich vermute deshalb, dass bis heute Trümmer der Maschine irgendwo im Kanal liegen. Bloß vier Meter unter uns, können Sie sich das vorstellen?! Ich kann nicht tauchen, aber ich habe diese Spezialzange konstruiert und taste in meiner Freizeit den Kanalboden Quadratzentimeter für Quadratzentimeter ab. Ich werde noch Jahre brauchen, bis ich damit fertig bin.«
»In Ihrer Freizeit? Sie machen das nicht beruflich?«, wollte Fabienne wissen.
»Ich bin Fallschirmspringer, oben in den Alpen, in Tallard. Ich bilde dort angehende Fallschirmspringer aus, springe im Tandem mit Touristen, trainiere Piloten, solche Sachen. Aber ich komme ursprünglich aus Velaux, das liegt quasi hier um die Ecke. Ich habe das Haus meiner Eltern behalten und in eine Art Privatmuseum verwandelt. Dort wohne ich, wenn ich nicht in den Alpen zu tun habe. Ich war schon immer von der Luftfahrt fasziniert, das kommt wahrscheinlich davon, wenn man gewissermaßen in der Einflugschneise des Flughafens von Marseille aufwächst. Na, jedenfalls habe ich zum Beispiel den Motor einer deutschen Me-109, die 1944 in der Nähe von Salon-de-Provence abgestürzt ist, und einen Teil des linken Flügels einer amerikanischen B-17 und einen Sitz aus einer Caravelle der Air France aus den Sechzigerjahren. Ein Überrest von Fabres Canard würde in meiner Kollektion einen Ehrenplatz erhalten.«
Das klingt so verrückt, dass muss die Wahrheit sein, dachte Blanc. Ein Sammler von Flugzeugtrümmern. Er hatte schon Leute mit seltsameren Hobbys getroffen – wenn auch nicht viele. »Sie müssen Ihre Suche für heute leider beenden, Monsieur Trossero«, sagte er. »Zurzeit ermittelt hier die Gendarmerie.«
»Sie haben bei Ihrer Suche weiter oben am Kanal nicht zufällig …«, Fabienne zögerte, »einen Damensportschuh der Marke Nike gesehen, schwarz und rosa, ziemlich neu? Einen rechten Schuh?«
Trossero schüttelte verwundert den Kopf. »Nein. Das war jetzt gerade kein makabrer Scherz, ja? Vor Jahren haben nämlich Ihre Kollegen hier am Kanal immer linke Schuhe gesucht.«
Blanc sah ihn misstrauisch an. »Woher wissen Sie das?«
»Die Disparues du Rove vergisst man nicht, mon Capitaine, nicht wenn man von hier ist. Stéphanie Couderc war damals das erste Mädchen, das verschwunden ist, und sie war bei mir auf der Schule, nur eine Jahrgangsstufe unter mir. Glauben Sie mir, das hat uns damals alle schwer getroffen. Ich denke da noch heute dran und …« Trossero blickte ihn an, weil er die Dinge langsam verstand. Er war unter seiner Sonnenbräune blass geworden. »Sie fragen mich nach einem rechten Schuh, weil Sie hier wieder einen linken Schuh gefunden haben«, flüsterte er fassungslos. »Nach so vielen Jahren … Deshalb sind Sie hier! Was ist passiert?«
»Darüber kann ich Ihnen wirklich noch keine Auskünfte geben«, erklärte Blanc fest.
»Sprechen Sie mit niemandem darüber«, ermahnte ihn Fabienne. »Keine Gerüchte! Wir wissen nicht einmal, ob hier überhaupt irgendetwas geschehen ist. Vielleicht stellt sich alles als harmloses Missverständnis heraus.«
Trossero blickte Sylvain an. Der Brigadier schwankte leicht, seine Lippen waren aufeinandergepresst, Schweiß glitzerte auf seiner Stirn. »Klar«, sagte Trossero, ohne den Blick von Sylvain zu nehmen, »vielleicht ist das alles nur ein Missverständnis.« Er machte sich nicht einmal die Mühe, so zu tun, als würde er das glauben. Er sah aus, als wollte er nur noch fort von hier.
Blanc reichte ihm seinen Notizblock und einen Stift. »Schreiben Sie mir bitte Ihre Adresse und Telefonnummer auf, Monsieur Trossero. Für den Fall, dass wir noch Fragen haben.«
»Die Adresse haben Sie schon, das Haus in Velaux steht ja noch.«
»Wir haben schon Ihre Adresse?«
»Seit dreiundzwanzig Jahren. Die Flics haben mich schon damals als Zeugen befragt. Mon Dieu, ich hätte nie geglaubt, dass mich dieser Albtraum wieder einholt.«
Blanc und Fabienne sahen Trossero nach, der in sein Kajak stieg und dann langsam in den Sonnenuntergang davonpaddelte.
»Seltsamer Zufall«, murmelte Blanc, so leise, dass Sylvain ihn nicht hören konnte. »Ein Zeuge von damals taucht ausgerechnet jetzt wieder auf.«
Fabienne zuckte mit den Achseln. »Vermutlich haben die Kollegen damals Hunderte Zeugen vernommen«, flüsterte sie. »Wir müssen die Ermittlungsakten der Disparues du Rove durcharbeiten und herausfinden, warum man Romain Trossero befragt hat.«
»Er hat es selbst gesagt: Er war mit einer der Verschwundenen auf der Schule.«
»Auch das wird er mit Hunderten anderer Menschen gemeinsam haben.«
»Hast du seine Arme gesehen? Wenn ich mir diesen Koloss vorstelle und ein junges Mädchen …«
Fabienne legte ihm die Hand auf die Schulter. »Ich weiß, dass deine Tochter im Alter der verschwundenen Frau ist, aber lass dich davon nicht verrückt machen. Ich bin schon vollauf damit beschäftigt, Brigadier Sylvain im Auge zu behalten.«
Blanc brachte ein schwaches Lächeln zustande. »Ich falle schon nicht in den Kanal«, versprach er. »Dieser Erfinder Henri Fabre, ob der mit der Verschwundenen verwandt war?«
Fabienne zuckte mit den Achseln. »Eine Millionen Leute hier heißen Fabre. Das muss nichts bedeuten.«
Es war Sylvain selbst, der ihre leise Unterhaltung schließlich unterbrach. »Der Hundeführer ist da«, meldete er.
»Vincent Gabriel«, stellte der sich vor. Er war Mitte dreißig, nicht besonders groß, aber sportlich, kräftiger Händedruck, dunkle Haut, Trekkinghose, leichte Wanderschuhe, ein Mann, dem man ansah, dass er geschlossene Räume nicht mochte. Gabriel hatte sich eine leuchtend rote Leine um den Leib geschlungen, sein Tier stand unangeleint neben seinem linken Bein. Es war ein Schweißhund, massig und mit kurzem braunem Fell, hängenden Ohren und traurig wirkenden Augen, so als hätte er schon viel zu viele Leichen gefunden.
»Sie müssen sich beeilen, es wird schon dunkel«, sagte Blanc.
Gabriel lachte gutmütig. »Dyson ist sowieso kurzsichtig. Er soll riechen, nicht sehen. Wenn es sein muss, suchen wir den Kanal die ganze Nacht ab.«
»Was haben Sie vor?«, fragte Fabienne. Blanc merkte ihr an, dass sie Hund und Herrchen mochte, und er fragte sich, wen von beiden wohl mehr.
»Die Duftspur eines Menschen ist genauso einzigartig wie sein Fingerabdruck«, erklärte Gabriel. »Wir verlieren bei jedem Schritt Tausende Hautschuppen, die auf den Erdboden rieseln und nach uns riechen. Dyson folgt dieser Spur.«
»Die Person wird schon seit dem Morgen vermisst«, gab Blanc zu bedenken.
»Keine Sorge. So eine Spur hält sich sechsunddreißig Stunden, wenn es nicht regnet. Und Blutspuren halten noch viel länger.«
Blanc warf Sylvain einen raschen Blick zu. »Wir suchen Hautschuppen, Monsieur Gabriel, nur Hautschuppen.«
Er zuckte mit den Achseln. »Gut. Haben Sie ein Objekt mit dem Duft der Zielperson? Der Hund muss einmal den Duft aufnehmen.«
Blanc winkte Ben-Rouijal zu sich. »Wo ist der Sportschuh?«
»Oben in unserem Transporter.«
Ben-Rouijal, Blanc und Fabienne führten Gabriel und seinen Hund über die Treppe hinauf. Der weiße Kleinlastwagen der Kriminaltechniker parkte am Rand der Rue Robert Schuman. Ben-Rouijal holte den Plastikbeutel mit dem Nike-Schuh hervor und öffnete ihn. Man sah ihm an, wie ungern er das tat, vermutlich fürchtete er, der Hund könnte kostbare Spuren zerstören. Doch Gabriel ließ Dyson bloß ein paar Augenblicke lang am geöffneten Beutel schnuppern, dann nickte er. »Das reicht.«
Der Hund senkte die Schnauze – und rannte, ohne zu zögern, zum Pfosten des Warnschildes, an dem das Mountainbike gelehnt hatte, das inzwischen auch schon im Kleintransporter verschwunden war. Blanc hielt den Atem an. »Wie geht es weiter?«, fragte er dann.
»Lassen Sie Dyson ein paar Sekunden Zeit.«
Der Hund umkreiste mit gesenktem Kopf, die Schnauze dicht über dem Boden, das Schild. Schließlich trabte er zur Treppe und lief den ganzen Weg bis zum Kanal wieder hinunter. Dort wandte er sich nach rechts, fort vom Tunnel. Er folgte einer Spur, die nur er bemerkte, bis zur altersschwachen Leiter, die vom Treidlergang bis ins Wasser führte und an der sich kurz zuvor die Polizeitaucher festgehalten hatten. Dort hob er den Kopf und bellte kurz.
»Das war es schon«, sagte Gabriel, sichtlich enttäuscht, dass der Job so rasch erledigt war. »Ihre Zielperson ist hier ins Wasser gegangen, da kann ihr auch Dyson nicht mehr folgen.«
»Sie ist geschwommen?«
Der Hundeführer zuckte mit den Achseln. »Vielleicht. Die Zielperson kann hier aber auch genauso gut in ein Boot eingestiegen sein. Für Dyson endet die Spur hier, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann.«
»Weiß der Hund, ob die Zielperson alleine war? Oder hat sie jemand begleitet? Oder ist sie gar mitgeschleift worden?«
»Mein Hund ist als Mantrailer ausgebildet«, erklärte Gabriel geduldig. »Der interessiert sich nur für die Spur, die wir ihm präsentiert haben. Sollten zur gleichen Zeit wie Ihre Zielperson noch andere Menschen hier gewesen sein, dann zeigt er das nur an, wenn wir auch deren Duftspuren bestimmen können. Haben Sie das Objekt einer anderen Person, nach der Dyson suchen soll? Falls ja, dann würden wir sehen, ob beide Spuren parallel verlaufen.«
Blanc schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht einmal, ob es hier zur fraglichen Zeit eine zweite Person gegeben hat. Hat Dyson Blut gewittert?«
»Nein, das hätte der Hund angezeigt. Es ist eine ganz normale Duftspur, wie sie jeder von uns ständig hinterlässt. Nichts Ungewöhnliches.«
Nichts Ungewöhnliches, dachte Blanc, außer dass sie vor einem dunklen Kanal endet. »Gehen Sie bitte zur Sicherheit dieses Ufer noch ein oder zwei Kilometer ab und danach auch das gegenüberliegende Ufer. Und lassen Sie Ihren Hund auch im Tunnel laufen. Vielleicht ist unsere … unsere Zielperson ja doch noch mal irgendwo wieder an Land gegangen. Es tut mir leid, das könnte doch die ganze Nacht dauern.«
Gabriel strahlte. »Macht doch nichts!«, rief er. Dann gab er seinem Hund ein Zeichen mit der Hand und begann, langsam am Kanal entlangzugehen.
»Glaubst du, Laetitia Fabre hat Selbstmord verübt?«, fragte Fabienne, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass Sylvain außer Hörweite stehen geblieben war. »Sie geht ans Wasser und …«
»Sie kann auch entführt worden sein«, gab Blanc zu bedenken. »Oder sie ist freiwillig mit jemandem mitgegangen. Man scheint ihr ja keine Gewalt angetan zu haben.«
»Irgendwer hat ihr den linken Schuh abgenommen. Du kannst jemanden auch zu etwas zwingen, ohne dass dabei Blut fließt. Mit Drogen, mit vorgehaltener Waffe, was weiß ich.«
»Die junge Frau trug einen Schutzhelm. Man kann ihr nicht einfach einen Schlag auf den Schädel gegeben haben.« Blanc blickte die steile Böschung hinauf. Die Schatten waren wie schwarze Tücher. Kein Vogel sang mehr. »Laetitia Fabre fuhr mit ihrem Mountainbike oben auf der Rue Robert Schuman entlang«, sagte er. »Wenn wir Sylvain glauben wollen, dann fuhr sie immer ziemlich schnell. Wieso stoppt sie dann ihr Rad, lehnt es gegen ein Schild und verschwindet in einem Kanal, den man von der Straße aus nicht einmal sehen kann?«
»Vielleicht ist es ja wirklich so, wie der Zeuge Bameule sich das anfangs gedacht hat: Laetitia Fabre musste mal und hat sich in die Büsche geschlagen. Und im Gestrüpp hatte sie eine verhängnisvolle Begegnung.«
»Und dieser Unbekannte zieht eine junge sportliche Frau bis nach unten und zwingt sie irgendwie aufs Wasser, um mit ihr zu verschwinden? Eine spontane, ungeplante Tat?«, fragte Blanc skeptisch. »Was ist, wenn das stattdessen geplant war?«, flüsterte er und beugte sich näher zu Fabienne. »Jemand lauert Laetitia Fabre an der Rue Robert Schuman auf. Jemand, der weiß, dass in dieser Villensiedlung nur selten jemand vor die Tür geht. Jemand, der weiß, dass man sich im Unterholz gut verbergen kann. Jemand, der Laetitia Fabre auf der Straße anhält und sie zum Kanal hinunterlockt. Sobald sie erst einmal unten ist, sieht sie niemand mehr. Vermutlich hört man oben nicht einmal, wenn unten jemand schreit. Dieser Kanal ist der perfekte Ort für einen Hinterhalt mitten in einer Stadt. Dieser Jemand zwingt sie in ein Boot, das er an der Leiter angebunden hatte. Fort ist er mit ihr – und wer weiß, wo Laetitia Fabre jetzt ist.«
»Dieser Jemand, der den Überfall so sorgfältig geplant hat, müsste dafür aber gewusst haben, dass sie am Sonntagmorgen ausgerechnet über diese ruhige Straße fährt«, gab Fabienne zu bedenken.
Sie blickten beide zu Brigadier Sylvain hinüber.
Blanc blieb bis tief in die Nacht am Tunnel du Rove. Die Taucher hatten irgendwann ergebnislos aufgegeben. Nein, nicht ergebnislos, korrigierte sich Blanc. Sie hatten den Körper von Laetitia Fabre nicht gefunden, und er beschloss, das als ermutigendes Ergebnis zu werten. Die Kriminaltechniker waren die Böschungen abgegangen, zuerst noch mit starken Handlampen, dann im Licht mobiler dieselgeneratorbetriebener Scheinwerfer, doch schließlich hatten auch sie die Suche abgebrochen: Es gab nichts zu finden außer diesem verfluchten linken Schuh und einem herrenlosen Fahrrad.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: