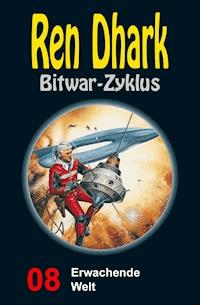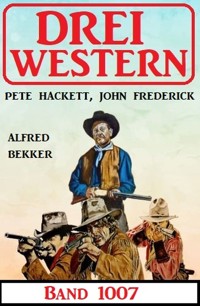
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch Enthält folgende Western: Pete Hackett: MacQuade und der Deserteur Alfred Bekker: Im Land von El Tigre John Frederick: Reiter der Stille Major Reilly reitet über die Grenze nach Mexico - und versucht El Tigre, den ungekrönten König der schlimmsten Banditen, die je das unsichere Grenzland heimgesucht haben, zu stellen. Vor der Jahrhundertwende war der Wilde Westen reich an Legenden. Man erzählte sich Geschichten von sagenumwobenen Revolvermännern, deren Kugeln auf magische Weise immer ihr Ziel fanden, von mächtigen Hengsten, deren unermüdlicher Galopp mit der Geschwindigkeit des Windes konkurrierte, von herrlichen Frauen, deren Schönheit Geist und Herz betäubte. Doch nirgendwo in den Weiten der Bergwüste wurde eine größere Legende erzählt als die Geschichte von Red Pierre und dem Phantomschützen McGurk. Diese beiden Männer aus der Wildnis, die sich so sehr ähneln und so unterschiedliche Hintergründe haben, haben eine einzige Eigenschaft gemeinsam: Sie sind unschlagbar. Das Schicksal ließ sie aufeinander prallen, Donner auf Donner, Blitz auf Blitz. Sie waren dazu bestimmt, sich an der Kreuzung eines langen, langen Weges zu treffen - eines Weges, der in den nördlichen Einöden Kanadas begann und schließlich zu einer tödlichen Konfrontation in den Bergen des Fernen Westens führte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bekker, Pete Hackett, John Frederick
Drei Western Band 1007
Inhaltsverzeichnis
Drei Western Band 1007
Copyright
Pete Hackett: McQuade und der Deserteur
Alfred Bekker: Im Land von El Tigre
Reiter der Stille
Drei Western Band 1007
Alfred Bekker, Pete Hackett, John Frederick
Dieses Buch Enthält folgende Western:
Pete Hackett: MacQuade und der Deserteur
Alfred Bekker: Im Land von El Tigre
John Frederick: Reiter der Stille
Major Reilly reitet über die Grenze nach Mexico - und versucht El Tigre, den ungekrönten König der schlimmsten Banditen, die je das unsichere Grenzland heimgesucht haben, zu stellen.
Vor der Jahrhundertwende war der Wilde Westen reich an Legenden. Man erzählte sich Geschichten von sagenumwobenen Revolvermännern, deren Kugeln auf magische Weise immer ihr Ziel fanden, von mächtigen Hengsten, deren unermüdlicher Galopp mit der Geschwindigkeit des Windes konkurrierte, von herrlichen Frauen, deren Schönheit Geist und Herz betäubte. Doch nirgendwo in den Weiten der Bergwüste wurde eine größere Legende erzählt als die Geschichte von Red Pierre und dem Phantomschützen McGurk.
Diese beiden Männer aus der Wildnis, die sich so sehr ähneln und so unterschiedliche Hintergründe haben, haben eine einzige Eigenschaft gemeinsam: Sie sind unschlagbar. Das Schicksal ließ sie aufeinander prallen, Donner auf Donner, Blitz auf Blitz. Sie waren dazu bestimmt, sich an der Kreuzung eines langen, langen Weges zu treffen - eines Weges, der in den nördlichen Einöden Kanadas begann und schließlich zu einer tödlichen Konfrontation in den Bergen des Fernen Westens führte.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Pete Hackett: McQuade und der Deserteur
Western von Pete Hackett
Pete Hackett Western - Deutschlands größte E-Book-Western-Reihe mit Pete Hackett's Stand-Alone-Western sowie den Pete Hackett Serien "Der Kopfgeldjäger", "Weg des Unheils", "Chiricahua" und "U.S. Marshal Bill Logan".
Über den Autor
Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G.F.Unger eigen war – eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen.
Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie "Texas-Marshal" und zahlreiche andere Romane. Ex-Bastei-Cheflektor Peter Thannisch: "Pete Hackett ist ein Phänomen, das ich gern mit dem jungen G.F. Unger vergleiche. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung."
Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger". Sie erscheint exklusiv als E-book bei CassiopeiaPress.
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author www.Haberl-Peter.de
© der Digitalausgabe 2013 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
*
McQuade war sich zuletzt sicher, dass Jim Stryker nach Fort Grant geflohen war. Vor ungefähr drei Wochen war ihm der Bandit in der Nähe von Casa Adobes im Sandsturm entkommen und der Kopfgeldjäger hatte die Jagd nach ihm aufgegeben. Aber dann hatte Stryker das Büro der Butterfield Overland Mail Company in Redington überfallen und wieder einen Mann dabei so schwer verwundet, dass er starb. Die Belohnungen, die für seine Ergreifung ausgesetzt worden waren, beliefen sich nun auf insgesamt tausendfünfhundert Dollar.
Redington liegt am San Pedro River. Ein Aufgebot war dem Banditen gefolgt. In den östlichen Ausläufern der Galiuro Mountains hatten die Verfolger allerdings seine Spur verloren. Stryker hatte nur zwei Möglichkeiten, wohin er sich wenden konnte. Die eine war Eureka Spring, die andere Fort Grant. Eine Flucht nach Südwesten schloss der Kopfgeldjäger aus, denn dort lief der Outlaw Gefahr, von renitenten Chiricahuas massakriert zu werden. Und nach Norden dehnte sich nur endlose Wildnis – menschenfeindliches Gebiet, heiß und staubig, in dem nur Klapperschlangen und Eidechsen eine Chance hatten.
In Eureka Spring war Stryker nicht aufgetaucht.
Also ritt der Kopfgeldjäger nach Fort Grant.
Das Fort war eine Ansammlung von flachen Baracken, Scheunen, Stallungen und Remisen. Alles war um den großen Paradeplatz herum angeordnet. An dem von Sonne und Regen gekrümmten Fahnenmast hing schlaff das Sternenbanner. Es gab eine Kantine, in der auch an Zivilisten Essen ausgegeben sowie Bier und Schnaps ausgeschenkt wurde. Einen Palisadenzaun mit einem Tor gab es nicht. An dem ausgefahrenen Reit- und Fahrweg, der von Tucson herüber führte, stand am Rand des Forts eine Wachbaracke, bei der einige Posten Dienst versahen. Insgesamt vier Soldaten waren als Streifenposten eingeteilt. Das Gewehr geschultert marschierten sie jeweils in Zweiergruppe in entgegengesetzter Richtung um das Fort herum.
McQuade wurde aufgehalten. Aber da er schon einige Male im Fort war, kannten ihn die beiden Posten. Einer sagte: „Auf der Spur welches Banditen kommst du heute nach Fort Grant, McQuade? Hat dir denn noch niemand gesagt, dass es eine Herausforderung an das Schicksal ist, durch diesen Landstrich zu reiten? Irgendwann, schätze ich, hängt dein Skalp am Gürtel eines Apachen. Deinen Hund werden die roten Halunken braten und fressen.“
McQuade war staubig und verschwitzt. Er hatte tagelang nur im Sattel gesessen und unter freiem Himmel geschlafen. Die Strapazen hatten unübersehbare Spuren in seinem hohlwangigen, stoppelbärtigen Gesicht hinterlassen. Die feine Schicht aus Staub und eingetrocknetem Schweiß in seinem Gesicht zersprang, als er sprach: „Bis jetzt ist es immer gut gegangen. Wahrscheinlich habe ich einen guten Schutzengel.“ Er griff in die Manteltasche und holte Strykers Steckbrief heraus. „Ist dieser Mann im Fort aufgetaucht?“
Der Soldat nahm und las, studierte kurze Zeit das Bild und nickte dann. „Ja, der ist hier. Ihm hätten die roten Heiden um ein Haar das Fell über die Ohren gezogen. Er kam vor einer Woche im Fort an, und er hatte eine Apachenkugel im Oberschenkel. Der Doc hat ihn zusammengeflickt.“
„Ich treffe ihn sicher in der Kantine an“, stellte McQuade fest.
„Ja. Er isst dort mittags und abends.“
Der Wachposten gab dem Texaner den Steckbrief zurück, der faltete ihn zusammen und steckte ihn wieder in die Tasche. Dann ritt er weiter. Es war um die Mitte des Nachmittags, auf dem Exerzierplatz und zwischen den Baracken ballte sich die Hitze. Die Luft flirrte. Ringsum ragten die bizarren Formationen der Pinaleno Mountains zum ungetrübt blauen Himmel. Ihre Konturen verschwammen hinter wabernden Hitzeschleiern.
Als McQuade an der Kommandantur vorüber ritt, sah er an der Wand neben der Tür zwischen einigen vergilbten Aushängen ein weniger mitgenommenes Blatt Papier, und selbst auf die Entfernung von etwa fünfzehn Yards konnte der Kopfgeldjäger erkennen, dass es sich um einen Steckbrief handelte. Er schien noch druckfrisch zu sein, das Papier war weiß, er stach aus den restlichen Aushängen hervor wie ein Silberdollar aus einer Handvoll Kupfermünzen.
McQuades Aufmerksamkeit war erregt. Er lenkte den Falben zum Holm vor der Kommandantur, ließ sich aus dem Sattel gleiten und stieg, gefolgt von Gray Wolf, mit sattelsteifen Beinen die wenigen Stufen zum Vorbau hinauf.
Gesucht wurde ein Sergeant namens Ken Steward. Auf seinen Kopf hatte der Kommandant des Departments Arizona eine Belohnung von siebenhundert Dollar ausgesetzt.
McQuade riss den Steckbrief von der Anschlagtafel, faltete ihn zusammen und verstaute ihn in der Manteltasche. Dann ritt er weiter zur Kantine. Dort angekommen brachte er sein Pferd in den Stall, der zur Kantine gehörte, und überließ das Tier dem Stallmann. Der Kopfgeldjäger nahm sein Gewehr und begab sich, begleitet von Gray Wolf, in die Kantine.
Um diese Tageszeit gab es dort allenfalls Zivilisten als Gäste. Doch sie waren ausgesprochen selten in diesem unsicheren Stützpunkt mitten im Apachenland. Die Zeichen standen auf Sturm, seit Cochise mit einer Bande renitenter Chiricahuas das Land zu beiden Seiten der mexikanischen Grenze unsicher machte.
Die Soldaten versahen die unterschiedlichsten Dienste. Die meisten befanden sich auf Patrouille irgendwo in der Apacheria. Diejenigen, die sich im Fort befanden, würden erst am Abend die Zeit für einen Kantinenbesuch finden.
Zwei Männer saßen an einem Tisch und fixierten den Kopfgeldjäger und seinen Hund. Ihr Interesse an den beiden verlor sich aber, nachdem sie sich gesetzt hatten. „Gib mir einen Krug voll Wasser, Slim“, rief McQuade dem Keeper zu. „Und vergiss nicht, Gray Wolf eine Schüssel voll Wasser zu geben. Außerdem haben wir Hunger.“
Der Keeper grinste. „Ich kann dir Eintopf mit Pökelfleisch anbieten, McQuade.“
„Ich bin nicht wählerisch. Du hast doch sicher auch ein Stück Fleisch für meinen grauen Partner.“
„Es wird sich etwas finden“, versetzte der Keeper. Slim Carson war ein ausgedienter Soldat, der den Job in der Kantine versah. Er brachte erst den Krug mit frischem, klarem Wasser für McQuade, dann eine verbeulte Aluminiumschüssel, die er auf den Boden stellte. Gray Wolf, der sich niedergelegt hatte, erhob sich und begann ziemlich lautstark das frische Wasser zu schlabbern.
„Einen Moment“, sagte der Texaner, als sich der Keeper abwenden wollte.
„Was ist?“
„An der Kommandantur hing der Steckbrief eines Soldaten. Er ist dem Kommandanten des Departments Arizona siebenhundert Dollar wert. Warum wird der Bursche gesucht?“
„Du sprichst von Sergeant Ken Steward“, antwortete der Keeper. „Steward hat zwei Soldaten erschossen, die ihm folgten, nachdem er hier in der Kantine in eine Schlägerei verwickelt war und später draußen einen Kavalleristen niedergestochen hat. Er ist ein Mörder und Deserteur. Wenn man ihn schnappt, wird man ihn unehrenhaft aus der Armee entlassen und dann am Hals aufhängen.“
„Weiß man, in welche Richtung er sich abgesetzt hat?“
„Ja. Corporal Rivera und der Trooper Shrader wurden fünf Meilen südlich von hier tot aufgefunden. Eine Patrouille brachte sie ins Fort.“
„Steward hat sich also in die Apacheria abgesetzt“, konstatierte der Kopfgeldjäger.
„Sieht ganz so aus. Wahrscheinlich hat er sich in einem der Dörfer verkrochen. Er hat eine ganz spezielle Beziehung zu den Rothäuten.“
Slim Carson setzte sich in Bewegung, um für McQuade einen Teller voll Eintopf aufzuwärmen.
*
Die Sonne versank hinter dem westlichen Horizont und färbte mit ihrem Widerschein den Himmel über den Bergen purpurn. Ein einsamer Stern funkelte am Westhimmel. Die Gipfel der Berge schienen zu bluten.
Im Fort erklang die Trompete, als die Flagge eingeholt wurde. Die getragenen Töne trieben hinaus in die Wildnis und verklangen. Die Fahnenparade war ein tägliches Ritual, das am Morgen und am Abend stattfand.
Nach und nach füllte sich die Kantine mit Männern. Slim Carson versorgte sie mit Essen und Trinken. McQuade wurde immer wieder angesprochen. Meistens wurde er gefragt, auf wessen Spur er nach Fort Grant gekommen war. Er war bekannt in dem Stützpunkt.
Die Düsternis nahm zu. Der rötliche Schein, der auf allem gelegen hatte, verblasste. Die Schatten hatten sich aufgelöst. Slim Carson begann, die Lampen anzuzünden, die über den Tischen von der Decke hingen. Einmal waren Hufschläge zu vernehmen, als eine Patrouille von ihrem Einsatz zurückkehrte und im klirrenden Trab an der Kantine vorbeizog.
Und dann kam Jim Stryker. Das Bild auf dem Steckbrief zeigte ihn mit Bart. Den hatte er sich abrasiert. Dennoch erkannte ihn der Kopfgeldjäger.
Stryker war nicht ganz sechs Fuß groß und untersetzt. Er besaß ein breitflächiges Gesicht, in dem kleine, listige Augen in tiefen Höhlen lagen. Es verlieh dem Antlitz des Banditen die Physiognomie einer Ratte. Um seinen Mund hatte sich ein brutaler Zug festgesetzt.
Der Bandit schaute sich aufmerksam um. Es war der typisch wachsame und argwöhnische Blick des ständig Gehetzten, des Verfemten, mit dem er alles erfasste und aufnahm. An McQuade blieb sein Blick hängen. Seine Brauen schoben sich zusammen. Und dann bemerkte er Gray Wolf, der am Boden lag und den mächtigen Schädel zwischen die Vorderpfoten gebettet hatte. Der Schimmer des Begreifens lief über das Gesicht des Banditen, er schwang herum und verließ die Kantine.
McQuade erhob sich mit einem Ruck und schnappte sich die Henrygun, die am Tisch lehnte. „Go on, Partner!“
Der Kopfgeldjäger nahm die Hintertür. Der Bandit hatte ihn erkannt. McQuade hatte sich im Süden des Arizona-Territoriums einen hohen Bekanntheitsgrad erworben. Man sprach von ihm als dem unerbittlichen Banditenjäger, der von einem großen, grauen Wolfshund begleitet wurde. Er genoss den Respekt der Menschen und sogar der meisten Gesetzeshüter in diesem Teil des Landes. Denn McQuade trat dort auf, wo Recht und Ordnung auf schwachen Beinen standen oder wo das Gesetz völlig versagte. Männer, die sich den Stern ansteckten, waren rar. In weiten Teilen des Territoriums herrschte Gesetzlosigkeit. Räuber, Mörder, Vergewaltiger und Brandstifter wurden nicht zur Verantwortung gezogen. Es gab niemand, der sich ihnen in den Weg stellte und ihnen das blutige Handwerk legte.
McQuade vertrat auf seine Weise das Gesetz. Die Steckbriefe legitimierten ihn, sein Gesetzbuch war der schwere Coltrevolver im Holster an seinem rechten Oberschenkel. Unerbittlich und kompromisslos bekämpfte er das Verbrechen. In Banditenkreisen wurde er als erbarmungsloser Bluthund bezeichnet.
Zwischen den Baracken nistete die Dämmerung. Der Himmel hatte eine bleigraue Färbung angenommen. McQuade lief um die Baracke herum und konnte von der Ecke aus umfassend in die Runde blicken. Der große Paradeplatz war verwaist. Von Jim Stryker keine Spur.
McQuade beschloss, im Stall nachzusehen.
Das Tor war geschlossen. McQuade zog es auf. Ein Schuss krachte, eine Mündungsflamme ließ für den Bruchteil einer Sekunde geisterhaftes Licht über die Wände zucken, die Detonation drohte den Stall aus allen Fugen zu sprengen. Das Stück Blei bohrte sich in den Rahmen des Tores. McQuade feuerte und glitt geduckt in die Düsternis hinter dem Tor, auch Gray Wolf huschte durch den schmalen Spalt, dann fiel das Tor schon wieder zu.
Der Kopfgeldjäger hatte Schutz in einer Box gesucht. Eine penetrante Mischung aus Pferdeausdünstung, Uringeruch sowie dem Geruch von Heu und Stroh stieg dem Texaner in die Nase. Jetzt, da das Tor geschlossen war, war alles in Dunkelheit gehüllt. Aber McQuades Augen passten sich an und er konnte die Tragebalken und Boxenwände gut ausmachen.
Der Texaner drückte den Gewehrkolben gegen seine rechte Hüfte, sein Zeigefinger lag um den Abzug, in der Kammer befand sich eine Patrone. Gray Wolf drängte sich gegen sein Bein, McQuade spürte die Wärme des Tierkörpers durch den Stoff von Staubmantel und Hose. Pferde stampften und prusteten. Die Schüsse hatten für Nervosität bei den Tieren gesorgt.
„Gib auf, Stryker. Du kommst hier nicht mehr raus. Es ist nur eine Frage von Minuten, bis der Stall von einer Kompanie Soldaten umstellt ist. Wirf deine Waffen auf den Gang und komm aus der Box.“
„Lebend kriegst du dreckiger Mannjäger mich nicht!“, prophezeite der Bandit. „Lieber mit einer Kugel im Kopf in den Stiefeln sterben, als am Ende eines Hanfstrickes elend zu verrecken.“
Der Bandit jagte einen Schuss in McQuades Richtung. Ein Pferd wieherte schrill. Hufe krachten gegen Boxenwände. Das unruhige Stampfen wurde intensiver.
„Hol ihn dir, Partner!“, stieß McQuade hervor.
Gray Wolf leckte über die Hand seines Herrn, dann huschte er in die Dunkelheit hinein. Der Wolfshund bewegte sich leise. Auf dem gestampften Lehmboden war das Scharren seiner Krallen nicht zu vernehmen. Ein schwarzer, schattenhafter Schemen, der mit der Dunkelheit verschmolz.
Einige Sekunden verstrichen, dann erklang ein erschreckter Aufschrei, im nächsten Moment der dumpfe Aufprall eines Körpers, und dann das bedrohliche Bellen des Wolfshundes. Gray Wolf war Herr der Situation.
McQuade richtete sich auf. Das Bellen Gray Wolfs wies ihm den Weg. Bei dem Wolfshund angelangt riss er ein Streichholz an. Draußen erklangen Befehle und waren trampelnde Schritte zu hören. Die Einsatzbereitschaft des Forts war nach den Schüssen im Stall mobil gemacht worden.
McQuade kauerte neben dem Wolfshund nieder. Unter Gray Wolf lag Stryker auf dem Rücken. Die Flamme des Streichholzes spiegelte sich in seinen Augen wider. Im vagen Licht war die Angst zu erkennen, die ihn aufwühlte.
Das Streichholz erlosch. Der Kopfgeldjäger entwaffnete den Banditen. Dann gebot er Gray Wolf, zurückzuweichen. Er zerrte Stryker auf die Beine.
Das Stalltor wurde aufgestoßen. Es knarrte und quietschte in den Angeln. Eine sonore Stimme rief: „Wer immer es auch ist, der sich im Stall eine Schießerei geliefert hat! Werft die Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen heraus. Wir haben den Stall umstellt.“
„Ich bin es – McQuade!“, rief der Kopfgeldjäger. „Wir kommen hinaus. Es ist alles in Ordnung.“
Er bugsierte den Banditen zum Tor. Stryker wagte keine Gegenwehr. Denn er wusste den Wolfshund dicht hinter sich und der Schreck, der ihn befallen hatte, als plötzlich der Hund über ihm war und ihm der stinkende Atem des Tieres ins Gesicht schlug, saß tief.
Draußen wurden der Kopfgeldjäger, Gray Wolf und der Bandit sofort von bewaffneten Soldaten umringt. Ein Kavallerist kam mit einer Laterne. „Wer ist das?“, fragte ein Lieutenant.
„Jim Stryker“, antwortete McQuade und zog den Steckbrief aus der Manteltasche. „Er hat geraubt und gemordet. Auf ihn wartet der Strick.“
Der Lieutenant studierte den Steckbrief sorgfältig, dann schaute er dem Banditen scharf ins Gesicht, nickte und sagte: „Ja, das könnte Stryker sein.“
„Ich bin seit längerer Zeit auf seiner Fährte geritten“, erklärte McQuade. „Sein letzter hold up fand in Redington statt. Er hat es auf die Büros der Butterfield Overland abgesehen. Ich bitte Sie, Lieutenant, ihn zu übernehmen und den Sheriff des Pima Countys von seiner Festnahme in Kenntnis zu setzen.“
„Sicher, McQuade, das Militär nimmt Ihnen den Kerl ab. Reiter Miller, Reiter Callaghan!“
Zwei Trooper traten vor und salutierten, einer schnarrte: „Sir!“
„Übernehmt Stryker und bringt ihn in das Verlies im Keller der Wachbaracke. – Reiter Foster, Reiter Snyder!“
„Sir!“
„Sie begleiten Miller und Callaghan. Sollte Stryker einen Fluchtversuch unternehmen, zögert nicht, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen.“
„In Ordnung, Sir!“
Jim Stryker wurde abgeführt. „Die Hölle verschlinge dich, McQuade!“, rief er mit hassverzerrter Stimme über die Schulter.
„Danke, Lieutenant“, sagte McQuade.
*
Als McQuade am Morgen sein Pferd aus dem Stall holte, kam Slim Carson um die Ecke der Mannschaftskantine. Zwischen den Baracken und anderen Gebäuden woben noch die grauen Schlieren der Morgendämmerung. Der Morgendunst verhieß wieder einen heißen Tag. Über den Horizont im Osten kroch das gelbe Licht des Sonnenaufgangs. Vögel begrüßten mit ihrem Gezwitscher den beginnenden Tag.
Slim Carson ging auf die fünfzig zu. Seine Haare und sein buschiger Schnurrbart waren grau. Die Narben in seinem Gesicht zeugten davon, dass ihm während seiner Zeit als Kavallerist im Indianerland eine Reihe blutiger Lektionen erteilt worden war. Er hatte aus ihnen gelernt, und darum hatte er ein für dieses Land, in dem der Tod allgegenwärtig war, hohes Alter erreicht. Die meisten der Männer, die auf dem Friedhof des Forts unter einem flachen, schmucklosen Hügel ihre letzte Ruhe gefunden hatten, waren keine fünfundzwanzig Jahre alt geworden.
„He, McQuade!“
Der Kopfgeldjäger wandte sich dem Veteranen zu. „Guten Morgen, Slim.“
„Du hast dich entschlossen, Ken Steward zu jagen, nicht wahr?“
„Richtig.“
„Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, McQuade.“
„Ich verstehe nicht. Du selbst hast mir gestern Abend erzählt, dass er hier im Fort einen Mann niedergestochen und zwei Soldaten, die ihn verfolgten, erschossen hat.“
„Ich will dir erzählen, was ich weiß, McQuade. Steward ging in der Kantine auf einen Soldaten los, der ihn als dreckigen Squawman beschimpfte. Sie prügelten sich. Die Bereitschaft wurde alarmiert, Corporal Hunter kam mit einem halben Dutzend Soldaten und beendete die Schlägerei. Während Tom Bundy – er war es, der Steward als dreckigen Squawman bezeichnete -, die Kantine verließ, trank Steward noch ein Bier und ging dann ebenfalls. Draußen erwarteten ihn Bundy und drei seiner Freunde. Was sich zutrug, wissen nur Steward, Bundy und dessen Kumpels. Steward ist auf der Flucht. Tom Bundy ist tot. In seinem Leib steckte ein Dolch. Bundys Freunde sagten aus, dass Steward das Messer zog, als ihn Tom Bundy aufforderte, den Kampf fortzusetzen, den Hunter mit den Bereitschaftssoldaten beendet hatte.“
„Wieso nannte Tom Bundy den Sergeant Squawman?“
„Ken Steward soll mal ein Verhältnis mit einer Chiricahua gehabt haben. Sie lebt in einem der Dörfer westlich oder südwestlich des Apache Passes, zwischen den Chiricahua Mountains und den Dragoons. Ihr Name ist Naona. Man munkelt, dass Steward einen Sohn mit ihr hat.“
„Aha. Sprich weiter, Slim.“
„Steward hat das Weite gesucht. Er ist zu Fuß in die Wildnis geflohen. Der Colonel schickte zwei Soldaten hinter ihm her, die ihn einfangen und zurückbringen sollten. Eine halbe Woche später brachte eine Patrouille die beiden zurück. Sie waren tot. Ihre Waffen und Pferde waren fort.“
„Die beiden können auch von Apachen ermordet worden sein“, gab McQuade zu bedenken.
„Der Doc holte aus ihren Körpern Kugeln, die aus einem Armeecolt stammten. Außerdem hätten die Rothäute die beiden skalpiert.“ Slim Carson verzog den Mund. „Im Fort ist man hundertprozentig davon überzeugt, dass Steward die beiden umgelegt hat, weil er ihre Pferde und Gewehre brauchte. Man geht davon aus, dass er Rivera und Shrader in sicherer Deckung erwartete. Und als sie auf Revolverschussweite heran waren, schoss er sie ohne jede Vorwarnung von den Pferden.“
„Sag mir die Namen der drei Männer, die dabei waren, als Steward seinem Kontrahenten den Dolch in den Leib gerammt haben soll.“
„Ned Millard, Mark Adams und Bill Curtis.“
„Wer hat sie vernommen?“
„Der Kommandant selbst, dabei war auch der Wachhabende, Captain Bannister, außerdem einige weitere Offiziere. – Noch etwas, McQuade: Ein Sergeant, der ein Verhältnis mit einer Squaw anfängt, ist aus Sicht des Colonels für die Armee nicht tragbar. Er setzte alle Hebel in Bewegung, um Stewards Versetzung zu erreichen. Als er im Hauptquartier auf taube Ohren stieß, forderte er Steward auf, von sich aus den Dienst zu quittieren. Steward erwies ihm den Gefallen nicht.“
„Interessant“, murmelte McQuade und schwang sich auf den Falben. „Nach dem, was du mir erzählt hast, werde ich alles daransetzen, Ken Steward lebend zu erwischen. Vielen Dank für deine Hinweise.“
Der Kopfgeldjäger trieb das Pferd an. Gray Wolf lief neben dem Falben her. Sie verließen Fort Grant in südliche Richtung. McQuade machte sich über das, was ihm Slim Carson erzählt hatte, seine Gedanken. Bis zum Apache Pass lagen etwa fünfzig Meilen vor ihm – fünfzig Meilen Wildnis. Westlich des Passes, in der weitläufigen Ebene, der man den Namen Sulphur Spring Valley gegeben hatte, lagen an den Creeks einige Chiricahua-Dörfer.
Es war kurz vor Sonnenuntergang, als McQuade eines dieser Dörfer erreichte. Die Apachen lebten hier in Wickiups. Kinder spielten unter der heißen Sonne. Hunde kläfften und tollten durch das Dorf. Die Kochfeuer vor den Grashütten brannten. Frauen versahen die tägliche Arbeit. Die alten Männer hockten vor den Zelten am Boden und rauchten Pfeife.
Sofort versammelten sich Männer, Frauen und Kinder um den Ankömmling. Dunkle Augen fixierten ihn und den grauen Wolfshund voller Misstrauen und Zurückhaltung. McQuade hob die rechte Hand, zeigte die Handfläche und rief: „Mein Name ist McQuade. Ich komme in Frieden. Versteht von euch jemand meine Sprache?“
Ein älterer Krieger trat vor. „Mein Name ist Mankuna.“ Seine Stimme klang kehlig, aber er sprach englisch, wenn auch mit hartem Akzent. „Weshalb kommst du in mein Dorf? Oft ist es so, dass einem Bleichgesicht weitere Bleichgesichter folgen. Dieses Land gehört den Chiricahuas.“
McQuade entspannte sich, legte die Hände übereinander auf das Sattelhorn und antwortete: „Keine Sorge, Mankuna, ich komme alleine. Ich will den Chiricahuas ihren Grund und Boden auch nicht streitig machen. Ein Mann ist in das Land der Chiricahuas geflüchtet. Er ist Soldat, und er soll eine von euren jungen Frauen, ihr Name ist Naona, zur Squaw genommen haben.“
Das breitflächige, asiatisch anmutende Gesicht des Apachen verschloss sich. „Du suchst diesen Mann?“
„Ja.“
„Gehörst du zur Armee? Oder vertrittst du das Gesetz der weißen Männer?“
„Weder – noch, Mankuna.“ McQuade zog den Steckbrief aus der Manteltasche, faltete ihn auseinander und reichte ihn Mankuna.
Der Apache, McQuade vermutete, dass er der Häuptling dieses Dorfes war, heftete seinen Blick auf die Fahndungsmeldung. „Ich kenne diesen Mann nicht“, erklärte er und gab McQuade den Steckbrief zurück. „In meinem Dorf gibt es auch keine Squaw, die Naona heißt.“
„Steward soll drei Männer, Soldaten, brutal ermordet haben“, stieß McQuade hervor. „Doch es bestehen Zweifel. Wenn du weißt, wo sich der Sergeant versteckt hält, Mankuna, dann sag es mir.“
„Ich bin hier!“
Die Stimme kam von rechts. McQuades Kopf flog herum …
*
Vor dem Eingang eines Wickiups stand hoch aufgerichtet Ken Steward. Er trug die blaue Uniform, in den Händen hielt er einen Springfield Kavalleriekarabiner, der Zeigefinger seiner Rechten krümmte sich um den Abzug.
Dass er so schnell fündig werden würde, damit hatte der Kopfgeldjäger nicht gerechnet.
Doch Steward hatte ihn vor der Mündung. Wenn es hart auf hart ging würde er um sich beißen wie ein in die Enge getriebenes Raubtier; unberechenbar und tödlich gefährlich.
Gray Wolf witterte die Gefahr mit untrüglichem Instinkt. Ein drohendes Grollen stieg aus seiner Kehle, seine Nackenhaare stellten sich auf, seine Augen verdunkelten sich.
„Sieh an!“, rief der Soldat. „McQuade, der Bluthund, reitet auf meiner Fährte. Nun, ich nehme an, dass man eine ziemlich hohe Belohnung für meine Ergreifung ausgesetzt hat.“
„Du bist nicht mehr wert als jeder andere Mörder auch“, versetzte McQuade fast gleichmütig. Er hatte den Aufruhr seiner Empfindungen sehr schnell wieder unter Kontrolle.
In Ken Stewards Gesicht zuckte kein Muskel. „Wenn ich der wäre, für den sie mich hinstellen, dann würde ich dich jetzt ohne mit der Wimper zu zucken vom Gaul schießen.“
„Dann bist du also nicht der, für den sie dich hinstellen?“, kam es geradezu gelassen von McQuade. Er zerrte das Pferd um die rechte Hand und nahm Front zu dem Sergeant ein. „Man hat mir eine wenig erfreuliche Geschichte erzählt, Steward. Hast du diesen Tom Bundy vor der Kantine erstochen? Und die beiden Soldaten, die dir folgten – hast du sie tot zurückgelassen, weil du ihre Pferde und Waffen wolltest?“
„Man wollte mich fertig machen“, antwortete Ken Steward grollend. „Ein Squawman ist eine Schande für die Armee. Man darf ihm nicht trauen. Denn er hat eine enge Bindung zu den Apachen. Und die hasst der Colonel wie die Pest.“
Es klang bitter. In der Stimme Ken Stewards schwang der Unterton einer tiefen Enttäuschung mit.
„Hast du Tom Bundy getötet?“
„Nein. Er ging in der Kantine auf mich los. Bundy war ziemlich betrunken. Er nannte mich einen dreckigen Squawman und meinte, dass man einen wie mich mit Schimpf und Schande aus der Armee jagen müsste. Ich ließ mich nicht provozieren, dennoch ging er auf mich los. Ich konnte ihn mir vom Leib halten, bis einige Bereitschaftssoldaten auftauchten und ihn mit sich nahmen. Als ich eine halbe Stunde später die Kantine verließ, erwarteten sie mich zu viert. Bundy drohte, dass er mich bis zum Hals hinauf aufschlitzen werde. Dann griff er an. Ich wich aus und er stolperte, stürzte und rammte sich sein eigenes Messer in den Leib. Einer seiner Freunde erklärte, dass sie mich dafür an den Galgen bringen würden. Und da ich die Einstellung der meisten Offiziere und vor allem die des Colonels kannte, zog ich es vor, mich aus Fort Grant zu verabschieden.“
„Corporal Jeff Rivera und der Trooper Brad Shrader sollten dich einfangen und zurückbringen. Man fand ihre Leichen einige Meilen vom Fort entfernt. Die Kugeln, die sie töteten, stammten aus einem Armeecolt. Außerdem hatten sie ihre Haare noch, sodass Apachen für ihre Ermordung wohl nicht in Frage kommen.“
„Rivera und Shrader hatten nicht den Auftrag, mich nach Fort Grant zurückzubringen. Sie sollten mich töten. Rivera sagte es mir unverblümt ins Gesicht. Die beiden fühlten sich verdammt sicher – zu sicher. Nun …“ Steward zuckte mit den Schultern.
„Deine Version der Geschichte klingt nicht gerade unglaubwürdig“, versicherte McQuade. „Aber es stehen drei Aussagen gegen deine. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass du ein Geächteter bist. Irgendwann wird es durchsickern, in welchem der Dörfer du dich verkrochen hast. Und dann werden sie eine Patrouille schicken, die dich festnimmt und ins Fort schafft.“
„Wer sagt denn, dass ich bei den Apachen bleibe?“
„Dann ziehst du als Verfemter durchs Land, du bist vogelfrei, und jeder, der dich erkennt, darf dich ohne jede Warnung erschießen. Du bist eine Menge Geld wert.“
„Das du dir verdienen möchtest, Menschenjäger.“
„Nicht unbedingt, Steward. Eigentlich müsstest du mich kennen. Und dann wirst du wissen, dass ich mir noch nie die Prämie für einen Unschuldigen verdient habe.“
Jetzt begann es im Gesicht des Sergeanten zu arbeiten. Das Flackern in seinen Augen verriet Unsicherheit. Er befeuchtete sich mit der Zungenspitze die trockenen Lippen. „Glaubst du mir wirklich, McQuade?“
„Aufgrund der Tatsache, dass ich noch lebe, weiß ich, dass du kein kaltblütiger Mörder bist, Steward. Wenn du einer wärst, hättest du mich wohl tatsächlich sofort vom Pferd geschossen, als dir klar wurde, dass ich hinter dir her bin.“
„Verdammt, McQuade, ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht.“ Ken Steward ließ das Gewehr sinken. „Naona und ich haben einen kleinen Sohn. Sie ist Mankunas Tochter. Unser Verhältnis ist längst beendet, denn Mankuna war der Meinung, dass eine Verbindung zwischen einem Soldaten und einer Chiricahua niemals gut gehen könne. Sein Volk würde mich niemals anerkennen, und Naona hätte bei meinem Volk keine Chance. Nach meiner Flucht aus dem Fort habe ich mich Hilfe suchend an Mankuna gewandt. Er gestattete mir, in seinem Dorf zu bleiben, zumindest vorübergehend.“
„Der Häuptling kennt also deine Geschichte.“
„Ja. Was schlägst du vor, McQuade?“
„Wir reiten gemeinsam nach Tucson. Im Hauptquartier erzählst du Colonel Richardson deine Version der Geschichte. Man wird von dort aus die erforderlichen Ermittlungen betreiben.“
„Gegen meine Aussage stehen die Behauptungen von Millard, Adams und Curtis!“, gab Steward zu bedenken.
„Es wird aber auch Aussagen geben, die bestätigen, dass Bundy es war, der dich beleidigt und die Auseinandersetzung vom Zaun gebrochen hat. Außerdem haben die vier dir aufgelauert, um es dir zu geben. Man wird die drei Freunde von Bundy in die Mangel nehmen. Und die Offiziere in Tucson, die die Verhöre durchführen, sind auch nicht von gestern.“
Steward nahm den Kopf etwas herum und schaute den Häuptling an. „Was meinst du, Mankuna?“
„McQuade hat recht“, kam es von dem Apachen. „Bei uns kannst du nicht bleiben. Selbst wenn – die Soldaten würden dich aufspüren und abholen. Du würdest keine Ruhe mehr finden. Immer müsstest du damit rechnen, erkannt zu werden. Du müsstest wieder kämpfen, und es würde wieder Blut fließen.“
„So ist es, Steward“, pflichtete McQuade bei. „Und am Ende deines Weges wartet eine Kugel oder ein Strick auf dich.“
Ken Steward kaute auf seiner Unterlippe herum. Er war unschlüssig. Ein tiefer Zwiespalt war in ihm aufgebrochen. Gefühl und Verstand lagen in zäher Zwietracht. Das Gefühl sagte ihm, dass er sich wie ein Hammel zur Schlachtbank führen ließ, wenn er dem Vorschlag des Kopfgeldjägers folgte. Verstandesmäßig jedoch versuchte er sich klar zu machen, dass er für den Rest seines Lebens ein Gejagter sein und irgendwann ein gewaltsames Ende finden würde.
Der abwartende Blick McQuades hing an Stewards Lippen. Auch Mankuna wartete auf eine Entscheidung.
Steward atmete tief durch. Und dann überwand er sich. „In Ordnung, McQuade. Ich reite mit dir nach Tucson und stelle mich dort im Hauptquartier.“
Die Anspannung in dem Kopfgeldjäger ließ nach. „Eine gute Entscheidung, Steward. Du wirst sie sicher nicht bereuen.“
*
Sie brachen auf, als die Morgennebel vom nahen Creek her trieben. In den Hügellücken und Schluchten der nahen Dos Cabezas Berge und der Chiricahua Mountains nistete noch die Dunkelheit. Doch im Osten begann der Himmel schon eine schwefelgelbe Farbe anzunehmen.
Die Apachen schliefen noch.
In dem Moment, als sie aus dem Dorf ritten und die Pferde in den schmalen Creek lenkten, um ihn zu überqueren, peitschte auf einem der Hügel weiter westlich ein Schuss. Steward stürzte vom Pferd. McQuade sprang aus dem Sattel, seine Henry Rifle flirrte aus dem Scabbard. Er repetierte und starrte über den Rücken des Falben hinweg zum Hügelrücken hinauf, auf dem Büsche wuchsen und aus dem einige mannshohe Felsen ragten.
Von dem Schützen war nichts zu sehen.
Im Apachendorf waren Stimmen zu vernehmen. Einige der Apachen, die von dem Knall des Schusses alarmiert worden waren, liefen näher. Unter ihnen war auch Mankuna. Sie scharten sich um den reglos am Boden liegenden Sergeanten. Das verworrene Durcheinander ihrer Stimmen erhob sich.
McQuade sagte sich, dass von dem Heckenschützen für ihn keine Gefahr drohte. Er ging zu Steward hin. Die Apachen machten ihm Platz. Der Kopfgeldjäger kniete links ab. Ken Steward war tot. Die Kugel war ihm mitten in die Brust gedrungen und hatte sein Herz durchschlagen. Mit einem galligen Geschmack auf der Zunge drückte sich der Kopfgeldjäger hoch. Sein Blick wanderte wieder den Abhang hinauf und tastete sich über den Kamm des Hügels.
Mankuna trat neben den Texaner und sagte: „Er war ein Freund der Chiricahuas, und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Wirst du seine Mörder verfolgen, McQuade?“
„Und ob ich das werde“, murmelte der Kopfgeldjäger. „Spätestens jetzt bin ich endgültig davon überzeugt, dass Steward die Wahrheit gesprochen hat. Er war kein Mörder, er hat sich lediglich gewehrt.“
Er ging zum Pferd, stellte den linken Fuß in den Steigbügel, griff nach dem Sattelhorn und riss sich in den alten, gebrochenen Sattel. „Go on, Partner!“ Er ruckte im Sattel und gab dem Falben den Kopf frei. Das Tier setzte sich in Bewegung. Gray Wolf folgte.
McQuade ritt auf den Hügel. Oben angekommen stieg er vom Pferd und heftete den Blick auf den staubigen Boden. Und er wurde fündig. Zwischen einigen Felsklötzen entdeckte er Stiefelabdrücke im Gras, und ihm entging nicht die Patronenhülse, die im Licht des beginnenden Tages matt glänzte.
Die Fußspur führte zwischen weiteren Felsen, die sich hier türmten und endete bei einigen Comas. Hier gab es Hufspuren. Sie führten nach Westen.
Es handelte sich um einen einzelnen Reiter. Das war McQuade aufgrund der Spuren klar geworden. Der Kopfgeldjäger ließ Gray Wolf an der Spur schnuppern. Die Nase dicht über dem Boden lief der Wolfshund in westliche Richtung. Bald ging es hangabwärts. Es gab immer wieder Hinweise, die McQuade verrieten, dass hier der Mörder Stewards geritten war. Vor einem Steilhang bog Gray Wolf nach Norden ab.
McQuade war noch keine Viertelstunde geritten, als er den Reiter wahrnahm. Er ritt durch eine weitläufige Senke. Sein Ziel schien eine Schlucht zu sein, die ein Felsmassiv, das sich von Westen nach Osten erstreckte, spaltete. Der Mann trug Zivilkleidung. Aber das hatte nichts zu bedeuten. Es konnte sich um jemand aus Fort Grant handeln, der ihm – McQuade – gefolgt war.
Der Texaner trieb den Falben an. Der Reiter schien ihn nicht zu bemerken. Als er ihm nahe genug war, zügelte er, nahm das Gewehr aus dem Sattelschuh, repetierte und hob es an die Schulter.
Der Schuss krachte. Die Detonation holte den Reiter ein. Er zerrte das Pferd herum und nahm den Verfolger wahr, der angehalten hatte und auf ihn zielte.
„Keine Bewegung!“, rief McQuade. „Runter vom Pferd und die Hände in die Höhe!“
Der Bursche dachte nicht daran. Wild drosch er seinem Pferd die Sporen in die Seiten, dazu stieß er einen spitzen Schrei aus. Aus dem Stand sprang das gequälte Tier an. Und der Reiter riss es sofort herum. Im selben Moment schickte McQuade seine zweite Kugel aus dem Gewehrlauf. Während sein erster Schuss den Reiter lediglich dazu bewegen sollte, anzuhalten, feuerte der Texaner nun gezielt. Doch er konnte sich nicht mehr auf das so jäh veränderte Ziel einstellen und sein Blei verfehlte den Burschen, der nun, als säße ihm der Leibhaftige im Genick, nach Westen zwischen zwei Hügel sprengte. McQuade knirschte mit den Zähnen und ließ das Gewehr sinken, rammte es in den Scabbard und trieb den Falben hart an. In einem spitzen Winkel stob er auf den Einschnitt zu, in dem der Reiter aus McQuades Blickfeld verschwunden war. Einige Gewehrschüsse peitschten. Der Kopfgeldjäger lenkte den Falben nach Norden und sprengte weitab von der Stelle, an der sein Gegner zwischen den Hügeln verschwunden war, einen Abhang hinauf, über eine Hügelkuppe hinweg und wieder nach unten, wo er am Fuß der Anhöhe den Falben nach Südwesten lenkte.
Er drosselte das Tempo und ließ den Falben im Schritt gehen. In kurzen Abständen hielt er das Pferd an, um zu lauschen. Gray Wolf trabte neben dem Falben her.
Felsiges, zerklüftetes Terrain lag vor dem Texaner. Schließlich vernahm er vor sich im Felsgewirr den krachenden und klirrenden Hufschlag. Er saß ab und zog den Falben in den Schutz einer Gruppe von Felsen, zwischen denen dorniges Strauchwerk wucherte.
Der Hufschlag nahm an Lautstärke zu. Plötzlich aber endete er. Das scharfe Prusten eines Pferdes wehte heran, das sich mit einem Klirren vermischte, als das Tier noch einmal mit dem Huf stampfte.
McQuade konnte den Reiter nicht sehen. Aber er befand sich in seiner unmittelbaren Nähe. Der Kopfgeldjäger schnappte sich die Henrygun, die vier Finger seiner Rechten schoben sich in den Ladebügel. Er repetierte aber nicht, denn das knackende Geräusch hätte ihn verraten.
Der Bandit kam in das Blickfeld des Kopfgeldjägers. Geduckt glitt er um einen Felsen herum, hielt an und sicherte um sich. Er hielt das Gewehr an der Seite, den Kolben hatte er sich unter die Achsel geklemmt.
McQuade zielte auf ihn. Aber er schoss nicht, denn er brauchte den Burschen lebendig. Eine Reihe von Fragen war offen, Fragen, die der Texaner auf jeden Fall beantwortet haben wollte.
Er trat aus dem Schutz der Felsen. Im selben Augenblick nahm ihn sein Gegner wahr. Er zuckte herum und schlug das Gewehr auf den Kopfgeldjäger an. McQuade kniete geistesgegenwärtig links ab und feuerte gleichzeitig mit dem Mörder.
Die Schüsse klangen wie einer und dröhnten durch die Bergwelt. Aufbrüllend antworteten die Echos. Der Bandit wirbelte herum und floh. „Gray Wolf!“ Als hätte der Wolfshund nur auf den Befehl gewartet, spurtete er los. Seine Pfoten schienen den Boden kaum noch zu berühren. Pfeilschnell flog er dahin. Einige Sekunden verrannen, dann peitschte ein Schuss, im nächsten Moment erklang Gray Wolfs wütendes Bellen, das aber sogleich wieder abbrach. Es war lastend still.
McQuade hatte keine Ahnung, ob der Wolfshund den Banditen gestellt hatte. Aber schon im nächsten Moment wurde ihm diese Frage beantwortet. Denn Gray Wolf glitt heran, rieb seinen Kopf am Bein des Texaners und fiepte leise. McQuade kraulte ihn zwischen den Ohren. Der Texaner vermutete, dass der Bandit auf einen Felsen geflüchtet war, sodass Gray Wolf das Nachsehen hatte.
Die Zeit verrann nur zähflüssig. Aber sie stand nicht still. Unerbittlich verrannen die Sekunden und Minuten. Das Warten zerrte an den Nerven, die Ungeduld bei dem Kopfgeldjäger wuchs.
Der Bandit war in der Nähe. Immer wieder vernahm McQuade das Stampfen der Hufe des Banditenpferdes. Und dann hörte er das Tacken harter Lederabsätze auf steinigem Untergrund. Sein Gegner befand sich über ihm auf dem Felsen. McQuade presste sich hart an die raue Wand und zog sich zurück. Nach oben hatte er hier keine ausreichende Deckung. Gray Wolf ließ ein leises, warnendes Knurren vernehmen.
Ein Schuss peitschte. Trommelfell betäubendes Jaulen folgte, als die Kugel vom Gestein abprallte. Hastende Schritte erklangen. Ein ganzes Stück von McQuade entfernt kam Geröll ins Rutschen.
Das Gepolter verklang.
Der Kopfgeldjäger glitt geduckt, jeden Schutz ausnutzend und unablässig um sich sichernd, an der Basis eines der steinernen Riesen dahin. Es gab Spalten und Risse, an die er sich vorsichtig heranschob, in denen aber keine Gefahr lauerte.
In der Zwischenzeit war es fast hell geworden. Die Sonne schickte ihre ersten Lichtbündel ins Land. In den Schluchten und Hügeleinschnitten hatte sich der graue Dunst aufgelöst.
McQuade kroch unter einen überhängenden Felsen. Gray Wolf lag neben ihm. Von dem Banditen war nichts zu hören oder zu sehen. McQuade spähte zu einem Felsblock in seiner Nähe und beschloss, sein momentanes Versteck zu verlassen und ihn als Deckung zu benutzen. Er kroch unter dem Felsen hervor und erhob sich - da trat sein Gegner hinter einem Felsvorsprung hervor.
Mit dem Erkennen der tödlichen Gefahr reagierte der Kopfgeldjäger, ließ sich zur Seite fallen und warf sich gleichzeitig halb herum. Der Schuss des Banditen wummerte. Das Mündungsfeuer aus McQuades Gewehr stieß ihm entgegen. Die Detonationen vermischten sich, die Steilhänge und Felswände schienen den Knall zurückzuwerfen.
Die Banditenkugel verfehlte den Kopfgeldjäger um Haaresbreite. Er glaubte den sengenden Strahl des Geschosses zu spüren. McQuades Blei hingegen fand ein Ziel. Doch der Treffer setzte den Banditen nicht außer Gefecht. Er wirbelte mit einem gellenden Aufschrei herum. Ehe der Texaner ein zweites Mal feuern konnte, hatte sich der Mörder Stewards hinter dem Felsvorsprung in Sicherheit gebracht.
Gray Wolf spurtete los und verschwand ebenfalls um den Felsen.
Als McQuade um den Felsvorsprung spähte, waren sowohl der Bandit als auch der Wolfshund verschwunden.
Trommelnde Hufschläge erklangen.
Gray Wolf begann wie von Sinnen zu bellen.
*
McQuade verhielt am Rand einer grasigen Senke zwischen den Felsen. Deutlich zeichnete sich im Gras die Spur eines Pferdes ab - die Spur des Pferdes, das der Mörder Ken Stewards ritt. Er hatte sich wieder nach Norden gewandt. Die Senke wurde in dieser Richtung von einer Felsenkette begrenzt, die sich von Westen nach Osten erstreckte. Hier und dort buckelten Felsbrocken aus dem Boden, halb in der Erde versunken, von der Witterung der Jahrmillionen rund geschliffen. Sie muteten an wie die Rücken ruhender Nashörner.
Als sich der Kopfgeldjäger dem Rim auf hundert Schritte genähert hatte, nahm er ein Blinken wahr, wie wenn sich Sonnenlicht auf Metall bricht. Er ließ sich vom Pferd kippen, da peitschte es ihm auch schon trocken entgegen. Die Kugel strich dicht am Kopf des Falben vorbei. Das Tier brach erschreckt zur Seite aus und scheute. Sein Wiehern übertönte für kurze Zeit die vielfachen Echos, mit denen die Detonation zerflatterte.
Sofort war McQuade wieder auf den Beinen, warf sich in den Sattel und stob in östliche Richtung davon. Die Hufe des Pferdes schienen kaum noch den Boden zu berühren. Die Gegend flog regelrecht an ihm vorbei.
Wieder erklang das Krachen des Gewehres. Aber einen Reiter im wilden Auf und Ab des Galopps zu treffen war verdammt schwer. Die Kugel ging jedenfalls daneben. Der Texaner holte das Letzte an Schnelligkeit aus dem Falben heraus. Dann stob er zwischen die Felsen.
Er ritt ein Stück nach Osten und wandte sich schließlich wieder nach Norden. Der krachende und klirrende Hufschlag umgab ihn. Er achtete nicht darauf. Es kam jetzt darauf an, vor dem Banditen das felsige Terrain zu verlassen und ihm den Weg zu verlegen. Also stob McQuade an den Felswänden und Geröllhängen entlang und erreichte eine wellige Ebene, über die er den Falben hinwegjagte. Weiter nördlich war das Terrain hügelig.
Ehe er zwischen die Hügel ritt, schaute er über die Schulter zurück. Und er sah den Banditen aus der Felswildnis galoppieren. Zufrieden registrierte McQuade, dass er ihn überholt hatte. Er stob über Bodenwellen hinweg und fegte durch Vertiefungen. Dann verschwand er hinter einer Anhöhe.
Plötzlich erschien Gray Wolf. Er jagte auf der Spur des Banditenpferdes dahin. McQuade steckte zwei Finger in den Mund und pfiff gellend. Den Wolfshund riss es regelrecht herum. Ein zweiter Pfiff des Kopfgeldjägers wies ihm die Richtung. Mit langen, kraftvollen Sätzen schnellte er heran.
McQuade spähte in die Richtung, aus der sein Gegner kommen musste. Der Hufschlag brandete heran. Dann sah er ihn auch schon um den Hügel sprengen. Unbarmherzig bearbeitete er sein Pferd mit den Sporen und dem langen Zügelende.
McQuade ruckte im Sattel. Der Falbe begann wieder zu laufen.
Auf einer der Anhöhen zügelte der Kopfgeldjäger. Der Bandit schien ihn wahrgenommen zu haben. Sofort drehte er ab und jagte wieder zwischen die Hügel. McQuade hinterher. Der Mörder Stewards nötigte sein Pferd einen Hang hinauf, aus dem Felsklötze wuchteten und auf dem niedriges, aber dichtes Strauchwerk wuchs. Auf dem Kamm des Hügels boten ebenfalls Felsbrocken Schutz.
Der Texaner hielt an. Sein Blick folgte über die Zieleinrichtung der Henrygun dem Banditen. Dieser musste immer wieder Hindernissen ausweichen. Mal ließ er das Pferd schräg hangaufwärts gehen, dann peitschte er es wieder in gerader Linie nach oben. Immer wieder glitten die Hufe des Tieres aus. Losgetretenes Geröll rollte den Abhang hinunter. Das Pferd bockte des Öfteren hinten hoch, wenn es auf die Hanken niederzubrechen drohte und stemmte die Hinterbeine wie Säulen gegen das Zurückgleiten.
McQuade zog durch. Die Henry Rifle schleuderte ihr Krachen hinter dem Banditen her. Der Bandit verschwand vom Pferderücken und robbte hinter einen Felsblock. Zwei Atemzüge später sah der Kopfgeldjäger, wie er den Lauf seines Gewehres über den Felsen schob.
McQuade aber war schon vom Pferd gesprungen und in Deckung gelaufen. „Hierher, Partner!“
Der Bandit jagte eine Kugel aus dem Lauf. Zwischen Gray Wolfs wirbelnden Läufen spritzte das Erdreich. Sofort fiel ein weiterer Schuss. Ein Querschläger quarrte. Dann war auch der Wolfshund in Sicherheit. Hechelnd, mit weit heraushängender Zunge ließ er sich bei seinem Herrn zu Boden gleiten.
McQuade spähte nach oben. Die Krone des Banditenhutes tauchte über dem Rand des Felsens auf. Er verschwand aber sofort wieder, als McQuades Gewehr peitschte. Die Kugel schrammte über den Fels und zog eine helle Spur. Das Blei wurde mit durchdringendem Heulen abgelenkt.
„Warte hier auf mich, Partner“, gebot McQuade dem Wolfshund. Er wollte das Tier nicht den Kugeln des Banditen aussetzen. Das intelligente Tier legte sich auf den Bauch und schielte zu seinem Herrn in die Höhe. „Rühr dich nicht vom Fleck, mein Junge“, murmelte der Kopfgeldjäger. „Der Halunke dort oben würde dich wegputzen wie bei einem Scheibenschießen.“
Der Wolfshund winselte leise.
McQuade machte sich an den Aufstieg. Unablässig sicherte er nach oben. Die Hügelkuppe lag im gleißenden Sonnenlicht. Der Tag hatte die Nacht endgültig vertrieben.
Es gab genügend Gestrüpp und Felsbrocken, die sporadisch aus der Erde wuchteten und Schutz boten. Er glitt von Deckung zu Deckung, schnell und lautlos wie ein Schatten, wartete, witterte und gehorchte seinen Instinkten. Und sie ließen ihn nicht im Stich. Als er hinter einem der Felsen hervortrat, mit den Augen die nächste Deckungsmöglichkeit anpeilend, nahm er oben zwischen den Felsen die flüchtige Bewegung wahr. Er stieß sich ab. Der Schuss peitschte, die Kugel klatschte gegen Felsgestein, meißelte einen wahren Hagel von Splittern los und quarrte mit grässlichem Heulen als Querschläger zum Himmel.
McQuade stand jetzt vollkommen ungeschützt auf dem Abhang, breitbeinig und leicht in der Mitte nach vorne geknickt, als suchte er festen Stand. Seine Henrygun spuckte Feuer, Rauch und Blei. Oben taumelte mit einem schrillen Aufschrei der Bandit zwischen den Felsen hervor, stolperte, knickte in den Knien ein, drückte sich noch einmal zu seiner vollen Größe in die Höhe, plötzlich jedoch drehte er sich halb um seine Achse und ging zu Boden. Sein Hut rollte ein Stück hangabwärts und verfing sich schließlich im Gras.
Vorsichtig pirschte McQuade sich an ihn heran. Der Bandit röchelte erstickend. Es hörte sich fast an wie verzweifeltes Wimmern. Er hatte McQuades Kugel in den rechten Oberschenkel bekommen. Mit beiden Händen umklammerte der Bursche das Bein. Blut quoll zwischen seinen Fingern hervor. Die pulsierenden Schmerzen verzerrten sein staubverkrustetes Gesicht, in das der perlende Schweiß helle Spuren zeichnete.
McQuades Schatten fiel über ihn. Sein Röcheln verstummte. Sein Kehlkopf rutschte hinauf und hinunter, als würgte ihn eine unsichtbare Faust. McQuade bückte sich, zog den Colt des Banditen aus dem Holster, steckte ihn sich in den Hosenbund, nahm das Gewehr und zerschlug es an einem der von der Erosion der Jahrtausende zernagten Felsklötze in zwei Stücke.
Der Bandit stierte ihn aus unterlaufenen Augen an, in denen Schmerz und Hass aber auch die panische Angst wüteten. McQuade sagte ungerührt und irgendwie schleppend: „Du hast es dir zu einfach vorgestellt, Hombre. Nenne mir deinen Namen.“
Gray Wolf glitt heran und setzte sich zwei Schritte vor dem Banditen auf den Boden.
„Die Hölle verschlinge dich!“, japste der Verwundete und holte rasselnd Luft.
„Du kommst aus Fort Grant, nicht wahr? Bist du Millard, oder Adams, oder ist dein Name Bill Curtis?“
Der Bandit schwieg verstockt.
„Wie du willst“, murmelte McQuade ohne jede Gemütsregung. „Du solltest dir das Halstuch um die Wunde binden, ehe du ausblutest, Hombre. Ich brauche dich nämlich lebend. Für Colonel Richardson im Hauptquartier in Tucson. Er hat gewiss eine Reihe von Fragen an dich. - Gib auf ihn Acht, Partner.“
McQuade schritt den Hang hinunter. Der Bandit schickte ihm eine üble Verwünschung hinterher und schleppte sich in den Schatten, wo er das Halstuch abnahm und es um den Oberschenkel band. Der Schmerz ließ ihn stöhnen.
Gray Wolf beobachtete jede seiner Bewegungen.
McQuade kam nach etwa zehn Minuten auf seinem Pferd zurück. Das Pferd des Banditen führte er am langen Zügel mit sich.
Am Fuß des Hügels ließ der Kopfgeldjäger die Pferde zurück und stieg, das Gewehr in der Hand, den Hang hinauf. „Hoch mit dir, Bandit. Wir wollen keine Zeit verlieren. Bis Tucson sind es über hundert Meilen.“
Ihm entging nicht das heimtückische, raubtierhafte Schillern in den Augen des Banditen. Der Bursche verströmte etwas, das McQuade alarmierte.
Der Bandit sagte: „Ich habe das Bein nur abgebunden, um die Blutung zu stillen. Es ist schon ganz gefühllos. Ich wäre dir dankbar, wenn du das Verbandszeug aus meiner Satteltasche holen und mich anständig verarzten würdest.“
„Das geht in Ordnung“, murmelte McQuade und wandte sich ab.
Wenige Minuten später kam er mit Verbandszeug und der Wasserflasche zurück. Er zog sein Messer aus dem Stiefelschaft, um das Hosenbein des Verwundeten aufzuschlitzen. Dabei beugte er sich über den Banditen. Da kam blitzartig Flahertys Rechte, die einen faustgroßen Stein umklammerte, zum Vorschein. Sein Arm zuckte in die Höhe.
McQuade registrierte die jähe Gefahr und zuckte unwillkürlich zurück. Sein traumhaft schnelles Reaktionsvermögen verhinderte, dass ihm der Kalksteinbrocken den Schädel zertrümmerte. Er wurde jedoch an der linken Schulter, genau am Halsansatz, getroffen, und der Schmerz lähmte seine linke Seite. Zischend entwich die Luft seinen Lungen, er torkelte zurück und fiel schließlich auf den Hosenboden. Nahe daran, seine Not hinauszubrüllen, sah er wie durch eine Nebelwand den Banditen heranhumpeln. Er hatte die Hand mit dem Stein erhoben und wollte damit McQuade den Schädel zerschmettern.
„Partner!“, stieg es wie ein Schrei aus McQuades Kehle.
Jetzt griff Gray Wolf ein. Er flog auf den Banditen zu, prallte gegen ihn und riss ihn von den Beinen. Der Bursche schrie wie am Spieß, als die Schmerzen in seinem Oberschenkel eskalierten. Der Wolfshund stand über ihm, der Bandit hatte den gefährlichen Fang unmittelbar vor den Augen, die Todesangst kam wie ein eisiger Guss.
McQuade kämpfte sich auf die Beine. Zuerst befürchtete er, dass ihm der Schlag auf die Schulter das Schlüsselbein zersplittert hätte. Er tastete es ab und atmete erleichtert auf, als sich seine Befürchtung nicht bewahrheitete. Vorsichtig bewegte er den linken Arm. Er öffnete und schloss die Hand und versuchte, die linke Schulter zu rollen. Nur mühsam verbiss er einen Aufschrei.
Er ließ den Arm hängen. Taub baumelte er von seiner Schulter. Mit der Rechten zog er den Colt. Zwei Schritte brachten ihn an den Banditen heran.
„Erwarte von nun an keine Rücksichtnahme mehr, Hombre. Wenn es sein muss, schleppe ich dich am Lasso nach Tucson. – Zurück, Partner.“
*
„Sag mir endlich deinen Namen!“, forderte McQuade. Von ihm ging eine starke, zwingende und unnachgiebige Strömung aus. In seinen Augen lag eine Härte, die den Outlaw erbeben ließ.
Die überwältigenden Schmerzen von seinem Bein und der Druck, den McQuades Blick auf ihn auslöste, waren angetan, den Trotz des Banditen bröckeln zu lassen. Er sagte sich, dass er den Kopfgeldjäger nicht noch mehr herausfordern dürfe. Nach einem rasselnden Atemzug stieß er hervor:
„Ned Millard.“ Er schielte mit heimtückischem Ausdruck auf den Revolver in McQuades Faust. Obwohl er sich fürchtete, überlegte er fieberhaft, wie er den Kopfgeldjäger überlisten konnte. Dieser schien Millards Gedanken zu erraten, denn er sagte mit stählernem Klang in der Stimme:
„Wenn du die Hölle erleben willst, dann versuch es, Millard. Sei dir aber sicher, dass es höllisch schmerzhaft für dich werden wird. Steh auf und dreh dich um!“
„Was - hast - du - vor?“, ächzte Millard und kämpfte sich auf die Beine.
„Du sollst dich umdrehen, verdammt!“, presste McQuade ungeduldig und warnend hervor und winkte mit dem Colt. Nur zögernd folgte Millard dem Befehl. Als er McQuade den Rücken zuwandte, schlug dieser zu. Der Revolverlauf knallte auf den Kopf des Banditen, und mit einem verlöschenden Seufzen brach Millard zusammen.
McQuade wollte kein Risiko eingehen. Diese Sorte war unberechenbar, und sie war mit allen Wassern gewaschen. Um ihren Hals aus der Schlinge zu ziehen wuchsen Kerle wie Millard über sich hinaus.
Der Kopfgeldjäger nahm eine dünne Schnur aus der Manteltasche und fesselte die Hände Millards. Dann holte er die Pferde. Der Bandit erlangte schon nach wenigen Minuten wieder das Bewusstsein und zerrte an seinen Fesseln. Sein Atem ging keuchend und stoßweise. Obwohl es kühl war, perlte auf seiner Stirn der Schweiß.
„Es ist zwecklos, Millard!“, gab McQuade kalt und ungerührt zu verstehen. „Die Schnur ist aus Leder, die zerreißt du nicht. Hoch mit dir!“
McQuade war abgestiegen, zerrte den Banditen auf die Beine und bugsierte ihn zum Pferd. Millard hinkte stark, stöhnte und ächzte und keuchte schließlich: „Du musst mich verbinden, McQuade. Das Halstuch reicht nicht …“
„Es muss reichen, Millard.“ McQuade fixierte den Banditen verächtlich. „Wenn es um dein Fell geht, scheinst du ja ziemlich zimperlich zu sein.“ Seine Mundwinkel zogen sich nach unten. „Wenn du aus dem Hinterhalt auf arglose Männer schießt und sie tötest, dann geht dir das nicht so nahe, wie?“
Der Kopfgeldjäger half Millard auf den Pferderücken. Auch er saß auf, schnappte sich den langen Zügel des Banditenpferdes und ritt an.
„Wie war das wirklich, an jenem Abend, als ihr Ken Steward aufgelauert habt und Tom Bundy starb?“, fragte der Texaner nach einer Weile, in der sie schweigend geritten waren.
„Steward rammte Tom einen Dolch in den Leib“, antwortete der Bandit. „Dem gibt es nichts hinzuzufügen.“
„Es war Bundys eigenes Messer, das in seinem Leib steckte“, versetzte McQuade. „Und es war wohl tatsächlich so, dass Bundy in seinen Dolch stürzte, als er Steward angriff und dieser dem Angriff auswich.“
Sein Mienenspiel verriet Millard. McQuade konnte in seinem Gesicht lesen wie in einem aufgeschlagenen Buch. „So war es doch, nicht wahr?“
Millard gab keine Antwort.
Wieder herrschte eine ganze Zeit Schweigen zwischen den beiden ungleichen Männern. Die Sonne stieg höher und höher, die Hitze nahm zu.
„Du wirst die Zähne schon noch auseinander nehmen“, sagte McQuade irgendwann einmal. „Denn es wird sicher nicht leicht für dich, wenn du den Hals alleine in die Schlinge stecken musst.“
Millard spuckte zur Seite aus.
Meile um Meile zogen sie dahin. Kleine Stechmücken, angezogen vom Schweißgeruch, quälten Mensch und Tier. Die Hitze verwandelte das Land in einen Glutofen und saugte ihnen regelrecht das Mark aus den Knochen.
Gegen Abend erreichten sie einen schmalen Creek. Das Wasser plätscherte zwischen Unmengen von Geröll dahin. Am Ufer wuchsen einige Büsche und ein schmaler Streifen Gras.
Millard blieb im Sattel, während sein Pferd trank. McQuade kniete am Ufer und wusch sich Schweiß und Schmutz aus dem Gesicht. Er konnte seinen linken Arm wieder einsetzen. Nur noch ein leichtes Ziehen war in der Schulter zu bemerken.
Sekundenlang achtete er nicht auf Millard. Dem Banditen war es tagsüber gelungen, seine Handfessel so weit zu lockern, dass er die Hand herausziehen konnte. Er nahm die Chance eiskalt wahr, die sich ihm bot. Blitzschnell streifte er die Lederschnur ab, dann warf er sich vom Sattel aus auf McQuade, der am Ufer kniete.
*
Als der Körper mit ungebremster Wucht auf ihn prallte, kippte McQuade vornüber und fiel mit dem Gesicht in das seichte Wasser. Ein Schwall Wasser drang in seinen Mund. Er hustete, und die Luft wurde ihm aus den Lungen gedrückt.
Millard kniete über ihm, presste ihn mit unwiderstehlicher Gewalt auf den Boden, mit beiden Händen drückte er McQuades Kopf unter Wasser. McQuade wand sich, versuchte sich unter dem Banditen zu drehen, stemmte sich gegen den Druck der Hände in seinem Nacken und auf seinem Hinterkopf. Aufgewühlter Sand drang ihm in Nase und Mundhöhle.
Millard schien der vernichtende, grenzenlose Hass mit übermenschlichen Kräften auszustatten. Mit verzerrtem Gesicht hockte er auf McQuade, der Kraftakt ließ ihn die Zähne zusammenbeißen und seine Backenknochen scharf hervortreten. Den Schmerz von der Wunde in seinem Oberschenkel ignorierte er. Der Wille zum Töten beherrschte ihn, er wütete in seinen Augen und prägte seine Züge.
Gray Wolf rannte wie von Sinnen bellend einmal auf die eine Seite der Kämpfenden, dann auf die andere. Sein Instinkt sagte ihm, dass sein Herr in großer Not war. Doch er erhielt keinen Befehl, einzugreifen.
In McQuades Lungen war kein Sauerstoff mehr. Sie fingen an zu stechen. Schwindel erfasste den Kopfgeldjäger, Panik stellte sich ein, ihr folgte die Todesangst. Seine Beine zuckten unkontrolliert, er zwang sich zu klarem Verstand und kühler Überlegung, und ehe die Flamme des Überlebenswillens zusammensank und erlosch, gelang es ihm, seine Arme in den schmierigen Untergrund zu stemmen und all seine Kraft zu mobilisieren. Mit einem Ruck kam er soweit hoch, dass er Millard etwas aus dem Gleichgewicht brachte. Der unbarmherzige Druck, der seinen Kopf unter Wasser hielt, ließ nach.
Gierig sog er frische Luft in sich hinein, und schlagartig schienen neue Reserven in seine Muskeln und Sehnen zurückzukehren. Und als er die Hände des Banditen wieder in seinem Genick spürte, warf er sich herum. Die Hände Millard rutschen ab, der Mörder verlor das Gleichgewicht und kippte über McQuade, drückte die Arme durch und stützte seinen Oberkörper ab, um zu verhindern, dass er vornüber ins Wasser stürzte.
McQuade lag jetzt auf dem Rücken, drückte seinen Oberkörper in die Höhe, und spürte, wie sich die Muskulatur zu beiden Seiten seiner Wirbelsäule und im Nacken verkrampfte. Der Atem Millards streifte sein nasses Gesicht. Von der Seite ließ McQuade seine Faust gegen das Jochbein des Banditen krachen, und dessen Kopf flog auf die rechte Schulter, ein bestürztes Gurgeln entrang sich ihm. Im nächsten Moment aber hatte er den Schlag verdaut, sein Oberkörper schwang hoch, und er kniete wieder über McQuade.
Millard gespreizte Finger zielten nach McQuades Hals, doch McQuade bäumte sich unvermittelt auf, und Millard wurde erneut nach vorne geworfen. Reflexartig stützte er sich auch jetzt mit beiden Armen ab. Und nun traf ihn McQuades Faust auf die Rippen. Millard krümmte sich zur Seite, und als er einen zweiten, eisenharten Schlag auf dieselbe Stelle einstecken musste, brüllte er gequält auf.
McQuade brachte seinen linken Arm zwischen sich und den Banditen. Seine Finger verkrallten sich im Kehlkopf des Outlaws, und Millards Augen quollen aus den Höhlen, sein Mund klaffte auf, er japste, und als McQuades Rechte ein drittes Mal gegen seine Rippen krachte, entrang sich ihm nur ein ersticktes Röcheln. Er verdrehte die Augen, versuchte, sich mit den Armen abzustoßen und aufzurichten, da aber löste sich McQuades unerbittlicher Griff von seinem Hals, und mit beiden Armen schleuderte McQuade den Banditen von sich.