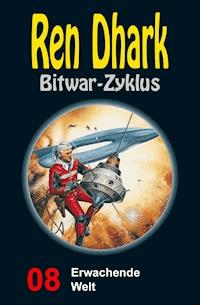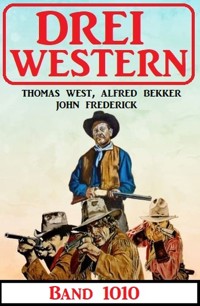
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis: Graingers Weg (Alfred Bekker/Thomas West) Grainger und die Squaw (Alfred Bekker/Thomas West) Die Männer vom Silver Canyon (John Frederick) Ungefähr hundert Mann reiten unter dem Kommando eines bisher unbekannten Anführers. Sie haben es inzwischen geschafft, den gesamten Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Devil's Slide und Salt Lake City unsicher zu machen. Die Überfälle werden mit fast militärischer Präzision durchgeführt. Die Bande schlägt mit großer Übermacht zu und geht dabei äußerst rücksichtslos vor. Wer sich ihr in den Weg stellt, wird kaltblütig erschossen. Grainger wird sich ihnen in den Weg stellen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
John Frederick, Alfred Bekker, Thomas West
Drei Western Band 1010
Inhaltsverzeichnis
Drei Western Band 1010
Copyright
Graingers Weg
Grainger und die Squaw
Die Männer vom Silver Canyon
Drei Western Band 1010
Alfred Bekker, Thomas West, John Frederick
Dieser Band enthält folgende Krimis:
Graingers Weg (Alfred Bekker/Thomas West)
Grainger und die Squaw (Alfred Bekker/Thomas West)
Die Männer vom Silver Canyon (John Frederick)
Ungefähr hundert Mann reiten unter dem Kommando eines bisher unbekannten Anführers. Sie haben es inzwischen geschafft, den gesamten Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Devil’s Slide und Salt Lake City unsicher zu machen. Die Überfälle werden mit fast militärischer Präzision durchgeführt. Die Bande schlägt mit großer Übermacht zu und geht dabei äußerst rücksichtslos vor. Wer sich ihr in den Weg stellt, wird kaltblütig erschossen. Grainger wird sich ihnen in den Weg stellen...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Graingers Weg
von Alfred Bekker & Thomas West
Der Umfang dieses Buchs entspricht 114 Taschenbuchseiten.
Eine Horde Banditen überzieht die Gegend nördlich des Cimmaron mit Überfällen. Sie tauchen im Morgengrauen auf, greifen ein Ranch oder eine Farm an, fallen über ein Bergwerk oder eine Bank oder ein Kutsche her, und ziehen sich danach blitzschnell wieder in das Oklahoma-Territory zurück. Weder Strafexpeditionen der US-Army noch die Marshalls und Town Marshals von Liberal, Dodge-City und den Gemeinden im Grenzgebiet werden mit der Landplage fertig. Deshalb wird der U.S. Government Squad gerufen – Grainger nimmt sich der Banditen an.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© 2006 by Alfred Bekker & Thomas Ziebula; Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der Autoren. COVER: WERNER ÖCKL
© dieser Ausgabe 2017 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
1
Am Morgen bedeckte er die kalte Asche seiner Feuerstelle mit Sand und Steinen und verwischte die Spuren seiner Stiefel am Ufer. Den Rest würde der Regen erledigen, der in einer schwarzen Wolkenfront von Westen heranzog. Maxwell schnürte seinen Proviant und seine Decke zu einem Bündel. Danach stieg er in den Sattel und ritt der aufgehenden Sonne entgegen.
Gegen Mittag bog der Lauf des Cimarron nach Südwesten ab. Timothy Maxwell folgte ihm und wusste, dass er Kansas nun endgültig verlassen und gesetzloses Gebiet betreten hatte: das Oklahoma Territorium. Hier hin reichte der Arm Washingtons noch nicht.
Zwei Stunden später bog ein Herbststurm das Gras auf den Boden und fegte das gelbe Laub aus den Kronen der Eichen. Es fing an zu regnen. Maxwell lenkte seinen Wallach in den Fluss, um in den Felswänden am Waldhang des anderen Ufers Schutz zu suchen. Von unten umspülten die anschwellenden Fluten des Cimarron seine Stiefel, von oben schlugen Sturzbäche auf Maxwell und seinen Gaul ein. Und von den Felshängen heulte ihnen eine Gewehrkugel entgegen.
Maxwell bückte sich tief in den Sattel. „Vorwärts!“ Er brüllte. „Ho! Ho!“ Wieder pfiff eine Kugel, und wieder daneben. Wie von selbst glitt das Spencer Gewehr aus dem Sattelholster und in seine Hand. Der Wallach gab sein Bestes, kletterte die steile Uferböschung hinauf, preschte durchs hohe Gras einem Hain alter Eichen entgegen.
Drei, vier Schüsse peitschten aus dem Wald. Scharfer, heißer Schmerz riss über Maxwells linken Oberschenkel. Er ließ sich aus dem Sattel fallen, rollte sich zwischen Farn und Eichengestrüpp ab und ging hinter einem knorrigen Stamm in Deckung. Der Wallach preschte ins Unterholz.
Eine Kugel schlug über Maxwell im Stamm ein, Rindensplitter spritzten ihm ins Gesicht. Er selbst schoss ungezielt und nach Gehör zurück. Der Regen lag wie ein milchiger Schleier über dem Hang. Die Wunde am Oberschenkel brannte wie Feuer.
Wieder ein Schuss, gleich noch einer, und jetzt sah er Mündungsfeuer und die Umrisse eines Hutes. Maxwell feuerte. Der Hut flog hoch, eine Windböe trug ihn davon.
Dann eine Salve von sieben, acht Schüssen kurz hintereinander. Hinter ihm pflügten Kugeln den Waldboden auf. Fast zu spät merkte Maxwell, dass er jetzt auch vom Fluss aus beschossen wurde. Die verdammten Mistkerle nahmen ihn in die Zange.
Er warf sich bäuchlings ins Unterholz. Gewehrkugeln heulten von links und rechts heran, kerbten den Eichenstamm, pflügten das Moos. Er rollte sich ins Gestrüpp, robbte durch Dornenhecken, Pfützen und Schlamm. Irgendwie gelang ihm ein Pfiff, und sein Wallach tauchte aus Regenschleiern und Gebüsch vor ihm auf.
Timmy Maxwell hängte sich in Zügel und Steigbügel auf der linken Pferdeflanke, so dass der Körper des Wallachs ihn wenigstens gegen die Schüsse vom Fluss her schützte. Er steckte das Gewehr ins Sattelholster, riss seinen langläufigen Navy Colt aus dem Hüftholster und feuerte aufs Geradewohl in den Waldhang hinein.
Der Wallach galoppierte entlang der Felsböschung, wagte nicht den Sprung zurück in die Fluten. Regen klatschte auf den Gaul und seinen angeschossenen Reiter, Kugeln pfiffen ihnen um die Ohren. Brennend heiß schlug es Maxwell in den Nacken, er schrie auf vor Schmerz, ließ sich aus Zügel und Steigbügel fallen, und stürzte über die Böschung zwei Pferdehöhen tief in den Cimarron hinab.
Der war flacher als befürchtet an dieser Stelle, aber von derart starker Strömung, dass Maxwell wie Treibholz flussabwärts gerissen wurde. Irgendwie gelang es ihm, den Colt über Wasser zu halten, wenigstens eine Zeit lang.
Hinter den Regenschleiern sah er zwei oder drei Reiter am Ufer entlang preschen. Sie verfolgten ihn. Timmy Maxwell konnte nur hoffen, dass er kein allzu deutliches Ziel bot zwischen Schaumkronen und Felsblöcken.
Er klammerte sich an einem großen Stein in der Flussmitte fest um zielen zu können, denn die Reiter waren schon fast auf seiner Höhe. Zwei, drei Schüsse explodierten am Ufer, Kugeln heulten übers Wasser und sprengten Gesteinssplitter aus seiner felsigen Deckung. Maxwell erwiderte das Feuer. Schmerz, Wut und Verzweiflung rasten in seinem Körper, er schoss die Trommel leer. Mindestens zwei der Scheißkerle erwischte er.
Kraftlos rutschte ihm dann die Hand vom nassen Stein. Er steckte den Revolver in den Hosenbund und ließ sich unter Wasser sinken. Die Strömung trieb ihn davon.
Über einen kleinen Wasserfall warf sie seinen wunden Körper in ein tiefes Felsbecken. Ein paar Minuten lang spielten die Naturgewalten Pingpong mit ihm. Er tauchte auf, er tauchte unter, er schluckte Wasser, er tauchte auf, er tauchte unter. Schließlich prallte er zwischen zwei vom Wasser glatt gescheuerte Steinblöcke und blieb in der engen Lücke dazwischen hängen.
Die Nacht kam, Timmy Maxwell hielt sich fest. Gegen Morgen hörte es auf zu regnen, Timmy Maxwell schwamm aus der Schlucht, und schaffte es ans Ufer. Niemand verfolgte ihn, vermutlich glaubten sie ihn abgesoffen. Die Strömung schaukelte gelbes und rotes Laub an ihm vorbei.
Die zweite Kugel hatte ihm den Haaransatz im Nacken aufgerissen, die erste den Oberschenkel durchschlagen. Der Knochen schien jedoch heil geblieben zu sein. Verdammter Mist, aber er lebte noch.
Der Regen hörte auf, es wurde Mittag. Timmy kroch die Böschung hinauf und schleppte sich durchs Unterholz. Der Himmel riss auf, die Herbstsonne schickte ein paar Strahlen durch die bunten Kronen. Seine Wunden klopften, er hatte Durst. Gegen Abend gelangte er auf einen Wildpfad. Er blieb liegen. Als es dunkel wurde, schlief er ein.
Am Morgen weckten ihn Stimmen. Er schlug die Augen auf und sah Mokassins, drei oder vier Paar, wahrscheinlich ein Fiebertraum. Timmy hob den Kopf. Sein Blick wanderte an Hosenbeinen hinauf, grob gewebter, brauner Stoff. Er sah Fransen, er sah einen bunt bestickter Gürtel, er starrte den mit Schnitzereien verzierten Griff eines Tomahawks an. Und auf ihn blickte ein braun gebranntes Gesicht herunter.
Indianer. Kiowa.
Sie packten ihn und rissen ihn hoch. Der Schmerz löschte sein Bewusstsein aus...
2
Der Schnee war getaut und hatte die Main Street in eine Schlammtrasse verwandelt. Es nieselte. Das Wasser gurgelte unter seinen Stiefeln, als er aus dem Sattel gestiegen war und sein Pferd zum Bürgersteig führte. Die Fenster zum Saloon waren geschlossen, trotzdem hörte er Stimmengewirr und Gelächter.
Er band den Schimmel fest und zog das Telegramm aus der Innentasche seines Hirschledermantels. Aufmerksam las er noch einmal den letzten Abschnitt: ...Bruckner ist Rechtsanwalt und erst seit etwa zwei Jahren unser Kontaktmann in Dodge City. Er wird Sie erkennen und Sie ansprechen. Bieten Sie ihm etwas zu rauchen an. Wenn er mit Hinweis auf sein Asthma ablehnt, haben Sie es ganz sicher mit Henry Bruckner zu tun...
Er faltete das Papier zusammen, steckte es zurück in die Manteltasche, und schnallte seine Mochila los. Den Sattelkarabiner klemmte er sich unter den Arm, die schwarzen Satteltaschen warf er sich über die Schulter.
Die Holzbohlen knarrten, als er den Bürgersteig betrat. Mit dem nassen Hut klopfte er das Wasser von seinem Mantel. Er stieß die Schwungtür zum Saloon auf und trat ein.
Rauchschwaden hingen wie Dunstfetzen unter den Lampen. An den Tischen und um die Theke drängten sich Cowboys, Geschäftsleute, Eisenbahner, Kartenhaie und erfreulich viele Frauen. Mit einem Blick erfasste er jeden einzelnen Gast. Der stämmige Graubart am Kartentisch fiel ihm auf sofort auf. Der könnte es sein, dachte er. Der Mann trug einen braunen Frack und einen schwarzen Zylinder. Sein wacher Blick taxierte den Neuankömmling für einen Augenblick.
Der knöpfte seinen dunkelbraunen Hirschledermantel auf und ging zur Theke. „N’Abend!“, rief der Wirt ihm entgegen, ein dürrer Bursche mit roten Locken. Einige Männer am Tresen drehten sich um und machten neugierige Mienen. Er kannte keinen von ihnen.
Seinen Hut legte er auf einen freien Barhocker, seinen .44er Winchester Sattelkarabiner lehnte er dagegen. „N'Abend. Einen Kaffee und ein paar gebratene Eier, bitte.“ Der Wirt nickte und verschwand in der Küche.
„Fürchterliches Wetter, was?“ Ein Mann mit schwarzem Zylinder und in braunem Frack drängte sich zwischen ihn und einem nach Schweiß stinkenden Cowboy. Er hatte einen grauen Bart und war nicht eben groß. „Sie sehen aus, als wären sie den ganzen Tag durch den Regen geritten.“
„In Wichita hat’s noch geschneit.“ Er fingerte ein Päckchen Zigarillos aus seinem Hirschledermantel. „Habe ich das letzte Mal vor zehn Jahren erlebt.“
Der Graubart machte große Augen. „Sie wollen mir nicht erzählen, dass Sie in einem Tag von Wichita bis nach Dodge City geritten sind!“
„Hab die Nachtkutsche genommen.“ Er steckte sich einen Zigarillo an und hielt dem anderen das Päckchen hin. „Bin schon ein paar Stunden in der Stadt, hab ein Pferd gekauft.“
„Nett gemeint, Mister, danke.“ Der Graubart hob abwehrend die Rechte. „Ich rauche nicht.“ Er klopfte sich auf die Brust. „Mein Asthma hat’s mir verboten.“
Der Wirt kam aus der Küche und stellte Kaffee und Eier auf den Tresen. Der Graubart roch den Kaffee und rümpfte die Nase. „Sie sehen aus, als könnten Sie einen vernünftigen Drink vertragen.“
„Schon möglich.“ Der Mann im Hirschledermantel zündete sich seinen Zigarillo an.
„Kommen Sie, ich lad’ Sie ein.“ Der Graubart lüftete den Zylinder und streckte die Rechte aus. „Gestatten? Bruckner. Henry Bruckner.“ Und dann an die Adresse des Wirts: „Zwei doppelte Whisky an meinen Tisch, Kevin!“
„Selbstverständlich, Mr. Bruckner.“ Der Rotschopf deutete sogar eine Verneigung an.
Der andere erfasste die ausgestreckte Hand des Anwalts und drückte sie. „Grainger, danke.“ Er nahm Gewehr, Mochila und Hut an sich und folgte Bruckner zu einem kleinen Tisch im hintersten Winkel des Saloons. Teller, Besteck und Kaffeebecher trug ihm der Graubart voran.
„So, hier können wir in Ruhe reden.“ Bruckner stellte die Eier und den Kaffee ab, setzte sich und wartete, bis Grainger sich aus seinem nassen Mantel geschält und ebenfalls Platz genommen hatte. Während er sich über seine gebratenen Eier beugte, fing der Anwalt an zu reden.
„Wir haben ein Problem hier im Süden von Kansas, Mr. Grainger, ein Problem der ganz harten Sorte, möchte ich meinen. Seit dem letzten Frühjahr überzieht eine Horde Banditen die Gegend nördlich des Cimmaron mit Überfällen. Sie tauchen im Morgengrauen auf, greifen ein Ranch oder eine Farm an, fallen über ein Bergwerk oder eine Bank oder ein Kutsche her, und ziehen sich danach blitzschnell wieder in das Oklahoma-Territory zurück.“
„Wo unsere schönen Gesetze ein paar Pferdeäpfel wert sind.“ Grainger sprach, ohne von seinem Teller aufzusehen.
„Leider. Weder Strafexpeditionen der US-Army noch die Marshalls und Town Marshals von Liberal, Dodge-City und den Gemeinden im Grenzgebiet werden mit der Landplage fertig. Es ist zum Haare-Ausraufen! Im letzten Monat haben sie eine Ranch dreißig Meilen südlich von Dogde City überfallen und den Rancher und seine Familie getötet. Mit fast sechshundert Pferden ist die Bande anschließend wieder nach Süden galoppiert und hat sich in den Hügeln und Wäldern jenseits des Cimmaron verkrochen.“
Der Wirt kam und stellte zwei doppelte Whiskys auf den Tisch. „Zum Wohl, Gentlemen.“
Grainger wartete, bis der dürre Lockenkopf wieder seine Theke ansteuerte, dann sagte er: „Und jetzt hat man den Fall der U.S. Government Squad aufs Auge gedrückt, hab ich Recht?“ Er schob den leeren Teller von sich.
„So ist es, Mr. Grainger.“ Bruckner griff nach seinem Whiskyglas. „Und um es ganz präzise zu sagen: Die leitenden Offiziere der U.S. Government Squad wollen, dass Sie die Sache übernehmen.“
„Aha. Was weiß man über die Bande?“ Grainger fischte den erloschenen Zigarillo aus dem Aschenbecher und steckte ihn zwischen die Lippen. „Wie groß ist sie? Kennt man Namen?“ Unter der Tischplatte riss er ein Schwefelholz an.
„Wir wissen nicht viel. Es sind mindestens zwanzig Männer.“ Der Anwalt drehte sein Glas zwischen den Fingern und beobachtete das Spiel des Lampenlichts in der bernsteinfarbenen Flüssigkeit. „Ihr Anführer muss bei der Army gewesen sein.“
„Ach...!“ Grainger blies eine Rauchwolke gegen die Öllampe. „Und woher weiß man das?“
„Das schließen ihre Führungsoffiziere aus der Art, wie die Überfälle durchgeführt werden...“
„Gründlich vorbereitet, clevere Taktik, todsichere Strategie – so in der Art, Mr. Bruckner?“
„So in der Art, richtig.“ Der Anwalt reichte dem anderen sein Glas. Sie stießen an und tranken.
„Wie genau lautet mein Auftrag?“, wollte der Mann von der U.S. Government Squad wissen.
„Versuchen Sie den Unterschlupf der Bande zu finden, enttarnen Sie den Anführer, und...“ Bruckner stellte sein Glas ab, seine Miene verfinsterte sich.
„Und?“
„Da ist noch eine dritte Sache, die ich Ihnen sagen muss, Mr. Grainger. Sie sind nicht der erste Agent, der ins Krisengebiet geschickt wird. Ihr Vorgänger hieß Maxwell, er ist seit drei Monaten spurlos verschwunden...“
„Timothy Maxwell?“ Grainger zog erstaunt die Brauen hoch. „Der Major des siebten US-Kavallerie-Regiments?“
„Genau der, Mr. Grainger. Er wollte noch vor dem Winter zum Kiowa Creek reiten. Zuletzt hat man ihn in einem Saloon in Liberal mit einer Tänzerin gesehen. Sie hieß Francine. Mehr wissen wir nicht.“
Grainger griff nach seinem Kaffee und lehnte sich zurück. „Francine...“ Über den Rand des Bechers beobachtete er das Treiben im Saloon. „Eine Professionelle?“
„Gut möglich.“
„Wie hieß der Saloon?“
„Night-Corner, üble Spelunke.“ Bruckner schnitt eine angewiderte Miene. „Wir nehmen an, dass Maxwell dort die Fährte der Banditen aufgenommen hatte. Dass er zum Kiowa Creek wollte, hat er dem Marshall erzählt, bevor er los ritt.“
„Wenn ich Sie also richtig verstanden habe, wird mein dritter Job der sein, Timmy Maxwell finden.“ Am Tresen stand ein schwarzhaariges Mädchen. Ihre Haut war weiß wie Sahne.
„Oder wenigstens sein Schicksal aufklären.“
Das Mädchen lächelte und Grainger lächelte zurück. „Gut. Morgen reite ich los. Danke für den Whisky.“ Er stand auf und schlenderte zur Theke...
3
Winterblüte wand sich aus den Armen ihres schlafenden Geliebten. Auf allen Vieren krabbelte sie zum Ausgang des Tippis, löste die Plane und schlug sie zurück. Vor einigen Tippis stieg bereits Rauch auf. Ein paar Kinder spielten mit einem jungen Hund. Vor dem Totempfahl hockte Schwarzer Büffel, der Medizinmann, und starrte ins Gras.
Aus den Nachbarzelten drang Gemurmel. Ein paar Frauen sammelten sich, um zum Fluss zu gehen. Sie trugen Tonkrüge auf den Schultern. Winterblüte erkannte ihre Mutter und ihre Schwestern. „Wartet auf mich...!“
Sie kroch zurück zu ihrem Geliebten, warf sich über ihn, und küsste seinen Hals; solange, bis er wach war. „Ich bin so froh, dass du wieder gesund bist, Timmy.“ Der Weiße schlug die Augen auf und lächelte wehmütig.
Winterblüte schnappte sich den größten der Tonkrüge und eine alte Lederdecke. „Ich gehe zum Fluss und hole Wasser. Holz bringe ich auch mit...“
Timmy Maxwell richtete sich auf. Er war nackt unter dem Fell, eine Narbe zog sich von seinem Nacken über seine Schulter. Seltsam, wie er schaute, irgendwie traurig. „Der Frühling kommt, Winterblüte. Es wird von Tag zu Tag wärmer. Morgen werde ich weiterziehen. Ich habe einen Auftrag.“
Seine Worte raubten ihr schier den Atem. Doch sie ließ es sich nicht anmerken, schluckte und sagte trotzig: „Ich wusste immer, dass du gehen wirst, wenn deine Wunden verheilt sind. Du musst die Banditen suchen, auch das weiß ich. Aber jetzt sind wir Mann und Frau, und wohin du gehst werde auch ich hingehen.“
Sprach’s, wandte sich ab und huschte aus dem Zelt. Sie wischte sich ein paar Tränen aus den Augen, und lief dann an den Tippis ihres Stammes vorbei zum Fluss hinunter.
Dort hatten sich bereits an die zwanzig Frauen des Stammes eingefunden. Einige fischten, andere wuschen Decken, Kleider oder sich selbst, wieder andere füllten ihre Krüge mit Wasser. Ein, zwei Speerwürfe entfernt, am Waldrand, schritten einige Mütter mit ihren Kindern durch Gras und Gestrüpp und suchten Reisig zusammen.
Schwarzer Büffel, der Schamane, sprang plötzlich auf. Winterblüte sah es aus den Augenwinkeln, während sie am Ufer kniete und den Krug in den eiskalten Fluten versenkte. Er drehte sich nach links, drehte sich nach rechts und ruderte mit den Armen.
Und dann fiel der erste Schuss, und eines der Kinder am Waldrand schrie auf. Winterblüte sah, dass der Knabe sich über seine tote Mutter warf. Zehn oder zwölf Reiter galoppierten auf Pferden aus dem Wald, auf schweren, grau gescheckten Pferden, wie die Blauröcke des Großen Vaters in Washington sie benutzten. Es waren Weiße, kein Zweifel, und sie brachten den Tod.
Mündungsfeuer blitzten, links und rechts von Winterblüte stürzten die Frauen schreiend ins Gras oder in den eisigen Fluss. Sie sprang auf und schaffte es wie durch ein Wunder bis zwischen die Zelte. Krieger rannten ihr entgegen, luden Gewehre, oder legten Pfeile in die Sehnen. Einem Sohn des Häuptlings zerschmetterte eine Kugel die Stirn. Die Wucht des Geschosses schleuderte ihm den Kopf in den Nacken, er riss die Arme hoch und schlug rücklings im Gras auf.
Winterblüte warf sich neben ihn und griff sich sein Gewehr. Während der Sterbende neben ihr nach Luft schnappte und sich in seinen letzten Atemzügen aufbäumte, blickte sie hinter sich: Sieben oder acht Reiter hatten bereits das diesseitige Ufer erreicht. Die Zügelriemen zwischen den Zähnen schossen sie aus Gewehren auf die heranstürmenden Krieger. Mindestens fünfzehn Reiter galoppierten hinter ihnen durch den seichten Fluss. Fast alle trugen dunkle Hüte und lange graue Mäntel, und hatten Tücher vor Mund und Nase gebunden. Und alle schossen aus Gewehren und Revolvern um sich. Einige zielten auf flüchtende Frauen und Halbwüchsige, sogar Kinder sah Winterblüte getroffen zu Boden sinken. Eine kalte Faust drückte ihr das Herz zusammen.
Sie blickte neben sich. Die gebrochenen Augen des Häuptlingssohnes starrten ins Leere. Zwei Krieger knieten wenige Schritte vor ihr auf den Boden und legten ihre Spencer-Gewehre auf die Angreifer an. Kugeln heulten heran und vorbei, Erdfontänen spritzten hoch, einer der Krieger brach getroffen zusammen. Das Gewehr in der Linken robbte Winterblüte nach rechts aus der Schussbahn. Hufschlag näherte sich, irgendwo schrie eine Frau, irgendwo wimmerte ein Kind.
Winterblüte hechtete in den Eingang eines Tippis. Im Halbdunkeln sah sie ein halbwüchsiges Mädchen zwischen Fellbündeln kauern. Mit dem linken Arm drückte sie einen kleinen Jungen gegen ihre Brust, in ihrer rechten Faust blitzte eine Klinge auf. Die Plane fiel vor den Tippieingang, das Mädchen und ihr Bruder verschmolzen mit den Fellbündeln zu einem einzigen Schatten.
Winterblüte legte das Gewehr an. Mit dem Lauf schob sie die Plane vor dem Eingang ein Stück zur Seite. Zwanzig Schritte entfernt preschten weiße Männer auf scheckigen Grauschimmeln vorbei. Die Schöße ihrer langen Mäntel flatterten hinter ihnen. Überall Geschrei, überall Schusslärm, und der Hufschlag der Angreifer klang wie die Trommeln einer Totenfeier. Winterblüte drückte ab.
Einer der Reiter sackte in sich zusammen und stürzte aus dem Sattel. Der hinter ihm riss an seinem Zügel, so heftig dass sein Pferd hochstieg. Er hatte blonde Brauen, und Winterblüte konnte sehen, wie er hinter dem blauen Mundtuch den Mund öffnete. Mit einem Revolver zielte er auf sie und schrie wütend. Der Schuss durchschlug die Tippiwand. Hinter Winterblüte begann der kleine Junge zu weinen.
Sie zielte kurz und drückte ab. Das Pferd des Angreifers knickte ein, er stürzte aus dem Sattel und rollte sich ab. Das blaue Tuch war ihm von Mund und Nase gerutscht, sein Hut lag neben ihm im Gras; ein blauer Hut, wie ihn die Soldaten der Weißen trugen. Winterblüte sah das blonde Langhaar des Mannes und seinen blonden Kinnbart und blonde Koteletten. Zwei seiner Komplizen hielten ihre Pferde bei ihm an. Mit schmerzverzerrtem Gesicht deutete er in Winterblütes Richtung. Augenblicklich feuerten die anderen beiden aus Revolvern auf das Tippi.
„Köpfe runter“, zischte Winterblüte und warf sich flach auf den Boden. Sie hörte die Kugeln die Tippiwand durchschlagen, sie hörte das Pfeifen der über sie hinweg rasenden Geschosse und sie hörte das Gebrüll von Männerstimmen. Das Gewehr auf den Tippieingang gerichtet erwartete sie die Angreifer.
Niemand stürmte ins Tippi.
Draußen jedoch brüllten Männer, und der Schusslärm verstärkte sich noch. Und da – war das nicht die Stimme ihres Liebsten? Winterblüte richtete sich auf. Kerzengerade saß sie und lauschte. Timmys Stimme, eindeutig Timmys Stimme!
Auf den Knien rutschte sie bis zur Eingangsplane. Mit dem Gewehrlauf schob sie das Leder gerade soweit zur Seite, dass sie durch den Spalt nach draußen spähen konnte. Timmy stand zehn oder fünfzehn Schritte entfernt zwischen den Tippies. Nur mit einer Hose bekleidet feuerte er aus einem Gewehr und einem Revolver auf weiße Männer, die hinter den Tippis oder im hohen Gras in Deckung gegangen waren.
Einer von ihnen brüllte Befehle und schoss aus zwei Revolvern auf Timmy. „Macht ihn fertig!“, brüllte er. „Blast ihm das Leben aus seinem verdammten Schädel...!“ Der Mann hatte einen langen, schwarzen Schnurrbart und trug eine schwarze Klappe über dem linken Auge.
Winterblüte stockte der Atem. Mindestens sieben oder acht Angreifer hatten sich auf Timmy eingeschossen. Und plötzlich sah sie, wie der Blonde mit dem Armeehut, zwischen zwei Tippis aus der Deckung sprang und sein Gewehr auf Timmy anlegte...
4
Die Dämmerung brach bereits an, als Grainger die Main Street von Liberal erreichte. Vorbei an Pferdegespannen, plaudernden Passanten und Müttern, die ihre Kinder zum Abendbrot in die Häuser riefen, ritt er sie fast bis zum Ende – bis zu jenem Saloon, den Henry Bruckner erwähnt hatte: Bis zum Night Corner.
In Städten wie Liberal war jedes zweite Haus ein Saloon. Diese wilden Rinderstädte lebten von umherziehenden Cowboys, die auf ihren Viehtrecks den Weg über das Oklahoma-Territory nahmen. Von Texas aus wurden die großen Herden bis hinauf nach Abilene getrieben, wo die Bahn auf sie wartete, um sie in den Osten zu verfrachten.
Irgendwann, das wusste Grainger, sollte die Bahn auch bis Liberal geführt werden. Das war zumindest geplant.
Vor dem Night Corner Saloon stieg Grainger vom Pferd. Eine kühle Abendbrise fegte über die Main Street und kugelte einen wurzellosen Busch vor sich her. Der Mann von der U.S. Government Squad band den Gaul am Hitchrack fest, wo bereits eine ganze Reihe von Pferden nebeneinander stand. Manche stammten von den umliegenden Ranches und Farmen, das erkannte Grainger an den Brandzeichen. Er schob den Hut in den Nacken, stieg auf den Bürgersteig und trat durch die Schwingtüren ins Innere des Saloons.
Ein Betrunkener wankte ihm entgegen. Der Mann der U.S. Government Squad wich im aus. Lallend verschwand der Torkelnde nach draußen. Hinter ihm pendelten die Schwingtüren hin und her.
Im Inneren des Saloons herrschte ausgelassene Stimmung. Ein Pianist klimperte auf einem verstimmten Klavier. Grainger fragte sich unwillkürlich, wie es jemand geschafft hatte, ein Piano an diesen Ort am Ende der Welt zu transportieren.
Aus einer Ecke war zänkisches Stimmengewirr zu hören. Eine Freitreppe führte ins Obergeschoss. Dort befanden sich vermutlich die Separees der Saloon Girls, die jetzt noch am langen Schanktisch saßen und sich um die Gäste kümmerten. Ihre tief ausgeschnittenen Kleider offenbarten mehr als sie verhüllten. Lautes Lachen übertönte das Piano-Geklimper.
Ein Cowboy kam auf Grainger zu. Er trug Chaps und eine Lederweste. Auffallend war, dass sein Holster auf der linken Seite seines Waffengurts hing. Er hatte den Arm um ein Saloon Girl gelegt und rempelte den großen Neuankömmling.
„Kannst du nicht aufpassen?“, knurrte der Cowboy. Schon lag seine Hand am Griff des Peacemakers, der aus dem tiefgeschnallten Holster ragte.
„Entschuldigung, Mister!“, sagte Grainger gelassen.
„Wenn du Streit willst, kannst du Streit kriegen!“, knurrte der Cowboy. Weder war Grainger auf einen Kampf erpicht, noch konnte er es jetzt gebrauchen, allzu viel Aufsehen zu erregen.
„Keinen Streit, Mister“, sagte Grainger. „Vielleicht ein anderes Mal, okay?“
„Dann glotz die Lady hier an meiner Seite nicht so gierig an!“ Der Kerl ließ die Frau los. Blitzschnell holte er aus und schlug zu. Doch noch schneller wich Grainger aus, und der Schlag ging ins Leere. Der Cowboy stolperte ein paar Schritte durch den Saloon. Er hatte eindeutig ein paar Whisky über den Durst getrunken. Sein Gesicht wurde dunkelrot. Er stützte sich am Schanktisch ab, fuhr herum und griff zum Revolver.
Kaum zur Hälfte konnte er das Eisen aus dem Holster ziehen, als er erstarrte, denn Grainger hielt seinen Colt Remington längst in der Rechten und zielte auf seine Brust. „Stecken lassen“, sagte er unmissverständlich.
Es war vollkommen ruhig geworden im Night Corner Saloon. Man hätte in diesem Augenblick eine Stecknadel fallen hören können.
„Lass es gut sein, Buddy!“, wandte sich einer der anderen Männer an den streitsüchtigen Cowboy. „Der Kerl ist selbst dann noch schneller als du, wenn du nüchtern bist!“
Der Mann namens Buddy presste die Lippen zu einem farblosen Strich zusammen und runzelte die Stirn. Quälend lange Sekunden verstrichen. Grainger hoffte, dass der Kerl nachdachte. Und tatsächlich ließ er endlich den Colt zurück ins Holster gleiten.
„Nichts für ungut. Nehmen Sie ‚nen Drink auf meine Kosten“, bot Grainger an und steckte seinen Remington ebenfalls zurück an den Ort der Waffenruhe. Aber dem Kerl schien danach nicht der Sinn zu stehen. Fluchend zog er mit seinem Girl davon. Die beiden gingen die Freitreppe hinauf, die ins Obergeschoss führte.
Grainger bemerkte einen Mann mit einem langen, schwarzen Schnurrbart, der oben an der Balustrade stand und zu ihm herunterblickte. Ein Auge war mit einer Filzklappe bedeckt. Er trug einen verdreckten Stetson, dazu einen knöchellangen Saddle Coat. Seine Hände ruhten auf den Kolben seiner beiden Revolvern. Als der Einäugige Graingers Blick bemerkte, grinste er breit. Dann drehte er sich um und verschwand.
Grainger ging an den Schanktisch und wandte sich an den Saloon Keeper. „Whisky.“Er legte eine Münze auf den Tisch.
Der Wirt füllte ein Glas und stellte es vor Grainger auf den Tresen. „Sie sind ziemlich schnell mit dem Eisen, Mister“, meinte er. Er war in den Fünfzigern und sehr groß und breitschultrig. Eine schmierige Schürze straffte sich über seinem gewölbten Bauch. „Respekt – ich habe noch nicht viele Männer gesehen, die so gut mit dem Revolver umgehen konnten!“
„Dieser Buddy war betrunken. Kein Wunder, zog er so langsam.“ Grainger leerte das Glas in einem Zug.
„Machen Sie sich nicht kleiner, als Sie sind, Mister….“
„Grainger. Mein Name ist Grainger.“
„Glauben Sie mir, ich habe einen Blick dafür.“ Der Salooner beugte sich vor und fuhr in gedämpftem Tonfall fort: „Wir haben im Moment keinen Town Marshal in Liberal.“
„Das tut mir Leid“, sagte Grainger.
„Vielleicht haben Sie ja Lust, den Posten zu übernehmen?“ Der hünenhafte Wirt zog die Brauen hoch. „Die Voraussetzungen scheinen Sie ja zu erfüllen.“
„Keinen Town-Marshal?“ Grainger musterte den Mann hinter der Theke. Der Salooner schenkte ihm unaufgefordert nach. „Was ist denn mit dem letzten Amtsträger geschehen?“
„Hat sich aus dem Staub gemacht, nachdem diese verfluchte Bande aus dem Oklahoma-Territorium seine Deputies erschossen hat. Die Oklahoma-Wölfe sorgen in unserer Gegend schon seit Monaten für Unruhe, und er wollte einfach nicht der nächste sein!“
„Oklahoma-Wölfe?“
„Der letzte Town-Marshal hat sie so genannt, vielleicht weil sie immer im Rudel angreifen.“
„So, so.“ Grainger spielte mit seinem Glas. „Und jetzt hat er die Flinte ins Korn geworfen. Sieht ja nach einem gefährlichen Job aus.“
„Der Stadtrat hat das Gehalt auf 120 Dollar im Monat festgesetzt. Das ist das Doppelte, was der Town-Marshal von Dodge bekommt!“
„Offenbar noch nicht genug“, sagte Grainger. Er trank sein Glas zum zweiten Mal aus und stellte es mit der Öffnung nach unten ab. „Sieht nicht so aus, als ob der Job was für mich wäre.“
„Schade.“
„Vielleicht können Sie mir aber in einer anderen Sache weiterhelfen…“
„Kommt drauf an.“ Der Saloon Keeper lehnte sich über den Tresen. „Lassen Sie hören, Grainger.“
„Erstens brauche ich eine ordentliche Mahlzeit, eine, die ein bisschen vorhält…“
„Kein Problem.“
„…und zweitens suche ich eine gewisse Francine. Angeblich soll sie hier arbeiten.“
„Stimmt.“ Der Salooner blickte nach rechts. Mit einer Kopfbewegung deutete er zur Treppe. Grainger folgte seinem Blick und sah eine rothaarige Schönheit mit einem tief ausgeschnittenen Kleid die Stufen herunterstelzen. „Wenn man vom Teufel spricht“, grinste der Wirt. Er sprach plötzlich leise und mit verschwörerischem Unterton. „Da kommt Francine...“
5
Gegen Abend lag sie noch immer über seinem nackten Oberkörper und weinte. Jemand berührte sie an der Schulter. „Es ist Zeit, Winterblüte“, sagte eine Männerstimme. Sie blickte auf. Hinter dem Schleier ihrer Tränen erkannte sie Schwarzer Büffel, den Medizinmann. „Wir müssen auch ihn für die Reise in die Ewigen Jagdgründe vorbereiten.“
Sie schluchzte, nickte und richtete sich seufzend auf. Voller Blut waren ihre Hände, ihre Kleider. Timmys Blut – ein Dutzend und mehr Kugeln hatten seinen Oberkörper zersiebt. Zwei Krieger bückten sich zu seiner Leiche hinunter, packten ihn an Handgelenken und Knöcheln und hievten ihn in seine Schlaffdecke. Sie trugen ihn zu den anderen Toten.
Winterblüte sah ihnen nach. Ein Weinkrampf schüttelte ihren Körper. Zwei Frauen gingen rechts und links von ihr in die Hocke, legten ihre Arme um Winterblütes Schultern und weinten mit ihr; ihre jüngste Schwester und die Frau ihres ältesten Bruders.
Einundzwanzig Kiowas hatten die Weißen getötet, und fast genauso viele verletzt. Zur Stunde konnte auch Schwarzer Büffel nicht sagen, wer seinen Verletzungen erliegen und wer wieder gesund werden würde.
Einundzwanzig Kiowas und Timothy Maxwell. Unter den Toten hatte Winterblüte auch ihre Mutter, zwei ihrer Brüder und ihren sechsjährigen Neffen wiedererkennen müssen. Der Tod der vieir Verwandten drückte ihr schier die Luft ab. Timmys Tod zerriss ihr das Herz.
Maxwell wollte kämpfen, wie alle waffenfähige Krieger des Stammes auch. Gemeinsam mit seinen indianischen Brüdern wollte er das Lager gegen die Mörder verteidigen. Doch innerhalb kurzer Zeit hatten sich die Angreifer auf ihn eingeschossen.
Er hatte keine Chance gehabt.
Kaum war er tot, zog die Bande ab. Ihre Verletzten und Toten nahmen sie mit. Es war, als hätten sie nach Timmy Maxwell gesucht. Es war, als hätten sie es einzig auf ihn abgesehen gehabt.
Die drei Frauen weinten noch, als die Dunkelheit auf das Lager fiel. Auf der anderen Seite des Flusses, auf der Lichtung vor dem Waldrand, loderten Flammen in den Nachthimmel. Trommeln wurden angeschlagen, der Wind wehte den Klagegesang der Kiowa ins Lager.
Winterblüte stand auf. Gestützt von ihrer Schwester und der Squaw ihres Bruders wankte sie zum Fluss. Sie wateten durch das Wasser und ließen sich im Kreis der Klagenden nieder, der sich um den Scheiterhaufen mit den Toten versammelt hatte.
Winterblüte starrte in die Flammen. Sie sah die toten, verkohlenden Leiber sich krümmen. Nach und nach erhoben sich die jungen Krieger und begann den großen Trauertanz zu tanzen. Bis zum Morgengrauen tanzten sie zum Rhythmus der Trommeln, während die Alten und Frauen sich die Kehlen heiser sangen und die Augen leer weinten.
Irgendwann erlosch die Glut, die Trommeln verstummten, und die Tänzer sanken erschöpft ins Gras. Schwarzer Büffel erhob sich und rief den Großen Geist an. Winterblüte hörte kaum zu. Ihr Herz war kalt geworden, ihre Brust wie aus Stein.
Als der Medizinmann bei Sonnenaufgang die Anrufung des Großen Geistes beendete, stand sie auf. „Rache!“, rief sie. „Ich schwöre dem Großen Geist Rache für meine Mutter, Rache für meine Brüder, Rache für meinen Neffen und Rache für den tapferen Krieger Timothy Maxwell!“
6
Ein Weib wie aus einem dieser Magazine, die einige Leute seit neustem an der Ostküste lasen – weiße Haut, dunkelrot geschminkte Lippen, Rundungen zum Schwindligwerden. Wie ein Jägerin ließ sie ihren Blick über die Tische schweifen, während sie Stufe um Stufe nahm. Grainger wurde es warm ums Herz. Und nicht nur ums Herz.
„Zweimal die Woche tritt sie hier als Tänzerin auf“, raunte der Salooner. „Das sollten Sie sich mal anschauen, Grainger. Die Lady bringt den ganzen Laden hier zum Kochen…“
Die Frau spielte mit einem Fächer herum. Ihre rote Mähne trug sie hoch aufgesteckt, und zwar so nachlässig, als wäre ihr Haar kaum zu bändigen. Rote Strähnen hingen ihr über den weißen Nacken und die nackten Schultern. Sie trat von der letzten Stufe, ließ ihr hochgerafftes Kleid los, und wandte sich zur Theke. Für einen Moment begegneten sich ihr und Graingers Blicke. Sie hatte hellgrüne Augen. Sie lächelte, während sie auf einen freien Barhocker rutschte.
„Danke für die Auskunft!“, murmelte Grainger. „Und denken Sie an meinen Hunger.“
„Klar doch.“
Der Mann der U.S. Government Squad ging zu der Tänzerin. „Darf ich Sie zu einem Drink einladen, Ma’am?“ Er setzte sich auf den Barhocker rechts von ihr. Es war nicht seine Art in solchen Fällen lange um Erlaubnis zu fragen.
Die Schöne musterte Grainger von oben bis unten. „Warum so förmlich?“, fragte sie schließlich. „Mein Name ist Francine.“ Das Lächeln kehrte auf ihre Züge zurück. „Und mit wem habe ich das Vergnügen?“
„Grainger. Einfach Grainger.“
„Ich habe dich hier noch nie gesehen!“
„Bin auf der Durchreise.“
Sie plauderten dies und das. Der Wirt stellte dem Mann von der U.S. Government Squad ein Steak mit Bratkartoffeln und Speckbohnen hin. Grainger nahm kaum wahr, dass die Kartoffeln lauwarm und die Bohnen versalzen waren, so sehr war er in das Gespräch mit der Tänzerin vertieft; und in ihre grünen Augen.
Irgendwann beugte sie sich nahe zu ihm und strich ihm den Staub von seinem Hemd. Danach nestelte sie an dessen Kragen herum. „Dein Hemd hat ewig keine Wäsche mehr erlebt. Ich wette, du hast einen langen und anstrengenden Ritt hinter dir!“
„Ich bin einiges gewohnt!“, grinste Grainger.
„Das freut mich zu hören. Ich hatte schon befürchtet…“
„Was?“
Sie sprach nicht weiter, stattdessen winkte sie dem Salooner zu. „Zwei Drinks nach oben!“, rief sie. Das verstimmte Piano setzte wieder ein. Seine Melodie und die raue Stimme der Frau passten zueinander. Francine nahm Grainger an der Hand und zog ihn mit sich zur Treppe, die Stufen hinauf und zu einem der Tische, die dort von spanischen Wänden und großen Topfpflanzen abgeschirmt standen. Von unten hatte Grainger sie nicht sehen können. Sie setzten sich nebeneinander.
Grainger musterte ihr Profil. Eine aufregende Frau, weiß Gott! Er hatte das Feuer in ihren meergrünen Augen gesehen. Ein wildes Verlangen, das ansteckend wirkte. Der Salooner brachte eine Flasche und zwei Gläser und knallte sie auf den Tisch. Er zwinkerte France zu und verdrückte sich wieder.
„Du bist kein einfacher Cowboy“, sagte Francine. Sie strich sich eine Strähne ihrer feuerroten Haare aus der Stirn. „Auch nicht irgendein dahergelaufener Vagabund.“ Sie beugte sich etwas vor, so dass ihr Dekolletee einen berauschenden Einblick bot. Dazu ihre Stimme mit diesem leicht rauchiges Timbre, dass Grainger so schätzte – sein Blut begann zu sieden, und die Strapazen des langen Ritts waren wie weg geblasen. Seine Lebensgeister meldeten sich mit Nachdruck, und er beschloss, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden.
„Wie gesagt, ich bin auf der Durchreise und will nach Oklahoma.“
„Hast du was ausgefressen?“
„Wie kommst du darauf, meine Schöne?“ Er begann ihr Haar zu streicheln.
„Die meisten, die es ins Indianergebiet zieht, haben irgendetwas auf dem Kerbholz. Aber mir soll das gleichgültig sein.“ Ihre Hand berührte seinen Arm, ihre Finger zeichneten den Verlauf seiner Unterarmvenen nach. „Du bist ein ganz besonderer Kerl, Grainger. Das habe ich gleich gesehen, als du hereingekommen bist…“
Er konnte sich nicht erinnern, sie beim Eintritt in den Saloon oben an der Treppe gesehen zu haben. „Dein Ruf ist aber auch nicht von schlechten Eltern“, sagte er. Seine Hand erreichte ihren Nacken. Francine ließ sich sein Streicheln gefallen.
„Nicht übertreiben, Grainger!“
„Immerhin spricht man auch in Dodge von dir und deinen Tanzkünsten!“ Und Verführungskünsten, hätte er fast hinzu gefügt, verkniff sich aber.
Sie lachte hell auf. „Slim Lee, der Besitzer des Dead Apache, stimmt’s? Er versucht schon seit ewigen Zeiten, mich für seinen Saloon abzuwerben! Aber da kann er lange warten! Mir gefällt es hier ganz gut.“
„Kennst du einen Mann namens Maxwell?“ Grainger schoss die Frage ab wie eine Kugel aus dem Hinterhalt. „Er müsste vor ein paar Monaten hier in der Gegend gewesen sein!“
Das Lächeln verschwand aus ihren Zügen, ihr Gesicht wurde ernst. „Ich habe ein sehr schlechtes Namensgedächtnis, weißt du?“
„Er wollte zum Kiowa Creek reiten, jemand hat ihn hier in Liberal mit dir zusammen gesehen.“
Ärger verzerrte ihre Meine. „Hör zu, Mann! Ich dachte, du wärst an mir interessiert – und jetzt fängst du an mir Löcher in den Bauch zu fragen! Ich kenne kleinen Maxwell! Oder warte mal...“
Sie zögerte, senkte den Blick, als würde sie in ihrem Gedächtnis kramen, und sagte schließlich: „Doch, ja. Da war vor einiger Zeit ein Kerl hier in Liberal, der so hieß, Maxwell, genau. Aber der ist mir nicht besonders deutlich in Erinnerung geblieben.“ Sie rückte näher an ihn heran und strich ihm über den Oberarm. „Bei dir wird das bestimmt ganz anders sein.“ Sie drückte ihren Schenkel an seinen.
„Schon möglich.“ Grainger legte seine Hand auf ihr Knie. „Versuch dich zu erinnern, Schätzchen. Wohin wollte dieser Maxwell?“
„Bist du ein Marshall oder so etwas?“ Der Blick ihrer grünen Augen bohrte sich seinen. Sie schüttelte den Kopf. „Kann ich irgendwie nicht glauben….“
„Der Kerl schuldet mir Geld“, sagte Grainger.
„Ach so, verstehe...“ Erleichterung entspannte ihre Züge. „Weißt du was? Ich mache dir einen Vorschlag, Grainger.“
„Und der wäre?“
„Wir setzen unsere Unterhaltung in meinem Zimmer fort.“
„Scheu bist du wirklich nicht!“
„Gib es zu, das magst du doch!“
Grainger grinste. Vielleicht konnte er ja wirklich mehr über Maxwell erfahren, wenn er Francine in einer etwas intimeren Umgebung aushorchte. Davon abgesehen zog ihn diese Frau, und wie sie ihn anzog! Das Feuer in ihren Augen erregte ihn nicht weniger, wie ihre Stimme und der Geruch ihres Parfums. Die Flamme des Begehrens loderte wild in ihm auf. „Einverstanden!“, sagte er.
„Ich schätze, du hast deinen Gaul noch vor dem Saloon festgemacht?“
„Richtig.“
„Bring ihn erst weg. Hundert Yards weiter findest du einen Mietstall. Mein Zimmer ist im Obergeschoss, Nummer 12. Komm einfach dort hin.“ Sie küsste ihn auf den Mund. „Ich warte auf dich!“
Sie stand auf und rauschte davon. Seine Antwort hatte sie gar nicht erst abgewartet. Offenbar war sie sicher, dass Grainger ihr eindeutiges Angebot nicht ausschlagen würde. Doch keine Professionelle? Sonst hätte sie ihm doch einen Preis genannt, oder?
Der Mann der U.S. Government Squad sah ihr nach wie sie über die Zimmerflucht tänzelte. Der Saum ihres knöchellangen Kleides streifte über den Boden. Vor einer Zimmertür blieb sie stehen, warf ihm eine Kusshand zu, schloss die Tür auf und verschwand dahinter.
Grainger erhob sich und schnappte sich sein Gepäck und sein Gewehr. Er stieg die Treppe in den Saloon hinunter und trat durch die Schwingtüren ins Freie. Draußen war es in der Zwischenzeit bereits dunkel geworden. Die Sonne hatte sich längst hinter dem Horizont verkrochen, die ersten Sterne funkelten über der Main Street von Liberal.
Ein dunkler Schatten schälte sich plötzlich aus dem Dunkel einer Seitengasse. Eine Gestalt tat einen Schritt nach vorn, und das Mondlicht fiel auf ein Gesicht mit stark ausgeprägten Augenbrauen und einem dunklen Vollbart. Der Kerl trug einen Zylinder, unter seinem Frack hing ein Patronengürtel mit zwei Revolvern.
Er stieg auf den Bürgersteig, blieb kurz stehen, musterte Grainger auf irgendwie unangenehme Weise, sagte aber kein Wort, grüßte nicht einmal, sondern lehnte sich schweigend neben dem Salooneingang an die Holzfassade und zündete sich einen Zigarillo an.
Grainger ignorierte ihn. Er packte Waffe und Mochila auf sein Pferd, stieg in den Sattel und ritt die Main Street hinunter, bis er den Mietstall fand. Er überzeugte sich davon, dass sein Gaul ordentlich untergebracht und versorgt wurde. Danach machte er eine Anzahlung und ging zurück zum Saloon. Den Sattel ließ er im Mietstall, Satteltaschen und Winchester nahm er mit. Als er den Saloon erreichte war der Frackträger verschwunden. Ein ungutes Gefühl beschlich Grainger.
7
Francine steckte gerade den Schlüssel in das Schloss ihres Zimmers, als plötzlich der Einäugige neben ihr stand. Sie hatte ihn nicht kommen hören. Offenbar hatte er sich in einer der Nischen im Korridor versteckt gehalten. „Wer ist dieser Fremde?“, fragte er. Er trug einen langen grauen Mantel, sein Schnurrbart und seine Locken waren schwarz. Eine dunkle Filzklappe bedeckte sein linkes Auge.
„Er nennt sich Grainger und hat nach Maxwell gefragt.“
„Versuche mehr über ihn herauszufinden.“ Er fasste sie am Oberarm.
„Warum sollte ich?“ Sie versuchte zu lächeln, es gelang ihr nicht.
„Du weißt, dass Mister McMurdo sehr großzügig sein kann.“
„Ach, lass mich doch in Ruhe!“ Sie streifte seine Hand von ihrem Arm.
Der Einäugige packte ihre Handgelenke. Wie Schraubstöcke, so fest hielten seine Hände sie. „Wir können uns doch auf dich verlassen, Francine? Das können wir doch, oder?“
„Lass mich los, Reilly!“ Sie schüttelte seine Hände ab, er gab sie frei. Francine atmete tief durch. „Also gut.“ Sie rieb sich die Unterarme. „Wäre ja nicht der Erste, den ich euch ans Messer liefere, nicht wahr?“
Reilly grinste schief. „Sieh zu, dass er ziemlich müde ist, wenn du mit ihm fertig bist!“
„Du Schwein!“
Der Einäugige lachte rau. „Was beschwerst du dich? Du bist immer gut für deine Spezialjobs bezahlt worden!“
8
Am Waldrand drehte Winterblüte sich ein letztes Mal um. Auf der anderen Seite des Flusses standen sie am Ufer und zwischen den Tippis. Manche winkten. Ihre Schwester und ihr jüngster Bruder zum Beispiel, die einzigen aus ihrer Familie, die das Massaker überlebt hatten.
Ihren ältester Bruder hatten sie gestern den Flammen und dem Großen Geist übergeben. Zwei Tage zuvor war er an seinen Schussverletzungen gestorben. Winterblüte hob die Rechte und winkte zurück. Danach drehte sich sie um und ging in den Wald hinein.
Die Kiowa-Squaw trug ein braunes Lederkleid, das ihr bis zu den Knien reichte. Um die schmale Taille hatte sie sich ein Army-Holster mit einem langläufigen Navy Colt geschnallt – Timmy Maxwells Waffengurt und Timmy Maxwells Revolver. Ein langes Bowie-Messer hing in einem Lederfutteral an ihrem Gürtel. Das blauschwarze Haar trug sie zu zwei Zöpfen geflochten.
Sie zog zwei Pferde hinter sich her. Proviant, Waffen und Gepäck hatte sie auf dem Rücken des Rappen verstaut, auf Timmy Maxwells Pferd. Den ungesattelten Schecken hatte sie dem Häuptling abgeschwatzt. Ihn würde sie reiten.
Der Häuptling wollte sie lange nicht ziehen lassen. Wieder und wieder hatte er Schwarzer Büffel den Großen Geist anrufen lassen. Schwarzer Büffel hatte nicht verraten, was er im Rauch seiner Pfeife gesehen hatte. Nach jeder Beschwörung sagte er das Gleiche: „Winterblüte hat dem Großen Geist Rache geschworen, also müssen wir Winterblüte ziehen lassen.“
Etwa bis zum Mittag zog sie die Pferde hinter sich her. Immer wieder blieb sie stehen, prüfte abgeknickte Äste, abgerissenes Laub, Pferdekot, Hufabdrücke im Waldboden. Über zwanzig Reiter hinterließen so viele Spuren, dass eine Kiowa ihnen auch nachts hätte folgen können.
Als Winterblüte sicher war, die Fährte der Bande gefunden zu haben, schwang sie sich auf den Schecken. Die Fährte war sieben Tage alt. Eine Zeitlang folgte sie ihr entlang eines Wildpfades. Gegen Abend kreuzte der Pfad einen Reitweg, wie ihn viele Winter zuvor die Blauröcke des Weißen Mannes benutzt hatten. Die Spuren der Mörder mündeten in den Weg und führten nach Norden.
Winterblüte schlug ihr Lager im Schutz des Wurzelgeflechts einer vom Sturm umgerissenen Eiche auf. Sie schlief rasch ein. Die Morgensonne weckte sie. Sie aß Beeren und getrocknetes Büffelfleisch und trank Wasser aus einem Lederschlauch. Danach folgte sie dem Reitweg nach Norden.
Am Nachmittag erreichte sie eine Anhöhe. Wasservögel flogen vorüber, und Winterblüte wusste, dass der Cimarron nicht mehr weit sein konnte. Vielleicht einen halben Tagesritt, vielleicht nicht einmal das.
Im Südwesten entdeckte sie eine Rauchfahne. Ein offenes Feuer? Der Kamin eines Farmhauses? Sie stieg ab und betrachtete die Fährten. Einige Spuren führten nach Norden zum Cimarron, die meisten nach Südwesten. Hatten sich die Banditen also geteilt. Winterblüte hörte auf die Stimme ihres Herzens: Sie stieg auf ihren Schecken und folgte den Spuren nach Südwesten.
Zwei Stunden später wusste sie mehr: Die Rauchfahne stieg vom Haupthaus einer Ranch auf. Sie band die Pferde in einem Kieferwäldchen fest und schlich sich an die Ranch heran. Im hohen Gras der offensichtlich nicht mehr benutzten Weiden wagte sie sich bis an den morschen Zaun vor dem Ranchhof.
Das Dach der Scheune war eingestürzt. Dennoch hörte Winterblüte das Schnauben von Pferden aus ihr. Die Fenster des Hauptgebäudes waren zerbrochen, die Brüstung vor der Veranda eingerissen. Büsche wuchsen entlang den Fassaden, auf dem Hof wucherte das Unkraut kniehoch.
Eine aufgegebene Ranch. Aber keine gänzlich verlassene: Aus dem Kamin stieg Rauch, aus dem Haus hörte sie Gelächter, in der Scheune standen Pferde.
Zwei Stunden verharrte sie im Gras vor dem Zaun. Dann kamen endlich zwei Männer hinaus auf die Veranda. Sie rauchten und sprachen leise miteinander. Beide trugen lange, graue Mäntel, einer einen schwarzen Stetson, der zweite den blauen Hut der Blauröcke. Dieser hatte einen blonden Kinnbart, und blonde Haarsträhnen hingen ihm über die Ohren und den Mantelkragen.
Timothy Maxwells Mörder.
9
Grainger trug die Satteltaschen über der Schulter und den Winchester-Karabiner samt Sattelhalfter in der Linken, als er vor Francines Zimmertür stand und klopfte.
„Komm herein!“, hörte er ihre Stimme durch das Holz. Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Er öffnete die Tür und trat ein.