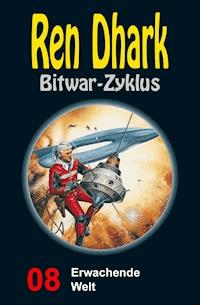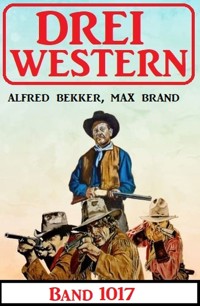
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Romane: Alfred Bekker: Sonara-Geier Alfred Bekker: Entscheidung in Nogales Max Brand: Heiße Schießeisen Schüsse peitschten dicht neben Jeff Kane in den trockenen, aufgesprungenen Boden. Eine Fontäne aus Sand wurde empor geschleudert. Die Kugeln schlugen in den steinigen, völlig verdorrten Boden ein. Kane griff zum Revolver. Blitzschnell. Er warf sich zur Seite, rollte um die eigene Achse über den Boden und riss mit einer fließenden, katzenhaften Bewegung den Revolver aus dem Holster. Kaum einen Lidschlag brauchte er dafür. Kane spannte den Hahn. Hinter dem ausgetretenen Lagerfeuer hob sich eine hoch aufragende schlanke Gestalt gegen das Sonnenlicht als dunkler Schatten ab. Blauschwarzes Haar, das von einem Stirnband zusammengehalten wurde, wehte in dem aufkommenden brandheißen Wind, der aus Südosten über die ausgedörrte, von schroffen Felsbrocken und vertrockneten Baumgruppen unterbrochene Hochebene wehte. Um die Hüfte trug der Indianer einen Revolvergurt, an dem sich auch eine Schlaufe befand, in der ein Tomahawk steckte sowie die Kunstvoll verzierte Lederscheide eines Bowie-Messers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bekker, Max Brand
Drei Western Band 1017
Inhaltsverzeichnis
Drei Western Band 1017
Copyright
SONORA-GEIER
ENTSCHEIDUNG IN NOGALES
Heiße Schießeisen
Drei Western Band 1017
von Alfred Bekker, Max Brand
Dieser Band enthält folgende Romane:
Alfred Bekker: Sonara-Geier
Alfred Bekker: Entscheidung in Nogales
Max Brand: Heiße Schießeisen
Schüsse peitschten dicht neben Jeff Kane in den trockenen, aufgesprungenen Boden. Eine Fontäne aus Sand wurde empor geschleudert. Die Kugeln schlugen in den steinigen, völlig verdorrten Boden ein.
Kane griff zum Revolver.
Blitzschnell.
Er warf sich zur Seite, rollte um die eigene Achse über den Boden und riss mit einer fließenden, katzenhaften Bewegung den Revolver aus dem Holster.
Kaum einen Lidschlag brauchte er dafür.
Kane spannte den Hahn.
Hinter dem ausgetretenen Lagerfeuer hob sich eine hoch aufragende schlanke Gestalt gegen das Sonnenlicht als dunkler Schatten ab.
Blauschwarzes Haar, das von einem Stirnband zusammengehalten wurde, wehte in dem aufkommenden brandheißen Wind, der aus Südosten über die ausgedörrte, von schroffen Felsbrocken und vertrockneten Baumgruppen unterbrochene Hochebene wehte.
Um die Hüfte trug der Indianer einen Revolvergurt, an dem sich auch eine Schlaufe befand, in der ein Tomahawk steckte sowie die Kunstvoll verzierte Lederscheide eines Bowie-Messers.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
SONORA-GEIER
Western-Roman von Alfred Bekker
Satteltramp Jeff Corley im Kampf gegen Vigilanten und Banditen - An Bord des Flussdampfers COLORADO QUEEN erfüllt sich das Schicksal eines Revolvermanns.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© dieser Ausgabe 2016 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
1
Eine plötzliche Bewegung und ein schwarzer Schatten hoch oben, bei den Felsspitzen...
Ein unmenschlicher Schrei holte den einsamen Reiter aus der Lethargie heraus, die sich fast automatisch einstellte, wenn man, wie er, stundenlang bei vor Hitze flimmernder Luft im Sattel zugebracht hatte.
Jeff Corley sah zu den schroff und zackig in den azurblauen Himmel ragenden Felsen hinüber und zog sich die Hutkrempe ins Gesicht.
Corleys Augen wurden zu schmalen Schlitzen, als er gegen die hochstehende Sonne blinzelte.
Es war ein tierischer Schrei, den Corley gehört hatte. Über den Felsen sah der Reiter den dunklen, schemenhaften Umriss eines großen Vogels kreisen.
Ein Geier!
Das mächtige Tier krächzte erneut, und es konnte aller Erfahrung nach nicht allzu lange dauern, bis weitere Aasfresser angelockt würden. Corley ließ seinen Braunen stoppen und überlegte einen Moment. Ein kreisender Geier konnte alles Mögliche bedeuten. Vielleicht war irgendwo ein halbwildes Rind durch die Trockenheit zu Grunde gegangen oder ein Puma hatte Beute gerissen und jetzt gönnten ihm die Aasfresser seine Mahlzeit nicht...
Aber genauso gut konnte es sein, dass da jemand in einer misslichen Lage war und dringend Hilfe brauchte. Ein Verletzter vielleicht, oder einer, dem das Pferd gestorben und das Wasser ausgegangen war...
Die Geier waren immer die ersten, die erkannten, wann es mit einem Lebewesen zu Ende gehen würde. Sie hatten einen Instinkt dafür, und sie hatten Geduld. Stundenlang warteten sie, bis ihr Augenblick gekommen war...
Corley wusste, dass es seine Pflicht war, nach dem Rechten zu sehen.
In der Wildnis musste jeder jedem helfen, das war ein ungeschriebenes Gesetz - auch wenn sich lange nicht alle daran hielten.
Aber für Jeff Corley war das keine Frage und so trieb er den Braunen voran.
Nach kurzer Zeit hatte er das zackige Felsmassiv umrundet. Wenig später sah er dann, worauf es der Geier abgesehen hatte.
Es war ein Bild des Grauens!
Corley sah einen Wagen, dessen hintere Achse gebrochen war und der jetzt schräg im heißen Sand stand.
Es war ein Vierspänner gewesen. Die Deichsel ragte in Stück nach oben.
Von den Pferden sah Corley keine Spur.
Im Sand verstreut lagen die zum Teil merkwürdig verrenkten Leichen von acht Männern. Ein kurzer Blick genügte Corley, um zu wissen, dass hier ein mörderischer Kampf getobt haben musste.
Die Männer waren allesamt erschossen worden. Manche von ihnen lagen auf dem Bauch und hatten den Rücken blutrot. Es machte ganz den Anschein, als wären sie in einen Hinterhalt geraten und von hinten aus dem Sattel geschossen worden. Andere schienen gerade noch Gelegenheit gehabt zu haben, ihre Eisen zu ziehen.
Aber viel hatte ihnen das nicht genutzt.
Ihre Augen standen zumeist weit offen und waren von Schrecken gezeichnet. Sie hatten kaum die Situation erfassen können und waren schon tot gewesen, so wirkte es auf Corley, der jetzt von seinem Pferd herunterstieg.
Jeff Corleys Hand ging instinktiv zu dem Revolvergriff, der an der Hüfte aus seinem tiefgeschnallten Holster ragte. Sein Blick glitt über die Umgebung, denn er wusste, dass die Gefahr vielleicht noch nicht vorbei war.
Was hier geschehen war, konnte noch nicht allzulange her sein, denn sonst hätten die Geier sich längst in Scharen über diese Beute hergemacht.
Die Gefahr, die für die acht erschossenen Männer einen grausamen Tod nach kurzem, aussichtslosen Kampf bedeutet hatte, konnte noch immer gegenwärtig sein.
Aber Corley konnte nirgends etwas sehen.
Dennoch - zur Sicherheit blieb Corleys Hand bei dem Revolvergriff an seiner Seite.
Diejenigen, die für dieses Schlachtfeld verantwortlich waren, mussten sämtliche Pferde mitgenommen haben und es schien so, als hätten sie auch einige der Waffen ihrer toten Gegner eingesammelt.
Aber darauf konnten es diese Bestien unmöglich allein abgesehen haben. Ein solches Blutbad für ein paar Waffen und Pferde anzurichten, das war zumindest ungewöhnlich. Und dann sah Corley einen Augenblick später den eigentlichen Grund. Auf der anderen Seite des Wagens lag eine aufgebrochene Stahlkassette. Sie war selbstverständlich leer, aber ein Stück weiter im Sand fand Corley dann ein kleines Papierband, das alles erklärte.
Es war eines jener Papierbänder, mit denen Banken üblicherweise abgezählte Packen von Scheinen zu bündeln pflegten.
Corley nahm das Papier auf. Es stammte von einer Bank in Dutton, Arizona.
Ein Geldtransport also, dachte Corley.
Und acht bewaffnete Männer hatten nicht ausgereicht, um zu verhindern, dass ein paar skrupellose Banditen sich die Dollars unter den Nagel reißen konnten!
Corley zuckte mit den Schultern.
Für diese Männer konnte er nichts mehr tun.
Nichts, außer einer Sache.
Er ging zurück zu seinem Braunen und griff zu dem Klappspaten, den er hinten am Sattel hatte. Die Toten sollten ihre letzter Ruhe finden und dafür wollte Corley sorgen, auch wenn es es in der erbarmungslosen Hitze eine ziemliche Plackerei werden würde.
Mochten sich die Geier anderswo ihre Mahlzeit suchen!
Aber Corley hatte noch nicht die Schnalle gelöst, die den Klappspaten am Sattel festhielt, da vernahm er ein verräterisches Geräusch irgendwo in seinem Rücken. Instinktiv war ihm von der ersten Sekunde an klar, dass für diesen Laut weder Geier noch Coyoten verantwortlich waren - es sei denn solche, die auf zwei Beinen zu gehen pflegten. Aus mehreren Richtungen kam etwas an Corleys Ohren. Mit den Augenwinkeln nahm er zwischen den Felsen eine flüchtige Bewegung war.
Corleys Hand ging jetzt vom Klappspaten aus fast unmerklich ein Stück weiter zum Scubbard, aus dem der Kolben eines Winchester-Gewehrs ragte.
Mit einer blitzartigen, entschlossenen Bewegung hatte Jeff Corley die Waffe herausgerissen und durchgeladen. Als er dann herumwirbelte, blickte er in von abgrundtiefem Hass gezeichnete Gesichter und blanke Revolvermündungen.
2
Was dann geschah, ging unwahrscheinlich schnell vor sich und Jeff Corley wusste, dass sein Leben an einem seidenen Faden hing.
Das Krachen der Revolver, das Aufblitzen der Mündungsfeuer, das alles ahnte Corley um den Bruchteil einer Sekunde voraus und warf sich zur Seite, während rechts und links von ihm die Kugeln einschlugen.
Sein Pferd stob wiehernd zur Seite, während Corley noch im Fallen die Winchester krachen ließ.
Ein Dutzend Reiter waren mit gezückten Waffen hinter den Felsen hervorgekommen und hatten Corley ins Visier genommen. Den ersten von ihnen erwischte er am Arm, sodass er laut aufschrie und seine Waffe in den Staub fiel. Das Pferd des Mannes richtete sich wiehernd auf und er hatte einige Mühe, oben zu bleiben.
Aber da waren noch all die anderen, die jetzt ein wahrhaft wütenden Kugelhagel in Corleys Richtung schickten. Der Sand wurde dutzendfach zu kleinen Staubfontänen aufgewirbelt, während die Kerle in einem wilden Sturmangriff heranpreschten.
In den Augen dieser Männer blitzten Wut und Zorn. Corley hatte nicht die geringste Ahnung, wer sie waren oder was sie wollten.
Es war nur sein Glück, dass sie in ihrer Mehrheit wohl nur mittelmäßige Schützen waren.
Mit einem Hechtsprung beförderte Corley sich hinter den halb umgestürzten Wagen, während das Blei durch das Holz splitterte.
Zunächst musste Corley den Kopf einziehen, so wütend war das Revolverfeuer, das auf ihn niederprasselte. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis er es dann wieder wagen konnte, kurz aus seiner Deckung hervorzutauchen und erneut seine Winchester sprechen zu lassen.
Corley war ein schneller und sicherer Schütze. Er holte mit einem kurz gezielten, guten Schuss einen der Männer aus dem Sattel.
Der Kerl wurde an der Schulter erwischt und durch die Wucht des Geschosses nach hinten gerissen. Als er dann unsanft auf dem Boden landete, rührte er sich zwar noch, schien aber kampfunfähig zu sein.
Indessen hatte sich die heranpreschende Gruppe geteilt. Die Angreifer waren in einem Bogen um den Wagen herumgeritten und hatten Corley auf diese Weise praktisch eingekreist.
Einen Sekundenbruchteil nur, nachdem Corley aus der Deckung hervorgetaucht war, spürte er plötzlich einen unangenehmen Ruck.
Instinktiv wollte er die Winchester in die Höhe reißen und erneut feuern, aber das ging nicht mehr.
Eine Lassoschlinge hatte sich um seinen Oberkörper gelegt und und sich blitzschnell zugezogen.
Corley wurde nach hinten gerissen, die Winchester glitt ihm aus der Hand und dann schrammte er rau ein paar Dutzend Meter über den Boden. Sie schleiften ihn einfach hinter sich her.
Der trockene Boden war zum Teil hart und rissig. Steine schrammten Corley die Haut auf.
Als sie endlich anhielten, blickte Corley erneut in hassverzerrte Gesichter.
Einer der Männer hatte den Revolver auf ihn gerichtet und zog den Hahn nach hinten.
"So, du Bastard! Jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen!"
Es war ein vierschrötiger Mann mit Sommersprossen und und einem grobgeschnittenen Gesicht, der das sagte. Und er bleckte dabei die Zähne wie ein Raubtier.
Corleys Revolver war bei der Schleiferei aus dem Holster gerutscht und so hatte nicht den Hauch einer Chance. Er hatte sich keuchend erhoben und stand jetzt wehrlos vor diesen Männern. Ohnmächtig ballte er die Hände zu Fäusten. Es gab nichts, was er tun konnte.
Er war seinen Gegnern völlig ausgeliefert. Sie konnten mit ihm tun, was ihnen beliebte.
Corley wollte etwas sagen, aber bevor auch nur eine einzige Silbe über seine Lippen kam, krachte bereits der Revolver des Sommersprossigen.
Der Schuss ging dicht vor Corleys Füße und schlug dort in den Boden. Trockener Staub wurde aufgewirbelt.
Einer der anderen Männer hatte seinen Gaul einen Schritt nach vorn machen lassen und war dem Vierschrötigen in die Parade gefahren. Er hatte ihm einfach den Revolverarm nach unten gedrückt, fast genau in dem Moment, in dem der Schuss losging.
Der Vierschrötige fluchte lauthals.
"Was soll das, Justin! Verdammt nochmal, was fällt dir ein?"
Der Mann, der Justin hieß, war älter als die anderen. Sein Haar war silbergrau, sein Gesicht hager. Er schien so etwas wie eine natürliche Autorität zu besitzen.
"Ich bin hier der Boss, Hiram! Das sollte hier niemand in Zweifel zu ziehen wagen!"
Seine Stimme war befehlsgewohnt und sicher, seine Züge hart. Er wandte sich Corley zu und unterzog ihn einer kritischen Musterung.
"Warum willst du diesen Hund am Leben lassen! Acht Männer waren bei dem Transport für die Bank! Und sie alle sind tot! Und hast du vergessen, wie brutal diese Bande die McQuire-Ranch überfallen hat? So viele haben schon dran glauben müssen und jetzt haben wir endlich einen dieser verfluchten Hunde... Und verdammt, so wahr ich hier stehe, er soll soll für alles bezahlen, Justin!"
Hirams Stimme bebte vor Erregung.
Tränen des Zorns rannen dem sommersprossigen Mann über die Wangen.
Corley begann zu dämmern, dass hier schreckliche Dinge geschehen sein mussten, Dinge von denen er keine Ahnung hatte. Aber nun schien es, als steckte er bis zum Hals in dieser Sache drin - gleichgültig, ob es ihm nun gefiel oder nicht. Justin deutete auf den sommersprossigen Mann namens Hiram und wandte sich dann an Corley.
"Dieser Mann hat allen Grund, dich zu hassen, Hombre! Er wollte eigentlich in ein paar Wochen heiraten! Aber die Frau, die mit ihm verlobt war, war Dan McQuires Tochter und sie starb bei diesem brutalen Überfall auf die Ranch ihres Vaters! So wie fast alle anderen, die dort gelebt haben!"
"Damit habe ich nichts zu tun", erklärte Corley gelassen. Aber sein Gegenüber spuckte nur verächtlich aus.
"Feige Ausreden!"
Justins Augen schienen grau und kalt zu sein. Und unerbittlich.
Er stieg langsam von seinem Gaul herunter und trat ein paar Schritte an Corley heran.
"Weißt du, warum du noch lebst, du Hundesohn?", zischte seine Stimme gefährlich.
Corley wusste, dass er nichts mehr zu verlieren hatte.
"Ich weiß überhaupt nichts", erklärte er wahrheitsgemäß und so ruhig, wie das in dieser Lage möglich war. "Ich weiß nicht, worum es hier geht oder weshalb Sie und Ihre Leute mich angegriffen haben! Und von den Überfällen, von denen Sie gesprochen haben, höre ich zum ersten Mal. Ich bin lediglich auf der Durchreise..."
Blitzschnell war Justin dann noch einen Schritt näher gekommen. Und ehe Corley sich versah, hatte ihm sein Gegenüber auch schon einen furchtbaren Fausthieb versetzt, der ihn der Länge nach hinstreckte.
"Ich mag es nicht, wenn man mich belügt!", sagte Justin kalt. "Merk dir das!"
"Sofort aufhängen!", meinte einer der anderen Männer. Aber Justin winkte ab und schüttelte energisch den Kopf.
"Er wird bekommen, was ihm zusteht, Leute! Er wird hängen, so wahr ich hier stehe! Aber erst dann, wenn er uns ein paar Dinge verraten hat, die uns weiterhelfen! Schließlich nützt es uns nichts, wenn wir uns an einem dieser Kerle schadlos halten!"
"Die Bande hat meine Frau umgebracht und meine Farm niedergebrannt!", kam es von einem der Männer zornig zurück.
"Wenn wir diese Bande besiegen wollen, dann müssen wir unseren Verstand gebrauchen, Leute! Rache ist ein Gericht, das man kalt ist! Merkt euch das!"
Die Kerle knurrten etwas vor sich hin, das Justin als Zustimmung zu deuten schien.
Justin atmete tief durch.
Er schien sich jetzt wieder ziemlich sicher sein, den aufgebrachten Haufen, der ihm folgte, einigermaßen unter Kontrolle zu haben.
Der graue Wolf wandte sich an Corley und wandte ihm einen verächtlichen Blick zu.
"Es liegt an dir, Hombre!"
Corley verzog das Gesicht und erhob sich mit einiger Mühe wieder. Die Arme konnte er dabei kaum zu Hilfe nehmen, da die festgezurrte Lasso-Schlinge ihn praktisch fesselte.
"Wie es aussieht, werdet ihr mich ohnehin töten - ohne mich auch nur anzuhören oder mir eine Chance zu geben!" Justin lachte hässlich und freudlos.
"Man kann auf verschiedene Art und Weise sterben, Hombre! Wir können dich einfach aufhängen und - aus! Dann geht es verhältnismäßig schnell für dich! Aber wir können dich auch vorher so zurichten, dass du wünschen wirst, nie geboren worden zu sein!"
Der Mann, der das Lasso hielt, das nach wie vor straff um Corleys Oberkörper geschlungen war, ließ seinen Gaul einen Schritt zur Seite traben, sodass Corley erneut zu Boden ging.
Justin ließ seine Stiefelspitze nach vorne schnellen und verpasste dem am Boden Liegenden einen brutalen Tritt in die Seite.
"Du hast die Wahl, Fremder!"
3
"Hier sind Spuren!", rief einer der Kerle. "Sie führen nach Süden!"
Der graue Justin nickte und bleckte dabei grimmig die Zähne.
"Natürlich...", murmelte er. "Wohin auch sonst... Sie werden versuchen, so schnell wie möglich über die Grenze zu verschwinden, so wie sie es immer tun!"
Dann hob er er beschwörend die Hände und augenblicklich sagte keiner aus der Meute noch ein Wort.
"Hört her, Männer, wir werden uns aufteilen. Norris und Watkins reiten mit den Verletzten und dem Gefangenen zurück in die Stadt. Der Rest folgt mir! Wir dürfen keine Zeit verlieren! Vielleicht holen wir sie noch ein!"
"Okay, Justin!", kam es von den Männern zurück. Justin überprüfte den Sitz des Revolvers an seiner Seite und murmelte: "Es wird zwar das Problem nicht auf Dauer lösen, wenn wir sie tatsächlich kriegen... Aber es kann in keinem Fall schaden, sie ein bisschen zu dezimieren!" Unterdessen machten sich zwei Männer daran, Corley rau zu packen und zu fesseln.
Dann nahmen sie ihn und legten ihn wie eine Leiche über den Rücken seines Pferdes
"Du wirst noch dein blaues Wunder erleben!", zischte einer von ihnen. Es war der größere von beiden. Ein stämmiger, hochgewachsener Mann mit etwas Bauch, aber sehr kräftig.
"Watkins! Norris!"
Es war Justins Stimme. Er saß bereits wieder im Sattel. Seine Abteilung war im Begriff aufzubrechen.
Die beiden wirbelten herum.
"Was ist?", fragte der Kleinere.
"Lasst ihn leben!"
Es war ein Befehl, der da über Justins dünne Lippen kam, nicht mehr und nicht weniger.
"Sollen wir ihn schon einmal ein bisschen bearbeiten? Vielleicht verrät er uns ja, wo das Hauptquartier dieser Bande ist und dann können wir es endlich ausräuchern!" Das war der Größere und er lachte hässlich dabei. Aber Justin schüttelte energisch den Kopf.
"Nein, Watkins! Das mache ich lieber selbst! Du schießt mir zu leicht über das Ziel hinaus - und dann ist der Hombre am Ende nicht mehr in der Lage auch nur irgendetwas zu sagen..." Watkins knurrte etwas vor sich hin.
Aber Justins Befehle waren für ihn Gesetz und er würde sie erfüllen.
Sekunden später preschten Justins Männer mit donnernden Hufen davon.
Der Aufbruch der Restgruppe ging nicht so schnell vonstatten. Zunächst einmal wurden die Verletzten versorgt. Um die toten Begleiter des Geldtransports würden sie sich ein anderes Mal kümmern.
Schließlich ging es dann endlich los, aber für Jeff Corley wurde es alles andere, als eine angenehme Reise. So bäuchlings auf einem Pferderücken zu liegen war eine ziemliche Strapaze.
Corley hatte das Gefühl, dass ihm regelrecht der Magen umgestülpt würde...
Glücklicherweise konnte wegen der Verletzten nicht allzu schnell geritten werden.
Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis sie endlich die Stadt erreichten. Mehrere Stunden mussten vergangen sein, aber es wäre für Corley im Moment unmöglich gewesen, das genau abzuschätzen.
Er hatte das Gefühl für Zeit verloren und hing benommen und schlaff über dem Sattel. Die Betriebsamkeit der Stadt war es, die ihn dann wieder aus seiner Agonie erweckte. Bei dieser Stadt handelte es sich vermutlich um jenes Dutton, Arizona, zu dessen Bank das Geld hatte transportiert werden sollen.
Corley sah aus seiner unglücklichen Lage heraus nicht allzuviel, aber das wenige, das er trotzdem wahrnahm, ließ ihn unwillkürlich stutzen.
Überall auf den Sidewalks und an den Hausecken standen bewaffnete Männer mit Gewehren und hielten Wache. Einige von ihnen patrouillierten auf der Straße herum.
Dem äußeren, flüchtigen Anschein nach waren diese Männer kein dahergelaufenes Gesindel oder eine Horde von Desperados, die sich hier breitgemacht hatte. Sie wirkten wie Stadtbürger.
Fast konnte man den Eindruck gewinnen, das Dutton von irgendeinem Feind belagert wurde...
Als der Reitertrupp vor dem Sheriff-Büro anlangte, stiegen Watkins und Norris aus den Sätteln.
Die Verletzten ritten weiter, vermutlich zum Doc, sofern es hier einen gab. Ansonsten zu jemand anderem, der sie pflegen konnte.
Watkins packte Corley bei den zusammengeschnürten Füßen und warf ihn kopfüber aus dem Sattel, sodass er hart auf dem Boden aufkam.
"Die Reise ist zu Ende, Hombre!", knurrte er. Und dann nahmen die beiden ihn zu zweit und trugen ihn fort. Mit einem Fußtritt wurde die Tür des Office aufgestoßen und dann ging es gleich in die benachbarte Gefängniszelle. Sie warfen Corley auf den Boden; die Zellentür fiel ins Schloss. Den Gefangenen loszubinden, dass hielten die beiden nicht für nötig.
Watkins setzte sich so an den Schreibtisch, dass er Corley immer im Auge hatte, während Norris sich am, Ofen zu schaffen machte, um Kaffee aufzusetzen.
Corley wälzte sich unbeholfen am Boden herum, um sich in eine bequemere Lage zu bringen.
"Gibt es hier keinen Sheriff?", fragte er anschließend. Watkins verzog seinen breiten Mund.
"Soll das ein Witz sein?"
"Jedenfalls seid ihr keine Sternträger. Und dieser Justin auch nicht."
"Es gibt keinen Sheriff mehr in Dutton. Er hat sich davongemacht. War ihm hier zu heiß, seitdem diese Horde von Desperados unsere Gegend in Angst und Schrecken versetzt hat."
Norris drehte sich vom Ofen herum und meinte: "Jetzt haben wir das Gesetz in die eigenen Hände genommen!"
"Ihr seid also Vigilanten!", erwiderte Corley. Norris nickte.
"Ja, genau! Und Cole Justin haben wir zu unserem Anführer gewählt... Wir sind auf niemanden mehr angewiesen! Auf keinen Sheriff, keinen Richter, nicht einmal auf einen Henker! Das machen wir jetzt alles selbst!" Er zuckte mit den Schultern.
"Wir haben an den Gouverneur geschrieben und um Hilfe gebeten, aber nie eine Antwort bekommen! Und irgendwie müssen wir uns ja vor euch Coyoten schützen! Wir werden es euch schon zeigen! Warte nur ab, Hombre! Aber das wirst du wohl nicht mehr erleben! Bald werden wir eine Truppe von Männern aus der ganzen Umgegend aufstellen und euch ein für allemal vertreiben!"
Corley begriff.
Hier herrschte ein regelrechter Krieg.
"Ich gehöre nicht dazu!", sagte Corley dann. "Ich gehöre nicht zu der Bande, die euch zu schaffen macht!"
"Feiger Lügner!", zischte Watkins.
Knurrend stand der großgewachsene, massige Mann auf und ging zu den Gitterstäben.
"Willst du, dass ich dir das austreibe, du Ratte!"
"Lass das!", rief Norris. "Du bekommst nur Ärger mit Justin! Hör' auf mich!"
Watkins zeigte seine Zähne und rüttelte einmal kräftig an den Metallstäben.
Dann ging er zurück zum Schreibtisch und entlud einen Teil seiner grenzenlosen Wut, indem er die flache Hand auf die Tischplatte donnern ließ.
Corley sah ein, dass es keinen Zweck haben würde, diese Männer überzeugen zu wollen. Man hatte ihnen allen zweifellos übel mitgespielt und jetzt waren sie blind vor Hass- und Rachegefühlen.
Ich werde auf Justin warten müssen, dachte Corley. Vielleicht konnte er bei dem eiskalt wirkenden grauen Wolf mehr erreichen.
Aber insgeheim wusste er, dass seine Chancen miserabel standen...
4
Es war gegen Abend, als der Vigilantenführer Justin und seine Leute in die Stadt zurückkehrten.
Offensichtlich ohne Erfolg, wenn man nach dem ging, was Corley von draußen an Gesprächsfetzen aufschnappen konnte. Wenig später war Justin dann auch schon im Office. Watkins und Norris hatte die Zeit mit Kartenspielen verbracht, aber als ihr Anführer jetzt eintrat, hörten sie sofort auf damit.
"Wir haben ihm nichts getan!", sagte Watkins. "So wie du gesagt hast, Justin!"
Aber der graue Wolf achtete überhaupt nicht auf ihn. Sein Blick war starr zur Zelle gerichtet. Er nahm beiläufig den Schlüssel vom Haken an der Wand und ging dann geradewegs zu den Gitterstäben.
Justin schloss auf, betrat die Zelle und baute sich breitbeinig vor dem am Boden liegenden Corley auf.
"Deine Komplizen sind uns entkommen!", zischte er.
"Es sind nicht meine Komplizen! Vielleicht werden Sie jetzt endlich mal vernünftig und hören mir zu!"
"Die Angst macht deine Zunge locker, Hombre!", versetzte Justin. "Aber mich kannst du nicht täuschen!" Und dann zog er das lange Bowie-Messer heraus, dass er am Gürtel trug.
Er trat zu Corley heran und forderte: "Ich will wissen, wohin sie geritten sind! Es gibt ein Versteck, irgendwo hinter der Grenze im Hochland. Dahin zieht ihr euch doch immer zurück, nicht wahr?"
Er beugte sich nieder und hielt Corley die blinkende Klinge unter die Nase. "Ich will wissen, wo es ist! Und ich werde dich so lange mit diesem Messer bearbeiten, bis du es mir gesagt hast! Und glaub mir! Ich werde nicht den Fehler machen, dich vorzeitig über den Jordan zu schicken!" In diesem Augenblick ging die Tür des Sheriff-Office auf und eine junge Frau kam herein.
Sie hatte langes, braunes Haar, dass ihr bis weit über die Schultern fiel.
"Dad!"
Sie erstarrte mitten in der Bewegung und sah zu Justin in die Zelle. Und Justin wirbelte herum.
"Eliza, das hier ist nichts für dich!"
"Dad, ich habe euch durch das Fenster zurückkommen sehen..."
"Geh jetzt!"
Aber Eliza ging nicht. Sie kam näher an die Zelle heran und schüttelte dann fassungslos den Kopf.
"Ich kann kaum glauben, was ich sehe!"
"Du verstehst nichts davon, Kind! Geh jetzt endlich!"
"Dad, du und die anderen Vigilanten, ihr seid angetreten, um dem Gesetz wieder zu Geltung zu verhelfen! Um dem Terror dieser Banditen endlich zu begegnen, weil es sonst niemand tut und die, deren Job das eigentlich wäre, zu schwach dazu sind! Aber das, was du jetzt tun willst, hat damit nichts zu tun!"
Jetzt richtete sich Justin wieder auf.
"So sollte eine Tochter nicht mit ihrem Vater reden!", rief er. Aber Eliza schien dieselbe Hartnäckigkeit und Durchsetzungskraft wie ihr Vater zu haben.
Und so versetzte sie eisig: "...und ein Mann, der das Recht durchsetzen will, sollte das nicht mit den Methoden derer tun, die er bekämpft!"
Sie deutete auf Corley. "Ich weiß nicht, was dieser Mann getan hat, aber wenn du ihn folterst, weiß ich nicht mehr, wo der Unterschied zwischen euch Vigilanten und den Männern ist, die Dan McQuire so lange quälten, bis er ihnen alle seine Geldverstecke verriet!"
Das saß.
Justin atmete tief durch und schnappte nach Luft. Es dauerte eine Weile, bis er wieder sprechen konnte. Als er dann seine Lippen bewegte, war sein Tonfall ein ganz anderer geworden.
"Du hast recht!", sagte er. Er beugte sich zu Corley und schnitt ihm die Fesseln durch. Dann steckte er sein Bowie-Messer weg. Seine Augen funkelten Corley kalt an, als dieser sich erhob.
"Hören Sie, Mister Justin...", begann Corley. Aber der graue Wolf schnitt ihm rau das Wort ab.
"Nein, Sie hören mir erst einmal zu! Ich werde Sie nicht um Verzeihung bitten! Aber meine Tochter hat recht, dass muss ich eingestehen. Ich könnte mir selbst nicht mehr in den Spiegel blicken, ohne vor mir auszuspucken. Euer Versteck werden wir auch so eines Tages ausräuchern, denn unsere Truppe hat immer mehr Zulauf!" Er atmete hörbar aus. "Jetzt habt ihr den Geldtransport für die Bank überfallen! Das bedeutet, dass viele Cowboys in der Umgegend keinen Lohn bekommen werden! Dasselbe gilt für die Arbeiter in O'Bryans Mine! Viele von ihnen werden sich jetzt uns anschließen!"
"Mister Justin, ich war zufällig dort, wo der Überfall stattgefunden hat! Als ich dort eintraf, war schon alles geschehen. Und wenig später kam dann Ihre Meute!"
"Pah!"
"Ich weiß, dass das in meiner Lage jetzt wie eine schwache Ausrede klingt. Aber es ist die Wahrheit! Überlegen Sie doch mal: Weshalb hätte ich am Tatort bleiben sollen, während meine angeblichen Komplizen mit der Beute längst über alle Berge waren? Wo läge da der Sinn?"
"Hören Sie auf! Wir haben Sie überrascht. Was weiß ich, warum Sie noch da waren, als wir kamen! Vielleicht waren Sie einfach zu gierig und wollten die Leichen bis zum letzten ausfleddern!" Justin machte eine unbestimmte Geste. "Die Sache ist klar und eindeutig! Sie werden hängen, Mister! Aber ich bürge dafür, dass Sie ein faires Verfahren bekommen!" Corley verzog das Gesicht.
"Vor einem Vigilanten-Gericht!"
"Ja."
Corley atmete tief durch.
Es war ein Aufschub, eine Galgenfrist im ursprünglichsten Sinn des Wortes. Mehr nicht. Das Urteil dieses 'Gerichtes', in dem Justin vermutlich gleichzeitig die Rollen von Ankläger und Richter spielen würde, stand schon jetzt fest. Schuldig und Tod durch den Strang.
Endlich glaubten die Menschen dieser Stadt, einen von jener Banditenhorde gefasst zu haben, die die Gegend in Schrecken versetzt hatte.
Und diesen einen würden sie nun auch für all die anderen zahlen lassen...
Es war nur allzu menschlich und Corley verstand die Beweggründe der Stadtleute auch. Aber ihm war auf der anderen Seite nicht wohl dabei, dass sein Leben davon abhing, ob diese Leute wieder zur Vernunft zurückfanden.
5
Während der Nacht schlief Corley tief und fest auf der harten Pritsche, die in der Zelle stand. Als er am Morgen erwachte, hatte er sich weitgehend von den Strapazen und Misshandlungen des Vortages erholt.
Die ganze Nacht über war ständig mindestens ein Posten im Office gewesen, um auf den Gefangenen aufzupassen. Sie hatten sich im Rhythmus mehrere Stunden abgelöst, aber von alledem hatte Corley nichts mitbekommen.
Aber als er er am Morgen erwachte, war er froh, nicht mehr in Watkins giftiges Gesicht blicken zu müssen.
Den Mann, der jetzt am Tisch saß, hatte er bisher noch nicht gesehen.
Sie sind sehr vorsichtig!, dachte Corley.
Selbst wenn er in diesem Augenblick den Zellenschlüssel in den Fingern gehabt hätte, hätte er immer noch an dem Posten vorbeigemusst. Und dessen Winchestermündung zeigte genau in seine Richtung.
Der Gefangene war aufgestanden und hielt jetzt die Gitterstäbe in den Händen. Der Posten schien Corleys Gedanken erraten zu haben. Er grinste.
"Schlag dir jeden Gedanken an Flucht aus dem Kopf, hörst du? Meine Kugel ist in jedem Fall schneller als du!" Corley lächelte müde.
"Keine Sorge, Hombre! So verhungert bin ich noch nicht, dass ich dünn genug wäre, um mich durch das Gitter quetschen zu können!"
Der Posten lachte gehässig.
"Du bekommst deine Henkersmahlszeit noch! Verlass dich drauf!"
Mit dem Kerl scheint man reden zu können!, dachte Corley. Und es konnte nicht schaden, noch etwas mehr über die Lage hier zu erfahren.
"Sag mal, was ist dieser Justin eigentlich für ein Mann?"
"Ihm gehört der Drugstore und ein Saloon, dessen Leitung er aber seiner Tochter überlassen hat!", antwortete der Posten ohne viel nachzudenken. "Sein Geschäft ging immer gut, schließlich hat er nicht viel Konkurrenz in der Gegend. Aber seit hier die Hölle los ist, hat er Schwierigkeiten, überhaupt noch Warenlieferungen durchzubekommen!"
"Schätze, er hat eine Menge Einfluss hier, nicht wahr?" Der Posten nickte.
"Aye, das hat er! Er ist fest entschlossen, diese Stadt wieder einer besseren Zeit entgegenzuführen! Und ich bin überzeugt davon, dass er es auch schaffen kann! Ich bewundere ihn..."
Etwas später kam dann Eliza Justin ins Office, um etwas zu Essen für den Gefangenen zu bringen.
Der Posten kam mit der Winchester herbei und scheuchte Corley in eine Ecke, bevor er kurz die Gittertür öffnete und das Frühstück hindurchschob.
Dann fiel die Tür wieder ins Schloss, aber Eliza Justin drehte sich nicht zur Tür um, sondern hielt den Blick geradewegs auf den Gefangenen gerichtet.
Sie trat etwas heran.
"Meine Saloonküche kann sonst mehr bieten, aber seit einiger Zeit sind bestimmte Dinge knapp in Dutton geworden...", meinte sie nicht ohne bissigen Unterton.
"Ist schon in Ordnung", meinte Corley.
"Sind Sie wirklich unschuldig, Mister?" Sie blickte ihn prüfend an.
Corley sah auf und nickte.
"Ja. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken!" Sie hob die Augenbrauen.
"Wofür?"
"Für das, was Sie gestern getan haben, Ma'am."
"Ja, Sie sähen jetzt sicher nicht mehr so gut aus, wenn Dad Sie mit dem Messer bearbeitet hätte! Aber bedanken Sie sich nicht bei mir. Ich habe es nicht für Sie getan!" Corley zuckte mit den Schultern.
"Mir ist gleichgültig, weshalb Sie es getan haben, Ma'am."
"Man wird Sie heute vor Gericht stellen, Mister! Bei mir im Saloon! Es wird eine Geschworenen-Jury geben und Sie werden Gelegenheit haben, sich zu verteidigen..."
"Zu gütig!"
"Ja, allerdings, das ist es! Denn Sie bekommen eine faire Chance! Die Leute auf der McQuire-Ranch hatten das nicht!"
6
Eliza Justin war schon seit einiger Zeit gegangen, da hörte Corley plötzlich Lärm von draußen. Ein paar raue Männerstimmen waren da zu hören, ein Pferdewagen schien vorzufahren. Und dann hörte er, wie genagelt wurde... Corley brauchte nicht zu dem hohen Gitterfenster zu gehen, und sich an den Stäben hochzuziehen, um hinauszublicken. Er wusste auch so, was da jetzt vor sich ging. Sie errichteten einen Galgen.
Und das bedeutete, dass der Ausgang dieses 'fairen' Prozesses schon feststand, bevor er überhaupt begonnen hatte. Irgendwann in den frühen Nachmittagsstunden, kamen sie dann, um Corley in Eliza Justins Saloon zu bringen. Justin selbst führte die Männer an. Insgesamt waren es fünf Bewaffnete.
Sie kamen zu ihm in die Zelle.
"Hände ausstrecken!", bellte Justin und Corley gehorchte. Es machte 'klick!' und der Vigilantenführer hatte ihm ein paar rostige Handschellen angelegt. Dann packte ihn an jedem Oberarm einer der Bewaffneten.
Corley wurde hinaus ins Freie geführt.
Der Gefangene ließ den Blick kurz die Main Street entlangschweifen. Er sah die Bank, das Hotel, den Drugstore und natürlich ein paar Saloons.
Aber nur vor einem standen jetzt Pferde.
Mindestens zwei Dutzend - und das war für diese Tageszeit ungewöhnlich viel.
Kein Zweifel, dort musste die Verhandlung angesetzt sein. Und das wollte sich niemand in Dutton entgehen lassen. Noch immer strömten Bürger dorthin. Und diejenigen, die den Zug mit dem Gefangen erblickten, blieben stehen und glotzten wie gebannt zu ihm herüber.
Schließlich war der Zug vor dem Saloon angekommen. Drinnen, hinter den brusthohen Schwingtüren, schien es brechend voll zu sein.
Corley sah die flüchtig festgemachten gesattelten Pferde und dachte: Vielleicht ist das meine letzte Chance!
Diese Chance war nur verschwindend klein.
Die Bewaffneten um ihn herum würden sofort schießen, wenn es ihm gelang, sich von den beiden Kerlen neben sich loszureißen.
Und selbst wenn er es dann schaffte, mit seinen gefesselten Händen auf ein Pferd zu kommen, bedeutete das noch lange nicht, dass er es geschafft hatte.
Eine gnadenlose Meute würde ihn hetzen und seine Flucht als Schuldeingeständnis werten.
Dennoch musste er es versuchen.
Nur einen Augenblick hatte Jeff Corley Zeit, um sich das durch den Kopf gehen zu lassen.
Denn wenn er erst einmal durch die Schwingtüren geführt worden war, war er verloren.
Die Verhandlung würde nicht lange dauern und wenn man ihn dann wieder hinausbringen würde, dann ging es vermutlich auf direktem Weg zum Galgen...
Er traf seine Entscheidung.
Urplötzlich schleuderte er dem links von ihm stehenden Wächter seine zusammengeketteten Fäuste ins Gesicht. Dann ließ er sich nach rechts fallen und riss seinen zweiten Bewacher mit sich zu Boden.
Blitzschnell rollte Corley sich dann am Boden herum, während bereits der Sand durch Schüsse aufgepeitscht wurde. Aber Corley hatte genau gewusst, was er tat.
Bevor die Schüsse fielen, war er bereits unter die Pferdebäuche gerollt. Durch die Ballerei gerieten die Tiere in Unruhe. Sie wieherten und rissen an den Zügeln. Corley musste den Hufen so gut es ging ausweichen.
"Los, packt ihn, Männer!", hörte Corley Justin rufen. Ein riesiger Tumult war entstanden. Pferde hatten sich losgerissen und liefen völlig kopflos durch die Gegend, während die umherstehenden Vigilanten ihnen zum Teil ausweichen mussten.
Das alles hatte nicht länger als einen Augenblick gedauert und nun war Corley auch schon wieder auf den Beinen. Mit den zusammengeketteten Händen griff er nach dem Sattelknauf eines Pferdes und schwang sich halb hinauf.
Dann trieb er das Tier nach vorn und preschte die Main Street entlang, während er haarscharf über seinem Rücken spüren konnte, wie die Kugeln von Justin und seinen Leuten knapp über ihn hinwegschossen.
So dicht es ging presste er sich an den Pferderücken, während ihm ein wahrer Geschosshagel hinterdreingeschickt wurde. Einige von Justins Männern hatten sich ebenfalls Pferde geangelt und machten sich an die Verfolgung. Schuss um Schuss ließen sie hinter ihm herkrachen, als gelte es, einer ganzen Armee Widerstand zu leisten.
Die meisten waren wirklich lausige Schützen und das war Corleys Glück, denn sonst wäre er schier von Bleikugeln durchsiebt worden.
Aber dann erwischte es den flüchtenden Reiter doch. Ein höllischer Schmerz durchzuckte ihn plötzlich. Dieser Schmerz ging von der Seite aus und durchflutete von dort aus in einem furchtbaren Schauer seinen ganzen Körper. Corley biss die Zähne zusammen und trieb das Pferd zu einem noch wilderen Galopp an.
Nur kurze Zeit verstrich, da hatte Corley das Ende der Main Street erreicht, und damit das Ende von Dutton. Er hatte kaum eine Ahnung, wohin er ritt, aber das war im Moment auch zweitrangig.
Hauptsache war erst einmal, etwas Abstand zwischen sich und die Meute zu legen, die hinter ihm her hetzte.
Corley hatte Glück im Unglück gehabt. Das Pferd, auf dem er saß war ein prachtvoller Rappen, der gut in Schuss war. Und vor allem auch schnell.
Das war jetzt das Wichtigste.
Mit schmerzverzerrtem Gesicht drehte er sich kurz im Sattel herum und sah die Schar seiner Verfolger. Sie kamen nicht als geordneter Verband, sondern in einem wilden, zerfransten Haufen.
Einige hatten wohl erst ihre Pferde wieder einfangen und unter Kontrolle bringen müssen.
Aber sie waren jetzt auf dem Weg. Ungefähr ein Dutzend Bewaffnete waren es. Und an ihrer Spitze ritt mit grimmigem Gesicht ihr Anführer Justin.
Corley wusste, dass diese Männer keine Gnade kennen würden, wenn er ihnen jetzt noch einmal in die Hände fiel. Vermutlich würde es dann auch nicht einmal mehr den Aufschub eines - wenn auch noch so abgekarteten - Verfahrens geben.
Ein Mann, der zu fliehen versuchte, musste schließlich schuldig sein...
Die Meute würde ihn sofort töten.
Jeff Corley wusste, dass er nur diese eine Chance hatte und er wollte sie um jeden Preis nutzen. Eine Zweite würde es nicht geben.
Er keuchte.
Der Schmerz, den die Wunde an seiner Seite verursachte, machte ihm sehr zu schaffen. Aber es war nicht nur der höllische Schmerz...
Es war zunehmend auch eine tödliche Schwäche, die sich in seinem Körper auszubreiten begann...
Weiter! Nur weiter!, hämmerte es in ihm.
Er nahm vage wahr, dass er in südöstliche Richtung ritt dem Stand der Sonne nach zu urteilen. Diese Richtung war so gut wie jede andere.
Noch lagen dünn mit braunem Gras bewachsene Hügel vor ihm, aber es konnte nicht allzulange dauern, dann würde er in karges Hochland kommen - etwa in jene Gegend, in der der Überfall auf den Geldtransport stattgefunden hatte. Wenn er im Hochland war, hatte er bessere Karten. Dort gab es mehr Möglichkeiten, sich zu verstecken.
Corley blinzelte zum Horizont, wo jetzt die ersten Anhöhen auftauchten.
7
Mit Befriedigung sah Corley, dass die Schar seiner Verfolger mehr und mehr auseinanderfiel. Die Pferde waren unterschiedlich schnell und ausdauernd und so blieben einige langsam aber sicher zurück.
Allerdings blieben noch immer genug Wölfe übrig, die sich an seine Fährte geheftet hatten.
Aber sie würden es jetzt schwerer haben, denn jetzt ging die Jagd ins Hochland hinein.
Vor ihm breitete sich nun eine kahle, bergige Ödnis aus, soweit das Auge reichte.
Felsmassive ragten schroff in die Höhe.
Unterdessen war Corley direkt in dieses karge Land hinein geritten. Von seinen Verfolgern konnte er bald nirgends mehr etwas sehen.
Das war gut so.
Er war jetzt erst einmal unsichtbar für sie und es würde für Justins Männer nicht leicht sein, ihn in diesem felsigen Labyrinth wieder aufzufinden.
Corley war allerdings klug genug, um zu wissen, dass das noch lange nicht bedeutete, dass er die Meute abgehängt hatte. Seine Spuren waren auf dem trockenen Boden wie ein offenes Buch für die Männer, die ihn verfolgten.
Zwischendurch nutzte er die Gelegenheit zu einer kurzen Pause, um sich um seine Wunde zu kümmern. Seine Seite war voller Blut.
Die Wunde sah böse aus und er konnte nur hoffen, dass sie sich nicht entzündete. Wenn es nur eine Fleischwunde war, hatte er eine gute Chance, aber wenn dort noch eine Kugel steckte, würde er bald jemanden finden müssen, der sie ihm herausschnitt...
Und dann waren da noch seine Hände, die noch immer in Handschellen steckten... Auch in diesem Punkt musste er jetzt etwas unternehmen.
Im Scubbard des Pferdes, dass Corley an sich gebracht hatte, steckte ein Winchester-Gewehr, aber mit nach vorn zusammengefesselten Händen ließ sich damit nicht sehr viel anfangen...
Corley ließ wachsam den Blick schweifen, stieg aus dem Sattel und zog dann das Gewehr mit beiden Händen aus dem Futteral.
Wenn es doch nur ein Revolver gewesen wäre!, fluchte er innerlich. Es wäre eine Kleinigkeit gewesen ihn trotz der zusammengebundenen Hände so hinzufingern, dass man die Handschellen mit einer Kugel hätte trennen können. Aber bei einem Gewehr war das etwas anderes.
Der Lauf war einfach zu lang - selbst bei einem Karabiner. Er konnte seine Hände nicht gleichzeitig vor der Laufmündung und am Abzug haben. Das war ein Ding der Unmöglichkeit...
Aber Corley hatte eine Idee.
Er band erst einmal das Pferd an einem vertrockneten Dorngebüsch gut fest.
Dann setzte er sich auf den Boden und lud die Waffe durch, die er dann mit dem Kolben aufstützte.
Das Mittelstück der Handschellen presste er vor Mündung, während er gleichzeitig mit dem Sporenrad des rechten Stiefels den Abzug zu betätigen versuchte.
Es krachte.
Die Waffe fiel mit rauchendem Lauf in den Sand. Corleys Hände waren frei.
Die Schellen um seine Handgelenke würden ihn jetzt kaum noch behindern.
Erst wenn er wieder mit Menschen zusammentraf, würde er eine Erklärung für seine ausgefallenen Armreifen finden müssen...
Aber jetzt hatte er näherliegende Sorgen.
Den Schuss hatte man weithin hören können. Das Krachen hallte mehrfach zwischen den Felsen wider, bis es sich schließlich verlor.
Es würde nicht leicht für Justin und seine Leute sein, die Herkunft des Geräusches auch nur ungefähr zu lokalisieren. Aber sicher hatte sie der Lärm jetzt aufgeschreckt. Sie wussten, dass der Mann, den sie suchten, irgendwo in der Nähe war und würden um so intensiver nach ihm Ausschau halten.
Corley schwang sich wieder in den Sattel, nachdem er das Winchestermagazin überprüft hatte.
Es war bis zur letzten Patrone geladen gewesen. Zwölf Schuss also - jetzt waren es noch elf.
Elf Kugeln!
Wenn die Kerle ihn wirklich aufstöberten, war das nicht viel.
8
Cole Justin beugte sich nieder und blickte angestrengt zu Boden. Mit der Hand berührte er den Sand und richtete sich dann wieder zu voller Größe auf.
"Du hattest recht, Watkins! Es muss ihn erwischt haben! Er hat Blut verloren!"
Watkins grinste zynisch.
"Dann wird er nicht weit kommen!"
Je weiter sie ins Hochland vorgedrungen waren, desto schwieriger war die Verfolgung geworden. So hatten dann auch die langsameren Reiter Justin und seine Vorhut nach und nach einholen können.
Justin seufzte und schwang sich wieder in den Sattel.
"Vorwärts, Männer! Wir müssen ihm auf den Fersen bleiben!"
"Was machen wir mit ihm, wenn wir ihn kriegen?", erkundigte sich Hiram, der Mann, dessen Verlobte bei dem Überfall auf die McQuire-Ranch umgekommen war.
Justin wandte sich im Sattel zu den Männern um. Ungefähr ein Dutzend waren sie und auf Grund des schnellen Aufbruchs ziemlich willkürlich zusammengewürfelt.
Einige hatten nicht einmal ihr eigenes Pferd unter dem Hintern, sondern einfach nach dem nächstbesten Gaul gegriffen.
Von Vorräten an Wasser, Proviant und Munition, wie sie für eine längere Jagd notwendig waren, konnte natürlich keinerlei Rede sein.
Bis jetzt hatte Justin seinen Leuten noch nichts von dem Plan gesagt, den er insgeheim hegte.
Aber jetzt war die Zeit reif.
Justin hob die Hand.
"Hört zu Männer! Ich sag euch, was wir tun werden!" Der Vigilantenführer kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen und ließ den Blick von einem zum anderen gleiten. Die Männer runzelten die Stirn.
"Was meinst du damit?", erkundigte Hiram mit deutlichem Misstrauen in der Stimme.
"Wir werden ihm weiter auf den Fersen bleiben, aber ich halte es für klüger, ihn nicht einzufangen!" Hiram verzog das Gesicht zu einer grimmigen Maske.
"Das ist nicht dein Ernst! Justin, das kann auf keinen Fall dein Ernst sein! Diesen Mörder, diesen Bastard..." Unter den Männern entstand ein bedrohliches Gemurmel und Justin merkte, dass das Ganze in eine falsche Richtung lief. Er hob erneut die Hand.
"Hört mir zu!", rief er.
Und sie schwiegen.
Noch hatte der graue Wolf sie alle im Griff.
Justin stellte das nicht ohne deutliche Erleichterung fest und atmete tief durch.
"Warum willst du diesen Hund schützen!", rief Hiram. Und auch Watkins meldete sich zu Wort.
"Ja, warum?"
"Ich will ihn nicht schützen. Aber wenn wir ihm nur folgen, ohne ihn einzufangen, dann könnte er uns direkt zum Nest dieser Bande führen!"
"Justin! Wir sind nicht dafür ausgerüstet! Wir hätten mehr Männer zusammentrommeln sollen! Wir..." Es war Watkins der das gesagt hatte und nun plötzlich abbrach. Er schüttelte energisch den Kopf.
"Ich weiß!", sagte Justin. "Aber es ist eine einmalige Chance. Dieser verwundete Coyote wird versuchen, auf schnellstem Weg zu seinem Rudel zu kommen, um sich die Wunden lecken zu lassen. Wenn er es trotz seiner Verletzung schafft - um so besser für uns. Und wenn nicht, dann brauchen wir darüber auch keine Träne zu vergießen!"
Die Männer sagten nichts.
Sie schienen es zu schlucken und irgendwann würden sie auch sicher begreifen, dass es so am besten war.
Justin zog sich den Hut tiefer ins Gesicht und blickte nach vorne.
Er deutete mit der Linken.
"Lassen wir die Spur nicht kaltwerden, Hombres!"
9
Die Dämmerung brach herein und Corley wusste, dass es bald sehr dunkel werden würde.
Schweiß stand ihm auf der Stirn.
Er hing schlaff im Sattel und hatte Mühe, sich überhaupt dort zu halten. Er fror erbärmlich, obwohl es noch immer warm war. Außerdem war ihm schwindelig.
Kein Zweifel, er hatte Wundfieber.
Es steckte ihm wohl doch eine Bleikugel im Leib und wenn er niemanden fand, der sie ihm herausschnitt, dann konnte er nur auf ein Wunder hoffen.
In der Rechten hielt er das Winchester-Gewehr fest umklammert. So gut wie möglich hielt er die Umgegend im Auge, während sein Pferd müde voranschritt.
Corley wusste dass er sich der schleichenden Agonie nicht ausliefern durfte. Er fühlte seine Schwäche, aber noch lebte er. Die Versuchung aufzugeben und sich einfach niederzulegen war groß.
Alles schien sinnlos und ohne Aussicht auf Erfolg zu sein. Aber Corley wollte nicht aufgeben.
Solange er noch einen klaren Gedanken im Kopf hatte, wollte er alles versuchen... Justins Horde sollte ihn nicht bekommen!
Als die Dämmerung schließlich langsam aber sicher in pechschwarze Finsternis überzugehen begann, dachte er zunächst daran, sich an einer geschützten Stelle einen Lagerplatz zu suchen.
Doch dann entschied er sich anders.
Nein, dachte er, wenn ich jetzt aus dem Sattel steige, werde ich nie wieder dort hinaufkommen! Dann ist es zu Ende!
Corley entschloss sich, die Nacht über im Sattel zu bleiben. Es würde nicht schnell vorangehen und es war auch nicht ausgeschlossen, dass er sich in diesen Bergen hoffnungslos verirrte.
Doch mit Hilfe der Sterne hoffte er, ungefähr die Richtung beizubehalten, um seinen Verfolgern wenigstens nicht geradewegs in die Arme zu laufen.
Corley beugte sich ächzend nieder und steckte die Winchester in den Sattelschuh.
Dann langte er zu den Satteltaschen, um die er sich bisher nicht gekümmert hatte. Es war einiger nutzloser Krempel darin, aber dann fühlte er dort auch etwas Hartes. Eine Flasche!
Corley zog sie heraus. Es war eine Whisky-Flasche, wenn auch nicht einmal halbvoll.
Aber es war immer noch besser als nichts! Mit dem Whisky würde er er die Wunde etwas auswaschen können. Heilen würde ihn das nicht.
Aber vielleicht würde es dann wenigstens nicht noch schlimmer werden!
10
Es wurde eine lange und unangenehme Nacht für Jeff Corley. Manchmal war er nahe daran, in die Bewusstlosigkeit hinüberzudämmern.
Aber er tat alles, um das zu verhindern.
Die Eiseskälte, die in der Nacht herrschte, half kräftig dabei mit, dass er bei Sinnen blieb.
Corley verlor das Gefühl für Zeit. Die Nacht schien kein Ende zu haben.
Stunde um Stunde kroch langsam dahin.
Von seiner Umgebung nahm der einsame Reiter kaum noch etwas wahr und so entging ihm auch, dass die karge Landschaft langsam in ein vegetationsreicheres Gebiet überging. Als die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne sich über den Horizont stahlen, hatte sein Pferd Gras unter den Hufen. Corley hing vornübergebeugt im Sattel.
Vage spürte er, wie der Gaul einfach einen Huf vor den anderen setzte. Von irgendwo her kam dann plötzlich das Geräusch von fließendem Wasser.
Es war das letzte, was Corley wahrnahm, bevor es schwarz vor seinen Augen wurde.
11
Barry Woodcock trat an die Reling der Colorado-Queen und blickte hinaus in den Nebel, der vom Fluss aufstieg. Woodcock und seine Mannschaft hatten das Flussschiff die Nacht über an einer geeigneten Stelle festgemacht, um am folgenden Tag den Colorado River weiter flussabwärts zu fahren.
Weiter nach Süden, bis nach Mexiko hinein.
Aber das Stück, dass Woodcock und seine Leute als nächstes vor sich hatten, würde nicht ganz einfach werden. Da war einerseits eine gefährliche Banditen-Horde, die die vor ihnen liegende Gegend in Atem hielt und von der sie weiter stromaufwärts schon schlimme Geschichten gehört hatten. Auf der anderen Seite gab es da noch einige gefährliche Untiefen, die umschifft werden mussten.
Aber Woodcock kannte den Colorado-River genausogut wie seinen Raddampfer. Dutzendfach war er schon den Colorado hinauf und hinunter gefahren, oft sogar bis über die Mündung hinaus und ein Stück die Küste von Sonora entlang. Sein Hauptgeschäft war der Warentransport, aber er handelte mitunter auch auf eigene Rechnung mit allem, womit sich Dollars oder Pesos machen ließen.
Woodcocks Augen suchten einen Augenblick und hatten dann gefunden, was sie vermisst hatten. Ein Stück weiter die Reling entlang lag ein Mann in eine Decke gehüllt, den Stetson über das Gesicht gezogen.
Er hatte seine Winchester im Arm wie eine Mutter ihr Baby und schnarchte laut vor sich hin.
"Hey, Randy!", tönte Woodcocks raue, kehlige Stimme. Der Mann am Boden schreckte hoch.
"Was...?"
"Ich dachte, du würdest Wache halten! Warst du nicht als letzter an der Reihe?"
Randy rappelte sich hoch.
"Bin nur kurz eingenickt, Boss!"
"Ja, ja... Jetzt ist es ohnehin egal. Wir müssen aufbrechen!" Woodcock war wirklich ein wenig ärgerlich, denn die Banditen, die in diesem Landstrich ihr Unwesen trieben, würden ihnen eine Unaufmerksamkeit nicht verzeihen..."
"Wir müssen verdammt nochmal auf der Hut sein, Randy! Wenn nur die Hälfte von dem wahr ist, was sich die Leute oben in Briggston von diesen Halunken erzählen, dann müssen wir sehr aufpassen! Ein Flussschiff mit voller Ladung! Das werden sich diese Hunde nicht entgehen lassen, wenn wir ihnen eine Gelegenheit lassen..."
"Ich weiß, ich weiß! Es kommt nicht wieder vor!"
"Schon gut, Randy!"
12
Wenig später glitt die Colorado-Queen durch den morgendlichen Nebel flussabwärts. Nicht mehr allzu lange und die Sonne würde es geschafft haben, den Nebel zu vertreiben. Und dann würde es wieder ein heißer Tag mit wolkenlosem Himmel werden.
Der Wasserstand des Colorado war niedrig zur Zeit - und das war einer der Faktoren, der die Sache gefährlich machte. Aber Woodcock war ein erfahrener Schiffer.
Woodcock stand am Steuer.
Fünf Menschen lebten an Bord des Flussschiffes. Außer Woodcock und Randy waren das noch zwei weitere Angestellte, sowie die junge Bellinda. Bellinda war in den letzten Jahren eine junge Frau geworden.
Woodcock hatte ihr einst ihren Namen gegeben. Sie war noch ein Säugling gewesen.
Der Schiffer hatte sie wie eine Tochter aufgezogen, nachdem er sie in einem von den Yumas geplünderten Dorf gefunden hatte.
Das war vor vielen Jahren, drüben in Mexiko gewesen, auf der anderen Seite der Grenze. Und es war bis heute der einzige Hinweis auf Bellindas Herkunft.
Sie wusste nicht, wer ihre Eltern waren, denn so weit reichten ihre Erinnerungen nicht. Und wie es schien, würde es ihr auch nie jemand sagen können.
Bellinda stand im Augenblick an der Reling und blickte hinaus zum Ufer. Der Colorado River trennte an dieser Stelle Arizona und Mexiko voneinander.
Bellinda blickte nach Arizona.
Auch sie hatte ihre Aufgaben hier an Bord, genauso wie die Männer. Aber im Moment gab es nichts zu tun.
Woodcock hatte die Maschinen nicht anlaufen lassen, sondern ließ die Queen einfach mit der Strömung flussabwärts treiben. Das ging nicht so schnell, als wenn sich das große Schaufelrad in Bewegung setzte, aber erstens sparte es Brennstoff und zweitens gab es keine meilenweit sichtbare Rauchfahne, die aus dem Schornstein hochstieg.
So etwas würde nur die Gier von zweibeinigen Coyoten erregen. Und die Queen war schließlich kein Schlachtschiff.
"Dad!", rief Bellinda plötzlich.
Ihr schlanker Arm deutete hinüber zum Arizona-Ufer, an dem sich noch ein paar Nebel-Reste hielten.
Woodcock legte die Stirn in Falten.
"Was ist denn, Bellinda?"
"Dad, Sieh doch mal! Da ist ein Reiter am Ufer! Er scheint verletzt zu sein."
Und jetzt sah es auch Woodcock.
Ein Mann hing schlaff auf einem Pferd, das seinerseits den Kopf zum Flusswasser hinabgeneigt hatte, um zu trinken.
"Weiß der Teufel, was dort geschehen ist! Sieht aus wie ein Toter!", meinte Woodcock.
"Der Mann ist vielleicht auch nur verletzt! Wir müssen ihm helfen!"
"Ich will keinen Ärger!", meinte Woodcock mürrisch. "Wer weiß, was dahintersteckt!"
"Es ist weit und breit niemand zu sehen! Ich bitte dich, lass uns nach ihm schauen!"
"Ich bin dagegen!"
"Wir können ihn nicht sich selbst überlassen! Nicht, wenn er noch lebt! Das wäre unmenschlich!"
"Also gut! Du sollst deinen Willen haben, Bellinda! Ich werde zum Ufer drehen! Randy! Wir legen gleich an!"
13
Es dauerte nicht lange und Woodcock hatte die Colorado Queen an eine Stelle am Ufer gelenkt, die tief genug für das Schiff war.
Randy und ein zweiter Mann, ein Schwarzer, sprangen an Land und hielten die Queen in dicken Tauen. Langsam legte sich sich das Flussschiff herum und krengte gegen die Uferböschung, von der ein Stück herunterbrach.
Wenn im Winter die Schmelzwässer den Colorado anschwellen ließen, dann lag die gesamte Uferregion unter Wasser. Jetzt kam auch Bellinda an Land. Ihr folgte Woodcocks dritter Mann, seiner Kleidung und seinem Akzent nach ein Mexikaner.
Bellinda erreichte den schlaff im Sattel hängenden Reiter als erste, der Mexikaner folgte bald nach.
Die junge Frau zog das Gesicht des Mannes etwas hoch und fühlte nach dem Puls an seiner Halsschlagader.
"Lebt er noch?", fragte der Mexikaner. Bellinda nickte.
"Ja, Aureliano! Er lebt! Er ist schwer verletzt, wie ich vermutet hatte. Wir müssen ihm helfen!"
Aureliano schob sich seinen mexikanischen Sombrero in den Nacken und strich sich dann mit den Fingern über seinen dünnen Oberlippenbart.
"Nicht so voreilig, Bellinda! Sieh mal auf seine Hände!" Jetzt sah auch Bellinda, was der Mexikaner meinte.
"Handschellen!"
"Richtig! Wahrscheinlich ein ausgebrochener Sträfling! Wir werden uns nur Ärger einhandeln, wenn wir ihn mitnehmen!"
"Das ist nicht sicher!", meinte Bellinda. "Außerdem wird er sterben, wenn wir ihm nicht helfen."
"Wahrscheinlich wird er sowieso sterben!", erwiderte Aureliano kalt.
Bellinda legte ihre Hand an den Sattel.
"Und wenn schon! Dann werden wir immerhin seine Sachen für gutes Geld verkaufen können!"
"Das Pferd können wir nicht mitnehmen!"
"Aber den Sattel und die Winchester." Bellinda neigte den Kopf zur Seite. "Komm, fass an, Hombre!"
14
Als Jeff Corley zum erstenmal erwachte, war es nur für ganz kurze Zeit. Ein Auflackern seines Bewusstseins sozusagen. Er sah nicht viel, aber es machte ihm den Anschein, als ob er in einem Bett lag.
Aber das musste reine Einbildung sein.
Es konnte nicht wahr sein...
Außerdem war da noch die schwache Erinnerung an wirre Fieberträume, die ihn geschüttelt hatten.
Und dann war es wieder schwarz und finster vor seinen Augen. Er fiel zurück in die Bewusstlosigkeit. Als Corley dann zum zweiten Mal erwachte, hatte er nicht die geringste Ahnung, wie viel Zeit vergangen war.
Er schlug die Augen auf und blinzelte. Durch ein rundes Fenster fiel ziemlich hell das Tageslicht ein.
Das erste, was er dann wirklich klar erkennen konnte, war das feingeschnittene Gesicht einer jungen Frau. Sie war dunkelhaarig und hatte große sprechende Augen, mit denen sie ihn aufmerksam musterte.
"Du bist wach?", fragte sie.
Corley nickte schwach mit dem Kopf. Er hörte ein Knarren und dann glaubte er, dass das Bett, in dem er lag, zu schwanken begonnen hatte.
Das muss am Fieber liegen, schoss es ihm durch den Kopf.
"Wo bin ich?"
"Auf der Colorado-Queen, dem Schiff meines Dads!", war die prompte Antwort.
Corley wollte sich aufrichten, aber die junge Frau trat näher heran und drückte ihn zurück in die Kissen.
"Dafür ist es noch zu früh!"
"Aber..."
"Du hast viel durchgemacht, Fremder! Aber wenn du dich jetzt schön ausruhst, wirst du es wohl schaffen! Kenneth hat dir die Kugel aus der Seite herausgeholt. Du wirst wirst später alle kennenlernen."
Sie ging dann zu einem Krug mit Wasser, goss etwas davon in eine Blechtasse und war dann wieder bei dem Verletzten.
"Hier", sagte sie und hielt Corley die Tasse unter die Nase. "Trink etwas! Das wird dir guttun. Du hast viel Flüssigkeit verloren!" Corley hatte tatsächlich eine trockene Kehle. Er nahm die Tasse und führte sie zum Mund.
"In welche Richtung fährt das Schiff?", fragte Corley dann.
"Den Colorado River flussabwärts..."
"Also nach Mexiko!"
"Ja..."
Ihre Augen begegneten sich und es schien Corley so, als wäre da jetzt ein Quentchen Misstrauen in ihren Zügen abzulesen.
Corley hob die Hand und dann sah er, dass die Schellen von den Handgelenken entfernt waren.
Jetzt verstand er.
"Ein merkwürdiger Armschmuck, den du da hattest..."
"Jeff ist mein Name. Jeff Corley."
"Du bist vor dem Gesetz auf der Flucht, nicht wahr?"
"Nein, Miss, ganz so ist das nicht."
"Vielleicht erklärst du es mir!"
Und genau das tat Corley dann auch.
Er erzählte ihr so knapp wie möglich, was ihm geschehen war, während sie ihn aufmerksam musterte und förmlich an seinen Lippen hing.
Aber ob sie ihm auch glaubte, das war eine ganz andere Frage. Sie war eine kluge junge Frau, das hatte Corley ziemlich schnell gemerkt. Eine Frau, die sich kein X für ein U vormachen ließ.
Und Corley wusste nur zu gut, wie seine Geschichte für einen Unbeteiligten klingen musste. Er selbst hätte einem anderen diese Story vermutlich auch nicht abgenommen...
"Es gibt tatsächlich eine Bande, die seit einiger Zeit die Gegend unsicher macht. In den Flusshäfen redet man davon. Überall haben die Leute Angst!", meinte sie dann. "Vielleicht stimmt deine Geschichte... Aber könnte es nicht ebenso gut sein, dass du tatsächlich zu dieser Bande gehörst - so wie es die Vigilanten, die dir auf den Fersen sind, behauptet haben?"
"Warum hätte ich dir dann davon erzählen sollen?"
"Das ist allerdings wahr..."
Sie zuckte mit den Schultern.
"Wir werden sehen, was wird. Schlaf jetzt erst einmal, Amigo!"
Sie wandte sich zum Gehen, aber dann hielt Corleys Stimme sie zurück.
"Du hast mir noch nicht deinen Namen gesagt!" Sie drehte sich wieder um und warf dabei keck ihre Haare nach hinten.
"Ich heiße Bellinda!", sagte sie.
Dann ging sie endgültig und es dauerte nicht lange, da war Corley bereits wieder in einen tiefen Schlaf hinübergedämmert.
15
Als Corley das nächste Mal erwachte, fühlte er sich schon wesentlich besser.
Es war Nacht. Jedenfalls war alles dunkel und von draußen kam kein Sonnenlicht herein.
Corley setzte sich auf und betastete vorsichtig die Wunde an seiner Seite. Ein Verband war angelegt worden - und zwar ziemlich gut.
Er hörte jemanden schnarchen. Corley drehte sich zur Seite und sah die Umrisse einer Hängematte.
Corley stieg aus dem Bett und richtete sich zu voller Größe auf. Er wollte sich etwas auf dem offenbar ziemlich großen Schiff umsehen.
Als Corley einen Schritt nach vorne machte, knarrte das Holz zu seinen Füßen und der Kerl, der in der Hängematte lag, schreckte hoch.
"Hey, wer macht da so einen Krach?"
"Ich bin's", meinte Corley.
Der Mann sprang aus seiner Hängematte.
Er war so rabenschwarz wie die Nacht. Nur seine Augen blitzten hell.
Er kam auf Corley zu und reichte ihm die Hand.
"Corley ist mein Name."
"Ich bin Kenneth!"
"Ah, dann bist du der Doc, der mir die Kugel herausgeschnitten hat!"
"Doc ist wohl etwas zuviel gesagt. Ich habe einfach eine ziemlich ruhige Hand und mein Bestes gegeben."
"Danke! Ich wäre wohl nicht mehr am Leben, wenn du das nicht getan hättest!"
Der Schwarze nickte.
"Das stimmt!"
Er griff zu seinem Revolvergurt, den er an einen Haken gehängt hatte und schnallte ihn sich um die Hüften. Dann griff er noch nach einem Winchester-Gewehr und meinte: "Es ist halb so schlimm, dass du mich geweckt hast, Hombre! Schließlich beginnt jetzt ohnehin bald meine Wache!" Er deutete auf das Bett, in dem Corley gelegen hatte.
"Leg' dich lieber wieder hinein! Es ist das einzige Bett an Bord und wenn wir erst in San Luis Colorado anlegen, wirst du dir ein anderes Nest suchen müssen..."
Corley zog die Augenbrauen hoch.
"Du meinst... ihr wollt das Ding noch verkaufen?"
"Es ist schon verkauft. Bestellt und verkauft an einen mexikanischen Hidalgo, der es in San Luis abholen will!" Kenneth lachte rau. "Du solltest es also nutzen, und ich schätze, dass es im Augenblick auch noch dringend brauchst!" Corley spürte Schwindelgefühl.
Der Schwarze hatte zweifellos recht.
Warum nicht noch ein paar Stunden schlafen? Zumindest, bis der Morgen graute.
16
"Hey, aufwachen!"
Es war eine helle Frauenstimme, die da in Corleys Bewusstsein drang. Als er dann die Augen aufschlug sah er, wie Bellinda ihm ein vorzügliches Frühstück ans Bett stellte. Der Duft von frischem Kaffee stieg ihm in die Nase und begann seine Lebensgeister wiederzuerwecken.
Er setzte sich auf.
"Es wird Zeit, dass du wieder auf die Beine kommst, Jeff!", meinte Bellinda und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. Corley lächelte auch.
"Nichts lieber als das!"
Dann waren Schritte zu hören und wenig später betrat noch jemand den Raum. Es war ein großer, bärtiger Mann in den fünfzigern mit braungebranntem Gesicht.
Auf dem Kopf trug er eine Schirmmütze, um die Hüften hatte er einen Revolvergurt.
Ein zweiter Colt steckte hinter seinem Hosenbund. Er kam langsam näher, während seine Augen an Corley hingen.
"Ich bin Woodcock!", sagte der Mann.
"Und mein Name ist Jeff Corley. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet!"
Aber Woodcock lachte nur rau.
"Nein, keine Rede davon! Hier draußen muss man sich helfen."
"Trotzdem tun es die meisten nicht."
"Das ist leider wahr. Und nun hören Sie mir gut zu! Gleichgültig, welche Story Sie meiner leichtgläubigen Tochter auch immer verkauft haben mögen..."
"Dad!"
"...wenn ein Mann eine Schusswunde und auseinandergeschossene Handschellen hat, dann flüchtet er vor dem Gesetz." Corley wollte etwas sagen, aber Woodcock brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen.
"Hören Sie zu, Corley - oder wie immer ihr wirklicher Name auch sein sollte! Es ist mir gleichgültig, wie viele Marshals Ihnen auf den Fersen sind! Sie werden Ihnen nur bis zur Grenze folgen können. Und die haben wir bereits hinter uns gelassen."
Corley atmete tief durch. Dann griff er zur Kaffeetasse, führte sie zum Mund und nahm einen Schluck.
Dieser Mann ist ein Fuchs!, war ihm sofort klar. Er verfolgte irgendein Ziel, dass Corley bis jetzt noch nicht kannte...
Corley verengte die Augen ein wenig und meinte: "Worauf wollen Sie hinaus, Woodcock?"
"Ich kann einen Mann gebrauchen, der mit Waffen umzugehen versteht..."
Corley lächelte dünn.
"Ist es so gefährlich in Mexiko?"
"Sie machen sich keine Vorstellungen! Eine Bande von Geiern macht den äußersten Nordwesten von Sonora unsicher. Es sind keine schlechtbewaffneten mexikanischen Bandoleros, sondern Gringos..."
"Es könnte dieselbe Bande sein, hinter denen die Vigilanten her sind!"
Woodcock nickte.
"Vorausgesetzt, an Ihrer Geschichte ist doch etwas Wahres dran, was ich aber nicht glaube. Schließlich sind diese Sonora-Geier überall im Gespräch! Wahrscheinlich haben Sie das nur geschickt in ihre Erzählung eingewoben..."
"Dad!", stieß Bellinda hervor.
Woodcock lachte zu seiner Tochter hinüber.
"Schon gut, Kind. Du hast offenbar an diesem Kerl einen Narren gefressen und siehst alles etwas blauäugig." Er wandte sich wieder an Corley. "Was immer Sie auch für ein Schurke gewesen sein mögen, ich brauche jeden Mann, den ich kriegen kann und der Mut genug hat, mit mir über San Luis Colorado hinaus zu fahren."
Corley zuckte mit den Schultern.
Zurück konnte er nicht, denn die Vigilanten konnten sein Gesicht so schnell nicht vergessen haben... Er hatte keine Lust, ihnen in die Arme zu laufen.
"Okay!", meinte er.
"Sie bekommen denselben Lohn wie alle anderen hier an Bord! Zwei Dollar pro Tag!"
"Das ist das Doppelte eines Cowboylohns!"
"Ich weiß, Hombre. Aber schließlich kann es auch doppelt so hart werden!"
"Ich bin kein ängstlicher Mann, Mister Woodcock!" Ein breites Grinsen zeigte sich jetzt um die Lippen des Schiffers.