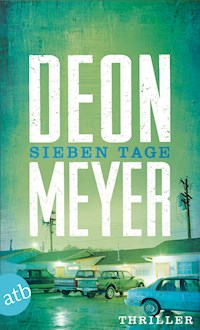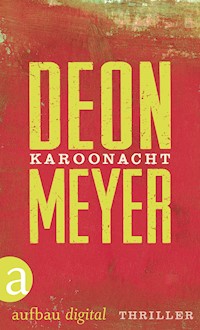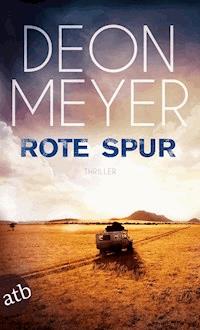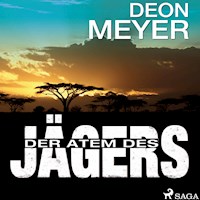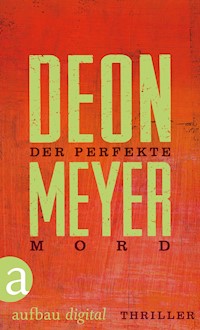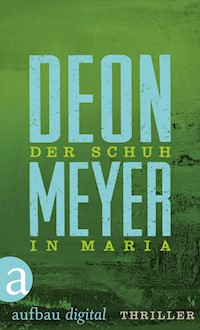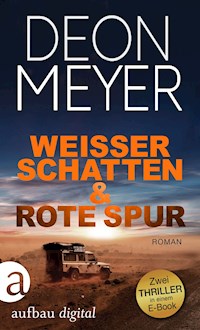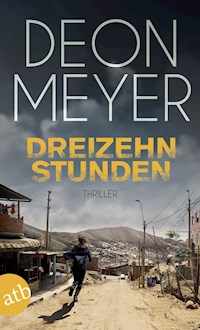
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Benny Griessel Romane
- Sprache: Deutsch
Countdown in Kapstadt.
Inspector Benny Griessel hat schon bessere Tag gesehen. Seit seine Frau ihn herausgeworfen hat, versucht er nüchtern zu bleiben, und nun soll er als Mentor auch noch eine Gruppe junger schwarzer Polizisten anleiten. Zwei Morde beginnen die Polizei von Kapstadt in Atem zu halten. Ein amerikanisches Mädchen wird gefunden - sie wurde mit einem Messer tödlich verletzt. Doch wo ist ihre Freundin Rachel, mit der sie am Tag zuvor aus Namibia gekommen ist? Griessel erfährt, dass Rachel durch die Stadt gejagt wird, sich aber nicht traut zur Polizei zu gehen. Zur selben Zeit findet ein Hausmädchen einen Musikproduzenten tot in seinem Haus - vor ihm liegt seine Frau mit der Pistole und erwacht langsam aus dem Alkoholrausch. In all dem Schlamassel erhält Griessel den Anruf seiner Frau. Sie bittet um ein Treffen - sie will ihm endlich sagen, wie es mit ihnen beiden weitergehen kann ...
"Deon Meyer ist ein überragend spannender Chronist einer schuldbeladenen Gesellschaft im Aufbruch." Tobias Gohlis, Die Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Über Deon Meyer
Deon Meyer, Jahrgang 1958, Rugby-Fan und Mozart-Liebhaber, ist der erfolgreichste Krimiautor in Südafrika. Er begann als Journalist zu schreiben und veröffentlichte 1994 seinen ersten Roman. Er lebt mit seiner Frau und vier Kindern in Melkbosstrand.
Im Aufbau Verlag liegen seine Romane »Der traurige Polizist«, »Tod vor Morgengrauen«, »Das Herz des Jägers«, »Der Atem des Jägers«, »Weißer Schatten« sowie der Story-Band »Schwarz. Weiß. Tot« vor.
Stefanie Schäfer hat Dolmetschen und Übersetzen an den Universitäten Heidelberg und Köln studiert. Für herausragende übersetzerische Leistungen wurde sie mit dem Hieronymusring ausgezeichnet. Sie lebt in Köln.
Informationen zum Buch
Inspector Benny Griessel hat schon bessere Tag gesehen. Seit seine Frau ihn herausgeworfen hat, versucht er nüchtern zu bleiben, und nun soll er als Mentor auch noch eine Gruppe junger schwarzer Polizisten anleiten. Zwei Morde beginnen die Polizei von Kapstadt in Atem zu halten. Ein amerikanisches Mädchen wird gefunden – sie wurde mit einem Messer tödlich verletzt. Doch wo ist ihre Freundin Rachel, mit der sie am Tag zuvor aus Namibia gekommen ist? Griessel erfährt, dass Rachel durch die Stadt gejagt wird, sich aber nicht traut zur Polizei zu gehen. Zur selben Zeit findet ein Hausmädchen einen Musikproduzenten tot in seinem Haus – vor ihm liegt seine Frau mit der Pistole und erwacht langsam aus dem Alkoholrausch. In all dem Schlamassel erhält Griessel den Anruf seiner Frau. Sie bittet um ein Treffen – sie will ihm endlich sagen, wie es mit ihnen beiden weitergehen kann.
»Deon Meyer ist ein überragend spannender Chronist einer schuldbeladenen Gesellschaft im Aufbruch.« Tobias Gohlis, DIE ZEIT
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Deon Meyer
Dreizehn Stunden
Thriller
Aus dem Afrikaans von Stefanie Schäfer
Inhaltsübersicht
Über Deon Meyer
Informationen zum Buch
Newsletter
05:36 – 07:00
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
07:02 – 08:13
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
08:13 – 09:03
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
09:04 – 10:09
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
10:10 – 11:02
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
11:03 – 12:00
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
12:00 – 12:56
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
12:57 – 14:01
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
14:02 – 15:10
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
15:12 – 16:14
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
16:41 – 17:46
Kapitel 47
17:47 – 18:36
Kapitel 48
18:37 – 19:51
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Danksagung
Glossar mit Erklärungen der afrikaanssprachigen Wörter und anderer Begriffe
Impressum
Für meine Brüder, Bertus und François
05:36 – 07:00
1
Um 05:36 rannte sie den steilen Hang des Leeukops hinauf. In schnellem Takt knirschten ihre Laufschuhe auf dem Kies des breiten Fußwegs.
Zu diesem Zeitpunkt, als die frühen Sonnenstrahlen sie wie ein Suchscheinwerfer am Berghang einfingen, bot sie ein Bild sorgloser Anmut. Von hinten betrachtet, tanzte ihr dunkler geflochtener Zopf auf dem kleinen Rucksack, und ihr zartblaues T-Shirt hob sich leuchtend von ihrem tiefbraunen Nacken ab. Die langen Beine, die aus den Jeansshorts ragten, bewegten sich federnd und rhythmisch. Alles an ihr strahlte Energie und athletische Jugendlichkeit aus. Sie wirkte lebenslustig, gesund und zielstrebig.
Bis sie plötzlich stehen blieb und einen Blick über die linke Schulter warf. In diesem Moment zerstob die Illusion, denn aus ihrem Gesicht sprachen Angst und Erschöpfung.
Sie hatte keinen Blick für die beeindruckende Schönheit der Stadt im weichen Licht der aufgehenden Sonne. Ihre Augen suchten wild und panisch nach einer Bewegung in dem hohen Fynbos hinter ihr. Sie wusste, dass sie ihr auf den Fersen waren, aber nicht, wie dicht. Sie atmete schnell und flach – vor Anspannung, Schrecken und Furcht. Es war das Adrenalin, ihr übermächtiger Lebenswille, der sie zwang weiterzulaufen, immer weiter, trotz ihrer müden Glieder, des Brennens in der Brust, der Dumpfheit nach einer schlaflosen Nacht und der Verlorenheit in einer unbekannten Stadt, einem fremden Land, einem unnahbaren Kontinent.
Vor ihr gabelte sich der Weg. Ihr Instinkt trieb sie nach rechts, höher hinauf, weiter auf die Felskuppe des Leeukops zu. Sie dachte nicht nach, sie hatte keine Strategie, sie lief blindlings. Ihre schlanken Arme schienen sie anzutreiben wie die Schubstangen einer Dampfmaschine.
Kripo-Inspekteur Bennie Griessel schlief.
Er träumte, er steuere einen großen Tanklastwagen über die N1 auf der Gefällestrecke zwischen Plattekloof und Parow, zu schnell, ein wenig unkontrolliert. Als sein Handy klingelte, reichte schon der erste schrille Ton, um ein flüchtiges Gefühl der Erleichterung über die Rückkehr in die Realität in ihm auszulösen. Er öffnete die Augen und sah auf den Radiowecker. Es war 05:37.
Er schwang die Beine über die Kante des schmalen Bettes. Der Traum war bereits vergessen. Für einen Augenblick blieb er auf dem Bettrand sitzen, reglos, wie vor einem Abgrund. Dann stand er auf, ging steif und verschlafen zur Tür und stolperte die Holztreppe hinunter ins Wohnzimmer, wo er das Handy am Abend zuvor hatte liegen lassen. Seine dunklen wirren Haare schrien nach einem Friseur, und er trug nichts als eine ausgeblichene Rugbyhose. Sein einziger Gedanke war, dass ein Anruf um diese Zeit mit Sicherheit nichts Gutes verhieß.
Die Nummer auf dem Display war ihm unbekannt.
»Griessel.« Seine Stimme verriet ihn. Heiser brachte er die ersten Worte des Tages hervor.
»Hi, Bennie, ich bin’s, Vusi. Tut mir leid, dass ich dich wecken muss.«
Griessel hatte Mühe, sich zu konzentrieren. Sein Kopf war voller Watte. »Schon okay.«
»Wir haben … eine Leiche.«
»Wo?«
»Bei St. Martini, der lutherischen Kirche oben in der Langstraat.«
»In der Kirche?«
»Nein. Die Frau liegt neben der Kirche.«
»Bin sofort da.«
Griessel beendete die Verbindung und fuhr sich mit einer Hand durch die Haare.
Die Frau hatte Inspekteur Vusumuzi Ndabeni gesagt.
Bestimmt eine Stadtstreicherin, eine der obdachlosen bergies, die am Fuße und an den Hängen des Tafelbergs lebten. Eine, die zu viel von Gott weiß was getrunken hatte.
Er legte das Handy neben seinen neuen gebrauchten Laptop.
Dann wandte er sich um, immer noch nicht ganz wach. Beim Umdrehen stieß er gegen das Vorderrad seines Fahrrads, das an seinem Leihhaus-Sofa lehnte, und konnte es gerade noch rechtzeitig auffangen, bevor es umfiel. Dann stieg er die Holztreppe wieder hinauf. Das Fahrrad erinnerte ihn flüchtig an seine finanzielle Misere, aber er schob diesen Gedanken beiseite.
Im Schlafzimmer zog er die kurze Hose aus. Ein verräterischer Moschusgeruch stieg ihm vom Unterleib aus in die Nase.
Verdammt!
Das Schuldbewusstsein traf ihn mit voller Wucht. Seine Gewissensbisse und die Erinnerungen an den vorigen Abend verdrängten die letzte Spur von Trägheit aus seinem Kopf.
Was war nur in ihn gefahren?
Er warf die Hose in einem vorwurfsvollen Bogen in Richtung Bett und ging ins Badezimmer.
Missgelaunt klappte Griessel den Toilettendeckel hoch, zielte und pinkelte.
Als sie den asphaltierten Seinheuwelweg erreichte, erblickte sie die Frau und den Hund, hundert Meter links von ihr. Sie wollte laut rufen, ihre Lippen formten zwei Wörter, aber ihre Stimme ging im Keuchen ihres Atems unter.
Sie rannte auf die Frau und das Tier zu. Der Hund war groß, ein Ridgeback. Die Frau war um die sechzig, eine Weiße. Sie trug einen großen rosa Sonnenhut, einen Wanderstock und einen kleinen Rucksack.
Der Hund wurde plötzlich unruhig. Vielleicht roch er ihre Angst, vielleicht spürte er ihre Panik. Ihre Sohlen klatschten auf den Teer, während sie ihren Lauf verlangsamte. Sie blieb stehen, drei Meter von der Hundebesitzerin entfernt.
»Helfen Sie mir!«, bat die junge Frau auf Englisch mit starkem amerikanischen Akzent.
»Was ist denn los?« Besorgt blickte die Frau sie an und wich einen Schritt zurück. Der Hund knurrte und zerrte an der Leine, strebte auf die junge Joggerin zu.
»Die wollen mich umbringen!«
Die Frau sah sich erschrocken um. »Aber hier ist doch niemand.«
Die Läuferin blickte über die Schulter. »Sie sind hinter mir her!«
Dann musterte sie die Frau und den Hund und erkannte, dass ihre Mühe vergeblich war. Sie konnten ihr nicht helfen. Nicht hier in der Offenheit des Berghangs, nicht gegen ihre Verfolger. Sie brachte die Frau nur in Gefahr.
»Rufen Sie die Polizei an. Bitte! Benachrichtigen Sie einfach die Polizei«, flehte sie und setzte erneut zum Laufen an, langsam zunächst, gegen den Widerstand ihres Körpers. Der Hund sprang mit einem Satz nach vorn und bellte. Die Frau zog an der Leine.
»Aber warum denn?«
»Bitte!«, wiederholte sie und schleppte sich weiter den Asphaltweg hinauf in Richtung Tafelberg. »Bitte, rufen Sie bei der Polizei an.«
Als sie etwa siebzig Schritte entfernt war, drehte sie sich noch einmal um. Die Frau stand immer noch genauso da wie eben, reglos und ein wenig verwirrt.
Bennie Griessel zog ab und fragte sich, warum er das Schlamassel gestern Abend nicht hatte kommen sehen. Er war nicht darauf aus gewesen, es war einfach passiert. Mein Gott, was machte er sich denn solche Vorwürfe, er war doch auch nur ein Mensch!
Aber er war verheiratet.
Wenn man das eine Ehe nennen konnte. Getrennt von Tisch, Bett und Wohnung. Nein, verdammt, Anna konnte nicht alles haben. Sie konnte ihn nicht aus seinem eigenen Haus werfen und erwarten, dass er zwei Haushalte unterhielt, und dann auch noch verlangen, dass er sechs Monate lang nüchtern und enthaltsam lebte.
Wenigstens war er nüchtern. Schon seit einhundertsechsundfünfzig Tagen. Das bedeutete einen Kampf von über fünf Monaten gegen die Flasche, Tag für Tag, Stunde um Stunde, bis jetzt.
Auf keinen Fall durfte Anna das mit gestern Abend erfahren. Nicht jetzt. Nur knapp einen Monat vor dem Ende seiner Verbannung, der Strafe für seine Sauferei. Wenn Anna es erfahren würde, wäre er geliefert, und all der Kummer und Ärger wären umsonst gewesen.
Er seufzte und stellte sich vor den Spiegelschrank, um sich die Zähne zu putzen. Er betrachtete sich. Die grauen Schläfen, die Falten um seine dunklen Augen, die slawischen Gesichtszüge. Ein Schönling war er nie gewesen.
Er öffnete den Schrank, holte Zahnbürste und Zahnpasta heraus.
Was hatte sie in ihm gesehen, diese Bella? Irgendwann gestern Abend hatte er sich gefragt, ob sie womöglich aus Mitleid mit ihm ins Bett ging, aber er war zu erregt gewesen und zu verdammt dankbar für ihre sanfte Stimme, ihre großen Brüste und ihren Mund. Mein Gott, dieser Mund! Münder machten ihn an, und genau da lag die Wurzel des Übels. Nein, alles hatte mit Lize Beekman angefangen, aber das sollte er mal Anna erzählen.
Scheiße.
Bennie Griessel putzte sich hastig die Zähne, ging unter die Dusche und drehte die Hähne weit auf, um die verräterischen Gerüche gründlich abzuwaschen.
Sie war kein Bergie. Griessel fuhr ein kurzer Stich durchs Herz, als er über die Spitzen des Friedhofszauns kletterte und das Mädchen dort liegen sah. Die Sportschuhe, die Khakishorts, das orangefarbene Trainingshemd sowie die Form ihrer Arme und Beine verrieten, dass sie noch jung war. Sie erinnerte ihn an seine Tochter.
Er ging den schmalen geteerten Weg hinauf, vorbei an hohen Palmen, Tannen und einem gelben Schild: FÜR UNBEFUGTE ZUTRITT VERBOTEN. PARKEN AUF EIGENE GEFAHR..Und auf diesem Weg lag sie dann, links neben der Kirche.
Er blickte hinauf zu dem traumhaften, klaren Morgenhimmel. Es war fast windstill, nur eine leichte Brise trug Meeresgerüche den Berg hinauf. Das war keine Zeit zum Sterben.
Vusi stand neben ihr, zusammen mit Dick und Doof von der Spurensicherung, einem Polizeifotografen und drei Uniformierten. Hinter Griessels Rücken, in der schmalen Nebenstraße der Langstraat, warteten weitere uniformierte Kollegen, mindestens vier, in den weißen Hemden und schwarzen Epauletten der Metro-Polizei, alle gleichermaßen von ihrer Wichtigkeit durchdrungen. Zusammen mit einer Gruppe Schaulustiger lehnten sie mit den Armen auf dem Zaun und betrachteten die reglose Gestalt.
»Morgen, Bennie«, sagte Vusi Ndabeni in seiner ruhigen Art. Er war mittelgroß, ebenso wie Griessel, wirkte aber kleiner: schmal und korrekt, mit scharfen Bügelfalten in der schwarzen Hose, schneeweißem Hemd mit Krawatte und polierten Schuhen. Sein wolliges Haar war kurz und eckig geschnitten, der Spitzbart tadellos gestutzt. Er trug dünne Gummihandschuhe. Griessel war ihm am vergangenen Donnerstag zum ersten Mal begegnet, ebenso wie den anderen fünf Fahndern, für die er ab jetzt ein Jahr lang den Mentor spielen sollte. Dieser Begriff stammte von John Afrika, dem Distrikt-Kommissaris »Fahndung und Verbrechensaufklärung«. Als Bennie allein in dessen Büro in der Alfredstraat zurückgeblieben war, hatte er erklärt: »Wir sitzen in der Scheiße, Bennie. Wir haben den Lotz-Fall vermasselt, und jetzt behauptet die Führungsebene, wir ließen am Kap die Zügel schleifen, und fordert, wir sollten uns mal zusammenreißen. Aber was soll ich tun? Ich verliere meine besten Leute, und die neuen wissen noch nichts, die sind noch völlig ungeschliffen. Kann ich auf dich zählen, Bennie?«
Eine Stunde später, als ihnen im großen Konferenzraum des Kommissaris sechs der besten »neuen« Leute mit unbewegter Miene auf grauen Behördenstühlen gegenübersaßen, formulierte John Afrika sein Anliegen ein wenig dezenter: »Bennie wird euer Mentor sein. Er arbeitet seit fünfundzwanzig Jahren bei der Polizei. Er war schon bei der ehemaligen Mordkommission, als die meisten von euch noch zur Grundschule gegangen sind. Was er schon vergessen hat, müsst ihr noch lernen. Aber damit ihr mich richtig versteht: Er ist nicht dazu da, euch die Arbeit abzunehmen. Er ist euer Berater, der euch hilft und für Fragen zur Verfügung steht. Euer Mentor. Laut Wörterbuch ist ein Mentor …«, und an dieser Stelle zog der Kommissaris seine Notizen zu Rate, »… ein kluger und vertrauenswürdiger Ratgeber oder Lehrer. Deswegen habe ich ihn zur provinzialen Sondereinheit versetzt. Bennie kennt sich aus, und ihr könnt ihm vertrauen, denn ich vertraue ihm. Ständig geht Wissen durch den Verlust altgedienter Kollegen verloren. Viele Neuzugänge werden auf die Bevölkerung losgelassen, ohne die geringste Erfahrung zu haben. Dabei brauchen wir nicht jedes Mal das Rad neu zu erfinden. Lernt von Bennie! Ihr seid eine handverlesene Truppe – es gibt nicht viele, denen eine solche Chance geboten wird.«
Griessel sah in ihre Gesichter. Vier athletische schwarze Männer, eine untersetzte schwarze Frau und ein breitschultriger farbiger Ermittler, alle knapp über dreißig. Überschwängliche Dankbarkeit spiegelte sich nicht in ihren Mienen wider, außer vielleicht in der von Vusumuzi (»Alle nennen mich Vusi.«) Ndabeni. Der farbige Ermittler, Fransman Dekker, musterte ihn sogar mit unverhohlener Feindseligkeit. Doch Griessel hatte sich bereits an die Unterströmungen in der SAPS, der neuen südafrikanischen Polizei gewöhnt. Als er so neben John Afrika stand, sagte er sich, dass er dankbar sein müsse, nach der Auflösung der früheren Mordkommission noch einen Job zu haben. Und dass er und Mat Joubert, sein ehemaliger Vorgesetzter, nicht auf irgendwelche unbedeutenden Wachen abgeschoben worden waren wie die meisten ihrer Kollegen. Diese verdammten Umstrukturierungen, die so wenig Neues brachten. Es war wieder genauso wie dreißig Jahre zuvor: Kripo-Ermittler mussten in kleinen Wachen Dienst tun, denn so handhabte man das heutzutage im Ausland, also musste die SAPS es nachäffen. Nein, er hatte wenigstens noch Arbeit, und Joubert hatte ihn sogar für eine Beförderung vorgeschlagen. Wenn sein Glück anhielt, wenn seine Vorgesetzten über seine Sauferei, über die Gerechtigkeitsquoten für ehemals benachteiligte Bevölkerungsgruppen, über die Politik und den ganzen Quatsch hinwegsahen, könnte er zum Kaptein aufsteigen. Noch heute würde er erfahren, ob es geklappt hatte.
Kaptein Bennie Griessel – das war Musik in seinen Ohren. Außerdem brauchte er diese Beförderung. Dringend.
»Morgen, Vusi«, sagte er.
»Hi, Bennie«, grüßte ihn Jimmy, der lange, magere Weißkittel von der Spurensicherung. »Wie ich höre, nennt man dich inzwischen ›das Orakel‹.«
»Wie diese Frau in Herr der Ringe«, ergänzte Arnold, der kleine Dicke. In den Kapstädter Polizeikreisen waren die beiden als »Dick und Doof« bekannt, oft begleitet von inzwischen ziemlich abgedroschenen Witzen, etwa: »Die Spurensicherung wird durch Dick und Doof zu euch halten.«
»Das war in Matrix, du Depp«, verbesserte Jimmy.
»Ist doch egal«, erwiderte Arnold.
»Einen schönen guten Morgen«, unterbrach sie Griessel. Er wandte sich zu den Uniformierten unter dem Baum und holte schon Luft, um sie anzuherrschen: »Das hier ist ein Tatort, los, raus hier, und zwar sofort«, als ihm einfiel, dass das Vusis Fall war. Er musste den Mund halten und Mentor spielen. Er warf den Uniformierten einen drohenden Blick zu, der keinerlei Effekt hatte, und wandte sich dann zu der Leiche um.
Das Mädchen lag auf dem Bauch, den Kopf der Straße abgewandt. Ihr blondes Haar war sehr kurz geschnitten. Über ihren Rücken zogen sich zwei horizontale Schnittwunden, gleichmäßig rechts und links über ihre Schulterblätter. Aber es war der gewalttätige Schnitt durch ihre Kehle, der ihren Tod verursacht hatte, tief genug, um die Speiseröhre freizulegen. Mit Gesicht, Brust und Schultern lag sie in einer großen Blutlache. Der Geruch des Todes hing bereits in der Luft, bitter wie Kupfer.
»Mein Gott!«, sagte Griessel. Angst und Ekel stiegen tief aus seinem Inneren in ihm auf. Er musste durchatmen, langsam und ruhig, wie Doc Barkhuizen es ihn gelehrt hatte. Er musste auf Abstand gehen, es nicht an sich heranlassen.
Er schloss für einen Moment die Augen. Dann schlug er sie wieder auf, blickte hinauf in die Bäume. Er rang um Objektivität, aber es war und blieb eine furchtbare Art zu sterben. In seinem Kopf stiegen unwillkürlich Vorstellungen davon auf, wie es sich zugetragen hatte – das blitzende Messer, das seifenglatt und tief durch ihr Gewebe schnitt.
Rasch erhob er sich und gab vor, sich umzusehen. Dick und Doof zankten sich um irgendetwas, wie üblich. Er versuchte zu verstehen, was sie sagten.
Mein Gott, und sie war noch so jung! Achtzehn, neunzehn?
Was war das für ein Wahnsinn, einem solchen Kind die Kehle durchzuschneiden! Was für eine Perversion!
Er verscheuchte die Bilder aus seinem Kopf, dachte an die Fakten, die Folgen. Sie war weiß. Das bedeutete Ärger. Das verhieß Medienrummel. Der ganze Kreislauf der Anschuldigungen, das Verbrechen sei außer Kontrolle geraten, würde wieder von vorn anfangen. Es bedeutete großen Druck und lange Arbeitszeiten und zu viele Leute, die sich einmischen würden. Jeder würde mal wieder seine eigene Haut zu retten versuchen. Er hatte es satt bis obenhin.
»Das gibt Ärger«, sagte Griessel leise zu Vusi.
»Ich weiß.«
»Es wäre besser, wenn die Kollegen da hinter der Mauer bleiben würden.«
Ndabeni nickte, ging auf die Männer in Uniform zu und bat sie, auf dem Umweg hinter der Kirche entlang den Friedhof zu verlassen. Sie reagierten nur widerstrebend, denn sie wollten unbedingt dabei bleiben. Endlich aber gingen sie.
Vusi gesellte sich zu Griessel, Notizbuch und Stift in der Hand. »Alle Tore sind geschlossen. Auf der anderen Seite, beim Pfarrbüro, gibt es ein elektrisches Eingangstor, und dann noch das Haupteingangstor hier vor dem Gebäude. Sie muss über die Gartenmauer gesprungen sein, das war die einzige Möglichkeit, hier reinzukommen.« Vusi sprach zu schnell. Er deutete mit dem Finger auf einen Farbigen, der jenseits der Mauer auf dem Bürgersteig stand. »Der alte Mann da … James Dylan Fredericks, der hat sie entdeckt. Er ist Day Manager bei Kauai Health Foods in der Kloofstraat. Er sagt, er sei mit dem Golden-Arrow-Bus von Mitchells Plain gekommen und dann am Bahnhof ausgestiegen. Als er hier vorbeigegangen sei, um fünf vor fünf, sei ihm die reglose Gestalt aufgefallen. Er sei über die Mauer geklettert, aber als er das viele Blut gesehen habe, sei er zurückgelaufen und habe bei der Wache am Caledonplein angerufen, weil er diese Nummer für eventuelle Notfälle im Geschäft gespeichert habe.«
Griessel nickte. Er vermutete, dass Ndabeni seinetwegen so nervös war, als sei er hier, um ihn, den Schwarzen, zu beurteilen. Er würde das klarstellen müssen.
»Ich werde Fredericks sagen, dass er gehen kann, schließlich wissen wir ja, wo wir ihn erreichen können.«
»Schon gut, Vusi. Du brauchst nicht … Ich weiß es zu schätzen, dass du mir die Einzelheiten mitteilst, aber will nicht, dass du denkst … weißt du …«
Ndabeni berührte Griessel am Arm, als wolle er ihn beruhigen. »Schon okay, Bennie. Ich will was lernen.«
Vusi schwieg einen Augenblick. Dann fügte er hinzu: »Ich will das nicht vermasseln, Bennie. Ich war vier Jahre lang in Kayelitsha. Ich will nicht dahin zurück. Aber das hier ist meine erste … Weiße«, sagte er vorsichtig, um bloß nicht rassistisch zu klingen. »Das hier ist … eine andere Welt.«
»Ja, das ist es.« Griessel war nicht gut in so etwas, ewig rang er um die richtigen, politisch korrekten Worte. Vusi half ihm aus der Verlegenheit: »Ich habe versucht zu ertasten, ob sie etwas in den Hosentaschen hat. Vielleicht einen Ausweis. Aber ich habe nichts gespürt. Wir warten jetzt nur noch auf den Rechtsmediziner.«
In den Bäumen zwitscherte schrill ein Vogel. Zwei Tauben landeten in ihrer Nähe und begannen sofort zu picken. Griessel sah sich um. Auf dem Kirchengrundstück stand ein Auto, ein weißer Toyota-Minibus. Er war auf der Südseite geparkt, vor einer zwei Meter hohen Backsteinmauer. Auf der Seite stand in großen roten Buchstaben das Wort Adventure.
Ndabeni folgte seinem Blick. »Die parken vermutlich nur aus Sicherheitsgründen hier«, meinte er und deutete auf die hohen Mauern und die geschlossenen Tore. »Ich glaube, die haben eine Agentur in der Langstraat.«
»Kann sein.« Die Langstraat war das Zentrum des Rucksacktourismus am Kap. Viele junge Leute, Studierende aus Europa, Australien und Amerika, die billige Unterkünfte und Abenteuer suchten, kamen hierher.
Griessel hockte sich wieder neben die Leiche, aber so, dass ihr Gesicht von ihm abgewandt war, denn er wollte weder die schreckliche Wunde noch ihre zarten Gesichtszüge sehen.
Hoffentlich ist sie nicht auch noch eine Ausländerin, dachte er.
Denn dann wäre wirklich der Teufel los.
2
Sie war die Kloofnek-Straße entlanggelaufen und einen Augenblick unentschlossen stehen geblieben. Sie wollte sich ausruhen, Atem schöpfen und versuchen, ihre Angst unter Kontrolle zu bekommen. Sie musste eine Entscheidung treffen: Entweder wandte sie sich nach rechts, weg von der Stadt, in Richtung Camps Bay, wie der Wegweiser verkündete, oder nach links, mehr oder weniger in die Richtung, aus der sie gekommen war. Ihr Instinkt sagte: nach rechts, immer weiter weg von den Verfolgern, von den grauenvollen Geschehnissen der letzten Nacht.
Aber genau damit würden sie rechnen, und es würde sie noch tiefer ins Unbekannte führen, weiter von Erin fort. Da wandte sie sich, ohne nachzudenken, nach links. Ihre Sportschuhe klatschten laut auf den Asphalt des nach unten führenden Weges. Etwa vierhundert Meter lief sie am rechten Rand der schmalen Straße entlang. Dann stolperte sie rechts einen steinigen Abhang hinunter, über ein pflanzenbewachsenes flacheres Stück, bis sie zu ihrer Erleichterung Higgovale erreichte, eine Siedlung hoch oben am Berg – große, exklusive Häuser mit üppigen Gärten, umgeben von hohen Mauern. Hoffnung keimte in ihr auf. Hier wartete die Normalität, hier wohnten Leute, die ihr helfen, die ihr Unterschlupf, Schutz und Unterstützung bieten konnten.
Doch alle Tore waren geschlossen, jede Villa ein Fort, die Straßen verlassen so früh am Morgen. Der Weg hatte sich steil bergauf gewunden; ihre Beine versagten ihr den Dienst, konnten nicht mehr, und dann sah sie das offene Tor des Hauses rechts von ihr. Mit jeder Faser sehnte sie sich nach Ruhe. Sie warf einen Blick zurück, sah aber niemanden. Sie ging durch das Tor: eine kurze, steile Auffahrt, eine Garage, ein Vordach. Rechts wuchsen dichte Sträucher an der hohen Mauer. Das Haus lag linker Hand, hinter einem Zaun aus Eisenstäben und einem geschlossenen Gittertor. Sie kroch in die Sträucher bis zu einer verputzten Wand, immer tiefer, ganz nach hinten, wo man sie von der Straße aus nicht sehen konnte.
Sie sank auf die Knie, rutschte mit dem Rucksack an der Mauer herunter. Sie ließ den Kopf hängen, todmüde, die Augen geschlossen. Dann erst setzte sie sich richtig hin. Ihr war bewusst, dass die Feuchtigkeit auf den Backsteinen und die vermodernden Blätter Flecken auf ihren blauen Jeansshorts hinterlassen würden, aber das war ihr gleichgültig. Sie sehnte sich nur nach Ruhe.
Dann stiegen plötzlich wieder die Bilder in ihr auf, die sich sechs Stunden zuvor in ihr Gedächtnis eingebrannt hatten. Sie zuckte unwillkürlich zusammen und öffnete die Augen, denn sie wollte jetzt nicht daran denken. Es war zu … viel. Durch die Gardine der dunkelgrünen Blätter und der leuchtenden, großen roten Blüten sah sie ein Auto unter dem Vordach stehen und konzentrierte sich darauf. Das Modell war ihr unbekannt, schlank, elegant und nicht neu. Sie versuchte, die Panik zu überwinden, indem sie sich fragte, was für ein Auto das sein mochte. Ihr Atem ging ruhiger, nicht aber ihr Herzschlag. Die Erschöpfung lastete auf ihr wie ein schweres Gewicht, aber sie wehrte sich dagegen. Noch konnte sie sich den Luxus nicht erlauben, ihr nachzugeben.
Um 06:27 hörte sie mehrere Leute die Straße entlangrennen Sie kamen näher. Wieder blieb ihr vor Schreck fast das Herz stehen.
Sie hörte, wie sie einander in einer fremden Sprache etwas zuriefen. Die Schritte wurden langsamer und hielten plötzlich inne. Sie beugte sich ein ganz klein wenig nach vorn, um durch die dichten Blätter zu spähen, und da sah sie einen von ihnen im offenen Tor stehen. Seine Gestalt war nur vage zu erkennen, aus kleinen Teilchen zusammengesetzt wie ein Mosaik, aber sie registrierte, dass er schwarz war.
Reglos blieb sie sitzen.
Sie sah, wie sich das Mosaik bewegte. Geräuschlos schlich er auf seinen Sportschuhen durch das Tor. Sie wusste, dass er nach möglichen Verstecken Ausschau hielt, am Haus, am Auto unter dem Vordach.
Die vage Gestalt halbierte sich. Bückte er sich? So dass er unter dem Auto hindurchschauen konnte?
Die Mosaikteilchen verdoppelten sich wieder, die Gestalt wurde größer – er kam auf sie zu! Konnte er sie sehen, hier zwischen den Sträuchern?
»Hey!«
Die Stimme erschreckte sie, ein Hammerschlag in ihrer Brust, und sie hätte nicht sagen können, ob sie sich im Moment des Ausrufs bewegt hatte.
Die dunkle Gestalt entfernte sich von ihr, jedoch ohne Eile.
»Was haben Sie hier zu suchen?« Die Stimme kam vom Haus, von oben. Jemand redete mit dem Schwarzen.
»Nichts.«
»Runter von meinem Grundstück, und zwar sofort!«
Keine Antwort. Der Mann blieb noch einen Moment stehen und wandte sich dann langsam und träge zum Gehen, bis seine Gestalt hinter den Blättern verschwand.
Die beiden Ermittler suchten den Friedhof von Süden her ab. Vusi begann vorn, an der Grenze zur Langstraat mit dem spitzen Barockzaun, Griessel hinten an der hohen Backsteinmauer. Er ging langsam, Schritt für Schritt, mit gesenktem Kopf, und ließ den Blick hin- und herwandern. Es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren, er spürte ein Unbehagen, etwas Ungreifbares, vage und formlos. Aber er musste seine Gedanken jetzt zusammenhalten, seine ganze Aufmerksamkeit auf den kahlen Boden richten, die Graspollen um die Baumstämme, die einzelnen Abschnitte des geteerten Weges. Ab und zu bückte er sich, hob etwas auf und hielt es zwischen den Fingern – den Kronkorken einer Bierflasche, zwei Ringverschlüsse von Limodosen, eine verrostete Metallscheibe, eine leere weiße Plastiktüte.
Dann gelangte er auf die Rückseite der Kirche, wo der Straßenlärm plötzlich gedämpft klang. Er blickte am Turm empor. Die Spitze trug ein Kreuz. Wie oft war er schon hier vorbeigefahren, ohne je richtig hingesehen zu haben! Es war eine schöne Kirche, deren architektonischen Stil er jedoch nicht einordnen konnte, umgeben von einem gepflegten Garten. Wann mochten wohl die Palmen, Tannen und Oleanderbüsche gepflanzt worden sein? Er umrundete das angebaute Pfarrbüro, und die Straßengeräusche schwollen wieder an. Er stellte sich in die nördliche Ecke des Grundstücks und blickte die Langstraat hinunter. Hier fand man noch das alte Kap mit den viktorianisch angehauchten Gebäuden, die meisten nur zwei Stockwerke hoch, einige inzwischen pastellfarben gestrichen, vielleicht, um sie für junge Leute attraktiv zu gestalten.
Woher rührte nur diese seltsame Unruhe in seinem Inneren? Es lag nicht an gestern Abend. Es lag auch nicht an der Frage, die er schon seit zwei, drei Wochen vor sich her schob, nämlich, ob er wirklich wieder zurück zu Anna ziehen solle und ob das gutgehen könne.
War es seine neue Rolle als Mentor? Die Situation, sich an einem Tatort aufzuhalten, aber nicht selbst ermitteln zu dürfen? Nur gucken, nicht anfassen? Es würde ihm schwerfallen, das wurde ihm immer klarer.
Vielleicht sollte er aber auch erst mal etwas essen.
Griessel blickte nach Süden, zur Oranjestraat-Kreuzung. Es war Dienstag, kurz vor sieben, und es herrschte reger Verkehr – Autos, Busse, Taxen, Mopeds, Fußgänger. Das typische hektische Treiben Mitte Januar, wenn die Schule wieder anfing und die Ferien vorbei und vergessen waren. Auf dem Bürgersteig hatte sich inzwischen eine Schar von Gaffern versammelt. Auch zwei Pressefotografen waren eingetroffen, Fototaschen über der Schulter, die Kameras mit den langen Teleobjektiven wie Waffen im Anschlag. Einen kannte er, einen Saufkumpanen aus seiner Alkoholiker-Zeit, der jahrelang für die Cape Times gearbeitet hatte und inzwischen für eine Boulevardzeitung Sensationen jagte. Eines Abends im Fireman’s Arms hatte er mal erklärt, wenn man sämtliche Polizisten und Journalisten für eine Woche auf Robbeneiland einsperren würde, könnten die Kneipen und Spirituosenläden am Kap dichtmachen.
Der Ermittler beobachtete einen Fahrradfahrer, der sich behände durch den Verkehr schlängelte, auf einem Rennrad mit lächerlich dünnen Reifen. Er trug eine enge schwarze Hose, ein helles, buntes Hemd, Spezialschuhe, einen Helm, ja, dieser Lackaffe trug sogar Handschuhe! Griessel folgte dem Rad bis zur Ampel an der Oranjestraat und dachte bei sich, dass er niemals in einem so lächerlichen Aufzug unterwegs sein würde. Ihm reichte ja schon dieser Pisspott-Helm, den er auch nie getragen hätte, wenn er ihn nicht als Dreingabe zu dem Fahrrad bekommen hätte.
Schuld an allem war Doc Barkhuizen, sein spezieller Freund bei den Anonymen Alkoholikern. Frustriert hatte sich Griessel bei Barkhuizen beklagt, dass sein Verlangen nach der Flasche noch immer nicht nachgelassen habe, obwohl die kritischen drei Monate schon längst vorbei waren. Seine Sucht war noch genau so verzehrend wie am ersten Tag. Der Doc hatte mit dem abgedroschenen Gemeinplatz geantwortet, er müsse eben von einem Tag zum anderen leben, aber Griessel hatte erwidert, er brauche mehr als diesen hohlen Trost. Da erklärte der Doc: »Du musst dich ablenken. Was machst du abends?«
Abends? Für einen Polizisten gab es kein »abends«. Und wenn er wirklich mal früh genug nach Hause kam, schrieb er an seine Tochter Carla, oder er legte eine seiner vier CDs in den Computer ein und spielte dazu Bassgitarre.
»Abends bin ich beschäftigt, Doc.«
»Und morgens?«
»Manchmal gehe ich im Park spazieren. Oben am Stausee.«
»Wie oft?«
»Keine Ahnung. Ab und zu. Einmal pro Woche, eher weniger.«
Das Problem mit dem Doc war seine Beredsamkeit. Und sein Enthusiasmus. Für alles und jedes konnte er sich begeistern. Er gehörte zu diesen »Das Glas ist halb voll«- Typen, die nicht ruhten, bis sie einen bekehrt hatten. »Ich habe vor ungefähr fünf Jahren mit dem Radfahren angefangen, Bennie. Joggen kann ich nicht wegen meines Knies, aber Fahrradfahren schont meine alten Knochen. Ich habe es ruhig angehen lassen, so etwa fünf, sechs Kilometer am Tag. Aber dann hat es mich gepackt, denn es macht richtig Spaß. Die frische Luft, die Gerüche, die Sonne … Man spürt die Hitze und die Kälte, und man sieht alles aus einer anderen Perspektive, denn man bewegt sich in seinem eigenen Tempo. Man kommt so richtig zur Ruhe. Man hat Zeit zum Nachdenken.« Und so weiter.
Nachdem der Doc ihm zum dritten Mal diese Predigt gehalten hatte, ließ er sich von der Begeisterung mitreißen, und Ende Oktober hatte er sich schließlich ein Fahrrad zugelegt. Auf seine übliche Art: Bennie Griessel, der Schnäppchenjäger, wie ihn sein halbwüchsiger Sohn Fritz manchmal scherzhaft nannte. Zunächst verglich er die Preise neuer Räder in den Geschäften und erfuhr dabei zweierlei: Erstens waren gute Modelle lächerlich teuer, und zweitens mochte er die robusten Mountainbikes lieber als die tuntigen Rennräder. Anschließend sah er sich in den Leihhäusern und An- und Verkauf-Läden um, aber dort gab es fast nur ausgediente alte Supermarkt-Modelle, und sogar die neuen waren klapprige Drahtesel. Dann las er eine Anzeige in der Zeitung, in der in den höchsten Tönen ein Giant Alias angepriesen wurde: 27 Gänge, superleichter Alurahmen, Shimano-Schaltung und Scheibenbremsen, gratis dazu eine Werkzeug-Satteltasche und ein Helm, und das Ganze »nur einen Monat alt, Neupreis 7500 Rand, aufrüstbar für DH«. Am Telefon erklärte der Verkäufer, DH stehe für Downhill, als wüsste Griessel selbstverständlich, was das bedeutete. Und da dachte er: 3500 Rand, das ist wirklich ein Schnäppchen, und was habe ich mir schon gegönnt, nachdem mich meine Frau rausgeworfen hat? Nichts. Die Sitzgarnitur aus dem Leihhaus von Mohammed »Hot Lips« Faizal. Und den Kühlschrank. Und dazu die Bassgitarre, die er Fritz zu Weihnachten schenken wollte, noch so ein Faizal-Glückstreffer, den er im September gelandet hatte. Das war alles. Nur das Nötigste. Der Laptop zählte nicht, den brauchte er, um mit Carla in Kontakt zu bleiben.
Als er das Fahrrad gekauft hatte, hatte er allerdings nicht an Weihnachten gedacht und die Ausgaben, die im Dezember noch auf ihn zukamen. Er handelte den Verkäufer noch um zweihundert Rand runter, zog das Geld aus dem Bankautomaten, bezahlte das Rad und fuhr am nächsten Morgen los. In seiner alten Rugbyhose, einem T-Shirt, Sandalen und dem verflixten peinlichen Helm. Dabei stellte er fest, dass die Gegend, in der er wohnte, nicht gerade ideal zum Radfahren war. Seine Wohnung lag nämlich ein gutes Stück den Tafelberg hinauf. Wenn man in Richtung Meer fuhr, musste man auf dem Rückweg die ganze Steigung wieder hinaufstrampeln. Oder man quälte sich erst bergauf in Richtung Kloofnek, um auf der Rückfahrt das Gefälle zu genießen, aber leiden musste man in jedem Fall. Schon nach knapp einer Woche gab er auf. Bis Doc Barkhuizen ihm den Rat mit den fünf Minuten erteilte.
»So mache ich das immer, Bennie. Wenn ich mich nicht aufraffen kann, sage ich mir: Nur fünf Minuten! Wenn ich nach fünf Minuten immer noch keine Lust habe, kehre ich wieder um.«
Griessel hatte es versucht – und war nicht ein einziges Mal wieder umgekehrt. Einmal unterwegs, fuhr man auch weiter. Ende November fand er allmählich Gefallen an dieser Freizeitbeschäftigung. Er hatte inzwischen eine Lieblingsstrecke. Um kurz nach sechs fuhr er die St. Johnsstraat hinunter und durchquerte widerrechtlich den Kompanjiestuin, bevor die übereifrigen Parkwächter ihren Dienst antraten. Dann bog er in die Adderleystraat ein und winkte den Blumenverkäufern am Goue Akker zu, die ihre Ware von den Transportern luden, fuhr bis ganz nach unten in die Duncanstraat am Hafen und sah nach, welche Schiffe an diesem Tag vor Anker lagen. Anschließend radelte er durch das Waterkant-Viertel bis zum Schwimmbad in Seepunt. Er betrachtete das Meer, den Berg und die Leute, die schönen, jungen Joggerinnen mit den langen, braunen Beinen und den wippenden Brüsten, die energisch marschierenden Rentner, Mütter mit Babys in Kinderwagen und andere Radfahrer, die ihn trotz seiner uncoolen Kleidung grüßten. Dann kehrte er um und fuhr zurück, insgesamt sechzehn Kilometer, und er fühlte sich gut. Wegen seiner eigenen Leistung. Wegen der Stadt, von der er so lange nur den schmutzigen Hinterhof gesehen hatte.
Und weil er das Fahrrad so günstig erstanden hatte natürlich. Doch dann, zwei Wochen vor Weihnachten, verkündete sein Sohn Fritz, er wolle doch nicht Bass spielen, sondern E-Gitarre. »Leadgitarre, Papa, Mensch, Papa, wir waren Freitagabend auf dem Konzert von ›Wellblech‹, und die haben diesen Leadgitarristen, Basson Laubscher, einfach Wahnsinn, Papa. Virtuos. Genial. Das wäre mein Traum, Papa.«
Wellblech.
Er hatte nicht mal gewusst, dass es eine Band dieses Namens gab.
Und das, nachdem Griessel bereits zwei Monate lang die Bassgitarre versteckt hatte, die er Fritz zu Weihnachten schenken wollte. Da musste er erneut mit Hot Lips Faizal reden, der jedoch so kurzfristig nur eine einzige Gitarre auf Lager hatte, eine verdammte Fender, so gut wie neu und auch fast so teuer. Und was er Fritz schenkte, dessen Gegenwert musste er auch seiner Tochter Carla nach London schicken, und da war er plötzlich pleite, denn Anna zwang ihn, Unterhalt wie nach einer Scheidung zu zahlen, wobei ihm ihre Berechnungsgrundlage völlig schleierhaft war. Ja, er hatte das ungute Gefühl, gemolken zu werden, denn sie verdiente gar nicht schlecht als Anwaltsassistentin. Doch auf seine Einwände erwiderte sie nur: »Für Alkohol hattest du immer Geld, Bennie, das war nie ein Problem.«
Die moralische Keule. Sie saß auf dem hohen Ross, weil er Mist gemacht hatte. Deswegen musste er bluten. Es war Teil seiner Strafe.
Aber das war es nicht, was ihm im Magen lag.
Griessel seufzte und kehrte um, zurück zum Tatort. Als er schließlich den Blick über die wachsende Menge der Schaulustigen schweifen ließ und daran dachte, dass man etwas gegen sie unternehmen musste, wusste er plötzlich, woher die rätselhafte innere Unruhe rührte.
Die Ursache war weder sein sexuelles Abenteuer noch seine finanzielle Lage noch der Hunger. Es war eine Vorahnung. Als verhieße dieser Tag Unheil.
Er schüttelte den Kopf. Er hatte sich noch nie von solchem Firlefanz irritieren lassen.
Die Metro-Polizisten halfen eifrig, eine junge Farbige in weißem Kittel über die Zaunspitzen zu bugsieren. Einmal auf der anderen Seite nahm sie ihre Tasche, nickte den Polizisten dankend zu und gesellte sich zu Griessel und Ndabeni. Sie kannten die Farbige nicht.
»Tiffany October«, stellte sie sich vor und reichte Bennie ihre kleine Hand. Er sah, dass sie leicht zitterte. Tiffany October trug eine schmale Brille mit schwarzem Gestell, und unter ihrem Make-up waren Spuren von Akne zu erkennen. Ihre Gestalt unter dem weißen Kittel war schmal und zart.
»Bennie Griessel«, sagte der Ermittler und zeigte auf seinen Kollegen. »Das ist Inspekteur Vusumuzi Ndabeni. Er leitet die Ermittlungen.«
»Sie können mich Vusi nennen.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen«, sagte die Frau und schüttelte ihm die Hand.
Die beiden Männer blickten sie fragend an. »Ich bin die Rechtsmedizinerin!«, fauchte sie plötzlich.
»Sie sind neu?«, fragte Vusi nach einer peinlichen Stille.
»Ja, ich arbeite heute zum ersten Mal allein am Tatort.« Tiffany October lächelte nervös. Dick und Doof von der Spusi kamen neugierig herüber, um sie zu beschnuppern. Beiden schüttelte sie höflich die Hand.
»Seid ihr fertig?«, fragte Griessel ungeduldig.
»Wir müssen noch den Weg und die Mauer untersuchen«, sagte Jimmy, der Dünne, und, an seinen kleineren Kollegen gewandt: »Bennie ist ein Morgenmuffel.«
Griessel ignorierte ihre ewigen Sticheleien.
Tiffany October blickte hinunter auf die Leiche.
»Ai«, sagte sie.
Die Ermittler reagierten nicht. Schweigend sahen sie zu, wie sie ihre Tasche öffnete, Handschuhe herausholte und sich neben das Mädchen kniete.
Vusi neigte sich näher zu Griessel. »Bennie, ich habe den Fotografen gebeten, Aufnahmen von ihrem Gesicht zu machen, aber so, dass die Wunde nicht zu sehen ist. Ich möchte die Bilder gerne in der Langstraat herumzeigen. Wir müssen sie identifizieren. Und vielleicht könnten wir diese Fotos auch an die Medien weitergeben.«
Griessel nickte. »Gute Idee. Aber du musst den Fotografen ein bisschen unter Druck setzen, bei denen dauert das sonst ewig.«
»Mache ich.« Ndabeni beugte sich zu der Rechtsmedizinerin. »Können Sie uns vielleicht ungefähr sagen, wann sie gestorben ist?«
Tiffany October blickte nicht einmal auf. »Nein, das wäre verfrüht.«
Griessel fragte sich, wo Professor Phil Pagel, der Leiter der Rechtsmedizin, heute Morgen blieb. Pagel hätte sich hingehockt und ihnen eine Schätzung genannt, die nur um höchstens eine halbe Stunde vom tatsächlichen Todeszeitpunkt abwich. Er hätte einen Finger in die Blutpfütze getaucht, hier gefühlt und dort an der Leiche herumgedrückt. Er hätte erklärt, dass die kleinen Muskeln als Erste von der Leichenstarre erfasst wurden, und geschätzt, sie sei seit soundsovielen Stunden tot. Später würde er seine Angaben bestätigen. Aber Tiffany October besaß nicht Pagels Erfahrung.
»Geben Sie uns nur einen Hinweis«, bat Griessel.
»Nein, das kann ich noch nicht.«
Tiffany October hatte Angst, einen Fehler zu machen. Griessel ging zu Vusi und flüsterte ihm ins Ohr: »Sie liegt schon lange da, Vusi. Das Blut ist schon schwarz.«
»Wie lange?«
»Ich weiß es nicht genau. Vier Stunden vielleicht oder sogar länger. Fünf.«
»Okay. Also müssen wir Gas geben.«
Griessel nickte. »Sieh zu, dass du schnell an die Fotos kommst. Und rede mit den Metro-Leuten. Sie haben Videokameras, mit denen sie die Straßen beobachten – auch die Langstraat. Wollen wir hoffen, dass die Dinger heute Nacht funktioniert haben. Der Überwachungsraum ist in der Waalstraat. Vielleicht kann man auf den Bändern etwas erkennen.«
»Danke, Bennie.«
Sie schlief ein, an der Wand hinter den Sträuchern.
Sie hatte sich nur für einen Moment ausruhen wollen. Mit geschlossenen Augen und dem Rucksack noch auf dem Rücken hatte sie sich gegen die Mauer sinken lassen und die Beine ausgestreckt. Nur für einen Augenblick wollte sie der Erschöpfung und Anspannung nachgeben. Die Geschehnisse der letzten Nacht spukten ihr wie Dämonen durch den Kopf. Um ihnen zu entfliehen, hatte sie an ihre Eltern gedacht und sich gefragt, wie spät es jetzt zu Hause war. Doch die Berechnung des Zeitunterschiedes war zu viel für sie gewesen. Wenn es in West Lafayette jetzt auch früh am Morgen wäre, würde ihr Vater mit dem Journal & Courier am Frühstückstisch sitzen und über die Entscheidungen des Schiedsrichters aus Purdue den Kopf schütteln. Ihre Mutter wäre spät dran wie immer. Eilig würden ihre Absätze die Treppe hinunterklappern, und sie hätte die verschlissene braune Ledertasche schon über die Schulter geworfen. »Ich komme zu spät, ich komme zu spät. Wie konnte das nur wieder passieren?« Ihr Vater würde die Zeitung sinken lassen. »Es ist ein Mysterium, mein Schatz«, würde er sagen, und er und seine Tochter würden sich ihr rituelles Lächeln über den Küchentisch hinweg zuwerfen.
Der Gedanke an den Alltag, die Geborgenheit und die Sicherheit ihres Elternhauses erfüllten sie mit schrecklicher Sehnsucht. Sie stellte sich vor, wie sie ihre Eltern anriefe, jetzt, in diesem Augenblick, wie sie ihre Stimmen hörte und ihnen sagte, wie sehr sie sie liebte. Sie führte ein imaginäres Gespräch mit ihrem Vater, der leise und ruhig antwortete, und darüber übermannte sie der Schlaf.
3
Dr. Tiffany October rief nach ihnen: »Inspekteur!«
»Ja?«
»Ich könnte vielleicht ein bisschen spekulieren …«
Griessel fragte sich, ob sie ihn eben gehört hatte.
»Ja, das würde uns schon weiterhelfen.«
»Ich glaube, dass sie hier getötet wurde, am Fundort. Das Muster der Blutung weist darauf hin, dass der Täter ihr in der Position die Kehle durchgeschnitten hat, in der sie jetzt liegt. Er muss sie zu Boden gedrückt haben, so, auf den Bauch, und dann den Schnitt gesetzt haben. Es gibt keine Spritzer, die darauf hindeuten, dass sie aufrecht gestanden hat.«
»Aha …« Darauf war er auch schon von selbst gekommen.
»Und diese beiden Schnitte …« Die Rechtsmedizinerin zeigte auf die Wunden, die sich quer über die Schulterblätter des Mädchens zogen.
»Ja?«
»Es sieht so aus, als seien sie post mortem zugefügt worden.«
Griessel nickte.
»Das hier scheinen Fasern zu sein …« Dr. October berührte mit einer Art Metallpinzette vorsichtig die Wunde. »Synthetisches Material in einer dunklen Farbe, ganz anders als die Kleidung der Toten.«
Ndabeni blickt hinüber zu den Kriminaltechnikern, die inzwischen gebückt den Weg entlanggingen, die Köpfe dicht beieinander, mit suchenden Blicken, dabei ununterbrochen plaudernd. »Jimmy!«, rief er. »Kommt mal her, wir haben hier was für euch.« Dann beugte er sich hinunter zu der Rechtsmedizinerin.
Sie sagte: »Ich glaube, er hat ihr etwas vom Rücken geschnitten. Wahrscheinlich einen Rucksack, also die Tragegurte, Sie wissen schon …«
Jimmy kniete sich neben sie. Tiffany October zeigte ihm die Fasern. »Ich warte, bis Sie sie gesichert haben.«
»Okay«, sagte Jimmy. Er und sein Kollege packten Material aus, um die Fasern einzusammeln. Dabei setzten sie ihr Gespräch fort, als habe es keine Unterbrechung gegeben: »Ich sage dir, sie heißt Amore.«
»Nein, nicht Amore, sondern Amor«, entgegnete der dicke Arnold, nahm eine kleine, transparente Plastiktüte aus seiner Tasche und hielt sie für seinen Kollegen bereit.
»Worum geht es denn?«, fragte Vusi.
»Um Joosts Frau.«
»Welcher Joost?«
»Van der Westhuizen.«
»Wer ist das?«
»Der Rugbyspieler.«
»Er war Kapitän der Nationalmannschaft, Vusi.«
»Ich hab’s mehr mit Fußball.«
»Egal, jedenfalls hat sie solche Riesen…« Arnold deutete mit beiden Händen große Brüste an. Tiffany October wandte pikiert den Blick ab. »Ich sag doch bloß, wie’s ist!«, verteidigte sich Arnold.
Jimmy zog die Fasern vorsichtig mit einer kleinen Zange aus der Wunde des Mädchens. »Amore heißt sie«, behauptete er beharrlich.
»Nein, Amor, jetzt glaub mir doch! Also, und da ist dieser Typ einfach zu ihr auf die Bühne gegangen …«
»Was für ein Typ?«, fragte Vusi.
»Keine Ahnung, irgend so ein Kerl, der sich eine ihrer Shows angesehen hat. Jedenfalls hat er nach dem Mikrofon gegriffen und gesagt: ›Du hast die schönsten Titten im ganzen Showbusiness.‹ Das hat er zu Amor gesagt, und Joost ist total ausgeflippt.«
»Shows? Sie tritt in Shows auf?«, fragte Griessel.
»Mann, Bennie, liest du denn nicht den Huisgenoot? Sie ist Sängerin!«
»Joost hat sich also diesen Typen geschnappt und gesagt: ›So redest du nicht mit meiner Frau!‹, und da hat der Typ geantwortet: ›Aber sie hat eben schöne Titten.‹« Arnold lachte laut, Jimmy fiel kichernd ein. Tiffany October stand entnervt auf und entfernte sich.
»Was denn?«, sagte der Kleine ein wenig schuldbewusst. »Das ist wirklich genauso passiert.«
»Vielleicht hättest du lieber ›Brüste‹ sagen sollen«, meinte Jimmy.
»Aber der Typ hat es so gesagt.«
»Warum hat Joost ihn nicht fertiggemacht?«
»Das frage ich mich auch. Er hat Jonah Lomu getackelt, dass die Fetzen flogen, und er reißt ganze Bäume aus, wenn er sauer ist, doch einen Typen, der über die T… – die Brüste seiner Frau redet, den lässt er ungeschoren.«
»Na ja, aber vor Gericht würde er ja auch kaum damit durchkommen. Der Anwalt von dem Typen bräuchte dem Richter nur einen Stapel Huisgenoot-Ausgaben auf den Tisch zu legen: ›Euer Ehren, sehen Sie die Fotos? Das ist der Beweis, dass mein Mandant recht hat.‹ Wenn eine Frau sich so fotografieren lässt, muss ihr Mann vorher wissen, dass danach alle Kerle über ihre Möpse reden, als ob sie ihnen gehörten.«
»Hast recht. Aber trotzdem heißt sie Amor.«
»Nein!«
»Du denkst an Amore Bekker, den DJ.«
»Nein, tu ich nicht. Aber eins sage ich dir: Ich würde meine Frau nicht so rumlaufen lassen.«
»Aber deine Frau hat auch nicht die schönsten Titten im ganzen Showbusiness. Und schließlich soll man zeigen, was man hat.«
»Seid ihr jetzt fertig?«, fragte Bennie.
»Nein, wir müssen noch den restlichen Weg und die Mauer absuchen«, sagte Jimmy und stand auf. Vusi rief den Fotografen. »Wie schnell können meine Porträts fertig sein?«
Der Fotograf, ein junger Mann mit langen Locken, zuckte mit den Schultern. »Mal sehen.«
Sag ihm, er soll Gas geben, sonst gibt’s einen Tritt in den Hintern, dachte Griessel. Aber Vusi nickte nur.
»Von wegen ›mal sehen‹!«, herrschte Griessel ihn an. »Noch vor acht haben wir sie vorliegen. Keine Diskussion!«
Verschnupft stelzte der Fotograf davon. Griessel warf ihm wütende Blicke hinterher. »Danke, Bennie«, sagte Vusi leise.
»Du musst knallhart sein, Vusi.«
»Ich weiß …«
Nach einem kurzen, unbehaglichen Schweigen fragte Vusi: »Was übersehe ich, Bennie?«
Griessel sprach bewusst leise und kollegial. »Der Rucksack – es muss Raubmord gewesen sein, Vusi. Ihr Geld, ihr Pass, ihr Handy …«
Ndabeni begriff schnell. »Du glaubst, der Rucksack wurde irgendwo weggeworfen.«
Griessel hielt es nicht mehr aus, tatenlos herumzustehen. Er blickte sich um zu dem Bürgersteig, wo das Gedränge der Sensationstouristen aus dem Ruder zu laufen drohte. »Ich kümmere mich darum, Vusi. Komm, sorgen wir dafür, dass die Metro-Leute auch mal was zu tun haben.« Er trat an die Mauer und rief: »Wer führt hier den Befehl?«
Die Uniformierten sahen sich an.
»Für den Bürgersteig sind wir zuständig«, antwortete ein farbiger Metro-Polizist mit beeindruckender Uniform, von oben bis unten mit Rangabzeichen behangen. Vermutlich ein Feldmarschall, dachte Griessel.
»Sie sind verantwortlich?«
»Richtig.«
Griessel spürte, wie Ärger in ihm aufstieg, denn ihm war das ganze Konzept der Stadtpolizei zuwider, blöde Verkehrsbullen, die ihre Arbeit nicht ordentlich erledigten. Auf den Straßen machten alle, was sie wollten. Doch er beherrschte sich und zeigte auf einen SAPS-Konstabel. »Ich möchte, dass Sie diesen Bürgersteig absperren, von da unten bis hier oben. Wenn die Leute gaffen wollen, sollen sie sich auf die andere Straßenseite stellen.«
Der Konstabel schüttelte den Kopf. »Wir haben gar kein Absperrband.«
»Dann holen Sie eben Absperrband!«
Dem Konstabel missfiel seine Aufgabe, aber er drehte sich um und bahnte sich einen Weg durch die Menge. Von links drängte sich ein Krankenwagen durch die Schaulustigen.
»Das ist unser Bürgersteig!«, beschwerte sich der schwerbehangene Metro-Polizist erbost.
»Sind Sie hier der Vorgesetzte?«, fragte ihn Bennie.
»Ja.«
»Wie heißen Sie?«
»Jeremy Oerson.«
»Und die Bürgersteige gehören zu Ihrem Zuständigkeitsbereich?«
»Ja.«
»Ausgezeichnet«, sagte Griessel. »Sorgen Sie dafür, dass der Krankenwagen hier parkt. Genau hier. Und dann möchte ich, dass Sie jeden Bürgersteig und jede Gasse von hier aus in einem Umkreis von sechs Blocks absuchen. Das Opfer trug einen Rucksack, und diesen Rucksack wollen wir haben. Durchkämmen Sie jeden Mülleimer, jede Ecke und jeden Winkel. Verstanden?«
Der Mann sah ihn lange an. Vermutlich erwog er die Konsequenzen einer Weigerung. Dann nickte er mürrisch und fing an, seinen Untergebenen Befehle zuzublaffen.
Griessel kehrte zu Vusi zurück.
»Kommen Sie, sehen Sie sich das mal an!«, rief die Rechtsmedizinerin über die Leiche gebeugt.
Sie gesellten sich zu ihr. Die Ärztin hatte mit einer kleinen Zange das Etikett hinten im Sporthemd des Mädchens herausgezogen.
»Broad Ripple Vintage, Indianapolis«, sagte sie und blickte sie vielsagend an.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte Vusi Ndabeni.
»Ich glaube, sie kommt aus Amerika«, antwortete Tiffany October.
»Scheiße!«, stöhnte Bennie Griessel. »Sind Sie sicher?«
Mit hochgezogenen Augenbrauen ob seines Sprachgebrauchs antwortete Tiffany October: »Ziemlich sicher.«
»Das gibt Ärger«, prophezeite Ndabeni. »Gewaltigen Ärger.«
07:02 – 08:13
4
In der Bibliothek des großen Hauses in der Brownlowstraat, Stadtteil Tamboerskloof, wurde Alexandra Barnard von den schrillen, verängstigten Schreien ihrer Haushaltshilfe aus dem Schlaf gerissen.
Es war ein surrealistischer Augenblick. Sie wusste nicht, wo sie war, ihre Glieder fühlten sich seltsam steif und verrenkt an, ihr Schädel brummte, und ihre Gedanken waren zäh wie kalte Melasse. Sie hob den Kopf und versuchte, ihren Blick zu schärfen. Sie erkannte die untersetzte Farbige an der Tür. Ihr Mund war zu einer Grimasse des Abscheus verzogen, und sie stieß weiterhin markerschütternde Schreie aus.
Alexandra stellte fest, dass sie rücklings auf dem Perserteppich lag, und fragte sich, wie sie hier hergeraten war. Während sie sich des widerlichen Geschmacks im Mund sowie der Tatsache bewusst wurde, dass sie besoffen auf dem Boden geschlafen hatte, folgte sie dem Blick von Sylvia Buys: Jemand lag neben dem großen braunen Ledersessel ihr gegenüber. Sie drückte sich mit beiden Armen hoch. Sylvia sollte endlich aufhören zu schreien! Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass ihr gestern Abend jemand beim Trinken Gesellschaft geleistet hatte. Wer lag bloß da? Sie setzte sich auf, damit sie besser sehen konnte, und erkannte die Gestalt. Es war Adam. Ihr Gatte. Er trug nur einen Schuh; am anderen Fuß hing eine Socke, als hätte er sie ausziehen wollen. Schwarze Hose, weißes Hemd, auf der Brust schwarz verschmiert.
Und dann, als hätte endlich jemand die Kamera scharf eingestellt, begriff sie, dass Adam verletzt war. Das Schwarze auf seiner Brust war Blut, das Hemd war zerfetzt.
Mit beiden Händen auf den Teppich gestützt, versuchte Alexandra aufzustehen, verwirrt, stumm vor Schreck. Sie sah die Flasche und das Glas auf dem Holztischchen neben ihr. Ihre Finger berührten etwas; sie sah hin und erkannte eine Pistole. Adams Pistole. Was machte die Waffe hier?
Sie stand auf.
»Sylvia«, sagte sie.
Die Frau schrie weiter.
»Sylvia!«
Die plötzliche Stille war eine schreckliche Erleichterung. Sylvia stand an der Tür, die Hände vor den Mund geschlagen, die Augen starr auf die Pistole gerichtet.
Alexandra Barnard tastete sich zwei Schritte voran und blieb dann stehen. Adam war tot. Das erkannte sie jetzt, anhand der Wunden und der Art, wie er dalag, aber sie begriff es nicht. Träumte sie?
»Warum?«, schrie Sylvia sie an, an der Grenze zur Hysterie.
Alexandra sah sie an.
»Warum haben Sie ihn getötet?«
Die Rechtsmedizinerin und die beiden Sanitäter legten die Leiche behutsam in einen schwarzen Sack mit Reißverschluss. Griessel saß auf der Steinumrandung einer Palme. Vusi Ndabeni sprach mit dem Dienststellenleiter. »Ich brauche mindestens vier, Sup, für die Recherchen … Ja, ich verstehe, aber es handelt sich um eine amerikanische Touristin … Ja, wir sind ziemlich sicher … Ich weiß, ich weiß. Nein, noch nichts … Danke, Sup, ich warte auf sie.«
Er kam zu Bennie hinüber. »Der Chef sagt, es gäbe heute irgendeine Demonstration der Arbeitergewerkschaft vor dem Parlament, daher könne er nur zwei Leute entbehren.«
»Ach, es gibt immer irgendeine Demonstration von irgendeiner verdammten Gewerkschaft.« Griessel seufzte und stand auf. »Ich helfe dir bei den Recherchen, Vusi, sobald die Fotos da sind.« Er konnte einfach nicht tatenlos herumsitzen.
»Danke, Bennie. Möchtest du einen Kaffee?«
»Schickst du jemanden einen holen?«
»Nein, unten an der Straße gibt es ein Café, ich geh schnell.«
»Lass nur, ich besorge uns einen.«
Sie drängten sich vor dem Schalter der Wache am Caledonplein, die Kläger, die Opfer, die Zeugen und die Mitläufer, um von den Ereignissen der vergangenen Nacht zu berichten. Über die Kakophonie der protestierenden und klagenden Stimmen hinweg klingelte ein Telefon, schrill und eintönig. Eine Sergeantin, erschöpft nach neun harten Stunden auf den Beinen, ignorierte das nächste stirnrunzelnde Gesicht vor ihr am Schalter und griff nach dem Hörer. »Caledon Square, Sergeant Thanduxulo Nyathi am Apparat, was kann ich für Sie tun?«
Eine Frauenstimme, fast unhörbar leise.
»Bitte sprechen Sie lauter, Madam, ich kann Sie nicht verstehen.«
»Ich möchte etwas melden.«
»Ja?«
»Mir ist eine junge Frau begegnet …«
»Ja?«
»Heute Morgen so gegen sechs Uhr, am Signal Hill. Sie sagte, ich solle bei der Polizei anrufen, denn jemand wolle sie umbringen.«
»Einen Augenblick, bitte.« Die Sergeantin zog sich ein Formblatt heran und holte einen Kuli aus der Brusttasche. »Wie war noch Ihr Name?«
»Also, eigentlich wollte ich das nur melden …«
»Ich weiß, aber wir brauchen trotzdem Ihren Namen.«
Stille.
»Hallo?«
»Mein Name ist Sybil Gravett.«
»Und Ihre Adresse?«
»Ich weiß wirklich nicht, was das zur Sache tut. Ich habe die junge Frau am Signal Hill gesehen, als ich mit meinem Hund spazieren gegangen bin.«
Die Polizistin unterdrückte einen Seufzer. »Und was ist dann passiert?«
»Nun, sie ist auf mich zugelaufen und hat gesagt, ich solle die Polizei anrufen, jemand wolle sie umbringen, und dann ist sie weitergerannt.«
»Ist ihr jemand gefolgt?«
»Ja, nach ein paar Minuten kamen sie angerannt.«
»Wie viele, Madam?«
»Nun, ich habe die Männer nicht gezählt, aber es müssen fünf oder sechs gewesen sein.«
»Können Sie die Verfolger beschreiben?«
»Sie waren, nun, einige waren weiß und einige schwarz. Und sie waren noch ziemlich jung … Ich fand es besorgniserregend, wie diese jungen Männer so verbissen hinter der jungen Frau hergelaufen sind.«
Sie schrak aus dem Schlaf hoch, weil jemand sie anschrie. Voller Angst wollte sie aufspringen, aber ihre Beine versagten ihr den Dienst, so dass sie stolperte und mit einer Schulter gegen die Mauer prallte.
»Bis obenhin zugedröhnt, was?« Der Mann stand vor den Sträuchern, die Hände auf den Hüften. Es war dieselbe Stimme, die eben vom Haus her ihren Verfolger angebrüllt hatte.
»Bitte!«, flehte sie und rappelte sich auf.
»Verlassen Sie sofort mein Grundstück!«, herrschte der Mann sie an und zeigte auf das Gartentor. »Was soll das? In meinem Büschen den Rausch ausschlafen!«
Sie bahnte sich einen Weg durch die Hecke. Der Mann trug einen dunklen Anzug. Ein Geschäftsmann mittleren Alters, kochend vor Wut. »Bitte, Sie müssen mir helfen …«
»Nein! Knall dich woanders mit dem Zeug zu! Ich habe die Nase voll! Raus hier!«
Sie fing an zu weinen und ging auf ihn zu. »Nein, Sie irren sich, bitte, ich komme aus A…«
Der Mann packte sie am Arm und schleifte sie zum Tor. »Ist mir doch scheißegal, wo du herkommst!« Aggressiv zerrte er an ihr. »Ich will nur, dass ihr verdammten Junkies aufhört, eure dreckigen Sachen auf meinem Grundstück zu machen!« Beim Tor angekommen, stieß er sie auf die Straße. »Und jetzt hau bloß ab, sonst rufe ich die Polizei!«, zischte er, machte auf dem Absatz kehrt und ging zurück zum Haus.
»Ja, bitte rufen Sie die Polizei!«, sagte sie schluchzend. Ihre Schultern zuckten, und sie bebte am ganzen Leib. Doch er hielt nicht inne, ging durch eine Gittertür, knallte sie hinter sich zu und verschwand.
»Oh, Gott!« Weinend und zitternd stand sie auf dem Bürgersteig. »Oh, Gott!« Aber durch den Tränenschleier hindurch blickte sie instinktiv die Straße entlang, erst nach links, dann nach rechts. Und tatsächlich: Weit oben, kurz bevor sich die Straße über die Flanke des Berges wand, standen zwei von ihnen. Kleine wartende Gestalten mit dem Handy am Ohr. Sie erschrak und setzte sich in Bewegung, weg von ihnen, in die Richtung, aus der sie vorhin gekommen war. Sie wusste nicht, ob sie sie gesehen hatten, und hielt sich dicht an den Mauern der Häuser. Dann blickte sie sich um und sah, dass sie auf sie zurannten.
Vor Verzweiflung war sie wie gelähmt. Vielleicht war es besser, einfach stehen zu bleiben und das Unvermeidliche über sich ergehen zu lassen, damit alles vorbei wäre. Für einen Augenblick erschien ihr diese Möglichkeit fast unwiderstehlich, der perfekte Ausweg, so dass sie ihre Schritte verlangsamte. Doch dann sah sie wieder Erin in der vergangenen Nacht vor sich. Adrenalin pulsierte durch ihre Adern, und weinend rannte sie los.
Als Griessel mit dem Kaffee kam, hoben die Sanitäter gerade die Leiche auf einer Tragbahre über die Mauer. Die Schaulustigen drängten sich näher heran, bis an das gelbe Flatterband, mit dem der Bürgersteig abgesperrt war. Griessel wunderte sich schon lange nicht mehr über die makabere Faszination, die der Tod auf die Leute ausübte. Er reichte seinem Kollegen einen Styroporbecher.
»Danke, Bennie.«
Der Kaffeeduft erinnerte Griessel daran, dass er noch nicht gefrühstückt hatte. Vielleicht konnte er zwischendurch kurz nach Hause gehen und einen Teller WeetBix essen, bevor die Fotos entwickelt waren, schließlich lag seine Wohnung nur einen Kilometer entfernt. Dann könnte er auch nachsehen, ob Carla ihm geschrieben hatte, denn gestern Abend …
Nein, er würde jetzt nicht über gestern Abend nachdenken.
Vusi sagte etwas auf Xhosa, was er nicht verstand, ein Ausruf des Erstaunens. Er folgte dem Blick des schwarzen Fahnders und sah, wie drei Metro-Polizisten über die Mauer kletterten. Oerson, den sich Griessel vorhin vorgeknöpft hatte, trug einen blauen Rucksack in der Hand. Enthusiastisch kamen sie auf sie zumarschiert.
»uNkulunkulu«, sagte Vusi.
»Fok«, sagte Griessel.
»Wir haben ihn gefunden«, verkündete der Feldmarschall selbstzufrieden und hielt Vusi den Rucksack hin.
Der Xhosa schüttelte den Kopf und zog die Gummihandschuhe wieder aus der Tasche.
»Was ist?«, fragte Oerson.
»Beim nächsten Mal«, antwortete Griessel mühsam beherrscht, »wäre es besser, wenn Sie uns Bescheid sagen würden, sobald Sie ein Beweismittel gefunden haben. Dann benachrichtigen wir die Spurensicherung und sperren das Umfeld ab, ehe sich jemand an dem Gegenstand zu schaffen macht.«
»Aber er hat in der Bloemstraat in einem verdammten Hauseingang gelegen. Tausend Leute könnten ihn angefasst haben. Außerdem ist sowieso nicht viel drin.«
»Sie haben ihn aufgemacht?«, fragte Vusi ungläubig, als er den Rucksack annahm. Die beiden Trageriemen waren durchgeschnitten, genau wie die Rechtsmedizinerin vermutet hatte.
»Es hätte eine Bombe drin sein können«, rechtfertigte sich Oerson.
»Haben Sie die Sachen etwa angefasst?«, wollte Vusi wissen und holte ein Schminktäschchen aus dem Rucksack. Er hockte sich hin, um den Inhalt auf dem Asphaltweg auszubreiten.
»Nein«, antwortete Oerson, aber Griessel wusste, dass er log.
Vusi zog eine Serviette des Steers aus dem Rucksack, dann ein geschnitztes kleines Nilpferd aus dunklem Holz, einen weißen Plastiklöffel und eine Petzl-Kopflampe. »Ist das alles?«, fragte er.
»Das ist alles«, sagte Oerson.
»Könnten Sie mir bitte einen Gefallen tun?«
Die Uniformierten antworteten nicht.
»Könnten Sie noch einmal nachsehen, ob Sie nicht noch andere Sachen finden? Vielleicht hat jemand etwas weggeworfen. Egal, irgendetwas. Am liebsten hätte ich natürlich einen Identitätsnachweis, einen Pass, einen Führerschein, irgend so etwas …«
Oerson war nicht gerade begeistert. »Wir können Sie nicht den ganzen Tag lang unterstützen.«
»Ich weiß«, erwiderte Vusi sanft und geduldig. »Nur noch dieses eine Mal, bitte.«
»Okay. Ich nehme noch ein paar von meinen Leuten mit«, sagte Oerson. Sie machten kehrt und kletterten wieder über die Mauer.
Vusi fuhr mit den Fingern in die kleinen Seitentaschen des Rucksacks. In der ersten fand er nichts. In der zweiten fühlte er etwas ganz tief unten – ein grünes Pappkärtchen mit einem schwarzgelben Logo darauf: Hodsons Bay Company. Und in kleinerer Schrift darunter: Bicycles, fitness, backpacking, camping, climbing gear, and technical clothing for all ages and abilities. Dazu eine Adresse: 360 Brown Street, Levee Plaza, West Lafayette, IN 47906. Auch zwei Telefonnummern waren angegeben. Der Xhosa studierte das Kärtchen aufmerksam und reichte es dann an Griessel weiter. »Ich glaube, IN steht für Indiana.«
»West Lafayette«, murmelte Griessel nachdenklich.