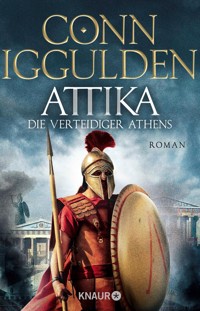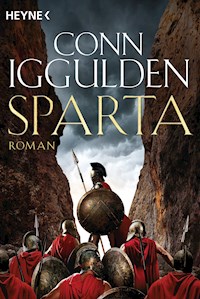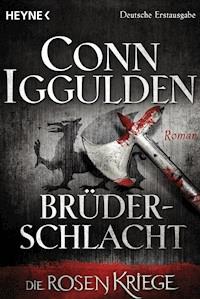9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ronin-Hörverlag, ein Imprint von Omondi GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dschingis Khan Saga
- Sprache: Deutsch
Rasend schnell verbreitet sich die Schreckensmeldung: Eine chinesische Stadt nach der anderen fällt unter den donnernden mongolischen Reitangriffen und beugt sich ihrem neuen Herrscher: Dschingis Khan. Doch im Westen erhebt sich ein neuer Feind: Für den Schah von Arabien sind die Mongolen nichts als Barbaren. Und so richtet er eine Gruppe von Dschingis Gesandten grausam hin. Um Vergeltung zu üben, marschiert Dschingis Kahn mit tausenden Kriegern in die Wüste Arabiens ein. Doch nicht nur der Reichtum der Städte, auch die Armee des Schahs entpuppt sich als gewaltiger als alles, was die Mongolen je gesehen haben! Währenddessen wächst die Unzufriedenheit in den eigenen Reihen: Seuchen wüten, besiegte Städte erheben sich wieder. Die sagenumwobenen Assassinen schlagen immer wieder aus den Schatten zu, während zwischen den beiden ältesten Söhnen des Khans ein erbitterter Streit um die Nachfolge ausbricht. Von zahllosen Feinden umringt muss Dschinghis Khan nun Überleben eines Volkes zu sichern, das tausende Meilen von seiner sicheren Heimat entfernt ist!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 826
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Prolog
Teil eins
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Teil zwei
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Teil drei
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
Epilog
Historische Anmerkungen
Impressum
Hügel der Knochen
Conn Iggulden
Aus dem Englischen von Sascha Zupancic
Prolog
In der Mitte des Kreises loderte das Feuer. Schatten flackerten darum herum, während dunkle Gestalten mit Schwertern umhersprangen und tanzten. Ihre Gewänder wirbelten, während sie andere Stimmen mit laut klagendem Gesang übertönten. Männer hatten Saiteninstrumente auf ihren Knien und zupften Melodien und Rhythmen, während sie mit den Füßen stampften.
Am Rande des Feuers kniete eine Reihe mongolischer Krieger mit nacktem Oberkörper und auf dem Rücken gefesselten Händen. Gemeinsam zeigten sie ihren triumphierenden Entführern das kalte Gesicht. Ihren Offizier Kurkhask hatte es in der Schlacht brutal erwischt. Sein Mund war blutverschmiert und sein rechtes Auge zugeschwollen. Er hatte schon Schlimmeres erlebt. Kurkhask empfand Stolz angesichts der Art und Weise, wie die anderen sich weigerten, Angst zu zeigen. Er beobachtete die dunkelhäutigen Wüstenkrieger, die die Sterne anriefen und gebogene Klingen schwangen, die mit dem Blut von Männern gezeichnet waren, die er gekannt hatte. Sie waren eine seltsame Rasse, dachte Kurkhask, diese Männer, die ihre Köpfe in viele dicke Tücher gebunden hatten und weite Tuniken über pludrige Hosen trugen. Die meisten hatten einen Bart, sodass ihre Münder nur als roter Schlitz zwischen schwarzen Borsten zu sehen waren. Sie waren durchweg hochgewachsener und muskulöser als die größten der Mongolenkrieger. Sie stanken nach seltsamen Gewürzen und viele der Männer kauten an dunklen Wurzeln und spuckten braune Klumpen auf den Boden zu ihren Füßen. Kurkhask verbarg seine Abneigung gegen sie, während sie zuckten, kläfften, tanzten und sich in einen Rausch spielten.
Der mongolische Offizier schüttelte müde den Kopf. Er war sich zu sicher gewesen, das wusste er jetzt. Die zwanzig Männer, die Temuge ihm mitgegeben hatte, waren allesamt erfahrene Krieger, aber sie waren keine Räuberbande. Als sie versuchten, die Karren mit den Geschenken und Bestechungsgeldern zu schützen, hatten sie zu langsam reagiert und waren erwischt worden. Kurkhask dachte an die Monate zuvor zurück und wusste, dass seine friedliche Mission ihn eingelullt hatte, er war unvorsichtig geworden. Er und seine Männer hatten sich in einem harten Land mit schwindelerregenden Bergpässen wiedergefunden. Sie waren durch Täler mit dürftigen Ernten gezogen und hatten Geschenke mit Bauern ausgetauscht, deren Armut alles übertraf, was er je gesehen hatte. Dennoch gab es reichlich Wild und seine Männer hatten fette Hirsche auf ihren Feuern gebraten. Vielleicht war das ein Fehler gewesen. Die Bauern hatten mahnend auf die Berge gezeigt, aber er hatte es nicht verstanden. Er hatte keinen Streit mit den Bergstämmen, aber in der Nacht hatte ein Heer von Kriegern sie überfallen. Sie waren mit wildem Geschrei aus der Dunkelheit gekommen und hatten auf die schlafenden Männer eingeschlagen. Kurkhask schloss kurz die Augen. Nur acht seiner Gefährten hatten den Kampf überlebt, doch seinen ältesten Sohn hatte er seit dem ersten Zusammenstoß nicht mehr gesehen. Der Junge hatte den Weg vor ihm ausgekundschaftet und Kurkhask hoffte, dass er überlebt hatte, um dem Khan die Nachricht zu überbringen. Allein dieser Gedanke bereitete ihm solches Vergnügen, dass es seinen bösartigen Groll beinahe aufwog.
Die Karren waren geplündert und das Silber und die Jade von den Stammesangehörigen gestohlen worden.
Als Kurkhask die Krieger mit gesenkten Augenbrauen beobachtete, sah er, dass viele von ihnen jetzt in mongolische Gewänder gekleidet waren, voller dunkle Blutspritzer auf dem Stoff.
Die Gesänge wurden immer lauter, bis Kurkhask sehen konnte, wie sich weiße Spucke an den Rändern der Münder der Männer sammelte. Er streckte seinen Rücken durch, als der Stammesführer eine Klinge zog und sich brüllend der Reihe zuwandte. Kurkhask tauschte Blicke mit den anderen aus.
»Nach dieser Nacht werden wir bei den Geistern sein und die Hügel unserer Heimat sehen«, rief er ihnen zu. »Der Khan wird uns hören. Er wird dieses Land leerfegen.«
Sein ruhiger Ton schien den arabischen Schwertträger noch mehr in Rage zu versetzen. Schatten flackerten über sein Gesicht, als er die Klinge über einem der Mongolenkrieger herumwirbelte. Kurkhask sah ausdruckslos zu. Wenn der Tod unvermeidlich war, wenn er seinen Atem im Nacken spürte, konnte er auch alle Angst beiseiteschieben und ihm ruhig begegnen. Das gab ihm zumindest eine gewisse Befriedigung. Er hoffte, dass seine Frauen viele Tränen vergießen würden, wenn sie es erfuhren.
»Sei stark, Bruder«, rief Kurkhask.
Bevor dieser antworten konnte, traf das Schwert den Kopf des Kriegers. Das Blut spritzte und die Araber johlten und trampelten mit den Füßen auf den Boden. Der Schwertträger grinste, seine Zähne leuchteten weiß gegen seine dunkle Haut. Wieder fiel das Schwert und ein weiterer Mongole kippte seitwärts auf den staubigen Boden. Kurkhask spürte, wie sich seine Kehle vor Wut zusammenschnürte, bis er fast daran zu ersticken drohte. Dies war ein Land mit Seen und klaren Bergflüssen, fast tausend Göröm westlich von Yenking.
Die Dorfbewohner, denen sie begegneten waren, waren von den fremden Gesichtern beeindruckt, aber sie waren freundlich. Noch am selben Morgen war Kurkhask mit Segenswünschen und Süßigkeiten, die seine Zähne zusammenklebten, auf den Weg geschickt worden. Er war unter blauem Himmel geritten und hatte nicht geahnt, dass die Bergstämme die Kunde seiner Anwesenheit weitertrugen. Er wusste noch immer nicht, warum sie angegriffen worden waren, es sei denn, um die Geschenke und Handelsgüter zu stehlen, die sie mit sich führten. Er suchte die Hügel nach seinem Sohn ab und hoffte erneut, dass der seinen Tod beobachten würde. Er konnte nicht würdelos sterben, wenn der Junge zusah. Es war das letzte Geschenk, das er ihm machen konnte.
Der Schwertkämpfer brauchte drei Schläge, um den dritten Kopf abzuschlagen. Als es ihm endlich gelang, hielt er ihn an den Haaren hoch zu seinen Gefährten, die lachten und in ihrer seltsamen Sprache sangen. Kurkhask hatte begonnen, ein paar Worte der paschtunischen Sprache zu lernen, aber dem Strom ihrer Worte konnte er nicht folgen. Er sah in grimmigem Schweigen zu, wie das Töten weiterging, bis er schließlich der Einzige war, der noch lebte.
Kurkhask hob den Kopf und blickte ohne Angst nach oben. Erleichterung erfüllte ihn, als er eine Bewegung jenseits des Feuerscheins wahrnahm. Etwas Weißes bewegte sich in der Dunkelheit und Kurkhask lächelte. Sein Sohn war dort draußen und gab ihm ein Zeichen. Bevor der Junge sich verraten konnte, neigte Kurkhask den Kopf. Das ferne Flackern verschwand, und Kurkhask merkte, wie alle Anspannung aus ihm wich. Er würde es dem Khan sagen.
Er sah zu dem arabischen Krieger auf, als der das blutige Stück Stahl hob.
»Meine Leute werden dich finden«, sagte Kurkhask. Der afghanische Schwertkämpfer zögerte, da er ihn nicht verstand.
»Staub sei in deinem Mund, Ungläubiger!«, rief er, die Worte ein unverständliches Gebrabbel für den mongolischen Offizier.
Kurkhask zuckte müde mit den Schultern.
»Du hast ja keine Ahnung, was du angerichtet hast«, sagte er. Das Schwert sauste auf ihn herab.
Teil eins
1. Kapitel
Der Wind auf dem hohen Bergrücken hatte sich gelegt. Dunkle Wolken zogen darüber hinweg und ließen Schattenbänder über die Erde ziehen. Der Morgen war ruhig und das Land schien leer, als die beiden Männer an der Spitze einer schmalen Kolonne ritten, einem Jagun von hundert jungen Kriegern. Die Mongolen hätten in hunderten Göröm Umkreis allein sein können, nur knarrendes Leder und schnaubende Pferdedurchbrachen die Stille. Als sie anhielten, um zu lauschen, war es, als würde die Geräuschlosigkeit über den staubigen Boden zurückkehren.
Tsubodai war ein General des Großkhans und das sah man ihm auch an. Seine Rüstung aus eisenschuppenbesetzem Leder war stark abgenutzt und wies an vielen Stellen Löcher und Rost auf. Sein Helm war dort gezeichnet, wo er ihm mehr als einmal das Leben gerettet hatte. Seine gesamte Ausrüstung war ramponiert, doch der Mann selbst blieb so hart und unnachgiebig wie Winterboden. In den drei Jahren, in denen er den Norden überfallen hatte, hatte er nur ein einziges kleines Scharmützel verloren und war am nächsten Tag zurückgekehrt, um den Stamm zu vernichten, bevor es sich herumsprechen konnte. Er hatte sein Handwerk in einem Land gemeistert, das immer kälter zu werden schien, mit jedem Göröm Einöde. Statt Karten hatte er nur Gerüchte über ferne Städte, die an Flüssen lagen, die so fest zugefroren waren, dass man auf dem Eis stehen und Ochsen rösten konnte.
An seiner rechten Schulter ritt Dschotschi, der älteste Sohn des Khans selbst. Mit gerade einmal siebzehn Jahren war er bereits ein Krieger, der das Land erben und vielleicht sogar Tsubodai im Krieg anführen würde. Dschotschi trug wie alle Krieger eine ähnliche Ausrüstung aus gefettetem Leder und Eisen und war mit den gleichen Satteltaschen und Waffen ausgerüstet. Tsubodai wusste, ohne fragen zu müssen, dass Dschotschi für seine Ration aus getrocknetem Blut und Milch lediglich Wasser benötigte, um eine nahrhafte Brühe daraus zu kochen. Das Land vergab denen nicht, die ihr Überleben auf die leichte Schulter nahmen, und beide Männer hatten die Lektionen des Winters gelernt.
Dschotschi spürte, dass er beobachtet wurde, und seine dunklen Augen flackerten auf, stets auf der Hut. Er hatte mehr Zeit mit dem jungen General verbracht als jemals mit seinem Vater, aber alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Es fiel ihm schwer, zu vertrauen, obwohl sein Respekt vor Tsubodai keine Grenzen kannte. Der General der Jungen Wölfe hatte ein Gespür für den Krieg, auch wenn er es leugnete. Tsubodai glaubte vor allem an Späher, an Training, Taktik und Bogenschießen, aber die Männer, die ihm folgten, sahen vor allem, dass er gewann, egal wie schlecht die Chancen standen. So wie andere Schwerter schmiedeten oder Sattel anfertigten, formte Tsubodai Armeen, und Dschotschi war sich des Privilegs bewusst, an seiner Seite zu lernen. Er fragte sich, ob es seinem Bruder Tschagatai im Osten ebenso gut ergangen war. Es war leicht, in Tagträumen zu schwelgen, während er über die Hügel ritt und sich die Gesichter seiner Brüder und seines Vaters vorstellte, wenn sie sahen, wie er Dschotschi gewachsen und stark geworden war.
»Was ist der wichtigste Gegenstand in deinen Rucksäcken?«, sagte Tsubodai plötzlich. Dschotschi hob seinen Blick für einen Moment in den düsteren Himmel. Tsubodai genoss es, ihn zu testen.
»Fleisch, General. Ohne Fleisch kann ich nicht kämpfen.«
»Nicht dein Bogen?« sagte Tsubodai. »Ohne Bogen, was bist du dann noch?«
»Nichts, General, aber ohne Fleisch bin ich zu schwach, um den Bogen zu benutzen.«
Tsubodai grunzte, als er hörte, wie seine eigenen Worte aufgesagt wurden. »Wenn das Fleisch weg ist, wie lange kannst du dann noch von Blut leben? Oder von Milch?«
»Sechzehn Tage höchstens, mit drei Reittieren, die sich die Wunden teilen.« Dschotschi brauchte nicht nachzudenken. Seit er und Tsubodai mit zehntausend Männern aus dem Schatten der Stadt des Chin-Kaisers geritten waren, hatte er die Antworten eingeübt.
»Wie weit könntest du in so kurzer Zeit reisen?«, fragte Tsubodai. Dschotschi zuckte mit den Schultern.
»Achthundert Göröm mit frischen Reittieren. Noch mal halb so weit, wenn ich im Sattel schlafe und esse.«
Tsubodai sah, dass der junge Mann sich kaum konzentrierte und seine Augen funkelten, als er seine Fragen blitzschnell in eine andere Richtung lenkte.
»Was stimmt mit dem Grat da vorne nicht?«, schnauzte er. Dschotschi hob erschrocken den Kopf. »Ich . . .«
»Schnell! Die Männer erwarten eine Entscheidung von dir. Leben hängen von deinen Worten ab.«
Dschotschi schluckte, aber mit Tsubodai hatte er von einem Meister gelernt.
»Die Sonne steht hinter uns, also werden wir weithin sichtbar sein, wenn wir den Kamm erreichen.« Tsubodai nickte und Dschotschi fuhr fort. »Der Boden ist staubig. Wenn wir den höchsten Punkt des Bergrückens schnell überqueren, werden wir eine Staubwolke aufwerfen.«
»Das ist gut, Dschotschi«, sagte Tsubodai. Während er sprach, trieb er sein Pferd voran und ritt hart auf den vor ihm liegenden Kamm zu. Wie Dschotschi vorausgesagt hatte, entstand hinter den hundert Reitern eine rötliche Wolke, die über ihren Köpfen schwebte. Irgendjemand würde sie bestimmt sehen und ihre Position melden.
Tsubodai hielt nicht inne, als er den Grat erreichte. Er trieb seine Stute über die Kante, wobei die Hinterläufe über lose Steine rutschten. Dschotschi tat es ihm gleich und atmete Staub ein, so dass er in seine Hand husten musste. Tsubodai war fünfzig Schritte hinter dem Kamm zum Stehen gekommen, wo das Gelände zum Tal hinabfiel. Ohne einen Befehl bildeten seine Männer eine breite Doppelreihe um ihn herum, wie ein auf dem Boden gespannter Bogen. Sie waren schon lange mit dem hitzköpfigen General vertraut, der sie anführte.
Tsubodai starrte mit gerunzelter Stirn in die Ferne. Die Hügel umgaben eine flache Ebene, die von einem Fluss durchquert wurde, der vom Frühlingsregen angeschwollen war. An seinen Ufern trabte eine langsame Kolonne, ihre Fahnen und Banner weithin sichtbar. Unter anderen Umständen wäre das ein atemberaubender Anblick gewesen, und selbst während sich sein Magen zusammenzog, spürte Dschotschi einen Anflug von Bewunderung. Zehn-, vielleicht elftausend russische Ritter ritten Seite an Seite, die Bannerfarben Gold und Rot wehten über ihren Köpfen.
Fast ebenso viele folgten in einem Geleitzug aus Karren und Reittieren, Frauen, Jungen und Dienern. Die Sonne brach in diesem Moment durch die dunklen Wolken und erhellte das Tal in ihrem Licht. Die Ritter erstrahlten.
Ihre Pferde waren wuchtige, zottelige Tiere, beinahe doppelt so schwer wie die mongolischen. Auch die Männer, die auf ihnen ritten, waren in Dschotschis Augen eine merkwürdige Sorte. Sie saßen, als wären sie aus Stein, stabil und schwer, von den Wangen bis zu den Knien in Metall gehüllt. Nur ihre blauen Augen und ihre Hände waren ungeschützt. Die gepanzerten Ritter waren für den Kampf gerüstet und trugen lange Speere, die wie Lanzen aussahen, aber mit Stahlspitzen versehen waren. Sie ritten mit aufrechtstehenden Waffen, deren Enden in Lederkappen hinter den Steigbügeln steckten. Dschotschi konnte Äxte und Schwerter sehen, die von den Hüftgürteln herabhingen, und jeder Mann ritt mit einem blattförmigen Schild, das an seinem Sattel befestigt war. Die Wimpel wehten über ihren Köpfen und sahen in den Bändern aus Gold und Schatten beeindruckend aus.
»Sie müssen uns sehen«, murmelte Dschotschi und blickte auf die Staubwolke über seinem Kopf.
Der General hörte ihn und drehte sich im Sattel um. »Sie sind keine Männer der Ebene, Dschotschi. Sie sind halbblind auf solche eine Entfernung. Hast du Angst? Sie sind groß, diese Ritter. Ich hätte Angst.«
Einen Moment lang blickte Dschotschi finster drein. Bei seinem Vater wäre das nur Spott gewesen. Doch Tsubodai sprach mit einem Leuchten in den Augen. Der General war erst in seinen Zwanzigern, zu jung eigentlich, um so viele Männer zu befehligen. Tsubodai hatte trotzdem keine Angst.
Dschotschi wusste, dass der General sich weder um die massiven Schlachtrösser, noch um die Männer, die sie ritten, Sorgen machte. Er vertraute auf die Schnelligkeit und die Pfeile seiner jungen Wölfe.
Die Jagun bestand aus zehn Arbans, die jeweils von einem Offizier befehligt wurden. Auf Tsubodais Befehl hin trugen nur diese zehn Männer schwere Rüstungen. Der Rest trug Ledertuniken unter gepolsterten Deelen. Dschotschi wusste, dass Dschingis den schweren Angriff dem leichten vorzog, aber Tsubodais Männer schienen zu überleben. Sie konnten schneller zuschlagen und galoppieren als die schwerfälligen russischen Krieger, und in ihren Reihen gab es keine Furcht. Wie Tsubodai blickten sie begierig den Hang hinunter auf die Kolonne und warteten darauf, entdeckt zu werden.
»Du weißt, dass dein Vater einen Reiter geschickt hat, um mich nach Hause zu holen?«, fragte Tsubodai.
Dschotschi nickte. »Alle Männer wissen es.«
»Ich hatte gehofft, noch weiter nach Norden zu kommen, aber ich bin der Gefolgsmann deines Vaters. Er spricht und ich gehorche. Verstehst du das?«
Dschotschi starrte den jungen General an und vergaß für einen Moment die Ritter, die da unten durch das Tal ritten.
»Natürlich«, sagte er und ließ seinem Gesicht nichts anmerken. Tsubodai warf ihm einen amüsierten Blick zu.
»Ich hoffe, du tust es, Dschotschi. Er ist ein Mann, dem man folgen sollte, dein Vater. Ich frage mich, wie er reagieren wird, wenn er sieht, wie gut du dich entwickelt hast.«
Für einen Moment verzog Dschotschi sein Gesicht vor Wut, bevor sich seine Gesichtszüge wieder glätteten und er tief durchatmete.
Tsubodai war in vielerlei Hinsicht mehr wie ein Vater für ihn als sein eigener, aber er vergaß nie die wahre Loyalität dieses Mannes. Auf einen Befehl von Dschingis hin würde Tsubodai Dschotschi ohne zu zögern töten. Während er den jungen General ansah, dachte er, dass er vielleicht sogar ein wenig Bedauern empfinden würde, aber nicht genug, um den Schlag zurückzuhalten.
»Er wird loyale Männer brauchen, Tsubodai«, sagte Dschotschi. »Mein Vater würde uns nicht zurückrufen, um zu bauen oder zu ruhen. Er wird ein neues Land gefunden haben, das er in Stücke reißen kann. Wie ein Wolf bleibt er immer hungrig. Selbst wenn ihm droht, der Magen zu platzen.«
Tsubodai runzelte die Stirn, als er hörte, dass auf diese Weise über den Khan gesprochen wurde. Seit drei Jahren hatte er bei Dschotschi keine Zuneigung mehr wahrgenommen, wenn dieser von seinem Vater sprach, selbst wenn manchmal eine gewisse Wehmut mitschwang, die aber mit den Jahren immer weniger wurde. Dschingis hatte einen Jungen weggeschickt, aber ein Mann würde zu ihm zurückkehren, davon war Tsubodai überzeugt. Trotz seiner Bitterkeit behielt Dschotschi im Kampf einen kühlen Kopf und die Männer begegneten ihm mit Stolz. Er würde es schaffen.
»Ich habe noch eine Frage an dich, Dschotschi«, sagte Tsubodai. Dschotschi lächelte kurz.
»Das hast du immer, General«, antwortete er.
»Wir haben diese eisernen Ritter über Hunderte von Meilen hinter uns hergelockt und ihre Pferde sind erschöpft. Wir haben ihre Späher gefangen genommen und sie zur Rede gestellt, obwohl ich nichts von diesem »Jerusalem« weiß, das sie suchen, oder wer dieser »weiße Christus« ist.«
Tsubodai zuckte mit den Schultern. »Vielleicht werde ich ihn eines Tages vor meiner Schwertspitze haben, aber die Welt ist groß und ich bin nur ein Mann.«
Während er sprach, beobachtete er die gepanzerten Ritter und den hinter ihnen herziehenden Tross, in Erwartung, entdeckt zu werden.
»Meine Frage, Dschotschi, ist folgende: Diese Ritter bedeuten mir nichts. Dein Vater hat mich zurückgerufen und ich könnte jetzt dorthin reiten, wo die Pferde noch fett vom Sommergras sind. Warum also sind wir hier und warten auf eine Herausforderung zum Kampf?«
Dschotschis Augen waren kalt, als er antwortete.
»Mein Vater wäre der Ansicht, dass es nun mal das ist, was wir tun. Und dass es für einen Mann nichts Ehrenvolleres gibt, als seine besten Jahre im Krieg mit dem Feind zu verbringen. Und er würde sagen, dass es dir Spaß macht, General, und dass du darüber hinaus keinen Grund brauchst.«
Tsubodais wendete seinen Blick nicht ab.
»Vielleicht würde er das sagen, aber du versteckst dich hinter seinen Worten. Warum sind wir hier, Dschotschi? Wir wollen ihre großen Pferde nicht, auch nicht für ihr Fleisch. Warum sollte ich das Leben von Kriegern riskieren, um die Kolonne zu zerschlagen, die wir da sehen?«
Dschotschi zuckte verärgert mit den Schultern.
»Wenn es nicht daran liegt, weiß ich es nicht.«
»Für dich, Dschotschi«, sagte Tsubodai ernst. »Wenn du zu deinem Vater zurückkehrst, wirst du alle Arten von Kämpfen gesehen haben, zu allen Jahreszeiten. Du und ich, wir haben Dörfer erobert und Städte geplündert, sind durch Wüsten geritten und Wälder, die so dicht waren, dass wir uns kaum einen Weg hindurchschneiden konnten. Dschingis wird keine Schwäche in dir finden.«
Tsubodai lächelte kurz über Dschotschis versteinerte Miene. »Ich werde stolz sein, wenn die Menschen sagen, dass du dein Können unter Tsubodai dem Tapferen gelernt hast.«
Dschotschi musste grinsen, als er den Spitznamen von Tsubodai selbst hörte. Im Lager blieb nichts geheim.
»Da ist er«, murmelte Tsubodai und zeigte auf einen entfernten Späher, der zur Spitze der russischen Kolonne zurückeilte. »Wir haben einen Feind, der vorneweg marschiert, einen sehr mutigen Mann.«
Dschotschi konnte sich die einsetzende Bestürzung unter den Rittern vorstellen, als sie nun die Hügelkette hinaufsahen und die Mongolenkrieger erblickten. Tsubodai grunzte leise, als sich eine komplette Reihe aus der Kolonne löste und die Hänge hinauf trabte, die langen Speere bereit. Er zeigte die Zähne, während sie immer näherkamen. In ihrer Arroganz stürmten sie bergauf. Er sehnte sich danach, ihnen ihren Fehler aufzuzeigen.
»Hast du deine Paitze, Dschotschi? Zeig sie mir.«
Dschotschi griff hinter sich, wo sein Bogenhalter am Sattel festgeschnallt war. Er öffnete eine Klappe in dem steifen Leder und zog eine Plakette aus massivem Gold heraus, auf der ein Wolfskopf eingeprägt war. Mit ihren zwanzig Unzen war sie zwar schwer, aber klein genug, um sie in der Hand zu halten.
Tsubodai ignorierte die Männer, die beharrlich den Hügel erklommen, und wandte sich stattdessen dem ältesten Sohn von Dschingis zu.
»Dies gibt dir das Recht, Tausend durch meine Hand zu befehlen, Dschotschi. Diejenigen, die einen Jagun befehligen, haben eine aus reinem Silber, wie diese.« Tsubodai hielt einen größeren Block aus dem weißlichen Metall hoch. »Der Unterschied ist, dass die silberne Paitze an einen Mann vergeben wird, der von den Offizieren jedes Arban unter ihm gewählt wird.«
»Das weiß ich«, sagte Dschotschi.
Tsubodai warf einen Blick zurück auf die sich nähernden Ritter.
»Die Offiziere dieser Jagun haben darum gebeten, dass du sie anführst, Dschotschi. Ich hatte nichts damit zu tun.« Er hielt ihm die silberne Paitze hin. Dschotschi nahm sie freudig entgegen und reichte ihm dafür die goldene Plakette zurück. Tsubodai verhielt sich feierlich und förmlich, doch seine Augen leuchteten.
»Wenn du zu deinem Vater zurückkehrst, Dschotschi, wirst du alle Ränge und Positionen kennengelernt haben.« Der General gestikulierte und seine Hand schnitt durch die Luft. »Rechts, links und in der Mitte.« Er blickte über die Köpfe der sich anstrengenden Ritter hinweg, die den Hügel hinauf galoppierten, und sah in der Ferne eine Bewegung auf einem Felsen. Tsubodai nickte heftig.
»Es ist Zeit. Du weißt, was du zu tun hast, Dschotschi. Du hast das Kommando.« Ohne ein weiteres Wort klopfte Tsubodai dem jüngeren Mann auf die Schulter und ritt über den Kamm zurück, wobei er die Reiterschar in der Obhut eines plötzlich sehr nervösen Anführers ließ.
Dschotschi spürte die Blicke der hundert Männer in seinem Rücken, während er sich bemühte, die Freude zu verbergen. Jede Zehnergruppe wählte einen Mann, der sie anführen sollte, und diese Männer wählten dann einen aus ihrer Mitte, der die Hundertschaft im Krieg anführen sollte. Es war eine Ehre, auf diese Art erwählt zu werden. Eine Stimme in seinem Kopf flüsterte ihm zu, dass er diese Ehre nur seinem Vater verdankte, aber er ignorierte sie und weigerte sich zu zweifeln. Er hatte sich das Recht verdient und sein Selbstvertrauen wuchs.
»Bogen aufreihen!«, rief Dschotschi.
Er hielt seine Zügel fest umklammert, um seine Anspannung zu verbergen, während die Männer eine breitere Linie bildeten, damit jeder Bogen Platz hatte. Dschotschi warf einen Blick über seine Schulter, aber Tsubodai war tatsächlich verschwunden und hatte ihn allein gelassen. Die Männer sahen ihn noch immer an. Dschotschi zwang sich zu einer eisernen Mine, weil er wusste, dass sie sich an seine Gelassenheit erinnern würden. Als sie ihre Bögen hoben, erhob er eine geballte Faust und wartete, während sein Herz schmerzhaft in seiner Brust pochte.
Bei vierhundert Schritten ließ Dschotschi seinen Arm herabfallen und der erste Pfeilschwarm peitschte durch die Luft. Die Entfernung war zu groß und jene, die die Ritter erreichten, zersplitterten an ihren Schilden, die nun hoch und nach vorne gehalten wurden, sodass fast der gesamte Mann geschützt war. Die langen Schilde erfüllten ihren Zweck, als auch der zweite Schwarm die Reihen traf, ohne dass ein einziger Reiter zu Boden ging.
Die mächtigen Pferde waren nicht schnell, aber trotzdem schlossen sie auf. Dschotschi sah nur zu. Bei zweihundert Schritten hob er erneut die Faust und weitere hundert Pfeile warteten auf knarrenden Sehnen. Bei einer solchen Entfernung wusste er nicht, ob die Rüstung der Ritter dieselben schützen würde. Nichts hatte sie je geschützt.
»Schießt, als hättet ihr noch nie einen Bogen besessen«, rief er. Die Männer um ihn herum grinsten und die Pfeile schnappten hervor.
Dschotschi zuckte instinktiv bei den Schüssen zusammen, die über die Köpfe der Feinde hinweggingen, als wären sie von panischen Narren abgefeuert worden. Nur wenige trafen und noch weniger brachten ein Pferd oder einen Mann zu Fall. Sie konnten nun das Donnern des Angriffs hören und sahen, wie die vorderen Reihen in Erwartung des Angriffs ihre Speere senkten.
Als er ihnen gegenüberstand, unterdrückte Dschotschi seine Angst in einem plötzlichen Anflug von Wut. Er wollte nichts lieber, als sein Schwert zu ziehen und sein Reittier den Hang hinunter auf den Feind zu stürzen. Vor Frustration zitternd, gab er einen anderen Befehl.
»Rückzug über den Kamm!«, rief Dschotschi. Er riss an den Zügeln und sein Pferd kam ruckartig in Gang. Die Männer seiner Jagun schrien durcheinander und folgten im Chaos ihrem General. Hinter ihm hörte er kehlige Stimmen, die triumphierend schrien, und in seiner Kehle stieg Säure auf. Ob aus Furcht oder vor Wut, das wusste er nicht.
Ilja Majaev blinzelte sich den Schweiß aus den Augen, als er sah, dass die Mongolen wie die dreckigen Feiglinge, die sie waren, kehrtmachten. Wie schon tausendmal zuvor nahm er seine Zügel locker in die Hand, klopfte sich auf die Brust und betete zur Heiligen Sophia, dass sie die Feinde des wahren Glaubens unter ihren Hufen zermalmen mochten. Unter dem Kettenhemd und der gepolsterten Tunika fand sich die Reliquie – ein Fragment ihres Fingerknochens in einem Medaillon aus Gold. Sein wertvollster Besitz. Die Mönche in Nowgorod hatten ihm versichert, dass er nicht getötet werden könnte, solange er es trug, und er fühlte sich stark, als seine Ritter über den Bergrücken stürmten. Zwei Jahre zuvor hatten seine Männer die Domstadt verlassen und Nachrichten für den Prinzen im Osten gebracht, bevor sie schließlich nach Süden abgebogen waren, um den langen Weg nach Jerusalem anzutreten. Ilja hatte mit den anderen auf sein Leben geschworen, diesen heiligen Ort gegen die Ungläubigen zu verteidigen, die die Monumente ihres Glaubens zerstören wollten.
Es hätte eine Reise des Gebets und des Fastens sein sollen, bevor sie ihr Können an den Waffen gegen die gottlosen Menschen einsetzten. Stattdessen wurden sie immer wieder von der mongolischen Armee attackiert. Ilja sehnte sich danach, ihnen nahe genug zu kommen, um sie zu töten, und er lehnte sich im Sattel vor, als sein Reittier hinter den fliehenden Reitern her stürzte.
»Übergib sie mir, oh Herr, und ich werde ihre Knochen brechen und ihre falschen Götter unter meinen Füßen zertreten«, flüsterte er vor sich hin.
Die Mongolen rasten wie wild den Abhang hinunter, aber die russischen Pferde waren kräftig und der Abstand wurde immer kleiner. Ilja fühlte die Stimmung der Männer um ihn herum, als sie knurrten und sich gegenseitig anfeuerten. Sie hatten Kameraden durch Pfeilschwärme in der Dunkelheit verloren. Späher waren spurlos verschwunden oder, schlimmer noch, mit Wunden aufgefunden worden, bei deren Anblick sich Männer erbrachen. In einem Jahr hatte Ilja mehr niedergebrannte Städte gesehen, als er in Erinnerung behalten konnte, und die schwarzen Rauchschwaden hatten ihn jedes Mal zu einer verzweifelten Verfolgung angetrieben. Doch immer waren die marodierenden Mongolen bereits verschwunden, wenn er ankam. Ilja trieb sein Pferd zum Galopp an, obwohl die Flanken des müden Tieres sich bereits erschöpft hoben und senkten und weiße Speichelklumpen Arme und Brust des Reiters trafen.
»Auf, Brüder!« rief Ilja den anderen zu. Er wusste, dass sie nicht erschöpft sein würden, wenn die Stammeskrieger endlich in Reichweite waren. Die Mongolen stellten ein Affront gegen alles dar, was Ilja lieb war, von den friedlichen Straßen Nowgorods bis hin zur Ruhe und Würde der Kathedrale des Heiligen Vaters in Jerusalem. Vor ihnen ritten die mongolischen Krieger durch eine Wolke aus ihrem eigenen Staub. Ilja gab Befehle und seine Männer schlossen sich zu einer Formation zusammen, fünfzig Reihen mit je zwanzig Mann nebeneinander. Sie banden ihre Zügel an die Sattelhörner, beugten sich mit Schild und Speer über die Hälse der Pferde und trieben die Tiere nur mit ihren Knien weiter an. Sicherlich hatte es in der Geschichte der Welt noch nie eine solche Streitmacht aus Männern und Eisen gegeben! In Erwartung des ersten Blutvergießens fletschte Ilja die Zähne.
Der Weg der fliehenden Mongolen führte sie an einem Hügel vorbei, der mit alten Buchen und Ulmen bewachsen war. Als Ilja vorbeidonnerte, sah er, wie sich etwas in der grünen Finsternis bewegte. Er hatte kaum Zeit, einen Warnruf abzugeben, bevor die Luft von heulenden Pfeilschäften erfüllt war. Doch selbst dann zögerte er nicht. Er hatte gesehen, wie die Pfeile an den Schilden seiner Männer zerschellten. Er brüllte den Befehl, die Formation zu halten, denn er wusste, dass sie durchbrechen konnten.
Ein Pferd wieherte vor Schmerz auf und prallte von links gegen ihn, quetschte sein Bein und holte ihn fast aus dem Sattel. Ilja fluchte vor Schmerz und holte tief Luft, als er den Reiter schlaff herabhängen sah. Ein Pfeil nach dem anderen flog von den dunklen Bäumen herab und er sah mit Schrecken, wie seine Männer aus ihren Sätteln fielen. Die Pfeile durchschlugen die Kettenhemden, als wären sie aus Leinen. Blut spritzte dort hervor wo die Pfeile wieder heraustraten. Ilja schrie wild auf und trieb sein erschöpftes Reittier an. Vor sich sah er die Mongolen in perfekter Einheit reiten und ihr Anführer starrte ihn direkt an. Die Mongolen hielten nicht an, um ihre Bögen zu spannen. Ihre Pferde stürmten weitervor, während die Krieger im Ritt ihre Pfeile fliegen ließen. Ilja spürte, wie ein Pfeil seinem Arm streifte, dann prallten die beiden Streitkräfte aufeinander und er machte sich bereit. Sein langer Speer traf einen Krieger in die Brust, wurde ihm aber so schnell entrissen, dass er dachte, seine Finger wären gebrochen. Er zog sein Schwert mit einer Hand, die fast zu taub zum Greifen war. Überall lag roter Staub, und mittendrin ritten die Mongolen wie die Teufel und schickten seelenruhig Pfeile in die dicht gedrängten Reihen seiner Männer.
Ilja hob seinen Schild und wurde zurückgeschleudert, als ein Pfeil einschlug, die Spitze ragte deutlich sichtbar durch das Holz. Sein rechter Fuß rutschte aus dem Steigbügel und er schwankte, als er das Gleichgewicht verlor. Bevor er sich erholen konnte, erwischte ihn ein weiterer Pfeil am Oberschenkel. Er schrie vor Schmerz auf und hob sein Schwert, während er auf den Bogenschützen zu ritt. Der Mongole sah ihn kommen, sein Gesicht völlig emotionslos. Es war kaum mehr als ein bartloser Junge, den Ilja da sah. Der Russe schwang seine Klinge, aber der Mongole duckte sich unter dem Schlag weg und stieß ihn, während er vorbeiritt. Die Welt drehte sich einen Moment lang in völliger Stille, dann stürzte Ilja fassungslos zu Boden. Das Nasenstück seines Helms wurde durch den Aufprall verbogen und brach ihm seine Vorderzähne ab. Blind vor Tränen erhob sich Ilja und spuckte Blut und Zahnsplitter. Sein linkes Bein knickte ein und er stürzte ungelenk, verzweifelt auf der Suche nach dem Schwert, das ihm aus der Hand gefallen war. In dem Moment, in dem er die Waffe auf dem staubigen Boden liegen sah, hörte er Hufschläge hinter sich. Er griff nach der Reliquie an seiner Brust und murmelte ein Gebet, als die Klinge des Mongolen auf seinen Hals niederging und ihm den halben Kopf abtrennte.
Er erlebte nicht mehr, wie der Rest seiner Männer abgeschlachtet wurde, zu schwer und zu behäbig, um sich verteidigen zu können gegen die Krieger von Tsubodai, dem General von Dschingis Khan.
Dschotschi stieg vom Pferd, um die Toten zu untersuchen, nachdem er einem Dutzend seiner Männer befohlen hatte, die Gegend abzusuchen und die Bewegung der Hauptkolonne zu melden. Ihre Kettenhemden hatte die Ritter nicht retten können. Viele der umherliegenden Leichen waren mehr als einmal durchbohrt worden. Nur die Helme hatten standgehalten. Dschotschi konnte keinen einzigen Mann finden, der mit einem Kopfschuss niedergestreckt worden war. Er hob einen der Helme auf und strich mit dem Finger über den hellen Metallschlitz, den ein Pfeil verursacht hatte. Er war gut gefertigt.
Der Hinterhalt war genauso verlaufen, wie Tsubodai es geplant hatte, dachte Dschotschi grinsend. Der General schien die Gedanken seiner Feinde lesen zu können. Dschotschi atmete tief durch und bemühte sich, das Zittern zu kontrollieren, das ihn nach jeder Schlacht überkam. Es durfte nicht sein, dass die Männer ihn zittern sahen. Ihm war nicht bewusst, dass sie ihn mit geballten Fäusten umherschreiten sahen, wie einen Mann, der immer noch hungrig war, einen Mann, der nie zufrieden war, egal was er erreicht hatte. Drei weitere Jaguns hatten an dem Überfall teilgenommen. Dschotschi sah die Offiziere zwischen den Bäumen hervorreiten, wo sie die ganze Nacht gelauert hatten. Nach Jahren an Tsubodais Seite kannte er jeden Mann wie seinen Bruder, wozu Dschingis ihm einst geraten hatte. Mekhali und Altan waren verlässliche Männer, loyal, aber nicht sehr einfallsreich. Dschotschi nickte den beiden zu, als sie mit ihren Pferden zu den Toten auf dem Feld trabten.
Der letzte von ihnen, Qara, war ein kleiner, sehniger Krieger mit einem von einer alten Wunde vernarbten Gesicht. Obwohl Qara ihm gegenüber tadellose Manieren zeigte, spürte Dschotschi dessen Abneigung und konnte sie nicht verstehen. Vielleicht hasste der finstere Mann ihn wegen seines Vaters. Dschotschi hatte schon viele getroffen, die seinen Aufstieg misstrauisch beäugten. Tsubodai hielt nicht hinterm Berg, wenn es darum ging, Dschotschi in jeden Plan und jede Strategie mit einzubeziehen, so wie es Dschingis einst mit dem Jungen aus Uriangqai getan hatte, der sein General geworden war. Tsubodai blickte in die Zukunft, während Männer wie Qara glaubten, sie sähen nur einen verwöhnten jungen Prinzen, der über seine Fähigkeiten hinaus befördert wurde.
Als Qara heranritt und beim Anblick der toten Ritter grunzte, wurde Dschotschi klar, dass er nicht länger der Vorgesetzte dieses Mannes war. Er hatte das Silber angenommen, als die Schlacht bevorstand, und fühlte sich noch immer geehrt, dass ihm hundert Leben anvertraut wurden. Doch das bedeutete, dass Qara sich zumindest für eine Weile nicht mehr vor dem Sohn des Khans in Acht nehmen musste. Ein Blick verriet Dschotschi, dass dies dem drahtigen kleinen Krieger durchaus bewusst war.
»Warum warten wir hier?«, sagte Qara plötzlich. »Tsubodai wird angreifen, während wir am Gras riechen und untätig sind.«
Dschotschi ärgerte sich über die Worte, aber er antwortete ganz entspannt, als hätte Qara ihn nur gegrüßt. Wäre der Mann ein echter Anführer gewesen, hätte er sich bereits auf den Rückweg zu Tsubodai gemacht. Dschotschi begriff, dass Qara trotz seines nun niedrigeren Ranges immer noch Befehle von ihm erwartete. Als er zu Mekhali und Altan blickte, stellte er fest, dass auch sie ihn erwartungsvoll ansahen. Vielleicht geschah dies aus reiner Gewohnheit, doch er spürte, wie ihm eine Idee kam und er wusste, dass er den Moment nicht vergeuden durfte.
»Siehst du ihre Rüstung, Qara?«, fragte er. »Das erste Stück hängt vom Helm herab und bedeckt ihr Gesicht bis auf die Augen. Das zweite Tuch aus Eisenringen reicht bis zu ihren Knien.«
»Ja. Es hat unsere Pfeile nicht aufgehalten«, antwortete Qara achselzuckend. »Wenn sie nicht auf dem Pferd sitzen, bewegen sie sich so langsam, dass es leicht ist, sie zu Fall zu bringen. Wir brauchen keinen derartigen Schutz, denke ich.«
Dschotschi grinste den Mann an und genoss die Verwirrung, die er damit auslöste.
»Wir brauchen ihn sehr wohl, Qara.«
Weit oben in den Hügeln über dem Tal wartete Tsubodai neben seinem Pferd, das zwischen toten Kiefernnadeln umherschnupperte. Fast fünftausend Männer rasteten um ihn herum und harrten seiner Entscheidung. Er wartete auf die Späher, die er ausgesandt hatte. Zweihundert von ihnen waren in alle Richtungen geritten, und ihre Berichte ermöglichten es dem General, sich im Umkreis von vielen Meilen ein Bild von der Gegend zu machen.
Er wusste, dass Dschotschis Hinterhalt ein Erfolg gewesen war, noch bevor dieser eine Nachricht gesendet hatte. Tausend Feinde weniger bedeutete nur noch Zehntausend, doch das waren immer noch zu viele. Die Kolonne der Ritter bewegte sich langsam durch das Flusstal und wartete darauf, dass die Angriffsgruppe siegreich zurückkehrte. Sie hatten keine Bogenschützen in die Wildnis mitgenommen, ein Fehler, der sie teuer zu stehen kommen würde. Doch es waren große Männer und derart stark, dass Tsubodai keinen einfachen Frontalangriff riskieren konnte. Er hatte Ritter gesehen, die von Pfeilen durchbohrt waren und trotzdem zwei oder sogar drei von ihnen getötet hatten.
Sie waren sehr mutige Krieger, aber er ging davon aus, dass das allein nicht reichen würde. Tapfere Männer stellten sich, wenn sie angegriffen wurden, und Tsubodai plante entsprechend. Jede Armee konnte unter den richtigen Bedingungen aufgerieben werden, da war er sich sicher. Seine eigene natürlich ausgenommen. Doch die eines Feindes dagegen schon.
Zwei der Späher galoppierten heran, um die letzte Position der russischen Streitkräfte mitzuteilen. Tsubodai ließ sie absteigen und mit Stöcken auf den Boden zeichnen, damit er sicher sein konnte, dass es keine Missverständnisse gab.
»Wie viele Späher haben sie?«, fragte er.
Der Krieger, der mit dem Stock gezeichnet hatte, antwortete ohne zu zögern. »Zehn in der Nachhut, General, weit verteilt. Zwanzig voraus und an den Flanken«.
Tsubodai nickte. Er wusste genug, um endlich loszuschlagen.
»Sie müssen getötet werden, vor allem die, die hinter der Kolonne der Ritter stehen. Greift sie euch, wenn die Sonne am höchsten steht, und lasst keinen von ihnen entkommen. Ich greife an, sobald du mit deiner Flagge signalisierst, dass die Späher ausgeschaltet sind. Wiederhole meine Befehle.«
Der Krieger wiederholte schnell und Wort für Wort, so wie es ihm beigebracht worden war. Tsubodai ließ auf dem Feld keine Verwirrung zu. Trotz der Flaggen, mit denen man sich über große Entfernungen hinweg verständigen konnte, musste er sich immer noch auf den Sonnenaufgang, den Mittag und den Sonnenuntergang als einzige Zeitangaben verlassen. Er spähte durch die Bäume nach oben und stellte fest, dass es nicht mehr weit bis zur Mittagszeit war.
Es würde nicht mehr lange dauern und er spürte das bekannte flaue Gefühl in seinem Magen, das ihn vor jeder Schlacht befiel. Er hatte Dschotschi gesagt, dass dieser Angriff seiner Ausbildung dienen sollte, und das stimmte auch, aber es war nicht die ganze Wahrheit. Tsubodai hatte verschwiegen, dass die Ritter mit tragbaren Schmieden in ihrem Gepäck reisten. Ein Schmied war wertvoller als jede andere Ware, die sie erbeuten konnten, und Tsubodai war fasziniert von den Berichten über Eisenkarren, die während der Fahrt Rauch ausstießen.
Tsubodai lächelte in sich hinein und genoss die aufsteigende Aufregung. Wie Dschingis fand auch er keinen Gefallen an der Plünderung von Dörfern und Städten. Natürlich war es etwas, das getan werden musste, so wie ein Mann kochendes Wasser auf ein Ameisennest schütten musste. Aber Tsubodai wollte Schlachten, in denen er sein Können unter Beweis stellen oder ausbauen konnte. Es gab für ihn keine größere Freude, als seine Feinde zu überlisten, sie zu verwirren und zu vernichten. Er hatte von der seltsamen Reise der Ritter in ein Land gehört, das so weit entfernt war, dass niemand seinen Namen kannte. Das spielte auch keine Rolle. Dschingis würde keine bewaffneten Männer auf seinen Ländereien reiten lassen – und alle Ländereien gehörten ihm.
Tsubodai verwischte die Zeichnungen im Sand mit der Spitze seines Stiefels. Er wandte sich an den zweiten Späher, der geduldig und voller Ehrfurcht vor seinem General wartete.
»Reite zu Dschotschi und finde heraus, was ihn aufgehalten hat«, befahl Tsubodai. »Er wird bei diesem Angriff zu meiner rechten Hand sitzen.«
»Euer Wille, Herr«, sagte der Späher und verbeugte sich, bevor er auf sein Pferd sprang und mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Bäume brach. Tsubodai blinzelte durch die Äste in die Sonne. Es würde sehr bald losgehen.
Unter dem Donnern von über vierzigtausend Hufen warf Anatoli Majaev einen Blick über die Schulter auf den Bergkamm, hinter dem der kleine Ilja verschwunden war. Wo war sein Bruder hin? Er betrachtete ihn immer noch als den kleinen Ilja, obwohl sein Bruder ihn sowohl an Kraft als auch an Glauben übertraf. Anatoly schüttelte müde den Kopf. Er hatte ihrer Mutter versprochen, dass er auf ihn aufpassen würde. Ilja würde sie einholen, da war er sich sicher. Er hatte nicht gewagt, die Kolonne anzuhalten, nachdem die Mongolen sich gezeigt hatten. Anatoly hatte überall hin Späher ausgesandt, aber auch sie schienen nun verschwunden zu sein. Er schaute wieder zurück und suchte angestrengt nach den Bannern von tausend Männern.
Voraus verengte sich das Tal zu einem Pass mit Hügeln, die Teil des Garten Edens hätten sein können. Die Hänge waren mit so dichtem Gras bewachsen, dass ein Mann die Wurzeln an einem halben Tag nicht hätte durchhacken können. Anatoly liebte dieses Land, aber sein Blick war stets auf den Horizont gerichtet, und eines Tages würde er Jerusalem sehen. Er murmelte ein Gebet zur Jungfrau Maria und in diesem Moment verdunkelte sich der Pass und er sah das mongolische Heer auf sie zureiten.
Die Späher waren also tot, wie er befürchtet hatte. Anatoly fluchte und konnte nicht anders, als sich noch einmal nach Ilja umzusehen.
Schreie kamen von hinten. Anatoly drehte sich vollständig im Sattel und fluchte bei dem Anblick einer weiteren dunklen Reiterschar, die schnell näherkam. Wie hatten sie ihn umgehen können, ohne entdeckt zu werden? Es war unglaublich, wie sich der Feind wie ein Geist durch die Hügel bewegte.
Er wusste, dass seine Männer die Mongolen mit einem Gegenangriff zerstreuen konnten. Sie hatten bereits ihre Schilde genommen und erhoben und sahen ihn an, um Befehle zu erhalten. Als ältester Sohn eines Barons war Anatoly der ranghöchste Offizier. Seine Familie hatte die gesamte Reise finanziert und sich mit einem Teil ihres großen Vermögens das Wohlwollen der Klöster gesichert, die in Russland so mächtig geworden waren.
Anatoly wusste, dass er nicht angreifen konnte, wenn der gesamte Gepäcktransport und die hinteren Reihen ungeschützt blieben. Nichts entnervte Kämpfer mehr, als gleichzeitig von vorne und hinten attackiert zu werden. Er gab dreien seiner Offiziere den Befehl, ihre Hundertschaften zu nehmen und vom hinteren Ende des Zuges aus her anzugreifen. Als er sich umdrehte, entdeckte er Bewegung auf den Hügeln und er grinste erleichtert. In der Ferne kehrte eine Reihe russischer schwerer Pferde über den Kamm zurück, deren Fahnen leicht im Wind wehten. Anatoly schätzte die Entfernungen ab und traf eine Entscheidung. Er rief einen der Späher zu sich herüber.
»Reite zu meinem Bruder und sag ihm, er soll die Truppe in unserem Rücken angreifen. Er muss sie daran hindern, in die Schlacht einzugreifen.«
Der junge Mann ritt davon, unbewaffnet und ohne Rüstung. Anatoly wandte sich wieder nach vorne und sein Selbstvertrauen wuchs. Da nun die Nachhut gesichert war, war er denen, die auf ihn zu galoppierten, zahlenmäßig überlegen.
Seine Befehle hatten nur wenige Augenblicke gedauert und er wusste, dass er durch die Mongolen hindurchschlagen konnte wie mit einer gepanzerten Faust.
Anatoly richtete seinen langen Speer über die Ohren seines Pferdes, und schrie »Angriffsformation! Für den weißen Christus, vorwärts!«
Anatolys Späher raste in vollem Galopp über den staubigen Boden. Schnelligkeit war alles, wenn zwei Heeresverbände auf die Kolonne zustürmten. Er hielt seinen Körper so tief wie möglich, der Kopf des Pferdes hüpfte neben ihm auf und ab. Er war jung und aufgeregt und ritt bis fast zu Ilja Majaevs Männern heran, bevor er erschrocken an den Zügeln riss. Nur vierhundert waren über den Kamm zurückgekehrt und sie waren durch die Hölle gegangen. An vielen Männern waren braune Blutspuren zu sehen, als sie sich näherten, und etwas an der Art, wie sie ritten, kam ihm seltsam vor.
Der Späher begriff plötzlich und zerrte in Panik an seinen Zügeln. Er kam zu spät. Ein Pfeil erwischte ihn unter einem Arm und er stürzte über den Kopf des Pferdes, so dass das Tier die Flucht ergriff.
Dschotschi und die anderen Mongolen sahen die liegende Gestalt nicht an, als sie vorüber galoppierten. Es hatte lange gedauert, den Toten die Kettenhemden auszuziehen, aber die List funktionierte. Keine Truppe machte einen Ausfall, um ihnen den Weg abzuschneiden, und obwohl die Russen es nicht wussten, wurden sie von drei Seiten angegriffen. Als das Gelände flacher wurde, stieß Dschotschi die Fersen zusammen und holte den Speer aus seiner Lederhülle. Es war ein schweres Ding und er musste sich anstrengen, ihn ruhig zu halten, während er und seine Männer auf die russische Flanke zustürmten.
Anatoly befand sich in vollem Galopp, mehr als eine halbe Tonne Fleisch und Eisen in eine Speerspitze konzentriert. Er sah, wie die vorderen Reihen erzitterten, als die mongolischen Bogenschützen ihre ersten Pfeile abfeuerten. Der Feind war schnell, aber die Kolonne konnte nicht mit solcher Geschwindigkeit angehalten oder gar gewendet werden. Der Lärm der Schildschläge und der Hufe war ohrenbetäubend, aber er hörte Schreie hinter sich und riss sich zusammen. Er hatte das Kommando, und als sein Verstand sich geklärt hatte, schüttelte er entsetzt den Kopf. Er sah wie Ilja die Hauptflanke attackierte und eben jene Männer angriff, die sich für die Pilgerfahrt der Familie Majaev verschrieben hatten.
Anatoly starrte mit offenem Mund und sah, dass die Männer kleiner waren und in blutiges Eisen gekleidet waren. Einige hatten beim ersten Zusammenstoß ihre Helme verloren, sodass die Gesichter der Mongolen zum Vorschein kamen. Er wurde bleich, denn nun wusste er, dass sein Bruder tot war und der Doppelangriff die hinteren Reihen zerschmettern würde. Er konnte nicht wenden und obwohl er verzweifelt Befehle brüllte, hörte ihn niemand.
Vorne ließen die Mongolen sie kommen, und feuerten tausende von Pfeilen auf die russischen Reiter ab. Die Schilde wurden zerschmettert und die Kolonne zuckte wie ein verwundetes Tier. Die Männer fielen zu Hunderten. Es war, als würde eine Sense über die Kolonne gezogen, die die Männer dahinmähte.
Von hinten überrollten die Mongolen den Gepäcktross und töteten jeden auf den Karren, der eine Waffe hob. Anatoly musste sich anstrengen, um nachzudenken und Details zu erkennen, aber er war mitten unter Feinden.
Sein Speer riss den Hals eines Pferdes auf und hinterließ eine klaffende Wunde, die ihn mit warmem Blut bespritzte. Ein Schwert blitzte auf und Anatoly bekam den Schlag gegen seinen Helm und verlor beinahe das Bewusstsein. Etwas traf ihn in die Brust und mit einem Mal konnte er nicht mehr atmen, nicht einmal mehr nach Hilfe rufen. Er rang nach einem einzigen Luftzug, nur einem Schluck, aber der kam nicht und er fiel in sich zusammen. Hart schlug er auf dem Boden auf. Hart genug, um seine letzten Todesqualen zu betäuben.
Abends an den Feuern ritt Tsubodai durch das Lager seiner Zehntausend. Den toten Rittern war alles Wertvolle abgenommen worden, und der General hatte den Männern Freude bereitet, indem er auf seinen persönlichen Zehnten verzichtete. Für diejenigen, die keinen Sold für ihre Kämpfe erhielten, war die Sammlung von blutbefleckten Medaillons, Ringen und Edelsteinen eine Möglichkeit, ihre Begehrlichkeiten in dieser neuen Gesellschaft, die Dschingis erschuf, zu befriedigen. In der Armee der Stämme konnte man reich werden, obwohl stets mit der Zahl der Pferde gerechnet wurde, die mit dem Reichtum gekauft werden konnten. Die Schmieden der Ritter waren für Tsubodai von größerem Interesse, ebenso wie die mit Eisen ummantelten Speichenräder der Wagen, die leichter zu reparieren waren als die massiven Scheiben der Mongolen. Tsubodai hatte die gefangenen Waffenschmiede bereits angewiesen, seinen Zimmerleuten ihr Handwerk zu zeigen.
Dschotschi untersuchte gerade den Vorderhuf seines Lieblingspferdes, als Tsubodai auf ihn zu trabte. Bevor der jüngere Mann sich verbeugen konnte, neigte Tsubodai den Kopf und erwies ihm die Ehre. Der Jagun, den Dschotschi befehligt hatte, stand voller Stolz aufgereiht.
Tsubodai hob seine Hand, um Dschotschi die goldene Paitze zu zeigen, die er ihm vor dem Mittag abgenommen hatte.
»Ich hatte mich schon gefragt, ob die Russen von den Toten auferstehen können«, sagte Tsubodai. »Das war ein kühner Schachzug. Gib mir dein Rangzeichen zurück, Dschotschi. Du bist mehr wert als Silber.«
Er warf die goldene Plakette durch die Luft und Dschotschi fing sie auf, während er darum kämpfte, seine Fassung zu bewahren. Nur das Lob von Dschingis selbst hätte ihm in diesem Moment mehr bedeutet.
»Wir werden morgen nach Hause reiten«, sagte Tsubodai, sowohl an die Männer als auch an Dschotschi gerichtet. »Seid bei Sonnenaufgang bereit.«
2. Kapitel
Tschagatai verspürte einen Juckreiz in seiner linken Achselhöhle, wo der Schweiß unter seiner besten Rüstung rann. Obwohl er der zweite Sohn des Khans war, wusste er, dass es nicht angebracht gewesen wäre, sich zu kratzen, während er auf den König von Koryo wartete.
Er riskierte einen kurzen Blick auf den Mann, der ihn in die ferne, ummauerte Stadt Songdo gebracht hatte. In der Halle der Könige war es in der Mittagshitze stickig, aber Dschelme fühlte sich in seiner lackierten Rüstung nicht unwohl. Ebenso wie die Höflinge und die königlichen Wachen hätte auch der mongolische General aus Holz geschnitzt sein können.
Tschagatai konnte in der Ferne Wasser fließen hören, ein sanftes Geräusch, das in der drückenden Hitze und der Stille noch verstärkt wurde. Der Juckreiz wurde unerträglich und er musste an etwas anderes denken. Während sein Blick auf einer hohen Decke aus weißem Putz und alten Kiefernbalken ruhte, erinnerte er sich daran, dass er keinen Grund hatte, sich eingeschüchtert zu fühlen. Trotz all ihrer Würde war die Wang-Dynastie nicht in der Lage gewesen, die Khara-Kitai zu vernichten, als dieses Volk aus dem Chin-Gebiet in ihr Land gekommen waren und Festungen gebaut hatten. Hätte nicht Dschelme seine Armee freiwillig eingesetzt, um sie niederzubrennen, wäre der König von Koryo noch immer wenig mehr als ein Gefangener in seinem eigenen Palast. Mit seinen fünfzehn Jahren fühlte Tschagatai bei diesem Gedanken eine gewisse Selbstgefälligkeit. Er hatte den ganzen Stolz und die Arroganz eines jungen Kriegers, doch in diesem Fall wusste er, dass sie gerechtfertigt waren.
Dschelme und seine Krieger waren in den Osten gekommen, um zu sehen, welche Armeen sich ihnen entgegenstellen würden und um zum ersten Mal den Ozean zu sehen. Sie hatten in den Khara-Kitai Feinde vorgefunden und diese wie streunende Hunde aus Koryo geprügelt. Tschagatai wusste, dass es nur gerecht war, dass der König nun einen Tribut zahlte, ob er nun um Hilfe gebeten hatte oder nicht.
In der schweren Luft schwitzend, quälte Tschagatai die Erinnerung an die Brise vom Meer im Süden. Der kühle Wind war seiner Meinung nach das einzig Gute an dieser blauen Weite. Dschelme war von den koryonischen Schiffen fasziniert gewesen, aber der Gedanke, über Wasser reisen zu wollen, verwirrte Tschagatai. Was man nicht reiten konnte, hatte für ihn keinen Wert. Schon bei der Erinnerung an die königliche Schute, die vor Anker lag, drehte sich ihm der Magen um. Draußen im Hof ertönte eine Glocke und der Ton hallte durch die Gärten, in denen Bienen Akazienblüten umschwirrten. Tschagatai stellte sich die buddhistischen Mönche vor, die den schweren Holzstamm bewegten, der die große Glocke anschlug, und er richtete sich auf, um wieder Haltung anzunehmen. Der König würde unterwegs sein und seine Qualen würden ein Ende finden. Er konnte das Jucken noch ein wenig länger ertragen: Allein der Gedanke an Erleichterung ließ es erträglich erscheinen.
Die Glocke ertönte erneut und die Diener öffneten die Schiebewände, sodass der Duft der Kiefern von den umliegenden Hügeln in die Halle dringen konnte. Unwillkürlich stieß Tschagatai einen Seufzer aus, als die Hitze nachzulassen begann. Die Menge kam ein wenig in Bewegung, um den König sehen zu können und Tschagatai nutzte die Ablenkung, um zwei Finger in seine Achselhöhle zu stecken und sich kräftig zu kratzen.
Er spürte, wie Dschelme ihm einen Blick zuwarf, und seine Miene versteinerte wieder, als der König des Koryo-Volkes endlich eintrat.
Keiner von ihnen war großgewachsen, dachte Tschagatai, als er den zierlichen Monarchen durch eine geschnitzte Tür hereinschweben sah. Er vermutete, dass der Mann Wang hieß, nach seiner Familie, aber wer wusste schon, wie sich diese drahtigen kleinen Leute nannten? Tschagatai schaute stattdessen auf ein Paar Dienerinnen im Gefolge des Königs. Mit ihrer zarten goldenen Haut waren sie wesentlich interessanter als der Mann, dem sie dienten. Der junge Krieger starrte die Frauen an, die sich um ihren Herrn kümmerten und seine Gewänder ordneten, während er Platz nahm.
Der König schien die anwesenden Mongolen nicht zu bemerken, während er darauf wartete, dass seine Diener ihr Tun beendeten. Seine Augen waren fast genauso dunkelgelb wie die von Dschingis, obwohl sie nicht die Fähigkeit seines Vaters besaßen, Leute in Schrecken zu versetzen. Verglichen mit dem Khan war der König von Koryo nur ein Lamm.
Die Diener beendeten endlich ihre Arbeit und der Blick des Königs richtete sich schließlich auf den Arban von zehn Kriegern, die Dschelme mitgebracht hatte. Tschagatai fragte sich, wie der Mann an einem Sommertag in solch dickes Tuch gekleidet sein konnte.
Als der König sprach, konnte Tschagatai kein Wort verstehen. Wie Dschelme musste er auf die Übersetzung in die Chin-Sprache warten, die er sich mühsam angeeignet hatte. Selbst dann konnte er es kaum verstehen. Während er zuhörte, wurde er immer frustrierter. Er mochte keine Fremdsprachen. Wenn ein Mann das Wort für Pferd kannte, warum sollte er dann ein anderes benutzen?
Natürlich verstand Tschagatai, dass Männer aus fernen Ländern vielleicht nicht die richtige Art zu sprechen beherrschten, aber er war der Meinung, dass sie es sich selbst schuldig waren, es zu lernen und nicht weiter ihr Kauderwelsch zu sprechen, so als ob alle Sprachen gleichwertig wären.
»Du hast dein Versprechen gehalten«, sagte der Übersetzer feierlich und unterbrach Tschagatais Gedanken. »Die Festungen von Khara-Kitai brennen schon seit vielen Tagen und die verdorbenen Völker sind aus dem hohen und schönen Land verschwunden.«
Es wurde wieder still und Tschagatai fühlte sich unbehaglich. Der Hof der Koryo schien sich an der Langsamkeit zu erfreuen. Er erinnerte sich an seine Erfahrung mit dem Getränk, das sie »Nok Cha« nannten. Dschelme hatte die Stirn gerunzelt über die Art und Weise, wie Tschagatai seinen Becher in einem Schluck leerte und ihn für einen weiteren bereithielt. Offenbar war die blassgrüne Flüssigkeit zu wertvoll, um sie wie Wasser zu trinken. Als ob es einen Krieger kümmern sollte, wie ein anderer aß oder trank! Tschagatai aß, wenn er hungrig war und er versäumte oft, an den aufwendigen Mahlzeiten des Hofes teilzunehmen. Er konnte Dschelmes Interesse an sinnlosen Ritualen nicht nachvollziehen, doch er hatte diese Gedanken nicht laut ausgesprochen. Wenn er über das mongolische Volk herrschte, würde er keine Anmaßung zulassen. Das hatte er sich geschworen. Essen war nichts, womit man sich aufhalten oder das man in tausend Geschmacksrichtungen zubereiten sollte. Es war kein Wunder, dass das Volk der Koryo so kurz vor einer Eroberung gestanden hatte. Sie würden nur eine Sprache sprechen und vielleicht nicht mehr als zwei oder drei verschiedene Gerichte essen, die schnell und ohne viel Aufhebens zuzubereiten waren. So bliebe mehr Zeit für Waffentraining und Übungen, um den Körper zu stärken.
Tschagatais umherschweifende Gedanken wurden jäh unterbrochen, als Dschelme endlich sprach und dabei offenbar jedes Wort abwog.
»Es war ein Glücksfall, dass die Khara-Kitai meine Späher angreifen wollten. Unsere Bedürfnisse wurden durch ihre Vernichtung erfüllt. Ich spreche jetzt für den Großkhan, dessen Krieger dein Land vor einem schrecklichen Feind gerettet haben. Wo ist der von euren Ministern versprochene Tribut?«
Während die Übersetzung durch den Raum hallte, versteifte sich der König leicht in seinem Sitz. Tschagatai fragte sich, ob der Narr sich durch die Worte beleidigt fühlte. Vielleicht hatte er die Armee vergessen, die vor der Stadt lagerte. Auf ein einziges Kommando von Dschelme würden sie die polierten Balken um den Kopf des Königs in Brand stecken. Für Tschagatai war es immer noch ein Rätsel, warum sie das nicht ohnehin schon getan hatten. Hatte Dschingis sie nicht ausgesandt, um ihre Fähigkeiten zu verbessern? Tschagatai erkannte verhalten an, dass es eine Kunst des Verhandelns gab, die er erst noch lernen musste. Dschelme hatte versucht zu erklären, warum man mit fremden Mächten verhandeln muss, aber Tschagatai konnte es nicht verstehen. Ein Mensch war entweder ein Feind oder ein Freund. Wenn er ein Feind war, konnte man ihm alles nehmen, was er besaß. Tschagatai lächelte, als er den Gedanken zu Ende dachte. Ein Khan brauchte keine Freunde, sondern nur Diener.
Einmal mehr träumte er davon, sein Volk zu regieren. Die Stämme würden seinen Bruder Dschotschi nie akzeptieren, wenn er überhaupt der Sohn des Khans war. Tschagatai hatte seinen Teil dazu beigetragen, das Gerücht zu verbreiten, dass Dschotschi das Ergebnis einer Vergewaltigung von vor vielen Jahren war. Dschingis hatte durch sein distanziertes Verhalten gegenüber dem Jungen dafür gesorgt, dass die Gerüchte tiefe Wurzeln schlagen konnten.
Tschagatai lächelte bei der Erinnerung und ließ seine Hand zum Griff seines Schwertes wandern. Sein Vater hatte es ihm anstelle von Dschotschi geschenkt. Eine Klinge, die die Geburt einer Nation miterlebt hatte. In seinem tiefsten Inneren wusste Tschagatai, dass er Dschotschi niemals einen Eid leisten würde.
Einer der Minister des Königs lehnte sich nahe an den Thron, um ein paar geflüsterte Worte zu wechseln. Es zog sich so lange hin, dass die Reihen der Höflinge in ihren Gewändern und Juwelen sichtlich zu erschlaffen begannen, aber schließlich zog sich der Minister zurück. Noch einmal sprach der König, und seine Worte wurden flüssig übersetzt.
»Geehrte Verbündete können Geschenke als Zeichen einer neuen Freundschaft annehmen, wie es besprochen wurde«, sagte der König. »Hunderttausend Bögen Ölpapier liegen für euch bereit, die Arbeit vieler Monde.« Die versammelte Menge der koryonischen Adligen murmelte aufgeregt bei diesen Worten, obwohl Tschagatai sich nicht vorstellen konnte, warum Papier als wertvoll angesehen werden sollte. »Zehntausend Seidenwesten wurden genäht und Jade und Silber vom selben Gewicht wurden dazugegeben. Zweihunderttausend Kwan Eisen und ebenso viel Bronze, aus den Minen und von der Gilde der Metallarbeiter. Aus meinen eigenen Vorräten habe ich sechzig Tigerfelle in Seide gewickelt und für die Reise mit dir vorbereitet. Und schließlich sind achthundert Wagenladungen Eichen- und Buchenholz ein Geschenk der Wang-Dynastie, als Dank für den Sieg, den du dem Volk der Koryo gebracht hast. Geht nun in Frieden und Ehre und betrachtet uns stets als Verbündete.«
Dschelme nickte steif, als der Übersetzer fertig war. »Ich nehme Euren Tribut an, Majestät.«
Rote Flecken hatten sich auf seinem Hals gebildet. Tschagatai fragte sich, ob der General den Versuch des Königs, sein Gesicht zu wahren, ignorieren würde. Den Eroberern war Tribut gezollt worden und Dschelme stand lange Zeit schweigend da, während er über die Worte des Königs nachdachte. Als er wieder sprach, tat er dies mit fester Stimme.
»Ich bitte nur darum, dass sechshundert junge Männer im Alter zwischen zwölf und sechzehn Jahren dazukommen. Ich werde sie in den Fertigkeiten meines Volkes ausbilden und sie werden viele Schlachten schlagen und große Ehre erfahren.«
Tschagatai bemühte sich, seine Zustimmung nicht zu zeigen. Sollten Sie doch an ihrem Gerede von Geschenken und ehrenwerten Verbündeten ersticken. Dschelmes Forderung hatte die wahre Machtverteilung im Saal offenbart und die Höflinge waren sichtlich beunruhigt. Stille breitete sich im Saal aus und Tschagatai beobachtete interessiert, wie sich der Minister des Königs noch einmal tief verbeugte. Er sah, wie die Fingerknöchel des Königs weiß wurden und sein Griff um die Armlehne fester wurde. Tschagatai hatte genug von ihrem Getue. Selbst die sanftmütigen Frauen zu Füßen des Königs hatten ihre Anziehungskraft verloren. Er wollte raus an die kühle Luft und vielleicht im Fluss baden, bevor die Sonne an Wärme verlor.
Doch Dschelme rührte sich nicht von der Stelle und sein Blick schien die Männer um den König herum nervös zu machen. Ihre abschätzenden Blicke waren verschwendet an die regungslosen Krieger, die dastanden und ein bestimmtes Ergebnis erwarteten. Die Stadt Songdo hatte weniger als sechzigtausend Einwohner und eine Armee von nicht mehr als dreitausend Mann.
Der König konnte tun und lassen, was er wollte, aber Tschagatai kannte die wahre Situation. Als die Antwort endlich kam, war sie keine Überraschung.
»Wir fühlen uns geehrt, dass du so viele junge Männer in deinen Dienst nimmst, General«, sagte der König.
Sein Gesichtsausdruck war säuerlich, aber Dschelme reagierte auf den Übersetzer und sprach weitere Worte des guten Willens, denen Tschagatai nicht weiter lauschen wollte. Sein Vater hatte Dschelme nach drei Jahren der Erkundung des Ostens nach Hause gerufen. Es würde gut sein, die Berge wiederzusehen, und Tschagatai konnte seine Ungeduld bei dem Gedanken kaum zügeln. Dschelme schien zu denken, dass dieses Ölpapier wichtig war, auch wenn Tschagatai bezweifelte, dass Dschingis es schätzen würde. Zumindest in diesem Punkt war sein Vater berechenbar. Es war gut, dass Dschelme auch Seide und Hartholz verlangt hatte. Solche Dinge waren es wert, sie zu besitzen.
Ohne einen ersichtlichen Befehl ertönte die Glocke draußen im Hof erneut und beendete die Audienz. Tschagatai sah den Dienerinnen zu, wie sie ihren Herrn zum Aufstehen bereitmachten und sich hinter ihm aufstellten. Er seufzte, als sich alle im Raum um ihn herum unmerklich entspannten, und kratzte sich noch einmal genüsslich in der Achselhöhle. Zuhause. Dschotschi würde auch zurückkehren, zusammen mit Tsubodai. Tschagatai fragte sich, wie sich sein Bruder in drei Jahren verändert haben würde. Mit siebzehn Jahren würde er erwachsen sein und zweifellos hatte Tsubodai ihn gut trainiert. Tschagatai ließ seinen Nacken mit beiden Händen knacken und freute sich auf die kommenden Herausforderungen.
In der südlichen Hälfte des Chin-Landes tranken sich die Krieger der dritten Armee von Dschingis besinnungslos. In