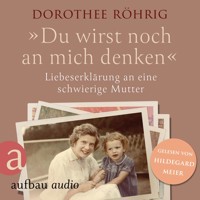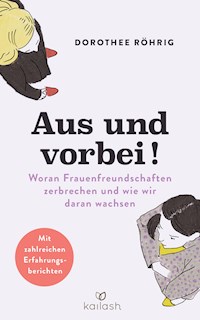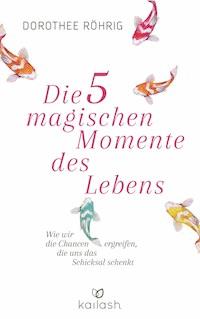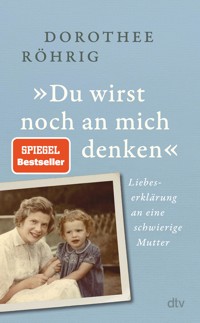
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Eine faszinierende Mischung aus Zeit- und Familiengeschichte.« Christine Westermann Der eindringliche Blick auf eine Familie, die deutsche Geschichte schrieb: Bonhoeffer-Dohnanyi Als Dorothee Röhrig auf ein altes Foto ihrer Mutter stößt, setzt sich ein Gedankenkarussell in Bewegung: Was weiß sie eigentlich über diese Frau, deren Vater kurz vor Kriegsende hingerichtet wurde und zu der sie zeitlebens ein ungewöhnlich enges und doch kontrolliert-distanziertes Verhältnis hatte? Und was hat diese Geschichte mit ihrer eigenen zu tun? Mit Empathie und Offenheit erzählt Dorothee Röhrig vom widersprüchlichen Verhältnis zu ihrer Mutter, der fremden Vertrauten, und von der Rolle der Frauen in einer Familie, die deutsche Geschichte schrieb: Bonhoeffer-Dohnanyi. Eine einfühlsame Reflexion über die Beziehung zwischen den Generationen, über die Schwierigkeit, mit quälenden Erinnerungen zu leben, und über den Versuch eines späten Kennenlernens. »Ihr gelingt ein gleichermaßen fesselndes wie psychologisch nuanciertes Familienporträt« Denis Scheck, ARD Druckfrisch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
»Wer war meine Mutter? Waren wir ein Glück füreinander?« Diese Fragen stellt sich Dorothee Röhrig immer wieder. Als sie sich nach deren Tod anhand von Briefen, Aufzeichnungen und Fotografien mit ihrer Familiengeschichte auseinandersetzt, findet sie eine Erklärung für das lebenslang schwierige Verhältnis: Die Verhaftung der Eltern ihrer Mutter, als diese sechzehn ist, die Hinrichtung des Vaters Hans von Dohnanyi zwei Jahre später – das lässt sich womöglich nur ertragen, indem man sich einen Panzer zulegt. Doch diese Überlebenstaktik hat einen hohen Preis, denn sie bedeutet: weder Gefühle noch Schwäche zeigen, keine Fragen zulassen, die böse Erinnerungen wecken, Zerbrechlichkeit mit Stärke überdecken. Und sie bedeutet auch, tunlichst zu vermeiden, sich allzu nahe zu kommen.
Dorothee Röhrig beleuchtet das komplizierte und trotz allem von großer Liebe getragene Beziehungsgeflecht. Den Helden der Familie Bonhoeffer-Dohnanyi, die bedeutende Personen der Zeitgeschichte und gleichzeitig ihre ganz normalen Verwandten sind, begegnet sie dabei mit eindringlichem, ganz eigenem Blick.
Dorothee Röhrig
»Du wirst noch an mich denken«
Liebeserklärung an eine schwierige Mutter
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Geleitwort
Kapitel 1 Vordergründig sicher geborgen
Kapitel 2 Hauptsache brav
Kapitel 3 Anders als die anderen
Kapitel 4 »Sei still, du weißt nicht, wen du vor dir hast!«
Kapitel 5 »Ein Kind ist keine richtige Familie«
Kapitel 6 Mein sorgloses Leben und ihr Leid
Kapitel 7 Liebe, Konkurrenz und Unverständnis
Kapitel 8 »Eine Frau muss doch nicht arbeiten«
Kapitel 9 »Eine Tochter gehört an die Seite ihrer Mutter«
Kapitel 10 Nach dem Winterschlaf
Epilog
Dank
Zitatnachweis
Geleitwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Literatur
Personen
Für
Sophie
Josefine und Caspar
Geleitwort
Im Frühjahr 2020, als Corona uns kaum vor die Tür lässt, entschließe ich mich, den Keller aufzuräumen. Diese grüne Kiste auszupacken, die verborgen in der hintersten Ecke steht. Meine Lebenskiste. Ich befördere ans Licht, was über Jahrzehnte wahllos hineingeflogen, in Vergessenheit geraten oder noch nie angesehen war. Wie das Foto von mir und meiner Mutter. Sie ist 28, ich bin knapp zwei Jahre alt. Ihr vorsichtiges Lächeln, der Griff, mit dem sie mich festhält, meine kritischen Kinderaugen. Das Foto berührt mich. Ich klemme es an meine Schreibtischlampe. Erinnerungen tauchen auf. Und Fragen. Jedes Mal, wenn ich das Bild von uns anschaue, sind es neue.
Meine Mutter war die ältere Schwester von Klaus von Dohnanyi und Christoph von Dohnányi. Sie starb vor fast sieben Jahren, kurz nach ihrem 90. Geburtstag. Ihre Eltern, Hans und Christine von Dohnanyi, geb. Bonhoeffer, waren maßgeblich am Widerstand gegen Adolf Hitler beteiligt. Beide wurden im April 1943 verhaftet. Meine Großmutter kam frei. In meinem Großvater erkannte die Gestapo einen der wichtigsten Gegner des Regimes. Er wurde am 9. April 1945 hingerichtet, wie auch sein Schwager Dietrich Bonhoeffer, ein Bruder meiner Großmutter. »Es war einfach der zwangsläufige Gang eines anständigen Menschen«, heißt es in der Familie bis heute. Der Preis des Anstands war allerdings hoch. Meine Großmutter und ihre drei Kinder erlebten hautnah Unrecht und Verbrechen und überlebten mit einer tiefen, immerwährenden Wunde.
Was geht wohl in einem 16-jährigen Mädchen vor, das aus der Schule kommt und beide Eltern sind verhaftet? Was ahnt sie, was weiß sie vielleicht sogar? Ist sie in Panik, wenn sie geheime Notizen ins Gefängnis schmuggelt? Wie erträgt sie den Anblick ihres schwerkranken Vaters in seiner Zelle? Und wie wirken sich diese Eindrücke und Gefühle auf ihr Leben aus – und damit auf meines? Was hat die Familiengeschichte mit mir gemacht? Wie bin ich aufgewachsen? Warum war es mir kaum möglich, meine Mutter nach ihrer Kindheit zu fragen, nach ihren Gefühlen, ihrem Schmerz, ihrem Glück?
Und überhaupt: Wie steht es eigentlich um die Rolle der Frau in meiner Familie? Meine Großmutter, eigenständig, mutig und mit hellwachem Geist, ist für meinen Großvater der Mittelpunkt. Welche Aufgaben waren meiner Mutter zugedacht? Meinungsstark, elegant und voller Humor, bleibt sie im Vergleich zu ihren Brüdern doch stets im Hintergrund. Was hat das für meine Mutter bedeutet – und damit für mich? Aus dem Berliner Frauengefängnis schreibt meine Großmutter, sie halte »Winterschlaf«. Sie gibt nichts von sich preis, lässt nichts an sich herankommen. Waren wir, Mutter und Tochter, miteinander auch wie im Winterschlaf? Unter einer dicken Decke aus Angst, Sprachlosigkeit und Verletzungen? Ich möchte versuchen, das zu verstehen, und beginne, mich mit meiner Familiengeschichte intensiv zu beschäftigen. Bücher zu lesen, Briefe, Aufzeichnungen.
Weil es an der Zeit ist, meiner Mutter den Platz einzuräumen, der ihr gebührt. Und einen anderen Blick zu wagen. Auf eine Familie, die außergewöhnlich ist und jedem Einzelnen viel abverlangt. Die Helden der Familie Bonhoeffer-Dohnanyi sind historisch wie zeitgenössisch bedeutend und zugleich meine ganz normalen Verwandten. Das macht den anderen Blick aus. Meinen Blick. Ich schreibe auf, was meine Mutter mir erzählt hat. Antworten, die ich bekam, Überlegungen, die mich begleiten, Fragen, die offen bleiben.
Heute, nach dem Tod meiner Mutter, fühle ich mich ihr oft näher als früher. Gegenüber der Familie, aus der ich stamme, spüre ich einen Zugewinn an Freiheit.
Kapitel 1Vordergründig sicher geborgen
0–7 Jahre
»Du hast wirklich Glück gehabt!« Ich bin zwölf Jahre alt, als meine Mutter mir zum ersten Mal von meiner Geburt erzählt. Vielleicht habe ich sie danach gefragt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall klingt das, was ich jetzt erfahre, ziemlich gruselig. »Plötzlich waren deine Herztöne weg und man hat blitzschnell einen Kaiserschnitt gemacht. Im letzten Moment haben sie dich geholt. Du warst schon richtig blau, fast tot. Professor Bickenbach hat dich an den Beinen nach unten gehalten und irgendwann hast du endlich geschrien.« Es reicht. Mehr will ich nicht wissen. Ist doch alles gut gegangen.
»Du hast Glück gehabt.« Der Satz beißt sich fest in meinem Ohr, in meiner Seele. Er begleitet mich, auch wenn ich nur selten an ihn denke. Nachts zum Beispiel, wenn ich nicht schlafen kann, weil ich am nächsten Tag eine Klassenarbeit schreibe, stelle ich mir ein blaues Baby vor, das kopfüber in der Luft hängt. Das bin ich. Der Beginn meines Lebens, verkehrt herum. Tun sie das mit allen Neugeborenen? Nachdenken bringt nichts. Egal, ich bin ja hier und gesund und morgen werde ich in Physik geprüft und habe keine Ahnung.
»Du hast Glück gehabt.« Die Worte meiner Mutter springen mich wieder an, als ich Jahrzehnte später das Foto von uns beiden in meiner grünen Lebenskiste finde. Was wollte sie mir damit sagen, damals auf der Terrasse, als ich mit ihr die Bettwäsche zusammenfaltete? Warum sollte nur ich Glück gehabt haben? War das erste Kind für meine Mutter nicht auch ein Glück? Haben wir nicht beide Glück gehabt? Waren wir ein Glück füreinander? Ich kann sie nicht mehr fragen. Nur noch zusammenklauben, was meine Erinnerung hergibt. Was aus meiner Kiste auftaucht. Und was Briefe verraten, die ich in ihrem Nachlass finde.
Ich bin der dritte Versuch meiner Mutter, nach zwei Fehlgeburten. Eineinhalb Jahre vor meiner Geburt schreibt meine Großmutter Christine von Dohnanyi an ihre Schwester Ursel, ihre Tochter komme nun bereits in den dritten Monat und müsse sich strengstens schonen. Der Arzt habe ihr nicht allzu viel Hoffnung machen können, dass sie das Kind diesmal austragen könne, weil wieder nicht alles in Ordnung sei. Sie sei aber trotz allem voller Zuversicht und nach außen guter Dinge.
Ich lese Großmamas Zeilen wie eine Detektivin. Alles, was ich vier Jahre nach dem Tod meiner Mutter erfahre, zieht mich mit ungeahnter Macht zurück in meine Familie. Die Geschichte von den Fehlgeburten, die mir hinter vorgehaltener Hand erzählt wurde, von denen meine Mutter selbst aber nie sprach, ist also wahr. Wie alt wären diese ungeborenen Geschwister heute? Ich beginne zu rechnen. Und zum ersten Mal spüre ich eine Art Traurigkeit, dass ich sie nie kennenlernen konnte.
Ich grabe in meiner Erinnerung. »Deine Mama konnte ihre Kinder im Bauch nicht gut genug ernähren«, flüstert mir Maria zu, als ich schon fast erwachsen bin. Sie ist seit fünfzehn Jahren in unserem Haushalt und kennt sich aus. »Eine Plazentainsuffizienz«, verrät mir Omama, meine Großmutter väterlicherseits, mit geheimnisvoll leiser Stimme. Ich kann mit dem Wort nichts anfangen.
Die Briefe von Großmama an ihre Schwester, von meiner Mutter in einer grünen Mappe sorgfältig aufbewahrt und mit dem Etikett »Mama« versehen, sind eine Fundgrube. So erfahre ich auch, wie labil der Zustand meiner Mutter in dem Jahr vor meiner Geburt war. Dass sie hohes Fieber hatte und eine Rippenfellentzündung und der Arzt nachts alle drei Stunden kommen musste, um ihr eine Spritze zu geben. Sonst wäre es vielleicht böse ausgegangen. Und wie schwer es für meine Großmutter war, dem Leiden des eigenen Kindes hilflos zuzusehen. Wie sehr sie dabei an ihre Grenzen kam. Und dass sie hoffte, mein Vater würde mit meiner Mutter bald eine kleine Erholungsreise machen.
Im August 1949, vier Jahre nach der Hinrichtung ihres Vaters im KZ, heiratet meine Mutter in München. Sie ist dreiundzwanzig Jahre alt, mein Vater nur wenig älter. Und jetzt, keine zwei Jahre nach der Hochzeit, schon wieder so viel Schmerz. Warum konnte ich mit ihr nie darüber sprechen?
»Du hast Glück gehabt.« Vielleicht ist das Glück tatsächlich mehr auf meiner Seite, denke ich plötzlich. Immerhin bin ich in der Tübinger Universitätsklinik durch Kaiserschnitt gesund auf die Welt gekommen und im Oktober 1952 gerade ein paar Tage alt, als bei meiner Mutter eine Thrombose in beiden Beinen festgestellt wird. Ein Familienerbe, schon ihr Vater, mein Großvater Hans von Dohnanyi, litt darunter, vor allem im Gefängnis. Sie, die so glücklich war, dass sie sich endlich wieder umdrehen und so besser schlafen konnte, muss ihre Beine hoch auf einem Gestell lagern. Jetzt, durch die Thrombose, fiebert sie sogar. Wegen ihres schlechten Gesundheitszustands darf sie mich nur selten sehen. Immer wenn die Schwestern mich zu ihr hineinfahren, ist meine Mutter furchtbar nervös. Sobald ich blass werde, zum Beispiel, weil ich in die Windeln mache, regt sie sich auf, sodass meine Großmutter es vernünftig findet, dass ich nicht ständig bei ihr im Zimmer bin. Doch zu ihrer Freude gedeihe ich gut und nehme regelmäßig zu: ein Püppchen mit rötlichblonden Haaren und zarter weißer Haut. Püppchen. So nennt mich meine Mutter bis zu ihrem Lebensende. Als sie mich kurz nach der Geburt betrachtet und bemerkt, dass ich mir ihren vorstehenden Oberkiefer, ein Familienmerkmal, ausgesucht habe, lacht sie: »Auf Schwäbisch heißt das ›Goschen‹.«
Großmama legt eine rote Rose auf das Bett ihrer Tochter. Von dieser Geste spricht meine Mutter später oft und ihre Augen leuchten. Als wäre es der einzige Lichtblick in einer ansonsten dunklen Zeit gewesen. Haben Schmerzen und Sorgen das Glück meiner Mutter über ihr Püppchen vertrieben? Überhaupt: Hatte das Glück je die Kraft, sich im Leben meiner Mutter durchzusetzen? »Du bist erst eine Frau, wenn du ein Kind geboren hast.« Das äußert sie mir gegenüber immer mal wieder. So nebenher und fast ein bisschen trotzig. Unsicher, wie dieser Satz wohl ankommt. Von dem Druck, keine richtige Frau zu sein, habe ich sie in ihrer Wahrnehmung befreit. Bin ich ihr Erlöserkind? Dann wäre ich doch ihr Glück!
Die Eltern nennen mich Dorothee, das bedeutet im Altgriechischen »Gottesgeschenk«. Noch heute bin ich für Johannes, den Cousin, mit dem ich aufwachse, das »Theechen«. Mit elf Jahren mag ich Dorothee nicht mehr. Zu ausgefallen, finde ich. Ich will Christine genannt werden. Das ist mein zweiter Name, nach Großmama. Meine Mutter ist dagegen: »So ein Quatsch.« Der Wunsch bleibt unerhört. Mein dritter Name ist Friederike, nach Omama. In unserer Familie ist es Tradition, Kindern die Namen ihrer Großeltern zu geben. Auch meine Mutter Barbara Elisabeth Pauline von Dohnanyi heißt mit zweitem und drittem Namen nach ihren beiden Großmüttern. Dieser Tradition folge ich achtundzwanzig Jahre später mit meiner Tochter Sophie nicht. Die Enttäuschung meiner Mutter ist groß.
Kurz nach meiner Geburt wird Helga mein Kindermädchen. Sie ist vierzehn Jahre alt und soll im Haushalt helfen. Für meine Mutter ist das normal. Schließlich ist sie selbst mit Kindermädchen aufgewachsen und ihre Mutter, meine Großmama, sogar mit einem ganzen Tross von Hausangestellten. Helga kommt aus zerrütteten Verhältnissen. Ihr Vater ist Alkoholiker und brennt Schnaps. Aber Helga ist stark. Und nach mehr als zehn Jahren in unserer Familie heiratet sie einen Tübinger Juristen und nennt ihre erste Tochter Barbara, nach meiner Mutter. Helga ist immer für mich da. Ihr Lachen und der lustige Pferdeschwanz gehören zu meinen frühen und fröhlichsten Erinnerungen. Sie zieht mit uns nach Wuppertal, wo mein Vater ein gutes berufliches Angebot als Justiziar eines Unternehmens angenommen hat. Ich bin erst wenige Monate alt. Die Stadt wird meiner Mutter über dreißig Jahre lang fremd bleiben. Ein Provinznest, wie sie öfter bemerkt. Im großbürgerlichen Leben von Berlin aufgewachsen, kommt ihr sogar eine Stadt wie München, wo sie kurz nach dem Krieg leben muss, provinziell vor. Immer wieder erzählt sie voller Verwunderung, dass man dort »zum Bahnhof« gehe. In »ihrem« Berlin habe es vor dem Krieg Dutzende von Bahnhöfen gegeben.
Jetzt also Wuppertal. Was für ein verlorener Platz! »Ach wie fern ist die Heimat und wie fremd bin ich hier, und es fragt ja kein Hunderl und kein Katzerl nach mir.« Dieses Lied singt sie mir vor, an meinem ersten Geburtstag. Und denkt an den Morgen meiner Geburt vor einem Jahr, von der sie nichts mitbekommen hat. Nur mein Vater wird immer noch bleich in Erinnerung an diese quälenden Stunden. Von Freude keine Spur an meinem ersten Geburtstag. Wie anders war doch alles für mich. Ich erinnere mich an die wundervolle Geburt meiner Tochter und ihren ersten Geburtstag. Die Begeisterung, mit der ich den Kuchen für sie backe. Mein Glücksgefühl, im neuen Häuschen mit Garten zum ersten Mal eine Kinderparty mit Familie und Freunden zu feiern.
Nichts davon an meinem Geburtstag. Die Stimmung ist getrübt. Fast flehentlich bittet meine Mutter, Großmama möge doch kommen. Doch aus dem Besuch wird nichts. Und Helga liegt in Tübingen nach einem Radunfall im Krankenhaus. Das hat meiner Mutter gerade noch gefehlt. Statt eine fröhliche Geburtstagsfeier auszurichten, sitzt sie nun allein an meinem Bett und verfasst einen Krankenbericht, denn ich, die Kleine, bin ziemlich elend. Ich habe Fieber, bin auffallend blass, meine Bäckchen sind eingefallen. Mein Geburtstagslicht wird nun einen Tag später angezündet werden müssen, dann geht es mir hoffentlich besser und auch mein Vater hat mehr Ruhe. Er hat seiner Frau einen zauberhaften Dahlienstrauß hingestellt und eine große Konfektschachtel. Den Sekt, den sie auf Eis gelegt haben, wollen sie heute Abend noch entkorken. Er scheint mir trotz Fieber geschmeckt zu haben, wie sie später bemerken. Ich muss schmunzeln. In der Familie war es Sitte, einen Finger ins Sektglas zu tauchen und das Geburtstagskind daran lutschen zu lassen. Schon bei meinen Groß- und Urgroßeltern. Davon wurde oft gesprochen.
Aufgewühlt und hellwach komme ich meiner frühesten Kindheit auf die Spur. Hatte ich gerade noch Mitgefühl mit meiner einsamen Mutter, bin ich doch einigermaßen entsetzt über ihre Erziehungsmethoden. Und fast ein bisschen stolz auf mich, dass ich offenbar ziemlich unnachgiebig sein konnte, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt hatte. So kreischte ich angeblich, wenn ich gefüttert wurde und nicht essen wollte. Ich kreischte, wenn man mich wickelte, ich kreischte auf der Straße in meinem Wagen, wenn ich etwas sehen wollte, was vorbeifuhr, und mein Blick nicht hinterherkam. Ein Kinderroller oder ein Auto zum Beispiel. Manchmal rutschte meiner Mutter dann doch die Hand aus. Das nahm ich ihr übel, zog einen Flunsch und stieß sie weg. Man merke jetzt so richtig, wie mein Grips erwacht, beobachtete sie in ihren Briefen.
Ich halte inne. Ja, es waren andere Zeiten. Erziehung hatte in dieser Generation wohl in erster Linie mit Ziehen und Zerren auf der einen Seite und Gehorchen auf der anderen zu tun. Aber was drückte meine Mutter da aus? Warum war sie nicht froh darüber, dass mein Verstand erwachte? Dass ich meinen eigenen Kopf entwickelte, ich etwas erleben wollte auf der Straße? Wo war ihr Stolz auf mich? Ihre Liebe? Ihr Glück?
Ich betrachte das Foto von uns beiden genauer. Es ist der Auslöser für dieses Buch. Ein Farbbild, das ich bis vor Kurzem nicht kannte und das mich schlagartig berührt. Warum? Ich kann es nicht erklären. Noch nicht. Meine Mutter lächelt vorsichtig, im hochgeschlossenen weißen Kleid, die kurzen Haare sind brav aus dem Gesicht gekämmt, die Oberlippe wölbt sich über ihre markanten Vorderzähne.
Mein Blick fällt auf ihre Hände, mit denen sie meinen kleinen Kinderarm umklammert. Aber ich sehe auch aus, als ob ich mich in jedem Moment losreißen könnte. Kritisch, eigenwillig. Etwas Spitzbübisches lauert in meinem Gesicht. An das taubenblaue gesmokte Samtkleidchen erinnere ich mich gut. Meine Mutter hat es wie so vieles aufbewahrt, später trägt es meine Tochter und dann ihr Teddybär. Auch meine ersten Löckchen gibt es noch. Meine Mutter hat sie in einen Umschlag gesteckt, auf dem »Dorothee« steht. Sie glänzen mir noch immer rötlich golden entgegen, als ich ihn öffne. Nach fast siebzig Jahren. Vorsichtig nehme ich die Haare heraus. Sie scheinen wie aus einer anderen Welt. Und sind doch meine eigenen. Eine Verbindung in die Vergangenheit, sichtbar, fühlbar. Danke, Mama.
Auf dem Foto kaum zu erkennen sind ihre verschiedenfarbigen Augen, ihr lebenslanges, unverwechselbares Merkmal. Für mich war es so normal, dass ich nie darüber nachgedacht habe. Auch nicht, als einige Freundinnen erstaunte Bemerkungen machten. Doch jetzt, während ich versuche, meine Mutter besser zu verstehen, ändert sich die Perspektive. Wie fühlt man sich mit einem blauen und einem braunen Auge? Wie kam es dazu? Niemand in der Familie trägt diesen Makel. Oder ist es eine Auszeichnung? Wie ging meine Mutter mit dieser Eigenheit um? Selbstbewusst? Ich glaube nicht. Wurde sie dafür gehänselt, früher in der Schule? Hat sie sich geschämt, im schlimmsten Fall ihr Leben lang? Wer hat sie getröstet, und wie? Du bist etwas ganz Besonderes. Vielleicht hat so etwas ihr Vater zu ihr gesagt. Oder mein Vater. Plötzlich hoffe ich es für sie.
Ihr Äußeres ist meiner Mutter nicht gleichgültig. Bis ins hohe Alter achtet sie darauf. Was muss sie empfunden haben, als sie, die Wasserratte, die stundenlang schwimmen konnte, jetzt sehr schnell müde wird und friert? Außerdem nimmt sie ständig ab und hat Sorge vor einer scheußlichen Klapperfigur. Im folgenden Winter kommt ein anderes Problem dazu. Meine Mutter hat eine runde Glatze auf dem Kopf und muss die Haare so kämmen, dass sie die Stelle möglichst zudecken. Was für eine entsetzliche Geschichte! Sie ist noch keine dreißig Jahre alt! Wie man nur an so etwas kommt? Auch mein Vater ist ganz bestürzt.
Aufmerksam blättere ich durch die Fotoalben von früher und suche nach dieser Glatze. Und tatsächlich, auf einem Bild, das von oben aufgenommen ist, kann ich die Stelle genau erkennen. Meine Mutter sitzt vor dem Weihnachtsbaum und kreisrund hebt sich deutlich ihre nackte Kopfhaut ab. Erschrocken halte ich inne. Denke an das große Foto von ihr als Zehnjährige, wie sie mit schönen dicken Zöpfen ein Kaninchen auf dem Arm hält. Das Porträt stand immer auf dem Schreibtisch meines Vaters und war wohl ein Werbebild aus den Dreißigerjahren für ein Haarwasser. Man hatte meine Großmutter auf der Straße angesprochen, weil die Haare meiner Mutter so auffallend kräftig waren. Und jetzt lese ich von ihrer Glatze. Kreisrunder Haarausfall, würde man heute diagnostizieren. Was für ein Drama muss das für sie gewesen sein! Meine Mutter ist in meinen ersten Lebensjahren nicht sehr gesund, das wird immer offensichtlicher. Ein chronischer Husten quält sie und sie fühlt sich schlecht. Man sieht es ihr wohl auch an, jedenfalls wird sie ständig auf ihren Zustand angesprochen. Das betrübt sie zusätzlich. Bis mein Vater eines Morgens glücklich feststellt, sie sähe plötzlich wieder jünger aus. Da ist sie richtig erleichtert.
Ich muss gut zwei Jahre alt sein, als wir in eine Wohnung in der Worringer Straße umziehen. Hier setzen meine frühesten Erinnerungen ein. Ich stehe am Fenster meines kleinen Kinderzimmers und schaue den Lastwagen hinterher, die lautstark die nahe gelegene Cronenberger Straße herauf- und hinunterknattern. Die Geräusche und das Hin und Her der Autos faszinieren mich. An die Wände meines Zimmers klebe ich Postkarten von Puppen und Tieren. Besonders liebe ich den bemalten Puppenschrank, den mein Großvater für meine Mutter gezimmert hat, Jahre vor seiner Verhaftung durch die Nazis. Das kleine Möbel hat wie durch ein Wunder den Krieg überlebt. Großmama schenkt mir Käthe-Kruse-Puppen, meine Mutter schneidert die Puppenkleider. Ich bekomme einen Zirkus mit Zelt, Wagen, Leitern und Figuren. Auch den liebe ich sehr. Begeistert drehe ich an dem Leierkasten. Er spielt die Melodie: Oh mein Papa. Christoph und Liane heißen die Nachbarkinder, mit denen ich im Gemeinschaftsgarten spiele. Zu dritt quetschen wir uns in eine Blechwanne, die meine Mutter mit Wasser füllt, und spritzen uns gegenseitig nass.
Immer wieder kommt Besuch. Großmama natürlich. Und Tante Renée mit ihrem Hänschen, meinem Cousin. Eigentlich heißt er Johannes, wohl nach meinem Großvater Hans von Dohnanyi. Hänschen ist der Sohn von Onkel Klaus, dem Bruder meiner Mutter, über den sie meinen Vater kennengelernt hat. Er ist ein dreiviertel Jahr älter als ich und wir werden zusammengespannt wie Geschwister. Vor Kurzem ist die Familie aus Amerika zurückgekehrt. Nun lebt sie nicht weit weg in Köln. Tante Renée illustriert Kinderbücher, sie kann gut malen. Und sie bringt ein großes Geschenk für mich mit. Aus Holzklötzen hat sie meine Geburtsstadt Tübingen nachgebaut, mit Kirche, Torbogen, Rathaus und Fachwerkhäusern. Einige entdecke ich als Studentin dort tatsächlich wieder. Drei Generationen spielen mit dieser bunten Stadt. Johannes und ich, meine Tochter, meine Enkelkinder. Danach schenke ich sie Johannes, als Andenken an seine Mutter. In Bad Aussee, im Ferienhaus der Familie, hält er sie bis heute in Ehren.
Im Sommer 1955 fahren wir ans Meer. Meine Mutter hat gerade ihren Führerschein gemacht, Helga und ich sitzen in unserem neuen Volkswagen hinten. Großmama, Tante Renée und Hänschen kommen mit dem Zug, die Väter müssen arbeiten. Anders als die fröhlichen Ostseefotos, die ich aus dem Fotoalbum kenne, vermuten lassen, geht es meiner Mutter nur leidlich gut. In Briefen nach Hause klagt sie über Übelkeit und Heuschnupfen. Beides ist nicht gerade eine Wonne, aber das Meer tut ihr gut, am Strand fühlt sie sich besser. Gerade hat sie eine Flasche Sinalco aufgemacht und genießt die süße Limonade, denn Kaffee ist ihr bereits zuwider. Aber alles nicht so wichtig, sie freut sich so schrecklich auf das Kleine und ist schon riesig gespannt. Möge mein Vater doch recht bald nachkommen! Meine Mutter ist also wieder schwanger.
Das Autofahren macht ihr viel Spaß. Sie kümmert sich gewissenhaft um den neuen Wagen, lässt beim Tanken regelmäßig Luft und Öl nachprüfen. Großartig, denke ich, zu der Zeit war es keineswegs selbstverständlich, dass eine Frau den Führerschein hatte. Meine Mutter erzählte oft lachend, wie sie die schriftliche Prüfung als einzige Frau zusammen mit sechs LKW-Fahrern machte. Besonders stolz schien sie darauf allerdings nicht zu sein. Sie fand die Situation eher komisch. Mir wird erst heute klar, was das damals bedeutete. Und ihre Rolleiflex! Ihr kleines Heiligtum, auch wenn sie sich nach ihrer Ausbildung an einer Münchner Fotoschule nicht mehr als Familienfotos zutraut. Denn ihre Rolle als Ehefrau und Mutter steht fest: Mein Vater verdient das Geld. An der Ostsee denkt sie ständig an ihn. Ob er genug esse und auch nicht zu sparsam lebe. Er solle vernünftig sein und seine Kräfte nicht verbrauchen. Sich mal ein Schnitzel braten, das sei einfach und gehe schnell. Und nicht vergessen, den Garten zu sprengen. Und sie lieb behalten, bitte.
Ihre Fürsorglichkeit bewegt mich. Auch, weil ich selbst gern »bemuttere«. »Overprotecting Mom«, sagt meine Tochter zu mir. Mein Mann muss sich gelegentlich wehren, wenn ich in der Haustür nachfrage, ob er seine Brille, seinen Schal, sein Handy dabeihat. Es fällt mir schwer, mich von diesem Kontrollzwang zu befreien. Ich kenne ihn schon von meiner Mutter. Was ich leider auch kenne und mich bemühe abzulegen, ist diese ständige leise Vorwurfshaltung gegenüber anderen, die es einem irgendwie nicht recht machen. Wie mein Vater, dessen Briefe und Karten in die Ostseeferien meiner Mutter keineswegs ausreichen. In drei Wochen nur drei Briefe, das ist zu wenig! Er überanstrenge sich nicht gerade. Ihr Bruder Klaus sei schon etwas besser, der schreibe an seine Frau Renée öfter. Zweimal die Woche kann man schon erwarten. Und dann die kleine Drohung: Wenn mein Vater sich nicht stärker bemühe, werde auch sie nicht mehr so viel berichten. Aber zum Glück hat sie ihn so lieb und küsst ihn aus der Ferne.
Zuckerbrot und Peitsche. Der Vergleich mit ihrem Bruder Klaus, lebenslang ein Thema. Ist der Brief nicht auch ein Hilferuf?, überlege ich mir. Meine Mutter ist schwanger. Sicher hat sie oft Angst nach allem, was passiert ist. Warum kann sie ihre Gefühle nicht ausdrücken? Stattdessen Vorwürfe. Nötigung. Auch das kenne ich gut von ihr. Spüre in dem Moment wieder diesen vertrauten Druck in meiner Brust. Warum findet sie keine liebevolleren Worte? Auch nicht, als sie einen Tag später eine Erklärung meines Vaters erhält. Er hatte Ärger im Büro und wollte ihn allein mit sich austragen. Das tut meiner Mutter dann doch leid. Aber warum sagt er ihr nicht mehr dazu? Es interessiert sie doch! Nur nackte Tatsachen ohne Kommentare sind ihr etwas wenig. Wieder Anspannung. Anklage. Und dann ein versöhnlicher Schluss. Mein kleiner Cousin Johannes habe mich im Streit umgeworfen. Durch ihn würde ich jedenfalls auf einen künftigen Bruder gut vorbereitet. Doch eigentlich ist sie wieder auf ein Mädchen eingestellt, gesteht sie meinem Vater.
Es läuft nicht so, wie meine Mutter sich das wünscht, mein Vater muss seine Ankunft an der Ostsee verschieben. Sie hat sich zu früh auf ihren Mann gefreut. Ich vermute, er rackert sich ab für die Familie. Und für das Geld. Das hat er sein Leben lang getan. Meine Mutter hadert mit der Situation. Warum bloß kann er nicht schon kommen? Jetzt bezahlen sie ein leeres Bett, wöchentlich fast sechzig Mark. Nun gut, meine Großmutter will das mittragen, aber sie zahlt an der Ostsee sowieso schon fast alles und Geld einfach zum Fenster rauswerfen, das sieht meine Mutter nicht ein. Überhaupt findet sie, dass man die achtzehn Urlaubstage, die mein Vater in diesem Jahr noch hat, ausnutzen sollte. Denn im nächsten Frühjahr ist ja das kleine Baby da und dann wird es mit Ferien schwierig. Diese endlose Trennung statt einer schönen Zeit mit der Familie am Meer – am Anfang war alles so gut geplant gewesen und jetzt hat es sich so dumm entwickelt. Meine Mutter ist enttäuscht.
Die Ehe meiner Eltern. Haben sie miteinander Glück gehabt? Ich vermute: ja. Aber ich weiß so wenig über die beiden. Nur, dass ich sie wie eine feste Mauer wahrgenommen habe. Da prallt man als Kind ab. Die erneute Schwangerschaft meiner Mutter geht mir nicht aus dem Kopf. Ich rechne nach. Das Geschwisterchen wäre drei Jahre jünger als ich. Nur: Ich habe es nie kennengelernt.
Bevor mein Vater Mitte August 1955 endlich an der Ostsee eintrifft, gebe ich mal wieder Anlass zu Sorge. Leider sehe ich gar nicht gesund aus und meine Mutter lässt mich nicht mehr ins Wasser, weil ich solche Ringe unter den Augen habe. Woran kann das liegen? Sie kommt nicht dahinter, denn ich bin dabei sehr vergnügt und futtere tüchtig. Großmama meint, die Seeluft sei anstrengend, aber täte mir letztlich bestimmt sehr gut. Ich tobe viel mit anderen Kindern und meine Mutter befürchtet, dass ich mir, wenn wir wieder in Wuppertal sind, sehr einsam vorkommen werde. Dabei habe ich gerade sehnsüchtig gesagt, dass ich nach Hause zu meinem Papa will: »Mama, du kannst doch Autofahren und ich setze mich vorn neben dich!« Diese Entschiedenheit rührt mich. Einmal mehr bin ich meiner Mutter dankbar, dass sie so viel geschrieben und aufgehoben hat.
Eine Szene, von der ich beim Lesen der Briefe erfahre, ergreift mich besonders. Ich erkenne, wie ich – auch – groß wurde: mit Vertuschung, Ablenkung und falscher Beruhigung. Meine Mutter hat mit mir eine sehr merkwürdige Geschichte erlebt, von der sie meinem Vater berichtet. Großmama lud alle in ein Café zum Eisessen ein. Auf dem Weg begegneten wir einem Mann im Rollstuhl, und ich fragte laut, ob er keine Beine habe. Meine Mutter versuchte meine Frage zu übergehen und deutete auf ein Eichkätzchen, das gerade vorbeigehuscht war, aber ich bestand auf einer Antwort und sagte: »Ich meine den Mann da, hat der Schmerzen?« Nun musste meine Mutter Farbe bekennen. Sie erklärte mir, dass man leise frage und der Mann bestimmt keine Schmerzen mehr habe. Das stellte mich offenbar nicht zufrieden. Ich war in Gedanken versunken, bis wir vor dem Café ankamen. Dort sahen wir den Mann im Rollstuhl wieder. Ich soll blass geworden sein, stumm am Tisch gesessen und sogar Eis und Kuchen abgelehnt haben. Nicht einmal ein schwarzes Kätzchen konnte mich auf dem Heimweg aufmuntern. Großmama meinte, ich, die Kleine, habe ein sehr weiches Gemüt. Aber sonst sei ich sehr vergnügt, beruhigt meine Mutter meinen Vater. Und wahrscheinlich auch sich selbst.
Ich wollte weder Eis noch Kuchen. Ich wollte nur gehört werden. Und wurde abgewehrt. Weil es in meiner Welt keine Irritationen geben durfte. Keine direkten Fragen. Keine ehrlichen Antworten. Die Oberfläche sollte stimmig sein und schön und unverdächtig. Ohne Verwundungen, Schmerzen, Trauer, Angst. Davon hatte man genug gehabt. Das steckte man jetzt weg. Leise. Unmerklich. Wie meine Mutter, die trotz ihres Unwohlseins nach außen hin guter Dinge ist. Großmama hat es ja beschrieben.
Kaum jemand weiß besser als sie, was es heißt, sich zu verstellen. In ihren Wochen im Frauengefängnis hat meine Großmutter geschwiegen, sich dumm gestellt, getäuscht, vertuscht, mit allen Mitteln die Nazischergen beruhigt. Und war allein mit ihrer Angst, ihren Sorgen um Mann und Kinder, den möglichen Tod vor Augen. Sie halte »Winterschlaf«, schreibt sie am 27. April 1943 ihrem Mann aus der Haft. »Hast Du mal einen Frosch im Winter im Wasser gesehen? So bin ich und so ficht mich von den äußeren Dingen, die einem normalen Menschen demütigend erscheinen müssen, nichts an.«
Vom Sommer 1955 bis zum Frühjahr 1958 scheint meine Mutter zu verstummen. Keine Briefe. Kein Hinweis, wann sie nach den Ferien an der Ostsee wieder eine Fehlgeburt erlitten hat. In welchem Monat sie war. Später flüstert mir meine andere Großmutter nur zu: »Es war eine Totgeburt.« Mit Babybauch sehe ich meine Mutter nie. Auch nicht, als sie mit meinem Bruder schwanger ist, der 1959 gesund auf die Welt kommt.
Der einzige Brief von Großmama, den ich aus dieser stummen Zeit finde, datiert aus dem Jahr 1956, er gibt Einblick in die Erwartung, die die Familie meiner Mutter an meinen hilfsbereiten Vater hat – der schließlich auch gerade zum dritten Mal ein Kind verloren hatte. Der Schwiegersohn solle doch bitte nachsehen, ob es eine Postkarte gäbe, die den fristgerechten Empfang ihres Wiedergutmachungsantrags bestätigt. Er sei ja in der Sache bereits auf den Ämtern gewesen. Auch mit der Anerkennung als politisch Verfolgte gäbe es noch Komplikationen. Ihr selbst scheint es ordentlich zu gehen. Sie habe bessere und weniger gute Tage, aber keine wirklich schlechten mehr.
In meiner kindlichen Wahrnehmung ist Großmama immer die, die uns beschenkt. Wie sehr sie um ihr Geld kämpfen musste, wie wenig sie hatte, wird mir erst jetzt klar. Sie stammte aus einer angesehenen großbürgerlichen Familie, in der es an nichts fehlte. Was machte der Geldmangel nach dem Krieg mit ihr? Wahrscheinlich war sie, gemessen an ihren geringen Mitteln, enorm großzügig. Im Oktober 1947, eineinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod ihres Mannes, bittet sie ihre Schwester Ursel nachzufragen, ob ihre Schwägerin Grete eventuell noch eine Kaffeemühle habe, ganz egal, was für eine. Und dann ein Päckchen zu schicken, falls das Ding auftaucht. Ihrerseits bietet sie Hilfe an für die Kinder ihrer älteren Schwester, sollten diese irgendwelche Wünsche haben oder in finanzielle Not kommen. Großmama hatte so ein großes Herz, denke ich spontan.
Im Jahr 1950, als nach dem Tod der Eltern Bonhoeffer deren Haushalt in Berlin aufgelöst wird, ist Großmama an dem Sofa interessiert, denn ihres ist von den Russen völlig demoliert, kein Tischler kann es reparieren. Auch um den Sessel und das Tischchen bittet sie, die Situation beim Essen könne so nicht weitergehen. Immer müsse sie sich drei Kissen unter den Allerwertesten klemmen, um an den viel zu hohen Tisch zu gelangen. Für einen neuen habe sie kein Geld. Tischchen und Sessel meine ich zu kennen. Sie standen bei meiner Mutter. Und sind jetzt bei mir.
Zurück nach Wuppertal. Die Kinderzeit in der Worringer Straße ist abrupt beendet, als Anfang des Jahres 1958 Tante Renée stirbt. Ein gutartiger Gehirntumor, heißt es. Sie ist 31 Jahre alt und überlebt die Operation nicht. Kurz vor seinem 6. Geburtstag hat Johannes keine Mutter mehr. Und Onkel Klaus ist Witwer, mit 29 Jahren. Ein Schock für die ganze Familie. Meine Mutter muss Tante Renée sehr nah gestanden haben, so nah wie keiner anderen Schwägerin. Bis ins hohe Alter erzählt sie mit auffallend warmer Stimme von ihr. Auch Großmama habe Tante Renée so sehr geliebt. Was für ein Verlust. »Ich will zu meiner Mama«, weint Johannes nachts in seinem Bett. »Das geht nicht, sie ist doch tot«, rufe ich aus meinem Bett zurück. Ich erinnere mich genau. Ich bin fünf Jahre alt.
Meine Großmutter zieht zu ihrem verwitweten Sohn nach Bensberg bei Köln, Helga und ich ziehen mit. Meine Eltern kommen von nun an regelmäßig zu Besuch, erzogen werden wir von Großmama. Onkel Klaus hat viel um die Ohren, er bleibt für mich im Hintergrund. Das Haus in der Buchenallee 17 kommt mir riesig vor im Vergleich zu der Wuppertaler Wohnung. Vor allem der Garten. Er ist teilweise verwildert und endet an einem alten Straßenbahngleis. Wir sammeln Stöcke, Moos und Farn und bauen daraus Häuschen für die Zwerge.
Johannes und ich werden gemeinsam eingeschult. Fräulein Proske heißt unsere Lehrerin, mit ihrer Zwickelbrille wirkt sie auf mich wie eine uralte Frau. Mit unseren Schulfreundinnen »Mückchen« und »Nati« spielen wir im Garten Kaufmannsladen in der alten Laube, die nie benutzt wird und sich herrlich dafür eignet. Aus Blättern wird Spinat, aus weißen Wiesenblüten Blumenkohl. Gelben Löwenzahn verkaufen wir als Eier. Onkel Klaus arbeitet bei Ford und hat amerikanische Freunde. Wenn »die Laytons« kommen, freue ich mich. Frau Layton ist ungewöhnlich elegant, das mag ich. Kit und Geoffrey sind ihre Kinder. Sie sprechen zum Glück deutsch, aber mit einer komischen Aussprache. Mit ihnen feiern Johannes und ich Karneval, als Burgfräulein und Till Eulenspiegel. Die Kostüme näht uns Tante Renate, die Frau von Onkel Christoph, dem anderen Bruder meiner Mutter. Tante Renate ist Schauspielerin, sie hat eine tiefe, laute Stimme und gerade ein Baby bekommen.
Wir gehen miteinander zu Kindergeburtstagen. »Hänschen, sei bescheiden«, mahnt Großmama jedes Mal. Beim Kuchenessen ist er immer der Erste. Ich trage zu solchen Anlässen ein hellblaues Flanellkleid mit weißem Bubikragen und einer im Rücken gebundenen Schleife. Auch, als wir zum ersten Mal abends in die Kölner Oper dürfen: ›Der Freischütz‹ von Carl Maria von Weber. Vorher müssen Johannes und ich Nachmittagsschlaf halten. Vor Aufregung bekomme ich kein Auge zu und zähle die Märchenfiguren auf der Tapete. Großmama erscheint mit ihrer blauen Nivea-Dose, wir müssen uns gut die Hände säubern und eincremen, dann ziehe ich mein Schleifenkleid an und wir fahren in die Stadt. Manchmal machen wir mit Großmama »Kleppei«. Wir dürfen dann Eigelb mit Zucker mixen und so lange rühren, bis ein sämiger Brei entsteht und der Zucker nicht mehr knuspert. Das lieben wir und löffeln um die Wette die Schüssel aus, noch bevor das Eiweiß geschlagen ist. Großmama liest uns auch oft vor. Wir hängen an ihren Lippen, wenn sie mit eindringlicher Stimme von Nils Holgersson und seiner Reise mit den Wildgänsen erzählt. Oder ein Märchen von Hans Christian Andersen ausgesucht hat. Ihre Lieblingsmärchen, sagt sie. Die Märchen der Gebrüder Grimm sind ihr zu grausam.
In der Schule erfahren wir, dass bald Muttertag ist. Johannes und ich sammeln Gänseblümchen und schmücken damit zwei Gartenstühle auf der Terrasse. Einen für Großmama, einen für meine Mutter, die zu Besuch kommt. Wir sind so stolz, aber nicht lange. »Wisst ihr, Muttertag gab es bei den Nazis. Der wird bei uns nicht gefeiert.« Was für eine Enttäuschung! Ratlos schauen wir uns an. Später beim Einschlafen höre ich das Geräusch von Bocciakugeln auf dem Rasen, dazu die Stimmen und das Lachen der Erwachsenen. Ich fühle mich sicher und geborgen.
Vermisse ich meine Eltern, sehne ich mich nach meiner Mutter? Ich kann es nicht sagen. Ich fühle es nicht. Ich erinnere mich weder an freudige Umarmungen beim Wiedersehen noch an Tränen beim Abschied. Meine Mutter, so scheint es mir, war mal da und mal nicht. Meinen Alltag erlebe ich mit Großmama, Johannes und Onkel Klaus. Und Helga ist ja immer in der Nähe. Jahrzehnte später, mit Mitte vierzig, notiere ich in meinem Lebenslauf, den ich für die Beantragung einer Psychoanalyse vorlegen muss: »Ich weiß nicht, wo ich damals richtig zu Hause war, in der großen Villa in Köln mit dem verwunschenen Garten oder in der elterlichen Wohnung in Wuppertal. Auf jeden Fall vermute ich, dass meine Mutter auf diese Weise Freiräume hatte und ihre Schwangerschaften gut vor mir kaschieren konnte.«
Heute habe ich das Gefühl, es wurde von der Familie alles nur Denkbare unternommen, um Johannes und mich so gut wie möglich durch diese ersten Jahre zu bringen. Ich spüre die Kraftanstrengung, die dafür nötig war. Vor allem bei meiner Mutter und meiner Großmutter. Zwei vom Krieg und von schwersten persönlichen Verlusten gebeutelte Frauen, die um ihr seelisches und körperliches Überleben kämpften. Und um das ihrer Kinder und Enkelkinder. Wo Leid ferngehalten wird, entsteht neues: So dachte damals keiner.
Wenige Wochen nach dem Tod von Tante Renée im März 1958 geht es in den Schnee, nach St. Märgen im Schwarzwald. Johannes und ich lernen Skilaufen und fahren fröhlich Pferdeschlitten. Meine Mutter registriert, dass ich eine große Liebe habe, einen achtjährigen Jungen. »Ich finde ihn sehr nett und er hat so weiche Hände«, soll ich gesagt haben. Das amüsiert sie und Großmama köstlich. Weniger gut gefällt ihnen, dass ich beim Einschlafen wieder Theater mache, so wie damals auf dem Ginsberg. Großmama hat mir für Köln einen Ballonroller in Aussicht gestellt, wenn ich am Abend gleich einschlafe. Sie hoffen beide, dass diese Aussicht zieht.
Der Ginsberg. Das Hotel im Sauerland. Dort besuchten wir Großmama, als ich etwa vier Jahre alt war. Sie war hier zur Erholung. Die Tür zu meinem Zimmer blieb einen Spalt breit offen, weil ich nicht einschlafen konnte. Der Hund des Hauses tapste an mein Bett und schnüffelte. Ich wachte auf und brüllte. Irgendwann eilten Mama und Großmama herbei. Diese Geschichte gehört zu meinen schrecklichsten Kindheitserinnerungen. Meine Mutter nennt das Theater. Und wenn ich jetzt kein Theater mehr mache und brav einschlafe, bekomme ich einen Roller. Warum kann ich auch in St. Märgen nicht schlafen, wovor habe ich Angst? Weiß es meine Mutter? Nicht fragen, lieber belohnen.
Ein gutes Jahr später, am 5. Mai 1959, ruft Helga aus dem Küchenfenster in Bensberg: »Theechen, du hast ein Brüderchen, und das lebt!« Sie ist aufgeregt. Ich bin im Garten und weiß noch, dass ich mich über die Nachricht wundere: Warum sollte es nicht leben? In der Münchner Universitätsklinik wurde soeben mein Bruder Christoph geboren, wieder bei Professor Bickenbach. Er hat mich in Tübingen auf die Welt gebracht und meine Mutter ist ihm nach München gefolgt.