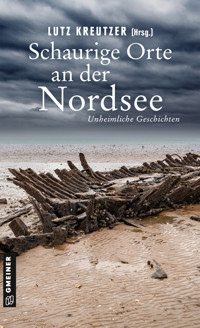2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Spreewald – eine Gegend voller unheimlicher Mythen und Legenden. Für einen ehemaligen Berliner Kommissar wird der erhoffte Neuanfang zu einem Alptraum ohne Erwachen …
Ein Umzug von der Großstadt in den idyllischen Spreewald – für den Berliner Kommissar Robert Lindner, der wegen einer Schussverletzung den Dienst quittieren musste, ist es der Beginn eines Alptraums. Während seine Frau Marie mit den beiden Kindern und der Renovierung eines alten Hotels beschäftigt ist, leidet er selbst unter unvorstellbaren Ängsten. Ihm scheint, dass sich im undurchdringlichen Wasserlabyrinth der Spree ein Geheimnis verbirgt, das seine Familie bedroht. Auf der Suche nach Beweisen verliert sich Robert immer mehr in unheilvollen Mythen und Legenden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Berlin, zwei Jahre nach der Wende: Kommissar Robert Lindner muss wegen einer Schussverletzung den Dienst quittieren. Schweren Herzens zieht er mit seiner Frau Marie und den beiden Kindern in ein abgelegenes Dorf im Spreewald, wo Marie ein kleines Hotel geerbt hat. Robert, der noch immer an den Spätfolgen seiner Verletzung leidet, tut sich schwer mit diesem Neuanfang auf dem Land. Er findet keinen Anschluss und wird zunehmend von Alpträumen geplagt. Bald ist er davon überzeugt, dass sich im undurchdringlichen Wasserlabyrinth der Spree ein unheimliches Geheimnis verbirgt, das seine Familie bedroht. Der Legende nach soll dort eine Heilerin ihr Unwesen treiben, die einst auf dem Scheiterhaufen landete. Doch Marie, Roberts engste Vertraute, will ihm nicht glauben und macht sich Sorgen wegen seiner wachsenden Paranoia. Verzweifelt versucht Robert Beweise zu finden und verliert sich dabei immer mehr in unheilvollen Mythen und Legenden.
Autor
Hendrik Berg wurde 1964 in Hamburg geboren. Nach einem Studium der Geschichte in Hamburg und Madrid arbeitet er zunächst als Journalist und Werbetexter. Seit 1996 verdient er seinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben von Drehbüchern. Er wohnt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Köln.
Weitere Informationen unter www.hendrik-berg.de
Hendrik Berg
Dunkle Fluten
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Originalausgabe Mai 2012
Copyright © 2012 by Wilhelm Goldmann Verlag,
München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Uno Werbeagentur München
Umschlagfoto: Getty Images/Dinodia Photos; FinePic®
mb · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN 978-3-641-07627-6V002
www.goldmann-verlag.de
Für Sigi.
Für Klaus und den Literatursalon.
Und natürlich für Anke.
In Liebe und Dankbarkeit.
1
Nur Stille. Absolut, kalt, endgültig. Die verschwommenen Gesichter der anderen – starre, ernste Masken der Vergangenheit. Wie in Zeitlupe schwebten sie an ihr vorüber. Die Sonne war nur ein zartes Glimmen hinter der dichten Wolkendecke des Winters.
Hass durchströmte jede Faser ihres Körpers. Wut. Und Angst. Aber am stärksten war der Hass. Auf die anderen, die draußen auf dem Eis standen, um mitanzusehen, wie es mit ihr zu Ende ging. Hass auf die, die sie verraten hatten. Hass auf das Schicksal, das zuließ, dass sie so jämmerlich sterben musste.
Zuerst hatte sie noch versucht, die Eisschicht mit ihrem Kopf und den Schultern zu durchstoßen. Immer wieder. Vergeblich. Die eisige Kälte drückte wie ein Nagelbrett auf ihren nackten Körper. Panik, als sich ihre Lunge mit dem frostigen Wasser des Flusses füllte. Mit dem Gesicht im Schlamm hatte sie versucht, ihre gefesselten Hände unter das Eis zu schieben. Wie verrückt hatte sie an der Eisschicht gekratzt und verzweifelt getreten. Alles umsonst. Die Haut unter ihren Fingernägeln blutete, ihre Fußknöchel schmerzten, doch das Eis bebte nur träge und blieb so geschlossen wie zuvor.
Schließlich wurden ihre Bewegungen langsamer, und ihr Bewusstsein sank in ein funkelndes Bett aus Erinnerungen. Ihr Vater stieg im hellen Mondlicht zu ihr ins Kinderbett. Ihre Mutter zerrte sie mit abwesendem Blick über einsame Felder. Sie waren auf der Flucht vor dem Krieg und den Soldaten. Und vor ihrem Vater. Dann das schmutzige Hinterzimmer im Gemeindehaus, in dem die Mutter nackt auf einem Tisch lag. Starre, an die Decke gerichtete Augen.
Sie sah die Sonne und den Mond, die im Wettlauf mit dem Leben über das Firmament rasten. Tag und Nacht, dann erneut Tag. Licht und Schatten. Immer wieder Schatten. Regen und Sonne. Sommer und Winter. Von Frost überzogene Ähren. Ein Fluss, der sich stumm seinen Weg durch Auen und Wälder bahnte. Ein Reiher im feuchten Sumpf, in dessen langem Schnabel ein glänzender Fisch zuckte.
Ihr Haus mitten im Sumpf. Der Duft nach feuchtem Gras. Dichter Nebel, der über das Wasser auf sie zuschwebte. Der Herbstwind, der sanft durch die Baumwipfel fuhr. Das gedämpfte Geräusch des Flatterns einer Krähe auf dem Dach. Ein Hahn, zerrissen von einem wilden Hund. Flimmerndes Licht an einem Sommertag. Sein zärtlicher Blick, als er mit ihr im frisch gemähten Heu niedersank, nackt, schwitzend vor Leidenschaft. Ihr Stöhnen, als er zum ersten Mal in sie eindrang.
Die Erinnerung ließ sie die Augen weit aufreißen. Durch das Eis sah sie die Gesichter der Männer und Frauen, die ihren Todeskampf mitleidslos und voller Verachtung beobachteten. Für einen kurzen Moment hatte sie das Gefühl, eine Ausgestoßene zu sein, einsam und unendlich allein in ihrem Schicksal. Ein dunkler Regen aus Hass und Verachtung spülte jedes Gefühl von Scham für ihre unglaubliche, ihre schreckliche Tat davon. Sie wusste, dass man ihr keine Wahl gelassen hatte. Keins dieser kleinen Menschlein würde das je verstehen. Er hatte sie gerufen, und sie war Ihm gefolgt. So wie sie Ihm immer folgen würde, bis ans Ende aller Zeiten.
Auch jetzt konnte sie Ihn spüren, konnte seine leise Stimme hören. Der dunkle Schatten. Immer wieder der dunkle, schwarze Schatten, der sie wie ein starker, aber unheimlicher Freund begleitete. Der auf sie wartete. Sanft und fordernd zugleich leitete die Stimme sie aus dem verwirrenden Labyrinth ihrer Erinnerungen. Endlich verstand sie die Worte und wusste: Sie war nicht allein. Sie würde niemals allein sein.
Sie spürte nichts mehr. Keine Schmerzen, keine Angst. Das Ende. Staunend beobachtete sie, wie letzte Luftblasen nach oben stiegen und sich unter der Eisfläche sammelten. Sie war bereit, war schon Teil von etwas Größerem. Wieder blickte sie nach oben. Die Gesichter der anderen, wie jämmerlich sie aussahen. Die Sonne fand einen Weg durch die dunklen Wolken. Das Licht brach sich im Eis, tauchte sie in einen leuchtenden Regenbogen und wies ihr den Weg. Sie lächelte, als das Leben aus ihr wich.
2
Der schwarze Mercedes rammte ihre rechte Vorderseite. Der Passat kam von der Spur ab, donnerte gegen einen der Betonpoller neben der Fahrbahn, drehte sich zweimal um seine Achse, rutschte über den regennassen Bürgersteig mitten durch einen Kiosk und krachte schließlich in das Schaufenster eines türkischen Supermarktes.
»Scheißkerle«, stöhnte Piet.
Robert starrte ungläubig auf die zerquetschten Tomaten, Zucchini und Orangen in der kaputten Holzkiste vor sich auf der Motorhaube. Wütend legte er den Rückwärtsgang ein. Die Kupplung knirschte. Als der zerbeulte Passat langsam durch die Trümmer des kleinen Ladens zurück auf den Bürgersteig fuhr, knackten Scherben unter den Reifen.
Durch die Regenschlieren auf der Windschutzscheibe sah Robert, wie Passanten entsetzt in Richtung des zerstörten Supermarktes starrten. Im Laden stand eine Frau mit Kopftuch und hob schreiend die Hände zum Himmel, während eine andere erschrocken ihr Baby an die Brust drückte. Fußgänger riefen panisch um Hilfe und deuteten immer wieder auf den Wagen mit dem blinkenden Blaulicht.
Doch Robert und Piet hatten keine Zeit. Sie mussten weiter, der Mercedes war schon nicht mehr zu sehen. Entschlossen legte Robert den Gang ein und ließ den Motor aufheulen. Mit durchdrehenden Reifen schossen sie zurück auf die Fahrbahn. Tomaten flogen gegen ihre Scheibe, als sie auf der Straße davonrasten.
Sie nahmen die Verfolgung wieder auf. Der Mercedes hatte inzwischen den Mehringdamm nahe dem Halleschen Tor verlassen und raste über die Skalitzer Straße unter der stählernen S-Bahn-Trasse vorbei am Kottbusser Tor in Richtung Treptow. Die Straße war durch den Feierabendverkehr und die vielen Baustellen in Kreuzberg völlig verstopft. Am Görlitzer Bahnhof ging gerade ein Flohmarkt zu Ende. Die Händler hatten ihre Wagen, darunter viele mit polnischen Kennzeichen, in der zweiten Reihe abgestellt und verstauten im strömenden Regen hastig ihre nicht verkauften Waren, als der Mercedes heranrauschte. Wie ein Panzer rammte sich der Wagen den Weg frei. Die Menschen flohen in alle Richtungen, Plastiktüten mit Büchern und Trödel flogen durch die Luft und landeten auf dem nassen Asphalt. Robert riss das Steuer rum, doch zu spät. Der Passat ruckte kurz, als er den kleinen Körper überfuhr.
»Nein!«, schrie Robert entsetzt.
»Nur eine Puppe, Mann! Es war nur eine Puppe.«
Robert blickte zurück und sah den aufgeplatzten Plastikkörper. Ihm war, als würde ihm unter dem blonden Haar ein schwarzes Auge nachstarren. Benommen schüttelte er den Kopf und atmete tief durch.
»Verdammt, wo bleibt die Verstärkung?«, fluchte Piet.
Robert hatte sich wieder nach vorn gewandt und suchte die Straße ab. Wo war der Mercedes? Er konnte ihn nicht mehr entdecken. Fluchend drückte er das Gaspedal durch und jagte den Dienstwagen auf gut Glück weiter durch Kreuzberg.
Als er aufstoßen musste, schmeckte er Zwiebeln und öliges Fleisch. Scheiß Döner! Wieso nur hatte er heute Mittag nichts Richtiges gegessen? Aber er wusste ja, warum: weil er auch diesen Morgen keine Zeit für ein ordentliches Frühstück gehabt hatte und mittags dann völlig ausgehungert gewesen war, hatte er einfach so schnell wie möglich so viel wie möglich runtergeschlungen. Er stöhnte auf und versuchte den Gedanken an das fettige Fleisch zu verdrängen.
Endlich hatte er den Mercedes wieder im Blick. Der Wagen näherte sich jetzt dem Schlesischen Tor. Auch hier hatten Bagger die Straße aufgebrochen, die Autos stauten sich auf dem alten Kopfsteinpflaster. Von beiden Seiten rasten zwei Streifenwagen mit grellem Blaulicht auf die Kreuzung zu. Verstärkung, endlich. Doch bevor sie dem Mercedes den Weg abschneiden konnten, rauschte dieser zwischen ihnen hindurch in Richtung Oberbaumbrücke.
»Na bitte«, grinste Piet, »jetzt haben wir die Dreckskerle da, wo wir sie haben wollen.«
»Bist du dir da sicher?« Robert warf seinem Freund ein Lächeln zu und schaltete noch einmal einen Gang hoch, um Anschluss an den Mercedes zu halten, der bereits die Spree überquerte. Mit aufjaulendem Motor verscheuchte er die Bauarbeiter, die den morschen Straßenbelag auf der Oberbaumbrücke erneuerten und die historischen Brückentürme renovierten.
Piet grinste zufrieden: Auf der anderen Seite der Brücke, noch vor der Mühlenstraße, hatten die Kollegen aus dem Ostteil der Stadt eine Sperre errichtet. Mit ihren Pistolen im Anschlag waren die Beamten hinter ihren Ladas in Stellung gegangen und erwarteten die Flüchtigen, die in ihrem inzwischen recht verbeulten Luxuswagen auf sie zurasten.
»Was, zum Henker?« Ungläubig beobachtete Piet das Geschehen. Der Fahrer des Mercedes schien nicht im Traum ans Aufgeben zu denken. Er beschleunigte. Die schwarze Limousine brüllte wie ein gequältes Raubtier auf und machte einen Satz. Schüsse fielen. Krachend durchbrach der Wagen die Sperre. Wie Spielzeugautos schleuderte er die beiden Ladas zur Seite.
Piet fluchte. Robert schwieg und konzentrierte sich aufs Fahren. Wieder musste er Trümmern ausweichen, um dem Mercedes folgen zu können, der jetzt über die Warschauer Straße und die S-Bahn-Brücke Richtung Friedrichshain fuhr.
Doch die vielen Karambolagen waren schließlich zu viel für den massiven Wagen. Rauch stieg aus der zerbeulten Motorhaube, der Mercedes knatterte wie eine alte Lokomotive über das brüchige Kopfsteinpflaster und verschwand dann links in der Gubener Straße.
»Jetzt haben wir sie.« Mit grimmigem Lächeln lud Piet seine Walther nach. Robert nickte und fuhr an der Spitze einer Kolonne von Streifenwagen in die Gubener, die wie alle Straßen in Friedrichshain auch zwei Jahre nach der Wende noch immer genauso verfallen und heruntergekommen aussah wie am Tag des Mauerfalls. Überall grauer Altbau mit brüchigen Fassaden, dazwischen über hundert Jahre altes Kopfsteinpflaster mit Löchern so groß, dass kleine Kinder sich darin verstecken konnten.
Der Mercedes hatte inzwischen stöhnend und röchelnd seinen Geist aufgegeben. Die beiden Insassen, ein großer Mann mit schütterem Haar und tief liegenden Augen und sein bulliger Begleiter, sprangen mit gezückten Waffen heraus und schossen sofort auf die näher kommenden Streifenwagen. Hektisch schauten sie sich um, dann deutete der Lange in eine Toreinfahrt. Der Bullige nickte und rannte los. Eine ältere Dame, die sich mit ihrer Gehhilfe über den Bürgersteig schleppte und den Riesen und seine Pistole verwirrt anstarrte, stieß er einfach zur Seite.
Robert sprang aus dem Wagen, während der Bullige in der Toreinfahrt verschwand und der Lange auf der anderen Seite in einen dunklen Hauseingang lief. »Humboldt & Söhne« stand in verblichenen Buchstaben aus der Vorkriegszeit darüber. Zwei Kollegen rannten an Roberts und Piets Seite. Robert deutete zur Toreinfahrt.
»Schnappt euch den Dicken! Wir holen uns Löwe!«
Die Beamten nickten, dann liefen Robert und Piet dem größeren Mann hinterher. Mit ihren Pistolen im Anschlag sprinteten sie in den Hauseingang, von dem rechts ein Treppenhaus in die oberen Stockwerke führte. Am Ende des Eingangs konnten sie das Licht des Hinterhofs sehen. Robert hielt den Finger an den Mund. Piet nickte und verharrte still.
Nur ein Fernseher lief leise, ansonsten war kein Geräusch zu hören. Eine Talkshow. Eine Mutter, die ihre Kinder bat, sie endlich in Ruhe zu lassen. Dazu prasselte der Regen.
Plötzlich fielen Schüsse, und Polizisten riefen aufgeregt durcheinander.
Die Kollegen schienen Löwes Begleiter gefunden zu haben.
Robert trat ungeduldig von einem Bein auf das andere, wies dann mit der Pistole zum Hinterhof und nickte Piet auffordernd zu, der aber den Kopf schüttelte.
»Nix da. Wir bleiben zusammen. Du weißt, wie gefährlich der Scheißkerl ist«, zischte er leise.
»Und deswegen darf er uns auf keinen Fall entwischen. Also los, mach schon!«
Piet zögerte einen kurzen Moment, dann lief er mit einem Aufstöhnen in Richtung Hinterhof. Robert schlich sich leise in das Treppenhaus. Nichts war zu hören – und nichts zu sehen. Die Kabel für den Lichtschalter hingen durchtrennt aus der Wand. Um in der Finsternis wenigstens etwas erkennen zu können, hatte jemand einige Windlichter auf den Boden gestellt.
Plötzlich schnelle Schritte. Zwei Stockwerke über ihm.
»Piet!«, rief Robert leise, aber sein Partner hörte ihn nicht. Robert entschloss sich, den Flüchtenden auf eigene Faust zu verfolgen. Mit der Waffe im Anschlag hastete er in das dunkle Treppenhaus.
»Du hast keine Chance, Löwe! Hier kommst du nicht mehr raus!«
Nur wenige Zentimeter neben Robert krachten Kugeln in das abgeschabte Geländer. Robert warf sich so heftig nach hinten gegen die Wand, dass loser Putz ihm in den Nacken rieselte.
Robert schüttelte sich, bevor er weiter nach oben lief.
»Was ist …?«, fragte eine überraschte Stimme, dann dröhnte plötzlich ein Schuss durch das Treppenhaus. Doch dieses Mal war nicht Robert das Ziel. Böses ahnend beschleunigte er seine Schritte.
Und tatsächlich: Im dritten Stock lag ein älterer Mann in speckigem Unterhemd und bekleckerter Jogginghose vor seiner offenen Wohnungstür. Stöhnend hielt er sich den Bauch, zwischen seinen krampfenden Fingern lief Blut auf die Holzdielen. Im Hintergrund flimmerte noch der Fernseher. Robert fluchte lautlos. Warum nur hatte sich der Mann von seiner Talkshow ablenken lassen?
»Hast du ihn erwischt?«
Piet kam die Treppe herauf, seine Walther im Anschlag. Sein Kollege schüttelte den Kopf und deutete auf den alten Mann, dessen Augen die Beamten mit fassungslosem Entsetzen anstarrten.
»Kümmerst du dich um ihn?«
»Willst du etwa allein …?«
Robert ließ Piet nicht ausreden.
»Hol dir eine Decke oder irgendein Kissen«, er gestikulierte in Richtung Wohnung, »und drück es ihm auf die Wunde. Ich bin gleich wieder da.«
Bevor Piet etwas erwidern konnte, lief Robert schon weiter nach oben, sprang von Treppenabsatz zu Treppenabsatz. Am Ende angelangt stand die Tür zur Dachkammer offen. Robert holte tief Luft und schlich sich hinein.
Ein großer Raum, in dem ein paar alte Koffer und ein verbogenes Fahrrad der Marke Diamant standen. Und überall Kisten. In einer stapelten sich vergilbte Exemplare des Neuen Deutschland. Welcher Idiot kam nach der Wende noch auf die Idee, den Mist aufzubewahren? Robert runzelte verständnislos die Stirn.
Von Löwe war nichts zu sehen. Der Regen trommelte mit ohrenbetäubendem Lärm auf das Dach. Durch ein kleines Loch konnte Robert den grauen Himmel erkennen. Jemand hatte einen Eimer darunter gestellt, doch das Wasser war längst über den Rand gelaufen und hatte auf dem staubigen Holzboden eine Pfütze gebildet.
Am Ende der Kammer war eine Tür nur angelehnt, sie führte auf das Dach. Ein Blick auf das Schloss genügte, um zu erkennen, dass jemand sie mit einem Tritt aufgebrochen hatte. Löwe! Robert öffnete die Tür mit vorgestreckter Pistole. Sein Hemd klebte am Körper, seine Hand zitterte. Robert musste an Löwes Opfer denken. Wie viele waren es? Zehn? Zwanzig? Er schloss die Augen, zählte in Gedanken von fünf zurück auf null, dann schob er sich durch die offene Tür hinaus auf das Dach.
Sofort wurde er von einer starken Böe erfasst. Der Regen klatschte ihm so heftig ins Gesicht, dass er für einen Moment blind war. Leise fluchend kniff er die Augen zusammen und betrachtete seine Umgebung. Das Unwetter lag wie ein schmutziges Tuch über der gesamten Stadt. Im Sommer konnte Berlin wunderschön sein, aber an diesem verregneten Wintertag war es die hässlichste Stadt der Welt.
Im Westen waren gerade noch Kreuzberg und Neukölln zu erkennen, Schöneberg und Tiergarten waren im verregneten Dunst schon nicht mehr zu sehen. Im Norden verschwand die obere Hälfte des Fernsehturms am Alex im düsteren Himmel. Die dunklen Wolken hingen so tief über der Stadt, dass Robert das Gefühl hatte, sich nur ein bisschen strecken zu müssen, um sie zu berühren.
Keine Spur von Löwe. Robert schaute sich vorsichtig auf dem von einer halbhohen Brüstung umgebenen Dach um, von dem man direkt auf die Nachbarhäuser steigen konnte. Es gab mehrere mannshohe Absätze und sogar eine kleine Laube, die sich jemand hier oben eingerichtet hatte. Wie Karlsson auf dem Dach, dachte Robert und musste unwillkürlich lächeln. Überall Pfützen. Die Dachpappe hatte sich an einigen Stellen gelöst und flog mit klatschenden Geräuschen im Wind hin und her. Der Rauch aus den Schornsteinen war sichtbares Zeichen dafür, dass hier – wie in den meisten Ostberliner Altbauten – noch mit Kohle geheizt wurde.
Robert wollte sich gerade die Laube näher anschauen, als Sirenen erklangen. Er warf einen kurzen Blick in die Straßenschlucht und sah Rettungssanitäter in die gegenüberliegende Toreinfahrt laufen. Waren seine Kollegen erfolgreich gewesen?
»Schöner Ausblick, was?«
Robert wirbelte herum.
»Weg mit der Knarre, sofort!«
Er erstarrte. Von der anderen Seite des Dachs aus zielte Löwe mit seiner Beretta auf ihn. Die Haare klebten an seinem kantigen Schädel, seine durchnässten Sachen hingen im Regen wie alte Lappen an seinem schlaksigen Körper herunter, und trotzdem lag ein Lächeln auf seinem Gesicht. Schwer atmend hob Robert die Hände, hielt seine Walther aber immer noch fest umklammert. Er ärgerte sich über sich selbst. Wie hatte er sich nur so ablenken lassen können? Jeder Polizeischüler hätte es besser gemacht.
»Wird’s bald, Lindner! Weg mit der Knarre!«, schrie Löwe erneut gegen das Unwetter an.
»Wieso schießt du mich nicht einfach über den Haufen? Bei dem armen Teufel da unten hattest du ja auch keine Skrupel.«
»Er war im Weg. Was sollte ich machen?«
»Du hast keine Chance. Schau runter. Dieses Mal entkommst du uns nicht.«
»Wie wär’s, wenn du mich begleitest? Dann würde ich mich gleich viel sicherer fühlen.«
Robert lächelte spöttisch. »Vergiss es, die Kollegen würden dich nie mit mir als Geisel gehen lassen!«
»So? Du meinst also, deine Freunde würden ohne weiteres einen braven Familienvater opfern? Um einen kleinen Gauner wie mich zu schnappen?«
Robert bemühte sich, keine Miene zu verziehen.
Löwe betrachtete ihn voller Verachtung. »Zum allerletzten Mal: Weg mit der Knarre! Du kommst jetzt mit. Und solltest du Probleme machen, finde ich im Haus bestimmt noch eine andere Geisel.«
Robert atmete tief durch, bevor er langsam in die Knie ging, um die Pistole abzulegen.
»Okay.«
»Brav …«
Die Schüsse fielen fast gleichzeitig, gingen im Unwetter jedoch fast unter. Kurz bevor Roberts Waffe den Boden hätte berühren sollen, hatte er sie hochgerissen, geschossen und sich gleichzeitig zur Seite geworfen. Doch Löwe war aufmerksam geblieben und hatte ebenfalls abgedrückt.
Für einen Moment sahen sich die beiden Männer schweigend in die Augen. Löwe stand am einen Ende des Daches, Robert kniete auf der anderen Seite. Fast schien es, als würde selbst der Regen den Atem anhalten. Wieder grinste Löwe, dann stutzte er. Verständnislos fasste er sich an die Brust, wo ein kleiner roter Fleck rasch immer größer wurde. Er musterte sein entsetztes Gegenüber, schüttelte verwundert den Kopf – und fiel stumm nach hinten über die Brüstung.
Erschöpft schloss Robert die Augen. Es war vorbei. Endlich. Die lange Jagd nach Löwe hatte ein Ende.
Aber etwas stimmte nicht. Wie in Zeitlupe nahm Robert Piet wahr, der auf das Dach gelaufen kam, ihn entsetzt anschaute und ihm etwas zurief. Robert lächelte, obwohl er nichts hören konnte. Es herrschte absolute Stille. Ungläubig schaute Robert an sich hinab. Sein Hemd war blutgetränkt, aber er spürte keinen Schmerz. Da war Frieden, grenzenloser Frieden. Dann wurde alles um ihn herum schwarz.
Er lächelte, als er nach vorn auf das Dach sackte und mit dem Gesicht in einer Pfütze landete. Noch immer fiel der Regen auf das Dach, auf Roberts Rücken und in die Pfütze, die sich langsam rot färbte.
3
Auch wenn er es nicht wahrhaben wollte: Aus dem Fenster schaute er hinaus ins Paradies.
Sonnenstrahlen durchbrachen die Wolken und tasteten sich über das sich im Wind wiegende Korn. Fruchtbare Erde. Goldene Felder, fast endlos. Und Störche. Überall Störche, die ohne jede Scheu durch ihre Welt schritten. Dazwischen schattige Wälder. Birken, Eichen und immer wieder Erlen glitten lautlos an ihm vorbei.
So viel Wasser. Grünes, blaues und schwarzes Wasser, das im warmen Sommerlicht übermütig glitzerte. Ein schmaler Fluss, der die Felder in sanften Schwüngen zerteilte, um dann im Dunkel eines Dickichts zu verschwinden. Da war ein Karpfen, der über den schlammigen Grund eines Baches huschte und sich hinter einem Stein versteckte. Funkelnde Libellen schwärmten über die Wasserfläche, bevor sie sich im dichten Schilf an den üppig bewachsenen Ufern niederließen. Dann ein Feld. Hochwasser hatte es überspült, den Boden in eine glatte Fläche verwandelt, aus der nur noch vereinzelt Pflänzchen sprossen.
Er musste die Augen zusammenkneifen, so sehr blendete ihn die Sonne, die sich im Wasser spiegelte. Dann verzog sich sein Gesicht zu einem verächtlichen Lächeln. Tatsächlich, es war ein Paradies. Ein lautloses Paradies. Er konnte weder das Rauschen der Wälder noch das Singen der Vögel hören, auch die Wärme des Spätsommers war nicht zu spüren. Stattdessen schmeichelten sanfte Mollakkorde seinen Sinnen, versuchten ihn für das Paradies zu gewinnen.
»Mama, Emma hat schon wieder Scheiße in der Hose.«
Robert schreckte aus seinen Gedanken auf. Verlegen blinzelte er und streckte seinen Rücken durch, der von der langen Fahrt schmerzte. Im Autoradio lief Whitney Houston, und Marie, seine Frau, drehte sich auf dem Beifahrersitz mit vorwurfsvoller Miene nach hinten zu ihrem zehnjährigen Sohn um.
»Lars! Wie redest du denn?«
Der Junge hielt sich seine Nase zu und deutete mit dem Finger auf seine kleine Schwester neben sich im Babysitz. Mit großen Augen starrte Emma ihn an.
»Jetzt riech doch mal. Das stinkt wie Hölle. Ich glaub, ich muss gleich kotzen.«
»Lars, noch so ein Wort, und …«
Erschrocken über das verärgerte Gesicht ihrer Mutter verzog Emma das Gesicht und fing an zu wimmern. Lars verschränkte trotzig seine Arme vor der Brust und schwieg. Marie sah ihn vorwurfsvoll an, bevor sie einen leicht verzweifelten Blick auf ihre Tochter warf. Mit einem hilflosen Seufzer wandte sie sich an Robert.
»Ich versteh das einfach nicht. Wir müssten doch schon längst da sein?«
Robert zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Keine Ahnung, ich war ja noch nie hier. Ich dachte, du kennst den Weg?«
Marie warf ihrem Mann einen finsteren Blick zu. Der verzog keine Miene und drückte einen Knopf auf der Mittelkonsole. Die Musik verstummte.
»Tut mir leid, aber ich kann dieses Gedudel nicht mehr ertragen.«
Einige Minuten lang fuhren sie schweigend durch die Landschaft. Die Straßen waren schmal, gerade breit genug für ein Auto. Bei Gegenverkehr musste einer der Fahrer in eine der Buchten ausweichen, die im Abstand von einigen Kilometern angelegt waren. Aber ihnen kam niemand entgegen. Kein Mensch weit und breit. Roberts Blick streifte die Anzeige auf dem Armaturenbrett. Er schüttelte den Kopf.
»Vielleicht hätten wir auf der Autobahn doch besser noch mal tanken sollen.«
»Wir sind doch gleich da«, erwiderte Marie.
Endlich begegneten sie einem Beweis dafür, dass sie doch nicht die einzigen Menschen auf der Welt waren. Ein Trecker versperrte ihnen auf der schmalen Straße den Weg. Vom Fahrer keine Spur.
»Verdammt!«, fluchte Robert. »Das hat uns gerade noch gefehlt.«
»Jetzt entspannt dich mal. Uns hetzt doch keiner.«
»Und wie lange sollen wir noch durch diese verlassene Gegend fahren? Ich will endlich ankommen.«
»Ach, auf einmal?« Marie seufzte.
Robert betrachtete seine Frau, die aus dem Fenster blickte und die Felder nach dem Fahrer des Treckers absuchte. Sie tat ihm leid. Ihm war klar, dass er sie mit seiner abweisenden Haltung verletzte, aber, verdammt, Marie wusste doch genau, wie wenig Lust er auf diese Einöde hatte. Genau genommen auf den ganzen Umzug. Natürlich, er hatte ihrem penetranten Drängen schließlich nachgegeben, hatte eingewilligt, und vielleicht gab es ja tatsächlich keine Alternative. Aber musste er deshalb ständig gute Laune heucheln? Nein, ganz bestimmt nicht. Das grinsende Teufelchen, das unsichtbar auf seiner Schulter hockte, forderte ihn auf, seinen gerechten Trotz noch lange nicht aufzugeben.
Mit beiden Händen drückte Robert auf die Hupe. Emma hörte auf zu wimmern, Lars und Marie zuckten zusammen.
»Musste das jetzt sein?«
Robert nickte mit grimmigem Grinsen und hupte unbeeindruckt weiter. Nach wenigen Augenblicken erschien ein älterer Mann. Seine Wangen schimmerten rot von geplatzten Äderchen, und sein kariertes Hemd trug er über seinem stattlichen Bauch bis zum Bauchnabel geöffnet. Provozierend langsam schleppte er sich zu seinem Trecker.
Robert öffnete das Fenster und bedeutete dem Bauern, sich zu beeilen. »Geht’s vielleicht auch ein bisschen schneller? Wir haben nicht ewig Zeit!«
Mit unbeweglicher Miene schaute der Mann kurz auf das Berliner Kennzeichen des Chrysler Voyager und zog sich träge auf seinen Fahrersitz. Dann endlich setzte sich der Trecker in Bewegung, fuhr ein kleines Stück weiter und blieb an der Einfahrt zu einem Feldweg stehen. Der Bauer ließ gerade einmal so viel Platz, dass sich Robert nur mit viel Augenmaß an seinem Gefährt entlangschleichen konnte.
Als sich die stummen Blicke der Fahrer trafen, zeigte der Bauer keine Regung. Mit kalten, blauen Augen starrte er Robert ins Gesicht, der sich aus dem Fenster beugte.
»Nach Glubitz? Wo müssen wir da lang?«
Ohne eine Miene zu verziehen hob der Bauer seine Hand und deutete in ihre Fahrtrichtung. Robert dankte mit einem spöttischen Kopfnicken.
»Idiot«, stieß Robert so leise aus, dass nur Marie seinen Fluch hören konnte, und gab Gas.
Seine Frau schüttelte vorwurfsvoll den Kopf. »Hast du einen neuen Freund gefunden?«
»Quatsch. Sag mir lieber, wie lange wir noch brauchen.«
Hilflos studierte Marie den Shell-Autoatlas, der aufgeschlagen auf ihrem Schoß lag. »Vielleicht hätten wir uns eine richtige Karte kaufen sollen? Ich habe nicht das Gefühl, dass hier alle Straßen eingezeichnet sind.«
Robert verdrehte die Augen. »Vielleicht gibt es von dieser gottverlassenen Gegend ja gar keine richtige Karte.«
Zu seiner Genugtuung musterte Marie ihn wieder mit einem vorwurfsvollen Kopfschütteln. Auf dem Rücksitz steigerte sich Emmas Wimmern zu einem lauten Schluchzen.
Am Straßenrand erblickte Robert ein kleines Schild.
»Schmogrow, 4 Kilometer«. Darunter der sorbisch-wendische Name: Smogorjow. Marie stöhnte auf.
»Das kann nicht sein. Wir sind ja völlig falsch!«
»Aber der Kerl …?«
»Der Kerl hat eigentlich gar nichts gesagt. Hast du das nicht gemerkt?«
»Tja, Ossi und Bauer, was soll man da auch anderes erwarten?« Robert lächelte zufrieden. Wieder mal stimmten seine Vorurteile über die Landbevölkerung. Marie betrachtete verärgert ihren Mann. Als Emmas Geheul stärker wurde, sagte sie: »Schau, ob du hier irgendwo halten kannst. Ich muss sie wickeln.«
Unter den Rädern des Chrysler knirschte es, als Robert in den nächsten Feldweg einbog. Marie stieg aus und kramte die Wickeltasche aus dem bis unters Dach voll beladenen Van hervor. Dann öffnete sie die hintere Tür des Wagens. Emma strampelte vor Freude. »Hallo, mein Engel«, sagte Marie lächelnd.
Lars öffnete seinen Gurt. »Darf ich raus?«
Marie nickte. »Aber lauf nicht weg, wir fahren gleich weiter.«
Lars sprang aus dem Wagen und atmete tief durch. Kein Windelgestank mehr. Neugierig betrachtete er den Bach, der direkt neben der Straße floss. Ein paar Stichlinge huschten durch das Wasser. Schnell sammelte Lars ein paar Steinchen von der Straße auf und versuchte, einen der kleinen Fische damit zu erwischen.
Auch Robert kletterte aus dem Wagen und streckte sich in der spätsommerlichen Mittagssonne. Die Hitze außerhalb des klimatisierten Wagens drückte ihn zu Boden. Er bewegte den Kopf hin und her, um die Verspannungen in seinem Nacken zu lösen, und stöhnte leise auf. Das lange Sitzen tat weder seinem Rücken noch seinem Bauch gut. Als er sich wieder aufrichtete, hatte er das Gefühl, jemand würde ihm mit einem Ruck ein übergroßes Pflaster von einer behaarten Körperstelle reißen. Der stechende Schmerz nahm ihm für einen kurzen Augenblick den Atem.
Marie bemerkte sein verzerrtes Gesicht. »Alles in Ordnung?«
Robert nickte. »Ich bin gleich wieder da«, verkündete er und verschwand im Feldweg.
Marie blickte ihm nachdenklich hinterher und kümmerte sich wieder um die glücklich strampelnde Emma.
Robert ging ein paar Meter, bis er hinter einer kleinen Biegung eine ruhige, nicht einzusehende Stelle fand, dann holte er eine Dose mit kleinen gelben Tabletten aus seiner Hosentasche. Er betrachtete sie einen Moment lang. Diese Scheißdinger. Ihm war klar, dass es falsch war, sie so häufig zu nehmen. Nur zwei Stück am Tag, hatte der glatzköpfige Doktor in der Charité gesagt. Der Blödmann. Wie sollte er denn seiner Meinung nach ein halbwegs normales Leben führen, wenn er schon nach vier Stunden ohne diese kleinen Pillen vor Schmerzen an die Decke ging? Egal, was passiert war, er hatte immer noch eine Familie, um die er sich kümmern musste.
Seufzend schraubte er die Dose auf, schüttete sich zwei Tabletten auf die Hand, schluckte sie hinunter und hustete. Er hätte an etwas zu trinken denken sollen. Ohne war das Zeug kaum runterzukriegen.
Er suchte sich einen Baum und öffnete den Reißverschluss seiner Hose. Während er pinkelte, ließ er den Blick über die Felder schweifen. Absolute Stille. Nur das Zirpen der Grillen und das Zwitschern einiger Spatzen. In der Ferne muhte eine Kuh, in der Nähe düngte ein Bauer seine Felder. Vielleicht ja sogar der Depp, den sie gerade getroffen hatten? Der Gestank war jedenfalls fürchterlich. Landluft! Angewidert verzog Robert die Nase und versuchte dabei mit einer Hand den Mückenschwarm zu vertreiben, der sich gerade auf ihn stürzen wollte.
Robert lächelte bitter. Genau das hatte er immer zu Marie gesagt. Von wegen Paradies! Das hier war der Arsch der Welt …
Ein lautes Rascheln. Direkt hinter ihm. Hastig zog Robert den Reißverschluss seiner Hose hoch und drehte sich um.
»Hallo?«
Nichts zu sehen. Aber Robert war sich sicher, dass er etwas gehört hatte. Obwohl ein Rascheln in freier Natur nichts Besonderes bedeuten musste, schaute er sich nervös um. Ein Tier? Dem Geräusch nach zu urteilen musste es sich um ein großes Tier handeln. Aber da war nichts.
»Marie? Lars?«
Keine Antwort. Er schaute sich verwirrt um. Die Luft über dem Weg flimmerte. Der Pfad führte unter den Bäumen auf das Feld, immer entlang an einem in der Sonne funkelnden Bach. Es war nicht mehr einfach nur leise, die Stille um ihn herum war binnen Sekunden absolut geworden. Keine Grillen und keine Spatzen mehr. Und auch keine Kühe.
Auch der Geruch nach Feldern, Dung und frisch geschnittenem Gras war mit einem Mal verschwunden. Stattdessen roch es nach Wasser, nach altem, abgestandenem Wasser und faulem Schlamm. Der Sinneseindruck war so intensiv, dass er Robert fast den Atem nahm. Er stöhnte auf. Wo, zum Teufel, kam auf einmal dieser Gestank her?
Sein Blick fiel auf einen toten Vogel, der halb verwest vor ihm auf dem Boden lag. Maden krochen über seinen kleinen Körper. Angeekelt verzog Robert das Gesicht, schaute sich wieder um. Seltsam. Er hatte den Eindruck, als würde ihn jemand beobachten. Ein Tier? Nein. Es war noch jemand hier …
Das Atmen begann ihm schwerzufallen, als würde eine große Last auf seinen Lungen liegen. Robert schluckte nervös. Ein Herzanfall? Seine Nackenhaare stellten sich langsam auf, und eine unbestimmte Kälte kroch über seinen Rücken – während sein Bauch von der drückenden Hitze noch immer feucht war. Seine Kiefer begannen zu mahlen, wie immer, wenn er unter großer Anspannung stand.
Hinter ihm war jemand!
Mit einem Ruck drehte er sich um. »He!«
Nichts. Er stand allein auf dem Feldweg, die Natur wirkte wie erstarrt, und das unheimliche Gefühl, beobachtet zu werden, war immer noch da. Genau wie der unerträgliche Gestank nach abgestandenem Wasser.
»Robert! Wo bleibst du denn? Wir wollen weiter!«
Maries Rufe aus der Ferne holten ihn zurück in die reale Welt. Er hörte wieder den Wind, die Vögel und sogar eine Kuh. Die Geräusche kamen mit einer Wucht zurück, dass er erschrocken zusammenzuckte. Was war nur los mit ihm? Auch von dem fauligen Wassergestank war jetzt nichts mehr zu bemerken. Lag es vielleicht an dem plötzlichen Temperaturwechsel? Daran, dass er aus dem klimatisierten Wagen gestiegen und in die heiße Mittagssonne getreten war? Hatte er sich alles nur eingebildet?
»Robert!«, rief Marie jetzt ungeduldiger, und er meinte, aufrichtige Sorge in ihrer Stimme zu hören.
Erschöpft machte er sich auf den Weg zum Wagen, als er erneut ein Rascheln hinter seinem Rücken hörte. Wieder schnellte er herum – und sah diesmal eine kleine Feldmaus. Mit einem kleinen Stock im Mäulchen starrte sie ihn kurz an, bevor sie leise unter einem Blätterhaufen verschwand.
Robert grinste. Verdammt, was war er nur für ein Waschlappen. Von wegen Großstadtcop. Jetzt ließ er sich schon von einer Maus ins Bockshorn jagen. Er zog sein Hemd zurecht und ging zu seiner Familie zurück.
Marie saß schon im Auto, jetzt hinter dem Steuer. Auch Lars legte sich wieder seinen Gurt um, während die frisch gewickelte Emma ihren Vater mit großen Augen anstrahlte. Robert klopfte an die Scheibe und winkte seiner Tochter zu. Emma quietschte vor Glück.
»Geht’s dir gut?«, fragte Marie, als er in den Wagen stieg.
Robert zuckte mit den Schultern. »Ich hätte auf der Raststätte nicht so viel von dieser Ost-Cola trinken sollen.«
Marie startete den Wagen.
»Du fährst?«
Sie legte entschlossen den ersten Gang ein und nickte. »Du hast doch gesagt, du willst endlich ankommen.«
»Weißt du denn jetzt, wo lang wir müssen?«
Marie nickte. »Ich hab mir die Karte noch mal angeguckt.«
Robert lächelte gequält. »Na, dann los!«
Marie war eine noch forschere Fahrerin als Robert. Der Van rutschte etwas in dem feinen Sand des Feldwegs, als sie mit einem Ruck losfuhr. Robert blickte auf den Rücksitz. Emma fielen die Augen zu, und Lars schaute auch schon müde aus dem Fenster. Langsam lehnte er sich in seinem Sitz zurück und versuchte, das schmerzhafte Pochen in seinem Rücken zu ignorieren.
»Tut’s wieder weh?«, erkundigte sich Marie besorgt.
»Geht schon«, log er, wandte sich von seiner Frau ab und schaute in die menschenleere Landschaft.
Schwalben flogen auf der Jagd nach Mücken über die Felder. Wie war das noch mit tief fliegenden Schwalben? Bedeutete das nicht, dass es bald regnen würde? Am Horizont zogen tatsächlich dunkle Wolken auf.
Robert wandte sich wieder Marie zu und beobachtete schläfrig, wie sie mit konzentriertem Blick nach dem richtigen Weg suchte. Auch wenn er sich heute vorgenommen hatte, den Trotzkopf zu spielen, musste er doch zugeben, dass Marie eine sehr attraktive Frau war. Trotz der Geburt der beiden Kinder hatte sie ihre sportliche Figur behalten. Früher, als sie noch regelmäßig ins Büro gegangen war, hatte sie am liebsten Blusen und knielange Röcke getragen. Es gab keinen Kollegen, der sich nicht nach ihr umgedreht hätte. Robert liebte sie am meisten, wenn sie nur Jeans und T-Shirt trug. Marie war eine natürliche Schönheit. Noch immer bekam Robert jedes Mal eine wohlige Gänsehaut, wenn er sah, wie sie bei dem Versuch scheiterte, ihre wilden, blonden Haare hochzustecken, und einzelne Strähnen sich widerspenstig über ihren Ohren kräuselten. Oder wenn ihr Haar im Wind ihr klares, norddeutsches Gesicht umspielte.
Seine Lider wurden immer schwerer. Er war kurz davor wegzudämmern, als Marie ihm auf das Knie klopfte. »He, du Schlafmütze, schau mal!«
Tatsächlich, auf einem rostigen, etwas abgeknickten Schild, neben einer kleinen Straße, die schon nach wenigen Metern in einem schattigen Hohlweg verschwand, stand: »Glubitz, 5 Kilometer«. Marie stieß ihn stolz in die Seite: »Siehst du, was hab ich gesagt? Gleich sind wir da.«
»Ich kann’s kaum erwarten«, erwiderte Robert trocken.
Marie zog grinsend eine Augenbraue hoch und bog in einen Weg ein. Schon nach wenigen Augenblicken wurde der Chrysler von der Dunkelheit wie von einem großen Schlund verschluckt.
4
Die Wochen nach dem Zwischenfall in Friedrichshain waren für Marie die Hölle gewesen. Die Kugel hatte Robert in den Bauch getroffen und war in der Wirbelsäule stecken geblieben. Er hatte so viel Blut verloren, dass er noch im Rettungswagen wiederbelebt werden musste. Doch auch danach blieb sein Zustand kritisch. Viele winterlich trübe Tage und dunkle Nächte lang hatte er mit dem Tod gekämpft, weil seine inneren Wunden immer wieder aufgebrochen waren.
Am schlimmsten war die Verletzung an der Wirbelsäule gewesen. Eine Zeit lang bestand sogar die Gefahr, dass Robert ab der Hüfte abwärts querschnittsgelähmt bleiben würde. Dann endlich gelang es den Ärzten, die Kugel zu entfernen. Dennoch brauchte Robert Wochen, bis er sich wieder einigermaßen normal bewegen konnte. In einem Punkt machten ihm die Ärzte allerdings wenig Hoffnung: Er würde sein ganzes Leben unter Rückenschmerzen leiden.
Marie hatte währenddessen an Roberts Bett ausgeharrt und seine Hand gehalten, sein verzweifeltes Stöhnen ertragen und ihm immer wieder Mut gemacht, wenn er sie mit ängstlichem Blick angestarrt hatte. Ihre größte Leistung war sicherlich gewesen, dass sie ihm ihre Angst nicht gezeigt hatte. Nur zu Hause hatte sie ihren Tränen freien Lauf gelassen – nachdem sie Emma und Lars ins Bett gebracht hatte.
Marie war Kummer und Sorgen gewöhnt. Schon immer hatte sie Angst um Robert gehabt. Oft hatte sie sich darüber beklagt, dass er in seinem Job sein Leben riskierte. Natürlich hatte Marie gewusst, was sie erwartete, als sie einen Polizisten, einen Großstadtpolizisten, geheiratet hatte, aber wieso musste er ständig übertreiben? Wieso musste er sich als Familienvater todesmutig in jede noch so kritische Situation stürzen? Jeder seiner Kollegen hätte verstanden, wenn er sich etwas zurückgenommen hätte, aber nein, Robert musste immer mit dem Kopf durch die Wand und seinen eigenen Kampf gegen das Böse führen. Natürlich konnte Marie nicht umhin, ihren Mann dafür zu bewundern, aber warum dachte er bei seinem Einsatz auf den gefährlichen Straßen Berlins – die nach der Wende noch viel gefährlicher geworden waren – nie an die eventuellen Konsequenzen für seine Familie?
Nach der Schießerei in Friedrichshain hatte Marie endgültig genug gehabt. Sie wollte sich nicht mehr tagtäglich um ihren Mann ängstigen. Sich Sorgen machen, auf einmal allein mit ihren beiden kleinen Kindern dazustehen, nur weil Robert sich aus sportlichem Ehrgeiz mit jedem Psycho der Stadt anlegen musste.
Robert lag seit zwei Monaten im Krankenhaus, als überraschend ein Schreiben im Briefkasten lag, das Marie zur Alleinerbin eines Hotels im Spreewald machte.
Ein Geschenk des Himmels. Marie war nie besonders gläubig gewesen, aber dieser Brief war für sie der nicht zu widerlegende Beweis, dass es da oben irgendjemand sehr gut mit ihr meinte. Für sie stand fest: Das Schicksal wollte, dass Robert nicht in den Polizeidienst zurückkehrte. Er würde gemeinsam mit ihr ein neues Leben anfangen.
Marie hatte ihre Tante Hedwig nie persönlich kennengelernt. Maries Mutter hatte sich schon vor vielen Jahren mit ihrer Schwester zerstritten und jeden Kontakt zu ihr abgebrochen. Wenn Marie ehrlich war, hatte sie schon lang vergessen, dass sie eine Tante in der DDR hatte.
Gut, es war kein besonders großes Hotel, aber nur deshalb war es zu DDR-Zeiten in Privatbesitz geblieben. Außerdem lag es mitten im Spreewald, in einer Region, die für Marie bis zu diesem Tag nur ein unbedeutender Name auf irgendeiner Landkarte gewesen war. Weder Robert noch sie waren schon einmal dort gewesen, doch als Marie sich bei ihren Freunden umhörte, erfuhr sie, dass die Gegend sehr schön sein sollte. Noch während Robert im Krankenhaus lag, war sie allein nach Glubitz gefahren. Zusammen mit einem Anwalt hatte sie sich das Haus genau angeschaut und war begeistert nach Berlin zurückgekehrt.
Kurz darauf folgte ein offizieller Termin: Der Familienrat tagte in der Station 7 der Charité. Marie wollte die Stadt verlassen und mit ihrer Familie nach Glubitz ziehen. Zuerst war Robert natürlich dagegen gewesen. In die Zone ziehen? Niemals! Aber ihm hatten die Kräfte gefehlt, um erfolgreich gegen Maries Plan zu protestieren – und am Ende auch die Argumente.
Marie hatte sich auf das Gespräch mit Robert vorbereitet und Fotos vom Spreewald und dem Hotel auf der Bettdecke ausgebreitet. Natürlich war alles ein großes Abenteuer, das war auch ihr klar. Ein Neuanfang in einem kleinen Dorf, weit weg von der Zivilisation im Nirgendwo. Aber dafür gab es dort keine Mörder, keine Bombenleger, keine Drogendealer und keine Russenmafia. Sie würde keine Angst mehr um Robert haben müssen, wenn das Telefon klingelte. Endlich könnten sie ein geregeltes Familienleben führen. Die Erbschaft ermöglichte ihnen eine spannende Perspektive im neuen, geeinten Deutschland.
Und zu guter Letzt erinnerte Marie Robert daran, dass sie den Kindern zuliebe ihre Karriere als Diplomkauffrau in einer westdeutschen Unternehmensberatung aufgegeben hatte. Die letzten Jahre hatte sie sich ausschließlich um die Erziehung ihrer Kinder gekümmert, dabei hätte sie in ihrem alten Job mehr Geld verdienen können als Robert bei der Polizei. Konnte sie da nicht von ihm verlangen, dass er sich jetzt ein einziges Mal nach ihr richtete?
Und Lars? Marie versuchte ihn mit einem Hochglanzfoto ihres neuen Hauses und der Aussicht auf spannende Kanuabenteuer im Spreewald zu bestechen. Aber die Bemühung war gar nicht nötig. Lars war auf seiner Schule in Wilmersdorf nicht gerade glücklich und wäre am liebsten sofort umgezogen. Am Ende hing alles nur noch an Robert. Was war ihm also übriggeblieben, als nachzugeben?
Als Marie nun die letzten Kilometer über die einsame Landstraße nach Glubitz fuhr, blickte sie immer wieder nervös zu ihrem Mann hinüber, der in düsteren Gedanken versunken aus dem Fenster starrte. Würde ihm das Hotel gefallen? Marie selbst hatte sich vom ersten Moment an in das alte Gebäude aus der Kaiserzeit verliebt, obwohl sie es bei ihrem kurzen Besuch nur im Regen gesehen hatte. Natürlich musste noch vieles ausgebessert und renoviert werden, aber sie war sich sicher, dass das Hotel das Potential zu einem richtigen Schmuckstück hatte.
Damit dies Wirklichkeit wurde, musste sie Robert an ihrer Seite wissen. Doch wie sollte das in der Praxis aussehen? Welche Aufgaben sollte er übernehmen? Mit dem Polizeidienst war es vorbei, von Marketing und Gastronomie hatte er keine Ahnung, und körperliche Anstrengungen sollte er auf Anordnung der Ärzte bis auf Weiteres vermeiden. Schließlich waren sie zu dem Entschluss gekommen, dass er die Rolle des Hausverwalters und Hausmeisters übernehmen sollte.
Doch Marie war sich unsicher. Robert war immer ein guter Kriminalhauptkommissar gewesen. Wenn sie ehrlich war, sogar ein hervorragender. Mit Polizeiarbeit kannte er sich aus. Seine Vorgesetzten hatten ihm angesichts der neuen Möglichkeiten durch die Wiedervereinigung eine große Karriere versprochen.
Aber so gut er als Polizist war – handwerkliches Talent hatte Robert nicht. Marie lächelte versonnen, als sie an seinen gescheiterten Versuch dachte, ihre neue IKEA-Küche aufzubauen. Auch nach einer Woche verzweifelten Schraubens und Hämmerns hatten die Kartons und Bretter noch ungeordnet auf dem Boden gelegen. Trotzdem hatte Robert sich standhaft geweigert, seine Niederlage zuzugeben.
Schließlich hatte Marie einen Experten geholt, der die Küche an einem Vormittag aufgebaut hatte. Robert war so beleidigt gewesen, dass er drei Tage lang kein Wort mit ihr gesprochen hatte.
Marie war klar, dass die Eingewöhnung im Spreewald für Robert besonders schwierig werden würde, aber mit der Zeit würde es ihm schon gefallen. Wenn schon frühpensioniert, dann doch am besten in dieser zauberhaften Umgebung, oder etwa nicht?
»Da ist es ja endlich, dein Glubitz«, meldete sich Robert vom Beifahrersitz und holte Marie aus ihren Gedanken in die Wirklichkeit zurück.
Tatsächlich passierten sie in diesem Moment das Ortsschild. Erst nach einigen Hundert Metern folgte das erste Gebäude des Dorfes, eine windschiefe Scheune. Dann kamen ein paar Bauerhöfe, einige kleine, unverputzte Wohnhäuser und schließlich eine Reihe Ferienhäuser, die sich hinter großen, wild wuchernden Hecken in lang gezogenen Gärten versteckten. Dazwischen erstrecken sich weite Gurkenfelder, auf denen Marie und Robert vereinzelte Bauern und vor allem Bäuerinnen bei der Arbeit entdeckten. Ein Schild wies die Richtung zum Ortskern, ein anderes verkündete, dass der Ort immerhin einen Campingplatz hatte.
»Ist das alles?« Robert klang eher zufrieden als enttäuscht. Seine Vorurteile hatten sich bestätigt: Glubitz war der Arsch der Welt.
Marie schüttelte den Kopf. »Wir machen nachher noch einen Spaziergang durchs Dorf, aber jetzt fahren wir erstmal direkt zum Hotel.«
Robert verzog die Lippen, doch Marie war seine schlechte Laune im Moment egal, da in diesem Augenblick der Spreewaldhof vor ihnen auftauchte. In Maries Augen sah das Gebäude wunderschön aus. Der rote Putz leuchtete vor dem satten Grün des alten Baumbestandes, der zum Grundstück gehörte, die großen Fenster waren weiß abgesetzt, und mit seinen vier Stockwerken erhob sich das Gebäude überraschend hoch über den Rest des kleinen Dorfes. Marie lächelte stolz. So malerisch und beeindruckend hatte sie das Hotel gar nicht in Erinnerung gehabt, aber jetzt konnte sie gut nachvollziehen, dass der Kaiser vor über hundert Jahren hier Stammgast gewesen war.
»Na, was sagst du?«, fragte sie Robert und strahlte übers ganze Gesicht.
»Ganz hübsch«, meinte Robert demonstrativ gelangweilt, aber sein Blick verriet, dass auch er beeindruckt war. »Muss natürlich noch viel gemacht werden, der Putz und die Fenster, aber dann kann das ganz ordentlich werden.«
Marie verzichtete darauf, Roberts Genörgel zu kommentieren, stellte den Wagen auf dem Parkplatz unter einer alten Eiche ab und wandte sich dann nach hinten: »Lars, mein Schatz, wach auf, wir sind da! Guck, unser neues Zuhause.«
Als sie gemeinsam ausstiegen, wurde Marie von einer sanften Brise empfangen. Sie atmete tief durch und blickte lächelnd zu Robert, der sich leise stöhnend streckte und sich scheinbar gleichgültig umschaute. Er sah aus wie ein trotziger Teenager.
Lars starrte fassungslos an dem hohen Gebäude hinauf. »Wow, und das gehört jetzt alles uns?«
Marie nickte und drückte ihren Sohn glücklich an sich.
»Viel los ist hier ja nicht gerade«, meldete sich Robert zu Wort.
»Bitte …«
»Ich meine ja nur. Außer uns sehe ich keinen Menschen.«
»Ich habe dir doch gesagt, dass das Hotel vorläufig geschlossen ist.«
Robert verzog verlegen das Gesicht. Er hatte gemerkt, dass er es mit seiner schlechten Laune übertrieb. Doch Marie war viel zu aufgeregt, um sich darüber Gedanken zu machen. Mit Emma, die ebenfalls aufgewacht war, auf dem einen Arm hakte sie sich mit dem freien Arm bei Robert ein.
»Los, du Nörgler, es wird Zeit, dass du unser Personal kennen lernst.«
5
Robert, Lars, darf ich euch Tom und seine Freundin Theresa vorstellen?«
Vor den Lindners stand ein junger Bursche in Portiersuniform, neben ihm eine junge Frau in einem einfachen Hauskittel, die verlegen lächelnd zu Boden schaute.
»Willkommen im Spreewaldhof, Herr Lindner«, sagte Tom. Er hatte eine freundliche, offene Ausstrahlung. Als er Robert die Hand gab und eine kurze Verbeugung andeutete, konnte Robert in seinen leicht zerzausten Haaren schon einzelne Lücken entdecken, obwohl er auf den ersten Blick kaum älter als dreißig wirkte.
Marie klopfte ihm freundlich auf die Schulter. »Tom hat die letzten fünf Jahre als Portier für Tante Hedwig gearbeitet. Ich hoffe, Sie werden uns die Treue halten. Das Gleiche gilt natürlich auch für Sie, Theresa. Wir würden uns freuen, wenn Sie noch lange unser Zimmermädchen bleiben.«
»Es wäre uns eine große Ehre«, sagte Tom, indem er sich erneut verneigte.
Alle Blicke waren jetzt auf Theresa gerichtet, die schüchtern auf die abgenutzten Holzdielen vor der Rezeption starrte.
Na, wunderbar, dachte Robert, das ist also unser Personal: ein schmalbrüstiges Bürschchen und seine schwachsinnige Freundin. Er lächelte Marie gequält zu. Falls sie ähnlich dachte, ließ sie es sich nicht anmerken.
Tom drückte zärtlich die Hand seiner Freundin, was diese als Aufforderung zu verstehen schien, endlich den Mund aufzumachen.
»Guten Tag«, hauchte sie mit starkem polnischem Akzent und reichte Robert die Hand. »Entschuldigung, ich spreche leider nicht sehr gut deutsche Sprache. Ich komme aus Krakau.«
Doch Marie schien das schüchterne Mädchen mit den großen braunen Augen bereits in ihr Herz geschlossen zu haben. »Kein Problem, Theresa. Ich denke, wir werden ganz wunderbar miteinander auskommen, nicht wahr?«
Marie blickte auffordernd zu Robert, doch statt ein paar nette Worte zur Begrüßung an die beiden zu richten wandte der sich an Tom: »Die Koffer? Wo kann ich die abstellen?«
Sofort sprang ihm der Mann helfend zur Seite. »Lassen Sie sie einfach nur stehen. Ich bringe sie gleich nach oben.«
Marie strahlte Robert an. »Eine gute Idee. Dann komm, ich will dir unsere neue Wohnung zeigen. Du wirst begeistert sein!«
Toms Angebot ignorierend wollte Robert sich einen der Koffer schnappen, doch Marie hielt ihn davon ab. »Robert, bitte. Du weißt doch, was Doktor Jahn gesagt hat. Du darfst nichts Schweres tragen.«
»Ich weiß schon, was ich tue.«
»Den Eindruck habe ich aber nicht. Und ich will nicht, dass du mir hier schon am ersten Tag zusammenklappst.«
Robert warf Marie einen verärgerten Blick zu. Tatsächlich spürte er wieder dieses Ziehen im Bauch und das schmerzhafte Pochen im Rücken. Aber wie konnte ihn seine Frau vor dem neuen Personal nur als schwächlichen Invaliden bloßstellen? Wie sollten die beiden unter diesen Umständen jemals Respekt vor ihm haben?
Tom, selbst schon auf dem Treppenabsatz, lächelte Robert freundlich zu: »Sie können mit dem Gepäck ruhig den Fahrstuhl nehmen. Er ist ziemlich alt und nicht sehr groß, aber für Sie und den Koffer reicht er allemal.«
»Quatsch, Treppensteigen hält fit!« Robert zog den Rollkoffer Stufe für Stufe nach oben. Die Lippen hatte er zusammengepresst, den Blick starr auf den Boden gerichtet.
Marie schüttelte verärgert den Kopf, aber Tom nickte anerkennend, bevor er Robert zusammen mit den anderen nach oben folgte.
Das Treppenhaus und die Flure des Hotels waren mit Stillleben und vergilbten Fotos dekoriert, die Spreewaldmotive zeigten: Enten im Schilfgras, Trauerweiden, die ihre Zweige ins Wasser hängen ließen, Bauern bei der Ernte und Familien in der traditionellen Tracht der Sorben, der slawisch stämmigen Volksgruppe, die die Mehrheit der Bevölkerung des Spreewaldes ausmachte.
Robert atmete ein. Dieser Geruch! War das nun der alte DDR-Mief, der Gestank der Parteikader, die nach Maries Aussage die letzten vierzig Jahre zur Stammkundschaft des Spreewaldhofs gehört hatten, oder einfach nur der Geruch von Vergangenheit und Vergänglichkeit, wie er ihn von den Besuchen bei seiner Großmutter in Uelzen kannte? Und von seiner Tante Emmy, die vor drei Jahren in Luckenwalde gestorben war und damit die Wiedervereinigung knapp verpasst hatte. Robert konnte sich nicht daran erinnern, dass Tante Emmy jemals jung gewesen war. In den Siebzigern waren seine Eltern regelmäßig mit ihm und seiner Schwester in den südlich von Berlin gelegenen Teil Brandenburgs gefahren, um sie zu besuchen. Endlose schweigsame Nachmittage bei Kaffee, staubigem Kuchen und geschmacksloser Hausmannskost. Am Abend hatte Tante Emmy immer eine Schublade ihres lackierten Art-déco-Schranks geöffnet und den Kindern etwas Schokolade gegeben. Offensichtlich hatte sie direkt nach dem Krieg angefangen, Süßwaren für eventuelle Enkelkinder aufzubewahren, entsprechend hatten die Schokoriegel damals geschmeckt. Oder hatte es daran gelegen, dass es sich um DDR-Schokolade handelte? Schlager-Süßtafel. Mehr als alle Politsendungen oder Trabbiwitze war diese Schokolade für Robert der Beweis dafür gewesen, dass es für den Arbeiter- und Bauernstaat keine Hoffnung gab.
»So, da wären wir: Willkommen in Ihrer neuen Wohnung!«
Ausgelassen wie ein junges Mädchen hüpfte Marie in die leeren Räume. »Na, was sagst du? Ist das nicht ein Traum?«
Robert trat ein und zog die Luft ein. Wenn der muffige Geruch schon im restlichen Hotel wahrzunehmen gewesen war, so verschlug er einem hier förmlich den Atem.
Tom ahnte, was Robert dachte, und lächelte. »Tut mir leid, wir hätten natürlich lüften sollen.« Zusammen mit Theresa öffnete er die Fenster.
Robert schaute sich um. Die Wohnung war tatsächlich beeindruckend. Recht groß, viel größer als ihre alte in Wilmersdorf. Sie bestand aus fünf Zimmern, besaß ein feudales Wohnzimmer, eine hübsche, wenn auch recht altmodisch eingerichtete Wohnküche und eine riesige Dachterrasse. Da die Wohnung im obersten Stock lag, waren die Zimmer nicht so hoch wie in Altbauwohnungen üblich, trotzdem schätzte Robert die Höhe auf stattliche dreieinhalb Meter.
»Jetzt mach schon den Mund auf. Sag bloß, die Wohnung gefällt dir nicht?«
»Na ja, mit viel heller Farbe und einer neuen Küche kann sie ganz erträglich werden«, murmelte Robert, doch Marie ließ sich ihre gute Laune nicht so leicht verderben.
»Ignorieren Sie ihn einfach«, wandte sie sich freundlich an Theresa und Tom. »Er ist Berliner, und die müssen immer meckern, sonst sind sie nicht glücklich.«
Theresa und Tom lächelten verschämt, schwiegen aber.
»Frau Gerling war eine alte Dame. Am Ende fehlte ihr einfach die Kraft für eine größere Renovierung«, unterbrach Tom die Stille, als er bemerkte, dass Robert einen Wasserschaden unter dem Fenster begutachtete.
Robert nickte und ging weiter durch die leere Wohnung. Die Wände zierten Flecken, anhand derer man erahnen konnte, wo vorher Möbel gestanden beziehungsweise Bilder gehangen hatten.
Wieder las Tom Roberts Gedanken. »Wir haben die Möbel Ihrer Tante erst einmal weggeräumt. Sie können sie sich ja mal anschauen. Vielleicht wollen Sie ja doch noch ein paar davon behalten.«
Das fehlte Robert gerade noch. Keine DDR-Möbel in seiner Wohnung! Schon morgen würde der Lastwagen mit ihren Sachen aus Berlin eintreffen. Robert seufzte bei dem Gedanken an die viele Arbeit, die der Einzug in ihr neues Zuhause noch bedeuten würde.
Marie knuffte ihn ungeduldig in die Seite. »Los, komm, du musst dir unbedingt die Dachterrasse angucken.«
Robert folgte seiner Frau und war zum ersten Mal begeistert: Was für eine Idylle! Überall Bäume, dazwischen immer wieder Felder und die in der warmen Nachmittagssonne glitzernde Spree. Nur in unmittelbarer Nachbarschaft konnte Robert zwischen den Bäumen einige Dächer von Bauernhöfen und Ferienhäusern ausmachen.
Auch die Luft hier oben war wunderbar. Und die Stille. Wenn er da an den Straßenlärm in Berlin dachte, wurde ihm ganz anders. Hier gab es nur das Zwitschern der Vögel und das sanfte Rauschen des Windes. In einiger Entfernung entdeckte Robert einen Bauern, der mit seinem Trecker das Heu einbrachte. Ganz leise, wie das Echo eines Geräuschs, war das Tuckern des Dieselmotors zu hören.
»Ein Traum, oder?« Marie, immer noch mit Emma auf dem Arm, lehnte sich bei ihrem Mann an.
Robert nickte lächelnd. Zum ersten Mal hatte er vergessen, dass er eigentlich nur missmutig aussehen wollte.
Tom stellte sich neben sie und deutete zum Horizont. »Sehen Sie den Kirchturm dahinten? Das ist Lübbenau.«
Robert kniff die Augen zusammen. Tatsächlich, am Horizont leuchteten schwach einige Dächer in der Sonne.
»Gibt es eine direkte Straße dorthin?«