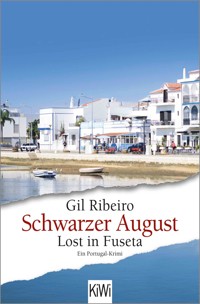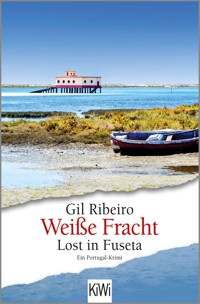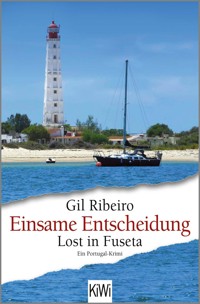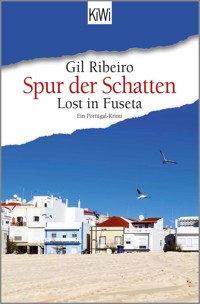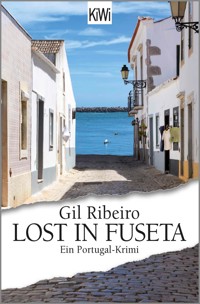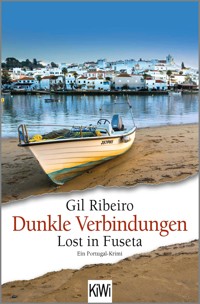
10,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Leander Lost ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein brutaler Raubüberfall und eine mysteriöse Leiche im Golfteich – Leander Lost und Graciana Rosado stehen vor ihrer bisher größten Herausforderung in diesem fesselnden Portugal-Krimi! Es hätte ein ereignisreicher, aber friedlicher September werden sollen für Leander Lost und Soraia: erst der Umzug in ein neues Haus, dann ihre Hochzeit. Doch die Nachsaison bringt keine Ruhe nach Fuseta. In einem Golfteich wird eine tote Frau gefunden. Kurz darauf kommt es zu einem brutalen Überfall auf einen Geldtransporter, der dunkle Erinnerungen an einen alten ungelösten Fall weckt. Sieben Jahre zuvor wurde Elias, Graciana Rosados Bruder, bei einem ähnlichen Überfall ermordet. Ihr Vater überlebte schwer verletzt. Nun erleben beide ein düsteres Déjà-vu. Kollege Duarte überlebt nur knapp den Schusswechsel, verliert aber sein Gedächtnis. Die Ermittlungen enthüllen, dass der Überfall nicht ohne Hinweise aus den Reihen der Polizei möglich war. Während Leander Duarte hilft, sich die Welt neu zu erschließen, wird aus dem Überfall eine Serie mit unklarem Muster. Geht es nur um Geld oder steckt mehr dahinter? Und welche Verbindung besteht zur Toten im Teich? Leander vertieft sich in den rätselhaften Fall. Doch Graciana hat längst beschlossen, die Mörder ihres Bruders selbst zur Strecke zu bringen. »Dunkle Verbindungen« ist ein fesselnder Cosy-Krimi in der malerischen Algarve mit dem autistischen Ermittler Leander Lost. Tauchen Sie ein in die spannende Welt dieses Portugal-Krimis voller rätselhafter Verbindungen und überraschender Wendungen! Die Krimis mit Kommissar Leander Lost sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Lost in Fuseta - Spur der Schatten - Weiße Fracht - Schwarzer August - Einsame Entscheidung - Dunkle Verbindungen - Lautlose Feinde (erscheint im April 2025, schon jetzt vorbestellbar)Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gil Ribeiro
Dunkle Verbindungen
Lost in Fuseta. Ein Portugalkrimi
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Gil Ribeiro
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Gil Ribeiro
Gil Ribeiro, geboren 1965 in Hamburg, landete 1988 während einer Interrail-Reise quer durch Europa nur dank eines glücklichen Zufalls an der Algarve und verliebte sich umgehend in die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Portugiesen. Seitdem zieht es ihn immer wieder in das kleine Städtchen Fuseta an der Ost-Algarve, wo ihm die Idee zu »Lost in Fuseta« kam. In seinem deutschen Leben ist Gil Ribeiro alias Holger Karsten Schmidt seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten Drehbuchautoren Deutschlands. Anfang 2020 erschien bei Kiepenheuer & Witsch sein Kriminalroman »Die Toten von Marnow«, der im Frühjahr 2021 als gleichnamige Mini-Serie in der ARD für Furore gesorgt hat. Holger Karsten Schmidt lebt und arbeitet bei Stuttgart.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Es hätte ein ereignisreicher, aber friedlicher September werden sollen für Leander Lost und Soraia: erst der Umzug in ein neues Haus, dann ihre Hochzeit. Doch die Nachsaison bringt keine Ruhe nach Fuseta. In einem Golfteich wird eine tote Frau gefunden. Kurz darauf kommt es zu einem brutalen Überfall auf einen Geldtransporter, der dunkle Erinnerungen weckt an einen alten ungelösten Fall …
Sieben Jahre zuvor ist Elias, Graciana Rosados Bruder, bei einem ähnlichen Überfall ermordet worden. Ihr Vater wurde schwer verwundet. Nun erleben beide ein düsteres Déjà-vu. Ihr Kollege Duarte überlebt nur mit Glück den Schusswechsel, verliert aber sein Gedächtnis. Die Ermittlungen fördern zutage, dass der Überfall nicht ohne Hinweise aus den Reihen der Polizei möglich gewesen ist.
Während Leander Duarte dabei hilft, sich die Welt neu zu ertasten, wird aus dem Überfall eine Serie, deren Muster sich aber nicht erschließt. Geht es den Tätern nur um die Erbeutung von Geld, oder steckt etwas anderes dahinter? Und was hat die Tote im Teich mit alldem zu tun? Leander Lost arbeitet sich immer tiefer hinein in den Fall. Was er dabei aus dem Blick verliert: Graciana hat längst beschlossen, die Mörder ihres Bruders mit eigenen Mitteln zur Strecke zu bringen.
Hinweis für E-Reader-Leserinnen und -Leser
Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:
www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karten-zu-dunkle-verbindungen
Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer
Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.
Inhaltsverzeichnis
Motto
TAG EINS
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
TAG ZWEI
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
TAG DREI
12. Kapitel
TAG VIER
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
TAG FÜNF
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
TAG SECHS
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
TAG SIEBEN
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
EPILOG
Nachwort
Dank
Leseprobe »Lautlose Feinde«
Die Vergangenheit ist ein Prolog.
Dan B. Tucker
TAG EINS
1.
Der Tod von Karen Riemann löste weder Bestürzung noch Genugtuung aus. Er geschah von der Öffentlichkeit unbemerkt, und ihr Mörder empfand weder das eine noch das andere.
Am Tag darauf, dem 23. September, drehte der Wind und sorgte für die Entdeckung ihrer Leiche.
Er kam aus Südost, zum Teil also aus dem benachbarten Spanien. Und da die Geschichte die Portugiesen gelehrt hatte, alles, was von dort kam, mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, zogen sie ein wenig die Köpfe ein und warteten ab. Die kleinen Fischerboote, verwitterte Nussschalen, liefen nicht aus. Die Fischer setzten sich in die Cafés in Meeresnähe und tauschten bei einer kräftigen Bica Neuigkeiten aus oder sezierten genüsslich die Spielzüge des gestrigen Matches zwischen Benfica Lissabon und dem FC Porto.
Themen wie Nachbarn, Schwangerschaften, Hochzeiten und Todesfälle überließen sie meist ihren Frauen, über Fußball konnten sie aber nie genug reden. Dabei drehten sie ihre filterlosen Zigaretten und sogen den Rauch so tief ein, dass man den Stich in der Lunge ahnte.
Die gut vier und fünf Meter hohen Atlantikwellen, die der Wind Richtung Ufer vor sich hertrieb, brachen wegen der Ebbe besonders früh. Ihr dumpfes, massives Dröhnen klang, als würden schwere Holzstämme mit großer Wucht in den Boden gerammt. Die Erde vibrierte. Dieses Phänomen trat nur sehr selten auf an der Ria Formosa, einem aus mehreren vorgelagerten Inseln bestehenden Naturschutzgebiet, das sich schützend vor die Küste gelegt hatte, wodurch eine kilometerlange Lagunenwelt entstanden war.
Der Wind jedenfalls – wie die Fischer mutmaßten: der verflixte spanische Anteil daran – brachte heftige Regenschauer mit sich. Aber es gab auch Menschen in der Gegend, die das nicht melancholisch stimmte, sondern die sich darüber freuten. Genau genommen: drei.
Der Erste war Leander Lost. Er stand auf der Veranda seines neuen Zuhauses und lauschte dem regelmäßigen Trommeln auf dem Vordach. Das Geräusch wirkte ungemein beruhigend auf ihn. Und das war nicht nur so eine Vermutung, sondern eine Tatsache: Er hatte sich selbstverständlich längst durch das Messen seiner Pulsfrequenz von dieser Kausalität überzeugt.
Es fühlte sich an wie zwei Gläser Vinho verde, jener sanft moussierende junge Weißwein, der einem nicht gleich zu Kopf stieg, sondern entspannend wirkte. Und Entspannung konnte Lost dringend gebrauchen. Seit zwei Wochen renovierten Soraia und er in jeder freien Minute die Villa Canto das Baleias.
Wobei »Villa« ein Begriff war, dem man in dieser Gegend von Portugal misstrauen musste, wie er festgestellt hatte. Selbst eine Ruine mit drei Brettern als Dach wurde mit dieser Bezeichnung geadelt. Das kleine Anwesen, an das sie ihr Herz verloren hatten, Soraia und er, war zwar keine Ruine, aber es war sichtlich in die Jahre gekommen. Und doch war es wunderschön. Und die Lage erwies sich als exzellent: Das Haupthaus war etwas kleiner als die Villa Elias, wo Leander sein erstes Zuhause in Fuseta gefunden hatte, aber der Grundriss war praktischer, da er über keine Durchgangszimmer verfügte. Und die Lage war exzellent: am Rand Fusetas in zweiter Uferlinie, idyllisch ruhig und doch nahe genug am Ort, um alles Notwendige gut zu Fuß erreichen zu können.
In den letzten Wochen hatten sie das Kleinod mit der Hilfe von Freunden und Bekannten und von Handwerkern, die ihnen zu Losts Verwunderung allesamt unbezahlt halfen, renoviert. Als er fragte, woher die Leute kamen, sagte Soraia bloß: »Es sind Freunde meines Vaters.«
Der Umzug war erledigt, die Kartons waren schon beinahe vollständig ausgepackt und der Inhalt fein säuberlich eingeräumt – Leander hatte in wenigen Tagen einen exakten Plan entworfen, wo was unterzubringen war. Welches Zimmer, welche Kommode, welche Schublade. Er benötigte Ordnung und Vorhersehbarkeit in seinem Privatleben. Lud die Nachbarin oder ein Bekannter sie spontan zum Essen oder zu einer Bootsfahrt ein, verunsicherte ihn die Störung seiner festen Abläufe nachhaltig. Es verursachte ein Gefühl der Lähmung, das erst allmählich wieder verschwand.
Regeln gaben ihm Sicherheit. Termine bildeten verlässliche Bojen in einem Ozean, in dem die Strömung ständig wechseln konnte und nie vorhersehbar war, wohin sie einen trieb.
Alleine zu leben bedeutete, leichter Ordnung halten zu können. Deshalb war es für Lost eine echte Herausforderung gewesen, als Soraia zu ihm in die Villa Elias zog, denn mit ihrer Anwesenheit veränderte sich auch die Ordnung im Haus. Da standen plötzlich Schuhe, die nicht in einer Linie angeordnet waren, Bücher, die nach der Lektüre nicht an ihren angestammten Platz zurückgestellt oder nicht korrekt einsortiert wurden (Alphabet, Erscheinungsjahr) und vieles mehr.
»Ich bin mir sicher, Sie würden trotzdem für Soraia durch die Sahara laufen«, hatte sein Kollege Sub-Inspektor Carlos Esteves in diesem Zusammenhang gesagt. Was die Frage aufwarf, weshalb er Grund dazu haben sollte. Ob es um die kürzeste Route (1.500 Kilometer) oder die längste (5.000 Kilometer) ging. Was er eigentlich in der Sahara zu suchen hatte, und ob es diese spezielle Wüste sein musste oder es auch die Wüste Gobi tat oder auch eine Eiswüste (war eine hohe Temperatur Teil dieses seltsamen Gleichnisses)?
Der Vergleich sollte wohl etwas Nettes veranschaulichen – das entnahm er Senhor Esteves’ Mimik –, aber er ergab unterm Strich keinen Sinn. Trotzdem hätte er diese Entbehrung sicherlich für Soraia auf sich genommen, wenn es erforderlich gewesen wäre. Zum Glück war das momentan nicht der Fall.
Und trotzdem war er froh, darauf gedrängt zu haben, diesen Schritt zu tun und sich gemeinsam ein eigenes Zuhause zu schaffen. Wie sehr Soraia den Ort mochte, hatte er schon gemerkt, als sie die Villa zum ersten Mal besichtigten. Kaum war die Schwelle der Eingangstür überschritten, strahlten ihre Augen, sie lächelte und ihre Grübchen traten hervor, für die Leander ein besonderes Faible hegte.
Nun trat sie zu ihm auf die Veranda und legte den Arm um seine Hüfte. Und genau in diesem Moment schwebte ein Dutzend Flamingos über die Ria Formosa und landete keine zweihundert Meter entfernt in einer der Salinen, in der sich das Meerwasser zu Tümpeln staute. Dort staksten die Vögel ein paar Meter auf und ab, um zum Stillstand zu kommen, ein Bein einzuziehen und in dem anderen ihr Gelenk einrasten zu lassen. Die Ruhe war perfekt, das Trommeln des Regens auch.
Lost hätte hier die nächsten 400 Jahre so stehen können und schauen und hören, ohne dass ihm langweilig geworden wäre – und über die Absurdität musste er lächeln. Denn statistisch betrachtet blieben ihm ja lediglich 41.
Die anderen beiden, die sich über den Regen freuten, waren Zara und Toninho.
Zara war mit dem ersten Verbrechen, das Leander hier in Fuseta zusammen mit seinen portugiesischen Kollegen aufgeklärt hatte, in sein Leben getreten. Eine Vollwaise aus einem Heim, die wie ein getretener Hund nach allem geschnappt hatte, was sich ihr näherte. Als bedrohte Zeugin in einem Mordfall hatte Lost sie geschützt und auf seine besondere Art ihr Vertrauen gewonnen. Mehr noch: Ihm war es zu verdanken, dass aus dem widerborstigen Mädchen eine selbstsichere junge Frau wurde, die ihr Abi nachholte und von seiner Seite nicht mehr wegzudenken war. Und so wurde das Besucherhäuschen, das zu Leanders eigenem Haus gehörte und das sie zunächst provisorisch bewohnt hatte, zu ihrer festen Bleibe. Es war so gekommen, wie Soraia es vorausgesagt hatte: Zwei Außenseiter hatten sich gefunden.
Und Toninho war ihr Freund.
Die beiden hatten sich um die Renovierung der Casinhas gekümmert, der beiden kleinen Besucherhäuschen, die sich auf dem Grundstück der neuen Villa befanden. Ein schmaler Pfad aus Pflastersteinen gabelte sich im Garten auf – einer führte zu den beiden Casinhas, der andere zum Pool.
Zara hatte bereits die rechte Casinha bezogen, während ihr Freund Toninho hoffte, sie würde früher oder später zu ihm in den Nachbarort Olhão ziehen, wo er zur Miete wohnte.
Die beiden freuten sich über den Regen, weil er Auswirkungen auf den nahe gelegenen Golfplatz hatte: Sobald die ersten Tropfen fielen, verließen die Golfer zügig das Green, um im Clubhaus ein paar Bahnen im Innenpool zu ziehen oder zu einer Shoppingtour nach Tavira oder Vilamoura aufzubrechen.
Und ein menschenleeres Green war die Voraussetzung für Toninhos neues Geschäftsmodell, das er von einem Freund übernommen hatte.
Sobald es anfing zu regnen, rief Tiago bei ihnen an. So auch heute: »Ihr könnt kommen.«
Toninhos Roller war an gut zwei Dutzend Stellen geflickt, aber er funktionierte. Der Anlasser gab beim dritten Mal den Widerstand auf, und die beiden fuhren zügig zum Monte Rainha. Das Golfresort nordwestlich von Moncarapacho befand sich im Hinterland der Algarve mit seinen sanft geschwungenen Hügeln. Die Fläche, die er einnahm, war enorm: groß angelegte, immergrüne Golfstrecken neben künstlichen Seen, dazu geschmackvolle Residenzen, die sich architektonisch in die Umgebung einpassten. Für die Sterblichen unter den Gästen gab es ein »Bistro«, für den Rest das O Céu, ein Sternerestaurant. Das Resort war ein Ort, der sich alle Mühe gab, internationale Standards zu erfüllen.
Toninho Santos steuerte seinen Roller an dem imposanten Haupthaus mit der Rezeption vorbei und erreichte die Driving Range, wo die Spieler ihren Abschlag üben konnten. Das Gelände war wie leer gefegt, nur Tiago begrüßte sie. Er schien immer schüchtern zu lächeln, selbst wenn sein Mund sich gar nicht bewegte. Aber dann, war Zara dahintergekommen, erledigten das seine Augen.
»Olá«, begrüßte er die beiden.
»Olá«, gab Toninho zurück, während sie sich die Helme vom Kopf zogen, »como vai?«
Tiago nickte nur und reichte ihm den Schlüssel für das Golfcart.
»Obrigada.«
Tiago war etwas jünger als die beiden und arbeitete als Küchenhilfe im Bistro. Er stammte aus Marokko. Seine Eltern waren noch illegal mit einem Schlauchboot über den Atlantik gekommen. Später hatte die Familie eine Aufenthaltserlaubnis erhalten und Papiere. Anfangs kümmerte Tiago sich hauptsächlich darum, dass die Müllbehälter im Monte Rainha stets geleert waren. Mittlerweile war er zur Küchenhilfe aufgestiegen.
Toninho stoppte das Cart am dritten Abschlagspunkt direkt am Lago Numero Três. Der »See Nummer drei«, wie sie ihn nannten, war neben der Nummer vierzehn der ertragreichste. Hier hatten sie vor vier Tagen überstürzt abbrechen müssen, weil sich die Sonne plötzlich gegen den Regen durchgesetzt hatte und einige Golfer zurück aufs Green kamen. Das junge Paar im See hätte sie beim nächsten Abschlag mit Sicherheit irritiert.
Zara und Toninho zogen sich aus. Unter ihrer Kleidung trugen sie Badesachen. Aus einer Tasche holten sie zwei gekürzte Kescher, Taucherbrillen und ein Paar starke wasserdichte Stabtaschenlampen, dann stiegen sie vorsichtig in den See.
Toninho deutete ans Ende des Gewässers: »Ich fang hinten an, du hier?«
Zara nickte. Er schmunzelte, beugte sich vor und gab ihr einen Kuss, was wegen der beiden Taucherbrillen gar nicht so einfach war. Dann kraulte er davon.
Der See war künstlich angelegt, und eine starke Pumpe wälzte das Wasser um, damit sich keine Algen bildeten, aber schon in anderthalb Meter Tiefe wurde es trotzdem recht dunkel.
Zara leuchtete den Boden ab, und zahlreiche helle Punkte reflektierten das Licht durch all die Wasserpflanzen hindurch – die Dimples, die kleinen Krater auf den Oberflächen der Golfbälle, die hier zu Dutzenden, ja Hunderten auf dem Grund des Sees lagen.
Zara sammelte ein Fünfergestirn an Bällen direkt vor ihr mit dem Kescher ein und verstaute sie in einem Netz, das sie sich umgeschnallt hatte.
Durch den Einsatz des Keschers hatte Zara etwas von dem matschigen Grund aufgewirbelt, sodass sich die Sichtweite schlagartig verkürzte. Im gräulichen Dunst sah sie etwas Bläuliches glitzern. Ein Golfball war das definitiv nicht.
Zara näherte sich mit einem kräftigen Schwimmzug, und tatsächlich: Was da den Strahl ihrer Taschenlampe reflektierte, war ein geschliffener Stein. Er erwiderte das Licht in sanftem Violett. Ein Ring mit einem Edelstein! Und obwohl die Luft schon knapp war und sie ein Brennen in der Lunge spürte, machte sie noch einen weiteren Schwimmzug darauf zu.
Als sie danach griff, spürte sie einen Widerstand. Der Ring lag nicht im Schlick, wie sie gedacht hatte. Er steckte auf etwas fest. Und obwohl sie kaum etwas sehen konnte, begriff sie schlagartig, was sie da anhob: eine Hand.
2.
»Bitte gehen Sie weiter – einer unserer Gäste hatte einen Schwächeanfall«, log Marcos Serra.
Er trug einen feinen Anzug aus Sevilla und winkte ein britisches Ehepaar mit einem einstudierten Lächeln und manikürten Fingern weiter. Er war für die Öffentlichkeitsarbeit des Golfresorts zuständig. Und er stand vor einem GAU. Denn der Schwächeanfall der Frau, die man aus dem See geborgen hatte, würde ziemlich dauerhafter Natur sein – was zum Glück niemand sah, denn zwei Angestellte schirmten mögliche Blicke auf sie mit einer Decke ab. Er war so geistesgegenwärtig gewesen, ein Absperrband zwischen einer Pinie und einer Sockelleuchte zu spannen, wo der Weg weiter vorne zum See abzweigte. Alle hatten sich daran gehalten, bis auf das britische Paar, dem es irgendwie gelungen war, es zu übersehen.
Nun ja, dachte Serra, Briten hielten gerne an gewohnten Wegen fest. Wie am Pfund oder am Linksverkehr.
Immerhin hatte es zu regnen aufgehört.
Zu seiner Erleichterung näherte sich nun von einem der Restaurants eine Gestalt, die sich im Gehen mit einem Kamm den Scheitel nachzog. Sie trug einen italienischen Maßanzug in Mittelgrau, dazu ein weißes Hemd und schwarze Oxford-Schuhe von Santoni. Das schwarze Haar und der schmale Oberlippenbart, aufs Feinste gestutzt, rundeten das Bild ab: Miguel Duarte, Sub-Inspektor der Kripo, der Polícia Judiciária.
Er war im Resort seit einiger Zeit häufiger zu Gast, denn er beriet die Geschäftsführung in seiner Freizeit in Sicherheitsfragen. Im Gegenzug durfte er hier seine Fertigkeit als Golfer vervollkommnen oder im Restaurant speisen.
Miguel Duarte stammte wie Serra eigentlich aus Sevilla, und sie waren sich in ihrem Bedauern über die portugiesische Begrenztheit sofort einig gewesen. Intellektuell, ästhetisch, wirtschaftlich, kulturell – die Reihe war endlos, wie sie bei einem Gläschen an der Bar festgestellt hatten (natürlich bei einem aus Andalusien). Im Grunde, stellten sie fest, waren die Portugiesen ein wandelnder Mangel.
Duarte arbeitete aber trotzdem bei der örtlichen Kriminalpolizei, und er ließ gegenüber Serra bei ihrem ersten Gespräch durchblicken, dass er in nachrichtendienstlicher Mission unterwegs sei, quasi ein spanischer Señor Bond. Ein Umstand, über den er nicht viele Worte verlieren durfte, versteht sich – was ihn in Serras Wertschätzung enorm steigen ließ, der ihm seitdem gebannt an den Lippen klebte.
Serra selbst war hier, weil er den Chef des Resorts kannte – seinen Schwager nämlich, natürlich ebenfalls Spanier.
Duarte jedenfalls erreichte ihn jetzt, trat neben ihn und warf einen Blick auf die Leiche.
»Kennst du sie?«
»Ja. Eine Deutsche. Karen Riemann.«
»Hat sie in der Gegend gearbeitet?«
»Ich glaube, sie ist – war Hausverwalterin«, antwortete Serra und zeigte auf ein Haus, das keine hundert Meter entfernt lag, eine Villa in einem satten Beigeton. »Die da. Gehört ebenfalls einem Deutschen. Sie kümmert sich darum. Villa Ria.«
»Verstehe. Villa Ria – wie einfallsreich. Ihr habt sie aus dem See gezogen?«
»Ja. Das junge Pärchen dort hat sie entdeckt. Sie säubern die Teiche von Golfbällen.«
Er deutete mit dem Kopf hinüber zu einer Parkbank, auf der Toninho neben Zara saß und beruhigend auf sie einsprach. Zara wirkte sichtlich mitgenommen. Duarte erkannte sie und ihren Freund sofort.
Es war diese Vollwaise, die man auf Rat von Soraia Rosado vor zwei Jahren bei dem Alemão einquartiert hatte. Und irgendwie hatte der es fertiggebracht, dass sie ihr aggressives Verhalten nach und nach ablegte, ihre Widerspenstigkeit und ihren grenzenlosen Zorn auf die Welt. Vermutlich hatte sie in ihm einen Verwandten im Geiste entdeckt oder so, schließlich war der Deutsche auch plemplem, er trug etwa bei hohen Temperaturen einen schwarzen Anzug. Ganz offensichtlich hatte er jedenfalls einen gehörigen Sprung in der Schüssel.
Und Toninho?
Von dem wusste Miguel nicht viel. Nur, dass er ständig irgendwelchen Gelegenheitsjobs nachging. Allerdings hatte er sich für ein Praktikum bei der GNR gemeldet. Daran war Carlos Esteves, Losts Kollege bei der Kripo, nicht ganz unschuldig.
Als Toninho ihn vor ein paar Wochen gefragt hatte, ob er den Job als Bulle allen Ernstes mochte, sagte er: »Weißt du, ich kann überall so schnell fahren, wie ich möchte. Wenn ich geblitzt werde, sortier ich das Foto einfach aus. Jeder möchte mein Freund sein, man isst und trinkt sich durch ganz Olhão, und es kostet dich keinen Cent, weil alle dir was ausgeben möchten. Und das Großartigste daran – sozusagen die Kirsche auf der Torte – ist: Du hast die Marke. Du gehörst zu den Guten.«
Da war Toninho das Lachen vergangen.
Was von Esteves als Spaß gedacht war, fiel bei Toninho auf fruchtbaren Boden: Morgen war sein erster Tag.
»Olá Senhor Duarte«, sagte Toninho. Zara schwieg.
»Olá, ihr beiden. Ihr habt sie also gefunden. Irgendeine Ahnung, wie die Frau in den Teich gekommen ist?«
Kopfschütteln.
Duarte musterte sie kurz und beschloss dann, dass hier nichts weiter zu holen war.
»Gut, dann könnt ihr gehen. Und morgen …« Weiter kam er nicht, denn Zara sprang auf und lief an ihm vorbei. Duarte blickte ihr nach, um zu sehen, wie sie auf Leander Lost zueilte und ihn umarmte.
»Wir haben eine tote Frau entdeckt!«
Leander trug wie immer seinen Anzug, eine schwarze Lederkrawatte und – als kleines Zugeständnis an dieses Land – schwarze Espadrilles.
Zara schmiegte sich Schutz suchend an ihn. Er ließ es geschehen, obwohl er auf Berührungen äußerst empfindlich reagierte. Sie waren ihm unangenehm, und er stand deshalb so lässig da wie ein Laternenmast. Aber ihm war klar, dass sie ihn jetzt brauchte. Und so strich er ihr mechanisch über den Rücken.
Soraia, die Leander hierher begleitet hatte, winkte Toninho mit einer mitfühlenden Miene zu sich.
»Zara hat schon ganz blaue Lippen«, sagte sie. »Geht rüber ins Clubhaus, zieht euch um, trocknet euch ab. Und dann bringe ich euch nach Hause.«
Toninho nahm Zara sanft an der Hand, die sich jetzt von Lost löste und von ihm und Soraia flankiert den Weg zum Hauptgebäude antrat.
Kaum waren sie weg, trafen auch die Kollegen ein: Graciana Rosado, Soraias ältere Schwester und Losts Vorgesetzte, sowie Carlos Esteves, ebenfalls Sub-Inspektor bei der Kripo und vom gleichen Dienstrang wie Duarte und Leander Lost. Der Mann, der Toninho unbeabsichtigt zu dem Praktikum bei der GNR animiert hatte.
Esteves trug eine kurze Hose, dazu Espadrilles und ein gebügeltes, offenes, hellblaues Hemd. In Spanien, wusste Duarte, hätte ein Vorgesetzter mit Sinn und Verstand ihn niemals so auf die Straße gelassen. Noch dazu kaute er gerade etwas.
Er hatte halblange, schwarze Haare und einen gepflegten Vollbart. Große, kräftige Hände.
Graciana Rosado dagegen trug eine enge Hose und eine taillierte Bluse. Die Haare offen. Sie bewegte sich mit jener gewissen Dynamik, die Temperament verriet. Ihr Blick war offen und klar.
Kurz hinter ihnen folgte auch die Rechtsmedizinerin Oliveira mit ihrem kleinen Koffer. Hose und Shirt in Kaki, eine Farbe, die ihren schönen Teint unterstrich. Die langen, zum Teil ergrauten Haare waren zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ihr war anzusehen, dass sie viel Sport trieb und sich gesund ernährte.
Nach der kurzen Begrüßung hockte sich die Doutora neben die Leiche und untersuchte sie.
»Ihr Name ist offenbar Karen Riemann«, sagte Duarte betont beiläufig, »das hab ich schon ermittelt. Und das ist Senhor Serra. Er ist für uns der offizielle Ansprechpartner von Monte Rainha. Senhora Graciana und die Senhores Esteves und Lost von der PJ.«
Esteves nickte ihm zu und sah hinüber zum Restaurant, von dem er schon viel Gutes gehört hatte. Und obwohl er gerade ein köstliches Bifana auf dem Weg hierher gegessen hatte, regte sich bei dem Anblick bereits wieder sein Appetit.
»Boa tarde«, sagte Graciana und schüttelte dem Mann die Hand, der ihren Gruß erwiderte und Leander und Carlos zunickte. »War die Frau bei Ihnen angestellt?«
»Nein«, sagte Serra. »Einige Häuser konnten vor der Bauphase vom Monte Rainha erworben und noch individuell gestaltet werden. Unser Resort besitzt etwa die Hälfte. Alle anderen Häuser und Apartments sind in privatem Besitz. Frau Riemann hat das da betreut«, er deutete zu der Villa, die er auch schon Duarte gezeigt hatte, »die Villa Ria. Sie war eine Alema. Der Hausbesitzer ist es auch. Er vermietet es an Touristen, und Senhora Riemann hat sich um die Abwicklung gekümmert. Auch darum, dass alles sauber und mit frischer Bettwäsche ausgestattet war.«
»Ich muss bei der Staatsanwaltschaft eine Autopsie beantragen«, stellte die Doutora ruhig fest und verharrte neben dem Opfer in der Hocke. Sie hatte sich Einweghandschuhe über die Hände gestreift und tastete jetzt den Kopf der Toten ab.
»Ist sie ertrunken?«, fragte Carlos.
»Kann ich noch nicht bestätigen, Senhor Esteves«, gab die Doutora zurück, »wenn ich bei der Obduktion feststelle, dass ihre Lungen voller Wasser sind, ist sie ertrunken. Wenn nicht, nicht.«
»Da ist etwas in ihrer Tasche«, sagte Leander und hockte sich hin. Er streifte sich einen Handschuh über, bevor er in die Außentasche der Jacke griff, die die Tote trug.
Er holte einen Stein hervor, dann einen weiteren und noch einen. Keine Kiesel, sondern richtige Brocken.
Marcos Serra hatte eine recht genaue Vorstellung davon, was passieren würde, wenn sich das hier als ein Mord herausstellte: Golfresort des Todes, Mord im Urlaubsparadies und so weiter.
Es würden jede Menge Stornierungen folgen, massive Umsatzeinbußen, und am Ende müsste man dichtmachen, und er wäre seinen Job los – gegenüber Duarte hatte er verschwiegen, dass er sich in Sevilla als Flamenco-Tänzer durchgeschlagen und die Anstellung im Monte Rainha ausschließlich seinem Schwager zu verdanken hatte.
Innerhalb der Familie wäre gelinde gesagt die Hölle los (gab es eine Steigerung von »Hölle«? – falls ja, wäre die los).
»Ich denke, sie war depressiv«, sagte Serra schnell, »es gibt viele Berichte von Selbstmördern, die das Wasser wählen und sich dafür Gewichte mitnehmen.«
»Was für Berichte sind das?«, fragte Leander.
»Na, in Zeitungen, man liest ständig davon. Steine hier, Steine da. Alle depressiv. Vielleicht ist ihr die Arbeit zu viel geworden, oder sie hatte Schulden. Oder war alkoholabhängig. Oder alles zusammen. Und dann ist sie in den See gegangen. So wird’s gewesen sein.«
Graciana tauschte nur einen kurzen Blick mit der Doutora, um zu erfassen, dass sie an so eine Geschichte ebenso wenig glaubte wie sie selbst. Dann rief sie im Kommissariat an.
»Marisa, ich bin’s. Ich brauche bitte über das Einwohnermeldeamt die Information, wo eine Karen Riemann gewohnt hat. Und alles, was es sonst noch offiziell über sie gibt. Obrigada.«
»Hier ist eine Verletzung«, sagte Oliveira und vermied dabei jede Wertung. Sie zeigte den Kollegen ein Hämatom an der Schläfe, das sich erst jetzt offenbarte, als sie die Haare der Toten sanft beiseitegestrichen hatte. Im Zentrum der Verletzung war der Schädel kreisförmig nach innen gewölbt – und knallrot. Die Schwellungen drumherum hatten eine violette Färbung angenommen.
»Eine Schussverletzung?«, fragte Carlos.
»Ganz gewiss nicht«, sagte Serra schnell, »hier ist kein Schuss gefallen.«
»Nein«, gab Oliveira ihm recht, »ich tippe auf einen stumpfen Gegenstand. Vielleicht vier bis fünf Zentimeter im Durchmesser. Und wohl rund, wie es aussieht. Zumindest gewölbt.«
»Die Maße entsprechen einem Golfball«, sagte Leander, »42,67 Millimeter Mindestmaß.«
Serra wurde schlecht.
»Das dürfte aber höchst unwahrscheinlich sein. Nicht wahr, Senhor Duarte?«, drängte der Public-Relations-Manager den Sub-Inspektor zu einer Aussage.
»Ja.«
»Was macht dich so sicher?«, fragte Carlos.
Duarte seufzte. Er freute sich über die Gelegenheit, den portugiesischen Kollegen als begriffsstutzig vorzuführen: »Carlos, mein Lieber, wie viele Tote hatten wir denn in den letzten Jahren auf Golfplätzen, hm?«
»Bisher keine«, kam Graciana Carlos zuvor, damit die Sache zwischen den beiden Sub-Inspektoren nicht hochkochte.
»Golfen ist ein absolut sicherer Sport«, fügte Serra mit einem freundlichen Lächeln hinzu.
»Golfen gehört zu den Top Ten der gefährlichsten Sportarten«, stellte Leander ruhig fest, »weltweit kamen allein vergangenes Jahr gut 4.500 Menschen auf Golfplätzen ums Leben.«
»Sie belieben zu scherzen«, sagte Serra, der noch eine Spur blasser wurde.
»Nicht die Bohne«, erwiderte Leander.
Leander kam in der Regel gerne schnell zur Sache. Kommunikation diente der Informationsvermittlung. Der Sinn von Small Talk war ihm fremd. Wenn man bei vergeudeter Lebenszeit überhaupt von etwas wie Sinn sprechen konnte. Sein ständiges Außenseitertum hatte ihm nicht viele Freunde beschert, vielmehr hatten abstrakte Begriffe wie menschliche Niedertracht oder Bosheit während seiner Jahre im Waisenhaus sinnlich erfahrbare Formen für ihn angenommen. Trotz allem war der Mensch ein Herdentier, das die Gesellschaft anderer suchte. Leander hatte allerdings häufig erfahren, dass man ihn dabei nicht einbezog, sondern mied. Das war als Kind so gewesen und änderte sich auch nicht, als er erwachsen wurde und bei der Polizei anfing. Seine Kollegen verdrehten hinter seinem Rücken die Augen, wenn sie sich unbeobachtet fühlten. Aber Lost entging das nicht.
So liebend gerne wäre er nicht aufgefallen, wäre nicht von der Norm abgewichen, wäre er einfach nur ein Teil der Gruppe gewesen.
Also arbeitete er hart an sich. Doch die Freude, die andere dabei empfanden, wenn jemand etwa auf dem Eis ausrutschte oder ihm ein anderes Missgeschick widerfuhr, empfand er einfach nicht. Dafür konnten die anderen nicht Tränen lachen über Begriffe wie Windhose oder Sprungbrett so wie er.
Er erinnerte sich, wie er einmal mit anderen Waisenkindern im Supermarkt war und vor einem Schild in Lachen ausbrach, so sehr, dass Dr. Winterberg, der Heimleiter, ihn kaum beruhigen konnte. Und als Leander endlich wieder Luft bekam und auf das Schild deutete, das ihn so sehr amüsierte, starrten die anderen ihn völlig entgeistert an. Wie einen Irren. Auf dem Schild stand: Vorteilspackung sichern!
Nur Dr. Winterberg lächelte ihn an. Ganz warm und sanft. Er hatte die Komik begriffen: Eine Packung voller Vorteile!
»Leander«, hatte eine ebenfalls anwesende Lehrerin gesagt, »komm doch mal aus dir raus.« Das Bild, dessen Entstehung sie damit in seinem Kopf auslöste, beherrschte die nächsten Jahre seine Albträume.
Dr. Winterberg hatte immer auf alles eine Antwort. Auch auf Leanders Frage nach dem Sinn von Small Talk.
»Es schafft eine entspannte Atmosphäre, über relativ Belangloses zu plaudern, Leander. Man kann nicht viel falsch machen. Man hat die Gelegenheit, die nonverbalen Signale zu deuten und sein Gegenüber besser kennenzulernen. Man fällt auch nicht gleich mit der Tür ins Haus – das ist, ähm, eine Redewendung für überstürztes Handeln. Für Überrumpelung.«
»Hab ich schon mal gelesen.«
»Small Talk«, hatte Winterberg gesagt und den Jungen mit den dunklen Augen, die frei waren von Arglist und Berechnung, angelächelt, »ist der Kitt zwischen den Menschen, Leander. Es ist ein Sich-Einfühlen, ein Herantasten, um dann schließlich auf das zu sprechen zu kommen, was einen wirklich bewegt – oder auch nicht.«
»Das verstehe ich nicht«, hatte Leander geantwortet.
Tja, wer konnte das dieser kleinen Intelligenzbestie mit dem fotografischen Gedächtnis verdenken, dem nie ein Augenblick seines Lebens verloren ging, keine Hänselei, kein Hohn und kein Spott wurde vom sanften Nebel des Vergessens für ihn verschluckt.
Der Humor der anderen blieb ihm ein Buch mit sieben Siegeln. Und es gab noch etwas, was er einfach nicht konnte: lügen.
Menschen lernten wie Tiere zunächst durch Nachahmung, das wusste Leander.
Wie froh war er also, als er »Das Kompendium der sinnlosen Sätze« in einem Antiquariat entdeckte und erstand. Eine Art Leitfaden für sinnentleerte Plauderei.
Ein teigiger, leicht übergewichtiger Misanthrop mit dem klingenden Namen Dan B. Tucker hatte diesen Schatz verfasst, und Leander Lost damit den Alltag enorm erleichtert. Nach der Lektüre des Werkes verfügte er über ein reiches Repertoire an Gesprächs- und insbesondere Small-Talk-Optionen. Bei dem Äußern solcher Phrasen (»So ein Tag aber auch!«) mangelte es ihm zwar an jener Beiläufigkeit, mit der sie ausgesprochen werden mussten, um ihre Wirkung zu entfalten (wie etwas Überflüssiges nämlich). Aber das bemerkten nur die anderen.
Zu seiner Freude hatte Dan B. Tucker sogar einen Appendix herausgegeben. Natürlich als Book on demand, denn kein Verlag setzte auf diesen zweiten Ladenhüter aus der Feder von Christian Busz (wie Dan B. Tucker mit bürgerlichem Namen hieß).
Für Leander war diese verlegerische Totgeburt mit dem Titel Alte Schweden und blinde Hühner allerdings ein Glücksfall. Denn es erweiterte seine Optionen um Redewendungen und Metaphern. Ihre situationsbedingte Anwendung war aber mitunter noch ein Minenfeld.
Statt »überhaupt nicht« oder »keineswegs« sagte der lässige Small Talker: »Nicht die Bohne.«
»Nicht die Bohne«, sagte Leander also auf dem Golfplatz des Monte Rainha, »4.500 Menschen. Wissen Sie, was die häufigste Ursache ist?«
»Herzstillstand?«
»Fast. Herzinfarkt ist die zweithäufigste Ursache.«
»Unfälle?«, fragte die Doutora.
»Unfälle mit den Karts sind die Nummert drei.«
»Doch nicht etwa Golfbälle, oder?«, fragte Graciana.
»Nein«, antwortete Lost. »Tod durch Golfbälle tauchen in der Statistik gar nicht auf, obwohl sie vorkommen. Die Liste wird angeführt von Tod durch Blitzschlag.«
Serra atmete erleichtert aus. Wenigstens eine gute Nachricht an diesem Tag.
»Golfer sind dabei mit zurzeit fünf Prozent an der Gesamtzahl aller Unfälle beteiligt«, führte Leander aus, weil er in den Mienen Interesse zu sehen meinte, »also mit rund 225 Toten pro Jahr.«
»Das ist ja wahnsinnig interessant«, sagte Duarte und unterdrückte ein Gähnen.
»Aber Golfbälle können dennoch töten, oder?«, hakte Graciana nach.
»Der Rekord bei Fluggeschwindigkeiten eines Golfballs liegt bei 339,56 Stundenkilometern. Das entspräche einer Aufprallenergie von knapp über 200 Joule.«
»Was heißt das?«, erkundigte Marcos Serra sich besorgt. Wenn sich herausstellen sollte, dass Karen Riemann von einem Golfball getroffen und … erlegt worden war, wäre Monte Rainha dort, wo Serra sie seit Monaten platzieren wollte: In den Abendnachrichten. Allerdings unter anderen Vorzeichen.
»Ein abgeschossenes 9-mm-Projektil gibt abhängig von seiner Geschwindigkeit mindestens 350 Joule Energie beim Auftreffen auf sein Ziel ab«, erklärte Leander.
Kurz blieb die Zeit stehen, und Graciana warf dem Mann, der vielleicht in diesem Jahr noch ihr Schwager sein würde, einen anerkennenden Blick zu, in dem eine Spur Zärtlichkeit lag. Senhor Léxico.
Diese gradlinige Unbedarftheit entwaffnete sie manchmal immer noch, obwohl Lost bereits seit nunmehr zwei Jahren seinen Dienst hier an der Ostalgarve verrichtete.
»Senhor Lost«, wandte die Doutora sich an ihn, »wie viel Joule werden bei einem durchschnittlichen Golfschlag frei?«
»69,44.«
»Kann ich sie in die Rechtsmedizin überführen?«
Die Frage der Doutora war an Graciana gerichtet, die nickte.
»Äh, wie wollen Sie das machen, bitte?«, schaltete Serra sich sofort ein.
»Mit einem Rettungswagen«, erwiderte Oliveira, während sie in einer geschmeidigen Bewegung aufstand.
»Das ähm … geht das nicht diskreter?«, fragte Serra und wandte sich dabei auch an Miguel Duarte.
»Wir können sie abgedeckt in einem Anhänger zu dem Ferienhaus bringen lassen, das sie betreut hat. Und der Rettungswagen kann sie dort abholen. Weniger Aufsehen nützt doch bestimmt auch der weiteren Ermittlung!«
Er sah an Carlos vorbei zu Graciana, die nickte: »So machen wir das.«
»Muito obrigado«, sagte Serra, »muito, muito.«
»Ja, ist gut jetzt«, erwiderte Carlos.
»Senhor Serra?«, wandte Graciana sich an ihn.
»Sim?«
»Das Gelände ist doch sicherlich mit Überwachungskameras ausgestattet?«, fragte die Inspetora.
»Natürlich. Da oben an den Wegen, also an allen Wegen. Und quasi sternförmig um das Hauptgebäude und …«
Sie unterbrach ihn mit einem Räuspern: »Ich benötige einen Plan des Geländes samt der Gebäude mit den Standorten der Kameras plus deren Aufzeichnungswinkel.«
»Besorge ich Ihnen.«
»Und den Namen und die Kontaktdaten des Besitzers der Villa Ria, por favor.«
Serra nickte und zückte sein Handy.
Während der Leichnam von Karen Riemann auf einen Anhänger geladen und abgedeckt wurde, marschierte Serra mit steifen Schritten auf und ab und gestikulierte beim Sprechen mit der freien Hand.
Die Bewegungen folgten keinem einheitlichen Muster, wie Lost analysierte.
Marcos Serra beendete sein Telefonat und trat diensteifrig an Graciana heran: »Der deutsche Besitzer heißt Winfried Jensen.«
»Gut, ich brauche seine Kontaktdaten. Gehen wir rüber zu der Villa Ria – Senhor Serra, kommen Sie bitte mit«, sagte Graciana.
»Ich besitze keine Schlüssel für das Haus.«
»Das kriegen wir hin«, beruhigte Carlos Esteves ihn.
Während sie an dem künstlichen See und den »Bunkern«, den ausgehobenen und mit Sand gefüllten Hindernissen, vorbeigingen, nahm Graciana den Kollegen Miguel Duarte beiseite.
»Ich hab da eine Kopie eines Schreibens von dir bekommen.«
Duarte nahm Haltung an, Schultern gerade, Kreuz durchgedrückt, Körperspannung. Eine der ersten Lektionen seines Vaters, des großen Toreros, der seine Söhne mit Unerbittlichkeit erzogen hatte.
»Und?«
»Und?«
Graciana war relativ klein. Große Augen, ein symmetrisches Gesicht mit weichen Zügen, das sich sehr energisch und unnachgiebig zeigen konnte – so wie jetzt.
»Spiel kein Spielchen mit mir, Miguel.«
Sie war nun stehen geblieben und er notgedrungen auch.
»Dein Schreiben nach Lissabon – ans Innenministerium.«
»Ach, das.«
»Ja, das.«
»Das ist natürlich ein heikles Kapitel.«
»Nein, heikel ist das eigentlich nur für dich, Miguel.«
Sie bedachte ihn mit einem durchdringenden Blick. Ihr Gesicht wirkte wie eingefroren. Duarte zögerte nur einen kurzen Moment, dann schenkte er ihr ein überlegenes Lächeln, das er bis zur Perfektion vor dem heimischen Spiegel eingeübt hatte.
»Es ist nichts gegen Senhor Lost persönlich, nur, damit du das weißt, Graciana. Ich will mich gar nicht darüber auslassen, dass er für den Polizeidienst nicht geeignet ist.«
»Das heißt, sein fotografisches Gedächtnis und seine analytischen Fähigkeiten waren bei der Lösung unserer Fälle nicht dienlich? Er war da ungeeignet?«
Duarte seufzte.
»Was ist, wenn er einen Schwerverbrecher über den Verbleib einer Zeugin nicht professionell anlügt, sondern deren Aufenthaltsort preisgibt? Was ist, wenn er eine subtile Warnung nicht korrekt versteht? Was ist, wenn ein Krimineller sein Aussehen so verändert, dass du und ich ihn zwar erkennen würden, aber Senhor Lost nicht, weil er dessen Gesichtsmerkmale nicht mehr eindeutig dechiffrieren kann, hm? Das sind lauter Risiken, die nicht nur ihn allein gefährden, sondern auch uns, seine Kollegen. Und unbeteiligte Dritte. Ich weiß, ich weiß, ich mache mich unbeliebt …«– zumindest in diesem Punkt stimmte Graciana ihm stumm zu – »… aber ich habe das Innenministerium darauf hingewiesen, dass Losts weitere Verwendung als Polizist vielleicht einmal Menschenleben kosten kann.«
Graciana Rosado nickte. »Deine Umsicht und Sorge um deine Mitmenschen ist löblich, Miguel«, sagte sie, und es kostete sie viel Willenskraft, diese Worte auszusprechen, »aber in Zukunft hältst du bitte den Dienstweg ein. Du kommst mit deinem Anliegen zu mir. Und schreibst nicht Beschwerden an mir vorbei.«
»Das hätte ich natürlich getan, wenn du nicht befangen wärst.«
»Ich bin befangen?«
»Ich bitte dich. Er ist mit deiner Schwester zusammen. Es heißt, sie wollen noch dieses Jahr heiraten. Natürlich bist du befangen. Der Umstand, dass du das nicht siehst, beweist eigentlich nur, wie sehr es zutrifft. Und wie richtig es von mir war, mich deshalb mit dem Wunsch direkt ans Innenministerium zu wenden, diesen Gestörten aus der Truppe zu entfernen.«
Im Hause Rosado, ihrem Elternhaus in Fuseta, wurde großen Wert auf Gerechtigkeit gelegt. Ihre Mutter hatte ihr das auf vielerlei Art in die Wiege gelegt, etwa, indem sie die Nachbarskinder alle gleich behandelte: sowohl die, die sie mochte, wie die, die sie weniger leiden konnte.
Und ihr Vater, ehemals Chef der GNR in Moncarapacho, bevor eine Kugel seine Wirbelsäule durchschlug und ihn in den Rollstuhl zwang, war ein Mann, dessen Rat die Leute suchten. Dabei war er kein Intellektueller, kein Bücherwurm, nur ein Mann, der gut zuhörte und sich Gedanken machte. Und dem ein untrüglicher Sinn für Gerechtigkeit innewohnte, ganz so, als habe sich bei ihm im Gegensatz zu anderen Menschen noch ein weiteres, unsichtbares Organ entwickelt.
»Pai, was ist Gerechtigkeit?«, hatte sie ihn als Kind gefragt, als sie ihn mit ihrer Mutter und ihrer Schwester auf dem Polizeiposten abholte. Sie erinnerte sich noch genau daran. An sein kleines Büro mit den knarzenden Holzdielen und dem Kühlschrank, in dem es immer eine Süßigkeit für die Töchter gab. Es roch nach Putzmitteln und Holz. Je länger die Sonne auf die Dielen geschienen hatte, desto intensiver der Geruch.
»Ja!«, hatte die kleine Soraia mit ihren Grübchen gesagt und hoffnungsvoll gegrinst: »Wenn wir beide ein gleich großes Stück Pastel de Nata bekommen oder jede eines.«
Die Uniform imponierte Graciana und seine riesigen starken Hände, die so behutsam und sanft sein konnten, wenn sie ein Kätzchen aufhoben. Sie kannte das Wort damals dafür noch nicht, aber sie hatte ein gutes Gespür dafür, wie die Leute ihm begegneten: mit Respekt.
Er ging vor ihr in die Hocke und musterte sie mit einem liebevollen Lächeln.
»Gerechtigkeit«, sagte er, »ist das Recht des Schwächeren, Grace.«
So klein sie damals noch war, so gut erfasste sie doch, dass dies eine tiefe Überzeugung ihres Vaters war, durch die er die Welt und sein Leben ordnete. Er hatte sich dafür entschieden, dass die Stärkeren die Schwächeren nicht herumschubsen durften. Das war einer seiner Grundsätze. Und das war wiederum einer der Gründe, warum so viele Menschen in Fuseta ihm vertrauten und seinen Rat suchten. Wenn es ein Problem zwischen zwei Nachbarn gab, einen Streit in einer Kneipe oder gar eine Familienfehde, rief man ihn, damit er vermittelte. Er tat das mit kühlem Kopf, ruhiger Stimme und einem verständigen Blick. Es gab wenige Streitigkeiten, die von António Rosado nicht mittels eines Gesprächs gelöst werden konnten.
Während jemand wie Carlos Esteves einem Streit eher nicht aus dem Weg ging, focht António Rosado es nur aus, wenn es darauf ankam.
Am 23. Juni 2011 kam es darauf an. Nach einem Überfall auf einen Werttransporter stellte er sich fünf Kriminellen entgegen, die ihm rieten, lieber nach Hause zu gehen. Was er nicht tat.
Gracia dachte an Leander Lost und musste lächeln. Er bemühte sich – und das mit großem Erfolg – Tag für Tag, ein wertvolles verlässliches Mitglied der Polícia Judiciária in Faro zu sein. Und sicher: Es gab immer noch ein paar kleine Defizite. Aber die stufte sie mit Blick auf seine Ermittlungserfolge als unerheblich ein. Ganz abgesehen davon: Jedem von ihnen unterliefen schließlich Fehler.
Sich hinter Leanders und ihrem Rücken um dessen Suspendierung aus dem Team beim Innenministerium zu bemühen, erschien ihr als eine massive Ungerechtigkeit, die ihr die Tränen in die Augen trieb. Vor allem, weil Lost sich nicht mal dagegen zur Wehr setzen konnte.
Duarte, der ihre Reaktion erfasste, blinzelte kurz und bestrich unbewusst mit der Zunge seine Unterlippe.
»Lost ist nicht gestört«, sagte sie entschieden.
»Nein? Ist das nicht etwa eine Störung, sein Hau?«
»Du weißt, was ich meine – als deine Vorgesetzte sage ich dir: Du redest in Zukunft nicht mehr so abfällig über deinen Kollegen. Das ist eine dienstliche Anweisung, Miguel.«
»Aber wenn …«
»Leg dich nicht mit mir an.«
Kurz maßen sich ihre Blicke, dann lächelte Miguel Duarte plötzlich und nickte: »Natürlich nicht.«
Damit ließ er sie stehen und folgte den anderen zur Villa Ria.
Graciana war vollkommen klar, dass es ihm am Ende überhaupt nicht um Leander Lost ging. Für Duarte war die Algarve einfach zu provinziell. Er hatte sich mehrfach bemüht, zur Kripo nach Lissabon versetzt zu werden. In die Hauptstadt, oder wie er es ausdrückte: in die Zivilisation. Und als schließlich bei ihnen hier in der Polícia Judiciária eine Beförderung anstand, die sein Leid wenigstens ein kleines bisschen geschmälert hätte, beförderte man nicht ihn, sondern stattdessen jemanden, den er für inkompetent hielt: sie.
Sein Ersuchen, Leander aus dem Polizeidienst entfernen zu lassen, richtete sich nicht in erster Linie gegen den Alemão. Es richtete sich gegen sie. Es sollte die zuständige Stelle im Innenministerium dazu animieren, sich Gedanken um die Eignung von Inspetora Graciana Rosado für ihren Posten zu machen.
3.
Der Löwe im Winter.
Das gefiel ihm. Das passte. Passte und war ihm ein Trost.
Es war ein Film, der zusammen mit anderen DVDs im Bücherregal des Ferienhauses stand und sich ihm eingeprägt hatte.
Ulisses Cruz lächelte die Decke an. Er lag splitternackt im Bett, gleichermaßen erhitzt wie ermattet von dem Schäferstündchen mit Sol, die warm und weich neben ihm lag und deren Brustkorb sich noch in schneller Frequenz hob und senkte.
Vom Haus aus konnte man den Berg hinab über ein zersiedeltes Gebiet bis zum Atlantik blicken, in dessen tiefem Blau sich das Sonnenlicht reflektierte. Er liebte den Ausblick, und kurz kam ihm der Gedanke, wie es wohl gewesen wäre, wenn Sol und er sich so ein Haus gekauft und dort ein relaxtes Leben geführt hätten.
Um dann sofort den Kopf zu schütteln.
Nein. Stillstand lag ihm nicht, er entsprach nicht seinem Naturell. Er wäre vor Langeweile in seinem Ohrensessel gestorben. 49 war noch kein Alter für so einen Lebensstil. Wahrscheinlich würde er nie alt genug werden dafür.
Sol schwang sich aus dem Bett und ging rüber zu der Küchenzeile. Ihr Gang war geschmeidig und federnd. Nächstes Jahr würde sie vierzig werden. Ulisses hatte sie schon oft so gesehen, unzählige Male an unzähligen Orten. Und doch weckte es immer wieder seine Lust, sie nackt zu sehen. Sie trug die Haare kurz und struppig, am linken Arm zog sich ein heller, tiefer Strich. Die Narbe stammte von einem Streifschuss. Salamanca, 2018.
Sie kam mit einer roten Tonschale voll Nachos und ziemlich scharfer Soße zurück und begann, ihn damit zu füttern.
»Ich hab die Pille abgesetzt«, sagte sie und grinste breit, als habe sie ihm einen Streich gespielt.
Ulisses lächelte nicht. Vielmehr erstarrte er. Und mit jeder Sekunde, die er nicht lächelte, verschwand Sols eigenes Lächeln.
Er stand auf. Rieb sich die kräftigen Schultern und den Bauchansatz.
»Es ist die falsche Zeit.«
Sol setzte sich aufs Bett und legte die Tagesdecke über ihre Schultern, als wäre ihr kalt.
»Ich hab nicht mehr viel Zeit – wir.«
»Ja.«
Sie las das Aber in seiner Miene.
»Aber?«
Wenigstens wich er ihrem Blick nicht aus. Und in seinem lag so was wie Wehmut.
»Vielleicht ist es besser, wir gehen danach getrennte Wege«, sagte er ruhig. Mit dem typischen Bass in seiner Stimme, bei dem sich manchmal immer noch ihre Nackenhaare aufrichteten.
Ihr stiegen Tränen in die Augen. Sol biss sich auf die Unterlippe, damit sie ihr nicht über die Wangen liefen.
»Du hast es nie gesagt …«
»Nein«, bestätigte er und zündete sich eine Zigarette an.
»Aber du weißt doch, dass ich es mir so wünsche …«
Er nickte, setzte sich neben sie und fuhr ihr zärtlich mit der Hand über den Nacken, gab ihr einen Kuss auf den Hals. Dann schaute er ihr fest in die Augen.
»Ich bin nicht dafür gemacht, Sol. Ich wollte, ich wäre es. Für dich. Ein Mann, der sesshaft werden kann. Ein kleines Häuschen, so wie das hier, baden gehen und sich nur überlegen müssen, was man abends isst und … ja … all das eben, du weißt schon.«
Ja, wusste sie. Sol nickte.
»Was ist so schlimm daran?«, fragte sie leise, es war ein Flüstern.
Er schenkte ihr ein ebenso trauriges wie entwaffnendes Lächeln: »Nichts, Sol. Nichts daran ist falsch. Aber es ist nicht mein Weg. Ich bin nicht der Mann dafür. Ich werde nicht sesshaft. Ich werde nie Tomaten züchten oder sonntags den Wagen waschen. Ich hab geglaubt, ich könnte das für dich sein, aber es … es wär eine Lüge.«
»Aber … wir können doch anders leben. Die Orte wechseln«, sie lachte jetzt, »uns wird doch nicht langweilig.«
Ulisses Cruz nickte wie jemand, den es schmerzte, jemanden verletzen zu müssen: »Ich will kein Kind, das irgendwann ohne Vater aufwachsen muss. Gleichzeitig möchte ich, dass du glücklich bist. Dein Kind braucht einen anderen Vater.«
Seine Worte trafen Sol Pinho tief und zerstörten unwiderruflich etwas in ihr.
Sie machten all die wertvollen Momente zwischen ihnen in einem Sekundenbruchteil zunichte. Jeder zärtlichen Geste wohnte von nun an eine Berechnung inne. Ulisses’ Zurückweisung war wie eine Betäubung für sie. Alles erreichte sie nur noch dumpf und von weither.
Doch sie riss sich zusammen und bewahrte Haltung.
»Gut, wenn es nicht passt, passt es nicht. Du hast recht, und … ich hätte es wissen müssen.«
Er nickte dankbar und griff nach ihrer Schulter, doch sie entzog sich der Berührung wie eine Katze, die einfach darunter wegtauchte.
Ulisses Cruz ließ die Hand sinken.
Ihre Reaktion beeindruckte ihn.
»Wir machen diese Sache gemeinsam, danach gehe ich.«
Sol Pinho stand auf und sammelte mit ein paar Handgriffen ihre Kleider auf.
»Ich nehme das freie Schlafzimmer im ersten Stock«, sagte sie kühl. Dann ging sie hinaus und quer durch das große Wohnzimmer, in dem Ulisses’ jüngerer Bruder César gerade die Sturmgewehre reinigte und ölte.
Sol verdeckte mit ihren Kleidern zwar das Nötigste, als sie wortlos die Treppe hinaufging, aber César Cruz konnte den Blick trotzdem nicht von ihr lösen.
Von den Frauen, die Ulisses ein Stück auf seinem Weg begleitet hatten, war sie zweifellos die betörendste.
4.
Als der Rettungswagen mit der toten Deutschen ohne Blaulicht und – noch wichtiger – ohne Sirene das Gelände des Monte Rainha verließ, bekreuzigte sich Marcos Serra.
Weil das Innere des Hauses ein möglicher Tatort war, musste er draußen bei offener Tür auf der Terrasse warten. Drinnen sahen sich Graciana Rosado, Carlos Esteves, der Deutsche im schwarzen Anzug und Miguel Duarte näher um.
Das Interieur war recht übersichtlich und verriet nichts über seinen Besitzer, denn es wirkte unpersönlich.
Doch auch von der Toten fand sich nichts: Kein Handy, keine Handtasche, nicht mal ein Schlüsselbund.
Carlos’ Magen knurrte, und er warf einen Blick in den Kühlschrank. Nur mal so. Es gab ein paar Aufmerksamkeiten in Form von Wasser, Wein und zwei Bieren. Aber nichts zu essen.
»Ich möchte, dass Sie sich jeden Raum genau ansehen, Senhor Lost«, sagte Graciana zu Leander. Mittlerweile war das ihr Standardvorgehen an Tatorten, denn egal, was später verändert oder gar vernichtet wurde – über Losts fotografisches Gedächtnis hatten sie stets Zugriff auf den ursprünglichen Zustand.
Carlos’ Blick wanderte durch das Fenster hinüber zu dem Hauptkomplex mit dem Restaurant. Dann wandte er sich an Duarte, der vor einem Gemälde stand, das einen Stierkampf zeigte. Natürlich.
»Du kennst das hier, Miguel?«
Der gebürtige Spanier wurde durch die Frage des Kollegen aus seinen Gedanken gerissen. »Wie bitte?«
»Das Gelände. Du kennst es.«
»Ja. Ich spiele hier manchmal.«
Carlos nickte, weil das ins Bild passte.
»Das Restaurant da, kannst du das empfehlen? Haben die was zum Mitnehmen?«
»Das O Céu hat einen Michelin, Esteves. Und«, schob er mit einem larmoyanten Lächeln hinterher, »damit ist kein Reifen gemeint. Die haben nichts zum Mitnehmen. Und außerdem …«
»Ich störe nur ungerne«, unterbrach Graciana ihn und trat dabei an die beiden heran: »Riemann. Wann war sie hier? Gestern? Heute? Arbeitet sie alleine? Für eine Agentur? Wenn ja, welche? Wird sie vermisst? Wo wohnte sie?«
»Ich telefonier mal rum«, antwortete Duarte, zückte das neueste iPhone-Modell und ging hinaus zum Pool.
»Die Agentur, die das Haus betreut, heißt Heavenly Places«, sagte Leander, der in der Tür zur Küche stand. Er hatte sich Einweghandschuhe übergezogen und hielt einen Ordner in den Händen, der Hinweise für die Besucher enthielt: Telefonnummern, Restaurants, Sehenswürdigkeiten, die nächste Klinik und vieles mehr.
»Sie befindet sich in der Rua 25 de Abril, in Cabanas.«
Cabanas. Das war ein Vorort von Tavira in Richtung Osten. Am Wasser gelegen. Mit Neubaugebieten und Ferienresorts. Und fest in britischer Hand.
»Da ist noch ein Name«, fuhr Lost fort, »Karen Riemann und Maja Witt.«
»Wir drei fahren hin«, entschied Graciana. »Miguel bleibt hier und wartet auf die Spurensicherung.«
In dem Augenblick knisterte der Funk an Carlos’ Gürtel.
»Carlos?«
Das war Toninhos Stimme. Während Carlos Esteves das Funkgerät in die Hand nahm, schaute Graciana auf ihre Armbanduhr: Stimmt, er hatte gerade seine Probeschicht bei der GNR in Moncarapacho begonnen. Es war 18:04 Uhr.
»Ja? Was gibt’s? Warum bist du nicht bei …«
»Hier ist gerade ein Notruf reingekommen«, unterbrach Toninho ihn hastig. »Von einem Sicherheitsunternehmen: Bilt. Die haben von ihrem Werttransporter ein Notsignal reinbekommen, aber die Fahrer melden sich nicht.«
»Wo?«, fragte Carlos knapp und folgte Graciana, die schon losgerannt war, hinaus zu den beiden Männern.
»Senhor Serra, Sie warten hier, bis die Spurensicherung eintrifft, und rühren nichts an und lassen niemanden rein – Miguel, komm mit.«
5.
Es war exakt 17:48 Uhr, als César mit dem Lieferwagen von der Nationalstraße 125, kurz: N 125, in Höhe eines Supermercados nach rechts Richtung Norden abbog und dem Werttransporter der Firma Frederic Bilt folgte.
Gepanzert, mit Sehschlitzen, kugelsichere Scheiben.
César trug wie Ulisses eine Sonnenbrille, was gerade jetzt, da die Sonne tief im Westen stand und die Autofahrer blendete, ganz natürlich wirkte.
Links von ihnen zogen ein paar typische, einstöckige Häuser mit roten Tonziegeldächern vorbei, danach folgten auf beiden Seiten Felder mit Oliven- und Feigenbäumen im Wechsel mit Orangen- und Zitronenplantagen. Auf einigen wurde gerade geerntet.
César blickte zu den Plantagenarbeitern hinüber, musterte ihre dürren Gestalten und die Schweißflecken auf der Rückseite ihrer T-Shirts und Hemden. Er schüttelte den Kopf: »Trottel.«
Ulisses brummte Zustimmung. Er wählte über sein Handy Sols Nummer, die ungefähr einen Kilometer weiter nördlich in einem Kombi in einer Seitenstraße auf sie wartete.
»Sim?«
»Noch achthundert Meter. Ist kein Wagen vor ihm.«
Klack.
Sie antwortete nicht einmal, sondern unterbrach einfach die Verbindung.
Da sie mit dem Lieferwagen jetzt in eine lang gezogene Kurve fuhren, konnte César an dem Bilt-Fahrzeug vorbei auf den weiteren Straßenverlauf schauen. Tatsächlich bog rund dreihundert Meter weiter der Kombi von rechts auf die Straße und setzte sich so vor den Werttransporter, der sich nun zwischen ihnen befand.
Ulisses Cruz zündete sich eine Zigarette an und inhalierte den Rauch. Er sah auf die Landschaft, die rechts an ihm vorbeizog. Bäume, Einmündungen, Häuser, Palmen, ein paar Wolken am Himmel, alles verwischte zu horizontalen Streifen. Die Formen lösten sich auf und zerflossen. Alles verlor seine Gestalt. Wie ein Leben, das zu schnell vorbeizog.
Er riss sich davon los und kontrollierte die Uhrzeit. Dann wählte er die Nummer des »Boten«.
Der wiederum wartete weiter nördlich an der Ausfallstraße, die von der nächsten Ortschaft hoch zum Autobahnanschluss führte, über den man in null Komma nichts an der spanischen Grenze war.
Er saß in einem Fahrzeug von Hermes, das der Kurierdienst eigentlich ausgemustert hatte. Es war frisch lackiert, und der Bote steckte in einer passenden Uniform. Von hier führte ein Weg an einer karminroten Mauer entlang zu einem offiziellen Gebäude. Ganz so, als hätte er dort gerade etwas abgeliefert. Niemandem würde das Fahrzeug zu dieser Zeit und in dieser Zufahrt in irgendeiner Weise auffallen.
»Fahr los«, wies Ulisses ihn lediglich an, um die Verbindung auch schon wieder zu beenden und nun den dritten Akteur ins Spiel zu bringen: den Monteur.
Ein Polizeiwagen der GNR kam ihnen mit hoher Geschwindigkeit entgegen – mit Blaulicht und Sirene. Am Steuer ein auffallend attraktiver Beamter und daneben eine GNR-Polizistin, die ihre Fingernägel überprüfte.
Der Monteur. befand sich bereits an einer Kreuzung in dem Ort, den sie bald durchqueren würden, unbemerkt von den Leuten, unten in der Kanalisation. Über ihm rauschte der Verkehr entlang und so spürte er nur das Vibrieren des Smartphones, denn er hatte es stumm geschaltet.
»Sim.«
»Zwei Minuten.«
»Claro.«
Nach dem Passieren des Ortsschildes machte die Straße noch einen letzten Schlenker, vorbei an einer mannshohen, weiß gekalkten Mauer, die oben abgerundet war. Dann folgte ein gerader Abschnitt – und eine Kreuzung mit einer Ampel. Es war die einzige im ganzen Ort. Und sie war grün.
Sol Pinho steuerte darauf zu. Ihr kam der Transporter von Hermes entgegen, der die Kreuzung überquerte und recht genau fünf Meter nach der Ampel stoppte. Warnblinker. Der Fahrer sprang mit einem Paket heraus und ging damit zu einem der Hauseingänge.
Die Ampel sprang auf Rot.
Sol bremste ab und stoppte den Wagen haargenau so, wie sie es mit Ulisses geprobt hatte. Der rechte Außenspiegel musste sich auf einer Höhe mit einer Türklinke der Nummer 61 befinden. Wie jetzt.
Sie blickte in dem Innenspiegel auf den Werttransporter, der nun mit etwa einem Meter Abstand hinter ihrem Kombi ebenfalls anhielt.
Ideal.
Ulisses hatte dafür gesorgt, dass aus einer Menge Variablen in dem Plan Konstanten geworden waren, die die Unwägbarkeiten seines Plans minimierten.
Der Abstand, mit dem der Transporter von Bilt hinter ihr zum Stehen kam, gehörte zu den Faktoren, die sich nicht beeinflussen ließen.
Aber der eine Meter spielte ihnen in die Hände – und konkret nun dem Monteur, dessen Smartphone in genau dem Moment vibrierte, in dem der Transporter zum Stehen kam.
»Jetzt«, gab Ulisses durch.
Der Monteur stemmte sich mit den Armen von unten gegen den sicher 40 Kilo schweren Gullydeckel und wuchtete ihn hoch.
Ein unterdrückter Seufzer, dann hatte der ihn heraus gewuchtet und vorsichtig zur Seite geschoben. Es war, als stünde Nuno, so sein richtiger Name, unter einer fahrbaren Schildkröte, die an allen Seiten gepanzert war.
Er musste sich beeilen und griff zu der Apparatur: einem elektrischen »Zerstäuber«, nichts weiter als eine schmale Metallflasche mit Spühverschluss, kombiniert mit einem Empfänger samt kleiner Antenne. Er legte sie unter dem Transporter auf dem heißen Asphalt ab, dazu zwei halbe Rohrschellen, an denen schon das Gaffertape befestigt war, das über ihre Enden hinausragte.
Die Ampel sprang auf Grün.
Sol Pinho drückte den Knopf der Warnblinkanlage.
Sie beobachtete, wie der Fahrer des Werttransporters hinter ihr auf die Gegenfahrbahn blickte, um an ihrem Kombi, der offenbar eine Panne hatte, vorbeizufahren. Die beiden Wachmänner hinter der Windschutzscheibe wirkten relativ jung. Sie trugen dunkelblaue Uniformen mit dem Logo von Bilt.
Aber der Hermes-Transporter blockierte die andere Seite, sodass für sie kein Vorbeikommen war. Der Fahrer ließ die Seitenscheibe herunterfahren und rief zu dem Boten hinüber – zu Ricardo, der ihm mit einem lässigen »Paciência, paciência« antwortete, aber gleichzeitig mit einer alten Frau sprach, die ihm die Tür geöffnet hatte.
Sol musste schmunzeln – Ricardo würde erst seinen Wagen wegfahren und damit die Spur wieder freigeben, wenn Nuno, der Monteur, unter ihnen seinen Job erledigt hatte.
Der schickte wiederum eine vorbereitete Textnachricht an Ulisses, der das Jetzt auf dem Display las und daraufhin César zunickte.