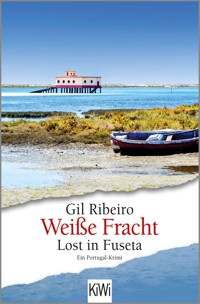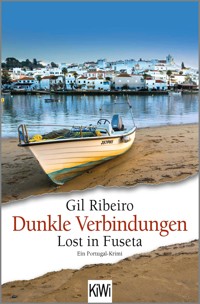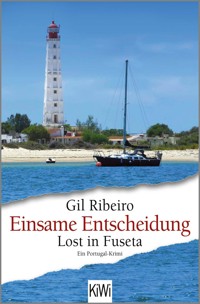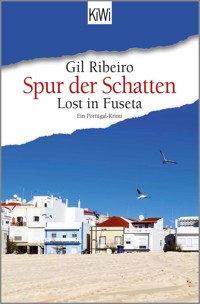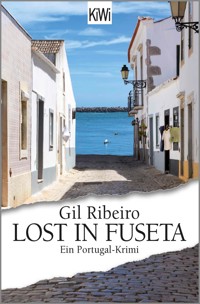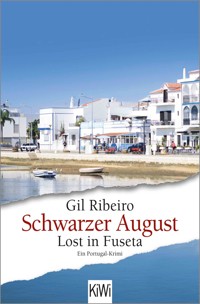
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Leander Lost ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein raffinierter Bombenleger versetzt die sonnenverwöhnte Algarve in Angst und Schrecken – doch Leander Lost ist ihm auf der Spur! Ganz Fuseta freut sich: Leander Lost, der so ungewöhnliche wie liebenswerte Austauschkommissar aus Deutschland, darf weiter in Diensten der portugiesischen Polícia Judicária ermitteln. Die sommerliche Idylle wird jedoch jäh gestört, als im Hinterland eine Autobombe explodiert und eine Bankfiliale in die Luft jagt. Nur Tage später explodieren drei Thunfisch-Trawler im Hafen von Olhão. Wer ist der raffiniert vorgehende Bombenleger, der mit verschlüsselten Bekennerschreiben Katz und Maus mit den Ermittlern spielt? Mit portugiesischer Menschenkenntnis und Leanders Kombinationsgabe kommen Graciana Rosado, Carlos Esteves und Leander Lost dem Täter Schritt für Schritt auf die Spur. Doch was steckt hinter den mysteriösen 40.000 US-Dollar einer Immobilienmaklerin, die bei der Explosion in die Landschaft flatterten? »Schwarzer August« ist der vierte Fall für Leander Lost – eine einzigartige Mischung aus Spannung, Humor und Liebe zum sonnigen Portugal. Tauchen Sie ein in die atemberaubende Kulisse der Algarve und begleiten Sie Leander Lost bei seiner nervenaufreibenden Jagd nach dem Bombenleger! Die Krimis mit Kommissar Leander Lost sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Lost in Fuseta - Spur der Schatten - Weiße Fracht - Schwarzer August - Einsame Entscheidung - Dunkle Verbindungen - Lautlose Feinde (erscheint im April 2025, schon jetzt vorbestellbar)Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Gil Ribeiro
Schwarzer August
Lost in Fuseta
Ein Portugal-Krimi
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Gil Ribeiro
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Gil Ribeiro
Gil Ribeiro, geboren 1965 in Hamburg, landete 1988 während einer Interrail-Reise quer durch Europa nur dank eines glücklichen Zufalls an der Algarve und verliebte sich umgehend in die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Portugiesen. Seitdem zieht es ihn immer wieder in das kleine Städtchen Fuseta an der Ost-Algarve, wo ihm die Idee zu »Lost in Fuseta« kam. In seinem deutschen Leben ist Gil Ribeiro alias Holger Karsten Schmidt seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten Drehbuchautoren Deutschlands: Anfang 2020 erschien sein Kriminalroman »Die Toten von Marnow«, der 2021 in der ARD als Mini-Serie zu sehen sein wird, bei Kiepenheuer & Witsch. Holger Karsten Schmidt lebt und arbeitet bei Stuttgart.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Es ist Hochsommer in Fuseta, dem kleinen Fischerort an der Algarve. Nach dem für Leander Lost und sein Team erfolgreichen Schlag gegen einen spanischen Drogenboss ist Soraia Rosado endlich zu Leander in die Villa Elias gezogen. Die beiden genießen ihre Zweisamkeit, die sternenklaren Sommernächte bei einem Glas Vinho Verde am Pool und lernen, was es bedeutet, als Aspie und Normalo zusammenzuleben. Doch die sommerliche Idylle wird jäh gestört, als im Hinterland eine Autobombe explodiert und eine Filiale der Crédito Agrícola in die Luft jagt. Der Spanier im Team, Miguel Duarte, ist überzeugt: Nun ist der islamistische Terror auch in Portugal angekommen. Doch warum explodieren zwei Tage später drei Thunfisch-Trawler im Hafen von Olhão? Und was hat es mit den 40.000 US-Dollar einer Immobilienmaklerin aus Vale de Lobo auf sich, die bei der Explosion der Bankfiliale in die Landschaft flatterten? Graciana Rosado, Carlos Esteves und Leander Lost stehen vor einem Rätsel. Wer ist der raffiniert vorgehende Bombenleger, der mit verschlüsselten Bekennerschreiben Katz und Maus mit ihnen spielt? Zug um Zug kommen sie mit portugiesischer Menschenkenntnis und Leanders Kombinationsgabe dem Täter und seinen Motiven auf die Spur. Und Leander muss sich entscheiden, wie viel sein Leben im Vergleich zu dem eines Kollegen wert ist.
Hinweis für E-Reader-Leserinnen und -Leser
Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:
www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karten-zu-schwarzer-august
Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer
Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
TAG EINS
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
TAG ZWEI
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
TAG VIER
9. Kapitel
10. Kapitel
TAG FÜNF
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
TAG SECHS
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
TAG SIEBEN
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
TAG ACHT
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
EPILOG
Leseprobe »Lautlose Feinde«
Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun,
sondern auch für das, was wir nicht tun.
Molière
TAG EINS
1.
In dem Feuerwerk bildeten Soraias Grübchen und ihre Sommersprossen die einzigen Fixpunkte. Sie gaben ihm Halt, er musste nicht nach Ecken Ausschau halten, die sonst seinen Puls beruhigten. Denn Leander Losts Puls raste. Und die Sommersprossen – es waren 47, im Sommer wie jetzt ausgeprägt, im Winter blasser – und die Grübchen bildeten den festen Rahmen, in dem sich das Feuerwerk vollzog.
In Soraias Gesicht nämlich. Ein Gewitter an Mikroexpressionen, über die sie wie jeder Mensch keinerlei Gewalt hatte, da sie die Mimik beherrschten, bevor das Bewusstsein wieder die Kontrolle darüber übernahm. Aber Soraia hatte nicht die Absicht, ihre Gefühle zu verbergen. Sie gab sich dem Genuss hin, und Leander bot sich jenes Feuerwerk aus Gefühlen, das niemals dem vorherigen glich. Jedes ein Unikat.
Für Leander war es, als könnte er fliegen: die Schwingen ausbreiten und segeln. Und dabei trotzdem überall Berührungspunkte mit Soraia haben und ihren Geruch einatmen. Wenn er seine Nase in ihren Hals vergrub, atmete er eine unaufdringliche Mischung aus Paprika und Lavendel.
Soraia wurde nicht müde, Leander dicht bei sich zu haben. Sein sinnlicher Mund, die langen Wimpern, die feingliedrigen Finger – und wenn sie sich so wie jetzt liebten: das kindliche Staunen, mit dem er sie betrachtete. Wie ein Neugeborenes, das überrascht einen ersten Blick in die Welt warf.
So pur und unschuldig, dass sie es um jeden Preis schützen wollte.
Danach lagen sie ermattet unter dem Moskitonetz, das zusammengerollt von der Decke baumelte, und strichen mit den Händen in sanften Bahnen über die Haut des anderen.
»Du riechst nach Sandelholz«, flüsterte Soraia.
Eine Meeresbrise fächerte durch das kleine Schlafzimmerfenster in den Raum und brachte die Morgenluft zum Tanzen. Es war der erste Sonntag im August, und die 23 Grad morgens um halb acht, die an der gesamten Ostalgarve herrschten, ließen für den Tag Temperaturen über dreißig Grad erwarten.
»Das sind die Pheromone«, erklärte Leander, »unsere Zuneigung ist das Produkt eines chemischen Prozesses.«
Soraia, die noch halb in seinem Arm lag, küsste ihn auf die Schulter. »Mein Romantiker«, sagte sie leise und lächelte.
Am liebsten wäre sie den ganzen Sonntag mit ihm hier liegen geblieben. Sie hätten vielleicht im Bett gefrühstückt, sich Dinge aus ihrem Leben erzählt, sich wieder geliebt, wären ein paar Runden im Pool geschwommen, Arm in Arm auf einem der Liegestühle eingeschlafen. So in etwa.
Denn seit knapp einer Woche war das im Großen und Ganzen ihr Tagesablauf. Vor sieben Tagen hatten sie sich in die Villa Elias zurückgezogen, das Telefon ausgestöpselt und die Handys in die Schublade neben der Eingangstür verfrachtet (vermutlich waren ihre Akkus längst leer). Sie hatten den Rest der Welt hinter sich abgeschlossen und nichts anderes getan, als den lieben langen Tag ihre Zweisamkeit zu genießen. Sich anzuschauen und in der Miene des anderen die eigene Ungläubigkeit darüber zu entdecken, dass dies alles gerade zwischen ihnen stattfand. Gegen jedes Gebot von Wahrscheinlichkeit und Glück.
Am sechsten Tag kamen zwei Jungs um die zehn Jahre mit frischen Sardinen vorbei, die sie in aller Bescheidenheit als die besten der Welt anpriesen. Sie transportierten einen Plastikeimer voller frisch gefangener Exemplare auf ihren rostigen Rädern von Haus zu Haus. Lachend und mit großen Augen präsentierten sie die kleinen Fische und verlangten für zehn Stück vier Euro, was von einem guten Geschäftssinn zeugte. Soraia lachte und gab ihnen fünf Euro.
»Obrigado, obrigado!«, riefen sie noch bis zur nächsten Biegung des Feldwegs.
Allerdings gab es in der Villa Elias keine einzige Zitrone mehr, wie Soraia und Lost feststellten – obwohl Leander Lost über eine bestens organisierte Vorratshaltung verfügte. In Fuseta munkelte man, der Alemão sei für einen nuklearen Winter gerüstet. Wie dem auch sei: Gegrillte Sardinen ohne ein paar Spritzer Zitrone waren selbstverständlich undenkbar. Aber es gab ja Zara. Sie ersparte Soraia und Leander den Weg nach Fuseta.
Auf dem Gelände der Villa Elias stand eine weiß gestrichene Casinha, ein Gästehäuschen, das auf zwanzig Quadratmetern einen überschaubaren Wohnraum inklusive Bett, eine Küchenzeile und ein Badezimmer beherbergte. Seit Losts erstem Fall an der Algarve wohnte die bald achtzehnjährige Vollwaise darin – und half ihnen mit Zitronen aus.
Zara lebte in Leanders Obhut, aber die Casinha war ihr Refugium, in dem er sie niemals ohne triftigen Grund behelligte – und triftige Gründe hatte es übers Jahr gezählt wenige gegeben. Manchmal aßen sie zusammen, manchmal suchte Zara auch seine Nähe, um ihn etwas zu fragen. Leander war praktisch eine wandelnde Wissensdatenbank, die täglich weiter anwuchs. Denn der Kommissar mit Asperger-Syndrom vergaß nicht.
Nie.
Zara sprach auch mit ihrem Freund über Dinge, die sie beschäftigten. Oder mit Soraia oder deren Schwester Graciana. Aber der Blick des Alemão auf die Welt, das Leben, die Menschen, auf praktisch jedes beliebige Thema, war stets ein anderer. Und stets bereichernd. Denn meist nahm jedes Thema – einmal durch Leanders Augen betrachtet – eine neue Gestalt an.
Während die Betreuer im Waisenheim ihr von morgens bis abends Vorschriften gemacht und sie damit eingezäunt hatten, trat Lost mit keiner Zehenspitze über die unsichtbare rote Linie, die sie eng um sich herum gezogen hatte. Er war nur mit ihrem Schutz beschäftigt. Und nichts sonst an ihr schien ihn zu interessieren.
Sie war damals die einzige Zeugin gewesen, die den Mörder ihrer Mutter identifizieren konnte – und deshalb in Lebensgefahr. Und sie hatte Leander Lost anfangs nicht leiden können, ja, sie misstraute ihm. Womit er keine Sonderstellung einnahm, denn zu dem Zeitpunkt misstraute sie der ganzen Welt.
»Komm ich lebend da raus, können Sie das versprechen?«, hatte sie ihn damals gefragt.
Und Leander Lost hatte in seinem schwarzen Anzug mit ihr am Pool gesessen und ein Kopfschütteln angedeutet: »Nein. Ich kann nur versprechen, dass du nach mir stirbst.«
Diese Bedingungslosigkeit hatte Zara nach und nach aus ihrem Schneckenhaus gelockt. Sie, die die Schule damals schon abgehakt hatte, stand mittlerweile kurz vor ihrem Abitur, und aus dem schreckhaften und misstrauischen Mädchen war eine selbstbewusste, empathische junge Frau geworden.
Leander und Soraia hatten Zara auf ihre Terrasse eingeladen, die im Wesentlichen aus einem großen Steintisch samt Eckbank bestand und mit hellbraunen Fliesen ausgelegt war. Sie war überdacht und bot Schutz vor Sonne und Blicken. Von hier aus waren es nur wenige Meter zu dem von blühenden Oleanderbüschen umsäumten Pool, der sich in der Länge auf zwölf Meter erstreckte. Aus der Überdachung der Terrasse lugten abends die Geckos hervor, klebten kopfüber auf Stein und Bambus und übten sich in Erstarrung. Scheinbar. Denn wenn Beute in Form eines Insekts in ihre Nähe kam, schossen sie blitzschnell vor.
Als Zara mit den Zitronen eintraf, wendete Leander gerade die Sardinen auf dem Holzkohlegrill. Es zischte.
»Ah, die Zitronen«, sagte er. »Was möchtest du trinken?«
Als sie ihn sah, fielen ihr vor Erstaunen die Früchte herunter.
Zara sammelte sie auf, als wäre nichts geschehen.
Und dann aßen sie zu dritt die Sardinen, die sie mit dem Zitronensaft beträufelten.
Tags darauf trafen die Rosados, Soraias Eltern, Zara – ganz zufällig, wie sie betonten – in der Pastelaria am Largo, wie man den kleinen zentralen Platz nannte. Was vielleicht kein allzu großer Zufall war, weil Zara dort jeden Sonntag Pastéis de nata kaufte, die kleinen Blätterteigtörtchen. Und sich noch weniger als Zufall entpuppte, weil Raquel Rosado gerade eben Conquilhas erstanden hatte, zufällig Zaras Lieblingsspeise. So frisch, dass das Salzwasser der Lagune an den Schalen der winzigen Muscheln abtropfte. Und prompt lud Raquel sie auf einen kurzen Snack ein.
Zara konnte es ihr nicht abschlagen. Für die Conquilhas von Raquel Rosado wäre sie bis zum Südpol marschiert.
Das Haus der Rosados schloss im zweiten Stock in Form einer ausladenden Dachterrasse ab, die auf einer Seite von kleinen Palmen in Trögen gesäumt wurde. Ein paar Wäschestücke wiegten sich im warmen Wind, ein Schwarm Möwen zog meckernd über ihre Köpfe hinweg, einige Haustüren weiter hörte jemand einem Tenor zu. Die winzigen Muscheln im Sud aus Öl, Weißwein, Koriander und Knoblauch waren ein Gedicht. Zara ertappte sich dabei, wie sie beim Essen seufzte.
António Rosado beugte sich in seinem Rollstuhl vor, umfasste mit seiner rechten Hand – die mühelos einen Apfel vor den Blicken Dritter verbergen konnte – die Kelle und füllte ihr nach.
»Ich bin satt.«
»Du bist ein Strich, Zara«, sagte Raquel Rosado, die entfernt an Sophia Loren erinnerte, und brachte es fertig, Sorge und Kompliment in einem Satz zu vereinen. Ihr fürsorglicher Blick wärmte Zara, obwohl sie im Schatten unter einem Segeltuch saß.
António flankierte die Aussage seiner Frau mit einem Nicken und schob ihr auch den kleinen Bastkorb mit den gerösteten Weißbrotscheiben zu.
»Na schön«, sagte Zara und benutzte eine leere Muschel als Zange, um das Fleisch aus den anderen Conquilhas zu lösen. Die Muscheln maßen kaum mehr als einen Fingernagel.
»Wie läuft es in der Schule?«, fragte António Rosado. Seine Gesichtszüge waren jetzt weich und nachgiebig, aber er konnte auch anders. Er hatte früher bei der Guarda Nacional Republicana, kurz GNR, als Leiter der örtlichen Polizeistation gearbeitet. Und sich vor sieben Jahren oben an der Nationalstraße 125 nach einem Überfall auf einen Geldtransporter allein auf weiter Flur einen offenen Schusswechsel mit den fünf Tätern geliefert. Daher der Rollstuhl.
»Ich muss mich noch in Englisch anstrengen, ich hab ja nur ein Jahr für den Lernstoff, für den die anderen zwei Jahre haben.«
Es war der Tribut an ihre Verweigerungshaltung während ihrer Monate im Heim, durch die sie den Anschluss verloren hatte.
»Und wenn du dir ein Jahr mehr Zeit nimmst?«, fragte Raquel. »Es kann doch nicht darum gehen, möglichst viel Wissen zu stapeln, hm? Es gibt ja auch noch ein Leben da draußen …«
»Ja, schon. Aber ich möchte … auf eigenen Füßen stehen. Größtmögliche Bildung bedeutet größtmögliche Unabhängigkeit.«
»Senhor Lost?«, fragte António Rosado.
Sie grinste ertappt und nickte.
»Apropos«, nahm Raquel wie zufällig den Ball auf: »Wie geht es unserer Tochter und Senhor Lost? Wir haben seit Tagen nichts gehört. Gut?«
Zara konnte ihr Lächeln nicht unterdrücken. António, Anfang sechzig, Raquel, Ende fünfzig, hingen an ihren Lippen wie neugierige Kinder. Sie unterdrückte den Impuls, sie in die Arme zu nehmen.
Stattdessen spannte sie sie nicht länger auf die Folter und erzählte, dass Soraia und Leander seit etwa einer Woche praktisch nicht mehr das Haus verließen und sie gestern erst mit ihnen Sardinen gegessen hatte.
»Sie haben kaum die Augen voneinander gelassen, und sie haben gegessen wie die Spatzen«, berichtete sie. »Mich haben die beiden auch nicht richtig wahrgenommen.«
Raquel sagte nichts. Sie lächelte nur und legte Zara spontan die Hand auf den Unterarm.
António atmete erleichtert aus, seine Mundwinkel hoben sich zwar nur ein wenig, aber seine Augen lächelten breit. Als Raquel das bemerkte, legte sie ihre andere Hand in seine, in der sie beinahe verschwand.
»Und Leander hatte weiße Shorts und ein hellblaues Hemd an.«
»Nein«, entfuhr es den beiden.
»Doch.«
Und daraufhin lächelten sie noch breiter.
Zu diesem Zeitpunkt, sonntags, halb zwölf, wachte Soraia allein im Bett auf. Sie legte ihre Hand links neben sich, auf Leanders Seite. Kalt.
Sie musste wieder eingeschlafen sein. Sie reckte sich, erstarrte aber mitten in der Bewegung. Denn kurz hatte sie die Angst gepackt, er könnte einfach verschwunden sein. Überfordert mit der Situation. Aber die Blicke zu seinem Nachttisch und zum Fensterbrett genügten Soraia, um sich zu beruhigen: ein daumengroßes Auge, aus Speckstein geschnitzt, das neben seinem Bett stand. Und unter dem Fenster ein Blitz aus demselben Material.
Zwei der sieben Wächter, wie Leander die Figuren nannte, die er in der Villa Elias verteilt hatte und die ihn vor der Implosion des Raumes schützten, die ihn unweigerlich ins Nichts reißen würde. So jedenfalls hatte er es Soraia erklärt.
Sie war noch nie dabei gewesen, aber sie glaubte ihm jede Silbe. Denn erstens konnte er nicht lügen, und zweitens hatte Zara es einmal erlebt, als sie einige der Skulpturen als Beschwerer für Servietten zweckentfremdet hatte. Sie wollte es nie wieder erleben.
Er stand mit weißen Shorts und nacktem Oberkörper am Pool, hinter dem das versengte Brachland sich über einen Kilometer weit bis zum nächsten Haus erstreckte. Die Zikaden zirpten, die Sonne hatte den Beckenrand erwärmt, auf dem Leander barfuß balancierte und mit dem Kescher die Insekten aus dem Pool fischte.
Er tat das gerne am Morgen, noch vor dem Frühstück, weil die ersten Bienen und Hummeln bereits nach Sonnenaufgang in dem Becken havarierten und ihren Todeskampf aufnahmen, den sie unweigerlich verloren, sofern Leander sie nicht rettete. Es war ihm unmöglich auszuschlafen, während sie ertranken. So zog er mit starrer, unbeweglicher Miene schon zum zweiten Mal heute mit dem Kescher systematische Bahnen durch das Wasser.
Hätte Soraia ihm neutral gegenübergestanden, hätte sie sein Verhalten als zwanghaft eingestuft. So fand sie es rührend.
Sie hatte zwei Gläser mit frisch gepresstem Orangensaft mitgebracht, von denen sie ihm eines reichte, nachdem er seine Rettungsaktion beendet hatte.
»Obrigado.«
»De nada.«
Leander trank mit Durst, sein Kehlkopf hob und senkte sich. Er lächelte sie an: »Schmeckt pelzig.«
Soraia nahm es sportlich. Er konnte ohnehin von sich geben, was er wollte, sie liebte jedes Wort, jeden Blick, alles. Sie hätte ihm auch einen Michelin-Stern verliehen, wenn er ihr Zwieback gegrillt hätte.
Aber eins, eins wollte sie dann doch wissen: »Wie ist das mit den Pheromonen?«
»Wie das ist?«, hakte Leander nach.
Soraia nickte und präzisierte ihre Frage: »Dass sie der Grund sind für … dass wir jetzt diese Tage verleben.«
»Ja.«
»Das heißt, es ist vorherbestimmt?«
»Nein, es ist ein … Wunder.«
Soraia stutzte. Leander glaubte nicht an Wunder. Er glaubte an überhaupt nichts. Darauf angesprochen, zitierte er gerne Marie von Ebner-Eschenbach: »Wer nichts weiß, muss alles glauben.« Er wusste lieber.
Bloß, dass sich Wunder nicht mit Wissen erklären ließen.
»Entziehen Wunder sich nicht dem Wissen?«
»Nicht das Wunder, das ich meine. Wunder sind per Definition Dinge, die sich nach menschlicher Vernunft oder Erfahrung kaum ereignen können.«
Leander setzte sich auf den Beckenrand und ließ die Füße im Pool baumeln. Soraia nahm neben ihm Platz. Dort, wo ihre Unterschenkel die Wasseroberfläche durchbrachen, beschrieben sie einen unwirklichen Knick. Und die Sonne zeichnete irrlichternde Muster auf ihre Haut.
»Es gibt nur diesen winzigen Spalt, von außen betrachtet wie ein minimaler Ausschlag in einer konstanten Linie«, begann er und überlegte kurz. »Das ist die Lebenszeit, die ein Mensch hat. Die ist natürlich individuell, aber mit großzügig bemessenen hundert Jahren kann man die Sache recht gut überschlagen. Und um mit jemandem eine Liebesbeziehung einzugehen, muss man denjenigen vorher gut kennenlernen.«
Soraia nickte.
Er hob den Blick vom Pool und betrachtete ihre Grübchen: »Die Chance, dass wir uns in der unendlichen Weite von Raum und Zeit treffen, lag bei eins zu über hundert Millionen. Ich denke, diese Größenordnung legitimiert den Begriff Wunder. Und der entzieht sich nicht dem Wissen.«
»Und die Pheromone?«, hakte Soraia nach und nahm seine Hand.
»Die haben es besiegelt. Aber sie sind nur die Tür, die die Evolution einem aufstößt. Hindurchgehen muss man selbst.«
Sie saßen unbewegt. Eine Familie Schwalben ergriff die Chance und segelte hinab, knapp über der Wasseroberfläche, schnappte etwas von dem Nass auf und zog wieder davon. Soraia beugte sich zu ihm und gab ihm einen Kuss. Am liebsten hätte sie Leander und sich für den Rest ihres Lebens hier eingeschlossen.
Sie ließ sich in den Pool gleiten. Leander betrachtete sie beim Dahintreiben im Wasser, während die Sonnenstrahlen sie beide warm bestrich. Er hatte das Gefühl, als legte man die Kontakte einer Neun-Volt-Batterie auf seine Zunge. Nur angenehmer.
So füllten sie die Tage. Und die Villa Elias bildete ihr geschütztes Eiland, auf dem sie tun und lassen konnten, wonach ihnen der Sinn stand.
Bis zum Nachmittag dieses 2. Augusts.
2.
Das Auto, das auf dem sandigen Hof der Villa Elias seitwärts zum Stehen kam, war in Montanagrünmetallic lackiert und wirbelte jede Menge Staub auf.
Weder Leander noch Soraia kannten diesen Wagen. Aber sie erkannten die kleine, dynamische Frau, die in der Sekunde nach dem Stillstand auf der Fahrerseite ausstieg und ohne Zeit zu verlieren auf die Villa Elias zuging: Graciana Rosado, Sub-Inspektorin bei der Polícia Judiciária in Faro.
Sie trug weiße Turnschuhe, blaue Jeans und eine weiße Bluse. Die 26er Glock steckte seitenverkehrt, mit dem Knauf nach vorne, in ihrem Gürtel. Eine Menge Leute erinnerte sie in ihrer Mischung aus geringer Körpergröße (1,62 Meter) und Eigenwilligkeit an die junge Holly Hunter.
Die Beifahrertür schwang mit Verzögerung auf. Ein kräftiger Kerl mit dunklen Locken und Sonnenbrille stieg aus. Er trug eine eigenwillige Kombination aus Shorts, buntem Hemd und einem sandfarbenen Leinenjackett plus Flipflops. Er sah nicht aus wie jemand, der wusste, was Eile ist. Er reckte sich, lehnte sich an den Wagen und biss genüsslich von einer Sandes mista ab, einem Weißbrot mit Käse und Schinken.
Carlos Esteves war der personifizierte Beweis von Charles Bukowskis These, dass alle Dinge zu jenem kommen, der ruhig in seinem Sessel abwartet. Eine massige Gestalt, die dennoch (kaum) ein Gramm zu viel durch die Gegend trug. Er arbeitete, wie auch Graciana Rosado und Leander Lost, als Sub-Inspektor bei der Kripo. Wobei Graciana und er in Fuseta aufgewachsen waren und dort lebten.
Gracianas schwarzer Volvo-Kombi, von ihr bisher privat wie dienstlich genutzt, hatte Anfang letzter Woche den Geist aufgegeben. Irgendwas mit einer Lambdasonde, das die Volvo-Leute nicht in den Griff bekamen.
Leander stand der Marke ohnehin kritisch gegenüber: »Der Konzern ist 2010 von einer chinesischen Firma übernommen worden. Sie wissen, dass China die Menschenrechte mit Füßen tritt.«
Die Chefin hatte Graciana und Carlos ersatzweise einen altersschwachen Passat angeboten, der bei der GNR bereits ausgemustert worden war. Er hatte knapp über 219000 Kilometer auf dem Tacho.
»Ich möchte dem Auto gegenüber nicht ungerecht werden«, sagte Graciana, »aber ich fürchte, ich bin zu Fuß schneller. Es kann nicht sein, dass wir flüchtige Kriminelle nicht festnehmen können, weil uns die nötige Motorisierung fehlt.«
Die Chefin hob in einer Abwehrgeste die Unterarme und zuckte bedauernd die Achseln: »Wir haben kein Geld, ich bekomme das nicht bewilligt. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ihr Bedarf ist absolut gerechtfertigt.«
Cristina Sobral – wie immer sehr gut gekleidet, heute in einem dezenten beigen Kostüm, das zeitlos wirkte – war tatsächlich ratlos. Sie saß in ihrem Büro mit den weiß gekalkten Wänden und den hellen Holzdielen. Über ihnen drehten die Ventilatoren unermüdlich ihre Runden.
Sobral kam aus dem Norden Portugals und hatte sich im Laufe der Zeit in ihrem Team Respekt erworben. Aber sie war hier an der Algarve noch nicht wirklich angekommen. Daher sperrte sie sich nicht gegen Vorschläge von Carlos oder Graciana, die im Gegensatz zu ihr hier jeden Strauch kannten.
»Haben Sie einen Vorschlag, Sub-Inspektorin Graciana?«
»Nein, leider nicht.«
Aber Carlos Esteves hatte einen, den er seiner Chefin darlegte, nachdem er sie alleine auf dem Parkplatz abgefangen hatte. Ein etwas ungewöhnlicher Plan, wie sie meinte, aber einer, der letztlich aufging.
Nur drei Tage später führte Cristina Sobral Graciana und einen Carlos Esteves, der sich beiläufig einen Oscar in Ahnungslosigkeit erspielte, in die Tiefgarage in der Rua António, in der die von der Polícia Judiciária konfiszierten Fahrzeuge abgestellt worden waren: Fahrräder, Motorräder, Autos, Transporter, zwei Lastwagen und ein kleiner Bagger.
Sobral führte sie unter dem Vorwand einer Fluchtwagenidentifikation zu einem Traum in Grün. Einem Mustang in der Bullitt-Edition, eine Reminiszenz an den gleichnamigen Film mit Steve McQueen.
»Nein«, sagte Graciana, »der ist mir nicht bekannt.«
Ihre Augen fuhren die Formen entlang, die alle im Geist des Understatements entworfen worden waren. Er stand dezent dort, er ließ die Muskeln nicht spielen, sie deuteten sich nur an. In ihm lag eine verborgene Kraft.
»Er hat einer Touristin gehört, einer …«, die Chefin warf einen Blick auf ihr Smartphone, »… einer Petra Lang. Sie ist letztes Jahr alkoholisiert in einen Bus gelaufen. Die arme Frau hatte keine Verwandten mehr, das Auto wird hier stehen, bis es verrostet ist. Und das ändern wir jetzt, wir nehmen es unter unsere Fittiche – und zwar als Ihren Dienstwagen.«
Damit reichte sie Graciana die Wagenschlüssel.
»Sie hat feuchte Augen bekommen«, erzählte Carlos später.
»Ich war erkältet, mir hat ein Auge getränt«, widersprach sie.
»Sie hat vor Erkältung gelächelt wie ein Honigkuchenpferd«, fügte er hinzu.
Gracianas Herz wurde weich, als sie in die Villa Elias eintrat und sah, wie Leander Lost gerade Gardinen im Schlafzimmer aufhängte.
Sie räusperte sich. Der Alemão blickte über die Schulter, ihre Blicke trafen sich. Er setzte die Gestalt mithilfe von fünf spezifischen Gesichtsmerkmalen zu einer Person zusammen, die er kannte: »Bom dia, Senhora Graciana.«
Graciana nickte: »Sim, bom dia … Ich störe Sie ungerne am Sonntag, aber es ist eilig, und ich habe Sie oder … Soraia nicht erreicht.«
»Wir haben unsere Handys in der Schublade verstaut«, sagte jemand hinter Graciana.
Es war So, Graciana erkannte sie an der Stimme und wandte sich um. Soraia kam auf sie zu, sie strahlte, wie Graciana es lange nicht mehr bei ihr gesehen hatte. Sie freute sich für ihre jüngere Schwester. Sie nahmen sich kurz in den Arm und drückten sich.
Da sie beide die Mimik der anderen im Schlaf lesen konnten, erfasste Soraia sofort, dass etwas Ernstes anlag: »Was ist passiert?«
»Auf der Straße zwischen Pereirinhas und Amaro Gonçalves ist eine Autobombe explodiert. Keine Toten oder Verletzten, heißt es.«
Soraia verging das Strahlen: »Eine Bombe? So was hat es hier doch noch nie gegeben«, stellte sie fest.
Graciana wirkte gefasster. Nicht nur, weil sie bereits Zeit gehabt hatte, sich mit Carlos auszutauschen.
Leander Lost gesellte sich zu den beiden und blickte seiner Vorgesetzten auf die Nasenwurzel. Die Leute hatten es gern, wenn man sie anblickte, während sie mit einem sprachen. Lost selbst empfand das allerdings als unangenehmes Starren, weshalb er lieber die Nasenwurzel fixierte. Keiner der normalen Menschen bemerkte den Unterschied.
»Ich hätte Sie gerne am Tatort dabei, Senhor Lost. Senhor Esteves wartet draußen. Wie lange brauchen Sie?«
Ganz untypisch für ihn zögerte Leander bei dieser Frage. Sein Blick wanderte kurz zu Soraia und dann zurück zu deren älteren Schwester: »Drei Minuten und dreißig Sekunden.«
Der dunkelgrüne Mustang schoss mit aufgesetztem Blaulicht aus dem Feldweg, an dem die Villa Elias lag, quer hinaus auf die N125. Graciana fing das ausbrechende Heck geschickt ab und trat das Gaspedal voll durch. Der V8 dröhnte sonor auf und katapultierte den Wagen nach vorne.
Carlos hatte den an Gewissheit grenzenden Verdacht, dass seine Kollegin eiligen Einsätzen nicht abgeneigt war, weil hierbei die Einhaltung von Verkehrsregeln (insbesondere Tempolimits) außer Kraft gesetzt war. In einem anderen Leben, da war man sich in Fuseta einig, wäre Graciana Rosado Rallyefahrerin geworden. Im Augenblick schaltete sie runter und zog dann auf die Leitlinie, um den Wagen zwischen zwei Lkws hindurchzumanövrieren.
In Höhe der Abzweigung in den Norden nach Belmonte bog Graciana Rosado mit ihrem Traum in Grün ins Hinterland ab. Die Straße verjüngte sich auf eine Spur. Leander Lost versteifte sich instinktiv. Die Landschaft schoss rechts und links an ihnen vorbei.
Die Anzahl der Häuser verringerte sich drastisch. Statt ihrer wurde die rissige Straße von Plantagen flankiert. Orangen, Zitronen, Oliven. Abgelöst durch Weideland, auf dem Schafe, Esel und Pferde im Schatten von Bäumen standen oder lagen. Wenn nach links oder rechts ein Weg abzweigte, endete der Asphalt und wurde zu Schotter oder festgefahrenem Sand.
Leander trug das, womit er vor einem Jahr in zwölffacher Ausfertigung hier an der Algarve eingetroffen war: einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine Lederkrawatte. Lediglich seine schwarzen Schuhe hatte er durch die bequemen Espadrilles ersetzt.
Er war für einen Polizisten der GNR eingetauscht worden, Rui Aviola, einen Frauenschwarm, der nach einem Jahr bei der Hamburger Polizei vor genau einer Woche wieder seinen Dienst in der örtlichen GNR-Station aufgenommen hatte.
Weil Leander Lost es vermied aufzufallen (schließlich war er nicht auf ein Außenseiterdasein erpicht), hatte er in Deutschland stets einen schwarzen Anzug mit Krawatte getragen. Dass er in Fuseta bei dreißig Grad im Schatten ungefähr so unauffällig war wie ein bunter Hund mit Außenbordmotor, hatte Leander nicht bedacht. Aber mittlerweile hielt man ihn wegen des Anzugs hier immerhin nicht mehr für übergeschnappt, sondern nach einem halben Jahr für plemplem und nun schließlich für eigen. Was terminologisch dem Maximum an Gastfreundschaft und Wohlwollen entsprach.
Sie schossen an Belmonte vorbei, nicht mehr als eine pittoreske Ansammlung von weiß getünchten Häusern mit roten Dachziegeln, einigen Ruinen, Ziegen und einer Bar mit den unvermeidbaren Plastikstühlen auf dem Gehsteig, auf denen Männer mit Schiebermützen rauchten, Karten spielten und Super Bock oder Sagres tranken.
»Wie gestaltet sich die Informationslage?«, fragte Leander.
»Oben auf der Landstraße zwischen Pereirinhas und Amaro Gonçalves ist ein Auto explodiert. Zum Glück ist niemand verletzt worden. Das ist das, was über Funk eingetroffen ist. Ein Reporter soll den Notruf abgesetzt haben, unsere Leute aus der GNR-Station in Moncarapacho sind sofort ausgerückt«, antwortete Graciana. Sie wusste, dass Leander auf den nackten Kern von Informationen fokussiert war und jede nicht notwendige Umschreibung für ineffizient hielt – weshalb sie sich kurzfasste.
Als sie eine Kreuzung erreichten und nach rechts abbiegen wollten, stand dort eine Traube Schaulustiger, die erst beiseiterückte, als Graciana kurz die Sirene aufheulen ließ.
Zwei GNR-Männer hatten die Straße mit Absperrband abgeriegelt und ihren Wagen, einen grünen Jeep, quer dazugestellt. Sie trugen Dreitagebärte, Sonnenbrillen und Maschinenpistolen. Außerdem gepanzerte Westen, wie Graciana feststellte, als sie sich am Seitenfenster bei ihnen auswies.
»Wer hat Sie angefordert?«
»Sobral. Polícia Judiciária.«
»Gibt es Verletzte?«
»Nicht dass ich wüsste.«
Graciana nickte, nahm ihre Ausweise, die der Mann ihnen in den Mustang zurückreichte, entgegen und fragte: »Wieso tragen Sie schusssichere Westen? Ist das jetzt Routine?«
Der Mann schüttelte den Kopf: »Terrorverdacht.« Er hob das Absperrband, damit sie durchfahren konnten.
Da schwebte etwas, sich selbst in seiner horizontalen Achse umkreisend, hinab und landete auf der Windschutzscheibe: ein Fünfhundertdollarschein. Carlos beugte sich vor, schnappte ihn sich und zog ihn hinein, um ihn zu begutachten.
Nach der ersten Kurve bemerkten sie zahlreiche Einwohner, die Papierschnipsel von der Straße und aus den Gräben sammelten. Linker Hand ein Feld mit Orangenbäumen, rechts Olivenbäume, an deren silbrig glänzenden Blättern Leander sich schwer sattsehen konnte.
In der nächsten Kurve hatten GNR-Beamte eine Kreuzung gesperrt und leiteten den Verkehr um. Und plötzlich erhob sich eine kleine Bankfiliale der CA, der Crédito Agrícola, im Nichts, denn die nächsten Orte und ihre Ausläufer waren kilometerweit entfernt.
Zwei Feuerwehrleute standen neben einem ausgebrannten Autowrack und deckten es mit Löschschaum ein. Der rote Feuerwehrwagen mit der Aufschrift Bombeiros war mitten auf der Straße abgestellt worden. Zwei weitere Angehörige der Feuerwehr, darunter eine Frau, rollten einen zweiten Schlauch schon wieder zusammen.
Etwas war von der kleinen Bankfiliale weggerissen worden. Sie stand mutterseelenallein in Olivenbaumplantagen, die sich entlang beider Straßenseiten erstreckten. Auf dem warmen Asphalt selbst liefen ein paar Olivenbauern und einige Bereitschaftspolizisten der Guarda Nacional herum und fingen Geldscheine aus der Luft. Andere pflückten sie aus den Sträuchern oder lasen sie vom Boden auf. Denn eine anhaltende Brise wehte sie aus der Bank hinaus auf die Straße.
»Sieh dir Luís an«, sagte Carlos mit leicht verärgerter Miene, als sie sich näherten.
Er meinte Luís Dias, der in vier Wochen in Pension gehen würde, auf die er sich seit dem 1. Oktober 1968 freute, seinem ersten Arbeitstag bei der GNR. Wie seine Kollegen steckte er in schwarzen Springerstiefeln, einer dunkelblauen Hose, dem hellblauen Hemd mit den Rangabzeichen auf den Schultern und trug ein grünes Barett. Für sein Alter und sein Gewicht huschte er erstaunlich flink umher und bückte sich mit der Elastizität eines Gummibands nach den Dollarscheinen.
Carlos hob eine Augenbraue: »Ziemlich beweglich für jemanden, der vorhin noch kaum auftreten konnte.«
»Lass gut sein, Carlos, er hat nur noch vier Wochen«, antwortete Graciana, während Luís Dias sich ein frisch eingesammeltes Bündel Scheine in die Hosentasche steckte.
Direkt nach dem Eingang des Notrufs hatte Graciana blitzschnell alles Notwendige veranlasst: Feuerwehr, Rettungsdienst, GNR-Einheiten wurden von ihr alarmiert.
In der GNR-Station in Moncarapacho war Luís Dias ans Telefon gegangen.
»Luís, ihr rückt sofort zur Filiale der CA hinter Pereirinhas aus. Die, die seit zehn Jahren geschlossen werden soll. Und da …«
»Das geht nicht, ich … ich bin gerade ziemlich übel umgeknickt. Ich kann praktisch nicht auftreten. Ich fürchte, ich muss hierbleiben.«
»Gut. Aber dann schick Ana und Rui raus. Da muss dringend abgesperrt werden. Es heißt, da weht jede Menge Bargeld ins Gelände.«
Jetzt entdeckte Luís den Mustang, den er zunächst nicht zuordnen konnte. Erst im letzten Augenblick erkannte er Graciana Rosado hinter dem Steuer, die direkt neben ihm hielt. Es waren ohnehin nur noch zwanzig Meter bis zur Bank, also stieg sie aus und klappte die Lehne des Sitzes nach vorne, damit Leander Lost ebenfalls den Wagen verlassen konnte.
»Olá, Luís.«
»Olá, das ist ja ein Ding, hm?«
»Ja«, sagte sie und ließ den Blick über die Szenerie schweifen. Die GNR-Polizistin Ana Gomes stellte auch Geldscheine sicher. Und weiter hinten Rui Aviola, der Polizist, der im Austausch mit Leander Lost ein Jahr in Hamburg verbracht hatte und vor wenigen Tagen zurückgekehrt war. Zwei Touristinnen, die ihre Fahrräder am Seitenstreifen abgestellt hatten, und drei Portugiesinnen zwischen siebzehn und 84 gingen ihm freudig zur Hand.
Aviola sah aus, als hätte ihn Michelangelo persönlich modelliert. Ein schöner Mann mit einem lässigen Lächeln, der in Fuseta als Liebhaber, Ehemann oder Schwiegersohn heiß begehrt war. Ganz besonders jetzt, da man ihn ein Jahr lang schmerzlich vermisst hatte.
Neben der Bank stand ein Rettungswagen mit zwei Sanitätern. Einer rauchte, der andere telefonierte mit seinem Smartphone.
»Lassen Sie uns zur Bank gehen«, forderte Graciana den Alemão auf. Der hagere Kerl ging neben ihr auf das Gebäude zu. Nach einem Jahr war seine Blässe einer leichten Segelbräune gewichen, die ihm ausgesprochen gut stand.
Die Genossenschaftsbank Crédito Agrícola war 1911 gegründet worden – und diese Filiale erinnerte daran. Sie war nicht mehr als ein Bungalow mit einem ausladenden Parkplatz vor dem Gebäude.
»Hatten Sie ein paar schöne Tage mit meiner Schwester?«
»Ja.«
Sie warf ihm einen Blick von der Seite zu. Losts Gesicht wirkte wie eine Maske. Es war nahezu frei von Falten.
Luís Dias wollte den beiden folgen, als sich ihm jemand in den Weg stellte, ein Mann, so groß, dass er ihm die Sonne nahm: Esteves. Der blickte ihn vorwurfsvoll an.
»Ich weiß, was du denkst, Carlos.«
»Na, was denk ich denn, hm?«
»Du denkst, ich bin ein Simulant.«
»Nein. Manchmal passieren eben Wunderheilungen, Luís. Ich freue mich für dich.«
»Du siehst aber nicht aus wie jemand, der sich freut.«
»Doch. Ganz tief drinnen freu ich mich. Und ich freue mich noch mehr, wenn ich richtig in der Annahme gehe, dass du das Bündel Geldscheine in deine Hosentasche gestopft hast, um es in der Dienststelle abzugeben.«
Luís war kurz verdutzt, dann wich die Überraschung seinem Ärger. Über Carlos’ unausgesprochenen Vorwurf, er stehle Geld, über Carlos Esteves’ Existenz an sich – und darüber, dass er auch noch recht hatte. Am meisten stieg die Wut in ihm hoch, weil er das Geld jetzt nicht behalten konnte.
Carlos, der in Luís’ Gesicht lesen konnte wie in einem offenen Buch, musste lächeln.
Dias beugte sich konspirativ vor und senkte die Stimme: »Das ist doch alles versichert, hm? Verstehst du? Da hat niemand einen Schaden davon, das will ich sagen. In einem Monat bin ich in Rente, so eine Gelegenheit kommt nie wieder.«
»Versichert heißt, alle bezahlen das, Luís. Ich habe nicht gehört, dass du mich gerade schmieren wolltest. Und jetzt gib mir das Geld, bevor ich’s mir anders überlege.«
Eine senkrechte Zornesfalte erschien auf Luís’ kleiner Stirn. »Unfassbar«, begann er, schüttelte dabei den Kopf, zog das Geldbündel heraus und reichte es Carlos, »wirklich unfassbar. Was sind das nur für Zeiten? Wo hat das alles nur hingeführt? Unfassbar.«
Inzwischen hatten Graciana Rosado und Leander Lost die Filiale erreicht. Direkt davor stand der ausgebrannte Kombi. Die Scheiben waren geschmolzen, das Nummernschild hatte sich in der Hitze zu einer irrwitzigen Figur verbogen, die sich vom Fahrzeug fortwand und in der Luft erstarrt war.
Graciana präsentierte den beiden Feuerwehrmännern, die ihre Löscharbeiten jetzt einstellten, ihren Dienstausweis: »Rosado, Polícia Judiciária, war da noch jemand drin?«
»Não.«
Sein jüngerer Kollege erwies sich als gesprächiger: »Der Wagen ist komplett ausgebrannt, aber da war niemand drin, nein.«
»Obrigada.«
Sie blickte sich über die Schulter. Ana Gomes war zu beschäftigt, um sie zu bemerken, und Luís war in ein intensives Gespräch mit Carlos vertieft – aber Rui Aviola fing ihren Blick auf. Sie winkte ihn zu sich.
Und dann überquerte er mit einem Schlendern die Straße, ein Pulk von drei Frauen folgte ihm und lächelte und redete auf ihn ein. Mit einem Handzeichen bedeutete er ihnen zu warten, bevor er an Graciana herantrat.
»Schön, dass du wieder da bist, Rui«, sagte sie und schenkte ihm ein warmes Lächeln, das er erwiderte. Beinahe wäre es mal passiert zwischen ihnen beiden, draußen in den Dünen der Ria Formosa, Graciana hatte zu viel Medronho getrunken, und das hatte Rui in ihren Augen noch unwiderstehlicher gemacht. Aber Carlos war plötzlich da gewesen, einfach so aus dem Nichts, und hatte Rui gesagt, er bringe Graciana nach Hause.
»Ich kann das auch machen«, hatte Rui gesagt.
»Nicht nötig, Rui«, hatte Carlos ihn abtropfen lassen. Die beiden Männer waren schon nächtelang um die Häuser gezogen und hatten sich amüsiert, aber hier hatte Carlos eine rote Linie gezogen.
An wichtigen Weggabelungen in ihrem Leben war Carlos immer da gewesen. Das wurde Graciana hier neben dem Autowrack plötzlich bewusst. Ein Gedanke, der sie kalt erwischte, so unerwartet wie ein Wolkenbruch.
»Ja, es ist toll, wieder hier zu sein. Hier ist es eben schön. Schön warm.«
Graciana biss sich auf die Unterlippe – er sah noch mehr zum Anbeißen aus als vor seiner Abreise. »Das ist Rui Aviola von der GNR, er war im Austausch mit Ihnen in Hamburg, Senhor Lost. Rui, das ist Senhor Lost.«
Aviola lächelte freundlich und reichte dem Deutschen die Hand: »Ich freue mich, Sie kennenzulernen.«
Lost, der Körperkontakt vermied, beließ es bei einem Nicken und starrte dem Mann auf die Nasenwurzel: »Ganz meinerseits.«
Die Kommunikation der Menschen trug objektiv betrachtet eine Menge überflüssigen Ballast mit sich herum, der den Blick auf die eigentliche Information vernebelte. Höflichkeitsfloskeln, Umschreibungen, zeitraubender Small Talk und all diese Schlingpflanzen menschlicher Verständigung, die den Informationsaustausch unnötigerweise in die Länge zogen.
Andererseits konnte man nicht einer von ihnen sein, ohne auf diese (ineffiziente) Weise miteinander zu sprechen. Und da hatte Leander quasi den Heiligen Gral für sich entdeckt: Dan B. Tuckers Kompendium der sinnlosen Sätze, mit denen er im Zweifelsfall nicht auffiel. »Ganz meinerseits« etwa war bei Begrüßungen, die mit »Ich freue mich« durch das Gegenüber begannen, eine todsichere Replik.
Falls das Kompendium mal keine Antwort lieferte, behalf Lost sich mit dem verbalen Echo.
»Hamburg ist großartig«, sagte Rui Aviola.
»Ja, das ist es.«
Man musste einfach nur die Aussage des anderen bestätigen, und schon fühlte der sich wohl.
»Aber es ist auch schön, wieder hier zu sein.«
»Ja, es ist schön, wieder hier zu sein.«
Graciana trat an Rui Aviola heran: »Hast du hier was mitbekommen?«
»Nein, ich bin mit den Bombeiros hier angekommen.«
»Senhor Aviola ist mit den Bombeiros hier angekommen.«
Man konnte das verbale Echo auch auf Dritte anwenden, was interessanterweise zu Irritationen führte.
Graciana stutzte kurz: »Ich weiß.«
Leander löste sich von ihnen und schritt um das Wrack herum. »Hat jemand das Kennzeichen überprüft?«, fragte er.
»Und?«, leitete Graciana die Frage an Rui Aviola weiter.
Der wandte sich um: »Ana, hat jemand schon das Kennzeichen überprüfen lassen?«
»Nein!«
»Luís?«
»Hm?«
»Hat jemand schon das Kennzeichen überprüfen lassen?«
»Ich nicht …«
Rui Aviola nickte und wandte sich wieder Graciana zu, er lächelte mit seinem sinnlichen Mund: »Nein.«
»Sei so nett und lass es überprüfen, Rui«, bat sie ihn. »Wir müssen wissen, wem der Wagen gehört. Obwohl ich davon ausgehe, dass der Bombenleger nicht der gemeldete Eigentümer ist.«
»Warum nicht?«, fragte Rui. Mit einem blinzelnden Blick musterte er ihr Gesicht auf der Suche nach einer Antwort.
Graciana war ernüchtert. Um ein Haar hätte sie vergessen, was in Fuseta allgemein bekannt war: dass Michelangelo beim Modellieren von Rui Aviola das Gehirn vernachlässigt hatte.
»Weil … wir ihn sonst sofort als Halter identifizieren könnten.«
»Ach so.«
»Besorg mir den Halter, por favor.«
Aviola nickte und ging zu dem viertürigen Wagen der GNR hinter dem Löschfahrzeug. Graciana gesellte sich zu Lost, der die Bank betrachtete.
Die Wucht der Explosion hatte das Heck des Wagens – es war ein Renault Espace – in Stücke gerissen. Die Heckklappe war wie ein Geschoss in die Frontmauer der Bank gleich neben dem Eingang katapultiert worden. Genau dort, wo sich die Schließfächer befanden. Dieser Bereich war auch von Dutzenden von Löchern überzogen. Überall lagen Glassplitter und aus der Wand gebrochene Teile aus Stein und Dämmstoff und Putz. Ein gebrochener Fensterrahmen ragte mit seinem Giebel hinaus und wiegte sich im Wind. Ein hellbrauner Staubteppich hatte sich über die Bank und vor ihren Eingang gelegt.
Graciana kannte Bilder von Gebäuden aus dem Krieg, die von Geschossnarben überzogen waren. Exakt so sah jetzt die Frontfassade der Crédito Agrícola auf der linken Seite aus.
Sie inspizierte das Heck des Espace und die Gebäudefassade. »Er hat den Wagen sehr nah vor der Bank geparkt.«
Lost nickte: »Für die größtmögliche Wirkung.« Er deutete mit dem Kopf in Richtung Foyer: »Sehen Sie die vielen kleinen Krater?«
»Ja.«
»Das war nicht die Druckwelle.«
»Sie meinen, es war eine Nagelbombe?«
»So was, ja. Er hat den Sprengsatz mit Metallteilen angereichert – die KTU wird das genau bestimmen. Das war wie ein riesiger Schrotschuss.«
Carlos Esteves trat zu ihnen und zündete sich eine an. Die Sonne wärmte ihm den breiten Rücken.
»Wer hat eigentlich den Notruf abgesetzt – und an wen?«, fragte Lost in die Runde.
»An die Zentrale in Faro«, wusste Carlos. »Es war ein Senhor …«, er kratzte sich kurz im Nacken, »… ein Senhor Moreno. Er wartet hinten bei der GNR in der Kurve. Soll ich ihn holen?«
»Ja, irgendwo müssen wir ja anfangen«, sagte Graciana.
Sie wunderte sich über Carlos’ Bereitschaft, in der Hitze – er entledigte sich seines Jacketts und warf es sich über die Schulter – zu Fuß die hundert Meter zurückzulegen. Aber sie wunderte sich nur die ersten zwei Schritte, die er unternahm, denn dann zückte er sein Handy und rief die Kollegen der Guarda Nacional an und bat sie, Senhor Moreno zu ihnen zu bringen.
Kaum hatte er das getan, ertönte hinter ihnen ein durchdringendes Hupen. Sie reckten die Köpfe. Ein weißes Jaguar-Cabrio schoss heran und stoppte in gut dreißig Metern Entfernung.
Der Fahrer, der ein maßgeschneidertes weißes Hemd mit Krawatte trug, öffnete nicht etwa die Tür, sondern stand im Wagen auf und schwang sich seitlich hinaus, wobei er schief aufkam und fast umknickte, sich im letzten Augenblick aber fing und auf sie zuging, als wäre nichts geschehen. Er trug eine graue Anzughose und gewienerte hellbraune italienische Schuhe.
»Eh, PJ«, rief er den Feuerwehrleuten zu, die die Schläuche gerade in ihrem Löschfahrzeug verstauten, und hielt ihnen aus zwanzig Metern Entfernung seinen Dienstausweis der Polícia Judiciária entgegen, »Abstand dreihundert Meter! Imediatamente!«
Er kümmerte sich nicht weiter darum, ob man seinem Befehl Folge leistete, sondern nahm die drei Sub-Inspektoren ins Visier, während er eilig auf sie zukam: Miguel Duarte. Wenn er außer Hörweite war, nannten sie ihn Pavão, den Pfau.
Er strich sich eine Strähne aus der Stirn und stoppte vor ihnen ab. Auf seinem Nasenrücken saß eine Ray-Ban mit schmalen dunklen Gläsern. »Olá«, sagte er und begutachtete das Fahrzeug und die Bank. »Was steht fest?«, fragte er.
»Dass hier eine Autobombe explodiert ist«, sagte Graciana. »Warum schickst du die Feuerwehr weg?«
Duarte nickte, als habe er mit dieser Frage gerechnet. Er seufzte, schob die Brille ins Haar zurück und betrachtete sie aus seinen eng beieinanderliegenden Augen. In seinem Blick lag verständnisvolles Mitleid. Ganz so, wie man wohlwollend ein Kind betrachtete, das einer simplen Addition nicht zu folgen in der Lage war. Bloß ohne das Wohlwollen.
»Weil ich der Einzige aus dem Team bin, der eine Fortbildung in Explosivstoffen und Bombenentschärfung gemacht hat. Ich gebe mich nämlich«, sein Blick wanderte zu Carlos, »nicht zufrieden mit dem Erreichten.«
»Eine Fortbildung?«, fragte Graciana Rosado mit ehrlicher Überraschung. »Wann das denn?«
»Vor ein paar Monaten.«
»Und wo?«, hakte Esteves nach.
Duarte zögerte kurz. »In Sevilla«, antwortete er schließlich.
»Ah, Sevilla.« Carlos grinste, weil Duarte in Sevilla geboren und aufgewachsen war – und dort immer noch jede Menge Verwandtschaft besaß. So konnte er seine Aufenthalte und die Reisen dorthin als dienstliche Ausgaben deklarieren.
Duarte machte den Ansatz, etwas zu erwidern, schluckte es aber hinunter. Er wollte sich wegen eines Kollegen wie Esteves nicht aufregen. »Ich rette dir vielleicht gerade dein Leben, Carlos Esteves, du wirst das vielleicht später mal begreifen, sehr vermutlich nicht, aber vielleicht eben doch, ganz möglicherweise wird es dir dann klar werden, und dann wirst du mir dankbar sein.«
»Wovon redest du?«, fragte Graciana.
»Ihr wisst, was die ganzen religiösen Spinner in Europa angerichtet haben. Spanien, Frankreich, England, Deutschland. Vielleicht haben wir es hier mit denen zu tun. Ich meine: eine Autobombe! Hatten wir so was hier schon irgendwann mal?«
»Nein«, räumte Graciana ein.
»Die Attentate von Islamisten haben bisher immer darauf abgezielt, so viele Menschen wie möglich zu ermorden«, schaltete Leander sich ein, »aber es ist Sonntag. Die Filiale war geschlossen. Sie befindet sich auch weit außerhalb jeder Ansammlung von Menschen. Wenn der Bombenleger ein Attentäter war, der viele Menschen in den Tod reißen wollte, war sein Plan nicht sehr konsequent.«
Duarte seufzte: »Diese Haarspalterei tut jetzt nichts zur Sache. Es kann hundert Gründe geben, warum der Sprengsatz jetzt explodiert ist und nicht zu einem anderen Zeitpunkt.«
»Exakt hundert?«, fragte Lost interessiert.
Duartes Miene verhärtete sich, er holte tief Luft für eine geharnischte Antwort, schüttelte dann aber den Kopf und winkte ab. Stattdessen wandte er sich an Graciana Rosado, die noch genau so lange seine Chefin sein würde, bis er sie überflügelt hatte: »Manchmal wird die erste Bombe dazu genutzt, jede Menge Helfer an den Tatort zu holen – um dann die zweite oder auch dritte Bombe zu zünden. Genau das«, er sah kurz zu Lost, »könnte der Plan sein.«
Der sah erst zu dem Wrack, dann auf das Bankgebäude.
Und er war damit nicht alleine. Carlos schluckte, sein Kehlkopf hob und senkte sich.
»Das heißt?«, fragte Graciana, deren Mundhöhle sich plötzlich sehr trocken anfühlte.
»Das heißt, alle entfernen sich mindestens dreihundert Meter«, sagte Duarte, »und dann zieh ich einen ballistischen Schutzanzug an und sehe mich um.«
»Danke, dass Sie uns gewarnt haben, Senhor Duarte«, sagte Leander. »Können wir Ihnen dabei behilflich sein?«
»Ich werde nach Sprengfallen suchen. Stolperdrähte und so was. Vielleicht hat der Mistkerl auch eine Mine hinterlegt oder irgendwas mit Bewegungssensor. Die Islamisten verstecken seit Neuestem auch gerne Sprengsätze in Spielzeug, in Teddybären oder Puppen. Wenn man sie anhebt, knallt es. Also, ich weiß nicht, was dadrinnen ist … oder in dem Auto. Wenn er uns beobachtet und manuell die zweite Bombe auslösen kann, dann hängt es davon ab, ob er einen einzelnen Polizisten als lohnenswert ansieht oder nicht. Und wenn es ein Zeitzünder ist … Wir können ja nicht ewig warten.« Und an Leander gewandt: »Nein, Senhor Lost, ich denke nicht, dass Sie mir dabei zur Hand gehen sollten. Oder haben Sie einen Speziallehrgang zur Bombenentschärfung absolviert?«
»Nein.«
Duarte nickte, weil er es sich gedacht hatte – und wandte sich wieder Graciana zu: »Rückt Senhora Isadora an?«
»Das tut sie.«
Isadora Jordão war die Kriminaltechnikerin in ihrem Team. Sie war gerade mal Anfang dreißig und hatte schon Anfragen aus Lissabon, Porto und Madrid abgelehnt. Sie wohnte mit einer Hündin auf einem Hausboot und blickte abends bei einem Joint aufs Meer.
Graciana nahm das Funkgerät, das sie an ihrem Gürtel eingehängt hatte, und sprach hinein: »Rosado, PJ. Alle Einheiten rücken auf dreihundert Meter von der Filiale ab. Alle Zivilisten im Umkreis müssen das Gebiet verlassen. Alle Zufahrtswege werden gesperrt. Fordern Sie wenn nötig weitere Einheiten an.«
Als Folge ihrer Ansage stellten Ana Gomes, Rui Aviola und Luís Dias das Einsammeln der Banknoten ein und geleiteten ihre Helfer zu den Absperrungen. Auch die GNR-Fahrzeuge dort setzten sich in Bewegung und dirigierten die Schaulustigen weiter weg. Mehrere Beamte schwärmten auf die Feldwege in den Orangen- und Olivenbaumhainen aus. Aus der Luft betrachtet hätte das alles eine Art Kreis ergeben, der sich ausdehnte und aus dem sich die Menschen entfernten.
Graciana wies Carlos an, Duarte beim Anlegen der Spezialkleidung behilflich zu sein.
Nach seinem Lehrgang hatte Miguel Duarte nämlich der Chefin so lange mit der Notwendigkeit solcher Anzüge in den Ohren gelegen, bis die sich vom Innenministerium zwei bewilligen ließ. Seitdem fuhr Duarte einen von ihnen im Kofferraum spazieren – man konnte schließlich nie wissen.
Anschließend trat Graciana an den Rettungswagen heran, an dem sich die Sanitäter die Beine in den Bauch standen und Kette rauchten. Die Notärztin hatte sich nur wenige Meter weiter einen Schattenplatz unter der einzigen Pinie weit und breit gesucht.
»Graciana Rosado, Polícia Judiciária«, stellte sie sich vor.
Die Frau, die ebenfalls rauchte, war für eine Notärztin recht jung, Ende zwanzig vielleicht. Dunkle Haare, zugänglicher Blick. An ihrem Handgelenk entdeckte Graciana eine Smartwatch, die alle möglichen Dinge wie Schrittzahl oder die Herzfrequenz aufzeichnete und im Hintergrund aus allen diesen Messdaten ein Bewegungs- und Gesundheitsprofil erstellte. Sie reichte Graciana die Hand: »Ich bin Lana.«
Graciana gefiel ihre direkte Art.
»Lana, jemand von uns geht da jetzt rein, in die Filiale, wir müssen noch mit einer weiteren Bombe rechnen. Ihn wird in ein paar Minuten noch eine Kriminaltechnikerin begleiten. Der Kollege hat Blutgruppe A, Rhesusfaktor positiv. Die Kollegin hat Blutgruppe B, ebenfalls Rhesusfaktor positiv. Wenn Sie die vorrätig haben, ist es gut. Wenn nicht, fordern Sie sie bitte schnellstmöglich an.«
Die Ärztin nickte ihr beruhigend zu: »Haben wir beides vorrätig. Wir haben alle Blutgruppen bis vier Liter im Wagen. Am Klinikum Faro hält sich ein Rettungshelikopter bereit, die Besatzung ist an Bord und wartet ab. Die müssen nur den Rotor anwerfen, und dann sind die in vier Minuten hier.«
Duarte sah aus wie ein gepanzerter Astronaut. Der überdimensionale Helm reichte knapp bis zu den Schultern. Beine, Oberkörper, Arme – alles war durch Panzerplatten geschützt. Duarte wog nun ziemlich exakt 23 Kilo mehr und hatte einen Wasserkopf.
Carlos schloss die Scharniere des Anzugs an seinem Hals.
Duarte sah auf, ihre Blicke trafen sich. Die ersten Schweißtropfen fielen dem gebürtigen Spanier von der Stirn auf die Wimpern. In dem Anzug steckte er in seiner ganz persönlichen Sauna. »Obrigado«, sagte er, »es ist besser, du gehst jetzt auch in den Sicherheitsbereich.«
Carlos nickte, wollte sich schon abwenden, aber noch in der Bewegung stoppte er ab und beugte sich zu dem Spanier: »Hör zu, Miguel, ich …« Carlos unterbrach sich selbst. Das, was er eigentlich sagen wollte, kam ihm nicht über seine Lippen. Dass Duarte ein hochnäsiger spanischer Pfau war, eitel bis zum Mond, dass er stets nur sein eigenes Vorankommen im Visier hatte und ohnehin stets glaubte, er sei schlauer als alle anderen. Aber dass angesichts des Umstands, dass er in ein paar Minuten sein Leben riskieren würde für sie, das alles zu einem Haufen unbedeutender Nebensächlichkeiten verblasste. Also sagte Carlos nur: »Viel Glück, Companheiro.«
Miguel Duarte schluckte. Es waren nur drei Worte, aber in dem Blick seines Kollegen las er mehr. Hier, in diesem winzigen Einschnitt der Zeit, wehte ihn eine Ahnung an. Die Ahnung, dass es mehr gab als Beförderungen und hohe Besoldungsstufen, dass es einen Sinn gab, zumindest einen Zipfel davon, und sich dieser Sinn gerade hier, in dem Miteinander mit diesem ungehobelten, ruppigen Kollegen, ein Stelldichein gab, das sie beide gleichermaßen überraschte.
Gerade wollte er all das in Worte fassen, als ein altersschwacher R4 vorfuhr, dessen Rot von der Sonne in ein stumpfes Matt abgeschossen worden war. Der linke Kotflügel war Isadora Jordão in den Jahren weggerostet, inzwischen hatte sie ihn durch ein baugleiches Teil in Orange ersetzt.
Die Kriminaltechnikerin stieg aus. Die Haare so kurz geschoren wie die von Lost, die Füße in schwarzen Motorradstiefeln, darüber eine Armeehose und ein weit geschnittenes kariertes Hemd aus der Herrenabteilung. Sie betrachtete kurz das Autowrack und die Bankfiliale. Dann ging sie zu Carlos und Duarte und nickte ihnen begrüßend zu. »Weiß man schon, wer das war?«
»Nein«, antwortete Carlos.
»Vielleicht IS-Spinner«, gab Duarte über den Helm zur Antwort. Er klang ein wenig nach Darth Vader. »Wir müssen mit Sprengfallen rechnen«, fügte er hinzu.
Jordão, die den Blick immer noch auf die Filiale gerichtet hatte, nickte. »Gehen wir«, sagte sie und spazierte los.
»Ihr Anzug«, sagte Carlos.
»Ist in Faro. Dauert zu lange jetzt. Gehen wir.«
»Warum haben Sie ihn denn nicht mitgebracht?«, wollte Duarte wissen.
Die Kriminaltechnikerin stoppte ab, wandte sich um und blickte ihm ohne Umschweife direkt ins Gesicht. »Ich möchte am Stück weiterleben«, sagte sie und machte nur eine kurze Pause: »Oder gar nicht.« Ohne eine Antwort abzuwarten, marschierte sie weiter, aufs Wrack zu.
»Bis gleich«, sagte Carlos Esteves.
»Ja«, gab Miguel Duarte etwas unbeholfen zurück und folgte Isadora Jordão.
Carlos sah ihnen beiden nach. Und hätte nicht tauschen mögen. Zusammen mit Lost und Graciana machte er sich auf den Weg. Der Rettungswagen fuhr im Schritttempo an ihnen vorbei.
»Die Filialleiterin«, wandte Graciana sich an Carlos, »ist das immer noch Senhora Mafalda Bento? Weißt du das?«
»Ich war ewig nicht mehr hier. Aber ja, müsste sie sein.«
»Ich brauch sie hier.«
Carlos Esteves nickte und zückte sein Handy.
Júlio Moreno war ein schmaler, sehniger Kerl, der Graciana nur um eine halbe Kopflänge überragte. Er trug Jeans, ein ausgewaschenes hellblaues Hemd und eine Spiegelreflexkamera, die über seiner linken Schulter baumelte. Moreno war erst 39 Jahre alt, aber sein Haar war trotzdem schon von einem silbrigen Grau.
Graciana hatte ihn neben einen Orangenbaum gebeten, der ihnen Schatten bot. Lost stand neben ihr, um zu kontrollieren, ob der Mann sie belog.
»Sie sind Senhor Júlio Moreno.«
»Sim.«
»Sie haben den Notruf abgesetzt.«
»So ist es.«
»Kommen Sie, erzählen Sie mir was darüber.«
Moreno nickte. Er entnahm einem abgegriffenen Etui mit Selbstgedrehten eine Zigarette, zündete sie sich an, nicht provokant, sondern eher nebenbei, zog daran und nickte erneut: »Ich war gerade auf dem Weg nach Luz de Tavira, mit der Vespa da.« Moreno deutete auf eine hellblaue Vespa mit dunkelbraunem Sitz.
Er kommt nicht von hier, dachte Graciana. Kein Mensch in der Gegend sagte Luz de Tavira. Denn Luz de Tavira war außer Luz bei Lagos an der felsigen Westküste das einzige Luz weit und breit.
»Und dann, ich kam gerade um die Kurve, gab es diesen Knall. Das Heck des Wagens ist in die Bank geflogen. Überall waren Splitter. Ja, dann hab ich angehalten und den Notruf gewählt.«
Er kniff die Augen wegen der Sonne etwas zusammen und schaute wie Carlos und ein paar andere von der GNR hinüber zu dem Gebäude, das Miguel Duarte in seinem Anzug gerade vorsichtig betrat. Isadora Jordão war in das Autowrack gekrochen und nahm Proben, wie es aussah.
»Haben Sie jemanden gesehen?«, fragte Lost.
»Nein. Nicht gleich«, schränkte Moreno seine Aussage ein, »nach der Explosion war hier ungefähr eine Minute lang nichts los. Und dann kamen die Bauern vom Olivenfeld. Und die beiden Radfahrerinnen.«
»Nach der Explosion hatten Sie die Filiale also im Blick?«, vergewisserte Graciana sich.
Moreno nickte.
»Und es ist keiner reingegangen?«
»Nein.«
Sie runzelte die Stirn und blickte zu Lost, der in sich gekehrt wirkte und über diesen Umstand ebenso zu stolpern schien wie sie.
»Was machen Sie mit der Kamera, Senhor Moreno?«
»Fotos. Ich arbeite für den Público.«
Graciana merkte auf. Der Público gehörte zu den seriösen Tageszeitungen Portugals, in denen es nicht nur um Klatsch, Verbrechen und Fußball ging. Ihr Ex-Freund arbeitete für dasselbe Blatt, allerdings von Lissabon aus.
»Wo wohnen Sie?«
»Ich habe mir für ein Jahr ein Haus in Laranjeiro gemietet, bis ich was Dauerhaftes gefunden habe. Die Villa Azul.«
Laranjeiro war eine kleine Ansammlung von ein paar Häusern um ein paar Straßen, in die sich bis auf ein paar Wanderer niemand zufällig verirrte. Es lag keine zehn Autominuten von Fuseta entfernt.
»Ich erlasse jetzt eine Nachrichtensperre, Senhor Moreno«, informierte sie ihn sachlich. Sie hatten bei einigen Fällen in der Vergangenheit Probleme mit Pressevertretern gehabt, die bei der Jagd nach einer Schlagzeile Täterwissen preisgegeben hatten.
Der Journalist nickte gelassen, als beträfe ihn das nicht. »Das wird nicht viel nützen, fürchte ich«, sagte er und deutete mit dem Kopf zu den Absperrungen, hinter denen die Trauben an Schaulustigen angewachsen waren.
Natürlich, die Sache würde wie ein Lauffeuer die Runde machen, ein Bombenattentat hatte es hier schließlich seit Menschengedenken nicht gegeben. Spätestens heute Abend würde es auf den Straßen und in den Bars Fusetas und der ganzen Umgebung das Gesprächsthema sein.
»Ja, aber ich will nicht, dass Einzelheiten an die Öffentlichkeit dringen. Haben Sie Fotos gemacht?«
Er schüttelte den Kopf. Dann nickte er mit einem lässigen Lächeln, das sie ärgerte, und reichte ihr die Kamera: »Sie können es gerne überprüfen.«
»Werde ich«, antwortete sie und nahm die Kamera entgegen, die schwerer war, als sie erwartet hatte.
Dann gab es einen Knall, der sie alle zusammenzucken und instinktiv die Köpfe einziehen ließ. Zwei Jungs hinter der Absperrung kicherten. Einer von ihnen hatte mit einem Holzknüppel gegen eine Blechtonne geschlagen. Eine Frau um die dreißig, vermutlich die Mutter, packte die beiden und zerrte sie schimpfend davon.
Graciana öffnete mit einem geübten Griff das Fach für die Speicherkarten und nahm sie heraus, bevor sie die Kamera an den Reporter zurückgab.
Der nahm sie wieder entgegen und hängte sie sich über die Schulter.
»Wo arbeiten Sie?«
»In der Redaktion in Faro.«
»Gut. Ich lasse Ihnen die Speicherkarten zukommen. Und jetzt verlassen Sie bitte mit Ihrer Vespa den abgesperrten Bereich.«
Carlos trat von der Straße zu ihnen in den Schatten: »Senhora Mafalda ist da.«
Senhora Mafalda Bento flatterten sichtlich die Nerven. Sie war eine ungewöhnlich große und schmale Frau um die sechzig, mit lockigem grauem Haar und Brillengläsern so dick, dass sich ihre Augen dahinter zu Stecknadeln verdichteten. Sie trug ein luftiges Sommerkleid in Weiß und Hellblau und wartete im Schatten einer Pinie innerhalb des abgesperrten Bereichs. Mit freiem Blick auf »ihre« Filiale – oder das, was noch von ihr übrig war.
»Meu deus«, sagte sie bei dem Anblick und schlug das Kreuz vor ihrer Brust.
»Ja, es ist schlimm, wenn man zum ersten Mal sieht, was eine Bombe anrichten kann«, schnitt Luís auf. Er hatte seine Sonnenbrille aufgesetzt, die Daumen in die Vordertaschen seiner Hose versenkt und stand breitbeinig neben ihr.
»Olá, Senhora Mafalda«, begrüßte Graciana sie.
»Olá, Graciana. Ist da noch was zu retten?«
»Schwer zu sagen. Wenn wir fertig sind, muss das ein Statiker beurteilen. Sollte die Filiale nicht geschlossen werden?«
»Ja, seit zwanzig Jahren. Was ist denn passiert?«
»Jemand hat eine Autobombe gezündet. Wie es aussieht, ist die Rückwand der Schließfächer dabei weggerissen worden – und von denen sind wohl welche betroffen. Wir haben schon jede Menge Banknoten eingesammelt. Dollars.«
»Eine Autobombe?«, fragte die Frau fassungslos.
»Ja.«
»Das, ähm … Das ist doch … Das kann doch …«
Ihr fehlten sichtlich die Worte, weshalb Graciana ihr aushalf: »Ja, so was ist hier noch nie passiert.«
Der Blick von Senhora Mafalda ging wieder hinüber zur Bank. »Oh je.«
»Es tut mir leid.« Graciana erinnerte sich, dass sie die einzige Mitarbeiterin in der Filiale war. Leiterin der Außenstelle, der Kreditvergabe und Frau am Schalter in Personalunion. »Vielleicht bringen sie dich in einer anderen Filiale unter.«
Senhora Mafalda schüttelte den Kopf: »Ich will hier nicht weg. Ich bin nie viel rumgekommen, ich war nur mal in Lissabon – und hatte schreckliches Heimweh. Ich hab alles hier vermisst, vor allem das Licht, du weißt schon. Ich bin jetzt 63, ich geh hier nicht mehr weg.«
Für Graciana waren diese Worte wie das sanfte Streicheln der Sonne im Nacken. Unvermutet, warm. Geborgen. Sie verstand genau, was Senhora Mafalda empfand. Und deutete ein Nicken an.
»Gab es Videoüberwachung?«
Senhora Mafalda nickte, und Graciana war hellwach. Selbst Luís dachte für einen Augenblick nicht an seine Pension, die näher rückte wie ein garantierter Lottogewinn.
»Welcher Bereich ist da überwacht worden? Nur drinnen oder auch draußen?«
»Eine für außen, zwei für den Eingang und den Schalterbereich.«
Graciana schaute hinüber zu der Bank, deren rechter Bereich ziemlich unversehrt aussah.
»Wie viele Schließfächer hat die Filiale?«
»Vier.«
»Nur vier?«
»Die Bank ist 1914 gebaut worden. Es ist eine Genossenschaftsbank«, erinnerte Senhora Mafalda sie, »damals gab es nicht viele Reiche, die ihr Geld da untergebracht haben. Damals haben vier davon gereicht, und wir haben nie neue dazubauen lassen.«
»Gut. Ich hoffe, wir können das … Gebäude bald zur Begehung freigeben. Ich möchte, dass du die Besitzer aufforderst, ihre Fächer auf Vollständigkeit zu überprüfen. Dazu wendest du dich bitte an Senhor Dias, ihr kennt euch ja – der gewährt den Besitzern dann Zutritt, nachdem sie sich ausgewiesen haben.«
Luís’ Gesichtszüge erschlafften: »Heute ist Sonntag.«
3.
Eine halbe Stunde später hatte Duarte per Funk Entwarnung gegeben.
Jetzt saß er klitschnass vor Schweiß auf einem Findling und trank mit großen Schlucken aus einer der Flaschen mit eiskaltem Wasser, die Graciana hatte besorgen lassen. Sein Schutzanzug lag vor seinen Füßen, als hätte man einem Astronauten die Luft rausgelassen. Obwohl ihm die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben stand, bemühte er sich, aufrecht zu sitzen und auch sonst Haltung zu bewahren.