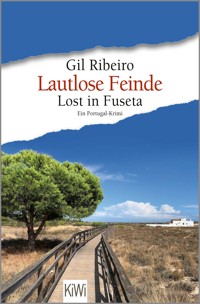
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Leander Lost ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein tödliches Spionagenetz an der Algarve – Leander Lost ermittelt in seinem bisher gefährlichsten Fall! Am Tag vor der Hochzeit von Leander Lost und Soraia wird der Zollbeamte André Bento getötet, als er versucht, die Entführung seiner Enkelin zu verhindern. Das Kind wird befreit, aber die Entführer entkommen. Peu à peu deckt Lost mitten in Portugal ein russisches Spionagenetz auf – mit fatalen Folgen. In einer berührenden Zeremonie geben sich Leander und Soraia endlich das Ja-Wort, und die Hochzeit im kleinen Kreis endet in einem Straßenfest in den Gassen Fusetas. Parallel dazu trifft Victor Fjodorow, Oberst des russischen Auslandsgeheimdienstes, in Portugal ein – mit einer hochriskanten Mission im Gepäck. Nur wenn diese gelingt, wird seine Tochter aus einem sibirischen Gefängnis entlassen. Außerdem findet sich mit Michael Learner ein hochrangiger US-Militär in Faro ein. Er hat einen Koffer bei sich, den er nicht aus den Augen lassen darf. Leander Lost bemüht sich fieberhaft, die Motive für Bentos Mord aufzuklären. Denn es werden zwei weitere Menschen, die untereinander und mit Bento in Verbindung standen, ermordet. Dabei stößt das Team auf ein russisches Spionagenetz, das bis jetzt »geschlafen« hat. Es stellt sich heraus, dass ein »Sandmann« dieses Netz allmählich ausschaltet. Als die Ermittlungen zu Victor Fjodorow führen, verübt der Sandmann einen Anschlag auf Lost und trifft Soraia. Die Ärzte geben ihr keine Chance ... Gil Ribeiros Krimireihe um den Asperger-Autisten Leander Lost entführt die Leser nach Portugal und besticht durch feinsinnigen Humor, ein unverwechselbares Lokalkolorit und spannende Fälle. »Lautlose Feinde« ist der siebte Band der erfolgreichen Reihe, deren erste beiden Bände bereits als ARD-Serie verfilmt wurden. Tauchen Sie ein in die einzigartige Welt von Leander Lost! Die Krimis mit Kommissar Leander Lost sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Lost in Fuseta - Spur der Schatten - Weiße Fracht - Schwarzer August - Einsame Entscheidung - Dunkle Verbindungen - Lautlose Feinde Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gil Ribeiro
Lautlose Feinde
Lost in Fuseta. Ein Portugal-Krimi
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Gil Ribeiro
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Gil Ribeiro
Gil Ribeiro, geboren 1965 in Hamburg, landete 1988 während einer Interrail-Reise quer durch Europa nur dank eines glücklichen Zufalls an der Algarve und verliebte sich umgehend in die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Portugiesen. Seitdem zieht es ihn immer wieder in das kleine Städtchen Fuseta an der Ost-Algarve, wo ihm die Idee zu »Lost in Fuseta« kam. In seinem deutschen Leben ist Gil Ribeiro alias Holger Karsten Schmidt seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten Drehbuchautoren Deutschlands. Holger Karsten Schmidt lebt und arbeitet bei Stuttgart.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Am Tag vor der Hochzeit von Leander Lost und Soraia wird der Journalist im Ruhestand André Bento getötet, als er versucht, die Entführung seiner Enkelin zu verhindern. Das Mädchen wird befreit, aber die Entführer entkommen. Peu à peu deckt Lost mitten in Portugal ein russisches Spionagenetz auf – mit fatalen Folgen.
In einer berührenden Zeremonie geben sich Leander und Soraia endlich das Jawort, und die Hochzeit im kleinen Kreis endet in einem Straßenfest in den Gassen Fusetas. Parallel dazu trifft Victor Fjodorow, Oberst des russischen Auslandsgeheimdienstes, in Portugal ein – mit einer hochriskanten Mission im Gepäck. Nur wenn diese gelingt, wird seine Tochter aus einem sibirischen Gefängnis entlassen. Außerdem findet sich mit Michael Learner ein hochrangiger US-Militär in Faro ein. Er hat einen Koffer bei sich, den er nicht aus den Augen lassen darf.
Leander Lost bemüht sich fieberhaft, die Motive für Bentos Mord aufzuklären. Denn es werden zwei weitere Menschen, die untereinander und mit Bento in Verbindung standen, ermordet. Dabei stößt das Team auf ein russisches Spionagenetz, das bis jetzt »geschlafen« hat. Es stellt sich heraus, dass ein »Sandmann« dieses Netz allmählich ausschaltet. Als die Ermittlungen zu Victor Fjodorow führen, gerät plötzlich Soraia in Lebensgefahr …
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2025, 2026, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © privat
Karte: Oliver Wetterauer
ISBN978-3-462-31290-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
www.kiwi-verlag.de/karte-lautlose-feinde
Inhaltsverzeichnis
Motto
Personen
1. Kapitel
TAG EINS
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
TAG ZWEI
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
TAG DREI
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
TAG VIER
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Epilog
Soundtrack
Danksagung
Die größte Kunst ist es, den Feind
ohne Schlacht zu unterwerfen.
Sun Tzu, Die Kunst des Krieges
A good hockey player plays where the puck is.
A great hockey player plays where the puck
is going to be.
Wayne Gretzky
Personen
Da in diesem Buch nicht jeder ist, wer er vorgibt zu sein, und manche unter einem oder gleich mehreren falschen Namen aktiv sind, erfolgt hier eine alphabetische Aufzählung der wichtigsten Nebenfiguren, die in diesem siebten Fall eine Rolle spielen:
Raica Afonso
Taschendiebin
André Bento
Clara Bento
Gabriel Bento
Maria Bento
Zöllner und Mordopfer
seine Tochter
sein Schwiegersohn
seine Enkelin
Victoria Coen
arbeitet für einen Nachrichtendienst
Jack Davis
kanadischer Geschäftsmann
José Fidalgo
GNR-Beamter aus São Brás de Alportel
Victor Fjodorow
das »Chamäleon«
Kolja Orlow
der »Sandmann«
Michael Learner
US-amerikanischer Oberst
Diogo Lima
Ex-Agent des portugiesischen Geheimdienstes
Vanessa Novo
Mordopfer in Lissabon
Mascha Karpenko
Fjodorows Assistentin
Raphael Romão
portugiesischer Geschäftsmann
Thierry Roux
französischer Geschäftsmann
Gloria Santos
Direktorin für Disziplinarmaßnahmen im Innenministerium
Matilda Vaz
Haushälterin von André Bento
Adriana Ventura
portugiesische Investigativjournalistin
Sienna White
leitet ein spezielles Reisebüro
Ewa Zorin
Orlows Assistentin
1.
Sie hatten sich in Strahan, Tasmanien, getroffen, in Tel Aviv und in Luxemburg. In Kihei auf Maui, in Salamanca und in Hamburg. Dieses Mal also in der Upper East Side in Manhattan. Wo der Septemberwind in Form einer warmen Brise durch die Straßen strich und die Kronen der wenigen Bäume in ein sanftes Rauschen versetzte, weil er bereits von den Ausläufern eines heranziehenden Gewitters vertrieben wurde. Eine Vorahnung des Herbstes erreichte New York City.
Sienna White wusste, er kam nicht gern hierher, obwohl er nur 800 Kilometer entfernt in Toronto in Kanada lebte. Die besseren USA, wie einige unkten. Aber gemessen an den Weiten Nordamerikas nur einen Katzensprung vom Pappardella entfernt, einem kleinen Restaurant Ecke Columbus Avenue und West 75th Street in der Upper East. Ein steinerner Schwarz-weiß-Boden und Fotografien aus Italien an den Wänden, die langsam vergilbten. Zusammen mit den weißen Tischdecken und der mit Holz verkleideten Decke vermischten sie sich zu jener Erinnerung, die jeder, der noch nie in Italien gewesen war, an das Land zu haben glaubte.
Auf der tiefroten Markise draußen prangte in verwaschenem Weiß der Schriftzug Cucina tipica Italiana. Was von den meisten Passanten als Verheißung und einigen wenigen als Warnung aufgefasst wurde.
Im Innenraum untermalte Andrea Bocellis Con te partirò diese Illusion und die abgewetzten Sitzflächen der Barhocker komplettierten den legeren Eindruck, sich im Pappardella in einer Art erweitertem Wohnzimmer zu befinden. Bei Freunden.
Auf all das blickte Sienna White, die sich an ihrem Tisch für den Platz auf der Bank entschieden hatte. Mit dem Rücken zu den Fotos aus Rom und Neapel. Und mit einem Exemplar der New York Times, das sie neben ihrer Handtasche abgelegt hatte.
Sienna White würde nächstes Jahr 45 werden. Sie war brünett, groß und dünn. Sie trug flache Schuhe und wenig Schminke, eine weiße Baumwollhose und eine olivefarbene Bluse, die ihren mediterranen Teint unterstrich. Dabei mied sie, wenn möglich, die Sonne.
Aber angeblich hatte irgendeine Urgroßmutter in ihrem weitverzweigten Stammbaum am Mittelmeer gelebt und diesen Hautton in feinen Schattierungen an ihre Nachfahren weitergegeben.
Jack Davis betrat das Lokal und bekam den Tisch neben ihr zugewiesen, was kein Zufall war, denn er hatte ihn reserviert. Er war knapp ebenso groß wie sie, Bauchansatz und kleine Hände, die frei von Schwielen oder anderen Hinweisen auf körperliche Arbeit waren.
Die Schläfen grau, die Geheimratsecken tief, ein Allerweltsgesicht mit einem wachen, aber wässrigen Blick. Es gab nichts an seiner Erscheinung, an seiner Art zu sprechen, sich zu bewegen oder auch nur zu atmen, was einen aufmerken ließ. Davis war niemand, an den man sich später erinnern würde. Ein Grad von Unscheinbarkeit, der an Unsichtbarkeit grenzte.
Auch seine Stimme, mit der er bei dem beleibten Kellner die Bestellung aufgab, hatte nichts Markantes an sich.
Alles an ihm lud dazu ein, ihn zu vergessen. Er war – Zufall oder Absicht – der perfekte Niemand.
Davis hatte sie zwar mit einem Lächeln und einem angedeuteten Nicken begrüßt, bevor er am Nebentisch Platz genommen hatte – wie man das als ein höflicher Mensch eben tat –, sie seitdem aber mit keinem Blick bedacht.
Er trug Slipper und eine hellgraue Sommerhose, dazu ein blaues Shirt und ein helles Leinenjackett.
Seine Kleidung wechselte über die Jahre und Orte. Keine Hose, kein Hemd, keine Jacke, die Sienna je ein zweites Mal gesehen hätte.
Manchmal ruhte eine Brille auf seinem Nasenrücken. Heute nicht.
Das Auffallendste an Jack Davis war eine Narbe, eine Art Schmiss am linken Auge, der ein paar Lachfältchen vertikal durchtrennte. Eine längst verheilte Verletzung, wie Sienna White vermutete.
Analog zu seiner Kleidung war er auch kulinarisch schwer zu fassen. Aus den bisherigen Treffen hatte sie abgeleitet, Davis sei kein Freund von Fisch, um jetzt zu hören, wie er neben einem Wasser und einem leichten Weißwein die Ravioli di Astice bestellte – mit Hummer gefüllte Ravioli.
Er war, wurde ihr bewusst, nicht zu greifen. Buchstäblich nichts an ihm wiederholte sich, alles war einer ständigen Veränderung unterworfen.
Als passte er sich mit traumwandlerischer Präzision an die jeweilige Situation an. Wie ein Chamäleon.
Auch diese Traurigkeit, die heute in seinen Gesten lag, in seinem Blick, der abhandengekommenen Leichtigkeit seiner Bewegungen. Ganz dezent hatte sie von seinem Wesen Besitz ergriffen. Im Blick, in den Augenbrauen, in der Art, wie er die Speisekarte angefasst hatte. Sienna hätte es nicht konkret an etwas festmachen können, aber sie spürte seine Schwermut. Eine jener hilflosen Art, die etwas Unbezwingbarem galt, der Schlechtigkeit der Welt etwa, obwohl Sienna sich sicher war, dass Davis’ Traurigkeit nicht ihr galt. »Entschuldigen Sie, wenn ich Sie störe«, sagte er, »aber sind Sie von hier? Sind Sie New Yorkerin?«
Kontaktaufnahme.
Sienna schenkte ihm ein freundliches Lächeln: »Ja. Kann ich Ihnen helfen?«
»Ich hoffe. Ich möchte die Frick Collection besuchen.«
»Das ist gar nicht weit von hier. Genauer gesagt: Ecke 70th Street und Fifth Avenue.«
»Denken Sie, es lohnt sich?«
Ist Ihnen jemand gefolgt?
»Ja«, antwortete Sienna White und unterstrich ihre Worte mit einem Nicken, »ich bin überzeugt, es ist einen Besuch wert.«
Nein, mir ist niemand gefolgt.
Sie bestellte beim Kellner einen Espresso und die Rechnung. Beim Griff nach ihrer Handtasche schob sie die Ausgabe der New York Times beiläufig ein Stück von sich weg und in seine Richtung.
Der Kellner kam zurück und legte ihr den ausgedruckten Beleg auf den Tisch: »42,50.«
Sienna gab ihm 50 Dollar: »Stimmt so.«
»Danke.«
Keine Karte. Keine digitalen Spuren.
Davis’ Anweisung. Von Anfang an. Strikt.
Keine Spur im Netz. Nirgends. Nie.
Deswegen oldschool: via Zeitung.
Der Kellner wandte ihnen den Rücken und sich einem anderen Gast zu.
Sienna stand daraufhin ohne Hast auf und Davis registrierte, wie sie mit ihrem Körper dabei die mögliche Blickachse des Kellners oder anderer Gäste auf ihre New York Times geschickt versperrte, die Davis nun an sich nahm.
»Die Collection hat noch zwei Stunden geöffnet. Aber wenn Sie es nicht schaffen: Sie öffnet morgen wieder um neun Uhr.«
»Vielen Dank, aber ich versuche es heute noch, ich fürchte, es kommt bald schwerer Sturm auf.«
Es wird einen Krieg geben.
Sie wollte nicht, aber Sienna schluckte leer. Das Lächeln durchzuhalten, fiel ihr schwer und so wurde es erst angestrengt und dann hölzern. Sie schaute ihm in die grauen Augen, um herauszufinden, ob sie sich verhört hatte. Hatte sie nicht: Davis deutete ein Nicken an und seine Miene war ernst.
Sofort stürzten die Fragen auf sie ein: Wann? Wer? Wo? Warum?
Aber natürlich durfte ihr keine davon über die Lippen kommen.
»Vielleicht kommt der Sturm ja auch nicht«, fügte Davis hinzu, doch Sienna erkannte, dass er mit diesen Worten lediglich seine schützende Hand über sie legte, um sie nicht zu beunruhigen. Wie nach Timothys Tod.
Der irgendwelchen Regierungsstellen in Washington auf einer seiner Geschäftsreisen in den Nahen Osten einen Gefallen erwiesen hatte. Welchen, darüber hatte er sich ausgeschwiegen. Seine Leiche wurde drei Tage später am Wüstenrand gefunden. Eine Frau erschien bei ihr zu Hause, die wie die beiden Brüder hieß, die den Film »Fargo« gemacht hatten, Coen. Sie überbrachte ihr behutsam und mitfühlend die Nachricht von Timothys Tod. Und berichtete ihr von einem tragischen Unfall mit Fahrerflucht.
Da trat Jack Davis in ihr Leben. Mit einem Foto von Timothy, das die Erzählung von einem Unfall als Lüge entlarvte. Coen hatte sie belogen. Und Davis arbeitete als Journalist und Kriegsreporter für investigative Plattfomen, Wikileaks, Bellingcat und andere: »Timothy wird nicht wiederauferstehen. Er ist tot. Aber wenn Sie in seinem Sinne handeln wollen, sein Andenken bewahren wollen, dann geben Sie mir die richtigen Informationen.«
Mit tränenverschleiertem Blick hatte sie die Augen von dem Foto gelöst und auf ihn gerichtet: »Ich will denen schaden, die dafür verantwortlich sind.« Er hatte genickt und ihre Hand ergriffen, sanft. »Miss White … Sienna …, nichts wird Timothy lebendig machen.« »Ich weiß«, hatte sie geschnieft. Es folgte ein langer, stummer Blick. »Was brauchen Sie, Mister Davis?« »Wann wer wohin reist, unter welchem Namen und wie lange.«
Und jetzt saßen sie hier im Pappardella und es stand ein Krieg im Raum. Sie wusste, es war gegen alle Absprachen, gegen seine Regeln, aber sie musste es wissen.
»Sehen wir uns wieder?«, flüsterte sie.
Da er nicht antwortete, schaute sie auf.
»Hoffentlich nach dem Sturm«, gab er zurück und sein Blick war frei von Zorn oder Vorwurf. Ganz im Gegenteil: Er war warm. Wie eine sanfte Berührung, die sie fühlte, obwohl sie ausblieb.
Nachdem Sienna White das Pappardella verlassen hatte und Jack Davis noch auf die Ravioli wartete, blätterte er in der Ausgabe der New York Times, die Sienna White absichtlich liegen gelassen hatte. Auf Seite elf fand er eine handschriftliche Notiz. Für die Zielperson, einen Oberst Michael Learner, waren fünf Hotels in Portugal für den identischen Zeitraum gebucht worden. Alle, das wusste Davis, würden bezahlt werden. Aber Sienna wusste, in welchem er tatsächlich einchecken würde: dem Da Gama in Olhão. Die Zimmer in den anderen vier Hotels würden leer bleiben.
Das war die entscheidende Information.
Davis, der seine Merkfähigkeit über die Jahre trainiert und gesteigert hatte, sog jedes Detail auf, bevor er mit der Notiz in der Hosentasche die Toiletten aufsuchte und sie dort säuberlich zerrissen davonspülte.
Für den Fall, dass man ihn beim Verlassen des Lokals verhaften würde. Was nicht geschah.
Da Gama in Olhão. 20.–24.09.
Dort würde es stattfinden. Der Coup. Die Rettung. Seine Mission. Alles.
TAG EINS
2.
Der 24. September 2021 begann wie die Tage zuvor: Die Sterne waren verblichen, die Kühle der Nacht – 22 °C – schwand und ein paar Wölkchen zogen weiter nach Osten, Richtung Spanien. Sie schwebten einem Horizont entgegen, den die aufgehende Sonne bereits in Brand setzte.
Im Laufe des Tages würde wieder ein Azurblau den Himmel beherrschen, das es nur hier gab.
Um 4:47 Uhr meldete sich Desgraçado zu Wort, der Hahn in ein, zwei Kilometer Entfernung.
Desgraçado hatte eine kräftige Stimme, als Mensch hätte es zum Opernsänger gereicht. Der Wind, der vom Atlantik über die Ria Formosa strich, ein riesiges Naturschutzgebiet aus vorgelagerten Inseln an der Algarve, trug seine Stimme weiter hinein in den Ort.
So kam es, dass ihm kurz darauf im nördlichen Teil Fusetas ein zweiter Hahn nacheiferte, O Segundo, der immer vergaß, als Erster zu krähen. Ab 4:51 Uhr ertönte in der Folge ein vielstimmiges Krähen bis hoch nach Moncarapacho im Norden und bis nach Olhão, dem geschichtsträchtigen Fischerort im Westen mit den kubischen Bauten, der deshalb den Beinamen Würfelstadt trug.
Als der Weckruf der vielen Hähne gegen 4:56 Uhr abebbte, meldete sich im Nachbarort Arroteia, kaum größer als eine Siedlung, der erste Hund zu Wort. Sein Gebell wurde erwidert, erst ein-, dann vier-, dann achtfach. Das Kläffen der Vierbeiner pflanzte sich fort wie eine schnelle Flut, verzweigte sich, nahm Abkürzungen, konzentrierte sich an einer Stelle, schwappte weiter, unterlief einer Teilung und wurde dann nach einer Weile – genauer gesagt nach acht Minuten – wieder schwächer, um nach und nach zu versickern. Um 5:04 Uhr gab es noch ein letztes Knurren von Edma, einer korpulenten Bernhardinerhündin, die wie immer das letzte Wort hatte.
Bei geschlossener Terrassentür wäre das alles kaum ins Schlafzimmer des Canto das Baleias gedrungen, dem neuen Zuhause von Soraia und Leander am westlichen Rand von Fuseta, einem kleinen Fischerdorf, das sich in vielerlei Hinsicht noch im Dornröschenschlaf befand.
Im Gegensatz zu Soraia, die wegen des frühmorgendlichen Konzerts seufzte und sich in der wenig aussichtsreichen Hoffnung auf die andere Seite drehte, um in dieser Position vielleicht schneller zurück in den Schlaf zu finden. Leander, der auf dem Rücken neben ihr lag und die Augen geschlossen hatte, lächelte leicht.
All das – erst die Hähne, dann die Hunde – ereignete sich hier morgens in verlässlicher Regelmäßigkeit. Genau das liebte Leander Lost und ließ ihn zufrieden lächeln. Er schätzte diese Verlässlichkeit von Abläufen und festen Routinen, die dem Alltag Ordnung verliehen. Und ihm Halt und Orientierung boten.
Leander Lost war imstande, eine hohe Flexibilität an den Tag zu legen, wenn es die Situation erforderte. Er war Sub-Inspetor der portugiesischen Kriminalpolizei, der Polícia Judiciária mit Sitz in Faro an der Algarve, und in seiner Dienstzeit war er des Öfteren mit Situationen konfrontiert, die sich nicht vorab planen oder vorhersehen ließen.
Bisher hatte er die Mehrzahl davon meistern können, aber es kostete ihn enorm viel Konzentration und Anstrengung, ein stiller Kraftakt, der von der Außenwelt in der Regel unbemerkt blieb.
Jetzt, als er einen warmen, feuchten Kuss auf seiner nackten Schulter spürte, öffnete er die Augen und blickte zur Seite – Soraia, die nicht schlafen konnte und sich an ihn schmiegte. Ihre Haut roch nach Paprika. Und als sie ihn verschlafen anlächelte, bildeten sich Grübchen in ihrem Gesicht.
Sein Faible für Grübchen würde Leander Lost zeit seines Lebens ein Rätsel bleiben. Irrational, nicht nachvollziehbar, evolutionär ohne jede Bedeutung. Und gerade deshalb so faszinierend. Magie vielleicht, auch wenn das ein Begriff war, der sich in Losts von Ratio und Logik geprägter Weltsicht nicht in dessen aktivem Wortschatz befand.
In Soraias dagegen schon. Sie fühlte sich unfähig, die Anziehungskraft, die Lost auf sie ausübte, in Worte zu fassen, geschweige denn zu begründen. Obwohl sie als Kindergärtnerin eigentlich genug Routine und Behutsamkeit mitbrachte, um den Kindern die Welt altersgerecht zu erklären. Und damit auch all das, was auf die Kleinen wie ein Wunder oder ein Mysterium wirken musste: Warum schweben Schneeflocken? Wie weinen Delfine?
Manche Erklärungen rauben den Dingen ihren Zauber, hatte ihre Mutter ihr gesagt, als sie noch klein war.
Und genau das beherzigte sie jetzt und küsste Leander erneut. Dieses Mal auf den Hals.
Wortlos nahmen sie sich in die Arme und genossen die Berührung und den vertrauten Geruch des jeweils anderen.
Um 5:20 Uhr, wusste Leander, würden die Flüge von Faro aus starten.
Die Abflug- und Einflugschneise verlief unter anderem über Fuseta und Moncarapacho.
5:20 Uhr: Abflug Easyjet 2409 nach Genf. 5:45 Uhr: Abflug Ryanair 2306 nach Dublin. 6:05 Uhr: Ankunft Eurowings 1208 aus London. 6:10 Uhr: Ankunft Ryanair 1908 aus Birmingham. 6:30 Uhr: Abflug Vueling 0412 nach Barcelona. Und so weiter.
Leander hatte jede Uhrzeit, Fluggesellschaft und jeden Abflug- oder Zielflughafen in seinem Gedächtnis hinterlegt. Der Tag nahm die bekannten Konturen an, was ihn entspannte.
Soraia umarmte ihn nun fester, ihr Mund fand seinen.
Und ja: Bei dem langsamen, zärtlichen Kuss durchflutete ihn dabei noch immer das Gefühl wie bei der allerersten Berührung ihrer Lippen: Als spritzte ihm jemand Kontrastmittel, das Leander wie eine warme Welle durchströmte, die an Zehen und Fingerkuppen zurückgeworfen wurde und angenehm von innen über die Schädeldecke strich.
Schön!
Um 7:49 Uhr wurde Maria Bento entführt.
3.
Ameisen sind die besten Lehrmeister in puncto Gründlichkeit.
Matildas Großvater hatte es ihr immer wieder gesagt. Sie erinnerte sich dabei an die Brille mit den runden Gläsern, die seine Augen so unnatürlich vergrößerten, weshalb sie als Kind vor Faszination den Blick kaum von ihm lösen konnte.
Oft saß er auf einem alten Plastikstuhl im Schatten der überdachten Veranda und löste Kreuzworträtsel und döste danach oder andersherum. So oder so war Punkt sechs Uhr am Abend ein Gläschen Portwein fällig. Das lockerte die Zunge und durchblutete die Wangen. Mit zunehmendem Alter begann er dann umso mehr von früher zu erzählen, desto weniger es im Jetzt zu berichten gab.
Ließ sie den Krümel eines Kekses oder einer Scheibe Brot fallen, stieß alsbald ein Ameisenspäher darauf. Und in Windeseile verbreitete sich die freudige Nachricht unter seinen Artgenossen und es entstand jenes hektisch anmutende Gewusel Dutzender, dann Hunderter und schließlich Tausender Ameisen, die diesen Fund rasend schnell abtransportierten. Das galt auch für ganze Brotlaibe, Hähnchenschenkel, Eis und dergleichen.
»Olhe«, sagte ihr Großvater dann und deutete mit seinem dürren, von Arthrose geplagten Zeigefinger auf das schwärzliche Band, das sich in sanften Linien über den Boden oder die Anrichte in der Küche schlängelte.
Olhe – schau.
Etwas stimmte nicht, meinte Matilda Vaz zu spüren, als sie mit dem von der Sonne ausgeblichenen Kleinwagen die schmale Auffahrt zur Quinta von Senhor André Bento hinauffuhr.
Das Haus, auf einer Seite von einer Gruppe hoher Pinien umgeben, lag auf einem Hügel, den es sich – obwohl jeweils weit über hundert Meter voneinander entfernt – mit drei anderen Gebäuden teilte. In der Morgensonne warfen die Bäume lange Schatten. Ein sandiger Feldweg führte in engen Kurven hier hinauf.
Die Quinta von Senhor André war durch ihre exponierte Lage zwar der Sonne ausgesetzt, die noch recht tief am azurblauen Himmel stand, aber im Gegensatz zu den Häusern im Tal auch dem frischen Wind, der salzgeschwängert war und Metall in dieser Gegend schnell korrodieren ließ.
Das weiß gestrichene Holztor zur Einfahrt auf das Grundstück war geöffnet und der alte, silberfarbene Pick-up von Senhor André stand an seinem Platz im Schatten eines Johannisbrotbaumes. Obwohl er heute Vormittag eigentlich Dienst hatte.
Aber das war nichts Ungewöhnliches. Senhor André arbeitete am Flughafen in Faro beim Zoll. Und hin und wieder musste er für einen kranken Kollegen in einer anderen Schicht einspringen oder bei einer groß angelegten Kontrolle kurzfristig aushelfen. Vielleicht hatte er gestern Nacht eine Sonderschicht einlegen müssen und konnte deswegen heute ausschlafen. Oder er frühstückte gerade auf der Holzveranda.
Wie auch immer: Matilda Vaz schnappte sich den Karabinerhaken mit den Schlüsseln der Häuser, die sie betreute, und ging zur Eingangstür. Sie zückte den mit dem gelben Streifen darauf, denn Bento hatte das Haus Casa Girasol getauft, weil seine Frau Sonnenblumen geliebt hatte.
Nach ihrem Tod vor gut acht Jahren war er in ein Loch gefallen. Er hatte das Spielen angefangen im Casino in Monte Gordo, nahe der spanischen Grenze. Als er dort zu seinem Schutz Hausverbot erhielt, spielte er im Casino in Portimão an der Westküste weiter.
Um ein Haar verspielte er die Hypothek auf sein Haus. Aber irgendjemand hatte ihn in letzter Sekunde wohl davor bewahrt.
All das jedenfalls änderte sich mit der Geburt seiner Enkelin Maria. Als hätte ihn die Existenz des Mädchens mit einem Schlag zur Besinnung gebracht: Weil er sonst ihr und den Eltern kaum etwas hätte vererben können außer der haushoch verschuldeten Casa Girasol.
Also mühte er sich ab. Legte Nacht- und Wochenendschichten ein, bildete sich fort, stieg in überschaubarem Rahmen auf und erhielt eine höhere Besoldung.
Es gab ein paar Frauen im Ort, die ein Auge auf den attraktiven Witwer geworfen hatten, doch André Bento schien dieses Kapitel in seinem Leben abgeschlossen zu haben. Was Matilda Vaz ein wenig bedauerte.
Als sie die Tür des Hauses fast erreicht hatte, beschlich sie ein merkwürdiges Gefühl. Später würde man im Ort von Vorhersehung tuscheln.
Matilda hätte selbst nicht benennen können, woher dieses Gefühl rührte. Als hätten sich die Farben ein wenig verändert, die Strömung der Luft oder so etwas.
Mit diesem Eindruck behaftet, wollte sie die Tür des ebenerdigen Hauses in Quelfes öffnen und stellte fest, dass diese nicht abgeschlossen war. Matilda blickte nach unten und entdeckte dort eine Ameisenstraße, die sich in beeindruckender Emsigkeit nach drinnen bewegte.
Ein paar von ihnen schlüpften bereits in der Gegenrichtung unter der Tür hindurch und zurück nach draußen. Sie alle trugen kleine Krümel von irgendetwas mit sich. Gelbe Krümel.
Zum Teil größer als sie selbst.
Ganz sanft legte sie ihre Finger auf die hölzerne Oberfläche der Tür und drückte sie behutsam auf.
Drinnen war es wegen der heruntergelassenen Jalousien dunkler. Und kühler. Die Straße der Ameisen bog nach nur zwei Metern scharf rechts ab. In Richtung Küche.
Matilda Vaz schlug eine satte Geruchsmischung aus Eisen und – war es Ei? – entgegen.
Und ein feines, vielstimmiges Surren.
»Senhor André?«
Keine Antwort.
Und mit dem ersten Blick, den sie in die Küche warf, wusste Martina Vaz es bereits: zwei Stühle neben dem uralten hölzernen Esstisch lagen auf der Seite am Boden. Und dann bemerkte sie etwas längliches Schwarzes, das sich bewegte: die Ameisenstraße, der Matilda nun folgte. Obwohl alle Anzeichen dafür sprachen, dass sie an deren Ende nichts Gutes erwarten würde. Als zöge sie ein Band mit unerbittlicher Bestimmtheit trotzdem hinein.
Hätte sie nicht sofort umkehren und Reißaus nehmen sollen? Die Polizei rufen?
Oder Bentos Tochter, die unten im Ort mit ihrem Mann den Gemüseladen betrieb?
Nichts von alledem tat sie, sondern folgte den Ameisen hinter den Esstisch. Dort lag er: André Bento, ein gedrungener, kräftiger Mann, Mitte, Anfang 60, bäuchlings im Flur.
Das Gesicht aschfahl, die glanzlosen Augen offen.
Das vielstimmige Surren stammte von den Fliegen, die um die Blutlache kreisten, die sich unter Senhor Andrés Körper auf den Bodenfliesen gebildet hatte.
Daher der Geruch von Eisen, schoss es Matilda durch den Kopf. Die Ameisen spazierten derweil an Bentos gebrochenem Blick vorbei, als wäre nichts geschehen. Der dunkle Strom, den sie in ihrer Vielzahl bildeten, gabelte sich vor dem Esstisch, der quasi beidseitig von den Insekten erklommen wurde. Denn darauf befanden sich, gegenüber angeordnet, Besteck, Wassergläser und zwei Teller mit Rührei. Gelbe Krümel. Sie transportierten das Rührei ab, begriff Matilda Vaz. Dann gaben ihr die Beine nach und sie musste sich setzen.
4.
Die Fischer mit den von der Sonne verbrannten Nacken hatten ihren nächtlichen Fang entladen und schlurften nach Hause, um sich schlafen zu legen. Drei, vier von ihnen öffneten noch ein eiskaltes Sagres und tranken es gemeinsam in der Morgensonne. Sie setzten sich vor ihre kleinen, hölzernen Hütten, kaum anderthalb Meter breit und allesamt mit einem spitzen Satteldach ausgestattet. Wie Umkleidekabinen standen sie im doppelten Dutzend nebeneinander und bildeten zusammen ein einseitiges, lückenloses Spalier. Alte, farbige Reusen stapelten sich ebenso wie Netze auf den winzigen Podesten vor ihnen, die es zu reparieren galt.
Von hier aus waren die Männer nur 20 Meter von ihren Booten entfernt, die nun wieder im Kanal bei minimalem Wellengang vor sich hin schaukelten und sich für die nächste Nacht bereithielten.
Aus einem Transistorradio knisterte ein Fado von Ana Moura. Der Schwermut des Stückes wurde von jener Frische der Wind aus den Segeln genommen, die in dem knappen Zeitfenster herrschte, in dem die Kühle der Nacht noch kurz die Oberhand behielt. Sodass die Fischer das Licht der Sonne noch als ein sanftes Streicheln auf den Wangen und den Unterarmen empfanden. Wie die erste Berührung von Verliebten.
Sie rauchten eine Selbstgedrehte und sahen zu, wie der kleine Ort allmählich erwachte und die Läden öffneten, die Cafés aufgesucht wurden und Straßenhändler in Shirts und Espadrilles neben Rechtsanwältinnen im Kostüm eine Bica tranken und sich unterhielten. Denn im Café und vor der Bica waren sie alle gleich.
Wie die Köche oder ihre Gehilfen ausströmten und in der Markthalle in Olhão jene Fische, Krebse und Muscheln begutachteten und kauften, die sie am Mittag und Abend ihren Gästen auf dem Außengrill zubereiten würden.
Der Ansturm der Touristen ebbte um diese Jahreszeit langsam ab, die Hektik der Kellner wich und die Zahl leerer Parkplätze nahm wieder zu. Das Gros der Wohnmobilflotte legte ebenfalls ab.
Alles im Ort manövrierte jetzt auf einen entspannten Herbst zu.
Ein Lieferwagen, der nicht rasch genug einparkte, wurde von einem weißen Cabrio angehupt, wie die Fischer nun beobachteten. Das Cabrio, ein Jaguar, zog recht schnell die schmale Straße weiter am Kanal hoch und stoppte kurz vor dem letzten Bistro, dem Farol, einem kleinen Holzbau in Form eines Oktagons. Mit weißen Tischen und roten Plastikstühlen davor. Über diesen Kanal waren die Fischer von ihrem nächtlichen Streifzug eingelaufen. Die Fähren setzten von hier aus über die Lagune vor Fuseta über, um die Touristen auf den vorgelagerten Inseln abzusetzen, damit sie dort im Atlantik baden oder sich in seinem Angesicht sonnen konnten.
Alles, was mit dem Meer zu tun hatte, mit Fischern, Muschelsammlern, Kite-Surfern, Hausbooten, einfach alles nahm hier seinen Anfang. Und genau dort, zwischen zwei eingezeichneten Parkplätzen, stellte der Fahrer des Jaguars seinen Wagen ab und stieg aus.
Während die Fischer stumm darüber rätselten, ob er sein Auto aus Dummheit oder Überheblichkeit so abgestellt hatte, dass der Jaguar zwei Parkplätze beanspruchte, machte Miguel Duarte sich auf den Weg ins Farol, in dem er verabredet war. Und er wusste die Antwort auf die Frage der drei oder vier Gestalten, die da vor den armseligen Hütten bereits am Morgen Bier tranken – unrettbare Alkoholiker vermutlich –: Weitsicht. Er parkte seinen Augapfel aus Weitsicht so.
Weil sich bei Portugiesen beim Ein- und Ausparken ein anderes Auto erst dann in deren Wahrnehmung schob, wenn sie es spürten. Oder das Geräusch von Metall auf Metall an ihr Ohr drang.
Wenn er das Cabrio so parkte wie jetzt, war es gefeit vor dem Aufschlagen anderer Autotüren. Gewiss, er belegte damit zwei Parkplätze gleichzeitig, aber er war Sub-Inspetor der Polícia Judiciária der Kripo, er durfte das.
Miguel, gebürtiger Sevillano, hatte eine alte Geschichte hierher verschlagen. In die Ödnis der Ostalgarve. Seitdem versah er hier mit einer Mischung aus Widerwillen und Resignation seinen Dienst – und hoffte auf eine Stelle in Lissabon oder Porto, die einzigen Städte dieses Landes, in denen ein Hauch von Weltläufigkeit, Kultur und Stil spürbar war. Von Zivilisation. Nun ja, ansatzweise zumindest.
Fuseta dagegen war von alledem selbstredend bis heute verschont geblieben, ein 2.000-Seelen-Ort, der sich in einem Dornröschenschlaf befand.
Seine beiden Kollegen, mit denen er zum Frühstück verabredet war, Graciana Rosado und Carlos Esteves, stammten, das sprach nicht gegen sie, beide von hier, und sie hatten, das sprach nicht für sie, Fuseta praktisch noch nie verlassen.
Duarte steckte in einem Maßanzug, aber er trug ihn lässig. Er zog sich mit dem Kamm seinen Scheitel nach und entdeckte dann Carlos Esteves, der an einem Tisch vor diesem Laden saß und eine typische Bewegung ausführte: nämlich mit der Hand zu seinem Mund. Natürlich mit etwas Essbarem darin, in diesem Fall einer Bifana. Während eine schier erdrückende Anzahl Portugiesen morgens in einem Café oder einer Padaria ein süßes, rundes Blätterteigtörtchen mit einer – ja – verführerisch guten Creme verdrückte, das Nationalheiligtum Pastel de Nata, verspeiste Esteves bereits ein Schnitzel, das zwischen zwei Weißbrotscheiben steckte.
Alternativ zu dem süßen Pastel wurde zum Frühstück auch gern eine Torrada gegessen, ein geröstetes Bauernbrot, auf dessen Oberfläche Salzbutter gestrichen wurde, die sich sofort verflüssigte.
Carlos Esteves war eine eindrückliche Gestalt: fast 1,90 m groß und halblanges, gelocktes Haar, das ihm bis in den Nacken fiel. Jemand, der den kleinen Dingen des Lebens etwas abgewinnen konnte – zum Beispiel einer Bifana am Morgen.
Ihm gegenüber saß Graciana. Im Gegensatz zu Carlos Esteves war sie ihm innerhalb der Kripo vorgesetzt, also weisungsbefugt. Eine kleine, schmale Person, die eine Jeans trug und Schuhe mit kurzen Absätzen und eine beigefarbene Bluse. Sie war Mitte dreißig. Die schulterlangen Haare trug sie offen. Hübsch.
Gracianas freundliche, direkte Art und ihre angenehme Erscheinung (in Miguels Augen lauter Belege für einen spanischen Einfluss in den Verästelungen ihres Stammbaums) luden zum Unterschätzen ein.
Miguel Duarte hatte die Erfahrung gemacht, dass man sich urplötzlich auf einem dornigen Weg wiederfand, wenn man dieser Einladung zu viel Glauben schenkte.
Eine Frau, die selbst im Sitzen eine unaufdringliche Dynamik ausstrahlte.
Miguel hatte die letzten Jahre auf ihren Posten geschielt. Einerseits, weil Graciana ihn selbst bei wohlwollender Betrachtung nicht auszufüllen vermochte, andererseits, weil die Übernahme ihres Postens für ihn wie ein Sprungbrett nach Lissabon fungieren konnte. Konnte, würde und, ja, müsste.
Nach einem Korruptionsfall letztes Jahr, in den mehrere Beamte im Alentejo in Zentralportugal – aus Miguels Sicht quasi das Herz der Ödnis Portugals – verwickelt waren, hatte das Innenministerium für dieses Jahr die Initiative Policial do Ano, Polizist des Jahres, ins Leben gerufen.
Jeder Polizeibeamte konnte sich um diesen Titel bewerben oder von Kollegen dafür vorgeschlagen werden. Eine Jury aus pensionierten Polizisten kürte dann drei Kandidaten zu Siegern. Wer den Wettbewerb gewann, dem winkten symbolische 2.000 Euro. Dem Zweitplatzierten 1.000 und der Nummer drei schließlich 500 Euro. Aber es würde in einem Dokumentarfilm über sie berichtet werden – und natürlich in den Zeitungen. Social Media.
Duarte hatte bei dem Gedanken an diese Initiative gar nicht das Geld im Sinn. Ihm ging es um Sichtbarkeit. Die Kripo in Lissabon (Porto war auch gut im Kommen, das wäre eine Alternative) würde die drei Sieger ganz sicher unter die Lupe nehmen. Eine Planstelle für einen von ihnen räumen oder gar schaffen.
Aber Duarte machte sich keinerlei Illusionen, dass er hier an der Ostalgarve eine zu untergeordnete Rolle innerhalb der Kripo spielte, um sich für eine Kandidatur zum Polizisten des Jahres in Position bringen zu können.
Jemand, der einen Fall aufklärte und eine Abteilung leitete, wäre der ideale Kandidat für so eine Auszeichnung. Die Position, die Graciana gerade bekleidete, etwa: stellvertretende Chefin der Polícia Judiciária, solange die tatsächliche Leiterin Cristina Sobral sich noch auf der Fortbildung befand. Nur war Graciana wie die meisten Einwohner dieses Landes noch nie mit Begriffen wie Ambition oder Anspruch in Berührung gekommen.
Er schlenderte auf das Farol zu.
Natürlich war die PJ Faro eine Gurkentruppe, aber eine mit Herz, das musste man ihr lassen. In ihrem letzten Fall hatte Duarte eine Kugel am Kopf getroffen und die Verletzung ihm sein Gedächtnis geraubt.
Er hatte sich in der Zeit davor einige Spitzen gegen die Kollegen erlaubt und wäre nicht überrascht gewesen, wenn sie seinen Totalausfall genutzt hätten, um seinen Posten mit einem neuen Kollegen zu besetzen. Ganz im Gegenteil hatten sie sich bemüht, ihn behutsam in sein altes Leben zurückzuführen. Und im Zuge dieser Rekonvaleszenz hatte Duarte feststellen müssen, was für ein unangenehmer Zeitgenosse er den anderen gegenüber bisweilen gewesen sein musste.
Graciana und Carlos waren vielleicht einfache Gemüter, aber sie hatten ihm in der Stunde der Not die Hand gereicht. Und Lost und Soraia hatten ihn in ihrem Gästehaus aufgenommen, bis seine Erinnerungen mit ihrer Hilfe nach und nach wieder zurückkehrten. Seine Identität. All die Leute, über die er früher gespottet hatte – das rechnete er ihnen hoch an. Sehr hoch.
Lost und Soraia – morgen würden die beiden heiraten. Und deshalb war er hier. Für das gemeinschaftliche Geschenk. Und Miguel nahm sich vor, Graciana und Carlos von Herzen zu mögen, ganz gleich, was passierte.
»Olá«, rief ihm Esteves mit vollem Mund entgegen.
Aber es würde Kraft kosten.
»Bom dia«, sagte er und setzte sich übereck zu ihnen an den Tisch, nachdem er unauffällig mit zwei Handbewegungen den Großteil des Staubs von der Sitzfläche gewischt hatte.
»Bom dia, Miguel«, kam es zweifach und gelassen zurück.
»Ihr seht entspannt aus«, sagte er, um etwas Nettes zu sagen.
»Obrigada«, gab Graciana Rosado zurück, die dann mithilfe eines Strohhalms einen Schluck frisch gepressten Orangensaft trank.
»Was hältst du von der Krawatte?«, fragte Carlos und zauberte aus der Tasche seines zerknitterten – tja, was eigentlich, Jacketts? – einen hellblauen Schlips hervor. Fast Azur, wie der Himmel.
»Kommt auf den Anzug an«, erwiderte Miguel.
»Hm?«, gab Graciana in Richtung Carlos von sich, als hätten die beiden schon unter vier Augen über das Thema gesprochen und als hätte sie Duartes Antwort vorhergesagt.
»Hm«, brummte Carlos.
Sie kannten einander schon von Kindesbeinen an und wussten jedes Hm des anderen treffsicher zu deuten. Das Hm hatte viele Gesichter.
»Na«, gab Carlos zurück und deutete mit der freien Hand auf seinen Oberkörper, »den hier.«
»Du willst das … morgen anziehen?«
»Ja.«
»Zur … Hochzeit«, vergewisserte Miguel sich.
»Ganz recht.«
Miguel Duarte stöhnte kaum hörbar auf – der Anzug war natürlich eine mittlere Katastrophe.
Und auch wenn Graciana Rosado sich modischer kleidete, war sie doch weit davon entfernt, sich wie eine spanische Frau zu bewegen, bei der bereits im Teenageralter alle Körperteile in einem magischen Fluss auf faszinierende Weise miteinander verschmolzen, zu Anmut nämlich und Grazie.
In Sevilla wäre schon an ihrer Art zu gehen, zu schauen, eine Bica zu bestellen und an unzähligen anderen Details für jeden Sevillano sofort ablesbar gewesen, dass sie aus der portugiesischen Provinz stammte. Wobei Portugal ja in Miguels Augen ohnehin eine einzige große Provinz darstellte. Ein bis auf Lissabon und Porto landesweites Dorf sozusagen.
Das sich – das musste man ihnen hier lassen – von Spanien trotz mehrerer Versuche nicht hatte unterwerfen lassen.
»Ich seh schon«, unterbrach Carlos Esteves seine Gedankengänge, »die Krawatte passt wohl nicht.«
Gran Dios.
Nichts passte.
Der weite Schnitt des Anzugs hatte mindestens zehn Jahre hinter sich. Sein Alter sah man ihm auch an den Abnutzungserscheinungen am Kragen und an den Ärmeln an. Das Jackett passte an den Schultern perfekt und spannte am Bauch. Schlecht.
Carlos Esteves war ein großer Mann, der trotz all dem, was er sich über den Tag verteilt an Toasts, Schnitzeln, Süßspeisen und mehr einverleibte, das eine oder andere Sagres nicht zu vergessen, nicht zunahm.
Kaum jedenfalls. Vielleicht hatte irgendeine Fügung des Schicksals ihn mit einem gütigen Gendefekt bedacht. Wie auch immer: »Hör zu: dieser Anzug, ähm, sitzt nicht.«
»Ich finde, das geht.«
Duarte zählte bis zehn. Er kam bis fünf.
»Für ein Bierchen hier in dieser … Kneipe ja, für eine Hochzeit nein.«
Carlos war ehrlich überrascht. Schließlich würde die Zeremonie an der Ria Formosa stattfinden und nicht in der Kirche. Drüben, auf der vorgelagerten Insel.
»Soraia und Senhor Lost lassen sich nicht kirchlich trauen.«
»Der Ort der Trauung hat nichts mit der Etikette zu tun. Eine Hochzeit ist eine Hochzeit.«
Carlos nickte: »Fein. Also?«
Er schenkte Duarte dieses offene, jungenhafte Grinsen, das am Rande jener Unsterblichkeit wandelte, die sie in der Jugend beseelt und ihnen Flügel verliehen hatte. So klar und unverfälscht, frei von Berechnung, ganz dem Augenblick gewidmet und damit abseits jedes Glaubens heilig.
Graciana beneidete ihren Kollegen und ewigen Jugendfreund darum – all das abstreifen und den Moment auskosten zu können.
Das war Carlos Esteves. Es gab niemanden sonst, der in der Lage war, das Kostbarste, über das ein Mensch verfügte, in diesem Maß in Genuss umzusetzen: seine Lebenszeit.
Sein jungenhaftes, unverfälschtes Lächeln hatte mehr Frauen verzaubert als Graciana Rosado Finger (und Zehen) hatte. Die pure Lebensfreude, der niemand etwas entgegenzusetzen hatte.
»Ich kleide dich ein«, sagte Duarte und fragte sich, wer da gerade sprach. »Ich kenne eine Schneiderin in Faro.«
Hatte er das gerade wirklich gesagt?
»Was ziehst du denn morgen an?«
»Einen grauen Kiton, Cesare Attolini.«
»Sagt mir nichts.«
Oh Wunder.
Duarte hatte große Lust, Carlos einfach da sitzen zu lassen. Unbehelligt von der Welt der Mode. Aber sie hatten auch gemeinsam mit Leander Lost in der Lagune der Ria Formosa gebadet, nachts, nackt und mit jenem Schuss Alkohol im Blut, der sie nicht die Contenance verlieren ließ, aber ihnen die Seelen öffnete. Dieser schmale, wunderbare Grat.
Von der sanften Strömung getragen waren sie rücklings im Wasser getrieben, über ihnen ein beeindruckend klarer Sternenhimmel. Eine seltsame Verbundenheit legte sich wie ganz selbstverständlich über sie, während sie in der Lagune trieben.
Oftmals begriff man besondere Augenblicke erst mit zeitlichem Abstand – in der Rückbetrachtung. In jener Nacht erfasste sie alle drei die Besonderheit bereits in dem Moment selbst.
Diese Nacht jedenfalls wirkte immer noch in ihm nach und stimmte ihn milde, wenn Carlos, Graciana oder Leander Lost Dinge taten, die seinen Puls in die Höhe trieben.
Wie jetzt.
Gracianas Handy meldete sich. Mit einem Blick auf das Display erkannte sie, dass es sich um Isadora Jordão handelte, die Kriminaltechnikerin.
»Olá, Isadora.«
»Olá.«
Die Tonlage des Olá war dienstlicher Natur.
»Es gibt einen Notruf aus Bico Alto. Da hat eine Senhora Matilda Vaz gerade einen Toten gefunden. Nach dem, was sie schildert, ist es kein natürlicher Todesfall.«
»Ist GNR vor Ort? Irgendjemand?«
»Ich habe die GNR von São Brás losgeschickt. Ansprechpartner ist Primeiro-Sargento José Fidalgo. Ich mache mich mit der Doutora auf den Weg.«
Isadora meinte Doutora Oliveira, die Rechtsmedizinerin, die die Leichenschau vornahm und bei Bedarf auch die Obduktion.
»Gut. Wir sind unterwegs«, sagte sie und stand auf. »Hast du Senhor Lost schon Bescheid gesagt?«
»Nein, ich …«, erwiderte Isadora und Graciana hörte ihr Zögern, »ich wollte es dir überlassen – wegen morgen.«
Graciana Rosado hatte eine gute Antenne für Zwischentöne. Für die feinen Schwingungen. Für jene Zone, in der Ratio und Logik auf verlorenem Posten standen. Wie Kompasse, deren Nadeln hilflos rotierten, weil es keinen Norden mehr gab.
Was sie verwoben zwischen den Silben hörte, erschien ihr wie eine leichte Form des Bedauerns. So was wie … Wehmut. Saudade.
Wegen morgen.
Isadora war ein eigenwilliges Gewächs. Hübsch und bemüht, das zu konterkarieren. Kurzhaarschnitt, Boots, Armeehose. Sie lebte mit Doc, ihrem Dobermann, auf einem Boot vor Olhão. Alle wussten, dass Isadora da den einen oder anderen Joint aus dem Material genoss, das sie immer mal wieder konfiszierten. Dass sie dabei die Füße auf die Reling legte und Doc den Nacken kraulte. Und beide zufrieden waren. Vielleicht sogar glücklich.
Andere Kommissariate hatten sich um sie bemüht, tief bis in den spanischen Teil der Iberischen Halbinsel, man hatte ihr das Doppelte geboten und auch mehr, aber Isadora hatte es vorgezogen, hierzubleiben.
Und dann war Leander Lost in ihrer aller Leben getreten und hatte alles in Bewegung gebracht. Keiner fand sich mit seinem Erscheinen unverändert. Auch Leander Lost selbst nicht. Dieser allgemeinen Veränderung wohnte nichts Magisches inne, das passierte zwangsläufig, wenn Menschen Spuren in anderen hinterließen.
Doch die Verbindung von Isadora und Lost war eine besondere. Ihre Schnittmenge erwies sich als relativ groß, wie Leander es einmal formuliert hatte.
Denn sie hatten schon vor ihrem ersten Aufeiandertreffen ähnliche Vorlieben und Interessen entwickelt. Amerikanische Revolverhelden etwa, Doc Holliday insbesondere (daher der Name ihres Dobermanns), Astronomie und den französischen Existenzialisten Albert Camus.
Und manchmal, die Kollegen bemerkten es vielleicht nicht, ruhten Isadoras Augen jenen entscheidenden Bruchteil eines Moments zu lange auf Leander.
Aber Graciana hatte es bemerkt.
Wegen morgen.
Die Wehmut war greifbar.
Morgen würde Leander ihre Schwester Soraia heiraten.
Graciana nickte intuitiv, obwohl ihr klar, war, dass Isadora sie nicht sehen konnte: »Ich sag ihm Bescheid.«
Leander stand am Rande des Pools und fischte mit dem Kescher im Wasser havarierte Insekten heraus, die er über dem Hibiskusstrauch ausschüttete. Die, die noch um ihr Leben gestrampelt hatten, begannen sich zu putzen und das Wasser abzuschütteln. Und die anderen, eine Libelle etwa, die bereits reglos im Salzwasser des Beckens getrieben hatte, regten sich bei einem Sonnenstrahl, der sie erfasste, erst langsam und erschöpft. Die Gliedmaßen zuckten, man meinte, ein Herz unter dem feinen Panzer zu sehen, das seine Arbeit wieder aufnahm.
Das ausdauernde und aussichtslose Strampeln in dem zehn mal fünf Meter großen »Ozean« des Hauses weckte Leanders tiefes Mitgefühl.
Es gab Menschen, Leander hatte es selbst beobachtet, denen dieses leidenschaftliche und verzweifelte Ringen um das Leben gleichgültig war. Mit dem Eintauchen eines Zeigefingers konnten sie dieses kleine Leben retten – und unterließen es oder saßen daneben, tranken einen Kaffee, unterhielten sich mit einem Freund und sahen dabei zu.
Bei einem ertrinkenden Hund oder einem ertrinkenden Reh wäre ihnen das nicht passiert.
Sie teilten Leben unbewusst in wertvolles und verzichtbares ein. Was, wenn man es nur ein Stück weiterdachte, eine fürchterliche Haltung war.
»Adriana sagt: Eine Fliege summt auch dem König um die Nase.«
Zara. Zara Pinto. 18 Jahre alt, im ersten Fall, an dem Lost beteiligt gewesen war, ein zorniges, misstrauisches Etwas irgendwo zwischen Punk und Grufti (das wusste sie vermutlich selbst nicht so genau), mit Piercing und Nieten-Halsband. Was weniger über ihre Umwelt verriet als über sie selbst: Sie ließ niemanden an sich heran. Aus Angst und Verunsicherung. Während der Mord an ihrer Mutter sie traumatisiert und innerlich verwüstet hatte, gab sie sich nach außen hin stark und selbstbewusst.
Erst als die Polícia Judiciária Soraias Rat befolgte und die Außenseiterin Zara im Besucherhaus des Außenseiters Lost unterbrachte, taute sie auf. Weil sie für Leander Luft war. Den Asperger-Autisten interessierte sie schlicht nicht. Sie hätte in seinen Augen ebenso gut eine Stechpalme sein können.
Langsam schöpfte sie Vertrauen und irgendwann durchlief sie auch in Losts Wahrnehmung eine Metamorphose von einer Statistin in seinem Leben zu einem festen Bestandteil, den er – obwohl ihm das nicht bewusst war – nicht mehr missen wollte. Zunächst schützte er sie in ihrer Funktion als Mordzeugin in seiner Funktion als Sub-Inspetor. Und nach Abschluss der Ermittlungen blieb sie einfach in der Casinha und sein Schutz weitete sich auf ihr Leben aus. Auf das, was sie war, werden wollte und einmal sein würde.
Seinetwegen holte sie die Schule nach, seinetwegen begriff sie, dass Bildung in einer patriarchalisch geprägten Welt der entscheidende Schlüssel für Mädchen zu Freiheit und Selbstbestimmung war.
Beim Abiball, als der DJ die Absolventen aufforderte, für den nächsten Tanz ihre Mutter oder ihren Vater auszuwählen, erfasste Zara das Bewusstsein ihrer Einsamkeit. Bis sie Soraia sah, deren Schwester Graciana und Carlos Esteves. Ihre kleine Ersatzfamilie. Und dann Leander Lost, und mit einem Mal fügte sich in ihrem Kopf zusammen, was ihr Bauch schon lange wusste, und sie tanzte diesen Tanz mit ihm.
Und nun Adriana. Adriana hier, Adriana da.
Adriana Ventura war eine Journalistin, die mit dem regionalen Schwerpunkt Algarve für die renommierte Tageszeitung Público arbeitete. Sie lebte in Estoi, nördlich und gar nicht weit von Faro entfernt gelegen und doch eine Oase der Einheimischen, in die sich nur selten ein Tourist verlief. Und wenn, dann wegen der Pousada im Palácio de Estoi, einem kleinen Rokoko-Palast, der aus dem 19. Jahrhundert stammte und der zu einem Luxushotel umfunktioniert worden war.
Ventura deckte Missstände in Niedriglohnsektoren auf – etwa die Ausbeutung von Migranten in der Landwirtschaft im Alentejo.
Ein Betriebsunfall im Baugewerbe in Albufeira, in dem sie ermittelte und sich unter falschem Namen anstellen ließ, sorgte landesweit für Furore und führte zu einer Verschärfung der gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen und zu vermehrten Kontrollen auf Baustellen. Die Verantwortlichen für den Unfall wurden rechtskräftig verurteilt.
Sich auch mit persönlichem Risiko voll und ganz zu engagieren, brachte ihr nicht nur in Journalistenkreisen den respektvollen Beinamen A Farejadora ein.
Die Spürnase.
Und seit einer Woche durfte Zara ein Praktikum bei ihr absolvieren.
Mit leuchtenden Augen erzählte sie am Abend, was sie alles gelernt und erlebt hatte. Wie man die richtigen Fragen stellte, wie man neutral blieb, zumindest im Artikel, was es bedeutete, eine lange, komplexe Geschichte wiederzugeben, wenn der Redaktionsleiter einem dafür nur 2.800 Zeichen in der nächsten Ausgabe zur Verfügung stellte, und viele Details mehr.
Die Intensität ihrer Begeisterung, erkannte Soraia, war etwas, was Zara in diesem Job weit bringen würde. Dabei hatte sie nicht eine Karriere im Sinn, sondern berufliche Erfüllung.
Es war Soraia eine Freude, in Zaras strahlendes Gesicht zu blicken, wenn sie von ihrem Praktikum berichtete. Und natürlich von Senhora Adriana.
»Eine Fliege summt auch dem König um die Nase.«
»Das ist eine Bemerkung, die sich als Metapher klassifizieren lässt«, antwortete Leander, »oder als profan.«
Zara setzte spielerisch eine strenge Miene auf: »Adriana ist nicht profan, sie ist mega.«
»Sie ist eine griechische Vorsilbe?«
Zara verdrehte die Augen überdeutlich, damit Leander Gelegenheit hatte, die Mimik zu dechiffrieren: »Mega ist ein Synonym für großartig.«
»Sieh einer an.«
Dan B. Tucker, Das Kompendium der sinnlosen Sätze, S. 202.
In dem Moment vibrierte Losts Handy in seiner Brusttasche – es war Graciana.
5.
Der Volvo V70 T5 schoss mit Blaulicht, aber ohne Sirene durchs Hinterland. Carlos, der es sich auf dem Beifahrersitz bequem gemacht hatte – fast in halb liegender Position, weshalb Duartes Wahl auf der Rückbank auf den Sitz hinter Graciana gefallen war –, musterte Graciana unauffällig von der Seite. Deren konzentrierter Blick war auf die Straße gerichtet. Sie hatte diesen T5 erst vor einem halben Jahr in einer Tüftlerwerkstatt aufgetan. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen.
»Der ist 17 Jahre alt.«
»Da beginnt ein spannendes Alter«, ließ sie Carlos’ Einwand mit einem verliebten Lächeln abprallen, das dem Wagen galt. Und an den Leiter der Werkstatt, einen alten Freund ihres Vaters, gerichtet: »Ist der Motor abgeregelt, Pedro?«
Pedro nickte und musste schmunzeln, weil er ihre Vorliebe für Wölfe im Schafspelz nur allzu gut kannte: »Ja, auf 250. Soll ich sie rausnehmen, die Sperre?«
»Ja. Und kannst du noch was aus dem Motor rauskitzeln?«
»Klar, aber dann müssen wir was am Fahrwerk machen.«
»Klingt gut.«


























