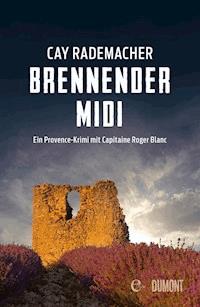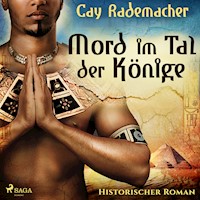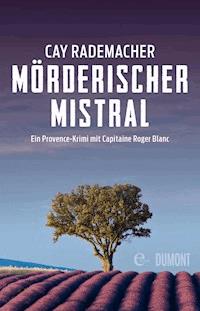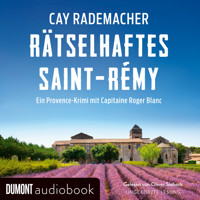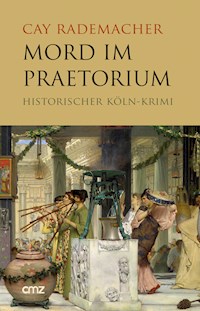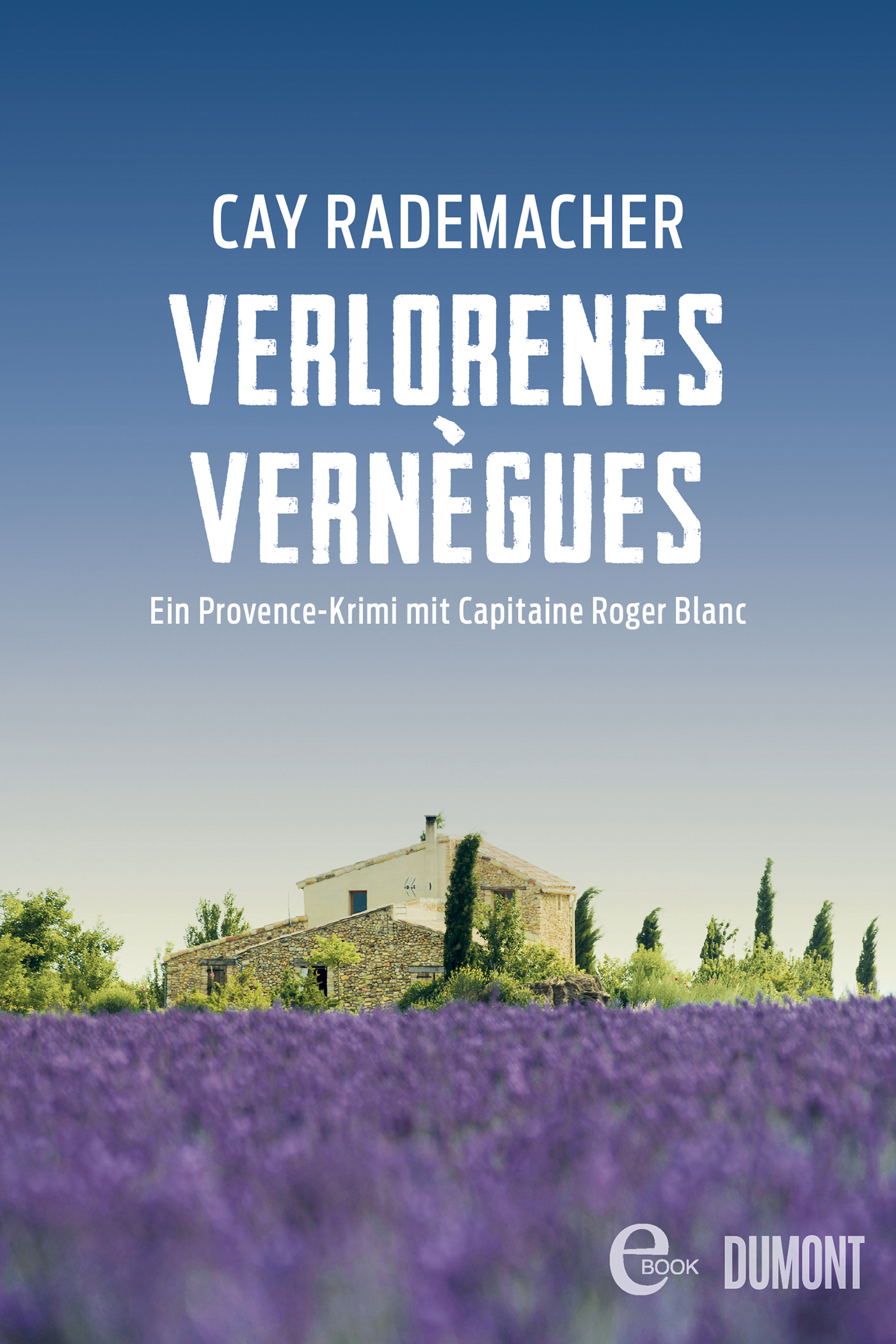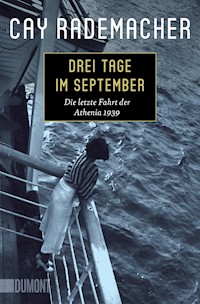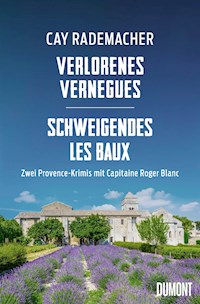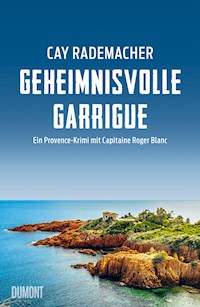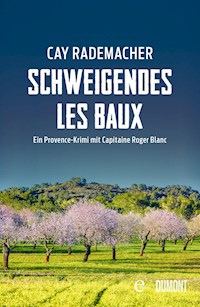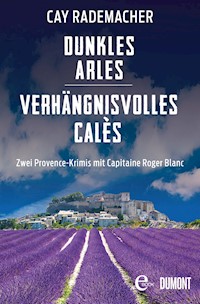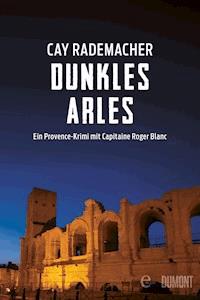
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Capitaine Roger Blanc ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der fünfte Fall für Capitaine Roger Blanc November in der Provence: Capitaine Roger Blanc und die Untersuchungsrichterin Aveline Vialaron-Allègre verabreden sich zu einem heimlichen Wochenende in Arles. Treffpunkt des Liebespaares ist das römische Amphitheater. Doch dann wird Aveline zufällig Zeugin eines extrem kaltblütigen Mordes. Sie selbst kommt nur knapp mit dem Leben davon – aber der unbekannte Täter raubt ihr eine Tasche mit wichtigen Unterlagen, die sie ihrem Ehemann, dem mächtigen Staatssekretär, um jeden Preis in Paris präsentieren muss. Blanc und Aveline haben nur zwei Tage, um den Mörder zu finden und sich die Dokumente zurückzuholen. Allerdings darf ja niemand wissen, dass sie in Arles sind. In den düsteren Gassen entspinnt sich ein Duell auf Leben und Tod: Sie jagen den Unbekannten – und der Unbekannte jagt sie. Dabei hat er mächtige Helfer. Nach und nach finden Blanc und Aveline heraus, dass der Tote im Amphitheater nicht das erste Opfer einer mysteriösen Gruppe ist, zu der sogar Politiker und Polizisten gehören. Als dann auch noch sein Kollege Marius Tonon, den Blanc in einer Klinik glaubte, bei diesen Verschwörern auftaucht, weiß er endgültig nicht mehr, wer sein Freund ist – und wer sein Feind … Mord in der Provence – Capitaine Roger Blanc ermittelt: Band 1: Mörderischer Mistral Band 2: Tödliche Camargue Band 3: Brennender Midi Band 4: Gefährliche Côte Bleue Band 5: Dunkles Arles Band 6: Verhängnisvolles Calès Band 7: Verlorenes Vernègues Band 8: Schweigendes Les Baux Band 9: Geheimnisvolle Garrigue Band 10: Stille Sainte-Victoire Band 11: Unheilvolles Lançon Band 12: Rätselhaftes Saint-Rémy Band 13: Bedrohliche Alpilles Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
November in der Provence: Capitaine Roger Blanc und die Untersuchungsrichterin Aveline Vialaron-Allègre verabreden sich zu einem heimlichen Wochenende in Arles. Treffpunkt des Liebespaares ist das römische Amphitheater. Doch dann wird Aveline zufällig Zeugin eines extrem kaltblütigen Mordes. Sie selbst kommt nur knapp mit dem Leben davon – aber der unbekannte Täter raubt ihr eine Tasche mit wichtigen Unterlagen, die sie ihrem Ehemann, dem mächtigen Staatssekretär, um jeden Preis in Paris präsentieren muss.
Blanc und Aveline haben nur zwei Tage, um den Mörder zu finden und sich die Dokumente zurückzuholen. Allerdings darf ja niemand wissen, dass sie in Arles sind. In den düsteren Gassen entspinnt sich ein Duell auf Leben und Tod: Sie jagen den Unbekannten – und der Unbekannte jagt sie. Dabei hat er mächtige Helfer. Nach und nach finden Blanc und Aveline heraus, dass der Tote im Amphitheater nicht das erste Opfer einer mysteriösen Gruppe ist, zu der sogar Politiker und Polizisten gehören. Als dann auch noch sein Kollege Marius Tonon, den Blanc in einer Klinik glaubte, bei diesen Verschwörern auftaucht, weiß er endgültig nicht mehr, wer sein Freund ist – und wer sein Feind …
© Françoise Rademacher
Cay Rademacher, geboren 1965, ist freier Journalist und Autor. Bei DuMont erschienen seine Kriminalromane aus dem Hamburg der Nachkriegszeit: ›Der Trümmermörder‹ (2011), ›Der Schieber‹ (2012) und ›Der Fälscher‹ (2013). Seine Provence-Krimiserie umfasst: ›Mörderischer Mistral‹ (2014), ›Tödliche Camargue‹ (2015), ›Brennender Midi‹ (2016), ›Gefährliche Côte Bleue‹ (2017), ›Dunkles Arles‹ (2018) und ›Verhängnisvolles Calès‹ (2019). Außerdem erschien 2019 der Kriminalroman ›Ein letzter Sommer in Méjean‹. Cay Rademacher lebt mit seiner Familie in der Nähe von Salon-de-Provence in Frankreich.
Mehr über das Leben im Midi erfahren Sie im Blog des Autors: Briefe aus der Provence
CAY RADEMACHER
DUNKLES ARLES
Ein Provence-Krimi mit Capitaine Roger Blanc
Alle Personen in diesem Roman sind erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht beabsichtigt und wären rein zufällig. Niemand in der realen Verwaltung oder Polizei von Arles ist in Machenschaften verwickelt, wie sie im folgenden Text geschildert werden.
eBook 2018 © 2018 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Umschlagabbildung: Getty Images / Jose Moreno Castellamo/UIG Karte: Kartografie Angelika Solibieda, Cartomedia-Karlsruhe Satz: Angelika Kudella, Köln eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, LeckISBN eBook 978-3-8321-8401-8
De plus, un autre sentiment me préoccupait maintenant. Une impression plutôt, qui me tenaillait depuis que je marchais dans cette foule: la sensation d’être suivi.
Die Todgeweihten grüßen dich!
Man spürt den Tod, wie man den stechenden Blick eines Fremden zwischen den Schultern spürt, dachte Capitaine Roger Blanc. Er schlug den Kragen seiner Lederjacke hoch und sah sich unbehaglich um. Er fühlte sich wie im Innern eines Vulkans, dessen Krater allerdings einst von Menschen geschaffen worden war. Rings um ihn benetzte feiner Regen graue, altersschiefe Steine, die Reihe um Reihe gen Himmel wuchsen. Blanc stand erst seit ein, zwei Minuten zwischen den Sitzen inmitten des römischen Amphitheaters von Arles und wünschte sich doch schon wieder von hier fort.
In Arles hatten sich in der Antike Gladiatoren zum Vergnügen des Publikums bekämpft. Hier waren im Mittelalter Verbrecher auf alle erdenklichen Arten hingerichtet worden. Und heutzutage starben hier im Sommer schwarze Bullen bei den spanischen Stierkämpfen, die in Arles so selbstverständlich veranstaltet wurden, als würde die Provence immer noch dem König von Katalonien unterstehen. Die mürben Steine des Amphitheaters dünsteten Jahrhunderte des Todes aus.
Freitagnachmittag. Blanc verkroch sich tiefer in seine alte Lederjacke. Er zog sein Handy hervor und blickte auf das Display: 16.November, Punkt 16.00Uhr. Der niedrige Himmel spannte sich über das hundert Meter weite Steinoval, grau und stumpf wie ein altes Tuch. Zwischen den steil ansteigenden Sitzreihen verloren sich nur wenige Besucher: Rentner aus Deutschland, Holland, Japan, Damen in grellvioletten Regenponchos und ihre Begleiter in himalajatauglichen Funktionsjacken, die ihre Spiegelreflexkameras gepackt hielten wie Faustfeuerwaffen. Als Blanc wenige Augenblicke zuvor über den Vorplatz gehastet war, die Hand am Schirm seiner Baseballcap gegen Windböen und Regenschauer, war er an einem langhaarigen jungen Gitarrenspieler vorbeigekommen, der unter einer Art Zelt hockte und schnelle Musik der Gitanes spielte, die er mit elektronischen Rhythmen aus einem Verstärker unterlegt hatte. Seine Melodien wehten bis in das antike Innere, ein seltsam deplatzierter Klang.
Und doch, dachte Blanc, trotz der eifrigen Rentner, trotz der leeren Steinstufen, der lächerlichen Musik, des Nieselregens: Man konnte im Amphitheater irgendwie noch immer die Hitze des Sommers ahnen, den flirrenden Sand der Arena, die Angstlustschreie der Zuschauer, den Geruch nach Blut.
Er wünschte, Aveline hätte einen anderen Treffpunkt vorgeschlagen.
Ein gestohlenes Wochenende in Arles: Der Flic und die Richterin, ein unter dem Allerweltsnamen »Dupont« reserviertes Hotelzimmer, Hoffnung auf ein paar Stunden Leidenschaft – ein schäbiger Ehebruch. Mehr als dreieinhalb Milliarden Frauen lebten auf der Welt, und keine war für ihn gefährlicher als Aveline Vialaron-Allègre. Blanc wusste nicht mehr, wie oft er sich schon geschworen hatte, ihre hoffnungslose Affäre zu beenden. Doch dann musste er bloß ihre Stimme im Handy hören oder bei einer zufälligen Begegnung auf den Fluren des Justizpalastes von Aix-en-Provence ihren Duft einatmen, und ihn schwindelte.
Das Novemberwochenende war wie ein unverhofftes Geschenk über Blanc gekommen. Avelines Mann war nicht, wie sonst oft, aus Paris in den Süden gekommen. Der Staatssekretär hatte rechtzeitig genug die Seiten gewechselt und sich Macrons neuer Partei angeschlossen. So war er einer der wenigen Politiker, der von der Flutwelle der Wahlen im Frühsommer nicht aus Ministerien und dem Parlament gespült worden war, im Gegenteil: Jean-Charles Vialaron-Allègre galt als einer der erfahrensten Köpfe der neuen Regierung und damit als graue Eminenz im Innenministerium. Nur beglich er dafür den Preis, den jeder entrichten musste, dessen Macht wuchs: Er bezahlte mit seiner Zeit. Vialaron-Allègre musste das ganze Wochenende über in der Hauptstadt mit dem Premier und dem Innenminister am Text eines neuen Antiterrorgesetzes feilen.
Da Aveline am Gericht gerade Ermittlungen gegen einen Islamisten führte, sollte sie ihre Ergebnisse am Montagmorgen im Innenministerium vortragen. Von Freitagnachmittag, wenn sie den Justizpalast in Aix-en-Provence verließ, bis Sonntagabend, wenn sie den Zug Richtung Paris besteigen würde, wäre Aveline deshalb, wie sie Blanc in einer SMS geschrieben hatte, »vom Radarschirm verschwunden«.
Sie hatte dieses Treffen vorgeschlagen: Arles lag gut vierzig Kilometer von ihrem Haus in Caillouteaux und Blancs heruntergekommener Ölmühle in Sainte-Françoise-la-Vallée entfernt. Nah genug, um rasch dort hinzufahren, aber nicht so nahe, dass sie fürchten mussten, dort einem Nachbarn oder Kollegen über den Weg zu laufen. Außerdem waren die Monumente von Arles bei Touristen so beliebt, dass selbst an düsteren Herbsttagen viele Besucher durch die Gassen strömten, genug jedenfalls, dass zwei Besucher mehr nicht auffielen. Und Arles hatte einen TGV-Bahnhof mit einer direkten Verbindung in die Hauptstadt. Erst am Sonntag um kurz nach acht würde Avelines Zug nach Paris abfahren.
Auch Blanc war mit der Eisenbahn gekommen. Sein alter Renault Espace war vor einigen Tagen wieder einmal kollabiert. Er hatte ihn seinem Nachbarn Jean-François Riou zum Herumbasteln in die Garage gestellt. Riou hatte das Gesicht verzogen, aber versprochen, den Minivan irgendwann in den nächsten Tagen wieder zum Laufen zu bringen. Für sein Rendezvous hatte Blanc notgedrungen den Zug von Miramas nach Arles nehmen und deshalb rechtzeitig aufbrechen müssen. Freitagmittag, so früh war er nie zuvor von der Arbeit verschwunden. Den meisten Kollegen auf der Gendarmeriestation von Gadet schien das aber nicht aufgefallen zu sein.
Sein Freund und Partner Marius Tonon war seit zwei Wochen offiziell im Urlaub, tatsächlich jedoch auf Entziehungskur, was außer Blanc allerdings kaum jemand wusste. Und selbst er hatte nicht einmal eine Telefonnummer; er vermutete, dass sie die Alkoholiker in der Entgiftungsklinik isolierten und es Marius deshalb verboten war, sich zu melden. Manchmal fragte er sich, ob sein Kollege den Kampf gegen seine Dämonen je gewinnen und tatsächlich irgendwann zurückkehren würde. Zugleich freute er sich, dass Marius nach Jahren der Sucht zumindest diesen Schritt endlich gewagt hatte.
In Gadet gab es deshalb nur eine Kollegin, in deren Büro er zum Abschied vorbeigesehen hatte. Fabienne Souillard hatte von ihrem Computermonitor aufgeblickt, ihn erstaunt angesehen und bloß halb im Scherz gefragt: »Hast du ein Date?«
Blanc hatte etwas von »Familienangelegenheiten« gemurmelt, was genau genommen ja nicht einmal gelogen war.
Nun zog er wieder sein Nokia hervor und checkte Anrufe und Meldungen: nichts von Fabienne. Gut so, alles ruhig auf der Gendarmerie, niemand würde ihn zurückbeordern. Nichts von seinen Kindern Eric und Astrid, und dieses eine Mal erleichterte es ihn, dass sie sich nicht sonderlich für ihn interessierten. Nichts von Riou oder einem anderen Nachbarn. Sie waren vom Radarschirm verschwunden, Aveline und er.
Er sah sich suchend um. Vorhin, als er das Monument betreten hatte, war ihm eine Schautafel aufgefallen, die einen alten Stich zeigte. Im Mittelalter war das Amphitheater eine Stadt in der Stadt gewesen, Dutzende winzige Häuser waren in, auf und vor dem Oval gewuchert wie Pilze auf einem umgestürzten Baum. Im 19.Jahrhundert hatten Denkmalschützer diese Häuser abgerissen, um das antike Skelett freizulegen. Nur drei eckige Wachtürme aus dem Mittelalter hatten sie stehen lassen, drei wuchtige Zacken auf einer steinernen Krone. Blanc blickte zum höchsten Turm – von dort würde er einen besseren Überblick haben. Vielleicht schlenderte Aveline schon hier herum und er entdeckte sie bloß nicht. Er ging durch die Sitzreihen, nickte einem erschöpften älteren Ehepaar zu, das sich auf den unbequemen Plätzen niedergelassen hatte. Über die von all den Bau- und Abrissarbeiten der Jahrhunderte aufgerissenen Steinstufen hatte man für die Stierkämpfe moderne Sitzreihen gespannt, eine gerüstartige Konstruktion aus hölzernen, braun gebeizten Bänken, die auf Stahlrohre geschraubt worden waren. Blanc ging über diese Anlage, mit jedem noch so vorsichtigen Schritt knarzte und vibrierte das riesige Gestell. Endlich erreichte er die schief getretenen steinernen Treppenstufen, die ihn bis auf den Turm hinaufführten.
Blanc blickte schließlich vom höchsten Punkt des Amphitheaters auf die Dächer von Arles. An einem altersgebeugten Haus gegenüber der Arena hing ein Balkon am obersten Stockwerk. Er war so schmal, dass dort nur ein winziger Tisch und zwei Bistrostühle Platz fanden, die dem Novemberregen trotzten. Einen flüchtigen Moment träumte er davon, mit Aveline auf so einem winzigen Balkon zu sitzen, an einem klaren Sommermorgen, zwei dampfende Kaffeeschüsseln in den Händen und die alte Stadt zu ihren Füßen. Er konnte sie auf dem Vorplatz nirgendwo ausmachen. Er schlenderte zur gegenüberliegenden Seite des Turms und musterte aus großer Höhe das Innere des Amphitheaters.
Doch auch hier hielt er vergebens nach einer schlanken Gestalt Ausschau, nach schwarzen Haaren, olivenfarbener Haut, nach einem raschen, selbstsicheren Gang, nach einer Gauloises in der feingliedrigen Hand, der linken, Aveline war Linkshänderin, und sie kümmerte sich nicht um Rauchverbote in öffentlichen Räumen. Er wusste nicht, was sie tragen würde, aber ihre Kleidung wäre ohne Zweifel eleganter als die funktionale Buntheit der anderen Besucher. Blanc war blond, über einsneunzig groß, und sein Körper war von unzähligen Laufkilometern bis auf Knochen und Muskeln ausgewrungen worden. Sie waren Exoten zwischen den älteren Bildungstouristen.
Irgendwann musste Aveline doch kommen, durch irgendeine Gasse der Altstadt musste sie schlendern. Sein Blick schweifte über die Altstadt, eine Decke aus braunen, roten, ockerfarbenen Dächern, zerstochen von antiquierten Fernsehantennen. Zur Linken floß grausilbern die Rhône, ein Fluss, der viel zu groß war für diese kleine Stadt. Dahinter verschwand ein weites, flaches Land im regenschmutzigen Dunst, das riesige Sumpfdelta der Camargue, wo Blanc schon einmal einen Mörder gejagt hatte; er wollte nicht daran zurückdenken. Zur Rechten begrenzte ein Hügelzug den Horizont, ein paar wenig imposante Kuppen, die bei diesem Wetter wirkten wie eine Meeresbrandung, die auf die Stadt zurollte, doch durch irgendeine Magie erstarrt war, bevor sie Arles verschlingen konnte.
Als er seine Aufmerksamkeit wieder auf das Innere des Amphitheaters lenkte, machte sein Herz einen Sprung. Aveline. Sie passierte gerade die Kasse, hielt inne und sah sich prüfend um. Trotz des grauen Lichts trug sie eine Sonnenbrille. Blanc eilte die engen Treppen des Turmes hinunter. Als Aveline ihn erblickte, schnippte sie eine halb gerauchte Gauloises achtlos fort und schlenderte in seine Richtung – man hätte an zwei Besucher denken können, deren Wege sich bloß zufällig kreuzten. Sie trug einen langen, grauen Kaschmirmantel, eine bordeauxfarbene Hose, flache Schuhe.
»Ein schöner Ort«, sagte sie.
»Für Gladiatoren«, erwiderte Blanc.
»Ich hoffe, Sie mussten nicht meinetwegen im Regen warten.«
»Nein«, log er.
Aveline schenkte ihm ein spöttisches Lächeln. Er wollte sie in die Arme schließen und scheiß auf die Besucher, die sie sehen könnten. Doch sie war vorsichtiger und hielt zwei Schritte Abstand zu ihm.
»Führen Sie mich herum?«
»Soll ich Ihnen die Tasche abnehmen?« Blanc deutete auf ihre große Tasche aus grünem Leder. Er hatte die Sachen für das Wochenende in eine alte, himmelblaue Adidas-Sporttasche gepackt, die seinen Umzug und seine Scheidung überstanden hatte, weil sie so Achtzigerjahre war, dass seine Exfrau sie nicht haben wollte. Er hatte sie in einem Schließfach neben der Kasse deponiert.
»Eine Handtasche heißt Handtasche, weil eine Frau sie in der Hand behält«, entgegnete Aveline. Blanc verzichtete auf eine Erwiderung. Er deutete mit einer Handbewegung den Weg an. Ein düsteres Gewölbe führte sie durch die aus Ziegelsteinen gemauerte Konstruktion unterhalb der Bänke. Ein Gang, vermutete Blanc, der einst die Besucherströme auf die verschiedenen Zuschauerreihen ausgespien hatte. Wasser tropfte von den Wänden, irgendwo gurrte eine Taube, eine Katze schlich missmutig davon, ihr Fell war so grau wie Avelines Mantel. Es stank wie in einem alten Keller. Außer ihnen war kein Mensch dort. Er hätte sie jetzt gern geküsst, doch Aveline war nicht gerade die Frau, die sich ausgerechnet in dieser muffigen Höhle ihrer Leidenschaft hingegeben hätte. Vielleicht auf dem Turm, im Wind und unter dem wolkenverhangenen Himmel, in einem aus der Zeit gefallenen Augenblick, wenn gerade keiner dieser Rentner hinsah. Sie stiegen nach oben.
Aveline blickte über die Rhône und die Camargue. Sie sagte nichts, lächelte nicht einmal, doch kleine Böen zersausten ihr Haar, und Blanc hoffte, dass sie in diesem Augenblick glücklich war.
»Der Turm gehört uns ganz allein«, sagte Aveline, überwand mit einer schnellen, fließenden Bewegung die letzten Zentimeter zwischen ihnen und küsste ihn.
Aveline liebte das Risiko. Wahrscheinlich, dachte Blanc, genoss sie in diesem Moment nicht nur den Kuss, sondern sie genoss es, auf dem höchsten Punkt dieser Stadt und mitten am Tag einen Mann zu küssen, den sie nicht küssen durfte. Er war wirklich verrückt, sich mit ihr einzulassen.
Er löste sich aus ihrer Umarmung, warf einen Blick in die Arena, um sicherzugehen, dass niemand sie beobachtete – und hielt erschrocken die Luft an. Im Zentrum der Sandfläche stand ein Mann. Würde er auch nur für eine Sekunde zufällig zum Turm hochblicken, dann würde er sie beide sofort erkennen.
Mitten im Amphitheater von Arles stand Lieutenant Marius Tonon.
»Weg von der Mauer«, flüsterte Blanc. »Rasch!«
»Ist Ihr Kollege nicht in Urlaub?« Aveline sah nach unten und trat erst dann von der Brüstung zurück. Sie ging unauffällig zur Außenseite des Turms, musterte die Dächer von Arles und schien nicht sonderlich beunruhigt zu sein.
»Vielleicht ist es ein Bildungsurlaub«, murmelte Blanc. Er hatte keine Ahnung, ob Aveline etwas von Marius’ Kur wusste. Und er hatte keine Ahnung, was man eigentlich bei einer Entziehungskur machte. Wurde man da nicht eingeschlossen? Er duckte sich hinter der Brüstung und musterte Marius. Pepitahut, zerknautschter beiger Trenchcoat, graue Stoffhose, neue hellbraune Gesundheitsschuhe – sein Freund sah aus wie die personifizierte Langeweile. Er stand noch immer in der Mitte der Sandfläche, dem auffälligsten Punkt des Amphitheaters. Kein Flic würde dort freiwillig stehen bleiben, gegen jeden beruflichen Instinkt. Keine Deckung, man war dort eine Schießbudenfigur. Es sei denn … Marius wollte gesehen werden.
Und tatsächlich trat wenige Momente später ein junger Mann auf ihn zu. Der Neuankömmling sah aus, als wäre er heute Morgen in Kanadas Wildnis aufgebrochen: kurze Lederjacke, darunter ein rotes Flanellhemd, Jeans, Timberlands. Von seinem Gesicht war nicht viel zu erkennen, er trug einen khakifarbenen Outdoorhut. Ein Vollbart wucherte über Wangen und Kinn, eine wuchtige Brille aus braunem Kunststoff umrahmte die Augen. Die Männer wechselten ein paar Worte, dann führte der Unbekannte Marius zu einem Gang unterhalb der Zuschauerränge. Vom Turm aus konnte Blanc bis in das Gewölbe blicken, und im Halbdunkel nahm er eine Bewegung wahr: In der Tiefe des Ganges wartete noch jemand. Ein Mann wie ein Amboss, Bomberjacke, Hoodie, Jeans, Springerstiefel. Er hatte die Kapuze tief über den Kopf gezogen. Er überragte Marius um drei Haupteslängen, und als er schließlich ein paar Schritte auf ihn zustapfte, bewegte er sich wie diese Bodybuilder, deren Oberschenkelmuskeln so aufgepumpt waren, dass sie mit gespreizten Beinen gehen mussten.
Das war doch niemals ein Wochenendausflug vom Trinkerheim. Zwei Alkoholiker, die mit Marius auf Entziehungskur waren? Die beiden Typen sahen nicht gerade aus wie frisch bekehrte Teetrinker. Wen traf Marius also dann? Freunde? Informanten? Was, zum Teufel, treibt er bloß da?, dachte Blanc, duckte sich noch tiefer hinter die Brüstung und spähte durch einen Riss im Mauerwerk nach unten. Marius schüttelte beiden Männern die Hand, so freundlich, als habe er sie schon oft gesehen.
»Sie gehen zuerst runter«, flüsterte Aveline, die lautlos herangekommen war und nun hinter ihm kniete. »Lieutenant Tonon darf Sie hier nicht bemerken.«
»Marius kennt Sie auch. Wir müssen gemeinsam verschwinden.«
Aveline schüttelte entschieden den Kopf. »Als Paar wären wir noch auffälliger. Sie gehen, solange Tonon durch die beiden Männer abgelenkt ist. Ich komme nach. Ich bin nicht zwei Meter groß. Und ich habe an eine Sonnenbrille gedacht. Ihr Kollege wird nicht auf mich achten.«
Blanc nickte. »Treffen wir uns vor dem Hotel?«
»Vor dem Jules César«, bestätigte Aveline.
Blanc warf einen letzten Blick nach unten: Marius ging mit den Unbekannten im Halbdunkel auf und ab. Er redete mit dem Typen im Holzfäller-Outfit, gestikulierte, es war nicht ganz klar, ob er dabei lachte oder doch eher empört war. Der Koloss im Hoodie blieb hingegen stets ein, zwei Schritte hinter ihnen zurück, fast sah er wie ein Leibwächter aus.
Der Südwestwind hatte inzwischen die meisten Regenwolken bis zu den Alpilles fortgetrieben. Nun wagten sich nach und nach mehr Besucher in das Amphitheater. Die Ränge füllten sich. Blancs Chancen stiegen, unerkannt zu entkommen. Er streichelte Aveline zum Abschied über die Hand, dann lief er tief gebückt zum fensterlosen Treppenhaus. Dort wäre er beinahe gegen einen bebrillten, schmächtigen Mann mittleren Alters geprallt, der mit energischen Schritten die Stufen hinaufkam. Blanc machte ihm im letzten Moment Platz und nickte höflich – wenn ein weiterer Besucher auf dem Turm stand, dann fiel Aveline weniger auf.
Als er am Fuß des Turms angekommen war, zögerte er. Der kürzeste Weg zum Ausgang hätte ihn über einige moderne Zuschauerränge geführt. Doch das ganze Stahlgestell würde unter seinen Schritten knirschen und vielleicht würde Marius gerade dadurch auf ihn aufmerksam werden. Blanc konnte nun allerdings nicht mehr länger in den Gang hineinblicken, er hatte keine Ahnung, ob sein Kollege und die beiden Unbekannten überhaupt noch dort waren.
Er blickte sich kurz um, atmete durch und entschied, dass das Risiko, den drei Männern im Labyrinth unterhalb der Sitzreihen zu begegnen, geringer war, als das Risiko, auf dem Gestell bemerkt zu werden. Er eilte in den nächstgelegenen, düsteren Gang. Das Amphitheater war mit lichtlosen Wegen durchzogen wie ein Termitenbau. Wenn Blanc Glück hatte, würde er auf Umwegen ungesehen bis zum Ausgang gelangen. Wenn er Pech hatte, würde er Marius direkt in die Arme laufen. Dann musste er sich eine Geschichte einfallen lassen.
Er war den Gang erst wenige Schritte weit hinuntergelaufen, als er plötzlich einen langgezogenen Schrei hörte. Ein Mann in Todesangst. Das steinerne Oval warf den schrecklichen Laut tausendfach zurück, er hätte von überall kommen können. Dann vernahm er einen dumpfen Schlag, ein hässliches Knacken, der Schrei brach abrupt ab. Eine Sekunde lang war es, als hielte die Zeit den Atem an. Dann zerschnitt der Ausruf einer Frau die Stille im Amphitheater. Angst lag in dieser Stimme, aber auch Zorn.
Avelines Stimme.
Blanc rannte los. Der Gang. Die Treppen hinauf in den Turm. Irgendwo hinter sich hörte er hysterische Schreie aus der Arena. Jemand rief nach der Polizei. Zahllose Schritte dröhnten auf den Rängen, die Stahlkonstruktion schepperte wie bei einem Erdbeben. Zwei, vier, sechs, acht Stufen, Blanc nahm sie in großen Sprüngen. Doch plötzlich rutschte er auf einer der ausgetretenen Steinplatten aus, taumelte einen schier endlosen Moment lang und schlug schließlich mit der Schulter so hart gegen die Seitenwand, dass es ihm die Luft aus den Lungen presste. Der Schmerz ließ kleine Lichtkerzen in seinen Augen explodieren. Er biss die Zähne zusammen und kämpfte sich hoch. Weiter. Tageslicht. Die Plattform des Turms. Blanc blickte sich atemlos um.
Neben der Mauer, die hoch über der Stadt aufragte, kämpfte Aveline um ihr Leben. Der muskulöse Mann, den er wenige Minuten zuvor noch mit Marius zusammen im Gewölbe gesehen hatte, hielt sie gepackt. Seine Kapuze hatte er noch immer so weit über den Kopf gezogen, dass sein Gesicht ein schwarzes Nichts war. Wie ist dieser Typ so schnell hier hochgekommen?, dachte Blanc erschrocken. Aveline schlug mit der rechten Faust auf ihn ein, doch sie traf bloß seine Schultern, die so hart waren wie eine Baumaschine. Mit der Linken fingerte sie an ihrer Manteltasche, als wolle sie ihr Handy zücken. Doch der Mann hatte seine schwarz behandschuhten Pranken so eng um ihren Leib geschlungen, dass sie nicht in ihre Taschen hineingreifen konnte. Der wird Aveline vergewaltigen, fuhr es Blanc durch den Kopf, aber dann erkannte er, was der Unbekannte wirklich vorhatte: Er zerrte Aveline näher und näher zur Mauer und zwang sie auf den Abgrund zu.
Blanc brüllte vor Wut und stürzte sich auf den Mann. Doch der war unfassbar schnell. Der Koloss ließ Aveline fallen, die auf den Boden schlug und stöhnte. Dann duckte er sich und rammte Blanc die Faust in den Magen. Der Schmerz war so schrecklich, dass Blancs Beine unter ihm wegknickten. Er knallte in gekrümmter Haltung auf die Steine und wollte bloß noch atmen, atmen, atmen, doch er konnte keine Luft einsaugen. Er hörte seltsam gurgelnde Laute und brauchte ein paar Augenblicke, bis er realisierte, dass sie aus seinem Mund drangen. Ihm wurde schwarz vor Augen.
Schritte. Er spürte Hände auf seinem Leib. Jetzt macht er dich endgültig fertig, dachte er noch, und ein unglaublicher Zorn durchflutete ihn, Zorn auf sich selbst, weil er so hilflos dalag, weil er Aveline nicht beistehen konnte, weil er so verdammt bescheuert gewesen war, ohne Deckung in diese Faust zu rennen wie ein Anfänger.
Doch die Hände taten ihm nicht weh. Kräftig, aber behutsam drehten sie ihn herum und drückten seinen gekrümmten Leib auseinander.
Luft.
Als das Flimmern vor seinen Augen verschwand, sah er Avelines Gesicht dicht vor dem seinen. Sie packte seine Schultern. »Stehen Sie auf!«, flüsterte sie.
Blanc brachte nur krächzende Laute hervor.
»Der Kerl ist abgehauen. Wahrscheinlich hat er Angst vor Zeugen.« Sie sprach sehr schnell, sehr kühl, sehr überlegt. »Gleich wird dieser Turm voller Menschen sein. Wir sollten besser verschwinden.«
»Was …«, keuchte Blanc. Er taumelte hoch. Er hätte am liebsten gekotzt.
»Ein Mann ist ein paar Sekunden nach Ihnen auf den Turm gekommen«, erklärte sie. Blanc nickte. Der schmächtige Typ mit der Brille, der es so eilig gehabt hatte.
»Ich habe gar nicht auf ihn geachtet«, fuhr Aveline fort, »er sah so gewöhnlich aus. Kurz darauf ist plötzlich dieser Riese aufgekreuzt. Danach ging alles sehr rasch. Der Typ hat kein Wort gesagt, sondern ist direkt auf den Mann zugegangen, hat ihn gepackt und in die Tiefe geschleudert. Er war wie ein Roboter. Schnell. Gefühllos. Präzise.« Aveline schüttelte den Kopf, und Blanc hätte schwören mögen, dass in dem Horror ihrer Stimme doch so etwas wie Bewunderung mitschwang. »Erst danach hat der Typ sich umgedreht und bemerkt, dass er eine Zeugin gehabt hat. Den Rest muss ich Ihnen nicht erzählen.« Sie atmete tief durch.
Blanc hatte immer noch Mühe zu atmen. Sein Bauch fühlte sich an, als würde ein Vorschlaghammer zwischen seinen Eingeweiden stecken. Er betastete den unteren Rippenbogen. Offenbar kein Knochen gebrochen, immerhin. Er wankte bis zur Brüstung und sah hinab. Weit unten, zwischen den steinernen Sitzreihen, lag der schmächtige Mann, er rührte sich nicht. Dutzende Besucher hatten einen Kreis um ihn gebildet, doch niemand wagte es, ihn anzufassen. Sie starrten den seltsam verrenkten Leib an. Unter dem Kopf breitete sich eine Blutlache aus, bis sie seine Brille mit den zersplitterten Gläsern umfloss, die fast einen halben Meter neben dem Gesicht in einem der seltenen Sonnenstrahlen aufblitzte. Marius und seine beiden Begleiter waren nirgends zu erblicken. Aus der Ferne wehte das Heulen der Ambulanz- und Polizeisirenen heran. Blanc schwindelte, und das lag nicht allein an Schmerzen und Atemnot.
Aveline hatte sich hinter die Brüstung geduckt. »Ich kann nicht als Zeugin aussagen«, erklärte sie. Sie sprach rasch. »Mein Mann darf nicht misstrauisch werden. Wenn ich aussage, wird Jean-Charles sich sofort fragen, warum ich in Arles war.«
Blanc brauchte tatsächlich einige Momente, bis die Bedeutung ihrer Worte zu ihm durchgedrungen war. Er schaute sie fassungslos an. »Sie müssen aussagen! Da unten liegt ein Toter! Der Mann hätte Sie ebenfalls beinahe ermordet. Sie dürfen nicht einfach weggehen, als wäre nichts geschehen. Was soll Ihr Mann schon denken, wenn er erfährt, dass Sie in Arles waren? Sie haben die Arena besucht, was ist dabei? Ihr Mann wird erleichtert sein, dass Ihnen nichts geschehen ist. Er wird doch nicht ahnen, dass wir uns hier verabredet haben. Er wird nicht …«
»Er wird. Wenn Sie aussagen und wenn ich aussage, dann erfährt mein Mann aus dem Polizeiprotokoll, dass wir zur selben Zeit am selben Ort waren. Unterschätzen Sie niemals seinen Scharfsinn.«
Blancs Gedanken rasten. »D’accord«, murmelte er schließlich. »Sie verschwinden von hier. Ich warte auf die Polizei und sage aus, was nötig ist: Der Mann auf dem Turm, der Kapuzenträger, die Tat. Als wäre ich an Ihrer Stelle gewesen. Die Ermittler bekommen eine brauchbare Zeugenaussage und schnappen sich den Typen. Wenn ich die Sache hinter mir habe, schicke ich Ihnen eine SMS und wir treffen uns in der Stadt.«
Aveline richtete sich auf und zog Blanc mit sich in den Schutz des Treppengewölbes. Sie trat ganz nahe zu ihm, und Blanc hoffte einen absurden Moment lang, sie würde ihn küssen. Doch sie brachte ihre Lippen bloß dicht an sein Ohr und flüsterte: »Meine Tasche. Der Kerl hat mir meine Sachen entrissen. Als Sie dazukamen, ist er weggerannt, aber er hat sich vorher meine Tasche gegriffen.«
Blanc schloss für einen hoffnungslosen Moment die Augen. Das war ein verdammter Albtraum. »Auf den Dokumenten in der Tasche steht sicher überall Ihr Name«, vermutete er tonlos. »Der Mörder weiß jetzt, wie die Zeugin heißt, die er beseitigen muss.«
»Nicht nur das«, erklärte Aveline und klang schon beinahe wieder heiter. »In der Tasche stecken Unterlagen über Islamisten, die ich Jean-Charles bei einer Konferenz im Innenministerium präsentieren muss. Sehr wichtige Unterlagen für eine sehr wichtige Konferenz. Ich kann da nicht mit leeren Händen ankommen.«
Blanc stöhnte. »Wir müssen doch zur Polizei gehen. Wir brauchen Personenschutz. Wir haben keine Wahl.«
»Wir haben die Wahl, mon Capitaine. Entweder wir gehen zur Polizei und erregen das Misstrauen meines Mannes. Oder wir gehen nicht zur Polizei und jagen den Mörder selbst. Sie wissen, was weniger gefährlich ist.«
Blanc packte Aveline an den Schultern und sah sie beschwörend an. »Die Stadt gehört zum Gebiet der Police Nationale, nicht zur Gendarmerie. Und hier ist das Gericht von Tarascon zuständig, nicht das von Aix. Wir dürfen in Arles nicht ermitteln, keine Zeugen befragen, keine Spuren sichern, keine Experten hinzuziehen, nichts! Und einen Mörder dürfen wir schon gar nicht verhaften. Was sollen wir bitteschön tun?!«
»Wir müssen uns schnell etwas einfallen lassen.« Aveline tippte mit einer gelassenen Bewegung auf ihre Armbanduhr. Plötzlich lächelte sie. »Ich muss die Dokumente im Ministerium präsentieren, es gibt keine Kopien. Mein Zug nach Paris geht am Sonntagabend. Bis dahin müssen wir uns die Tasche von dem Mörder zurückgeholt haben. Ohne Polizei. Ohne Gericht. Nur Sie und ich.« Nie hatte Aveline bezaubernder gelacht als jetzt.
Blanc wurde in diesem Moment bewusst, dass sie die Gefahr mehr liebte, als sie je einen Mann lieben würde. Sie küsste ihn, lange und hingebungsvoll. »Wir treffen uns später«, flüsterte sie dann.
Er lehnte sich erschöpft gegen die kalte Wand und zog sein Handy hervor. 17.07Uhr. Ihnen blieben weniger als einundfünfzig Stunden.
Ein ungläubiger Commissaire
»Ein schwarz gekleideter Koloss kommt auf den Turm, geht wortlos zu einem harmlosen Besucher, wirft ihn in die Tiefe wie einen Kieselstein, verpasst Ihnen anschließend einen Hieb in den Magen und spaziert nach getaner Arbeit wieder friedlich davon. Habe ich das so richtig zusammengefasst?«
»Ich habe nicht gesagt, dass er spaziert ist.« Blanc unterdrückte den Drang, seine Hand auf den schmerzenden Bauch zu pressen. Er unterdrückte den Drang, auf das Handydisplay zu gucken, obwohl es inzwischen mindestens sechs Uhr sein musste. Er unterdrückte den Drang, dem Typen vor ihm die Fresse zu polieren. Er stand noch immer auf dem Turm des Amphitheaters. Vor ihm hatte sich Commissaire Alphonse Lizarey von der Police Nationale aufgebaut: Mitte vierzig, klein, schwarzhaarig, hektisch, hager. Er hatte in der letzten Viertelstunde einen Ring aus Marlborokippen um seine polierten Lederschuhe gestreut. Aus der ausgebeulten Brusttasche seines Uniformhemds lugten zwei rot-weiße Packungen und ein Plastikfeuerzeug.
Der verdammte Idiot sollte seine Kippen behalten und die Leute von der Spurensicherung über den Turm scheuchen, dachte Blanc. Aber der hielt das offenbar nicht für nötig, denn er schien schon davon überzeugt zu sein, dass das Opfer ohne fremdes Zutun über die Brüstung gestürzt war. Selbstmord oder Unfall waren seine Vermutungen, das hatte Lizarey gleich zu Anfang der Befragung angedeutet.
»Ich habe auf dem Boden gelegen und Sterne gesehen. Ich habe nicht mehr mitbekommen, wie der Mörder verschwunden ist«, erklärte Blanc geduldig.
»Der Mörder, das unbekannte Wesen, vielleicht ist er ja auch davongeflogen, mais oui.« Lizarey gehörte zu den klein gewachsenen, energiegeladenen Männern, die nie länger als fünf Sekunden an einem Platz verharren können. Er drehte sich brüsk von Blanc weg und marschierte in raumgreifenden Schritten quer über die Plattform. Er sah hinunter. Der Tote lag inzwischen unter einer Plastikplane, Ärzte und Sanitäter waren schon wieder verschwunden. Einige Uniformierte suchten noch mehrere Quadratmeter um die Leiche nach vielleicht herumliegenden Habseligkeiten des Opfers ab. Polizisten hatten die anderen Besucher in die Arena geführt, befragt und schließlich gehen lassen. Blanc hätte gern gewusst, ob Marius als Zeuge vernommen worden war, doch er wagte nicht, sich danach zu erkundigen, um das Misstrauen des Ermittlers nicht noch mehr anzuheizen.
Blanc hatte Lizarey seinen Dienstausweis gezeigt und behauptet, er habe das Amphitheater in seiner Freizeit besucht, reine Neugier, das Bildungsinteresse eines Parisers, den sein Job zufällig in den Süden verschlagen hatte. Nette Stadt, dieses Arles, aber eigentlich würde er jetzt am liebsten wieder nach Hause fahren. Lizarey hatte ihn jedoch nicht gehen lassen, hatte gar nicht richtig zugehört und nur missmutig auf den Dienstausweis gestarrt. Es war offensichtlich, dass er zu den Beamten der Police Nationale gehörte, die jeden Gendarmen in ihrem Hoheitsgebiet als feindlichen Eindringling betrachteten und er gab einen Dreck auf Blancs Bildungsinteresse.
Blanc hatte sich zusammengenommen und noch einmal seine Version der Ereignisse erzählt, eine Version, in der es keine Aveline und keinen Marius gab: der schmächtige Mann, der Koloss aus dem Aufgang, der Mord, der Schlag in die Magengrube. Doch irgendetwas hatte Lizarey an dieser Geschichte von Anfang an nicht gepasst. Blanc musste sie nun schon ein drittes Mal herunterleiern, und wie jeder Lügner wurde er nervös dabei. Habe ich etwas vergessen? Habe ich diesmal etwas erzählt, das ich beim letzten Mal nicht erwähnt habe? Verwickle ich mich gerade in Widersprüche? Es war eine beunruhigende Erfahrung, bei einer Befragung plötzlich auf der anderen Seite zu stehen.
»Kannten Sie den Toten?«, fragte Lizarey endlich und zündete sich eine neue Marlboro an.
Blanc schüttelte den Kopf. »Nie zuvor gesehen.«
»Thierry Gravet, einundfünfzig Jahre alt, Geschichtslehrer am Collège Frédéric Mistral in Arles. Harmloser geht es nicht.«
»Irgendjemand sieht das anders.«
»Hat dieser«, Lizarey zögerte, »dieser gesichtlose, kapuzenverhüllte Koloss etwas zu Gravet gesagt, bevor er ihn in die ewigen Jagdgründe geschleudert hat? Eine Drohung? Eine Beleidigung?«
»Kein Wort.«
»Einfach hin und ab über die Mauer, he?«
»Sie glauben mir nicht.«
»Glauben ist was für Priester.«
»Ich kann nichts dafür, dass der Mörder vor der Tat keine Arie gesungen hat.«
»Ein Dienstausweis ist kein Freibrief für dumme Bemerkungen.« Lizarey begann wieder, an der Brüstung entlangzutigern, während er sich schon wieder eine neue Zigarette anzündete. »Ich will Ihnen mal was verraten, Kollege«, fuhr er schließlich fort und betonte das letzte Wort so, dass es sich wie eine Beleidigung anhörte. »Zum Zeitpunkt des Todes befanden sich nicht einmal einhundert Personen im Amphitheater. Niemandem ist ein schwarz gekleideter, zwei Meter großer Riese aufgefallen, nicht einmal der Dame an der Kasse. Keiner hat ihn hereinkommen sehen, keiner hat ihn durch die Ränge gehen sehen, niemand hat ihn auf diesem bescheuerten Turm gesehen. Und übrigens hat auch kein einziger dieser Zeugen Sie auf diesem Turm gesehen. Ich habe bloß ein Ehepaar gefunden, bei dem sich die Frau an Sie erinnert hat. Sie haben ihnen unten zugenickt, auf den Rängen, beinahe da, wo der Tote jetzt liegt. Weit, weit unter dem Turm.« Lizarey fixierte ihn.
»Die meisten Zeugen sind kurzsichtige Rentner.«
»Einer dieser kurzsichtigen Rentner, ein Holländer, hat allerdings Monsieur Gravet auf dem Turm erkannt. Er hat weiterhin ausgesagt, dass ihm Gravet aufgefallen sei, weil der sich beängstigend weit über die Brüstung gebeugt habe. Ganz allein.«
»Das war kein Selbstmord oder Unfall. Das war …«
»Dieser Holländer«, unterbrach ihn Lizarey ungerührt, »hat dort oben weder Sie noch einen schwarz gekleideten unbekannten Mann gesehen. Aber«, der Commissaire lächelte dünn, »dieser Holländer mit seinen möglicherweise doch nicht ganz so kurzsichtigen Augen hat ausgesagt, dass er ein paar Sekunden vor Gravets Todesschrei am anderen Ende des Turms eine Frau gesehen hat. Elegant. Dunkle Haare. Grauer Mantel, dunkelrote Hose. Und eine Sonnenbrille. Bei dem Wetter. Seltsam, nicht wahr?«
»Die ist mir gar nicht aufgefallen«, erwiderte Blanc und zwang sich, Lizareys Blick standzuhalten.
»Die ist leider auch keinem meiner Kollegen aufgefallen, die die Besucher als Zeugen befragt haben.« Lizarey studierte seinen Notizblock. »Ein paar Dutzend ältere Damen und Herren, drei städtische Angestellte an der Kasse, ein Gendarm auf Bildungsurlaub, ein toter Lehrer. Voilà, das ist die gesamte Belegschaft des Amphitheaters – so, wie meine Jungs sie registriert haben. Keine elegante Frau. Dabei wäre das eine wichtige Zeugin, finden Sie nicht auch?«
»Vielleicht ist die Dame bloß das Hirngespinst eines holländischen Rentners.« Blanc fragte sich kurz, wie Aveline unerkannt aus dieser Steinschüssel entkommen sein mochte. Wenigstens das ist uns gelungen, sagte er sich, wenigstens das. Dann jedoch sah er zufällig zu Boden. Zwischen den Marlboro-Zigarettenstummeln des Commissaires lag eine filterlose Kippe. Gauloises. Er blickte rasch wieder auf.
»Möglich, dass es das Hirngespinst eines alternden Trottels war«, gab Lizarey widerwillig zu. »Wichtigtuer mit erfundenen Geschichten laufen mir jeden Tag über den Weg. Trotzdem würde ich gern mit dieser Dame sprechen. Ich habe sie zur Fahndung ausschreiben lassen. Nur zur Sicherheit.«
»Es ist immer gut, sich abzusichern«, erwiderte Blanc und versuchte, sich den Schock nicht anmerken zu lassen.
Der Commissaire kritzelte ein paar Ziffern auf eine seiner inzwischen leer gerauchten Marlboro-Packungen. »Das ist meine private Handynummer. Falls Ihnen noch etwas einfallen sollte, Kollege.«
Blanc nahm die zerdrückte Schachtel und schwor sich im Stillen, diese Nummer niemals anzurufen.
»Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich noch Fragen habe. Gute Heimfahrt.« Lizarey nickte knapp und verschwand im Treppenhaus des Turms. Endlich.
Blanc atmete vorsichtig und so flach wie möglich. Sein Bauch schmerzte immer noch bei jedem Zug. Wäre er an Lizareys Stelle, dann würde er jetzt alle verfügbaren Beamten in die Stadt beordern, zu Fuß, im Streifenwagen. Und ein paar Beamte vor die Monitore der städtischen Überwachungskameras. Ein zwei Meter großer, schwarz gekleideter Kerl. Eine Stadt von bloß fünfzigtausend Einwohnern. Die Chancen standen doch nicht so schlecht, dass irgendjemand irgendwo diesen Typen gesehen haben, dass ihn irgendwo irgendeine Kamera gefilmt haben musste! Aber Lizarey würde nicht einen einzigen Polizisten auf die Spur des Mörders setzen. Keine Fahndung nach dem Kerl, merde, was dachte sich der Commissaire? Aber eine Fahndung nach Aveline, das schon. Ob er Blanc für einen Spinner hielt? Ob er glaubte, dass sich dieser Lehrer freiwillig in die Tiefe gestürzt hatte? Ob er mit der Fahndung bloß eine Zeugin ausfindig machen wollte, deren Aussage glaubwürdiger wäre als die von Blanc? Die Lizarey bestätigen würde, was er sowieso glaubte, nämlich dass es gar keinen Mörder gab? Oder ob er aus ganz anderen Gründen nach einer eleganten, dunkelhaarigen Frau suchte? Aber aus welchen Gründen? Eines war klar: Lizarey würde kein Verbündeter auf seiner Suche nach dem Täter sein. Im Gegenteil.
»Wir schließen jetzt, Monsieur!« Die dickliche Frau von der Kasse war bis auf den Turm gestiegen. Sie atmete schwer, und man sah ihr an, dass sie nicht glücklich darüber war, bis zum höchsten Punkt ihres Amphitheaters steigen zu müssen, um einen späten Gast hinauszutreiben.
»Gibt es noch einen zweiten Ausgang?«, fragte Blanc.
»Einen Notausgang.«
»Ist der verschlossen?«
»Jetzt ja.«
»Das heißt, er war vorhin noch offen?«, fragte Blanc und bemühte sich, seine Stimme gelassen klingen zu lassen, auch wenn es ihm schwerfiel.
»Wahrscheinlich haben ihn die Flics geöffnet, als sie herumgeschnüffelt haben. Oder sie haben die Leiche durch den Notausgang herausgetragen. Das ist diskreter, und der Arme war ja kein schöner Anblick.« Ihr Gesicht zeigte Ungeduld, Gleichmut und Müdigkeit, keine Verwunderung. Blanc hätte ihr gern seinen gelben Dienstausweis vorgehalten. Ein unverschlossener Notausgang. Ein Hüne, den niemand hatte kommen und gehen sehen. Er fühlte sich wie gefesselt. »Kannten Sie den Toten?«
»Sind Sie Journalist, oder was?«
»Vergessen Sie’s.« Bevor Blanc die Treppen hinunterstieg, blickte er noch ein letztes Mal vom Turm. Wenn sich auf einigen schmutzig-grauen Steinstufen nicht ein dunkler Fleck ausgebreitet hätte, dann würde nichts mehr auf den Toten hindeuten. Aber auch diese Spur würde im nächsten Regenschauer vergehen.
Vor dem Amphitheater schlang Blanc seine blaue Sporttasche um die Schulter. Er wollte das Monument einmal umrunden, um die Lage einzuschätzen. Die Römer hatten für die Arena einst die gewölbte Kuppe eines Hügels gekappt: Das Amphitheater stand in einer Mulde auf der Anhöhe. Direkt um die Steinbögen erstreckte sich auf zehn, zwanzig Meter Breite ein Streifen felsigen Bodens, uneben und von trockenem Dreck überkrustet. Jenseits dieses Streifens führte eine asphaltierte Straße um das Monument, die an der Freitreppe zum Haupteingang begann und zu beiden Seiten steil anstieg. Blanc wandte sich nach rechts und stand nach ein paar Dutzend Schritten schon so hoch, dass er in die mittlere Bogenreihe der Arena hineinsehen konnte. Er folgte der Straße bis zu ihrem höchsten Punkt und ging auf der gegenüberliegenden Seite wieder hinunter bis zum Haupteingang.
Direkt gegenüber der Freitreppe glänzten die Fenster der kleinen Brasserie L’Aficion. Im warm leuchtenden Innern nahm er Bewegungen wahr. Gäste, Kellner – Zeugen, dachte er, Zeugen, die dasitzen und die man nur befragen müsste. Verdammter Lizarey. Der Gitarrenspieler war fort. Den hätte man auch nach dem Koloss fragen können, dachte Blanc resigniert. Einige Souvenirstände hatten schon geschlossen. Von dem massigen Mann, von Marius oder dem Typen mit Vollbart war nichts zu sehen.
Er folgte der Straße, vorbei an zwei, drei weiteren Cafés, aus denen gelbes Licht flutete, die meisten Tische waren inzwischen leer. Den Notausgang entdeckte er, nachdem er ein Stück weit um das Amphitheater herumgegangen war. Hier lag zwischen den Bögen der Anlage und dem modernen Asphalt das alte Felsplateau wie der Grund eines ausgetrockneten Kanals unterhalb des Straßenniveaus. Kaum ein Tourist verirrte sich hierhin. Und die Besucher, die auf der Straße um das Monument flanierten, sahen selten dort hinunter, die betrachteten eher die Bögen und Türme. Der Notausgang war eine ziemlich solide aussehende Stahltür. Blanc stieg bis zu ihr hinab. Weder Schloss noch Rahmen zeigten Spuren eines gewaltsamen Versuchs, die Tür zu öffnen. Und der Felsboden davor war so hart, dass er keinen Fußabdruck erkennen konnte.
Blanc zog sein Nokia hervor, um Aveline anzurufen. »Wir haben noch ein paar Probleme mehr«, sagte er.
Straßengewalt
»Wir müssen Ihnen Kleidung kaufen, bevor wir im Hotel einchecken«, sagte Blanc am Handy.
Aveline lachte. »Ich kann den Rezeptionisten losschicken, um mir eine Bluse und eine Zahnbürste zu besorgen.«
»Mit dem würde ich kein Wort wechseln. Wahrscheinlich hält jeder Portier, jeder Taxifahrer und jeder Schaffner am Bahnhof in dieser Stadt gerade Ausschau nach einer Frau in grauem Mantel und dunkelroter Hose, die an einem trüben Novembertag eine auffällige Sonnenbrille trägt.«
»Meine Brille verschwindet soeben in der Manteltasche. Ein Zeuge hat mich also in der Arena gesehen?«
»Und ein Commissaire der Police Nationale würde Sie gerne verhören. So gern, dass er Sie zur Fahndung ausgeschrieben hat.«
»Irgendwann passiert einem alles zum ersten Mal. Kennt er meinen Namen?«
»Commissaire Lizarey hat keine Ahnung, nach wem er sucht.«
»Also gut«, fuhr Aveline nach einer kurzen Pause fort. »Gehen wir shoppen. Wir treffen uns gegenüber dem Hotel. Auf dem Boulevard des Lices. Die Boutiquen dort sind noch geöffnet und die Restaurants sind voll. Wir werden nicht auffallen.«
»Ich bin in fünf Minuten da.«
»Mon Capitaine?«
»Ja?«
»Ich hoffe, Sie haben ein ordentliches Limit bei Ihrer Bank. Ich kann schlecht mit meiner Kreditkarte zahlen. Wenn mein Mann die Kontoauszüge liest, wüsste er, dass ich in Arles war.«
»Es wird mir eine Freude sein, für Sie zu bluten, Madame le Juge.«
In der Boutique, in der sie sich schließlich umsahen, waren mehr Kunden als in den anderen Geschäften, hier fühlten sie sich zunächst sicher. Doch Blanc mochte die wummernde Musik nicht. Aus den Raumduftspendern quoll ein süßliches Parfum, das er nicht mochte. Erst recht mochte er die diskreten Videokameras an der Decke nicht, die er erst entdeckt hatte, als er bereits mitten im Laden stand, und die mit ihren Weitwinkelobjektiven auch die letzte Ecke des Raumes ausspähten. Und er mochte die Blicke der jungen Verkäuferin nicht.
Aveline ließ ihn weniger bluten als befürchtet. Sie hatte innerhalb weniger Minuten einen einfachen beigefarbenen Mantel erstanden und eine Jeans und beides gleich anbehalten. Selbst in diesem Outfit sah sie hinreißend aus. Die Verkäuferin musterte Aveline, während sie ihren teuren Mantel und die bordeauxfarbene Hose zusammenfaltete und in die große Papiertasche mit dem Aufdruck der Boutique gleiten ließ. Und sie musterte Blanc, als er zahlte. Hätte er genügend Geld dabei gehabt, hätte er bar bezahlt, nur um ebenfalls keine Kreditkartenspuren zu hinterlassen. Er zwang sich, beim Zahlen nicht nach oben zur Überwachungskamera zu gucken. Paranoia. Aber diese Verkäuferin starrte sie mit großen Augen an. Und, verdammt, ihr neugieriger Blick galt eindeutig mehr Blanc als Aveline. Nachdem seine Geliebte und er die Boutique verlassen hatten, sah Blanc durch das Schaufenster, wie die Verkäuferin von der Kasse zurücktrat und sich halb umdrehte, so als wollte sie, dass kein Kunde sie störte. Dann zog sie ihr Handy hervor und tippte auf das Display.
»Arme Kleine«, kommentierte Aveline, die Blancs Blick gefolgt war.
»Armer Roger Blanc. Sie sollten nicht Mitleid mit ihr haben, sondern mit mir. Ich werde gerade verpfiffen.«
»Die Maus ruft nicht bei der Polizei an. Sie hat sich bloß in sie verguckt.«
»Und deshalb zückt sie ihr Smartphone, sobald wir draußen sind?«
»Auf der Kreditkarte, mit der Sie gerade bezahlt haben, steht Ihr Name. Jetzt sieht sie auf Facebook nach, ob Sie noch zu haben sind.«
Blanc sah Aveline einen Moment lang an. »Meinen Sie das wirklich ernst?«
»Willkommen im einundzwanzigsten Jahrhundert, mon Capitaine. Und jetzt lassen Sie uns essen gehen.«
Blanc spürte auf einmal, wie hungrig er war. Er war mittags so eilig aus Gadet abgereist, dass er nichts mehr hatte essen können. Das Waux-Hall, auf das Aveline deutete, leuchtete aus dem Erdgeschoss eines hellen, massigen Empirebauwerks am Boulevard des Lices in die Dunkelheit. Ein Vorbau aus Glas und Eisen wölbte sich vor der Fassade, ihn erinnerte das an alte Brasserien in Paris und an den Schwung der Métro-Schilder, an die elegante Weite im Musée d’Orsay und ein wenig sogar an den Eiffelturm – und damit an alles, was er verloren hatte. Die meisten Tische in der Halle aus Eisen und Glas waren besetzt, was gut war, denn so würden sie nicht sehr auffallen. Allerdings konnte jeder vom belebten Boulevard aus ungehindert in diese helle Halle blicken, was weniger gut war.
»Seltsamer Name für ein Restaurant«, sagte Blanc, während er Aveline die Tür aufhielt.
»Le Waux-Hall wurde in einer Zeit eröffnet, als England groß in Mode war.«
»Vor dem Brexit, nehme ich an.«
»Vor der Französischen Revolution.«
Blanc gab dem Kellner ein Zeichen, sie zu einem der wenigen freien Tische so tief wie möglich im Innern des Speiseraums zu führen. »Woher wissen Sie, wie dieses Restaurant an seinen Namen kam?« Er rückte ihr den Stuhl zurecht.
Aveline zündete sich eine Gauloises an. Niemand wagte, ihr das zu verbieten. »Sie sind nicht im Dienst, mon Capitaine.«
»Ich möchte dieses Restaurant als satterer und klügerer Mann verlassen.«
»Satt werden Sie hier.« Sie lachte. »Mein Gatte liebt das Theater …«
»Das hat er mir selbst erzählt.« Blanc erinnerte sich nicht gerade mit Vergnügen an die letzte Begegnung mit dem Staatssekretär in Paris.
»… und deshalb gehen wir hin und wieder ins Theater von Arles«, fuhr Aveline so gelassen fort, als wäre sie bei jener Begegnung in Paris nicht dabei gewesen. »Gute Schauspieler, eine gute Bühne, engagierte Stücke. Das Haus steht bloß ein paar Hundert Meter die Straße runter. Wenn mein Mann im Süden ist und das Sägen der Zikaden nicht mehr ertragen kann, dann entspannt er sich mit Kultur.«
Blanc blickte sich alarmiert um. »Ich habe gedacht, niemand kennt Sie in Arles?!« Er musste sich beherrschen, um nicht laut zu werden.
»Ich stehe ja im Theater nicht auf der Bühne, sondern sitze in einer dunklen Loge.«
»Aber anschließend gehen Sie mit Ihrem Mann in dieses Restaurant?«
»Selbstverständlich nicht. Meistens hat er so viel zu tun, dass er sich nach der Vorstellung von seinem Chauffeur zu uns nach Caillouteaux bringen lässt, um noch irgendwelche Dinge zu erledigen. Ich ziehe es vor, nach dem letzten Akt über das Stück nachzudenken. Für mich ist das Theater fast wie ein Verbrechen bei Gericht, auch wenn selbst ein Sartre vor manchen realen Kriminalfällen verblasst.«
»Sartre war kein Gangster.«
»Das würde Jean-Charles vermutlich nicht unterschreiben. Ich habe jedenfalls nach den Vorstellungen schon ein paar Mal hier gegessen, aber immer allein. Es ist gewissermaßen der sicherste Ort in ganz Arles – nämlich der einzige, in dem mein Gatte niemals nach mir suchen ließe, denn er selbst würde nicht einmal auf die Idee kommen, seinen Fuß hier hineinzusetzen.«
»So schlecht duftet das Essen nicht.«
»Jean-Charles würde niemals in ein Etablissement mit englischem Namen einkehren.«
Blanc blickte sich noch einmal unauffällig um. In der Tat war es schwer, sich Monsieur Ministre de l’État Jean-Charles Vialaron-Allègre hier vorzustellen. Die meisten Gäste redeten laut und tranken viel und sahen entschieden unpariserisch aus – die sind von hier, dachte er, und die sind oft in diesem Restaurant. Kein Deko-Schnickschnack auf den weißen Tischen, kein Essen auf der Speisekarte, dessen Namen man erst googeln musste, kein sanftes Hintergrundgeklimper aus diskret versteckten Bose-Lautsprechern, kein Ort für Vialaron-Allègre. Hier saß niemand, der je mit einem Pariser Staatssekretär ein verräterisches Wort reden würde.
Sie bestellten eine gardianne de taureau. Die Kellnerin bedachte sie bloß mit leerer, professioneller Freundlichkeit. Die kennt Aveline nicht, sagte sich Blanc erleichtert. Und sie wirkte auch nicht so, als würde sie gleich seinen Namen heimlich auf Facebook checken wollen. Er entspannte sich ein wenig.
Eine Viertelstunde später dampften Stierfleisch, dunkle Soße und der würzige Reis der Camargue auf ihren Tellern. Blanc spürte, wie die Kraft langsam in seinen Körper zurückströmte, ein archaisches Ritual: Du isst den Stier und seine Kraft geht auf dich über.
Aveline betrachtete ihn und lächelte. »Im Sommer zahlen Gourmets Fabelpreise für das Fleisch der Stiere, die am Nachmittag zuvor in der Arena vor ihren Augen zu Tode gekämpft wurden«, erklärte sie.
Blanc nickte und ließ das Weinglas kreisen. Er betrachtete die schöne Frau an seinem Tisch. Warten Sie schon länger hier? Führen Sie mich herum? Das hatte sie ihn, ein wenig spöttisch, im Amphitheater gefragt. Da hatte er geglaubt, sie kenne Arles nicht. Und nun eröffnete sie ihm, dort regelmäßig ins Theater zu gehen, und sie kannte sogar den Ursprung des obskuren englischen Namens einer Brasserie. Er fragte sich, wie oft Aveline tatsächlich schon in Arles gewesen war. Und wie viele Leute sie hier trotz ihrer gegenteiligen Behauptung doch wiedererkennen mochten. Und ob sie immer nur mit ihrem Gatten hier gewesen war … Und ob sie tatsächlich immer nur zu ihrem Vergnügen in der Stadt gewesen war … Er dachte an ihre Handtasche und einen absurden Moment lang glaubte er, dass irgendetwas in dieser Tasche vielleicht so wichtig war, dass der Mörder sie ihr gezielt entrissen hatte. Was mochte in dieser Tasche sein? Von normalen Ermittlungsunterlagen gab es Kopien. Wenn Aveline ihren Mann nicht misstrauisch machen wollte, brauchte sie doch bloß zurück nach Hause zu fahren. Sie hatte jederzeit Zugang zum Justizpalast in Aix-en-Provence, sie könnte sich am Samstag Doubletten aller Unterlagen verschaffen und sie, ganz wie geplant, am Montagmorgen im Ministerium präsentieren. Dem Staatsekretär würde nichts auffallen, er hätte keinen Grund, seine Frau mit einem obskuren Verbrechen in Arles in Verbindung zu bringen. Aber Aveline fuhr nicht nach Hause zurück, in dieser verdammten Tasche musste etwas Unwiederbringliches verborgen sein. Etwas, das so wichtig war, dass seine Geliebte dafür ihre Karriere, ihre Reputation und sogar ihr Leben riskierte. Und er machte bei diesem Wahnsinn mit, weil er sie in ihrer Not nicht allein lassen konnte, aber Wahnsinn war es trotzdem. Er war ein Narr, und es wurde nicht besser dadurch, dass er wusste, dass er einer war.
»Ich möchte wissen, was Marius mit den beiden Männern zu schaffen hatte«, sagte er zögernd und fast mehr zu sich selbst als zu Aveline. »Ob er womöglich sogar wusste, dass einer der beiden einen Mord begehen würde. Das hat doch alles so absurd gewirkt wie ein Albtraum. So unlogisch.«
»Logik ist nicht Lieutenant Tonons größte Stärke. Aber wenn es Sie beruhigen sollte: Ihr Kollege war definitv nicht auf dem Turm«, versicherte Aveline.
»Und der Mann mit Vollbart und Flanellhemd?«
»Der war auch nicht da.«
Blanc schloss die Augen. Wenn er genauer darüber nachdachte, wurde ihm klar, dass er eigentlich ziemlich wenig über Marius wusste: Seit ewigen Zeiten nicht mehr befördert, geschieden, erwachsene Kinder, die nicht mehr mit ihm redeten, Alkoholprobleme, Übergewicht, ein ganz normaler Flic eben. Aber ein Flic, mit dem kein anderer Beamter der Station von Gadet noch zusammen arbeiten wollte. Und niemand hatte Blanc bis jetzt verraten, warum das eigentlich so war.
Er spielte kurz mit dem Gedanken, Marius einfach auf dem Handy anzurufen und um ein Treffen zu bitten. Aber irgendetwas hielt ihn davon ab. Es waren nie die schrecklichen Wahrheiten, vor denen man die Augen verschloss, sondern die unangenehmen. Morde, Vergewaltigungen, das ganze menschliche Leid – da konnte Blanc genau hinsehen, auch wenn es ihm manchmal das Herz zusammenzog. Der Mann vor dir ist ein vielfacher Killer, ein sadistischer Sexualstraftäter, ein Menschenschmuggler, Zuhälter, Pyromane? Na und? Er konnte trotzdem nüchtern Spuren verfolgen und Fakten analysieren. Diese Wahrheiten mochten schrecklich sein, aber indem er sich ihnen stellte, stellte er sich zugleich auf die Seite des Guten: gegen das Verbrechen, aufseiten der Opfer. Aber wenn der Mann vor dir dein Freund ist und dich womöglich verraten hat? Dann musst du dir eingestehen, dass du dich getäuscht hast, dass du Illusionen aufgesessen bist und du dich selbst ändern musst. Da stand man nicht mehr auf der Seite des Guten, und vielleicht gab es das gar nicht mehr, diese klare Trennung in Gut und Böse.
Mach dir nichts vor, sagte sich Blanc. Du hast kein Vertrauen mehr in Marius.
Als sie das Waux-Hall verließen, schlenderten schon deutlich weniger Menschen über die Trottoirs. Plötzlich vibrierte Blancs Nokia. Alarmiert sah er auf das Display, halb fürchtete er, dass ihn Lizarey sprechen wollte, dann las er Astrids Namen. Seine Tochter. Sie rief eigentlich nie an, warum ausgerechnet jetzt?»Geht es dir gut?«, fragte er.
»Das ist ja mal eine Begrüßung.«
Blanc biss sich auf die Lippen. Seine Tochter meldete sich bloß dann, wenn sie irgendein Problem hatte. »Ich mache mir nur Sorgen, weil du mich so spät anrufst.«
»Früher warst du um diese Zeit immer noch im Büro. Da hast du dir nie Sorgen gemacht.«
Das Gespräch entgleitet mir, dachte Blanc beunruhigt. Da spreche ich einmal mit Astrid und nach noch nicht einmal zehn Sekunden rede ich Mist. »Ich mache jetzt früher Feierabend«, sagte er und bemühte sich um eine fröhliche Stimme.
»Schön, wenn man in deinem Alter noch etwas lernen kann. Was hältst du davon, wenn ich dich besuche?«
»Jetzt?!«
»Mit so viel Begeisterung habe ich gar nicht gerechnet. Vielleicht muss ich dich fragen, ob es dir gut geht?«
»Mir geht es blendend«, log Blanc. Seine Gedanken rasten. Wenn seine Tochter dieses Wochenende bei ihm in Sainte-Françoise-la-Vallée aufkreuzen würde, wie sollte er …
»Ich wollte nächsten Monat kommen«, verkündete Astrid, als hätte sie seine Überlegungen erraten.
»Nächsten Monat?«
»Du weißt noch, was Weihnachten ist, ja?«
»Ich besorge einen Weihnachtsbaum.« Eine Welle von purem Glück durchströmte ihn. Seine Tochter. Weihnachten.
»Glaubst du wirklich, sie haben in der Provence Tannen?«, fragte Astrid. »Eigentlich wollte ich über die Feiertage mit Freunden in Paris bleiben. Und …«, sie zögerte, »… Maman besuchen. Aber die fliegt mit ihrem neuen Typen in die Sonne. Rio, glaube ich. Sie haben mich eingeladen. Das könnte nett werden, aber ich habe nicht so viel Urlaub. Also wird das wohl nichts. Und da dachte ich mir: Die Provence kennst du auch nicht!« Sie lachte wieder. Blanc plauderte noch ein wenig mit seiner Tochter über Belanglosigkeiten, auch das hatte er seit hundert Jahren nicht mehr getan, dann verabschiedete sich Astrid.
Aveline zog an ihrer Zigarette und lächelte amüsiert, nachdem er das Gespräch beendet hatte. »In der Provence stellt man keine geschmückte Tanne hin. Hier baut man eine Krippe auf«, erklärte sie.
Blanc blickte sie an. Weihnachten. Wie Aveline wohl feiern würde? In ihrem Haus in Caillouteaux, mit ihrem Gatten, traut vor einer provenzalischen Krippe sitzend? Wohl eher in Paris, in einem schicken Restaurant, gemeinsam mit mächtigen Freunden. Und niemals mit Kindern, wurde ihm schlagartig klar, denn Aveline war nicht die Frau, die Kinder haben wollte.
Blanc schaute auf sein Handy. Fast zweiundzwanzig Uhr. Noch gut sechsundvierzig Stunden. Er kam sich mit seiner hässlichen Sporttasche so auffällig vor, als würde er ein exotisches Tier mit sich herumtragen. Aveline wirkte mit ihrer Tüte aus der Boutique hingegen so alltäglich wie jede andere Shopperin, die sich bei einem guten Essen von ihren Einkäufen erholt hatte. Ihre Sonnenbrille hatte sie nun ins Haar geschoben, was ihrer Frisur irgendwie ein anderes Aussehen verlieh. Nicht schlecht, dachte Blanc, kramte in seiner Tasche und zerrte seine Baseballcap heraus.
Sie schlenderten den Boulevard des Lices hinunter, bis sie neben einer kleinen Erhebung innehielten. Ein nachlässig gepflegter Park bedeckte den Hang, kaum mehr als ein paar Büsche, Pinien, Zypressen und mittendrin ein mit trockenen Blättern und Nadeln gefülltes Becken, in dem wohl schon seit Wochen kein Wasser mehr stand. Aveline hatte im Jules César gebucht, dem ersten Haus am Platz, nur wenige Schritte weiter auf der gegenüberliegenden Seite der Straße. Blanc dachte daran, dass er das Zimmer mit seiner Kreditkarte bezahlen würde, die nicht auf den Namen »Dupont« ausgestellt war. Er dachte daran, dass er Commissaire Lizarey gesagt hatte, er würde zu Hause übernachten und nicht in einem Hotel in Arles. Vor dem Park fiel das Licht der Straßenlampen spärlich zum Boden. Er musterte den Boulevard zu beiden Seiten und sah keine auffallend massige Gestalt. Keinen Polizisten. Keiner der späten Spaziergänger blickte Aveline an, als würde er sie wiedererkennen. Sie warteten trotzdem einen Augenblick im Schatten einer Zypresse und beobachteten weiterhin die Umgebung, ob ihnen irgendjemand auflauern könnte. Die Gebäude genau gegenüber waren zwei massige Betonkästen aus den Siebzigerjahren. Das Postamt, erkannte Blanc – und das Hauptquartier der Police Nationale. Kein Flaneur verirrte sich vor diese beiden hässlichen Kästen.
»Kommen Sie schon! Niemand lauert uns auf«, flüsterte Aveline schließlich ungeduldig und trat aus dem Schatten auf den hell erleuchteten Boulevard. Sie war bereits einige Schritte weit gekommen, als Blanc plötzlich einen Dieselmotor aufbrüllen hörte. Er klang wie von einem Lastwagen, nur kam der Lärm dafür viel zu schnell näher.
Er blickte sich nach links um. Nichts. Nach rechts. Nichts. Dann eine Bewegung am Rande seines Sichtfeldes. Doch von links. Ein schwerer, dunkler Geländewagen raste über den Boulevard des Lices, bedrohlich wie ein Panzer. Wo zum Teufel kam der her? Seine Scheiben waren getönt. Alle Lichter waren ausgeschaltet.
Er hielt genau auf Aveline zu.
Für Blanc war es wie in einem dieser Albträume, in denen die Zeit aussetzte. Man kämpfte und schlug um sich und rannte und kam doch nicht einen Millimeter voran. Er sah das Auto. Er sah Aveline. Sie hatte sich zu ihm umgedreht, als wollte sie etwas sagen. Sie schwenkte die Tasche der Boutique. Er wollte schreien, doch er brachte keinen Ton hervor. Seine Rechte fuhr an den Gürtel, aber selbstverständlich hatte er seine Sig-Sauer gar nicht erst mitgenommen. In einer Geste absoluter Lächerlichkeit zerrte er statt seiner Pistole bloß seinen Haustürschlüssel aus der Hosentasche.
Dann fiel die Lähmung von ihm ab. Der Lärm flutete zurück, das Brüllen des Motors, das Murmeln der Stadt, Avelines Stimme. Blanc ließ die Sporttasche fallen und sprang. Mit seiner Linken umfasste er Avelines Leib, riss sie mit sich, schleuderte sie weiter. Sie blickte ihn schockiert an, Schmerz durchzuckte ihre Züge. Blanc spürte den Luftzug des vorbeirasenden Wagens, das Dieselbrüllen, die Hitze des Motors. Instinktiv schlug er noch im Fallen nach dem Auto. Der Schlüssel fuhr mit einem metallischen Schlag gegen etwas Hartes, dann wurde er ihm aus der Hand gerissen.
Blanc kämpfte sich hoch, zerrte Aveline mit sich bis auf die andere Straßenseite und ging hinter einem Baum in Deckung. Der Geländewagen war fort. Niemand war auf den Gehwegen zu sehen, niemand rief etwas. Kein Sirenengeheul der Polizei. Es war so still, als hätte es das schwere Auto mit dem aufheulenden Motor nie gegeben.
»Alles in Ordnung?«, fragte Blanc keuchend.
»Meine neue Jeans hat nicht mal einen Riss.« Aveline versuchte sich an ihrem üblichen kühlen Lächeln, doch es gelang ihr nicht. Sie war sehr blass. »Ich glaube, ich brauche jetzt eine Zigarette.«
»Ich fasse es nicht«, sagte er schwer atmend. »Das war der zweite Mordanschlag an diesem Tag.«
Er küsste Aveline. »Das war ein Hinterhalt«, wiederholte er.
»Jemand hat uns aufgelauert. Wie konnten wir den bloß übersehen?« Sie zündete sich eine Gauloises an. Ihre Hand zitterte leicht.
Blanc nickte und rang noch immer nach Luft. »Der Typ muss uns aus einem Versteck heraus beobachtet haben und hat so lange gewartet, bis Sie auf der Straße waren.«
»In Anbetracht der Umstände können wir wohl kaum zur Polizei gehen und Anzeige erstatten.«
Blanc half ihr auf die Beine und klopfte sich den Straßendreck ab. Misstrauisch blickte er sich um, dann betrat er vorsichtig den Boulevard des Lices. Im Laternenlicht blitzte sein Schlüssel neben dem Mittelstreifen auf, etliche Meter von der Stelle entfernt, an der der Geländewagen sie beinahe überfahren hatte. Er hob den Schlüssel auf, eilte zu Aveline zurück und betrachtete ihn: Lacksplitter waren in den Zacken hängen geblieben. Dunkelgrüne Metallicfarbe, soweit er das erkennen konnte. Das Labor der Gendarmerie könnte daraus vielleicht einiges machen. Vergiss es. Er steckte den Schlüssel ein und holte sich die Sporttasche, die noch auf der gegenüberliegenden Seite lag, wo er sie fallen gelassen hatte. Es war immer noch kein Fußgänger zu sehen. Kein Auto auf der Straße. Wo waren bloß all die Leute geblieben? Es war, als wären sie die beiden einzigen Lebenden in einer Stadt, durch die die Pest gezogen war.
»Was halten Sie von einem Drink an der Hotelbar?«, fragte er Aveline.
»Gar nichts.« Sie lächelte schon wieder. Für sie war das wohl eine Art Spiel. Ein intellektueller Wettstreit zwischen dem Mörder und ihr – und sie war sich offenbar schon ziemlich sicher, wer am Ende gewinnen würde. »Der Kerl hat uns im Auto aufgelauert. Fast alle guten Hotels in Arles befinden sich in der Innenstadt und die ist praktisch eine einzige Fußgängerzone. Mit seinem dicken Geländewagen wäre er da kaum durchgekommen, zumindest nicht unbemerkt.« Sie hielt ihre Gauloises in der Linken. Ihre Hände waren jetzt wieder so ruhig wie die eines Chirurgen.
»Nur vor dem Jules César verläuft ein breiter Boulevard. Der Typ wusste also, dass wir dort ein Zimmer reserviert haben. Und dass er uns dort mit dem Auto erwischen konnte«, murmelte Blanc. »Er musste bloß warten, bis wir ihm vor den Kühler laufen. Er hat Sie gegen siebzehn Uhr in der Arena angegriffen. Um zweiundzwanzig Uhr lauert er uns bereits vor dem Hotel auf. Wie hat der Kerl das so schnell herausgefunden?«
»Er hat wahrscheinlich in meiner Handtasche nachgesehen. Zwischen meinen Unterlagen steckte ein Hotelprospekt. Ich wollte das Spa im Jules César ausprobieren. Ich hätte früher daran denken sollen.«