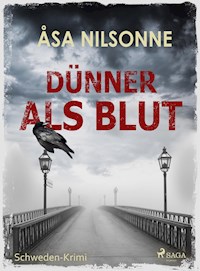
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Monika Pedersen
- Sprache: Deutsch
Mord im Krankenhaus – der erste Fall für die sympathische Stockholmer Polizistin Monika Pedersen: Per Zufall wird sie von der Streife in die Mordkommission geschickt und hat sofort ihren ersten Fall an der Hand. Im Västra-Krankenhaus stellt sich heraus, dass ein Patient nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern kaltblütig ermordet wurde. Doch schnell zeigt sich, dass Pedersen wohl nicht nur das Krankenhaus genauer unter die Lupe nehmen muss, sondern auch das Privatleben des Verstorbenen..."Schweden hat eine neue Krimikönigin: Åsa Nilsonne." - Östgöta Correspondenten"Monika Pedersen ist eine sehr angenehme Bekanntschaft: umgänglich, normal, ehrgeizig und unsicher. Aber nicht ohne Überraschungen. Monika Pedersen und Åsa Nilsonne müssen unbedingt weitermachen." - Dagens Nyheter"Åsa Nilsonne ist die neue schwedische Krimi-Königin: Hier verbinden sich Spannung und Dynamik mit großer Sachkenntnis." - Ostra Smaland"Åsa Nilsonne verbindet Spannung mit menschlicher Wärme." - Dagens NyheterDie fünf Kriminalromane rund um die ehrgeizige Stockholmer Polizistin Monika Pedersen kreisen nicht nur um spannende Fälle in bester skandinavischer Krimitradition, sondern handeln auch von ihrer persönlichen und professionellen Entwicklung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Åsa Nilsonne
Dünner als Blut - Schweden-Krimi
Übersetzt Gabriele Haefs
Saga
Dünner als Blut - Schweden-Krimi ÜbersetztGabriele Haefs Coverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1994, 2020 Åsa Nilsonne und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726445107
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
DANK
Mein besonderer Dank gilt Kriminalkommissar Björn Axelsson, der sich freundlich und geduldig bemüht hat, meinen Wissensstand über Räumlichkeiten, Organisation und Arbeitsweise der Polizei zu vergrößern; Nisse Hellberg und Wilmer X, der mir Einblick ins Musikleben verschafft hat, und diversen Kollegen und Freunden, die Auskünfte und Meinungen beigetragen haben.
Ich danke dem St. Görans Krankenhaus in Kungsholmen, seit zwölf Jahren »mein« Krankenhaus, möchte mich aber dafür entschuldigen, daß ich es durch das Västra Krankenhaus ersetzt habe. Es gibt außer der geographischen Lage keine Ähnlichkeiten, und ich möchte vor allem darauf hinweisen, daß keine meiner Personen einem wirklichen Menschen entspricht, doch auch erfundene Personen brauchen schließlich Namen und Aussehen. Ich habe auch einige der Häuser von Kungsholmen umgestellt, und ich hoffe, daß mir das die Einwohner dieses angenehmsten Wohnviertels von Stockholm nachsehen werden.
ANMERKUNG DER ÜBERSETZERIN
Auf schwedisch heißt das männliche Krankenhauspersonal »Schwester«. Im Buch treten diverse »männliche Krankenschwestern« auf, so wie »Schwester Peter«, ein arger Schurke. Ich fände es schade, wenn diese schöne schwedische Eigenart in der Übersetzung verlorenginge.
PROLOG
Langsam verbreitete sich ein Grippevirus in der Inneren Mongolei, einem spärlich bevölkerten Teil des sonst so dichtbesiedelten China. Die Bevölkerung, die vor allem aus Viehzüchtern bestand, wurde krank und nach einigen Tagen mit Fieber und Muskelschmerzen auch wieder gesund. Die dreijährige Olan bekam, wie viele andere, hohes Fieber, sie weinte und klagte über Schmerzen im ganzen Körper, sie schwitzte und hatte Durst, während sich das Grippevirus in ihrem Körper verbreitete. Bei einer seiner unzähligen Milliarden von Kopien änderte das Virus seine Eigenschaften, indem es sie neu kombinierte, wie die Glasstücke in einem Kaleidoskop neue, einzigartige Bilder ergeben, wenn sie die Plätze vertauschen. Die neue Kombination unterschied sich nur in einem einzigen Punkt von den anderen Varianten, die im Umlauf waren: Es fiel der menschlichen Immunabwehr sehr schwer, sie zu entdecken. Olan ging es nicht besser, ihr Zustand verschlechterte sich in den nächsten Tagen. Ihre Eltern begriffen langsam, daß sie sterben würde, und baten deshalb den Arzt bei einem seiner regelmäßigen Besuche in der Stadt um Rat.
Der Barfußarzt, der Olan auf Gedeih und Verderb fiebersenkende Mittel und Antibiotika verpaßte, nahm das neue Virus in die nächsten beiden Städte auf seiner Besuchsliste mit, dann wurde er selber krank und mußte das Bett hüten, bis er wieder schmerzfrei war.
Olan überlebte, ohne Hilfe der Medikamente, aber ihre Genesung erhöhte das Ansehen des Arztes in ihrem Ort, und die Nachfrage nach seinen Diensten stieg.
Das Virus brauchte ein Jahr, um Zhenshou zu erreichen, dann wanderte es im Laufe einiger Wochen nach Shanghai weiter, von wo kein Anstieg der Todesfälle berichtet wurde, was vermutlich daran lag, daß in dieser riesigen Stadt nicht so genau über Todesfälle Buch geführt wurde. Vielleicht lag es auch daran, daß solche Auskünfte in Folge der neuen politischen Zurückhaltung dem Ausland gegenüber geheimgehalten wurden.
Seltsamerweise wurde Mexiko City – als erste Stadt mit voller Informationsfreiheit – voll getroffen. Unter dem millionenstarken Menschengewimmel verbreitete sich das Virus mit überraschender Geschwindigkeit und hinterließ dabei eine reiche Ernte an Todesfällen. Wie immer kamen die sehr Alten und die sehr Jungen zuerst an die Reihe, aber auch unter erwachsenen, nicht besonders unterernährten Menschen kam es zu Todesfällen. In einigen Stadtteilen, in den Slumgebieten der Stadt, schien die Pest gewütet zu haben. Manche Familien verloren innerhalb einer Woche die Hälfte ihrer Kinder, und nun plötzlich erwachte die selbsternannte »entwickelte Welt« zum Leben. In Mexiko City gibt es ja Ausländer genug, und in direkter Nachbarschaft liegt eines der leistungsstärksten menschlichen Gemeinwesen der Welt.
Sofort wurde mit allem erdenklichen virologischen und bakteriologischen Fachwissen eine Hilfsaktion eingeleitet, und bald war die Ansteckungsquelle erkannt: ein normales, mutiertes Grippevirus. Diese Nachricht war in gewisser Hinsicht beruhigend, da zur Identität der Krankheit schon wesentlich phantasievollere und beängstigendere Vorschläge gemacht worden waren. Aber sie breitete sich weiter aus, und eine effektive Behandlungsmethode wurde nicht gefunden.
In westlichen Zeitungen beruhigten die Journalisten ihr Publikum mit bekannten Tatsachen: Epidemien in der Dritten Welt, die die Armen, Obdachlosen und Unterernährten ums Leben bringen, müssen für uns oder für unsere Kinder noch lange keine Gefahr bedeuten. Die Berichte über die Verbreitung der Krankheit, die zuerst Schlagzeilen geliefert hatte, schrumpften zu Kurznotizen auf den Auslandsseiten.
Einige Wochen später wurde die Bevölkerung von Rom, London, Seattle und Kopenhagen durch die Entdeckung geschockt, daß das neue Virus die Grenze zwischen der armen und der reichen Welt nicht respektierte. In der westlichen Welt starben zwar nur sehr alte und schwache Menschen, aber fast ein Drittel der Bevölkerung dieser Städte erkrankte, Block um Block, Stadtteil um Stadtteil. Läden schlossen, Buslinien mußten eingestellt werden, in den Straßen stapelten sich die Abfälle.
Die geringen bisher produzierten Impfstoffmengen wurden zur heißesten Handelsware auf dem Schwarzmarkt. Es kam zu verwirrenden und quälenden ethischen Diskussionen: Wer geht vor? Der Regierungschef, der 89jährige Greis im Pflegeheim oder die 35 jährige asthmakranke Frührentnerin? Ab und zu mutierte das neue Virus wieder, aber die neuen Kombinationen waren fast alle weniger dramatisch in ihren Interaktionen mit dem menschlichen Körper, und sie wanderten weiter in die Welt und aus der Welt hinaus, neben ihren besser getarnten Verwandten, die mit ihrem einzigen Ziel solchen Erfolg hatten: sich zu vermehren.
1
Bo Ekdal entschloß sich im Jahre 1984, im Alter von 41 Jahren, keine Zeitungen mehr zu lesen. Er hatte von einem Tag auf den anderen eingesehen, daß von nun an nicht nur seine Jahre und Tage begrenzt waren, sondern auch seine Stunden und Minuten, und überrascht und mit einem Hauch von Trauer war ihm klargeworden, daß es weder ihn selber noch irgendwen sonst interessierte, was er sich für Meinungen über die Lage im Mittleren Osten, die neuesten Steuererhöhungen oder den Lyriker des Jahres gebildet hatte. Von nun an sortierte er lieber die von ihm selbst verfaßten Fachartikel, während er sein cholesterinfreies Frühstück verzehrte, oder er nahm sich, wenn sein Gewissen das zuließ, seine liebsten griechischen Dramen vor, in denen er voller Erstaunen immer noch bei jedem neuen Lesen neue Tiefen entdeckte. Er hielt ansonsten die übrige Belletristik für überflüssig, sowohl für ihn selber als auch für andere.
Also war es wohl richtig, zuerst mit den Zeitungen aufzuhören, dachte er, ohne zu wissen, warum, während er langsam durch einen langen Backsteinkorridor im Pathologischen Institut schlenderte, in dem er Professor und Chef war. Vielleicht lag es daran, daß Stockholm an diesem Märzmontag in dichten Nebel gehüllt war, wie ein Wertgegenstand sorgfältig verpackt, um in der Post nicht zu Schaden zu kommen, scheinbar ohne Kontakt zur Außenwelt. Vielleicht ließ nun seine Unruhe, die fast schon Panik war, von ihm ab, und es gewann langsam die Ahnung Oberhand, daß alles gutgehen würde, daß sein Leben trotz allem zu irgendeiner Art von Erfolg führen würde, der die anderen dazu bringen würde, seine Eigenheiten, wie das Fehlen der Morgenzeitung, mit Nachsicht oder, warum nicht, mit Respekt zu betrachten: »Es ist eigentlich kein Wunder, daß Professor Ekdal soviel erreicht hat – schon seit Jahren vergeudet er seine Zeit nicht mehr mit den Nachrichten.« Die Nackenmuskeln schmerzten, als er anfing, sich zu entspannen.
Neben ihm ging Professor Hayakawa, Quell seiner Unruhe und, seit einer halben Stunde, auch Quell eines zaghaften Glaubens an eine akzeptable Zukunft. Sein Institut und die dort betriebene Forschung waren von Professor Hayakawa, dem einzigen Gutachter des National Council of Basic Research, überprüft worden. Hayakawa war kein Japaner, wie oft angenommen wurde, sondern Amerikaner, Kind japanischer Einwanderer. Er war ein weltberühmter Pathologe, und er hatte seine Kollegen dadurch überrascht, daß er eine Professur in Harvard mit einer Stelle als wissenschaftlicher Berater der einflußreichsten (lies: reichsten) Stiftung zur Finanzierung von Forschungsarbeiten vertauscht hatte. Aber schon bald war klargeworden, daß Hayakawa in seiner neuen Position mehr Macht und Einfluß auf die Pathologie und verwandte Gebiete hatte denn als Professor. Da in allen Erdteilen und fast allen Ländern immer weniger Mittel zur Grundlagenforschung bereitgestellt wurden, kam dem Geld der Stiftung entscheidende Bedeutung zu, und Hayakawas Unterstützung wurde zu einer immer notwendigeren Grundbedingung für die Forschungsinstitute. In diesem Jahr war es Bo Ekdal gelungen, das Interesse der Stiftung zu wecken, aber ein Entschluß würde erst fallen, nachdem Hayakawa eine »on-site-inspection« durchgeführt hatte, nachdem er also die Voraussetzungen des Institutes, das Geld richtig einzusetzen, beurteilt hatte.
Bo Ekdal brauchte das Geld. Im letzten Jahr war seine Forschung in eine produktive, spannende und teure Phase eingetreten. Er hatte Personal und Material finanziert, indem er Gelder von anderen Konten des Instituts umgeleitet hatte. Außerdem hatte er, als es nicht mehr zu vermeiden war, auf die Standardstrategie bei Liquiditätsproblemen zurückgegriffen. Er hatte aufgehört, Rechnungen zu bezahlen. Dieses Manöver ermöglichte es, aus dem Teufelskreis der Wissenschaft auszubrechen: ohne Ergebnisse keine Gelder und ohne Gelder keine Ergebnisse. Nun hatte er seine Ergebnisse, und wenn alles gutginge, würde er bald seiner Sekretärin den Stapel von Mahnschreiben mit dem kurzen Bescheid übergeben können: bitte bezahlen. Das Aushilfspersonal, das von all dem nichts ahnte, konnte dann feste Stellungen bekommen, und seine Forschungen konnten sich ungebremst von engen finanziellen Rahmen entfalten. Hayakawas Besuch war seit Monaten systematisch vorbereitet worden. Das Institut war geputzt, Routinehandgriffe waren überprüft worden, jede Laborassistentin hatte lernen müssen, auf englisch zu erklären, was sie tat und warum. Das Personal war eine große Hilfe gewesen, und das Arbeitsklima hatte sich verbessert, was Bo Ekdal für eine in Krisenzeiten typische Erscheinung hielt. Alles war bereit gewesen. Kein Staatsbesuch hätte besser geplant sein können. Doch vier Monate vor dem Besuch war Bo Ekdals engste Mitarbeiterin zu ihrer eigenen und zur Überraschung aller im Alter von 45 Jahren zum erstenmal schwanger geworden. Zwölf Tage vor dem Besuch wurde sie von vorzeitigen Wehen überrascht und mußte nun in der Frauenklinik unter strengster Bettruhe am Tropf hängen.
Zehn Tage vor dem Besuch hatte das neu kombinierte Grippevirus aus der Inneren Mongolei Stockholm und das Västra Krankenhaus erreicht. Viele waren erkrankt. Auch viele Gesunde meldeten sich krank, da das Risiko einer Entdeckung im Moment minimal war. Alles in allem erreichten die Arbeitsausfälle wegen Krankheit Rekordhöhen.
Vier Tage vor dem Besuch waren die Obduktionsassistenten aufgrund eines unbegreiflichen Solidaritätsstreiks, der sich um ein Schiff drehte, das in Göteborg nicht gelöscht werden konnte, aus dem Verkehr gezogen worden.
Zum erstenmal, seit man sich erinnern konnte, fehlte Affe, der Hausmeister, der zum für die Instrumente verantwortlichen ersten Obduktionsassistenten umbenannt worden war. Das führte zu einer leichten Desorientierung im Institut, so, als ob eines der auffälligsten Häuser oder Denkmäler der Stadt plötzlich verschwunden wäre. Im Pathologischen Institut war der Krankheitsausfall nicht besser oder schlimmer als sonst überall. Gut die Hälfte des Personals kam zur Arbeit, und Bo Ekdal hatte einen Krisenplan entworfen, nach dem die Arbeit, die er für die wichtigste hielt, verrichtet wurde; der Rest mußte warten.
Er beschloß, Obduktionen und Vorlesungen einzustellen und sich auf die Untersuchungen von Gewebeproben von Menschen zu beschränken, die noch lebten und denen die Untersuchungsergebnisse deshalb von Nutzen sein könnten. Professor Albinsson aus der Chirurgie, bekannt wegen seines vulkanischen Temperaments, rief an und verlangte, daß seine Forschungspatienten wie üblich obduziert werden sollten – der alte Witz von Operation gelungen, Patient tot, war eine recht realistische Beschreibung des Schicksals vieler seiner Patienten, und er mußte diese Fälle von denen unterscheiden können, wo es hieß: Operation mißlungen, Patient tot. Bo Ekdal hatte erklärt, warum das unmöglich war, der Chirurg hatte zuerst angeboten und dann gedroht, selber zu kommen und zu obduzieren. Bo Ekdal hatte abgelehnt und damit eine Explosion ausgelöst, von der er selber nur den Anfang gehört hatte, da er sofort den Hörer aufgelegt hatte. Augen und Ohrenzeugen hatten beschrieben, wie der Chirurg wie ein Berserker auf seiner Station gewütet hatte; Menschen waren nicht zu Schaden gekommen, aber einige Topfblumen hatten ihr Leben lassen müssen.
Jetzt war der Besuch Hayakawas jedenfalls schon fast vorbei. Vor ihnen lag noch das Mittagessen, das wohl kaum zum Problem werden konnte. Sie gingen immer noch schweigend durch den Flur. Der Besuch war außerordentlich gut verlaufen, und Hayakawa hatte ihm schon mitgeteilt, daß er Bos Gesuch unterstützen würde. Die Ungewißheit und Unruhe, mit denen Bo so lange gelebt hatte und die in den letzten Wochen so quälende Ausmaße erreicht hatten, fielen schon von ihm ab. Hayakawa unterbrach Bos Grübeleien. »Und wann findet die Vorführung statt? Ich habe wohl erwähnt, daß ich um drei Uhr abgeholt werde?« Bo sah auf seine Uhr, und er hoffte, mit dieser Geste leicht zerstreut zu wirken. Die Uhr zeigte Viertel vor zwölf. »Um eins«, improvisierte er, während die Panik voll zurückkehrte, als ob sie nur auf den richtigen Moment gewartet hätte.
Die Vorführung! In all der Aufregung hatte er die Vorführung vergessen! Hayakawa schloß alle seine Besuche mit einer Vorführungsobduktion ab. Hayakawa, in seinem Auftreten eher Japaner als Amerikaner, durchlebte eine merkwürdige Verwandlung, wenn er vor Publikum stand. Er war so sensibel, eitel und oft auch arrogant wie irgendein Solokünstler oder eine Primadonna. In einigen Fällen hatte er mit Instrumenten, die er für unbrauchbar hielt, um sich geworfen. In einem anderen Fall hatte er auf dem Absatz kehrtgemacht und den Saal verlassen: Die Leiche war ihm nicht mager genug gewesen. In allen Fällen waren die Gelder eingefroren worden, auch wenn der eventuelle Zusammenhang zwischen beidem unklar war.
Hayakawas Vorführungen waren Anlaß verschiedener Spekulationen, Tratschereien und Psychologisierungsversuche, aber in einem Punkt waren sich alle einig: Er war ein glänzender und virtuoser Obduzent und außerdem ein ausgezeichneter Entertainer, was in diesem Fach schon seltener vorkam. Die am häufigsten auftretende Erklärung für den Grund seiner Vorführungen war, daß er ganz einfach beweisen wollte, daß er den Schreibtischjob nicht aufgrund mangelnder Begabung oder unzureichender Fähigkeiten erhalten hatte und daß er noch immer dazugehörte. Andere neigten eher zu der Ansicht, daß er Bewunderung brauchte, Applaus, daß seine Anspruchslosigkeit und sein reserviertes Auftreten mit Augenblicken von Expansivität und Selbstbehauptung abwechselten. Eine dritte Erklärung war, daß es ihm nicht gelungen war, sein japanisches und sein amerikanisches Wesen zu verschmelzen, und er deshalb auf diese Weise zwischen beiden pendelte.
Bo hatte jedenfalls noch nie gehört, daß irgendwer das alles vergessen haben könnte, daß jemand die Möglichkeit verpaßt hätte, diesem mächtigen Mann den Auftritt zu sichern. Ausgerechnet er hatte es vergessen. Um eins, hatte Bo mechanisch gesagt, als ob er einen Schlag abwehren müßte. Um eins. Gab es denn irgendeine Möglichkeit, innerhalb von eineinviertel Stunden eine Obduktion zu arrangieren? Dazu mußte er aber zuerst Hayakawa loswerden.
Sie erreichten die Kantine, die fast die ganze sechste Etage einnahm – man hatte Aussicht in alle Himmelsrichtungen außer nach Süden. Fünf Schlangen zogen sich bis zur Mitte der Kantine hin, zwei führten zum Stammessen, zwei zum leichten Imbiß und eine zur vegetarischen Mahlzeit. Hayakawa ließ sich nicht dadurch stören, daß die Speisekarte auf schwedisch war. Er betrachtete sie und stellte fest: »Sie haben eine vegetarische Alternative – das ist ausgezeichnet. Können wir die nehmen?« Der Mittagsbetrieb war auf seinem Höhepunkt, und Bo glaubte, noch nie ein solches Gedränge erlebt zu haben. Vielleicht war die Schlange am vegetarischen Stand kürzer, aber Bo hatte weder Zeit noch Ruhe, darauf zu achten, daß die schöne Chinesin ihnen Kichererbseneintopf mit Crème fraîche servierte. Bo blickte sich um. Er suchte nach einem passenden Tischpartner für Hayakawa. Er konnte fast keine Bekannten entdecken und schon gar keine, mit denen sich Hayakawa vielleicht eine Stunde lang wohl fühlen könnte. Wie ein Falke, der Beute erspäht, sah er plötzlich Ann Lilja, eine jüngere Chirurgin, durch die große Tür eintreten. Sie blickte sich suchend um, als sei sie nicht sicher, ob sie sich anstellen oder lieber nebenan in der Cafeteria ein Brot essen sollte. Bo hatte Angst, sie könnte in irgendeinem Fahrstuhl verschwinden, ehe er sie dingfest machen konnte.
»Entschuldigen Sie mich einen Augenblick.« Er lachte gezwungen und lief zu Ann hinüber, die ihn überrascht ansah. Niemand im Krankenhaus hatte je gesehen, daß Bo Ekdal sich so rasch bewegt hätte.
»Ann, kannst du mir helfen, ich habe hier einen Typen, der das Institut inspiziert, um zu entscheiden, ob wir Gelder bekommen sollen, die uns für fünf Jahre aller finanziellen Sorgen entledigen könnten. Ich muß noch ein paar Einzelheiten in die Wege leiten, kannst du dich eine Stunde lang um ihn kümmern? Das wäre die gute Tat des Jahres.«
Sie schien belustigt, lachte und nickte. »Sicher.«
Bo fand, daß sie eine seltsame und sympathische Beziehung zu ihrem Äußeren hatte. Er fand sie sehr schön, und es beeindruckte ihn, daß sie ihre klassischen Züge und Formen weder verbarg noch betonte. Sie schien sich wohl in ihrer Haut zu fühlen. Zusammen gingen sie zurück zu Hayakawa, der noch immer in seiner Schlange stand. »Professor, darf ich Ihnen Dr. Lilja vorstellen? Eine unserer vielversprechendsten jungen Chirurginnen.«
Bo Ekdal hatte Ann Lilja nur wenige Male getroffen, wenn sie mit ihrem Chef, dem cholerischen Professor Albinsson, die Pathologie aufgesucht hatte. Er hoffte nun, daß ihre sozialen Fähigkeiten genauso hochentwickelt waren wie die medizinischen. Er hoffte auch, daß sie gutes Englisch sprach. Ann lachte wieder, grüßte, und Bo sah, daß er keinen Gedanken an Hayakawa zu verschwenden brauchte, so lange Ann bei ihm war. Ihr Englisch erwies sich als hervorragend, und Hayakawa schien kaum zu merken, daß Bo mit dem Versprechen ging, ihn rechtzeitig zur Vorführung wieder abzuholen. Draußen mußte Bo auf den Fahrstuhl warten. Die Sekunden schlichen dahin, und er spielte mit dem Gedanken, die Treppe zu nehmen, fand aber, daß es doch besser sei, auf den Fahrstuhl zu warten. Er rannte in sein Zimmer, ohne die besorgte Nachfrage seiner Sekretärin zu beantworten, wie alles abgelaufen sei.
Auf den erstbesten Zettel schrieb er:
Er überdachte die drei Punkte.
Punkt eins schien das schwierigste Problem zu sein. Seine eigenen Studenten hatten wegen der Grippewelle die ganze Woche frei bekommen, um zu Hause zu lernen. Es war kaum denkbar, daß sie zu erreichen waren. Woher konnte er Studenten nehmen? Von den anderen Stationen natürlich. Er wählte aufs Geratewohl die Nummer einer Station. Das war kein Problem, da alle Abteilungen mit 50 anfingen.
»Station zweiundsiebzig, Inger, Krankenpflegerin.«
»Hier ist Professor Ekdal in der Pathologie. Haben Sie auf Ihrer Station ein paar Studis?«
Wenn diese Frage Schwester Inger überraschte, so ließ sie sich das nicht anmerken. Eine Berufskrankheit, von der Krankenschwestern leicht befallen werden. »Wir haben drei.«
»Schwester, bitte, sagen Sie denen, daß sie um fünf vor eins in der Pathologie erscheinen sollen, im Obduktionssaal.«
Das ist ein Befehl, hätte er in seiner Verzweiflung hinzufügen können, aber das schien nicht nötig zu sein. Schwester Inger antwortete, überraschenderweise, wie eine Schwester aus dem Arztroman: »Selbstverständlich, Professor.«
Von diesem Erfolg ermuntert streckte er den Kopf zur Tür hinaus und begegnete dem ängstlichen Blick seiner Sekretärin. Sie saß doch wohl nicht, seit er an ihr vorbeigesaust war, so verängstigt und fragend da? Er bat sie, weitere Stationen anzurufen, um Studenten aufzutreiben – sie brauchten mindestens zwanzig, was doch trotz der Grippe nicht unmöglich sein konnte.
Punkt eins hatte er in zehn Minuten gelöst. Konnte er den Rest in einer Stunde schaffen?
Punkt zwei waren die Instrumente. Zu einer normalen Obduktion waren viele Einzelheiten nötig. Skalpelle, diverse Messer, Scheren, Sonden und noch einiges mehr. Es müßte eigentlich möglich sein, ein akzeptables Sortiment zusammenzuraffen – falls sie nicht weggeschlossen waren. Und wenn nun Affe, ordentlich, wie er war, alles abgeschlossen und den Schlüssel mit nach Hause genommen hatte? Konnte Bo dann wohl bei den Chirurgen andere Instrumente leihen? Ihre ließen sich im Notfall doch bestimmt verwenden. Und konnte er das schaffen, ohne Professor Albinsson mit hineinzuziehen, von dem er sich nach dem letzten Gespräch keinerlei Zusammenarbeitsbereitschaft erwartete? Oder sollte er sich in der Gynäkologie erkundigen?
Bo lief durch den Korridor und zog, während er nachdachte, seinen Schlüsselbund aus der Tasche. Er hatte keine Ahnung, welcher Schlüssel zum Obduktionssaal gehörte, er wußte nur von der Sekretärin, daß einer angeblich paßte. Er rannte durch das Umkleidezimmer, in dem die vielen gelben Schutzkittel hingen. Zwei große Mattglastüren führten in den eigentlichen Obduktionssaal. Der süßliche und leicht fade Duft dieses Saals hing in der Luft, als ob er nicht den Leichen und den Reinigungsmitteln zu verdanken sei, sondern aus Wänden und Fußboden gekrochen komme.
Bo ging zur Tür und wollte gerade den ersten Schlüssel ausprobieren, als er hinter der Tür eine Bewegung registrierte. Für einen kurzen Moment überkam ihn eine archaische, unvernünftige Angst vor Toten, die zum Leben erwachen, vor Ratten und vor Leichenschändern. Seine Nackenhaare sträubten sich wie die eines Hundes, der sich fürchtet. Die Angst wich einer realistischen Sicht der Dinge: Waren hier vielleicht Einbrecher am Werk? Was sollte er jetzt tun? Ob sie gefährlich sein konnten? Während er bewegungslos vor den Türen verharrte, durch die er tausendmal gegangen war, ohne sie als Grenze zu betrachten, überkam ihn der Zorn: auf das Schicksal und vor allem auf das derzeitige Auftreten des Schicksals. Kleine Gauner, die auf ihrer Jagd nach Schnaps und Geld nicht vor einem Einbruch in der Pathologie zurückschreckten. Er beschloß, die Einbrecher zu vertreiben, legte die Hand auf die eine Türklinke und probierte den ersten Schlüssel, als er bemerkte, daß die Tür nachgab. Sie war nicht verschlossen. Kleine Gauner hatten wohl kaum den passenden Schlüssel, revidierte er seine Annahme, vorsichtig öffnete er die Tür. Der Obduktionssaal sah aus, als ob er schon länger leer gestanden hätte als während der letzten acht Tage, seitdem hier die Tätigkeit eingestellt worden war; die weißen Fliesen an den Wänden, die rostfreien Tische, die an der Wand festgeschraubten Bänke hatten etwas Museales.
Bo ging hinein und räusperte sich laut. »Jaja«, hörte er aus der Materialkammer. Es war Affe, der in Streik Getretene. Auf den hintersten Bänken lagen die Instrumente des Institutes in Reih und Glied, und Affe kam langsam aus der Kammer, eine kleine Schere und einen noch kleineren Schraubenzieher in der Hand. Affe war fast Albino und hatte folglich in all den Jahren, in denen Bo ihn nun schon kannte, ungefähr gleich ausgesehen.
Weiße Haare, hellblaue Augen – möglicherweise ging er, wie wir alle, jetzt etwas gebeugter, war im Laufe der Zeit etwas runzeliger geworden, aber in diesem Moment wirkte er vor allem wie ein Lausbub, der verbotenerweise auf Nachbars Apfelbaum erwischt wird, schuldbewußt, aber nicht ganz unzufrieden mit seiner Unternehmung.
»Ich wollte alles mal durchsehen, immer muß irgendeine Schraube nachgezogen oder irgendwas geschliffen werden.« Bo und Affe hatten aus Vorsicht niemals über Politik gesprochen, als ob unterschiedliche Ansichten ihre schweigsame, aber sehr gute Zusammenarbeit aufs Spiel setzen könnten. Nun hing das Schiff in Göteborg zwischen ihnen.
»Immerhin mach’ ich ja keine sichtbare Arbeit«, sagte Affe schließlich, ohne Bos Blick standzuhalten.
»Affe, möglicherweise hast du ein Dutzend Jobs hier im Institut gerettet, von allem anderen ganz zu schweigen. Hör zu.«
Bo erklärte Affe die Lage, und Affe engagierte sich immer mehr. Schließlich sagte er: »Wir lassen alles hier liegen, dann kann er sich selber seine Instrumente aussuchen. Hast du eine Ahnung, wie es leichentechnisch bei uns aussieht?«
»Im Flur liegen welche.«
Bo ging hinaus und hoffte, eine obduzierbare Leiche zu finden, und Affe sortierte die Instrumente. Im Flur lagen auf Rolltischen wirklich vier Leichen, deren Gesichter mit Laken abgedeckt waren. Eine konnte wegen ihres Fettes ausgeschlossen werden. Bo sah sich die nächsten an: einen sehr alten, sehr mageren Mann. Der schien zu passen, bis Bo sein Patientenarmband las: Abraham Roskowski. Eine Obduktion war aus religiösen Gründen unmöglich, wenn Abrahams Bekenntnis das war, was sein Name annehmen ließ.
Und wenn nun auch die nächste Leiche sich als unbrauchbar erwies? Es war halb eins, also konnten noch immer neue kommen, aber auf diese Möglichkeit wollte Bo sich nicht verlassen. Er trat an den letzten Rolltisch heran, hob die Decke und blieb bestürzt stehen. Dort lag ein schmächtiger Mann von vielleicht fünfzig mit kindlichem Gesicht und schütteren blonden Haaren. Seltsamerweise war er noch vollständig bekleidet. Bo betrachtete mißtrauisch Schlips, Hemd, Jacke, als werde er zum Zeugen eines ungewöhnlich geschmacklosen Scherzes. Er dachte einen Moment lang über mögliche Erklärungen nach. Ob der Mann zu Hause gestorben und in die falsche Institution gebracht worden war? Dann hätte er doch in die Gerichtsmedizin gehört. War er in der Notaufnahme gestorben, ehe sie ihm die Jacke hatten ausziehen können? Auf dem Rolltisch lagen keine Papiere, aber dann sah Bo das Patientenarmband am dünnen Handgelenk des Mannes. Dann hatte wohl trotz allem alles seine Ordnung. Er mußte eingewiesen und vorschriftsmäßig behandelt worden sein, war aber trotzdem gestorben und hier gelandet. Die Kleider konnte Bo sich nicht erklären, aber das spielte keine Rolle. Er überprüfte den Namen: Gösta Persson. Er überlegte einige Sekunden lang, ob es die richtige Leiche sei – er wußte nichts über Göstas Haltung zu einer eventuellen Obduktion, er hatte keine Ahnung, wie Göstas Familie darüber dachte. Göstas Obduktion brach die meisten Regeln, geschriebene wie ungeschriebene, die Bos Leben sonst leiteten, und er wollte sich alles gut überlegen. Das Risiko dieser Handlung war schwer zu berechnen. Bestenfalls würde niemand Fragen stellen. Schlimmstenfalls konnte Bo angezeigt und vor die Ethikkommission geladen werden. Andererseits mußte er davon ausgehen, daß seine wissenschaftliche Karriere beendet war, wenn er von Hayakawa kein Geld bekam. Bo war kein Spieler, er war niemals Risiken eingegangen, schon gar nicht aus Lust am Risiko. Im Gegenteil, er strebte nach Ordnung und Kalkulierbarkeit in seinem Leben, während die Forschung die Rolle des Unvorhersehbaren einnahm. Sie ließ ihn jeden Arbeitstag voller Erwartung angehen. Die Forschung gab ihm das Gefühl der Existenzberechtigung auf diesem bereits überbevölkerten Planeten. Er konnte es sich nicht leisten, die Forschung zu verlieren.
Mit energischen Schritten schob Bo Göstas Leichnam in den Obduktionssaal, wo Affe sich schon um Beleuchtung, Stühle und – zu Bos Überraschung – auch um eine Videokamera gekümmert hatte, die wie ein großer schwarzer Vogel auf dem Stativ hockte.
»Woher hast du die denn?« fragte er.
»So eine haben vor anderthalb Jahren alle Institute bekommen, und seither steht sie bei mir herum – niemand hat sich dafür interessiert, aber jetzt kommt sie doch wie gerufen, oder?«
»Affe, du bist ein Genie!«
Auch Affe war ein wenig verwirrt, als er sah, daß Gösta vollständig angezogen war. Für einen Moment glaubte er, Bo habe einen Passanten erschlagen. Dann aber zuckte er mit den Schultern. Wie zwei Verschwörer zogen sie Gösta, dessen Körper etliche Blutergüsse aufwies, aus. Bo hatte keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, darüber konnte Hayakawa sich den Kopf zerbrechen. Sie stopften die Kleider in zwei schmale weiße Plastikbehälter, die sie neben Mantel und Schuhe in das Unterfach des Rolltisches stellten. Dann hoben sie Gösta auf den Obduktionstisch. Bo trat einen Schritt zurück und versuchte, alles mit Hayakawas Augen zu sehen. Er fand alles gediegen und wohl organisiert. Er rief seine Sekretärin an, um sich nach den Studenten zu erkundigen. Sie hatte bei den meisten Stationen Glück gehabt, einige hatten sich geweigert, aber an die zwanzig Studenten würden sich wohl einfinden.
Zu seiner Überraschung kam Hayakawa ihm im Flur entgegen. »Ich wollte gern etwas früher kommen, um mir die Instrumente anzusehen.«
Daran hätte er denken müssen. Hayakawa, wie andere Schauspieler, mußte sich natürlich mit der Bühne, den Requisiten und vielleicht sogar mit der Akustik des Raumes vertraut machen. Hayakawa begrüßte Affe, kontrollierte die Aufstellung der Stühle, verschob zwei von ihnen um einige Zentimeter, warf einen raschen, aber eindringlichen Blick auf Gösta und nickte. »Ausgezeichnet.«
Affe zeigte ihm das Instrumentenbuffet. Hayakawa griff aufs Geratewohl zu einigen Scheren, probierte sie aus und legte sie mit leichtem Nicken zurück. Damit begnügte er sich, offenbar überzeugt davon, daß alles in brauchbarem Zustand war. Affe und Bo wechselten Blicke – Erleichterung, Stolz, Triumph.
Hayakawa suchte sich rasch die Instrumente zusammen, die er verwenden wollte, und legte sie auf den Instrumententisch. Dann setzte er sich auf einen der hinteren Stühle und schien in eine Form von Meditation zu versinken. Er wollte ganz offenbar nicht gestört werden. Bo ging hinaus. Er wollte versuchen, Gösta Perssons Krankenbericht aufzutreiben.
Göstas Krankenbericht lag nicht an Ort und Stelle, im Gegensatz zu dem von Abraham Roskowski. Zuoberst lag eine Obduktionsanweisung, was nur bedeuten konnte, daß Abraham und seine Familie mit einer Obduktion einverstanden waren. Verdammt. Bo hatte keine Zeit, sich Vorwürfe zu machen, weil er nicht zuerst nach den Krankenberichten und dann erst nach der Leiche gesucht hatte. Ob er in der letzten Minute noch die Leichen tauschen könnte? Nein, es war zu spät, es war überhaupt zu spät für alles andere, er konnte nur noch nach unten rennen und das Schauspiel beginnen lassen.
2
Hayakawa hatte den Saal verlassen, als sich die ersten Zuschauer einfanden, denn die Vorstellung mußte schließlich mit dem Einzug des Hauptdarstellers anfangen, unterstellte Bo. Der fiel auch äußerst professionell aus: Hayakawa blieb kurz in der Türöffnung stehen, so daß sein Publikum ihn bemerken mußte. Er blickte erwartungsvoll in die Runde aus Studenten und jungen Pathologen, die sich im letzten Moment hatten freimachen können. Als der Kontakt hergestellt war, schritt er majestätisch zum Obduktionstisch, legte seine Hand, die in dem dünnen Gummihandschuh hellgrau und künstlich aussah, auf Göstas weißgelben Brustkorb und fragte lächelnd eine Studentin ganz hinten: »Können Sie gut genug sehen?« Sie nickte. Hayakawa zögerte einen Moment, dann fragte er einen großen rothaarigen jungen Mann, der kurz vor der Ohnmacht zu stehen schien: »Und Sie? Sie sollten vielleicht ein wenig näher kommen und sich setzen?«
Charisma.
Bo spürte, wie sogar die Studenten, die die Pathologie längst hinter sich gelassen hatten (und die deshalb wirklich in Ohnmacht fallen konnten – man gewöhnt sich in wenigen Wochen an Obduktionen, wird aber ebenso rasch wieder entwöhnt), von der Stimmung ergriffen wurden, die Hayakawa herbeizauberte. Aus dem Augenwinkel sah Bo Ann Lilja hereinkommen, leise und vorsichtig, und Hayakawa begrüßte sie mit einer kleinen, aber ausdrucksvollen Geste. Bo fragte sich, wie sie sich hatte freimachen können, aber diese Überlegung wurde von Hayakawa gestoppt, der zu erzählen begann, wer er sei, was ihn nach Stockholm geführt habe und wie sehr er von Bo Ekdals Arbeit beeindruckt sei. Dann richtete er seinen Blick auf Gösta.
»Ehe wir anfangen, möchte ich Ihnen die Frage stellen, die fast nur Pathologen korrekt beantworten können. Wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, daß wir zur selben Diagnose kommen wie der behandelnde Arzt des Patienten? Mit anderen Worten, wir erhalten durch die Obduktion das endgültige Ergebnis, aber wieviel wußte man schon vorher? Möchte jemand das schätzen? Oder fragen wir lieber Ihren Professor?«
Bo sprach gern über seine Arbeit. »An die fünfundsiebzig Prozent. In jedem vierten Fall stellt sich heraus, daß der Patient aufgrund einer fehlerhaften oder unvollständigen Diagnose behandelt worden ist.«
Hayakawa nickte.
»Vergessen Sie das nicht, wenn Sie erst eigene Verantwortung tragen. Aber nun wollen wir uns den Mann ansehen, den wir hier vor uns haben. Wir fangen wie üblich mit der äußerlichen Leichenschau an. Wissen Sie, daß es Pathologen gibt, die davon träumen, die äußeren Zeichen so klar deuten zu können, daß sie nicht mehr weitergehen müssen? Manche glauben, daß dem Körper alles von außen anzusehen ist, wenn wir nur die subtilen Veränderungen, die den inneren Krankheitsprozeß widerspiegeln, entdecken und lesen können. Was sehen wir nun hier? Wie weit, glauben Sie, können wir kommen, wenn wir sehr, sehr neugierig sind und sorgfältig und vorsichtig vorgehen bei unserer Untersuchung? Wollen wir es versuchen? Wir beginnen mit seinem Alter, möchte jemand einen Versuch machen?«
Bo Ekdal verfluchte sich selber noch einmal. Hayakawa würde bald entdecken, wie improvisiert das Ganze war. Niemand wußte doch irgend etwas über Gösta. Hayakawa würde nach Diagnosen fragen, nach Behandlungsdauer, den Ergebnissen der Laboruntersuchungen. Bo fragte sich abermals, warum er nicht von Anfang an reinen Tisch gemacht hatte. Ein Wissenschaftler muß doch ganz besonders darauf achten, niemals zu lügen, und sei es auch nur ganz indirekt. Das Alter, ja. Das war das einzige, was Bo über Gösta wußte, abgesehen von Namen und Adresse, die auch auf dem Armband standen. So weit würde alles gutgehen, aber was dann?
Hayakawa diskutierte Göstas Alter mit den Studenten. Er sprach über Falten am Ohr, Zähne, Hautelastizität. »Wir tippen auf achtundvierzig Jahre«, sagte er schließlich und wandte sich Bo zu. Er sah aus wie der Zauberer mit dem Kaninchen aus dem Zylinder, so sicher war er sich seiner Sache.
Bo lachte resigniert. »Um zwei Tage falsch geraten, Professor, er war bei seinem Tod 47 Jahre, elf Monate und 29 Tage alt.«
Hayakawa verbeugte sich leicht, und einige Studenten fragten sich, ob ein kurzer Applaus erwartet werde. Hayakawa fuhr fort: »Bei der Betrachtung des Allgemeinzustands ist es wichtig, nicht blind das Augenfälligste anzustarren. Wir sollten uns fragen, wie es ihm wohl gegangen ist, wie er gelebt hat, wie wir seinen Tod mit seinem Leben in Verbindung bringen können.«
Hayakawa zeigte, führte vor, hob Hautfalten hoch, untersuchte das Innere der Augenlider, klopfte auf die Bauchdecke und sprach währenddessen darüber, daß der Mann vermutlich über einen langen Zeitraum hinweg schlecht gegessen habe, daß er wenig Bewegung hatte, daß seine Hoden etwas kleiner waren als erwartet, daß alles zusammen dem typischen Bild des chronischen Alkoholikers ähnelte.
»Darüber hinaus gibt es noch etwas, was bemerkenswert und ungewöhnlich ist, und worüber Sie sicher schon kurz nachgedacht haben. Nämlich?«
»Er hat Blutergüsse«, meinte schließlich eine junge Frau in der ersten Reihe.
»Richtig. Und ich glaube zu wissen, warum Sie zögern: Sie fragen sich, ob Sie normale Leichenflecken sehen oder ob es sich um Blutergüsse handelt, die er sich vor seinem Tode zugezogen hat. Leichenflecken, wie Sie wissen, beruhen auf der Schwerkraft, sie befinden sich immer an den untersten Körperteilen. In Krankenhäusern werden die Toten immer auf den Rücken gelegt, ich weiß nicht warum, aber ich kann Ihnen versichern, daß das überall auf der Welt der Fall ist. Deshalb finden wir Leichenflecken auf dem Rücken und den Unterseiten von Armen und Beinen. Sehen Sie, hier sind sie. Was passiert übrigens, wenn man eine Leiche mit entwickelten Leichenflecken umdreht?«
Bertram Schwieter, der junge Aushilfspathologe, der nicht wußte, ob seine Aushilfsstelle verlängert werden würde, ergriff die Gelegenheit beim Schopfe, auf seinen Professor einen guten Eindruck zu machen, und antwortete: »Wenn es innerhalb von sechs Stunden nach dem Todesfall geschieht, dann wandern die Flecken, sonst bleiben sie, wo sie sind.«
»Und wann sind sie zuerst zu sehen?«
»Ungefähr zwei Stunden nach dem Tod.«
»Ganz recht! Aber um zu unseren Blutergüssen zurückzukehren, denn darum handelt es sich hier ja, so sehen Sie, daß sie durchaus keine Ähnlichkeit mit Leichenflecken haben, was Farbe und Verbreitung angeht. Was ist hier passiert, was sollen wir glauben? Alle Blutergüsse weisen dieselbe Farbe auf, mit Ausnahme eines viel älteren, hier an der linken Wade. Wieso bekommt man überhaupt Blutergüsse? Nun, weil das Blut aus dem Gefäßsystem austritt, und wie geschieht das? Gewalt gegen den Körper, so daß die Gefäße zerreißen, oder irgendein Problem mit dem Blut selber, wodurch geringe Blutungen, die eigentlich von selber aufhören sollten, einfach weiter Blut ins Gewebe entlassen. Woher sollen wir wissen, womit wir es hier zu tun haben? Sehen Sie hier einen Betrunkenen, der stürzt, der gegen Möbel rennt, der vielleicht von jemandem, dem es ebenso elend geht wie ihm selber, einen Schlag in den Magen verpaßt bekommt? Wonach müssen wir jetzt suchen, was meinen Sie?«
»Nach Hautverletzungen.«
Der Rothaarige, der geantwortet hatte, durfte nun selber nachsehen. Er beugte sich über Gösta und untersuchte die Haut an zwei Blutergüssen am Rumpf und drei an den Beinen.
»Die Haut wirkt völlig unverletzt.«
»Gibt es Grund zu der Annahme, daß er ganz nackt war?«
»Sicher, ja, die Kleider können seine Haut geschützt haben. Dann sollte ich mir wohl lieber Hände und Gesicht ansehen.«
»Sicher. Aber wenn wir uns Hände und Gesicht ansehen, dann finden wir keinen Hinweis auf eine Schlägerei, keinen Hinweis darauf, daß er so oft und auf die Weise gefallen ist, die nötig wäre, um die seltsamen Flecken zu ergeben, die seinen ganzen Körper bedecken. Seltsamerweise haben wir sogar einen in der rechten Achselhöhle und mehrere auf der Innenseite des Oberschenkels. Warum ist das so seltsam?«
Die Frage wurde einer Studentin gestellt, die tief errötete und ihren Blick senkte.
Hayakawa nickte also ihrem Nachbarn aufmunternd zu, und der antwortete: »Wahrscheinlich, weil man sich durch Stürze oder bei Prügeleien da normalerweise nicht verletzt.«
Hayakawa schien entzückt zu sein.
»Exakt. Wenn wir nun nicht annehmen, daß er gefallen ist, können wir uns dann vorstellen, daß er aus anderen Gründen geblutet hat?«
»Leberversagen«, schlug ein großer, yuppiehafter Student vor. »Natürlich. Seine kleinen Hoden weisen auf eine schlechte Leberfunktion hin. Sie wissen sicher noch, daß die Leber die kleine Menge von weiblichen Sexualhormonen abbaut, die es bei Männern gibt, aber wenn die Leber nicht mehr mitmacht, steigen die Werte im Blut, weswegen die Hoden langsam verschwinden. Die Leber produziert schließlich auch einen Teil der Stoffe, durch die das Blut gerinnt; wenn die Leber nicht funktioniert, dann funktioniert auch das Blut nicht. Und was denken wir nun über die Todesursache? In einem Mundwinkel und, soviel wir sehen können, auch in der Mundhöhle finden wir Reste von eingetrocknetem Blut. Außerdem sind Magenblutungen meine Spezialität, eine Spur, die nun auch nicht zu verachten ist. Wollen wir beschließen, daß wir zu dem Ergebnis gekommen sind, daß der Mann Alkoholiker war, daß er an einer Magenblutung gestorben ist und daß sein Blut nicht richtig geronnen ist, was dann zur Todesursache beigetragen haben muß?«
Diese Frage brauchte nicht beantwortet zu werden, und Hayakawa fuhr fort: »Jetzt wollen wir sehen, ob wir der Wahrheit näher kommen, wenn wir einen Blick auf sein Inneres werfen.« Er griff zum auserwählten Skalpell, trat dicht an Göstas Körper heran und machte einen langen Schnitt, der unter der rechten Wange ansetzte, sich mit einem kleinen Bogen um den Nabel bis zur Taille fortsetzte und bei den Schamhaaren endete. Es war eine einzige Bewegung, geschmeidig und exakt, ein schöner Anblick.
»Schauen Sie, schon jetzt sehen wir, daß er nicht nur Blutergüsse hatte, die von außen zu sehen waren, sondern daß auch hier und dort innere Blutungen aufgetreten sind, wenn auch nicht unmittelbar unter den Blutergüssen, was ebenfalls dagegen spricht, daß er in eine Schlägerei verwickelt war«, er blickte augenzwinkernd auf, »aber das wußten wir ja schon, oder?«
Hayakawa richtete sich auf und schaute auf die Uhr. Halb zwei. »Das geht ja gut. Wonach sollen wir jetzt suchen? Woran sollen wir denken?«
»Verletzungen der Speiseröhre«, schlugen zwei Studenten gleichzeitig vor.
»Warum das?« Die beiden wollten gleichzeitig antworten, aber diesmal verstummte die Frau, und ihr Kommilitone sagte: »Bei Leberschädigungen wird der Blutfluß behindert, und eine der Alternativrouten, die das Blut einschlagen kann, geht durch die Gefäße, die außen an der Speiseröhre liegen. Diese Gefäße werden ausgedehnt und überlastet, was zu Brüchen führt, an denen man verbluten kann.«
Seine Kommilitonen kicherten über seinen Ernst, seine Wortfülle, aber Hayakawa nickte. Er verbreitete sich nun über die verschiedenen Methoden, die Speiseröhre herauszunehmen, wenn man die Gefäße untersuchen wollte. Während er sprach, holte er Göstas Organe aus dem Leichnam, als ob sie lose in der Bauchhöhle gelegen und nur darauf gewartet hätten, herausgenommen zu werden. In zwei Minuten war Hayakawa weiter gekommen, als Bo das normalerweise in einer halben Stunde schaffte. Bisher hatte er noch keine unnötige Bewegung gemacht, er hatte sich in keinem Fall in der Anatomie verirrt, und immer wieder beschrieb er, welche Alternativen er hatte und weshalb er sich für diese hier entschied. Bo ließ sich widerwillig beeindrucken. Das war um Klassen besser als alles, was er je gesehen hatte. Nun setzte Hayakawa zu seiner Zusammenfassung an: »Und nun zur Speiseröhre. Hier sehen Sie die Gefäße, die zweifellos etwas erweitert und schlaff sind, aber dadurch kann er nicht verblutet sein. Aber warten Sie, die Gefäße wirken dicht, aber wenn wir sanft und sehr vorsichtig nachfühlen, dann entdecken wir auf einem eine Narbe. Sie ist nicht zu sehen, aber hier ist das Gewebe etwas härter als an anderen Stellen. Er hat hier vor langer Zeit eine Blutung gehabt und hatte das Glück, sie zu überleben. Ansonsten finden wir nur eine diffuse Blutung in der Schleimhaut. Im Magen finden wir recht viel Blut, aber keine spezielle Blutungsursache. Keine gemeine kleine Arterie, die gesprudelt hat, kein Magengeschwür, keine Kratzer oder Löcher. Aber sehen Sie her, hier haben wir auch schon frühere Blutungen, mehrere sogar. Er hatte Magengeschwüre, hier haben wir mehrere alte Narben und eine kleine Wunde, die erst vor kurzer Zeit verheilt zu sein scheint. Und wieder die Blutung der Schleimhäute, die wir schon vorhin gesehen haben. Aber nun müssen wir seine Leberwerte zu Hilfe nehmen, hier gibt es ja einiges, worüber wir uns nur wundern können.«
Bo Ekdal wurde es schwindelig. Vielleicht würde er jetzt in Ohnmacht fallen. Das wäre dann immerhin seine Rettung – nicht einmal Hayakawa würde wohl weitermachen, wenn sein Gastgeber bewußtlos auf dem Fußboden lag.
»Der Patient ist gestorben, nachdem er dreimal wegen Blutungen behandelt worden war, erstmals vor achtzehn Monaten mit blutenden Speiseröhrenvarizen, dann ein halbes Jahr später wegen eines blutenden Magengeschwürs und schließlich vor einem Monat.« Eine klare Frauenstimme, die Bo nicht sofort lokalisieren konnte, die sich jedoch als die von Ann Lilja entpuppte. Wundersamerweise schien Gösta auf ihrer Abteilung gelegen zu haben, und Bo fiel Professor Albinssons Kommentar ein: »Die Kleine ist tüchtig, und außerdem hat sie ein photographisches Gedächtnis.«
Hayakawa hatte die Leber gerade in Scheiben geschnitten, zeigte Gefäße und Gallengänge, die überraschend deutlich waren, und sprach über den Grund der Blutungen.
»Da stimmt was nicht, liebe Leute. Um so zu bluten, hätte die Leber in einem viel schlechteren Zustand sein müssen. Schauen Sie her!«
Er hob eine Leberscheibe hoch und ließ ein schmales Messer darüber hinweggleiten. Dahinter zeigte sich das gesunde Lebergewebe rotviolett und fleischig, während die zerstörten Adern eingesunken und starr dazwischen lagen.
»Hier gibt es zwar große Schäden, aber sie sind nicht groß genug, um daran zu verbluten.«
Hayakawa dachte laut nach: »Ob er wohl ein Bluter gewesen sein kann?«
Er blickte Ann Lilja an, die den Kopf schüttelte. Göstas Blut sei nicht in ausreichender Menge vorhanden gewesen, da er so viel geblutet habe, aber das vorhandene Blut sei immerhin bei allen drei Behandlungsrunden normal gewesen.





























