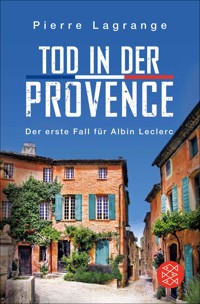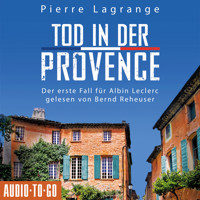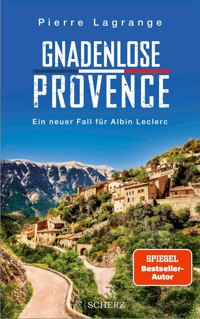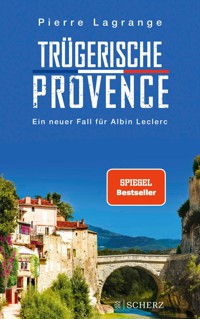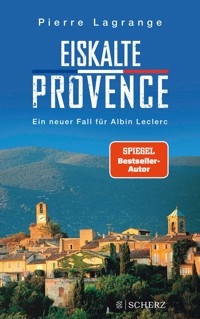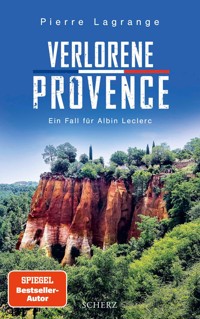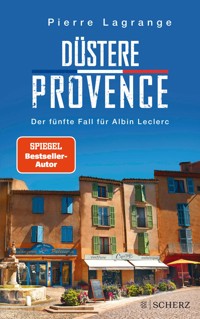
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Commissaire Leclerc
- Sprache: Deutsch
Die Provence war noch nie so düster – Der fünfte Fall für Commissaire Albin Leclerc von Bestseller-Autor Pierre Lagrange Eine Mordserie erschüttert die Provence. Drei Männer sind bereits tot: ein Bankier, ein Priester und ein Restaurant-Besitzer. Sie alle haben vor 25 Jahren gegen Louis Rey ausgesagt. Jetzt kommt der ehemalige Gangsterboss aus dem Gefängnis. Und er rächt sich. Als Albin Leclerc die Ermittlungen aufnimmt, glaubt er noch, dass seine privaten Probleme seine einzigen wären. Doch schon bald wird es ernst für den Commissaire. Denn er ist der vierte Mann, den der Gangster beseitigen will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Pierre Lagrange
Düstere Provence
Ein neuer Fall für Albin Leclerc
Roman
Biografie
Pierre Lagrange ist das Pseudonym eines bekannten deutschen Autors, der bereits zahlreiche Krimis und Thriller veröffentlicht hat. In der Gegend von Avignon führte seine Mutter ein kleines Hotel auf einem alten Landgut, das berühmt für seine provenzalische Küche war. Die Bände der Erfolgsserie um den liebenswerten Commissaire Albin Leclerc und seinen Mops Tyson sind im FISCHER Verlag erschienen.
Weitere Titel von Pierre Lagrange:
›Tod in der Provence‹, ›Blutrote Provence‹, ›Mörderische Provence‹ sowie ›Schatten der Provence‹
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Aus Verantwortung für die Umwelt hat sich der S. Fischer Verlag zu einer nachhaltigen Buchproduktion verpflichtet. Der bewusste Umgang mit unseren Ressourcen, der Schutz unseres Klimas und der Natur gehören zu unseren obersten Unternehmenszielen.
Gemeinsam mit unseren Partnern und Lieferanten setzen wir uns für eine klimaneutrale Buchproduktion ein, die den Erwerb von Klimazertifikaten zur Kompensation des CO2-Ausstoßes einschließt.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.klimaneutralerverlag.de
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2020 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Lektorat: Susanne Kiesow
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: mauritius images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491184-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
Epilog
[Leseprobe aus »Eiskalte Provence«]
1. Kapitel
1
Blut fordert Blut, dachte Louis Rey und wartete vor der schweren Stahltür. Er trug einen dunkelblauen Anzug von Armani, allerdings in einem Schnitt aus den neunziger Jahren, dazu zeitlose Schuhe von Gucci. Das zur Hälfte aufgeknöpfte Hemd war fast so weiß wie seine Haare, die auf dem Kopf und die auf der Brust. Er hielt eine kleine Sporttasche in der Hand, die durch den Kunstledergriff schon ganz schwitzig war.
Er spürte seinen Puls. Er ging schneller als normal. Kräftiger. Kein Wunder. Es lag an der Aufregung und dem Zorn. Denn Blut, überlegte Rey und starrte auf den mattgrauen Lack vor sich, Blut will fließen. Dazu ist es gemacht. Wie Benzin für Motoren. Es treibt den Körper an. Es hat nur diesen einen Zweck. Es pumpt durch die Adern und Venen und hält die große Maschine am Laufen. Blut ist der Saft des Lebens. Aber es braucht ein geschlossenes System. Wird es beschädigt, sucht sich das Blut seinen Weg, genau wie Wasser. Genau wie das Leben. Es läuft aus einem heraus und kommt nicht mehr zurück. So einfach ist das.
Viele drehen durch, sobald sie ein paar Tropfen verlieren. Denn weg ist weg, und die Reserven sind begrenzt. Ein Fingerhut voll versetzt manche Menschen bereits in Panik. Dabei verfügt jeder Mensch über fünf bis sechs Liter, je nach Konstitution, Männer mehr als Frauen. Bei einer Geburt geht allenfalls ein halber Liter verloren. Nicht der Rede wert. Erst ab zwei Litern wird es kritisch. Andererseits kann bereits ein Viertelliter nach der zehnfachen Menge aussehen, wenn man ihn überall an den Wänden und auf dem Fußboden verteilt. Schmeiß mal ein Bierglas an die Wand und stell dir die Pfützen und Spritzer in Rot vor. Das gibt schon eine ziemliche Sauerei, wusste Louis Rey und wartete weiter.
Schon seit fast fünf Minuten stand er hier. Vielleicht machten die Idioten das extra, um ihn zu ärgern, oder es war eine Art bescheuertes Ritual. Rey befeuchtete seine trockenen Lippen, streckte das Kinn hoch, rollte den Kopf im Nacken und zählte die Schrauben am Türrahmen, der ebenfalls aus Stahl und grau lackiert war.
Er hatte Blut auf jede nur erdenkliche Art und Weise fließen sehen. Aus manchen Menschen spritzte es wie aus einem defekten Schlauch. Es blubberte wie ein Geysir, tropfte wie ein leckender Wasserhahn oder floss gemächlich wie ein purpurner Fluss. Er hatte gesehen, wie es aus Schusswunden sprudelte, aus klaffenden Schnitten, zerquetschten Nasen, geplatzten Muskeln und offenen Brüchen rann. Manches Blut war hellrot, anderes dunkel. Es roch nach Metall, wenn es frisch war, und stank schon nach kurzer Zeit abartig – umso schlimmer, je älter es war.
Es gab Freaks, die auf Blut standen. Sie sahen es gern und machten manchmal irgendwelchen Scheiß damit, spielten herum und genossen es, wenn es warm an den Fingern klebte. Das Blut ihrer Gegner an den eigenen Händen: das stärkste Symbol für Macht. Tja. Für einige arme Irre war es eine Art Elixier, eine Droge. Gefährliche Typen, deren Sucht und Gier man zwar für sich ausnutzen konnte, vor denen man sich aber dennoch vorsehen musste, weil sie schlicht und ergreifend nicht ganz richtig im Kopf waren. Wandelnde Zeitbomben, die jederzeit explodieren konnten, und dann wollte man mit Sicherheit nicht in der Nähe sein.
Louis Rey war Blut jedenfalls stets völlig egal gewesen. Für ihn hatte es keinerlei Bedeutung gehabt. Er hatte es höchstens lästig gefunden, und wenn Menschen entweder gar keines hätten oder schlicht und ergreifend nicht bluten würden, wäre ihm in der Vergangenheit ziemlich viel Ärger erspart geblieben. Denn wann immer Leute bluteten, blieben Spuren zurück, die man mit Bleiche oder sonst was aufwändig beseitigen musste und dabei wiederum neue Spuren hinterließ. Man konnte sich außerdem noch so vorsehen – es blieben immer irgendwo verräterische Mikrotröpfchen an den Fingern, im Hemdstoff oder auf den Schuhen zurück. Nein, Blut war ein lästiges Mistzeug.
Aber inzwischen dachte Rey anders darüber – gerade jetzt im Moment zum Beispiel, während die Tür sich nach einem Surren endlich automatisch öffnete und mit einem dumpfen Klacken vor ihm aufsprang. Seine Sichtweise hatte sich in den vergangenen fünfundzwanzig Jahren radikal verändert. Jetzt, dachte Louis und schritt in den langen Raum, wollte er Blut sehen. Jede Menge davon. Er wollte es an den Fingern spüren und beobachten, wie es sich zu Pfützen ergoss. Er wollte hören, wie Knochen splitterten, Sehnen rissen, und fühlen, wie Klingen in Fleisch eindrangen, um es zu zerteilen. Definitiv. Es würde so sein wie in der Bibel, die er in der Zelle häufig gelesen hatte und wo es hieß: »Und der zweite Engel goss aus seine Schale ins Meer; und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen im Meer starben.« Und an einer anderen Stelle stand auch: »Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung.«
Aber an Vergebung war Louis Rey ohnehin nicht interessiert. Nein, keine Vergebung, für niemanden.
Rey ging durch den Flur zu einer Art Tresen. Hier roch es immer noch so wie auf der anderen Seite der Stahltür – nach Menschen und Putzmitteln. Wie in einem Altersheim. Hinter dem Ausgabeschalter stand ein uniformierter Angestellter der Justizvollzugsbehörde. Sein Name war Jean, gut zwei Köpfe größer als Rey. Jean grüßte ihn wortlos mit einem Nicken. Rey stellte seine Tasche auf dem Metalltisch vor sich ab. Er öffnete den Reißverschluss und sah ein paar seiner Habseligkeiten aus der Zelle sowie die Broschüre für die Haftentlassung mit den Checklisten für das Leben nach dem Knast.
In den letzten Wochen hatte er mit ziemlich viel Papierkram zu tun gehabt. Es war ein bürokratischer Irrsinn, um was man sich alles kümmern musste. Mit einem Fingerschnippen wurde man aus der Matrix des Alltags entfernt und in den Knast gesteckt. Sich wieder in die Matrix einzufügen war hingegen nicht so leicht: Sozial- und Krankenversicherungen, Rentenbescheide, eine Adresse, eine Wohnung, Zuschüsse des Staates, Abschlussberichte, ein neuer Führerschein, Erstausstattungen … Vor fünfundzwanzig Jahren hatte sich Rey um nichts kümmern müssen. Andere hatten das für ihn getan. Er hätte sich sogar Leute anstellen können, die ihm jeden Morgen den Hintern abwischten. Aber jetzt hatte er nichts mehr. Nichts und niemanden. Na ja, fast niemanden. Nur eine einzelne treue Seele war verblieben.
Jean nahm einen Karton aus dem Regal, der mit Louis Reys Namen beschriftet war. Er zog einige Plastikbeutel heraus und ließ sich quittieren, dass er sie Rey übergeben hatte, der die Verpackungen nacheinander öffnete. Die Seidenkrawatte steckte er in die Sporttasche. Den inzwischen viel zu weiten Gürtel zog er durch die Schlaufen an der Hose, die goldene Rolex mit den Brillanten legte er an. Auch sie saß zu locker. Er würde das Armband anpassen lassen müssen oder die Uhr beim Juwelier versetzen, weil er vielleicht das Geld brauchen würde, je nachdem.
Jean pfiff durch die Zähne. »Eine echte Rolex. Die wird ein Vermögen wert sein.«
Rey sparte sich einen Kommentar und nahm die Geldbörse, in der sich lediglich ein paar lausige Geldscheine befanden. Früher hatte er stets ein paar tausend Francs dabeigehabt. Er warf das Portemonnaie in die Sporttasche, ließ das Feuerzeug von Cartier folgen, zwei mit Monogramm bestickte Taschentücher aus feinem Stoff und eine noch nicht geöffnete Packung Gauloises Blondes.
»Wirst dich wundern«, sagte Jean. »Hat sich viel geändert dort draußen im letzten Vierteljahrhundert.«
»Manche Dinge ändern sich nie«, erwiderte Rey.
»Wenn du das sagst.«
Rey setzte seine letzte Unterschrift. Aber Jean hatte nicht Unrecht, dachte er. Die Welt hatte sich in einem atemberaubenden Tempo weitergedreht. Er hatte Zellennachbarn gehabt, die regelrecht Angst vor dem hatten, was sie draußen erwartete.
Rey nahm einige Dokumente an sich, steckte sie ebenfalls in die Sporttasche und verschloss sie schließlich. Fertig. Das war es dann.
Jean sagte: »Herzlichen Glückwunsch.« Er grinste belustigt. »Und was machst du draußen? Dein Imperium wieder aufbauen?«
Sterben, dachte Rey. Sterben werde ich. Aber ein paar Leute nehme ich mit auf die große Reise.
»Ich weiß nicht, wovon du redest, Jean«, erwiderte er und fasste nach der Tasche.
»Na, du hast doch bestimmt ein paar Schweizer Konten und Immobilien?«
Rey zuckte mit den Schultern. Früher gab es Immobilien und Schweizer Konten. Er hatte alles gehabt. Jetzt war alles weg.
»Sind wir dann fertig?«, fragte er.
»Wir sind fertig«, bestätigte Jean und machte eine Geste zu einer weiteren Stahltür.
Rey nickte und setzte sich in Bewegung. Vor der Tür, die der vorherigen glich, blieb er stehen und wartete darauf, dass Jean sie öffnete. Einen Moment später gab es einen elektrischen Summton. Die Tür sprang auf und füllte das Halbdunkel mit gleißendem Sonnenlicht. Rey gab sich einen Moment, schloss die Augen, sog die frische Luft ein. Dann ging er schließlich nach draußen. Hinter ihm fiel die Tür wieder zu. Er hörte den metallischen Ton der Verriegelung. Er öffnete die Augen und blinzelte in den hellblauen Morgenhimmel, der sich wolkenlos über der Provence spannte. Es war noch frisch, aber es würde zweifellos ein heißer Tag werden.
Rey ließ seinen Blick über die Flächen mit dem von der Sonne verbrannten Rasen schweifen. Er hörte das ferne Rauschen vom Verkehr und das leise Zischen von Bewässerungsanlagen. Er sah zwei Lkw, die durch den Kreisverkehr fuhren und auf das Gelände des Centre Pénitentiaire d’Avignon abbogen. Sie waren an den Seiten mit Bildern bedruckt, die Obst-Arrangements zeigten, und stoppten direkt neben dem großen Parkplatz.
Rey setzte sich in Bewegung. Es gab niemanden, der hier auf ihn warten würde, und er hatte sich kein Taxi rufen lassen. Er plante, zu Fuß zu gehen – ein paar Kilometer bis zur Bar von Marc Ledoux. Er würde sich dort etwas stärken, zunächst ein kaltes Bier genehmigen, dann einen starken Kaffee, vielleicht ein Salamibaguette, und schließlich weitersehen.
Rey spürte, wie die Kraft mit jedem Meter Wegstrecke und jedem Atemzug in ihn zurückströmte. Leben, dachte er, ist doch wie Fahrradfahren. Man verlernt es nicht. Sein Gang wurde aufrechter, die Haltung gerader. Er spürte die Sonne auf der Haut – der Gefängnisarzt hatte ihn bei der letzten Untersuchung, bei der er ein paar Überweisungen geschrieben hatte, davor gewarnt, sich zu lange darin aufzuhalten. Ein Vierteljahrhundert Knast mache die Haut sehr empfindlich, Freigang hin oder her. Aber Rey war das egal. Er sehnte sich nach der Sonne. Sollte seine Haut doch verbrennen.
Er ging eine gerade verlaufende Straße entlang, folgte einem dunkelgrünen Maschendrahtzaun, der ein vollkommen leeres Grundstück einfasste. An einer Kreuzung blieb er stehen. Links, rechts und vor sich sah er Wohnblocks, die in hellem Orange gestrichen waren. Billige Wohnungen. Davor spielten zwei Kinder. Ein kleines Mädchen fuhr Dreirad. Ein Junge schoss mit einem Plastikgewehr auf imaginäre Gegner. Eine junge Frau, vielleicht die Mutter, stand dabei und befasste sich lieber mit ihrem Telefon, statt ihre beiden Sprösslinge zu beachten.
Rey dachte an seine eigene Familie, seine Frau, seine Tochter, und fragte sich, ob er inzwischen selbst Enkel hatte. Louise und Camille lebten nach seinem Wissen längst nicht mehr in Frankreich. Der Kontakt zu ihnen war seit Jahren abgebrochen. Eher seit Jahrzehnten. Beides hatte seine Gründe, das mit dem Ausland und dem Kontakt. Zuletzt hatte ihm ein Vögelchen vor rund fünf Jahren gezwitschert, dass Louise wieder heiraten wollte, einen reichen Farmer in Argentinien, und Camille nach Kapstadt gegangen war. Er dachte immer noch oft an die beiden. Aber sie waren ohne ihn fraglos besser dran, weswegen er keinen Kontakt zu ihnen suchen würde. Sie hatten ihn bereits einmal verloren. Sie sollten ihn nicht noch mal verlieren, und das würden sie, ganz ohne Zweifel.
Rey stellte die Sporttasche ab und holte die Packung Zigaretten und das Feuerzeug heraus. Er öffnete die Schachtel, klopfte darauf, nahm sich eine Gauloises mit den Lippen und brauchte fünf Versuche, bis er sie angezündet hatte. Immerhin funktionierte das Feuerzeug nach fünfundzwanzig Jahren Zwangspause noch. Erstaunlich. Und die Zigarette schmeckte wenigstens einigermaßen. Besser als gar keine. Er klemmte sie zwischen die Zähne, griff nach der Tasche und setzte sich in Bewegung, immer der Nase und der Sonne nach und der Silhouette der Stadt entgegen. Den Papstpalast und damit das Zentrum von Avignon konnte man nur verfehlen, wenn man blind oder vollkommen blöd war. Man brauchte lediglich Richtung Südwesten zu laufen und musste sich ansonsten einfach am Fluss orientieren. Die Rhône führte einen zwangsläufig irgendwann mitten ins Geschehen.
Rey war etwa eine dreiviertel Stunde zu Fuß unterwegs, als er die Stadtmauern erreichte. Wie ein Pilger, dachte er. Er ignorierte die hupenden Autos an den Hauptstraßen und genoss stattdessen die Geräusche, die er ein Vierteljahrhundert lang hatte entbehren müssen. Er wählte den Weg entlang des Boulevards Saint-Lazare und ging von dort aus über die Kais, an deren Mauern die Ausflugsschiffe hielten, mit denen man über den Fluss schippern konnte. Von einem fliegenden Händler kaufte er eine billige Sonnenbrille, weil ihn das grelle Licht auf den Wellen blendete. Der Afrikaner hatte Rey erst zum Teufel schicken wollen, als er ihm einige Francs-Scheine unter die Nase hielt. Euros steckten nicht in Reys Geldbörse. Schließlich hatte der Mann akzeptiert und Rey nun die knallrote Kopie einer klassischen Ray Ban auf der Nase.
Er spazierte am braungrünen Wasser entlang, inhalierte die Luft, die einerseits frisch, andererseits brackig war und wegen des vierspurigen Boulevards am Fluss auch nach Abgasen roch. Alles, dachte Rey, war besser als der Geruch nach Menschen und Knast, der sich in seine Schleimhäute gefressen hatte.
Er ging bis zur Pont d’Avignon, die berühmte Bogenbrücke, die mitten im Fluss plötzlich aufhörte – eine der vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt, wo Touristen gerade Selfies machten. Von dort aus spazierte er schließlich durch eines der vielen Tore in die Stadt hinein und gelangte auf den großen Platz vor dem Papstpalast. Er marschierte darüber hinweg, ignorierte die Touristengruppen, die Bestuhlung der Cafés und Restaurants und die Gaukler, die sich mit Kunststücken ein bisschen Geld verdienten. Er ging die Rue de la République entlang, auf der sich unter Platanen die hellen Sonnenschirme von Restaurants und Bars wie an einer Perlenschnur aufreihten, und passierte das Opernhaus. Einige hundert Meter weiter endete die Fußgängerzone. Rey wechselte auf den Bürgersteig der Rue de la République, wo es links und rechts diverse Geschäfte, Boutiquen, Bar Tabacs, Supermärkte und einen McDonalds gab. Dazwischen quetschte sich der eilige Lieferverkehr über die enge Fahrbahn.
Rey bog auf die Rue Mignard ab, wo es wie auf Knopfdruck kühler und stiller wurde. Er ging im Schatten zwischen den hohen, alten Häusern entlang, bis er den Place Saint-Didier an der gleichnamigen katholischen Kirche erreichte. Unter den dortigen Platanen quetschten sich Mopeds und Lieferwagen. Bevor er den Platz in Richtung Rue Laboureur wieder verließ, stoppte er an einem schäbigen Eckgebäude, dessen Fassade mit Graffiti besprüht war. Er betrachtete die Fassade, las das verblichene Schild mit der Aufschrift Le Combattant, unter die ein Ricard-Werbeschriftzug gedruckt war. Zum ersten Mal lächelte Rey und dachte: »Nein, manche Dinge ändern sich nie«, bevor er die Bar betrat, in der ihn schummriges Halbdunkel und der Geruch nach abgestandenem Bier, Zigarettenrauch, Putzmittel und starkem Kaffee in Empfang nahm.
Der Laden war bis auf zwei Gäste, die am Fenster saßen und Zeitung lasen, leer. Auf einem an der Wand angebrachten Flachbildschirm lief ein Autorennen, allerdings ohne Ton, dafür zu Musik mit der unverkennbaren Stimme von »Satchmo« Louis Armstrong, die aus irgendwelchen nicht sichtbaren Boxen kam. Die beiden Gäste blickten kurz auf, als Rey die Bar betrat. Sie wirkten nicht sehr vertrauensselig und mehr wie die Art von Gästen, die hier waren, um mit den Handys, die auf ihren Tischen lagen, zwielichtige Geschäfte zu machen. Sie scannten Rey im Bruchteil einer Sekunde, wogen ihn ab, sortierten ihn ein und kamen zu dem Schluss, dass er ihnen nicht bekannt war, dass von ihm keine Gefahr ausging und auch kein Geschäft zu erwarten war, weil es sich bei ihm mit seinem aus der Mode gekommenen Anzug und der teigigen Hautfarbe um einen Knacki handeln musste, der gerade rausgekommen war. Schließlich widmeten sie sich wieder ihren Zeitungen und interessierten sich nicht mehr für Rey, der an den Tresen aus dunklem Holz trat.
Dahinter stand ein breitschultriger Mann mit Glatze und hantierte an einer riesigen Espressomaschine. Er trug ein T-Shirt mit dem Aufdruck einer japanischen Motorölfirma. Seine sehnigen Unterarme waren vor langer Zeit tätowiert worden. Damals irgendwo in Französisch-Guayana, wusste Rey, als Marc Ledoux noch in der Fremdenlegion und jung gewesen war, bevor ihn der Kosovo-Einsatz in den Neunzigern zerbrochen hatte. Als sich Ledoux umdrehte, blickte Rey in ein von Falten und einer Narbe zerfurchtes Gesicht und ein paar kristallklare Augen, die Reys Züge absuchten und schließlich noch etwas heller wurden.
»Bist du ein Geist?«, fragte Ledoux.
»So ähnlich«, erwiderte Rey. »Du stehst immer noch auf Satchmo.«
»Er ist der Beste.«
Ledoux grinste, wobei er eine große Zahnlücke offenbarte. Er beugte sich über den Tresen, nahm Reys Gesicht in beide Hände und presste ihm zwei Küsse auf die Wangen. Sein Griff war stahlhart. Kein Griff, den man an der Kehle spüren möchte. Und eine Begrüßung, die Rey früher als viel zu persönlich und respektlos empfunden hätte. Aber heute lagen die Dinge anders. Ledoux freute sich und grinste noch immer wie ein Honigkuchenpferd. Rey ließ sich von der Euphorie etwas anstecken und lächelte zumindest.
»Bist du heute raus?«, fragte Ledoux.
»Vor etwa einer Stunde«, antwortete Rey.
»Warum hast du nichts gesagt?«
»Halb so wild.«
»Und kommst direkt zu mir?«
Rey nickte. »Weil ich ein Bier und einen Kaffee will.«
Ledoux schmunzelte, drehte sich um und schmiss die Kaffeemaschine an, die fauchend einen tiefschwarzen Sirup in eine dickwandige Tasse spuckte. Derweil ging Ledoux zum Kühlschrank und holte eine Flasche »1664« heraus, öffnete sie und stellte sie Rey hin. Rey leerte sie in einem Zug, während Ledoux den Kaffee folgen ließ. Damit ließ sich Rey mehr Zeit als mit dem Bier.
»Darf ich rauchen?«, fragte er.
Ledoux nickte. »Du darfst hier absolut alles. Du hättest mir eine Nachricht zukommen lassen sollen. Ich hätte dich abgeholt und alles Nötige für dich geregelt.«
Rey nahm die Packung Gauloises hervor, legte sie neben die Tasse und zog das Feuerzeug aus der Hosentasche.
»Sind die antik?«, fragte Ledoux und deutete auf die Gauloises.
»Ziemlich«, erwiderte Rey, was Ledoux mit einem keuchenden Auflachen quittierte.
Wortlos griff er unter den Tresen, förderte eine frische Schachtel zutage, und gab sie Rey. Der nahm sich eine, steckte sie an und sah, wie Ledoux die alte Schachtel in den Mülleimer warf und Rey die neue hinlegte.
»Geht nicht nur um einen Kaffee und ein Bier, heh?«, fragte Ledoux mit einem Augenzwinkern.
Rey inhalierte tief, stieß den Rauch aus und saß einige Momente einfach nur so da auf dem Barhocker, genoss die Zigarette, den Kaffee, genoss einfach alles. Er fuhr sich unter der Nase her, weil er dort etwas Feuchtes bemerkte. Er öffnete die Augen und betrachtete die rote Schmierspur auf seinem Handrücken.
»Nein, nicht nur um ein Kaffee und ein Bier«, sagte er zu Ledoux und nahm eine Papierserviette aus dem Spender vor sich, um sich damit die Nasenspitze abzutupfen.
»Mit deiner Nase alles in Ordnung?«
»Passiert von Zeit zu Zeit. Das Alter«, log Rey. Er beugte sich über den Tresen zu Ledoux, streckte die Hand aus und legte sie in dessen Nacken, tätschelte ihn freundschaftlich. Nichts als Muskeln und Sehnen. »Du hast immer zu mir gehalten«, sagte Rey leise. »Niemand hat mir etwas in den Knast geschickt. Du hast es getan. Jedes Jahr zum Geburtstag. Jedes Jahr zu Weihnachten. Das vergesse ich dir nicht, mein Freund.«
»Ist doch selbstverständlich«, erwiderte Ledoux.
»Nein«, sagte Rey und setzte sich zurück auf den Barhocker. »Ist es eben nicht. Zumindest nicht für jeden.«
Dennoch, dachte Rey, gab es niemanden mehr, dem er vertrauen würde. Gar keinen. Fünfundzwanzig Jahre waren eine lange Zeit. Wer wusste, was Ledoux in diesem Zeitraum alles widerfahren war.
Rey fragte: »Bist du noch im Neunmillimeter-Geschäft?«
»Wenn du willst«, erwiderte Ledoux und lehnte sich etwas vor, »können wir auch über kleinere oder größere Formate reden.«
Rey nickte. »Beizeiten. Ich bräuchte ein Auto.«
»Such dir die Marke aus. Du kannst von mir alles bekommen, was du willst. Das schließt zwei Ukrainerinnen mit ein, die gleich vorbeikommen, bevor sie ihren Job für mich beginnen. Du warst lange im Bau. Ist vielleicht gut für deine Nase und deine generelle Verfassung, bevor wir uns um die Hardware kümmern.«
Rey trank einen großen Schluck Kaffee. Er war stark und heiß. Genau richtig.
»Das Einzige, was ich brauche«, sagte Rey, »ist eine Bleibe, ein Auto und eines dieser Smartphones, mit dem ich ins Internet kann.«
»Schon geschehen«, antwortete Ledoux. »Die Schweinehunde haben dir nicht einmal eine Bleibe organisiert?«
»Nein«, erwiderte Rey. »Ich habe mich zwar um eine gekümmert und eine Adresse. Aber ich benötige eine andere Bleibe. Ein Zimmer reicht mir.«
»Verstehe. Und die Ukrainerinnen? Würden dir guttun.«
»Kann sein«, antwortete Rey, betrachtete die blutige Serviette und dachte: Blut fordert Blut. Blut will fließen, und es wird fließen. Vor allem das Blut des Mannes, der Louis Rey für ein Vierteljahrhundert hinter Gitter gebracht und damit sein Leben zerstört hatte. Aber alles der Reihe nach. Alles Schritt für Schritt.
»Eines habe ich vergessen«, murmelte Rey und steckte das Taschentuch ein.
Ledoux sah ihn fragend an.
»Einen Spaten brauche ich auch.«
2
Albin stand vor der Haustür und zog an der Zigarette. Er stieß den Rauch durch die Nasenlöcher aus und dachte an das Jahr 1953.
Der Indochinakrieg war noch im vollen Gang. Der in Algerien stand bevor. Kambodscha erklärte sich für eigenständig. In allen Konflikten ging es um die Unabhängigkeit der Länder von Frankreich. Albin konnte es ihnen nicht verübeln. Wenn er ein Land wäre, dann wäre er ebenfalls lieber für sich selbst verantwortlich, als sich von Paris diktieren zu lassen, wie er zu leben hatte. Niemand mochte das, nicht mal im eigenen Land, denn Paris war ein Staat im Staat. Die Pariser hatten keinen Schimmer vom Süden, nicht einmal vom Norden, Westen oder Osten. Paris war einfach … Na ja, Paris war eben Paris.
1953 wurde außerdem Elisabeth die II. in London gekrönt und in den USA Dwight D. Eisenhower zum Präsidenten bestimmt. Im August gab es in Frankreich einen Generalstreik von vier Millionen Arbeitern. Einen Monat zuvor war Albin Leclerc in Avignon als Sohn der Schneiderin Louise und des Tiefbauingenieurs Albert Leclerc geboren worden. Sie hatten ihm eine Menge Ratschläge mit auf den Weg durchs Leben gegeben, aber vor allem zwei Dinge: Straßen sind am besten, wenn sie gerade verlaufen, und alles folgt einem einzigen großen Schnittmuster.
Siebenundsechzig Jahre. Verdammt, dachte Albin, das waren eine ganze Menge. Sieben. Und. Sechzig. Er war ein alter Mann. In drei Jahren würde er die siebzig erreichen, und drei Jahre – mal ehrlich – waren gar nichts. Drei Jahre waren ein Witz. Sie würden vergehen wie im Flug. Dabei spürte er – abgesehen von einigen körperlichen Veränderungen, die er beharrlich ignorierte – keinen wesentlichen Unterschied dazu, wie er sich mit fünfzig Jahren gefühlt hatte. Und mit fünfzig, daran konnte er sich noch gut erinnern, hatte er keine erhebliche Differenz zum Lebensgefühl in seinen Vierzigern bemerkt, die sich nicht allzu sehr von seinen Dreißigern unterschieden.
Trotzdem, das war unverkennbar, war er älter geworden. Ein Großvater.
Albin trat die Zigarette auf dem Boden aus und warf sie in den Mülleimer. Zeit, wieder in die Küche zu gehen, statt sich über einen solchen Unsinn wie das Alter und die Zeit Gedanken zu machen. Heute, am großen Tag von Albins Geburtstagsfeier, wurden viele Gäste erwartet. Es gab eine Menge vorzubereiten und eine ganz besondere Attraktion: Er, Albin Leclerc, würde höchstpersönlich das Festmahl zubereiten.
Gut, zugegeben, Veronique assistierte ihm dabei. Oder genauer: Sie führte die Regie, und Albin war so eine Art Komparse, aber das musste man später ja nicht an die große Glocke hängen.
Veronique stand am Herd und summte eine Melodie, die im Radio lief, als Albin wieder hereinkam. Sie bemerkte das Geburtstagskind gar nicht. Dafür hatte sie ihn am Morgen umso mehr bemerkt und ihn mit einem prächtigen Frühstück auf der Terrasse von Albins kleinem Haus an der Stadtmauer von Carpentras empfangen. Dort hatte auch sein Geburtstagsgeschenk gewartet: Ein todschicker Rasenmäher mitsamt roter Schleife. Albin hatte ihn sich gewünscht, weil er keine Lust mehr hatte, das Grün im Garten mit diesem rostigen Rolldings zu kürzen, das man vor sich herschieben musste, um die Schneidemesser in Bewegung zu setzen. Veronique hatte ihn damit mehrfach aufgezogen. Also hatte Albin beschlossen, dass professionelles Gerät hermusste – wenngleich der neue Mäher eher so wirkte, als könne man damit innerhalb von fünf Minuten sämtliche Grünflächen von Versailles frisieren, was angesichts Albins kleinem Garten etwas unverhältnismäßig wirkte. Andererseits wäre jeder Rasenmäher zu groß dafür gewesen.
Fast schien das die Bürde von Albins zweitem Frühling zu sein: Größenunterschiede. Immerhin war er über einsneunzig groß, und sein Mops Tyson, den seine Kollegen Albin zum Ruhestand geschenkt hatten, wirkte wie ein Witz neben ihm. Zumindest optisch, worauf die Kollegen es damals wohl auch angelegt hatten. Sie wollten Albin außerdem eine Beschäftigung im polizeilichen Ruhestand geben, damit er keinen von ihnen mehr nervte. Hatte aber absolut nicht geklappt.
Tyson lag unter dem Wohnzimmertisch und sah Albin nachdenklich an, der wiederum auf Veroniques Hintern starrte, der im Takt der Melodie aus dem Radio hin und her schwang. Veronique führte ein Blumengeschäft, war nur unwesentlich jünger als Albin, ging aber locker für Anfang Fünfzig durch. Sie war nach Albins Maßstäben eine grandiose Köchin – falls seine Maßstäbe denn etwas galten. Bevor er sie kennenlernte, hatte er sich vornehmlich von Mikrowellen- und Dosengerichten ernährt. Seitdem Veronique in sein Leben getreten war, waren diese Zeiten jedoch vorbei.
Auf der Anrichte vor ihr standen zwei große Kasserollen für den Ofen. Überall lagen Kräuter, Knoblauchknollen, Kartoffeln und Gemüse herum. Es duftete umwerfend. Auf einem großen, dicken Brett aus Olivenholz befanden sich drei Lammkeulen vom Format eines Radrennfahrer-Oberschenkels. Gigot, hatte Veronique gesagt, sei für so zahlreiche Gäste am Abend am einfachsten zu machen und sowieso immer eine gute Sache. Gigot sei ein Familienessen, und das passe ja wohl.
Albin hatte anmerken wollen, dass nicht alle Gäste Teil seiner Familie wären, die Bemerkung dann aber wieder heruntergeschluckt. Genaugenommen war sie nämlich nicht allzu falsch, denn man konnte durchaus einige der eingeladenen Nicht-Blutsverwandten als eine Art erweiterte Familie betrachten. Zumindest tat das Veronique.
Manon, Albins Tochter, arbeitete heute im Blumenladen. Sie war aus Paris vor ihrem psychopathischen Ehemann geflohen und hatte bei Albin in der Provence Unterschlupf gefunden. Auch seine Enkeltochter lebte hier, Clara. Sie war inzwischen im letzten Kindergartenjahr, kniete neben Tyson am Wohnzimmertisch und malte das zehnte oder fünfzehnte Geburtstagsbild für Albin. Auf jedem waren Blumen, ein kleiner Hund und Elfen in unterschiedlichen Anordnungen zu sehen.
Sie blickte auf, als Albin hereinkam, widmete sich dann wieder ihrem Bild und fragte beim Zeichnen: »Warum essen wir eigentlich die Beine von einem Lämmchen?«
»Weil sie gut schmecken«, erwiderte Albin und vergrub die Hände in den Hosentaschen.
»Aber die Lämmchen essen doch auch nicht unsere Beine?«
»Das ist richtig.«
»Yusuf im Kindergarten hat gesagt, dass man Schweine nicht essen darf, weil sie schmutzige Tiere sind. Lämmchen machen sich auf der Wiese doch auch schmutzig?«
»Yusuf und seine Eltern haben aber einen Glauben, der ihnen vorschreibt, dass sie kein Schweinefleisch essen dürfen, weil Schweine schmutzig sind. Sie sind Muslime und lesen den Koran. So wie wir die Bibel. Von Lämmchen ist im Koran aber keine Rede. In der Bibel auch nicht – jedenfalls steht dort kein Verbot, was Lämmer zum Essen angeht. Dort werden dauernd welche geschlachtet.«
»Ich glaube schon, dass man Schweine essen darf.«
»Ich auch.«
»Schweine sehen unter der Haut nämlich ganz normal wie Fleisch aus. Da ist kein Dreck. Und wenn sie sich von außen schmutzig machen, dann kann man sie doch abwaschen?«
Albin lachte.
»Trotzdem tun mir die Lämmchen leid.«
Albin sagte: »Ich verrate dir ein Geheimnis.«
Clara blickte auf.
»Wir tun den Lämmern einen großen Gefallen. Die meisten von ihnen möchten nämlich Menschen sein, und wenn wir zwei von ihren vier Beinen essen, dann müssen sie zwangsläufig auf zwei Beinen gehen, hm? Wir helfen ihnen bei der Evolution.«
»Albin!«, hörte er aus der Küche Veroniques Stimme. »Erzähl dem Kind nicht so einen Blödsinn. Mach dich lieber nützlich und stell die Tische und Stühle im Garten auf, und dann schälst du die Kartoffeln.«
Albin zuckte spielerisch zusammen und antwortete: »Sehr wohl, mein General.«
Clara runzelte die Stirn und legte ihren Kopf schief. »Was ist eine Evalation?«
Albin winkte ab und ging dann nach draußen. »Nicht so wichtig«, antwortete er. »Sie geht sowieso an vielen Menschen vollkommen vorbei.«
Er betrachtete die Stühle und die Tische, seinen Garten, der sich heute mit vielen Gästen füllen würde: Polizeikommissarin Caterine Castel mit ihrem neuen Freund Jean Villeneuve, dem Kurator aus Aix-en-Provence, Albins Nachfolger bei der Polizei, Alain Theroux und Familie, die Rechtsmedizinerin Berthe mit ihrem Mann, sogar der Gastwirt Matteo mit Frau. Und mittendrin er, der Jubilar – Albin Leclerc, seit neuestem sogar wieder mit einer fast offiziellen Funktion versehen.
Hoffentlich, dachte Albin und machte sich an die Arbeit, hoffentlich würde ihm irgendwer zum Geburtstag Visitenkarten schenken, auf denen stand: Albin Leclerc, Polizeiberater.
3
Ledoux hatte sich einige Male entschuldigt, dass er nur einen kleinen Fiesta in Weiß für Rey auftreiben konnte. Für Rey spielten Marke und Farbe keine Rolle. Hauptsache, ein fahrbarer Untersatz. Er hatte eine halbe Stunde gebraucht, um sich mit der Technik, dem Navigationssystem und den Anzeigen im Cockpit vertraut zu machen. Die Autos von heute glichen Computern. Schließlich hatte Rey beschlossen, dass die Technik für ihn keine Rolle spielte, solange der Motor gut funktionierte und der Tank gefüllt war.
Das Smartphone war auf den ersten Blick erheblich komplexer. Auf der anderen Seite war es aber sehr intuitiv zu bedienen – wie beim Fiesta: Schlüssel rein, Kupplung treten, Gang rein, Fuß auf das Gaspedal. Man konnte sämtliche Möglichkeiten, die das Smartphone bot, einfach ausblenden und nur das damit tun, was man tun wollte: telefonieren oder ins Internet gehen. Wie das ging, erschloss sich unmittelbar. Jedes Kind würde es bedienen können, und wahrscheinlich waren Kinder sogar besser damit, denn sie reflektierten nicht, was sie gerade taten, sondern machten es einfach.
Rey verließ die Stadt, als die Sonne langsam unterging. Er fuhr in Richtung Süden, steuerte über Landstraßen, die immer schlechter wurden, und bog schließlich rechts ab, passierte einige Obstbaumplantagen, bis er schließlich ein Weinfeld erreichte. Er stoppte auf dem schlecht befestigten Wirtschaftsweg und stieg aus.
Er inhalierte die würzige Luft, schloss für einen Moment die Augen und sah sich selbst vor vielen Jahren durch das Weinfeld gehen, als es in voller Pracht stand. Es hatte damals ihm gehört. Jetzt gehörte es entweder dem Staat, oder der Staat hatte es gewinnbringend an jemanden veräußert, der ebenfalls einmal den Traum vom Leben eines einfachen Weinbauern gehabt hatte. In Bezug auf Rey, wenn man ehrlich war, handelte es sich dabei allerdings um die romantische Verkleidung der Wahrheit. Tatsächlich war es natürlich darum gegangen, mit dem Ankauf von Weingütern schmutziges Geld in Grundbesitz zu verwandeln, um später sauberes Geld daraus zu destillieren. Hatte am Ende jedoch nicht geklappt. Ein paar Handschellen und ein Gerichtsurteil waren dazwischengekommen.
Rey ging um den Wagen herum, öffnete den Kofferraum und nahm den Spaten heraus, den Ledoux ihm gegeben hatte. Ein nagelneuer Klappspaten. Sah aus wie ein Militärgerät, handlich und stabil. Rey setzte sich in Bewegung. Er marschierte entlang der Rebstöcke. Unter seinen Schuhen knirschte der trockene Boden. Fünf Minuten später erreichte er eine Anhöhe und das Ende der Reihe, wo sich ein prächtiger Rosenbusch befand. Genau die Stelle, die Rey gesucht hatte. Er machte zwei Schritte nach Norden. Dann klappte er den Spaten auf und begann zu graben.
Rey hatte die Arbeit unterschätzt. Er brauchte deutlich länger als erwartet. Außerdem erwischte er die richtige Stelle nicht auf Anhieb und benötigte mehrere Anläufe. Er war klatschnass geschwitzt, als die Spatenkante endlich auf Metall traf. Es dauerte eine weitere Viertelstunde, bis er die Munitionskiste aus der staubigen Erde zog und sie schließlich öffnete.
Es befand sich nicht viel darin. Aber der Inhalt hatte das letzte Vierteljahrhundert augenscheinlich bestens überstanden. Es hatte sich ausgezahlt, dass Rey die Kiste mit Silikon abgedichtet hatte, damit keine Feuchtigkeit eindringen konnte. Im Inneren lag ein Umschlag mit einigen tausend Francs. Rey steckte die Scheine ein. Er würde sie morgen bei der Bank umtauschen und hoffte, dass das problemlos möglich wäre. Weiter befand sich ein dünner Reiseführer in der Kiste. Rey schmunzelte über sich selbst: Er hatte ihn hier platziert, damit er sein Ziel nicht aus den Augen verlieren würde. Bei Gott, das würde er nicht. Der Gedanke daran hatte ihn in Hunderten oder Tausenden von Nächten im Knast vor dem Durchdrehen bewahrt.
Er schob das Heft in die Hintertasche seiner Hose. Dann nahm er die Plastiktüte hervor, wickelte sie auf und zog eine in Wachspapier geschlagene Glock mit zwei Magazinen und zwei Kartons Munition hervor. Hundert Schuss. Alles wirkte nagelneu. Aber man konnte sich nur auf eine Waffe verlassen, von deren Funktionalität man sich vorher vergewissert hatte.
Natürlich, dachte Rey, als er einige Patronen aus dem Karton nahm und in das Magazin lud, hätte er sich Geld und eine Waffe von Ledoux besorgen können. Aber bei allem Vertrauen: Wenn Ledoux ihm Geld und eine Waffe gab, dann könnte er auch über Geld und eine Waffe reden oder zum Reden gezwungen werden. Das wollte Rey in jedem Fall ausschließen. So konnte Ledoux höchstens sagen, dass er Rey ein Auto, ein Smartphone und ein Appartement besorgt hatte. Völlig unverfänglich.
Rey drückte das Magazin in die Waffe und lud sie durch. Er zielte auf einen großen Stein in zehn Metern Entfernung und gab zwei Schüsse ab. Sie krachten ohrenbetäubend und spalteten den Stein in der Mitte. Irgendwo flogen ein paar Vögel auf. Ansonsten regte sich nichts. Das nächste Haus war einige Kilometer weit entfernt.
Rey war zufrieden. Er steckte die Glock ein, versenkte die Munitionskiste im Boden und vergrub sie wieder, weil er keine Verwendung mehr dafür hatte und niemandem das Loch im Boden auffallen sollte. Den Spaten klappte er zusammen und steckte ihn in die Tüte, in der zuvor die Waffe eingewickelt gewesen war. Er wollte keine Erdspuren im Kofferraum hinterlassen. Dann ging er zurück zum Wagen, verstaute alles und setzte sich ans Steuer. Der Abend war jung, und es gab einiges zu erledigen.
Zum Beispiel Vital Didier.
4
Der Abend senkte sich träge über die Provence. Die Luft war nach wie vor heiß und drückend. Kein Wind wehte. Alles war still. Die untergehende Sonne klebte wie eine Orange auf dem Himmel, der eine undefinierbare Farbe zwischen Grau und Blau hatte.
Vital Didier blinzelte und blickte dann wieder auf das iPad. Es lag auf seinem Schoß. Er saß am Poolrand, schwitzte, hielt die Füße ins Wasser und betrachtete die Sonderausstattung für den neuen F-Type auf der Homepage von Jaguar. Er würde ihn in Dunkelgrün nehmen, mit cremefarbenen Ledersitzen. Wenngleich es Wahnsinn war. Absoluter Unfug, überhaupt darüber nachzudenken. Genauso wie es Blödsinn war, sich mit Ferraris, Porsches und ähnlichen Sportwagen zu befassen. Nicht weil Didier dazu das Geld fehlte, absolut nicht. Es war deswegen Blödsinn, weil man in seinem Alter in diese flachen Autos ziemlich schlecht einsteigen konnte und noch schlechter wieder herauskam, unter Umständen überhaupt nicht mehr.
Diese peinliche Erfahrung hatte Didier bereits vor einigen Jahren nach der Testfahrt mit einem Lamborghini machen müssen, als die Verkäuferin ihm aus dem Sitz helfen musste. Er hatte den Wagen dann doch nicht gekauft, sondern einen Porsche Cayenne Geländewagen genommen und sich darüber aufgeregt, dass das Autohaus attraktive junge Verkäuferinnen beschäftigte, vor denen man sich eine solche Blöße geben musste. Früher, da waren dort nur männliche Verkäufer angestellt. Kerle, die kommentarlos verstanden, was ein anderer Mann brauchte und wollte. Dann hatten sie ihr Personal mit weiblichen Angestellten ergänzt. Didier nahm an, dass das eine neue Art psychologischer Verkaufsführung war, um alten Säcken wie ihm das Geld noch schneller aus der Tasche zu ziehen, indem sie gutaussehende Frauen einsetzten, denen man unbewusst imponieren wollte. Aber der Chef des Autohauses hatte Didier eines Besseren belehrt und erklärt, dass sie schlicht und ergreifend deswegen Verkäuferinnen einsetzten, weil die Zahl von weiblichen Kunden zunehmen würde. Es gebe ja immer mehr Frauen in Topjobs und außerdem viele, die sich ihre Autos heute selbst kauften, statt sie von ihren Männern aussuchen zu lassen. Und außerdem, hatte der Mann gesagt: Wo ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern bei gleicher Qualifikation? Tja, so verhielt sich das heute. Didier glich einem Dinosaurier aus einer anderen Epoche.
»Ich bin mal weg«, hörte er Jeanne aus dem Haus rufen, danach durch die offenstehenden Flügeltüren das Stakkato ihrer Absätze aus dem Flur, das Rumsen der Haustür und schließlich das Röhren des Porsche-Motors, als sie mit dem Cayenne aus der Einfahrt zurücksetzte und mit Vollgas in Richtung Avignon fuhr. Jeanne traf sich dort mit ihren Freundinnen zum Abendessen. Allesamt alte Schachteln, die sich von den jungen Kellnern gegen üppige Trinkgelder hofieren ließen, wie Didier annahm.
Es war ihm gleichgültig. Sollten sie nur. Jeanne machte ohnehin, was sie wollte. Zum Beispiel jedes Mal die Haustür benutzen, statt durch die Garage zum Auto zu gehen. Dabei hatte Didier extra einen Durchbruch machen lassen, damit man sich einige Meter sparen konnte. Aber Jeanne war es zu schmutzig in der Garage. Vermutlich befürchtete sie, sich einen Ölfleck an der Sohle zu holen oder dass irgendein Abgasgeruch sich mit ihrem Parfüm vermischte.
Er schaute zur Seite und sah, dass Jeannes Handtasche immer noch auf einem der Gartenstühle stand. Sie hatte das Ding glatt vergessen. Oder eine andere mitgenommen, denn eigentlich vergaß sie ihre Handtasche niemals. Alles andere schon, aber nichts aus der Hermès-Chanel-Gucci-Ralph-Lauren-Sammlung, das man sich über den Unterarm oder über die Schulter hängen konnte. Also hatte sie wahrscheinlich eine andere mitgenommen. Außerdem: Ihm doch egal.
Didier platschte mit den Füßen im Wasser des Pools, den niemand außer ihm benutzte. Sein Arzt hatte gesagt, dass Schwimmen gut für Herz und Kreislauf sei. Also hatte Didier den Pool bauen lassen – nach einer Debatte mit Jeanne, die einen Pool für überflüssig hielt, weil sie meinte, dass das Chlor ihrer Haut nicht bekommen würde. Außerdem fand sie es unsinnig, noch mehr Geld in das Anwesen zu stecken, und regte sich darüber auf, dass er, Vital Didier, als Mann der Finanzen nach ihrer Meinung wider besseres Wissen handelte. Sie hasste es hier in Mormoiron, das sie für ein Kaff hielt – und es war ein Kaff, daran gab es nichts zu deuteln. Trotzdem gefiel es Didier, und er hatte sich den Ort als Ruhesitz ausgesucht, eben weil es ein Kaff war.
Er hatte genug davon, dass ihm die Leute in der Stadt auf die Nerven gingen – und das war in seiner Zeit als Bankvorstand Tag für Tag geschehen. Mehr als genug. Abgesehen davon war sein Abgang als Bankvorstand, nun ja, aus unterschiedlichen Gründen nicht besonders rühmlich vonstatten gegangen, weswegen Didier es sowieso für besser hielt, sich in Avignon so lange nicht mehr blicken zu lassen, bis Gras über die Sache gewachsen war.
Inzwischen war das längst der Fall. Jeanne verkehrte wieder in der besseren Gesellschaft, in der man die Vorfälle geflissentlich ignorierte – und mal ehrlich, wer hatte denn in diesen Kreisen keinen Dreck am Stecken?
Vital Didier hingegen hatte sich inzwischen an sein Kaff gewöhnt und die Zeit damit verbracht, das alte Bauernhaus in eine ansehnliche Villa zu verwandeln, die inzwischen auf dem Immobilienmarkt drei Millionen Euro bringen könnte, falls man einen Käufer dafür fand. Was nicht so leicht wäre, wie er wusste, denn: Wer wollte schon in Mormoiron leben?
Doch Didier war das gleichgültig. Das Haus wollte er ja ohnehin behalten. Er hatte außerdem genug Geld, um den ganzen Ort zu kaufen, wenn er wollte. Wollte er aber nicht. Er wollte nur hier sitzen, sich die Füße kühlen und endlich eine Entscheidung darüber treffen, welchen Jaguar er sich bestellen sollte. Und zwar unabhängig davon, ob er rein und wieder raus kam oder ihn sich nur von morgens bis abends in der Garage ansehen und darüber freuen würde, so ein schönes Auto zu besitzen.
Es würde die letzte Entscheidung seines Lebens werden.
5
Albin stach mit einer spitzen Gabel in das Fleisch. Sie glitt hinein wie in Butter. Er setzte das sehr scharfe Messer an und schnitt einige Scheiben von der Haxe ab. Sie fielen dampfend und wie in Zeitlupe auf die zahlreichen Knoblauchzehen und breiteten sich fächerförmig darüber aus. Neben dem dicken Küchenbrett aus altem Olivenholz standen Schalen voller Kartoffeln mit Rosmarin und gebackenem Gemüse – Auberginen, Paprika, Zucchini. Schließlich trennte Albin das Fleisch vollständig vom Knochen ab und legte ihn neben den anderen. Es war bereits die zweite Keule.
»Wie ein Profi«, freute sich Berthe und lachte.
Berthe war Gerichtsmedizinerin. Sie kannte sich mit Fleisch und Knochen aus, weswegen Albin das Kompliment mit einem Lächeln annahm. Schließlich trat er einige Schritte vom Tisch zurück, um sich die Hände an einem Küchentuch abzuwischen, das auf dem Beistelltisch lag. Er beobachtete die Horde Raubtiere, die sich über das Gigot hermachte.
Da war zunächst Berthe, die stets eine knallrote Brille und kurzgeschnittene Haare trug. Ihr Mann war heute nicht dabei, sie hatte ihn wegen Krankheit entschuldigt. Wahrscheinlich hatte er einfach keine Lust auf die weite Strecke von Nîmes gehabt, wo Berthe mit ihm lebte und am Rechtsmedizinischen Institut der Universitätsklinik arbeitete, das für den Bezirk rund um Carpentras mit zuständig war. Berthe und Albin hatten viel und oft miteinander zu tun gehabt. Darüber war eine Art Freundschaft entstanden, wenngleich keiner von beiden das Wort verwenden würde: Man kannte sich gut, man war sich sympathisch. Basta. Berthe hatte außerdem eine Vorliebe für süße Backwaren, insbesondere für Schokocroissants. Albin hatte sie bereits mehr als einmal damit gewogen stimmen können und im Gegenzug Informationen erhalten.
Neben ihr saßen seine Tochter Manon und Veronique, die gerade damit befasst waren, den Gästen die Teller zu füllen. Manon lebte von ihrem psychopathischen Ehemann Gilles getrennt und zusammen mit ihrer Tochter Clara bei Albin in der Provence. Sie war aus Paris regelrecht zu ihm geflohen, nachdem sie endlich begriffen hatte, dass Gilles ein Irrer war – und zudem noch gewalttätig. Einige Jahre lang hatten sie und Albin keinen Kontakt miteinander gehabt, denn sie war sauer auf ihn gewesen. Zudem hatte Gilles es verstanden, jegliche Beziehung zwischen Vater und Tochter zu unterbinden. Nun war wiederum ihm jeder Kontakt zur Familie verboten, und er saß alleine in seinem Pariser Autohaus und beschäftigte Horden von Anwälten, um die anstehende Scheidung zu blockieren, die Manon kürzlich eingereicht hatte. Es war zum Verzweifeln. Bei Leuten wie Gilles kamen sogar Albin Mordgedanken.
Dann war da Theroux. Theroux war Polizist und über lange Jahre Albins Protegé gewesen. Obwohl er manchmal etwas schwer von Begriff war und regelrecht auf der Leitung zu sitzen schien, hielt Albin ihn für einen ausgezeichneten Polizisten. Theroux trug eine seiner verschossenen Jeans und dazu ein Polohemd, das mit Aufnähern und Emblemen regelrecht gepflastert war. Seine Pilotensonnenbrille hatte er ins gelockte Haar hochgeschoben, was Albin ziemlich affig fand. Aber immer noch besser als auf der Nase, denn dann glich er mit seiner übertriebenen Halskette und der anderen Kette an seinem rechten Handgelenk einem Pornostar aus den siebziger Jahren.
Neben ihm saß Sophie, seine Frau, die deutlich kleiner und schmaler war als Theroux, sozusagen petite. Sie hatte ein Sommerkleid an, trug die Haare zu einem Bubikopf geschnitten und wirkte extrem schlecht gelaunt, wenngleich sie sich offensichtlich Mühe gab, es anlässlich des kleinen Festes zu überspielen, um niemandem die Stimmung zu verderben. Vielleicht lag die üble Laune an ihrem Sohn Mathis, ein dürrer Schlaks, der inzwischen um die fünfzehn Jahre alt sein musste und ausschließlich mit seinem Handy befasst war. Ihr anderer Sohn, Jerome, war in Claras Alter. Die beiden saßen auf dem Rasen und schlürften Orangina durch Strohhalme. Manon hatte den beiden eine Decke gegeben, damit sie Picknick spielen konnten, wovon Clara deutlich begeisterter zu sein schien als Jerome. Das musste an seinem Alter liegen – davon träumen, ein cooler Ninja zu sein, und dann doch dazu verdammt sein, mit einem Mädchen auf einer geblümten Decke zu sitzen.
Castel saß neben Theroux. Die meisten nannten sie Cat, eine Abkürzung für Caterine. Sie war wenig größer als Sophie, aber deutlich drahtiger und kurzhaariger. Castel war im Streifendienst nach Carpentras gekommen, eine Art Strafversetzung aus Marseille, wo sie bei der Kriminalpolizei und außerdem im Backoffice einer Spezialeinheit tätig gewesen war. Mittlerweile hatte sie sich wieder nach vorn gearbeitet und schob keinen Dienst mehr in Uniform auf der Straße, sondern war wieder Ermittlerin und arbeitete mit Theroux zusammen. Sie hatte ihren Freund dabei, Jean Villeneuve, ein schlanker Mann um die Vierzig mit einer Nerd-Brille. Er war Kurator im Musée Granet in Aix-en-Provence. Eine Polizistin wie Castel, an deren Seele man Diamanten schleifen konnte, und ein Kunstwissenschaftler – wer hätte das gedacht? Albin vielleicht als Vorletzter und Castel als Allerletzte. Aber es schien mit beiden gut zu funktionieren, und darauf kam es schließlich an.
Unter dem Tisch, und damit nicht sichtbar, hielten sich Tyson und Mila auf. Mila war eine Mops-Dame. Castel und Villeneuve hatten sie sozusagen adoptiert, um sie vor dem Tierheim zu bewahren. Mila war schwarz wie die Nacht. Tyson eher hellbeige. Es war augenscheinlich, dass die beiden sich mochten. Albin konnte nicht einschätzen, ob sich Tiere einer Rasse, zudem Männchen und Weibchen, automatisch gut fanden, oder ob mehr dahintersteckte – sofern bei einem Mops überhaupt mehr dahinterstecken konnte, als seinem Instinkt zu folgen.
Schließlich war da noch Matteo und stopfte bereits die zweite Ladung vom Gigot in sich hinein. Er war ein kleiner, rundlicher, aber kräftiger und sehr behaarter Mann. Albin wusste nicht, wie alt Matteo war. Er schätzte, dass sie beide etwa im selben Alter sein mussten. Matteo führte das Café du Midi, war ein glühender Fan von Marine le Pen und dem im Süden Frankreichs sehr starken Front National, der hier inzwischen jede Menge Bürgermeister stellte. Matteo hatte sogar einmal überlegt, ob er bei den Kommunalwahlen für die Partei kandidieren sollte. Der Tag, an dem Matteo in die Politik gehen würde – rechts, links oder in der Mitte –, wäre jedenfalls der Tag, an dem Albin die Koffer packen und auswandern würde. Albin hatte keine Ahnung, ob er und Matteo Freunde waren. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sie kannten sich jedenfalls seit immer schon, und am Ende kannten sie einander vielleicht sogar besser, als Veronique Albin jemals kennen würde.
Unter Umständen galt das im umgekehrten Fall auch für Matteos Frau Iris, die neben ihm saß und sich blendend mit Veronique zu verstehen schien. Erstaunlich, dachte Albin, dass er Iris in all den Jahren nie persönlich getroffen hatte. Auch Iris stopfte sich, wie ihr Gatte, bereits die zweite Portion rein, wenn nicht sogar schon die dritte. Sie trug einen schwarzen Wickelrock zu einem roten T-Shirt und hatte – bizarrerweise – eine rote Nelke hinters Ohr gesteckt, was sie insgesamt wie eine Flamencotänzerin wirken ließ. Eine kleine, nicht mehr ganz junge Flamencotänzerin. Matteo redete nur selten über sie, und Albin hatte sogar eine Zeitlang geglaubt, Iris sei womöglich nur ein Hirngespinst von Matteo, denn – mal ganz ehrlich – wer wollte denn schon einen wie Matteo heiraten?
Aber ganz offensichtlich hatte das tatsächlich einmal jemand gewollt, nämlich Iris, die ähnlich geformt war wie ihr Mann, allerdings über deutlich weniger Haare auf den Unterarmen verfügte. Vielleicht, dachte Albin, trug sie auf den Zähnen dafür umso mehr. Wäre nicht verwunderlich, wenn sie sich gegen Matteo durchsetzen wollte. Jedenfalls war vollkommen klar, wer von den beiden in der Ehe die Hosen anhatte. Das hatte Albin bereits in den ersten fünf Minuten gespürt.
Sie hatte Veronique eben erklärt, dass sie deswegen nie im Café auftauchte und Matteo aushalf, weil sie seit Jahren als Altenpflegerin arbeitete und ständig Wechselschichten einlegte. Wie Albin weiter im Gespräch zwischen Veronique und Iris mitgehört hatte, war sie der Auffassung, dass sie sowieso nichts mit dem Café zu tun habe, weil sie Matteo bereits mit Café kennengelernt habe und das seine Sache sei. Er helfe ja auch nicht beim Windelwechseln von Bettlägerigen.
Iris lachte außerordentlich viel, derb und laut. Matteo neben ihr lachte heute Abend kaum, und wenn, dann nur zurückhaltend, um ihre außerordentlich gute Laune und ihr feuriges Temperament nicht noch anzufachen. Mit anderen Worten: Er wollte Iris auf gar keinen Fall später noch Flamenco tanzen sehen. Albin ebenfalls nicht.
Veronique war mit Iris ins Gespräch vertieft und bedeutete Albin mit einer Geste, dass er die dritte Haxe aus dem Ofen holen solle, noch bevor er sich selbst etwas auffüllen konnte. Also ging er in die Küche, um genau das zu tun. Dabei konnte schließlich nicht viel schiefgehen.
6
Vital Didier legte das Tablet zur Seite,