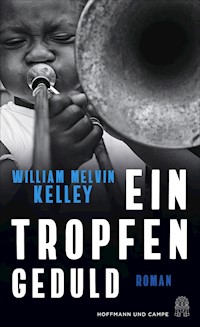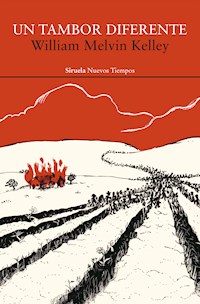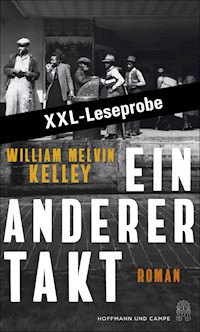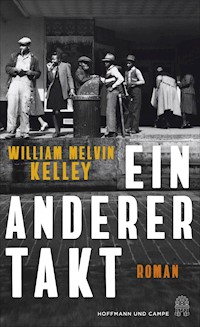
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der vergessene Gigant der amerikanischen Literatur" The New Yorker Die kleine Stadt Sutton im Nirgendwo der Südstaaten. An einem Nachmittag im Juni 1957 streut der schwarze Farmer Tucker Caliban Salz auf seine Felder, tötet sein Vieh, brennt sein Haus nieder und macht sich auf den Weg in Richtung Norden. Ihm folgt die gesamte schwarze Bevölkerung des Ortes. William Melvin Kelleys wiederentdecktes Meisterwerk Ein anderer Takt ist eines der scharfsinnigsten Zeugnisse des bis heute andauernden Kampfs der Afroamerikaner für Gleichheit und Gerechtigkeit. Fassungslos verfolgen die weißen Bewohner den Exodus. Was bringt Caliban dazu, Sutton von einem Tag auf den anderen zu verlassen? Wer wird jetzt die Felder bestellen? Wie sollen die Weißen reagieren? Aus ihrer Perspektive beschreibt Kelley die Auswirkungen des kollektiven Auszugs. Liberale Stimmen treffen auf rassistische Traditionalisten. Es scheint eine Frage der Zeit, bis sich das toxische Gemisch aus Wut, Verzweiflung und Hilflosigkeit entlädt. Mal mit beißendem Sarkasmus, mal mit überraschendem Mitgefühl erzählt hier ein schwarzer Autor vom weißen Amerika. Ein Roman von beunruhigender Aktualität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
William Melvin Kelley
Ein anderer Takt
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren
Mit einem Nachwort von Kathryn Schulz
Hoffmann und Campe
Den größeren Teil von dem, was meine Mitbürger gut nennen, halte ich innerlich für schlecht, und wenn ich irgendetwas bereue, so ist es höchstwahrscheinlich mein gutes Betragen. Von welchem Dämon war ich besessen, dass ich mich so gut benahm?
***
Wenn jemand mit seinen Gefährten nicht Schritt hält, so tut er es vielleicht deshalb nicht, weil er einen anderen Trommler hört. Lasst ihn zu der Musik marschieren, die er hört, wie immer ihr Takt und wie fern sie selbst auch sei.
Henry David Thoreau
Der Staat
Auszug aus dem Thumb-Nail Almanach, 1961, Seite 643:
… ein Bundesstaat im tiefen Süden, im Norden begrenzt durch Tennessee, im Osten durch Alabama, im Süden durch den Golf von Mexiko, im Westen durch Mississippi.
HAUPTSTADT: Willson City; FLÄCHE: 129921 km2; BEVÖLKERUNG (vorläufig, laut Zensus 1960): 1802268; MOTTO: Wir wagen es, mit Ehre und Waffen für unser Recht einzustehen; EINTRITT IN DIE UNION: 1818
Obwohl der Staat auf eine vielfältige und wechselhafte Geschichte zurückblickt, kennt man ihn hauptsächlich als Heimat des Generals der konföderierten Armee Dewey Willson, der 1825 in Sutton geboren wurde, einer Kleinstadt vierzig Kilometer nördlich der Hafenstadt New Marsails. Willson absolvierte 1842 die Militärakademie in West Point und stieg vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs bis zum Rang eines Obersten auf. Nach dem Austritt seines Heimatstaates aus der Union im Jahr 1861 gab er sein Offizierspatent zurück und wurde zum General der konföderierten Armee ernannt. Hauptsächlich ihm sind die beiden berühmten Siege der Konföderierten in den Schlachten bei Bull’s Horn Creek und Harmon’s Draw zu verdanken; die letztere wurde keine fünf Kilometer von seinem Geburtsort entfernt geschlagen. Willsons Sieg bei Harmon’s Draw vereitelte den Versuch der Unionstruppen, auf New Marsails zu marschieren und es einzunehmen.
Nach dem Wiedereintritt des Staates in die Union im Jahr 1870 wurde Willson Gouverneur. Wenig später bestimmte er den Ort, zeichnete, zu großen Teilen jedenfalls, den Plan und veranlasste den Bau der neuen Hauptstadt, die heute seinen Namen trägt. 1878 zog er sich aus dem öffentlichen Leben zurück und ließ sich in seiner Heimatstadt Sutton nieder. Am 5. April 1889 erlitt er nach der Einweihung einer drei Meter hohen Bronzestatue seiner selbst, die die Bürger von Sutton ihm zu Ehren hatten errichten lassen, einen Schlaganfall und verstarb. Er wird von den meisten Historikern als der nach Robert E. Lee bedeutendste General der Südstaaten angesehen.
Im Juni 1957 verließen aus noch ungeklärten Gründen sämtliche Neger den Staat. Heute ist er der einzige Bundesstaat, unter dessen Einwohnern sich kein einziger Neger befindet.
Der Afrikaner
Jetzt war es vorbei. Die meisten Männer, die auf der Veranda von Thomasons Lebensmittelgeschäft saßen oder standen, aufrecht oder angelehnt, waren am Donnerstag, als das alles angefangen hatte, draußen auf Tucker Calibans Farm gewesen, auch wenn keiner von ihnen, mit Ausnahme von Mister Harper vielleicht, gewusst hatte, dass es der Anfang von etwas gewesen war. Den ganzen Freitag und den größten Teil des Samstags hatten sie den Negern von Sutton zugesehen, die, mit oder ohne Koffer, am Ende der Veranda auf den stündlich verkehrenden Bus gewartet hatten, der sie über die Hügel im Osten und vorbei an Harmon’s Draw zum Bahnhof von New Marsails bringen würde. Aus dem Radio und den Zeitungen hatten sie erfahren, dass Sutton nicht der einzige Ort war, wo das passierte. In allen großen und kleinen Städten bis hin zum letzten Kaff benutzten die Neger alle verfügbaren Transportmittel, einschließlich ihrer eigenen Beine, um sich über die Staatsgrenze nach Mississippi, Alabama oder Tennessee zu begeben, wo manche (allerdings nur die wenigsten) sich sofort nach einem Dach über dem Kopf und Arbeit umsahen. Die Männer wussten auch, dass die meisten nicht gleich hinter der Grenze bleiben, sondern weiterziehen würden, bis sie irgendeinen Ort erreicht hatten, wo sie leben oder wenigstens in Würde sterben konnten, denn in der Zeitung hatten sie Bilder vom Bahnhof gesehen, wo alles voller Neger war, und die lange Karawane der mit Negern und ihrem Zeug vollgestopften Wagen auf der Landstraße zwischen Willson City und New Marsails hatte sie in der Überzeugung bestärkt, dass diese Leute das nicht auf sich nahmen, um nach bloß hundert Kilometern gleich wieder anzuhalten. Und sie hatten die Erklärung des Gouverneurs gelesen: »Es gibt keinen Grund zur Sorge. Wir haben sie nie gewollt, wir haben sie nie gebraucht, und wir werden sehr gut ohne sie zurechtkommen; der Süden wird sehr gut ohne sie zurechtkommen. Auch wenn unsere Bevölkerungszahl um ein Drittel verringert ist, werden wir prima zurechtkommen. Es sind noch immer genug gute Männer da.«
Das wollten alle glauben. Sie hatten noch nicht lange genug in einer Welt ohne schwarze Gesichter gelebt, um irgendeine Gewissheit zu haben, doch sie hofften, dass alles gut gehen würde, und versuchten sich einzureden, es sei jetzt wirklich vorbei, ahnten aber, dass es für sie jetzt gerade erst anfing.
Zwar hatte das Ganze hier seinen Anfang genommen, doch inzwischen war ihnen der Rest des Staates weit voraus: Sie hatten in sich noch nicht die Wut und Verbitterung gespürt, über die sie in der Zeitung gelesen hatten, sie hatten nicht versucht, die Neger aufzuhalten, wie es andere weiße Männer in anderen Städten getan hatten, die es als ihr Recht ansahen, schwarzen Händen die Koffer zu entreißen und Faustschläge zu verteilen. Ihnen war die entmutigende Feststellung erspart geblieben, dass solche Bemühungen vergeblich waren, oder vielleicht war ihnen diese Demonstration gerechten Zorns auch regelrecht verwehrt worden – Mister Harper hatte ihnen erklärt, dass die Neger sich ohnehin nicht aufhalten ließen, und Harry Leland war so weit gegangen zu sagen, sie hätten ein Recht darauf zu gehen –, und so wandten sie sich an diesem späten Samstagnachmittag, als die Sonne hinter den schmucklosen, ungestrichenen Gebäuden auf der anderen Seite der Landstraße unterging, wieder Mister Harper zu und mühten sich zum tausendsten Mal in drei Tagen, zu begreifen, wie es eigentlich angefangen hatte. Sie konnten nicht alles wissen, aber das, was sie wussten, enthüllte ihnen vielleicht einen Teil der Antwort, und sie fragten sich, ob an dem, was Mister Harper über die »Stimme des Blutes« gesagt hatte, vielleicht etwas dran war.
Mister Harper erschien gewöhnlich morgens um acht auf der Veranda, wo er seit zwanzig Jahren Hof hielt, und zwar in einem Rollstuhl, so alt und sperrig wie ein Thron. Er war pensionierter Army-Offizier. General Dewey Willson persönlich hatte ihn nach West Point empfohlen, und so war er nach Norden gegangen und hatte gelernt, Kriege zu führen, die zu führen er dann nie Gelegenheit bekommen hatte: Er war zu jung für den Bürgerkrieg, kam erst nach Kuba, als der Spanisch-Amerikanische Krieg längst vorbei war, und war zu alt für den Ersten Weltkrieg, in dem er seinen Sohn verlor. Der Krieg hatte ihm nichts gegeben, aber alles genommen. Vor dreißig Jahren war er zu dem Schluss gekommen, das Leben sei es nicht wert, dass man ihm stehend begegnete, denn es schlug einen ja doch bloß nieder, und so hatte er sich in den Rollstuhl gesetzt, betrachtete die Welt fortan von der Veranda aus und erklärte ihr willkürliches Wirken den Männern, die sich täglich um ihn scharten.
In all den Jahren hatte er diesen Stuhl vor den Augen der Welt nur einmal verlassen – und zwar am vergangenen Donnerstag, um sich Tucker Calibans Farm anzusehen. Jetzt saß er wieder wie festgewachsen, als hätte er sich nie erhoben. Das glatte weiße, in der Mitte gescheitelte Haar war lang und hing zu beiden Seiten seines Gesichts herab wie das einer Frau. Seine gefalteten Hände ruhten auf einem kleinen, aber ausgeprägten Bauch.
Thomason, der, weil es so wenig Kunden gab, eher selten in seinem Laden war, stand direkt hinter Mister Harper und lehnte an der schmutzigen Schaufensterscheibe. Bobby-Joe McCollum, kaum zwanzig und der jüngste der Gruppe, saß auf der Verandatreppe und rauchte eine Zigarre. Loomis, der ebenfalls zum Kern der Gruppe gehörte, saß auf einem Stuhl, den er nach hinten gekippt hatte. Er war auf der Universität in Willson gewesen, wenn auch nur drei Wochen lang, und fand Mister Harpers Erklärung für die Ereignisse zu unwahrscheinlich, zu einfach. »Also, ich kann das nicht glauben, dieses ganze Zeug von wegen Stimme des Blutes und so.«
»Was soll es denn sonst sein?« Mister Harper drehte sich zu Loomis um und blinzelte ihn durch die herabhängenden Haare an. Er sprach anders als die anderen Männer – seine Stimme war hoch und belegt, sie klang trocken und akzentuiert wie die eines Neuengländers. »Wohlgemerkt: Ich bin keiner von diesen abergläubischen Schwätzern, ich glaube nicht an Geister und so weiter. Für mich ist das rein genetisch: etwas Besonderes im Blut. Und wenn irgendjemand auf der Welt etwas Besonderes im Blut hat, dann Tucker Caliban.« Er senkte die Stimme, bis sie beinahe ein Flüstern war. »Ich sehe geradezu, wie es gewartet hat: Es hat geschlafen, und eines Tages ist es aufgewacht und hat Tucker tun lassen, was er getan hat. Kann gar nicht anders sein. Wir hatten nie irgendwelchen Ärger mit ihm, genauso wenig wie er mit uns. Aber auf einmal hat das Blut in seinen Adern aufbegehrt, und er hat diese … diese Revolution angefangen. Und mit Revolutionen kenne ich mich aus – das ist eine der Sachen, die sie uns in West Point beigebracht haben. Was meint ihr wohl, warum ich es so wichtig fand, dass ich von meinem Stuhl aufgestanden bin?« Er starrte über die Straße. »Es ist das Blut des Afrikaners! Ganz einfach.«
Bobby-Joe stützte das Kinn in die Hände. Er drehte sich nicht zu Mister Harper um, und so merkte dieser nicht gleich, dass der Junge sich über ihn lustig machte. »Von diesem Afrikaner hab ich schon mal gehört, und ich weiß auch, dass mir vor langer Zeit mal einer die Geschichte erzählt hat, aber ich kann mich ums Verrecken nicht erinnern, wie sie ging.« Mister Harper hatte sie schon viele, viele Male erzählt, zuletzt erst gestern. »Erzählen Sie doch mal, Mister Harper, damit wir verstehen, was das mit dem Ganzen hier zu tun hat. Na, wie wär’s?«
Mister Harper hatte inzwischen gemerkt, was los war, doch das machte nichts. Er wusste, dass manche der Männer fanden, er sei zu alt und solle eigentlich tot sein, anstatt sich jeden Morgen auf die Veranda schieben zu lassen, aber er erzählte die Geschichte eben gern. Trotzdem wollte er sich ein bisschen bitten lassen. »Ihr kennt diese Geschichte doch so gut wie ich.«
»Och, Mister Harper, wir wollen doch bloß, dass Sie sie uns noch mal erzählen.« Bobby-Joe sprach, als wäre der alte Mann ein kleines Kind. Einer, der hinter Mister Harper stand, lachte.
»Na, egal. Ich erzähle sie euch, ob ihr sie hören wollt oder nicht – nur um euch zu ärgern.« Er lehnte sich zurück und holte tief Luft. »Würde natürlich keiner behaupten, dass alles daran wahr ist.«
»Das ist wahr, wenn auch sonst nichts wahr ist.« Bobby-Joe zog an seiner Zigarre und spuckte aus.
»Vielleicht lässt du mich einfach erzählen.«
»Ja, Sir!«, sagte Bobby-Joe betont zackig, doch als er sich umsah, fand er in den beschatteten Gesichtern der anderen Männer keine Zustimmung; Mister Harper hatte sie bereits in seinen Bann geschlagen. »Ja, Sir.« Diesmal war es aufrichtig gemeint.
Wie gesagt, keiner würde behaupten, dass alles an dieser Geschichte wahr ist. Anfangs vielleicht schon, aber seitdem hat bestimmt der eine oder andere gedacht, er könnte die Wahrheit verbessern. Und da hatte er recht. Eine Geschichte ist viel besser, wenn sie halb erlogen ist. Ohne Lügen wird das nichts. Zum Beispiel die Sache mit Samson. Das war sicher nicht ganz so, wie man’s in der Bibel liest; irgendeiner hat sich wohl gedacht, wenn da einer ist, der ein bisschen stärker ist als die meisten anderen Männer, kann’s ja nicht schaden, ihn viel stärker zu machen. Und das ist wahrscheinlich das, was die Leute hier gemacht haben: Sie haben den Afrikaner genommen, der sowieso schon ziemlich groß und stark war, und haben ihn noch größer und stärker gemacht.
Ich würde sagen, sie wollten sichergehen, dass wir ihn nicht vergessen. Obwohl … wenn man’s bedenkt, gibt’s eigentlich keinen Grund, warum wir den Afrikaner vergessen sollten, auch wenn das alles schon ziemlich lange her ist, denn wie Tucker Caliban hat der Afrikaner für die Willsons gearbeitet, die die wichtigsten Leute hier in der Gegend waren. Nur dass die Willsons damals ein ganzes Stück beliebter waren als die heute. Sie waren nicht so hochnäsig wie unsere Willsons.
Aber hier geht’s ja nicht um die heutigen Willsons, sondern um den Afrikaner, und der gehörte dem Vater des Generals, Dewitt Willson. Dewitt hat’s zwar nicht geschafft, den Afrikaner zum Arbeiten zu bringen, aber gehört hat er ihm, so viel steht fest.
Das erste Mal kriegten die Leute in New Marsails – das damals noch New Marseille hieß, nach der Stadt in Frankreich – den Afrikaner an jenem Morgen zu sehen, an dem das Sklavenschiff, auf dem er war, in den Hafen einlief. Damals war es immer ein großes Ereignis, wenn ein Schiff kam, und alle liefen im Hafen zusammen, um es zu begrüßen; sie hatten’s auch nicht weit, denn die Stadt war damals nicht größer als Sutton heute.
Das Schiff legte an, die Segel wurden geborgen und festgemacht, und dann wurde die Gangway runtergelassen. Der Besitzer, der zugleich der größte Sklavenauktionator von New Marsails war – er konnte so gut und schnell reden, dass er sogar einen einarmigen, einbeinigen, schwachsinnigen Neger zu einem Spitzenpreis an den Mann bringen konnte –, spazierte an Bord. Mir wurde gesagt, dass er ein spindeldürres Männchen mit so gut wie gar keinen Muskeln war. Er hatte einen gerissenen Blick und eine runde, aufgequollene Nase, pockig wie eine faule Orange, und er trug immer einen altmodischen blauen Anzug mit spitzenbesetztem Kragen und eine Art Derby aus grünem Filz. Und hinter ihm, genau drei Schritte hinter ihm, ging ein Neger. Manche sagten, das war sein Sohn von einer farbigen Frau. Ich weiß nicht, ob das stimmte, aber ich weiß, dass dieser Neger aussah und ging und sprach wie sein Herr. Er hatte die gleiche Statur und die gleichen schlauen Augen und war sogar gleich gekleidet – mitsamt dem grünen Derby –, sodass die beiden wie das Negativ und der Abzug desselben Fotos waren, denn der Neger war braun und hatte krauses Haar. Er war der Buchhalter und Aufseher des Auktionators und außerdem alles, was man sich nur vorstellen kann. Die beiden gingen also an Bord, und der Neger hielt sich ein bisschen abseits, während der Auktionator dem Kapitän die Hand schüttelte, der an Deck stand und die Arbeit der Mannschaft überwachte. Damals hat man sich natürlich anders ausgedrückt als heute, und darum weiß ich nicht, was genau sie gesagt haben, aber ich nehme an, es war so was wie: »Hallo – wie war die Fahrt?«
Ein paar der Leute auf dem Kai fanden, dass der Kapitän irgendwie krank aussah. »Ganz gut«, sagte er. »Bis auf die Tatsache, dass wir diesmal einen richtig aufsässigen Scheißkerl dabeihaben. Wir mussten ihn in Ketten legen, getrennt von den anderen.«
»Dann wollen wir uns den mal ansehen«, sagte der Auktionator. Der Neger hinter ihm nickte. Das tat er immer, wenn der Auktionator was sagte, sodass es aussah, als wäre er ein Bauchredner und der Auktionator seine Puppe – entweder das oder umgekehrt.
»Noch nicht. Verdammt! Ich lass ihn raufbringen, wenn die ganzen anderen Nigger von Bord sind, dann können wir ihn alle zusammen bändigen. Verdammt!« Er wischte sich die Stirn, und wer gute Augen hatte, konnte den blauen Fleck dort sehen – als hätte ihn einer mit Wagenschmiere bespritzt und er hätte noch nicht die Zeit gehabt, es abzuwischen. »Verdammt!«, sagte er noch mal.
Na, da waren die Leute natürlich ziemlich gespannt, nicht bloß aus reinem Interesse wie sonst, sondern weil sie den Scheißkerl sehen wollten, der so viel Ärger machte.
Dewitt Willson war auch da. Nicht wegen dem Schiff oder weil er Sklaven kaufen wollte. Nein, er wollte nur seine Standuhr abholen. Er baute sich gerade ein neues Haus außerhalb von Sutton, und er hatte diese Uhr in Europa bestellt und wollte sie so schnell wie möglich haben, und am schnellsten ging es mit einem Sklavenschiff. Er wusste natürlich, dass es sieben Arten von Unglück bringt, Sachen auf einem Sklavenschiff zu transportieren, aber er hatte es so eilig, seine Uhr zu kriegen, dass er sie mit diesem Schiff hatte schicken lassen. Sie war in der Kajüte des Kapitäns, verpackt in einer mit Watte gepolsterten und festgezurrten Kiste. Und Dewitt war mit einem Wagen gekommen, um sie abzuholen, nach Hause zu fahren und seine Frau zu überraschen.
Dewitt und alle anderen standen da und warteten, aber erst ging die Mannschaft runter in den Laderaum, ließ die Peitschen knallen und trieb die Neger in einer langen Reihe raus. Den meisten Frauen hingen die Brüste bis auf die Bäuche, und einige hatten schwarze Kinder auf dem Arm. Die Gesichter der Männer waren finster verkniffen, als hätten sie in Zitronen gebissen. Fast alle Sklaven waren splitternackt und standen blinzelnd an Deck; sie hatten schon lange nicht mehr das Licht der Sonne gesehen. Der Auktionator und sein Neger gingen wie immer an der langen Reihe auf und ab, inspizierten Zähne und Muskeln und begutachteten gewissermaßen die Ware. Dann sagte der Auktionator: »Na, dann rauf mit dem Unruhestifter.«
»Auf keinen Fall, Sir!«, rief der Kapitän.
»Warum nicht?«
»Hab ich doch gesagt: Ich hol ihn erst rauf, wenn die anderen Nigger von Bord sind.«
»Tja, na gut«, sagte der Auktionator, sah aber nicht so aus, als würde er irgendwas verstehen. Und sein Neger auch nicht.
Der Kapitän rieb mit der Hand über den blauschwarzen Bluterguss. »Verstehen Sie nicht? Er ist ihr Häuptling. Wenn er das Kommando gibt, haben wir hier mehr Ärger als der liebe Gott Priester. Ich hatte jedenfalls schon genug!« Er rieb noch mal über die Stelle.
Die Matrosen trieben die Neger die Gangway hinunter, und die Leute am Kai traten beiseite und sahen zu. Diese Neger rochen sogar wütend, denn die waren da unten so zusammengepfercht gewesen, dass keiner mehr Platz hatte als ein Kind in der Krippe. Sie waren dreckig und wütend und bereit zu kämpfen, weshalb der Kapitän ein paar Männer mit Gewehren an Land schickte, damit sie ihnen Gesellschaft leisteten. Die anderen Matrosen, zwanzig oder dreißig, standen an Deck und traten von einem Bein aufs andere. Die Leute auf dem Kai wussten gleich, was los war: Die Matrosen hatten Angst. Man konnte es in ihren Augen sehen. All die großen, starken Männer hatten Angst vor dem, was da unten im Laderaum festgekettet war.
Auch der Kapitän sah irgendwie ängstlich aus, fummelte an dem Bluterguss herum, seufzte und sagte zu seinem Maat: »Na gut, dann geh runter und hol ihn.« Und zu den anderen: »Und ihr geht mit – alle. Vielleicht kriegt ihr das ja hin.«
Die Leute hielten den Atem an wie Kinder im Zirkus, wenn der Seiltänzer dran ist, denn selbst eine blinde, stocktaube alte Dame hätte gemerkt, dass im Laderaum irgendwas war, das gleich zum Vorschein kommen würde. Es wurde ganz still, und außer dem Klatschen der Wellen am Schiffsrumpf hörte man nur die Matrosen, die, allesamt in schweren Arbeitsschuhen, hinunter in den Laderaum trampelten und sich Zeit ließen, dem Ding da unten zu sagen, dass es an Deck erwartet wurde.
Auf einmal kam von irgendeinem finsteren Ort in den Tiefen des Schiffs ein Gebrüll, lauter als ein in die Enge getriebener Bär, lauter sogar als zwei Bären bei der Paarung. Es war so laut, dass sich die Bordwände nach außen wölbten. Und alle wussten, dass es aus einer einzigen Kehle kam, denn es waren nicht mehrere Stimmen, die sich vermischten, sondern bloß eine. Und dann war direkt vor ihren Augen und knapp über der Wasserlinie plötzlich ein Loch in der Bordwand, und Splitter flogen in hohem Bogen durch die Luft, wie wenn man eine Handvoll Kieselsteine in einen Teich wirft. Man hörte Kampfgeräusche, Poltern und Geschrei, und nach einer Weile kam einer an Deck gestolpert und blutete aus einer Kopfwunde. »Gottverdammich – er hat die Kette aus der Wand gerissen«, rief er. Alle starrten auf das Loch, und keiner merkte, dass der Matrose in diesem Augenblick an seiner Kopfverletzung starb.
Tja, ihr könnt euch vorstellen, wie sich die Leute auf dem Kai in Grüppchen zusammendrängten, zum Schutz für den Fall, dass dieses Ding im Laderaum sich irgendwie befreite und durch das friedliche Städtchen New Marsails tobte. Dann wurde es wieder ganz still, auch im Laderaum, und alle lauschten. Sie hörten Ketten klirren, und dann sahen sie den Afrikaner zum ersten Mal.
Als er die Treppe vom Laderaum zum Deck raufging, erschienen zuerst sein Kopf und die Schultern, so breit, dass er seitwärts gehen musste, dann kam der Rest des Körpers und hörte gar nicht mehr auf zu erscheinen. Schließlich stand er da, splitternackt bis auf einen Lendenschurz und mindestens zwei Köpfe größer als alle anderen an Deck. Er war schwarz und glänzte wie die Stelle auf der Stirn des Kapitäns. Sein Kopf war so groß wie die Kessel in Kannibalenfilmen und wirkte genauso schwer. Mit den vielen Ketten, die an ihm herabhingen, glich er einem geschmückten Weihnachtsbaum. Aber vor allem von seinen Augen konnten sie den Blick nicht wenden; sie lagen so tief in den Höhlen, dass sein Kopf aussah wie ein riesiger schwarzer Totenschädel.
Da war etwas unter seinem Arm. Zuerst dachten sie, dass es ein Tumor oder so war, und achteten nicht weiter darauf, aber dann bewegte es sich ganz von allein, und sie sahen, dass es Augen hatte, dass es ein Baby war. Jawohl, er hatte sich ein Kind unter den Arm geklemmt wie eine schwarze Lunchbox, und es drehte den Kopf und sah alle an.
Jetzt, da sie den Afrikaner sahen, wichen sie ein Stück zurück, als wäre der Abstand zwischen ihnen und ihm nicht groß genug, als könnte er den Arm über die Reling strecken und ihnen den Kopf vom Leib schnippen. Aber er war jetzt ganz ruhig, und er blinzelte auch nicht wie die anderen, sondern genoss die Sonne, als würde sie ihm gehören und als hätte er ihr befohlen, über ihm zu scheinen.
Dewitt Willson starrte ihn nur an. Schwer zu sagen, was er dachte, aber einige behaupteten, sie hätten ihn immer wieder murmeln hören: »Ich muss ihn haben. Er wird für mich arbeiten. Ich werde ihn brechen. Ich muss ihn brechen.« Sie sagten, er habe nur gestarrt und vor sich hin gemurmelt.
Und der Neger des Auktionators starrte ebenfalls, aber er murmelte nicht. Es hieß, er habe ausgesehen, als würde er den Afrikaner taxieren: Er musterte ihn von Kopf bis Fuß, rechnete – soundso viel für Kopf und Verstand, soundso viel für Statur und Muskeln, soundso viel für die Augen – und machte sich Notizen auf einem Zettel.
Der Kapitän rief den Matrosen an Land zu, sie sollten die Neger zur Versteigerung bringen, also zu dem kleinen Hügel in der Mitte von New Marsails, wo heute der Auktionsplatz ist. Einige Männer machten eine Gasse frei, und ein paar weitere gingen an Land und trieben die aneinandergeketteten Neger vor sich her. Ihnen folgten die Leute, die am Kai gestanden hatten und die es jetzt zur Auktion zog, weil sie sehen wollten, was der gängige Preis für einen guten Sklaven war – so wie die Leute heutzutage die Börsennachrichten lesen –, und, viel wichtiger noch, weil sie gespannt waren, wie viel der Afrikaner bringen würde. Erst als sie weg waren, kamen der Afrikaner und seine Eskorte, mindestens zwanzig Mann, von denen jeder eine Kette hielt, sodass der riesige Neger aussah wie ein Maibaum, umgeben von einem Kreis aus Männern, die einen gesunden Abstand zu ihm einhielten.
Als sie den Platz erreicht hatten, zerrte man die anderen Neger beiseite, und der Afrikaner und sein Gefolge stellten sich auf den Hügel. Woraufhin der Auktionator, dessen Neger auch jetzt drei Schritte hinter ihm stand, mit der Versteigerung begann:
»Meine Herrschaften, Sie sehen hier eines der großartigsten Besitztümer, die ein Mann sich nur wünschen kann. Beachten Sie Größe, Breite und Gewicht, beachten Sie die außergewöhnlich starken Muskeln und die edle Haltung. Es handelt sich um einen Häuptling – er hat also hervorragende Führungsqualitäten. Und wie Sie sehen, ist er sanft im Umgang mit Kindern. Er ist natürlich auch imstande zu zerstören, aber ich behaupte, das zeigt nur, wie gut er zupacken kann. Ich glaube, das, was ich hier sage, bedarf keines weiteren Beweises – sehen Sie ihn sich an, und Sie haben Beweis genug. Wenn ich ihn nicht schon besitzen würde und eine Farm oder Plantage hätte, würde ich die Hälfte meines Landes und alle meine Sklaven verkaufen und alles Geld zusammenkratzen, um ihn zu kaufen, damit er die andere Hälfte bearbeitet, aber ich besitze ihn schon und habe kein Land. Das ist mein Problem. Ich kann ihn nicht gebrauchen, ich muss ihn loswerden. Und da, liebe Freunde, kommen Sie ins Spiel. Einer von Ihnen muss ihn mir abnehmen, und für diesen Gefallen werde ich ihn bezahlen. Jawohl! Es soll niemand sagen, dass ich mich für einen Gefallen, den ein Freund mir tut, nicht erkenntlich zeige. Und zwar folgendermaßen: Der Käufer kriegt zwei zum Preis von einem, denn das Kind, das dieser Neger im Arm hat, lege ich noch drauf.«
(Einige sagen, sie hätten später rausgefunden, dass der Auktionator dieses Angebot machen musste, denn schon der Kapitän hatte versucht, dem Afrikaner das Kind wegzunehmen, und eins vor den Kopf gekriegt. Also konnte der Auktionator sie gar nicht separat verkaufen – dafür hätte er einen von beiden töten müssen.)
»Sie wissen, dass Sie damit ein gutes Geschäft machen«, fuhr er fort, »denn das Kind wird wachsen und so groß werden wie sein Vater. Stellen Sie sich das mal vor: Wenn dieser Mann zu alt zum Arbeiten ist, haben Sie hier sein verjüngtes Ebenbild, das an seine Stelle tritt.
Es ist Ihnen sicher nicht neu, dass ich nicht besonders gut bin, wenn es um Preise und Kosten und so weiter geht, aber grob geschätzt dürfte ein Arbeiter wie der hier wohl nicht unter fünfhundert Dollar kosten. Was meinen Sie, Mister Willson – glauben Sie, das ist er wert?«
Dewitt Willson gab keine Antwort. Er sagte gar nichts, griff in die Tasche, zog tausend Dollar in bar hervor, so gelassen, als würde er sich ein Stäubchen vom Anzug zupfen, ging den Hügel halb hinauf und gab dem Auktionator das Geld.
Der Auktionator schlug mit dem grünen Derby an sein Bein. »Verkauft!«
Keiner, nicht mal die Leute, die behaupten, sie wären dabei gewesen, kann genau sagen, was als Nächstes geschah. Es muss wohl so gewesen sein, dass die Matrosen, die die Ketten festhielten, nicht mehr so aufpassten, als sie das ganze Geld sahen, denn der Afrikaner drehte sich einmal um sich selbst, und schon hielt keiner mehr irgendwas fest, sondern hatte eine blutige Hand, weil die Kette durchgelaufen war wie ein Sägeblatt. Und jetzt hielt der Afrikaner die Ketten, alle Ketten, er hatte sie gerafft wie eine Frau die Röcke rafft, wenn sie in einen Wagen steigt, und ging auf den Auktionator los, als hätte er verstanden, was der Mann sagte und tat, was aber eigentlich nicht sein konnte, denn er war ja Afrikaner und sprach wahrscheinlich nur dieses afrikanische Kauderwelsch. Aber egal, er ging jedenfalls auf den Auktionator los, und manche Leute, wenn auch nicht alle, schwören, dass er ihn mit den Ketten geköpft hat und dass der Kopf mitsamt dem Derby wie eine Kanonenkugel ein paar Hundert Meter durch die Luft geflogen und dann noch ein paar Hundert Meter weit gehüpft ist und immer noch genug Schwung hatte, um einem Pferd, auf dem ein Mann nach New Marsails ritt, das Bein zu brechen. Der Mann kam in die Stadt und erzählte, dass er sein Pferd erschießen musste, weil ihm ein fliegender Kopf mit einem grünen Derby das Bein gebrochen hatte.
Dann passierten ein paar seltsame Dinge. Der Neger des Auktionators, der ein, zwei Schritte zurückgetreten war, als der Afrikaner sich losgerissen hatte, kümmerte sich gar nicht weiter um den geköpften Auktionator, sondern achtete nur darauf, dass kein Blut auf seinen Anzug spritzte. Er rannte zu dem Afrikaner, der bei dem taumelnden, aber noch immer aufrecht stehenden Leichnam stand, packte ihn am Arm, zeigte in eine Richtung und rief: »Da lang! Da lang!«
Ich nehme an, der Afrikaner verstand zwar nicht, was der Neger sagte, wohl aber, dass er ihm helfen wollte. Er rannte los, und der Neger folgte ihm, wie er dem Auktionator gefolgt war, mit drei Schritten Abstand. Der Afrikaner rannte den kleinen Hügel hinunter, obwohl er wohl an die dreihundert Pfund Ketten trug, und er schwang sie, brach sieben oder acht Leuten einen Arm oder ein Bein und bahnte sich und dem Neger einen Weg durch die versammelten Bürger von New Marsails. Manche griffen zum Gewehr und wollten auf ihn schießen, und vielleicht hätten sie ihn auch getroffen (was nicht heißen soll, dass das den Afrikaner gestoppt hätte), aber Dewitt Willson lief wie ein Verrückter den Hügel rauf, zwischen die Leute und die beiden fliehenden Neger, und schrie: »Er gehört mir! Ich bringe jeden vor Gericht, der auf mein Eigentum schießt!« Aber schon war der Afrikaner außer Schussweite und rannte nach Süden in die Sümpfe am Ende der Stadt. Also holten Dewitt und ein paar Männer Pferde und Gewehre und machten sich an die Verfolgung.
Der Afrikaner legte ein ziemliches Tempo vor (er hat wohl nicht nur das Kind und die Ketten, sondern auch den Neger getragen, denn sonst hätte das Bürschchen nicht mithalten können), und Dewitt und die anderen hätten vielleicht Mühe gehabt, ihn zu verfolgen, wenn er nicht geradewegs durch Wald und Sumpf gerannt wäre und eine Schneise aus ausgerissenen Sträuchern, Grasbüscheln und kleinen Bäumen gezogen hätte, in denen sich die Ketten verfangen hatten, und die direkt zum Meer führte. Sie war schnurgerade und so breit, dass zwei Pferde nebeneinanderher gehen konnten, und sie folgten ihr durch den Sumpf und über den Strand bis zum Wasser. Dort endete die Spur.
Die Männer meinten, der Afrikaner habe wohl versucht, zurück nach Afrika zu schwimmen (manche sagten, er hätte es trotz Ketten und Kind schaffen können), und der Neger des Auktionators sei jetzt wahrscheinlich allein auf der Flucht. Sie waren einigermaßen müde, wollten nach Hause und die ganze Sache vergessen, aber Dewitt war sicher, dass der Afrikaner nicht einfach weg war, jedenfalls nicht übers Meer, sondern dass er zurückkommen würde, und darum ließ er die Männer den Strand absuchen. Ein paar Hundert Meter weiter fanden sie zwei Paar Fußspuren, die in den Wald führten.
Für Dewitt Willson wurde es schwierig, die Männer dazu zu bringen, die Verfolgung seines Eigentums fortzusetzen. Zum einen wurde es dunkel. Zum anderen war die Spur jetzt nicht mehr so breit, denn der Afrikaner hatte die Ketten wohl gerafft, damit sie sich nicht irgendwo verfingen, so wie Mädchen beim Waten ihren Rock raffen. Da war es verständlich, dass die Männer nicht mehr ganz so eifrig waren, denn jetzt ging es darum, einen wilden Mann im Wald zu suchen, und zwar nachts, wo es bestenfalls schwierig sein würde, ihn zu sehen, und man nicht wusste, wo er war, und er jederzeit kommen und einem den Kopf abschneiden konnte, bevor man überhaupt wusste, dass er da war. Also kampierten sie am Strand. Ein paar Männer holten Decken und Proviant, und bei Tagesanbruch nahmen sie die Verfolgung wieder auf.
Mehr als diese eine Nacht aber brauchten der Afrikaner und der Neger des Auktionators nicht. Es wurde jetzt schwieriger denn je, ihn zu fangen, denn als die Verfolger nach ein, zwei Kilometern an eine Lichtung kamen, lag da im Sonnenlicht ein schimmernder Haufen aus zerbrochenen Steinen, Ketten und Schellen, von denen sich der Afrikaner in der Nacht befreit hatte. Jetzt also konnte er sich ungehindert bewegen und war irgendwo in der Gegend. Er war so groß und so schnell, dass niemand auch nur den leisesten Schimmer hatte, wo er gerade war, und den Leuten dämmerte langsam, dass er im Umkreis von hundertfünfzig Kilometern eigentlich überall sein konnte. Aber Dewitt ließ nicht locker und jagte sein Eigentum, jetzt mit weniger Männern, zwei Wochen lang, die halbe Strecke bis dahin, wo jetzt Willson City ist, und wieder zurück, dann an der Golfküste entlang bis fast nach Mississippi und in die andere Richtung bis nach Alabama, und nach und nach fanden die Männer, die noch bei ihm waren, dass er irgendwie seltsam wurde. Er schlief nicht, er aß nicht, saß vierundzwanzig Stunden am Tag auf seinem Pferd und führte Selbstgespräche. »Ich kriege dich … ich kriege dich … ich kriege dich …« Eines Tages, fast einen Monat nach der Flucht des Afrikaners – Dewitt war die ganze Zeit nicht zu Hause gewesen –, fiel er vor den Augen der Männer vom Pferd und wachte erst auf, als er auf einer Trage zu seiner Plantage gebracht worden war und dort noch eine Woche geschlafen hatte. Seine Frau erzählte den Leuten, dass er noch im Schlaf Selbstgespräche führte, und als er dann aufwachte, schrie er: »Aber ich auch! Ich bin auch tausend Dollar wert! Ich auch!«
Der Afrikaner änderte die Taktik.
Eines Nachmittags saßen Dewitt und seine Frau auf der Veranda. Er versuchte, wieder zu Kräften zu kommen, indem er in der Sonne saß und etwas Kühles trank. Und mit einem Mal kam der Afrikaner in bunten afrikanischen Gewändern, mit Schild und Speer über den Rasen auf das Haus zugerannt, als wäre er ein Zug und das Haus ein Tunnel, den er durchqueren wollte, und genau das tat er auch: vorn rein und zur Hintertür wieder raus und weiter zu den Sklavenbaracken, wo er jeden einzelnen von Dewitts Sklaven befreite und ins Dunkel des Waldes führte, bevor Dewitt auch nur sein Glas abstellen und aufstehen konnte.
Als wäre das nicht genug, passierte am nächsten Abend einem Mann, der östlich von New Marsails wohnte, fast dasselbe. Er kam in die Stadt und erzählte es allen: »Ich lag friedlich im Bett und schlief, als ich von draußen, bei den Sklavenhütten, ein Geräusch hörte. Und verdammt, als ich ans Fenster ging, sah ich, dass sich alle meine Nigger in den Wald davonmachten, und vorneweg rannte einer, der so groß war wie ein schwarzes Pferd, das sich auf die Hinterbeine stellt. Und da war noch ein anderer«, fuhr der Mann fort, »der immer ein paar Schritte hinter dem Großen war und mit den Armen gefuchtelt und meinen Niggern gesagt hat, was sie tun und wohin sie rennen sollen.«
Obwohl er noch nicht wiederhergestellt war, ritt Dewitt Willson in die Stadt. Bei der großen Versammlung, die zur Lösung des Problems einberufen worden war, meldete er sich zu Wort und sagte: »Ich schwöre, ich gehe nicht nach Hause ohne diesen Afrikaner oder das, was von ihm übrig ist. Und alle sollen wissen: Jeder, ob schwarz oder weiß, der mir Informationen gibt, die mir helfen, den Afrikaner zu fangen, ist am nächsten Tag um tausend Dollar reicher.« Die Nachricht verbreitete sich in der Gegend wie der Geruch von Kohlsuppe, rauf und runter, sodass man noch Jahre später, wenn man nach Tennessee kam und erwähnte, woher man war, gefragt wurde: »Und? Wer hat Willsons Tausend denn nun gekriegt?«
Dewitt Willson hielt Wort und machte sich wieder auf die Jagd nach dem Afrikaner. Er verfolgte ihn einen Monat lang durch den ganzen Staat. Manchmal war er nah dran, ihn zu kriegen, aber eben nicht nah genug. Zwar stellten er und seine Männer den Flüchtigen und seine Bande, die, weil man etliche getötet oder gefangen hatte, auf etwa ein Dutzend reduziert war, und es kam zur Schlacht, immer aber gelang es dem Afrikaner irgendwie zu entkommen. Einmal hatte er den Fluss im Rücken, und sie dachten schon, sie hätten ihn, doch er drehte sich einfach um, sprang hinein und tauchte davon, und zwar weiter, als irgendjemand einen Stein werfen kann. Den Neger des Auktionators bekamen sie ebenso wenig zu fassen. Er war immer in der Nähe, hielt das Kind, wenn der Afrikaner kämpfte, und verfolgte das Geschehen mit geldgierigen Augen, die unter dem grünen Derby hervorblitzten. Ja, genau, er hatte noch immer den Derby, wenn auch sonst nichts aus seinem früheren Leben, denn er trug jetzt, wie der Afrikaner, nur noch diese langen bunten Gewänder.
Wieder veränderte sich Dewitt. Es war wie damals, bevor er zusammengebrochen war: Er sprach mit keinem, nicht mal mit sich selbst, war die ganze Zeit finster und schweigsam. Und so ging es weiter: Der Afrikaner machte Überfälle und befreite Sklaven, und Dewitt Willson und seine Männer verfolgten ihn, fingen die meisten Sklaven wieder ein oder töteten sie und sorgten so dafür, dass die Bande nie aus mehr als zwölf, dreizehn entlaufenen Sklaven bestand. Den Afrikaner und den Neger des Auktionators aber kriegten sie nicht.
Eines Nachts hatten sie ihr Lager nördlich von New Marsails aufgeschlagen. Alle schliefen, außer Dewitt, der auf seinem Pferd saß und ins Feuer starrte. Plötzlich hörte er hinter sich eine Stimme, als würde der Geist des Auktionators zu ihm sprechen, aber der war’s natürlich nicht. »Sie wollen den Afrikaner? Ich bring Sie zu ihm.«
Dewitt fuhr herum. Da stand der Neger des Auktionators in seinem Gewand und mit dem Derby auf dem Kopf. Er war unbemerkt ins Lager geschlichen.
»Wo ist er?«, fragte Dewitt.
»Ich bring Sie hin. Ich geh zu ihm und geb ihm eine Ohrfeige, wenn Sie wollen«, sagte der Neger.
Dewitt war einverstanden. Später sagte er, er sei sich nicht sicher gewesen, ob es richtig war, dem Neger zu folgen, weil es ja auch ein Hinterhalt hätte sein können. Aber er sagte auch, er habe nicht geglaubt, dass der Afrikaner so was tun würde. Einige der Männer, die bei ihm waren, meinten, zu diesem Zeitpunkt sei er schon so verrückt gewesen, dass er alles getan hätte, um den Afrikaner zu fangen, dass er jedem Gott weiß wohin gefolgt wäre, um ihn endlich zu kriegen.
Also weckte Dewitt die anderen, und sie ließen sich von dem Neger führen. Nach nicht mal zwei Kilometern kamen sie an das Lager des Afrikaners. Es brannte kein Feuer, die Neger, ungefähr ein Dutzend, lagen ohne Decken auf dem nackten Boden und schliefen. Mitten auf der Lichtung, an einen riesigen Felsen gelehnt, saß der Afrikaner und hielt das Kind im Schoß. Er hatte den Kopf mit einem Tuch bedeckt, und vor ihm lag ein Haufen Steine, mit denen er leise zu sprechen schien.
Dewitt Willson verstand nicht, warum niemand den Afrikaner gewarnt hatte. Wie war es möglich, dass sie sich unbemerkt anschleichen konnten? Er beugte sich zu dem Neger und sagte: »Warum sind keine Wachen aufgestellt? Er weiß doch, dass ich in der Nähe bin. Warum gibt es keine Wachen?«
Der Neger grinste. »Es gab eine Wache – mich.«
»Warum tust du das? Warum verrätst du ihn?«
Wieder grinste der Neger. »Weil ich kein Wilder bin, sondern Amerikaner. Und außerdem: Ein Mann muss dem Ruf seines Geldbeutels folgen, stimmt’s?«
Dewitt Willson nickte. Manche sagen, er wäre beinahe umgekehrt und hätte darauf verzichtet, sich sein Eigentum auf diese Weise zurückzuholen, er wäre lieber am nächsten Morgen wieder hin geritten, wenn der Afrikaner längst weg gewesen wäre, und hätte ihn weiter gejagt, bis er ihn in einem fairen Kampf gefangen hätte, denn nach all den Wochen, in denen er den Afrikaner durch die Wälder gejagt, seine Spur verfolgt und gedacht hatte, diesmal würde er ihn vielleicht erwischen, nur um dann festzustellen, dass seine Chancen, ihn zu fangen, ungefähr so groß waren wie die eines Zwergs, der Basketballspieler werden will, nach all den Mühsalen, den langen Stunden im Sattel, dem schlechten Essen und den Nächten auf dem harten Boden war in ihm anscheinend so was wie Respekt für diesen Mann entstanden, und ich würde sagen, es machte ihn vielleicht ein bisschen traurig, dass es ihm nur deswegen gelungen war, sein Eigentum aufzuspüren, weil jemand, dem der Afrikaner vertraute, ihn verraten und die weißen Männer zu seinem Lager geführt hatte. Aber die anderen sahen das nicht so. Sie wollten den Afrikaner fangen, egal wie, denn sie wussten, er hatte sie an der Nase herumgeführt, und das sollte aufhören.
Also umzingelten sie das Lager, und Dewitt Willson forderte die Neger auf, sich zu ergeben. Die Weißen zündeten Fackeln an, damit der Afrikaner sah, dass er von Feuer, Pferden und Männern mit Gewehren umstellt war. Die Neger sprangen auf und sahen sofort, dass Gegenwehr zwecklos war, denn sie hatten nur afrikanische Waffen, und die ließen sie gleich fallen. Der Afrikaner aber sprang auf den Felsen, legte das Kind ab und warf einen Blick in die Runde, um zu sehen, mit wie vielen Gegnern er es zu tun hatte. Er war allein, das wusste er, denn alle anderen Neger hatten sich entweder in die Büsche geschlagen oder standen herum, als wären sie ihm noch nie begegnet und als könnte er genauso gut ein Papst aus dem dritten Jahrhundert sein.
Da stand er also auf dem Felsen, allein, im Feuerschein glänzend, fast nackt, und seine Augen waren schwarze Höhlen. Dann sprang er runter. Einer legte sein Gewehr an.
»Wartet!«, rief Dewitt. »Lasst uns versuchen, ihn lebend zu kriegen. Versteht ihr denn nicht? Das ist doch der Sinn der Sache: Wir wollen ihn lebend!« Er stand in den Steigbügeln und schwenkte die Arme, damit die anderen auf ihn hörten.
Einer der Männer verstand das als Aufforderung, den Helden zu spielen, und wollte den Afrikaner einfach über den Haufen reiten, aber der pflückte ihn vom Pferd, wie man sich beim Karussellfahren einen Ring schnappt, brach ihn wie einen trockenen Ast übers Knie und warf ihn beiseite.
»Wenn ihr schießt, dann auf Arme und Beine!«, schrie Dewitt.
Einer auf der anderen Seite des Kreises schoss, und sie sahen, dass die Kugel die Hand des Afrikaners durchschlug und neben Dewitts Pferd in den Boden fuhr, doch der Neger schien den Knall gar nicht mit irgendeinem Schmerz zu verbinden, nein, er zuckte nicht mal zusammen. Ein anderer traf ihn knapp über dem Knie, und das Blut lief an seinem Bein herunter. Es sah aus wie ein rotes Seidenband.
Mit dem Rücken zum Felsen, auf dem das Kind schlief, beschrieb der Afrikaner langsam einen Kreis und musterte jeden Einzelnen, auch den Neger des Auktionators, der neben Dewitt stand, aber sein Blick streifte ihn nur, und es war keine Wut oder Bitterkeit darin. Doch dann sah er zu Dewitt Willson und starrte ihn an, nein, die beiden starrten einander an, aber nicht, als wäre es ein Kampf, ein Kräftemessen, sondern als würden sie ohne Worte über irgendwas diskutieren. Und sie schienen schließlich zu einem Ergebnis gekommen zu sein, denn der Afrikaner verbeugte sich ganz leicht, wie ein Kämpfer vor dem Kampf, und Dewitt Willson hob das Gewehr, zielte auf den Kopf des Afrikaners und traf ihn genau über dem Ansatz seiner breiten Nase.
Er war getroffen, aber der Afrikaner stand einfach da. Schließlich sank er auf die Knie, dann nach vorn auf die Hände. Er schien zu schmelzen, und plötzlich sah er mit entsetztem Gesicht auf, als wäre ihm gerade was eingefallen, das er noch tun musste, und er stieß einen lauten Klageschrei aus und kroch auf das schlafende Kind zu. Das Blut lief ihm in die Augen, in der Faust hatte er einen großen Stein. Er hob ihn hoch, aber Dewitt Willson zerschmetterte ihm mit dem Gewehrkolben den Kopf, bevor er zuschlagen konnte. So starb der Afrikaner.