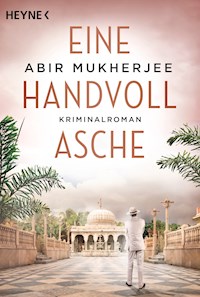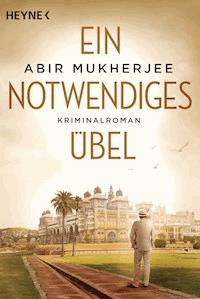9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sam-Wyndham-Serie
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem Endeavour Historical Dagger für den besten historischen Kriminalroman des Jahres
Kalkutta 1919 – die Luft steht in den Straßen einer Stadt, die im Chaos der Kolonialisierung zu versinken droht. Die Bevölkerung ist zerrissen zwischen alten Traditionen und der neuen Ordnung der britischen Besatzung.
Aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt, findet sich Captain Sam Wyndham als Ermittler in diesem Moloch aus tropischer Hitze, Schlamm und bröckelnden Kolonialbauten wieder. Doch er hat kaum Gelegenheit, sich an seine neue Umgebung zu gewöhnen. Denn ein Mordfall hält die ganze Stadt in Atem. Seine Nachforschungen führen ihn in die opiumgetränkte Unterwelt Kalkuttas – und immer wieder an den Rand des Gesetzes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 634
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
April 1919. In Black Town, jenem riesigen Teil Kalkuttas, in dem nur die indische Bevölkerung lebt, wird die Leiche eines weißen Mannes gefunden. Das allein ist schon ungewöhnlich. Doch noch seltsamer ist, dass es sich bei dem Ermordeten um einen engen politischen Berater des britischen Lieutenant-Governors handelt, des höchsten und mächtigsten Mannes in ganz Bengalen. Handelt es sich bei der Tat um einen Terrorakt der indischen Unabhängigkeitsbewegung? Captain Sam Wyndham, ein ehemaliger Scotland-Yard-Ermittler, der noch keine zwei Wochen in Indien weilt und große Schwierigkeiten hat, sich an das zerrissene Land und seine Gepflogenheiten zu gewöhnen, steht vor seinem ersten Mordopfer in Kalkutta.
Der Autor
Abir Mukherjee ist Brite mit indischen Wurzeln: Seine Eltern stammen aus Kalkutta und wanderten in den Sechzigerjahren nach England aus. Ein angesehener Mann ist Mukherjees Debütroman und schaffte auf Anhieb den Sprung auf die britischen Bestsellerlisten. Der Autor lebt mit seiner Familie in London.
ABIR MUKHERJEE
EIN
ANGESEHENER
MANN
Roman
Aus dem Englischen
von Jens Plassmann
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
In liebender Erinnerung an meinen Vater,
Satyendra Mohan Mukherjee
Kalkutta scheint voller »aufstrebender Männer« zu sein.
– Rudyard Kipling, City of Dreadful Night (1891)
1
Mittwoch, 9. April 1919
Immerhin war er gut angezogen. Schwarze Fliege, Smoking, das ganze Programm. Wenn man schon umgebracht wurde, konnte man sich dafür auch gleich richtig in Schale werfen.
Der Geruch schnürte mir die Kehle zu. Ich musste husten. In ein paar Stunden würde der Gestank selbst den Fischhändlern hier in Kalkutta den Magen umdrehen. Ich nahm ein Päckchen Capstan aus der Tasche, klopfte eine Zigarette heraus und ließ den köstlichen Rauch meine Lungen reinigen. In den Tropen riecht der Tod noch übler als sonst wo. Wie so vieles.
Ein kleiner, ausgemergelter Peon hatte ihn beim Herumstreunen entdeckt. Dem armen Schlucker war vor Schreck beinahe das Herz stehen geblieben. Sogar jetzt, eine Stunde später, zitterte er noch am ganzen Leib. Gefunden hatte er ihn in einer dieser Ecken, die von den Einheimischen Gullee genannt werden. Dunkle, auf drei Seiten von maroden Häusern eingefasste Sackgassen, in denen man den Kopf weit in den Nacken kippen musste, um über sich ein Stückchen Himmel sehen zu können. Der Kleine musste gute Augen haben, dass er ihn in der Dunkelheit überhaupt bemerkt hatte. Vermutlich war er einfach seiner Nase gefolgt.
Die Leiche lag verrenkt, mit dem Gesicht nach oben in einem offenen Abwasserkanal. Kehle durchschnitten, Arme und Beine unnatürlich abgewinkelt und ein großer brauner Blutfleck auf dem gestärkten weißen Smokinghemd. An einer Hand fehlten ein paar Finger, und ein Auge war aus der Höhle gehackt, wobei diese letzte Schändung wohl auf das Konto der mächtigen schwarzen Krähen ging, die auch jetzt noch auf den Dächern über uns bedrohlich Wache hielten. Alles in allem kein sonderlich würdevolles Ende für einen Burra Sahib.
Allerdings hatte ich schon schlimmere gesehen.
Dann war da noch das Schreiben. Ein zu einer Kugel zusammengerollter, blutverschmierter Zettel, den man ihm wie einen Flaschenkorken in den Mund gestopft hatte. Das war eine interessante Spielart, die ich so noch nicht erlebt hatte. Und wenn man schon alles gesehen zu haben glaubt, ist es nett, von einem Mörder überrascht zu werden.
Inzwischen hatten sich eine Menge Leute aus dem Viertel eingefunden. Es war eine kunterbunte Mischung aus Gaffern, Hausierern und Hausfrauen, die immer näher herandrängte, um einen Blick auf die Leiche zu erhaschen. Die Sache musste sich rasch herumgesprochen haben. Das tat sie immer. Mord ist auf der ganzen Welt ein Publikumsmagnet, und hier in Black Town hätte man Eintritt nehmen können für den Anblick eines toten Sahib. Ich verfolgte, wie Digby lautstark ein paar indische Constables anwies, gefälligst eine Absperrkette zu bilden. Die schrien ihrerseits prompt die Menge an, die mit höhnischen Kommentaren und Beleidigungen in fremder Zunge reagierte. Die Polizisten hoben fluchend ihre Bambus-Lathis und schlugen nach links und rechts aus, bis der Haufen sich langsam zurückbewegte.
Das Hemd klebte mir am Rücken. Noch nicht einmal neun Uhr, und schon war die Hitze selbst im Schatten der Gasse erdrückend. Ich kniete mich neben den Leichnam und tastete ihn ab. An der Innentasche der Smokingjacke spürte ich eine Wölbung, griff hinein und zog den Inhalt heraus. Eine schwarze Brieftasche, ein paar Schlüssel und Kleingeld. Die Schlüssel und die Münzen verstaute ich in einem Asservatenbeutel, die Brieftasche nahm ich genauer in Augenschein. Sie war alt, weich und abgenutzt, musste ursprünglich allerdings eine Stange Geld gekostet haben. Im Innern steckte die zerknitterte und ganz speckig gewordene Fotografie einer jungen Frau. Sie mochte in den Zwanzigern sein, und dem Stil ihrer Kleidung nach zu urteilen, war das Bild schon vor längerer Zeit aufgenommen. Ich drehte es um. Auf die Rückseite waren die Worte Ferris & Sons, Sauchiehall Street, Glasgow gestempelt. Ich schob das Foto in meine Tasche. Ansonsten war die Brieftasche mehr oder weniger leer. Kein Geld, keine Visitenkarten, nur ein paar Quittungen. Nichts, was zur Identifizierung des Mannes beigetragen hätte. Ich legte die Brieftasche zu den anderen Gegenständen in den Beutel und wandte meine Aufmerksamkeit dem Papierknäuel zu, das im Mund des Toten steckte. Ich zog ganz behutsam daran, um die Leiche nicht mehr als unbedingt nötig zu bewegen. Es löste sich sofort. Hochwertige Papiersorte. Schwer. Wie man sie in einem exklusiven Hotel finden würde. Ich glättete das Blatt. Einseitig beschriftet, drei Sätze. In schwarzer Tinte. Morgenländische Schriftzeichen.
Ich rief Digby zu mir, einen drahtigen blonden Sohn des Britischen Empire mit dominantem Militärschnauzer und der Ausstrahlung eines Mannes, dem das Befehlen im Blut lag. Auch wenn es bisweilen schwer erkennbar schien, war er mein Untergebener. Nach zehn Jahren Dienst in der Imperial Police Force zeichnete ihn ein versierter Umgang mit der einheimischen Bevölkerung aus, zumindest glaubte er selbst das. Er kam herüber und wischte sich die schweißige Hand am Uniformrock ab.
»Für einen Sahib schon ungewöhnlich, in dieser Gegend der Stadt ermordet aufgefunden zu werden«, sagte er.
»Ich hätte gedacht, es ist für einen Sahib ungewöhnlich, irgendwo in Kalkutta ermordet aufgefunden zu werden.«
Er zuckte mit den Schultern. »Täuschen Sie sich da mal nicht, alter Knabe.«
Ich reichte ihm den Zettel. »Was halten Sie davon?«
Nachdem er beide Seiten mit reichlich Getue untersucht hatte, antwortete er: »Scheint mir Bengali zu sein … Sir.«
Das letzte Wort spuckte er leicht verächtlich aus. Ich konnte es ihm nicht verdenken. Bei der Beförderung übergangen zu werden ist nie angenehm. Wenn der Posten dann auch noch an einen Außenstehenden geht, der gerade erst mit dem Schiff aus London eingetroffen ist, dürfte der Stachel richtig tief sitzen. Aber das war sein Problem. Nicht meins.
»Können Sie das lesen?«, fragte ich.
»Selbstverständlich kann ich das lesen. Es heißt: ›Keine weiteren Warnungen. Englisches Blut wird durch die Straßen strömen. Raus aus Indien!‹«
Er gab mir den Zettel zurück. »Sieht aus, als hätten wir es mit Terroristen zu tun«, sagte er. »Aber das ist selbst für die ganz schön dreist.«
Auf den ersten Blick lag er mit seiner Einschätzung vermutlich richtig, aber ich wollte erst alle Fakten kennen, bevor ich Schlussfolgerungen zog. Vor allem aber gefiel mir sein Ton nicht.
»Ich möchte, dass die gesamte Gegend abgesucht wird«, sagte ich. »Und ich möchte wissen, um wen es sich bei dem Opfer handelt.«
»Oh, wer das ist, weiß ich«, sagte er. »Der Mann heißt MacAuley. Alexander MacAuley. Ist ein hohes Tier drüben im Writers’.«
»Wo?«
Digby machte ein Gesicht, als hätte er plötzlich einen ekelhaften Geschmack im Mund. »Das Writers’ Building, Sir, ist der zentrale Verwaltungssitz für Bengalen und einen Großteil des restlichen Indiens. MacAuley zählt, besser gesagt, zählte, zu den leitenden Männern dort. Immerhin persönlicher Berater des Lieutenant-Governors. Womit es bloß noch stärker nach politisch motiviertem Mord riecht, habe ich recht, alter Knabe?«
»Setzen Sie einfach die Suche fort«, wies ich ihn seufzend an.
»Jawohl, Sir«, antworte er und salutierte. Nach einem kurzen Blick in die Runde fixierten seine Augen einen jungen indischen Sergeant, der konzentriert zu einem Fenster hinaufstarrte, das zu der Gasse hinausführte. »Sergeant Banerjee?«, rief Digby. »Hierher, bitte.«
Der indische Polizist wirbelte herum, nahm Haltung an, eilte dann herüber und salutierte.
»Captain Wyndham, darf ich vorstellen«, sagte Digby. »Sergeant Surrender-not Banerjee. Allem Anschein nach eine der hoffnungsvollsten Verstärkungen für His Majesty’s Imperial Police Force und der erste Inder, der die Aufnahmeprüfung unter den drei Besten abgeschlossen hat.«
»Bemerkenswert«, sagte ich. Zum einen, weil es das war, zum anderen, weil Digbys Ton vermuten ließ, dass er selbst nicht dieser Ansicht war. Dem Sergeant schien es einfach nur peinlich zu sein.
»Er und seinesgleichen«, fuhr Digby fort, »bilden die Früchte der Politik, mit der die hiesige Regierung die Zahl der Einheimischen in allen Behördenzweigen erhöhen möchte. Gott steh uns bei.«
Ich wandte mich um. Banerjee war ein schmaler, kleiner Kerl mit dieser Art von hübsch geschnittenen Gesichtszügen, die ihn auch mit vierzig noch jugendlich aussehen lassen würde. Das genaue Gegenteil zum typischen Bild vom grobschlächtigen Streifenpolizisten also. Er wirkte zugleich ernsthaft und extrem angespannt. Ein ordentlicher Seitenscheitel teilte das glatte, schwarze Haar, und die runde Metallbrille verlieh ihm einen gelehrten Ausdruck. Eher Poet als Polizist.
»Sergeant«, sagte ich. »Ich möchte, dass Sie Tatort und Umgebung akribisch absuchen lassen.«
»Natürlich, Sir«, antwortete er in einem Englisch, das perfekt auf einen Golfplatz in Surrey gepasst hätte. Er klang britischer als ich. »Sonst noch etwas, Sir?«
»Nur eins noch«, sagte ich. »Warum haben Sie so aufmerksam da hinaufgeblickt?«
»Ich habe eine Frau bemerkt, Sir.« Er zögerte. »Sie hat uns beobachtet.«
»Banerjee«, sagte Digby und fuchtelte mit dem Daumen in Richtung der Menschenmenge. »Dämliche Gaffer haben wir hier in Massen.«
»Ja, Sir, aber diese Frau wirkte verängstigt. Sie erstarrte, als sie mich sah, und verschwand sofort vom Fenster.«
»Okay«, sagte ich. »Sobald Sie die Spurensuche organisiert haben, gehen wir beide mal rüber und sehen nach, ob wir mit Ihrer Freundin ein wenig plaudern können.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, alter Knabe«, sagte Digby. »Es gibt da ein paar Dinge, was die Einheimischen und deren Gebräuche betrifft, die Sie wissen sollten. Beispielsweise reagieren sie manchmal komisch, wenn wir die Frauen in ihren Familien befragen wollen. Wenn man da reinplatzt, um irgendeine Frau zu vernehmen, hat man ruck, zuck den schönsten Aufstand an den Hacken. Es wäre vielleicht besser, die Sache mir zu überlassen.«
Banerjee trat unbehaglich von einem Bein aufs andere.
Digbys Miene verfinsterte sich. »Würden Sie gerne etwas dazu bemerken, Sergeant?«
»Nein, Sir«, sagte Banerjee entschuldigend. »Ich denke nur, dass dort niemand einen Aufstand verursachen wird, wenn wir hineingehen.«
Digbys Stimme bebte. »Und was macht Sie da so sicher?«
»Nun ja, Sir«, sagte Banerjee. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um ein Bordell handelt.«
Eine Stunde später standen Banerjee und ich in der Maniktollah Lane vor dem Eingang von Nummer 47. Es war ein marodes zweistöckiges Gebäude. Wenn an irgendetwas in Black Town kein Mangel herrschte, dann an maroden Gebäuden. Die Gegend schien komplett aus verwahrlosten alten Häusern zu bestehen, in denen es vor menschlichem Leben wimmelte. Digby hatte Bemerkungen fallen lassen über die erbärmlichen Zustände, unter denen die Einheimischen hausten, aber in Wahrheit besaß dieses Viertel auch eine pulsierende, verkommmene Schönheit, die sich nicht allzu sehr von Londoner Stadtteilen wie Whitechapel oder Stepney unterschied.
Das Haus war einst in fröhlichem Hellblau gestrichen worden, doch die Farbe hatte den Kampf gegen die unerbittliche Sonne und den Monsunregen längst verloren. Inzwischen waren nur noch ein paar ausgeblichene Reste übrig, wässrig blaue Flecken auf schimmelbedecktem graugrünem Putz – schwindendes Zeugnis glücklicherer Zeiten. An manchen Stellen war der Putz ganz abgefallen und hatte orangefarbenes Mauerwerk freigelegt, aus dessen Rissen Gräser wuchsen. Über uns ragten die Trümmer eines Balkons wie verrottete Zähne aus der Wand. Grüne Schlingpflanzen wucherten um die eiserne Brüstung.
Die Eingangstür bestand aus kaum mehr als einigen groben, schlecht zusammenpassenden Brettern. Auch hier war die Farbe längst verblasst und ließ das dunkle, wurmzerfressene Holz darunter durchschimmern.
Banerjee hob seinen Lathi und klopfte laut.
Im Innern blieb alles still.
Er sah mich an.
Ich nickte.
Er hämmerte erneut gegen die Tür. »Polizei! Aufmachen!«
Endlich drang gedämpft eine Stimme nach draußen.
»Aschee, aschee! Einen Moment!«
Geräusche. Füße schlurften in unsere Richtung. Dann fummelte offenbar jemand an einem Vorhängeschloss herum. Die dünne Holztür klapperte und öffnete sich einen Spalt. Vor uns stand, krumm wie ein Fragezeichen, ein schrumpeliger Alter mit silbergrauem Haarschopf. Pergamentdünne, braune Haut schlabberte um seine spindeldürre Gestalt und verlieh ihm das Aussehen eines fragilen, eingesperrten Vögelchens. Der alte Mann schaute zu Banerjee auf und verzog den Mund zu einem zahnlosen Lächeln.
»Ha, Baba, was möchtest du?«
Banerjee wandte sich zu mir. »Sir, es ist vielleicht einfacher, wenn ich es ihm in Bengali erkläre.«
Ich nickte.
Banerjee redete, aber der alte Mann schien ihn nicht zu verstehen. Der Sergeant wiederholte seine Worte, diesmal lauter. Die schmalen Brauen des alten Mannes zogen sich fragend zusammen. Allmählich änderte sich seine Miene, und das Lächeln kehrte zurück. Er verschwand, und wenig später schwang die Tür ganz auf. »Aschoon!«, sagte er zu Banerjee und dann zu mir gewandt: »Kommen Sie, Sahib. Kommen Sie, kommen Sie.«
Er schlurfte vor uns einen langen, düsteren Flur hinunter. Die Luft war kühl und roch stark nach Räucherstäbchen. Wir folgten ihm. Unsere Schuhe hallten auf dem polierten Marmorboden. Die Einrichtung war geschmackvoll, fast opulent, und stand in krassem Widerspruch zur schäbigen Fassade des Gebäudes. Es war, als würde man in London in Mile End eine Mietskaserne betreten und sich plötzlich im Innern einer Stadtvilla in Mayfair wiederfinden.
Der Alte blieb am Ende des Flurs stehen und bat uns in einen großen, gediegenen Salon. Rokoko-Sofas wechselten sich mit seidenbezogenen orientalischen Sitzkissen ab. Ein juwelenbehangener indischer Prinz auf einem weißen Streitross blickte stoisch aus einem gerahmten Bild, das an der gegenüberliegenden Wand über einer roten Samt-Chaiselongue hing. Ein riesiger grüner Punkah, ein Fächerwedel, mit den Ausmaßen eines Esstischs hing unbewegt von der Decke. Durch die Fenster zum Innenhof strömte Licht ins Zimmer.
Der Alte bedeutete uns zu warten und verschwand leise.
In einem Nebenraum tickte eine Uhr. Ich genoss die kurze Verschnaufpause. Auch nach über einer Woche hatte ich noch immer das Gefühl, mich nur langsam zu akklimatisieren. An der Hitze allein lag es nicht. Da war noch etwas anderes. Etwas Gestaltloses, schwer Bestimmbares. Eine Übelkeit in der Magengrube und eine nervöse Unruhe, die sich als Schmerz tief im Hinterkopf niederschlug. Kalkutta selbst schien seinen Tribut zu fordern.
Ein paar Minuten später öffnete sich die Tür, und eine Inderin mittleren Alters trat ein. Der alte Mann folgte ihr wie ein treues Hündchen. Banerjee und ich standen auf. Für ihr Alter war die Frau durchaus attraktiv. Zwanzig Jahre zuvor hätte man sie gewiss als Schönheit bezeichnet. Sie hatte eine vollschlanke Figur und kaffeefarbene Haut, die braunen Augen waren mit Kajal betont. Ihr Haar hatte sie in der Mitte gescheitelt und zu einem festen Knoten aufgesteckt. Auf ihrer Stirn prangte ein leuchtend roter Fleck. Sie trug einen hellgrünen Seidensari, dessen Saum mit goldenen Vögeln bestickt war, darunter eine Bluse aus grüner Seide, die ihren Bauch frei ließ. Mehrere goldene Reifen schmückten ihre Arme, und von ihrem Hals hing eine reich verzierte und mit zahllosen kleinen grünen Steinen besetzte Goldkette.
»Namaskar, meine Herren«, sagte sie und legte die Hände zur Begrüßung zusammen. Ihre Armreifen klingelten leise. »Bitte, setzen Sie sich doch.«
Ich warf Banerjee einen fragenden Blick zu. War dies die Frau, die er am Fenster gesehen hatte? Er schüttelte den Kopf.
Sie stellte sich als Mrs Bose und Besitzerin des Hauses vor.
»Wie mein Diener mir sagte, haben Sie einige Fragen.«
Sie trat zu der Chaiselongue und ließ sich elegant darauf nieder. Im selben Moment setzte sich der Punkah an der Decke in Bewegung und begann für einen angenehmen Luftzug zu sorgen. Mrs Bose drückte auf einen kleinen Messingknopf in der Wand. Lautlos erschien ein Hausmädchen in der Tür.
»Sie trinken doch einen Tee, oder?«, erkundigte sich Mrs Bose. Ohne unsere Antwort abzuwarten, wandte sie sich an das Mädchen und gab Anweisungen.
»Meena, chai.«
Das Mädchen verschwand so lautlos, wie sie gekommen war.
»Mein Name ist Captain Wyndham«, sagte ich. »Und dies ist Sergeant Banerjee. Sie dürften bereits davon gehört haben, dass es in der Gasse nebenan zu einem Zwischenfall gekommen ist, richtig?«
Sie lächelte höflich. »Angesichts des Lärms, den Ihre Beamten veranstalten, dürfte inzwischen wohl die ganze Para mitbekommen haben, dass sich, wie Sie es ausdrücken, ›ein Zwischenfall‹ ereignet hat. Vielleicht könnten Sie mich ja aufklären, was genau geschehen ist.«
»Ein Mann wurde ermordet.«
»Ermordet?«, wiederholte sie ausdruckslos. »Wie ungemein schockierend.«
Mir waren englische Frauen begegnet, die bereits bei der bloßen Erwähnung von Mord ihr Riechsalz benötigten, aber Mrs Bose schien aus robusterem Stoff zu sein.
»Verzeihen Sie mir, Gentlemen«, fuhr sie fort, »aber in diesem Teil der Stadt werden tagtäglich Menschen umgebracht. Ich kann mich nicht erinnern, jemals erlebt zu haben, dass deshalb die halbe Polizei Kalkuttas aufgetaucht und eine ganze Straße abgesperrt hätte. Und schon gar nicht, dass sich dafür auch noch ein britischer Officer interessiert hätte. Normalerweise wird der arme Teufel einfach zur Leichenhalle gekarrt, und damit hat es sich. Warum diesmal so viel Aufregung?«
Diesmal war ein Engländer ermordet worden, daher die ganze Aufregung. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie das bereits wusste.
»Ich muss Sie fragen, ob Sie vergangene Nacht aus dieser Gasse vielleicht irgendwelche unpassenden Geräusche gehört oder irgendetwas gesehen haben, Madam.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich höre jede Nacht unpassende Geräusche aus dieser Gasse. Besoffene, die sich streiten, oder heulende Hunde, aber wenn Sie mich fragen, ob ich gehört habe, wie ein Mann ermordet wurde, dann lautet die Antwort nein.«
Das klang überaus entschieden, was mich verblüffte, da Frauen aus der Mittelschicht und in ihrem Alter meiner Erfahrung nach meist nur allzu erpicht darauf waren, bei Morduntersuchungen zu helfen. Es brachte eine spannende Abwechslung in ihren Alltag. Einige waren so übereifrig in ihrem Wunsch, etwas Hilfreiches beizutragen, dass sie sämtlichen Klatsch mit einer Freude wiedergaben, als wäre es das Johannesevangelium. Das Verhalten von Mrs Bose schien einfach nicht normal für eine Frau, die gerade erfahren hatte, dass wenige Meter von ihrem Haus entfernt ein Mord verübt worden war. Irgendetwas verheimlichte sie, da war ich mir sicher. Was nicht heißen musste, dass es mit dem Mord in Verbindung stand. Die Behörden hatten in letzter Zeit so viele Verbote erlassen, da konnte sie sehr wohl etwas vollkommen anderes verbergen wollen.
»Hat es hier im Viertel kürzlich Treffen gegeben, die aufrührerischen Zielen dienten?«, fragte ich.
Sie betrachtete mich, als wäre ich ein besonders begriffsstutziges Kind. »Durchaus denkbar, Captain. Wir leben hier schließlich in Kalkutta. Eine Stadt mit einer Million Bengalen, die nichts Besseres zu tun haben, als ständig über Revolution zu reden. Ist das nicht der Grund, warum die Hauptstadt nach Delhi verlegt wurde? Besser in einem verschlafenen Nest, umgeben von gefügigen Punjabi, in der Wüstenhitze gebraten werden, als sich mit einem so furchtbar gefährlichen bengalischen Aufrührerpack herumschlagen zu müssen. Obwohl sie letztlich nie mehr tun als reden. Aber um Ihre Frage zu beantworten, nein, Treffen, die aufrührerischen Zielen dienten, habe ich nicht bemerkt. Nichts, was eine Verletzung Ihres wundervollen Rowlatt Act darstellen würde.«
Der Rowlatt Act. Die Beschlüsse waren einen Monat zuvor gefasst worden und erlaubten uns, jeden zu verhaften, der in dem Verdacht stand, terroristische oder revolutionäre Aktivitäten zu unterstützen. Bis zu zwei Jahre durften wir die Leute ohne Gerichtsbeschluss festsetzen. Aus Polizeisicht machte dies die Dinge hübsch unkompliziert. Die Inder dagegen waren natürlich erbost, was ich ihnen nicht verdenken konnte. Schließlich hatten wir eben noch einen Krieg im Namen der Freiheit geführt, und jetzt fingen wir hier damit an, Leute ohne richterliche Anordnung zu verhaften und wegzusperren, nur weil wir irgendetwas an ihnen verdächtig fanden, weil sie sich womöglich unerlaubt in der Öffentlichkeit versammelten oder einen Engländer schief angesehen hatten.
Mrs Bose erhob sich. »Es tut mir leid, Gentlemen. Ich kann Ihnen wirklich nicht weiterhelfen.«
Es wurde Zeit, die Sache anders anzugehen.
»Vielleicht überdenken Sie das noch einmal, Mrs Bose«, sagte ich. »Der Sergeant hier hat einen Verdacht geäußert hinsichtlich der Art von Etablissement, die Sie in diesem Haus führen. Ich bin zwar der Meinung, dass er sich irrt, aber natürlich könnte ich in weniger als einer halben Stunde ein Zehn-Mann-Team von der Sittenpolizei hier haben, um herauszufinden, wer von uns beiden recht hat. Vermutlich würden sie den ganzen Laden auf den Kopf stellen und Sie anschließend auch noch zur Befragung ins Lal Bazar mitnehmen. Die Kollegen könnten sogar auf die Idee kommen, Sie ein oder zwei Nächte im Zellentrakt verbringen zu lassen, quasi auf ganz besondere Einladung des Vizekönigs … Oder aber Sie zeigen uns ein wenig Entgegenkommen.«
Sie lächelte mich an. Eingeschüchtert wirkte sie nicht, was einigermaßen verwunderlich war. Allerdings wählte sie ihre nächsten Worte mit Bedacht. »Captain Wyndham, mir scheint, es ist ein … missverständlicher Eindruck entstanden. Selbstverständlich bin ich mit Freuden bereit, Ihnen zu helfen, wo ich nur kann. Aber ich habe in der vergangenen Nacht wirklich nichts Auffälliges gesehen oder gehört.«
»Wenn dem so ist«, sagte ich, »haben Sie gewiss nichts dagegen, wenn wir mit jedem sprechen, der sich im betreffenden Zeitraum noch in diesem Haus aufhielt.«
Die Tür öffnete sich, und das Hausmädchen trat ein mit einem Silbertablett, das sämtliche Zutaten für eine gutbürgerliche Teerunde offerierte. Sie stellte alles neben ihre Herrin auf ein Mahagonitischchen und verließ den Raum.
Mrs Bose nahm die Kanne und ein edles silbernes Teesieb und füllte drei Tassen. »Selbstverständlich, Captain«, erklärte sie. »Sie können sprechen, mit wem Sie wollen.«
Erneut drückte sie auf den Messingknopf in der Wand, und das Hausmädchen kehrte zurück. Es folgte ein knapper Austausch in fremder Sprache, bevor das Mädchen wieder verschwand.
Mrs Bose wandte sich an mich. »Und Sie, Captain? Sie müssen neu sein in Indien. Wie lange sind Sie denn schon hier?«
»Ist das wirklich so offenkundig?«
Mrs Bose lächelte. »Aber ja. Erstens weist Ihr Gesicht einen interessanten Pinkton auf, was vermuten lässt, dass Sie die wichtigste Alltagsregel noch nicht gelernt haben: zwischen zwölf und vier nie nach draußen zu gehen. Zweitens fehlt Ihnen noch dieses großspurige Auftreten, das Ihre Landsmänner Indern gegenüber gerne demonstrieren.«
»Tut mir leid, Sie zu enttäuschen«, sagte ich.
»Das braucht es nicht«, erwiderte sie leichthin. »Ich bin mir sicher, das kommt mit der Zeit.«
Bevor ich antworten konnte, öffnete sich die Tür, und vier schlanke junge Frauen betraten den Raum, gefolgt von dem Hausmädchen und dem alten Mann, der uns eingelassen hatte. Ihrem leicht zerzausten Aussehen nach zu urteilen, waren die Mädchen gerade aus dem Schlaf gerissen worden. Im Unterschied zu Mrs Bose war keine von ihnen geschminkt, aber alle besaßen eine große natürliche Schönheit. Sie trugen einfache Baumwollsaris in verschiedenen Pastelltönen.
»Captain Wyndham«, sagte Mrs Bose, »darf ich Sie mit den Angehörigen meines Hausstands bekannt machen?« Sie deutete auf den alten Mann. »Ratan kennen Sie ja bereits. Und auch Meena, mein Hausmädchen. Die anderen hier sind Saraswati, Lakshmi, Devi und Sita.« Jedes Mädchen faltete die Hände zur Begrüßung zusammen, sobald sein Name fiel. Sie schienen nervös zu sein. Das war nicht anders zu erwarten. Auch in London reagierten die meisten jungen Prostituierten nervös, wenn sie von einem Kriminalbeamten vernommen wurden. Nicht alle, aber die meisten.
»Meine Angestellten sprechen nicht durchweg Englisch«, fuhr Mrs Bose fort. »Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich Ihre Fragen in Hindi übersetze?«
»Warum Hindi und nicht Bengali?«, fragte ich.
»Weil Kalkutta, mein lieber Captain, zwar die Hauptstadt von Bengalen ist, viele Einwohner aber trotzdem keine Bengalen sind. Sita hier stammt aus Orissa und Lakshmi aus Bihar. Hindi dient hier als Lingua franca, könnte man sagen.« Sie lächelte, amüsiert über ihre eigene Redewendung, und deutete auf Banerjee. »Spricht Ihr Sergeant denn kein Hindi?«
Ich sah ihn an.
»Mein Hindi ist ein wenig eingerostet, Sir«, antwortete er. »Aber ansonsten ganz passabel.«
»Na, wunderbar, Mrs Bose«, sagte ich. »Dann fragen Sie doch bitte, ob jemand vergangene Nacht in der Gasse irgendetwas Auffälliges gehört oder beobachtet hat.«
Mrs Bose gab die Frage an ihre Angestellten weiter. Der Alte schien sie nicht zu verstehen, weshalb sie ihre Worte lauter wiederholte. Ich sah zu Banerjee, der seinen Blick fest auf Devi gerichtet hielt.
Einer nach dem anderen antwortete: »Nahin.«
Das überzeugte mich nicht. »Sieben Menschen waren letzte Nacht im Haus, und keiner von Ihnen hat etwas gesehen oder gehört?«
»Anscheinend nicht«, sagte Mrs Bose.
Ich betrachtete sie der Reihe nach aufmerksam. Ratan, der alte Mann, war vermutlich zu taub, um etwas gehört zu haben. Das Hausmädchen, Meena, hätte etwas mitbekommen können, aber ihre Körpersprache machte nicht den Eindruck, als würde sie etwas verheimlichen. Mrs Bose selbst war viel zu clever, um etwas preiszugeben. In ihrer Branche lernt eine Frau sehr schnell, wie man mit unangenehmen Nachforschungen der Polizei umgeht. Anders bei den vier Mädchen. Sie hatten sich wahrscheinlich die ganze Nacht um Kunden gekümmert. Eine von ihnen konnte also leicht etwas beobachtet haben. Und sie waren gewiss nicht so routiniert wie Mrs Bose darin, es vor mir zu verbergen.
Ich wandte mich an Banerjee. »Sergeant, bitte wiederholen Sie die Fragen noch einmal bei jedem einzelnen der vier Mädchen.«
Er folgte meiner Anweisung. Ich behielt die Mädchen bei ihren Antworten scharf im Auge. Saraswati und Lakshmi sagten beide sofort: »Nahin.« Devi zögerte eine Sekunde und senkte den Blick, bevor sie ebenfalls mit »Nahin« antwortete. Dieses Zögern war alles, was ich brauchte.
Banerjee stellte auch dem letzten Mädchen seine Frage, aber ihre knappe Antwort ließ keine verdächtigen Anzeichen erkennen. Devi war diejenige, mit der wir uns unterhalten mussten. Allerdings nicht jetzt und nicht hier. Wir mussten allein mit ihr reden.
»Es sieht leider so aus, als könnten wir Ihnen nicht weiterhelfen, Captain«, sagte Mrs Bose.
»Ja, scheint so«, erwiderte ich und erhob mich vom Sofa. Banerjee tat es mir nach. Sollte Mrs Bose erleichtert sein, ließ sie es sich jedenfalls nicht anmerken. Gelassen wie eine Lotusblume auf einem See. Ich unternahm einen letzten Versuch, sie aus der Ruhe zu bringen. »Erlauben Sie mir noch eine abschließende Frage?«
»Natürlich, Captain.«
»Wo ist Mr Bose?«
Sie lächelte verschmitzt. »Ach, kommen Sie, Captain. Ihnen muss doch klar sein, dass es in meinem Beruf bisweilen notwendig ist, nach außen hin den Anschein von Ehrbarkeit zu pflegen. Verheiratet zu sein, auch wenn der Ehemann nie in Erscheinung tritt, erleichtert erfahrungsgemäß die Vermeidung vieler kleiner Alltagsproblemchen.«
Wir verließen das Haus und traten wieder hinaus in die sengende Hitze. Die Leiche war noch immer da, lag nur inzwischen unter einer schmutzigen Plane. Eigentlich hätte sie längst abtransportiert sein sollen. Ich sah mich nach Digby um, konnte ihn aber nirgends entdecken.
Die Gasse war ein einziger Glutofen, was auf die Zahl der Gaffer jedoch keinen großen Einfluss hatte. Im Gegenteil, sie schien noch angewachsen zu sein. Dicht gedrängt standen sie in Trauben unter großen schwarzen Schirmen. In Kalkutta führte offenbar jeder ständig einen Schirm mit sich, allerdings nur als Schattenspender, nicht als Regenschutz. Ich nahm mir vor, den Ratschlag von Mrs Bose zu beherzigen und künftig spätestens um zwölf in geschlossenen Räumen zu sein.
Aus der Ferne war eine Sirene zu hören, und wenig später bahnte sich ein olivgrüner Krankenwagen seinen Weg durch die Menschenmenge in der schmalen Straße. Vorneweg fuhr ein Constable auf einem Fahrrad und schrie die Leute an, zur Seite zu treten. Als er die Absperrkette erreichte, stieg er ab, lehnte das Rad an eine Mauer und kam rasch auf mich zu.
Er salutierte. »Captain Wyndham, Sir?«
Ich nickte.
»Ich habe eine Nachricht für Sie, Sir. Commissioner Taggart wünscht dringend Ihre sofortige Anwesenheit.«
Lord Charles Taggart, Commissioner der Polizei. Seinetwegen war ich in Bengalen.
Ich dankte dem Constable, der gleich wieder zu seinem Rad zurückeilte. Der Krankenwagen hatte inzwischen an der Absperrkette angehalten, und zwei indische Sanitäter waren ausgestiegen. Sie sprachen mit Banerjee, hoben dann den Leichnam auf eine Trage und verstauten ihn in der Ambulanz.
Ich hielt erneut Ausschau nach Digby. Als ich ihn nirgendwo sah, bat ich Banerjee, mich zu begleiten, und wir gingen gemeinsam zu dem Wagen, der am Eingang der Gasse stand. Der Fahrer, ein großer Sikh mit Turban, salutierte und öffnete die Fondtür.
Während wir uns durch die engen, überfüllten Straßen von Black Town schlängelten, blieb der Fahrer mit der Hand auf der Hupe und brüllte allen Fußgängern, Rikschas und Ochsenkarren, die uns den Weg versperrten, wüste Drohungen zu. Ich wandte mich an Banerjee. »Woher wussten Sie, dass es sich bei dem Haus um ein Bordell handelt, Sergeant?«
Er lächelte schüchtern. »Ich habe ein paar der Anwohner nach den Gebäuden ringsum befragt. Eine Frau war nur zu begierig darauf, mir mitzuteilen, was in Nummer 47 vor sich geht.«
»Und unsere Mrs Bose? Was halten Sie von ihr?«
»Interessante Frau, Sir. Und zweifellos keine glühende Verehrerin der Briten.«
Er hatte recht. Aber das hieß noch lange nicht, dass sie in die Sache verwickelt war. Schließlich war sie eine Geschäftsfrau, und ich hatte die Erfahrung gemacht, dass solche Leute wenig Zeit für Politik hatten. Es sei denn natürlich, es brachte ihnen Profit ein.
»Welche Frau haben Sie denn im Fenster bemerkt?«
»Es war die, die sie Devi nannte.«
»Halten Sie das nicht für ihren wahren Namen?«
»Völlig ausgeschlossen ist es nicht, Sir. Aber Devi heißt die Allgöttin, und auch die anderen drei hatten alle Namen von Hindu-Göttinnen. Das dürfte in meinen Augen kein Zufall sein. Und soweit ich weiß, ist es für solche Mädchen durchaus üblich, unter falschem Namen zu arbeiten.«
»Wie wahr, wie wahr, Sergeant«, sagte ich und merkte nüchtern an: »Sehr beeindruckende Milieukenntnisse, ich gratuliere.«
Die Ohren des jungen Mannes liefen rot an.
»Und Sie glauben also, dass sie etwas gesehen hat?«, fuhr ich fort.
»Sie hat es verneint, Sir.«
»Ja, aber was denken Sie?«
»Ich denke, sie lügt, und, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ich denke, den Eindruck hatten auch Sie, Sir. Ich verstehe nur nicht, warum Sie das Mädchen nicht eingehender befragt haben.«
»Geduld, Sergeant«, sagte ich. »Für alles gibt es die richtige Zeit und den richtigen Ort.«
Mittlerweile hatten wir die Chitpore Road am Rand von White Town erreicht, wo die breiten Alleen von imposanten Villen gesäumt wurden. Hier wohnten die reichen Kaufherren, die mit allem handelten, was Gewinn versprach, von Baumwolle bis Opium.
»Ungewöhnlicher Name, ›Surrender-not‹«, sagte ich.
»Das ist nicht mein wirklicher Name, Sir«, antwortete Banerjee. »Eigentlich heiße ich ›Surendranath‹. Das ist einer der Namen von Indra, dem König der Götter. Leider fiel Sub-Inspector Digby die Aussprache wohl so schwer, dass er mich stattdessen lieber ›Surrender-not‹ taufte.«
»Und was sagen Sie dazu, Sergeant?«
Banerjee rutschte nervös auf seinem Sitz hin und her. »Sturkopf ist nicht das Schlimmste, was ich in meinem Leben genannt worden bin, Sir. Zieht man in Betracht, dass viele Ihrer Landsleute von Natur aus nicht in der Lage sind, einen fremdländischen Namen auszusprechen, der aus mehr als einer Silbe besteht, dann ist ›Surrender-not‹ gar nicht so schlecht.«
Wir fuhren eine Weile weiter, ohne zu reden, aber das Schweigen wurde bald unangenehm. Außerdem wollte ich diesen jungen Mann gerne besser kennenlernen, da er, abgesehen von Dienstpersonal und kleinen Beamten, so ziemlich der erste richtige Inder war, dem ich seit meiner Ankunft begegnete. Also fragte ich ihn nach seinem Werdegang.
»Ich bin in Shyambazar aufgewachsen«, erzählte er. »Anschließend Internat und Studium in England.«
Sein Vater war Anwalt in Kalkutta und hatte seine drei Söhne alle zur Schulausbildung nach England geschickt. Erst in die Harrow School, dann auf irgendein Oxbridge College. Banerjee war der jüngste. Von seinen älteren Brüdern war einer in die Fußstapfen seines Vaters getreten, hatte Jura studiert und war an der Anwaltskammer Lincoln’s Inn in London zugelassen. Aus dem anderen war ein renommierter Arzt geworden. Für Banerjee hatte sich sein Vater eigentlich eine Karriere im Indian Civil Service auf höchster indischer Verwaltungsebene vorgestellt, aber trotz der prestigeträchtigen Aussichten hatte sich der junge Mann nicht damit anfreunden können, seine Tage mit dem Zählen von Büroklammern zu verbringen. Stattdessen beschloss er, Polizist zu werden.
»Wie hat Ihr Vater darauf reagiert?«, fragte ich.
»Besonders glücklich ist er nicht darüber«, antwortete er. »Er unterstützt die Home-Rule-Bewegung für die Selbstverwaltung Indiens. Er denkt, durch meinen Eintritt in die Imperial Police Force würde ich den Briten bei der Erniedrigung meines eigenen Volkes Hilfestellung leisten.«
»Und was denken Sie?«
Banerjee überlegte einen Moment, bevor er antwortete. »Meiner Meinung nach werden wir eines Tages tatsächlich die Selbstverwaltung erreichen, Sir. Vielleicht ziehen die Briten sogar vollständig ab. So oder so wird mit diesem Einschnitt aber gewiss nicht automatisch eine Zeit des allgemeinen Friedens und der Eintracht unter meinen Landsleuten anbrechen, ganz egal, wie Mr Ghandi darüber denken mag. Es wird auch dann noch Morde in Indien geben. Sollten Sie sich also irgendwann verabschieden, Sir, werden wir Inder die Fähigkeit besitzen müssen, die Lücken zu füllen, die Sie hinterlassen. Das gilt für die Verbrechensbekämpfung wie für alle anderen Bereiche.«
Wie das leidenschaftliche Bekenntnis zum Empire, das ich von einem Polizisten erwartet hätte, klang das nicht unbedingt. Als Engländer geht man unwillkürlich davon aus, dass die Einheimischen entweder für oder gegen einen sind und dass diejenigen, die der Imperial Police Force beitreten, gewiss zu den loyalsten gerechnet werden können. Schließlich dienen sie der Aufrechterhaltung des Systems. Dass zumindest dieser Sergeant hier eine etwas zwiespältige Haltung in dieser Frage einnahm, wirkte irgendwie beunruhigend.
Meine erste Woche in Kalkutta hatte bereits für so manche Verunsicherung gesorgt, wie ich eingestehen musste. Indern war ich schon vorher begegnet, und im Krieg hatte ich sogar Seite an Seite mit ihnen gekämpft. Ich erinnere mich noch an Ypern 1915, den selbstmörderischen Gegenangriff auf einen bedauernswerten kleinen Ort namens Langemarck, den unsere Generäle befahlen. Die Sepoys der 3. Lahore Division, die hauptsächlich aus Sikhs und Pathanen bestand, hatten ohne Aussicht auf Erfolg angegriffen und waren niedergemäht worden, bevor sie die Stellungen der Boches auch nur zu Gesicht bekamen. Sie starben heldenhaft. Jetzt hier in Kalkutta war es verstörend zu erleben, wie wir deren Angehörige in ihrem eigenen Land behandelten.
»Und Sie, Sir?«, fragte Banerjee in meine Gedanken hinein. »Was bringt Sie nach Kalkutta?«
Ich blieb stumm.
Was sollte ich darauf antworten?
Dass ich einen Krieg überlebt hatte, der meinen Bruder und meine Freunde getötet hatte? Dass ich verwundet und nach Hause verschifft worden war, nur um dort während meiner Genesung im Spital zu erfahren, dass meine Frau einer schweren Grippe erlegen war? Dass ich eines Englands überdrüssig geworden war, an das ich nicht länger glauben konnte? Mit einem Inder über solche Dinge zu reden gehörte sich nicht. Also sagte ich ihm, was ich jedem sagte.
»Ich hatte den dauernden Regen satt, Sergeant.«
2
Ich war sechs, als meine Mutter starb. Mein Vater war Rektor der örtlichen Schule und damit ein sehr bedeutender Mann innerhalb der Gemeinde – und ein völlig unbedeutender jenseits davon. Er heiratete schon bald ein zweites Mal, und prompt wurde ich als entbehrliches Überbleibsel nach Haderley verfrachtet, ein unscheinbares Internat in einer verschlafenen Gegend im tiefsten Südwesten. Weiter als dort konnte man nirgends in England von allem nur halbwegs Bedeutsamen entfernt sein.
Das Internat unterschied sich nicht von unzähligen anderen kleinen öffentlichen Schulen, die überall auf dem platten Land anzutreffen waren. Von der geografischen Lage wie von der Einstellung her überaus provinziell, boten sie eine passable Erziehung, den Anschein von Respektabilität und vor allen Dingen einen bequemen Verwahrungsort für Mittelschichtsprösslinge, die aus welchem Grund auch immer unauffällig aus dem Weg geschafft werden mussten. Mir war das durchaus recht. Ich war glücklich in Haderley, ganz sicher glücklicher, als ich es zu Hause gewesen war. Ich hätte sogar noch mehr Zeit dort verbracht, wenn ich gekonnt hätte. Wie beneidete ich die Jungs, die auch in den Ferien dort blieben, weil ihre Eltern zu irgendeinem abgelegenen Winkel der Erde abkommandiert waren, wo sie die Bürde des weißen Mannes trugen und den Fortbestand des Empire sicherten.
Das Empire – es war tatsächlich ein Unternehmen der Mittelschicht, das fest auf den Schultern von Schulen wie Haderley gründete. In diesen Anstalten nämlich wurden jene unbekümmerten, tüchtigen jungen Männer am Fließband produziert, die später die Schmiere bildeten, mit der das Räderwerk des Empire am Laufen gehalten wurde. Die Jungs, die seine Verwaltungsbeamten und Polizisten wurden, seine Pfaffen und Steuereintreiber. Im Gegenzug würden diese Jungs heiraten und selbst Kinder bekommen, Kinder, die sie später zurück nach England schickten, um dort die gleiche Erziehung zu genießen, die sie erhalten hatten. So wurden sie in genau denselben Schulen zur nächsten Generation von Kolonialverwaltern geformt, und der Kreis schloss sich.
Ich verließ Haderley mit siebzehn, als das Geld ausging. Mein Vater war im Jahr zuvor erkrankt, und angesichts der finanziell angespannten Verhältnisse stellten die Schulgebühren plötzlich einen unbezahlbaren Luxus dar. Ich machte ihm deshalb keine Vorwürfe. Solche Dinge passierten eben. Gleichwohl ergab sich daraus für mich die Frage, was ich nun mit meinem Leben anfangen sollte. Hoffnungen auf ein Studium, sofern ich mir die jemals gemacht hatte, konnte ich nun vergessen. Stattdessen tat ich das, was dynamische junge Männer, denen es an Perspektiven und noch stärker an finanziellen Mitteln mangelte, seit Jahrhunderten taten. Ich ging nach London.
Ich hatte Glück. Ein Onkel von mir wohnte im East End, ganz in der Nähe der Mile End Road. Als Friedensrichter in der Gegend besaß er einige Beziehungen, und er war es, der mir vorschlug, es bei der Polizei zu versuchen. Mir schien das eine gute Idee, vor allem da ich keine Alternativen sah. Also bewarb ich mich, und man bot mir eine Stelle als Constable in der H Division der Metropolitan Police an, die ihre Zentrale in Stepney hatte. Die Leute denken immer, die Met sei die älteste Polizeitruppe der Welt. Ist sie nicht. Wir hatten die Bow Street Runners, das stimmt, aber die erste Stadt mit einer richtigen Polizei war Paris. Und nicht einmal in Großbritannien ist die Met die älteste. Diese besondere Ehre gebührt Glasgow, das bereits gut dreißig Jahre lang eine Polizei besaß, bevor Robert Peel eine für London vorschlug. Andererseits, wenn es eine Stadt gab, die noch dringender als London einer Polizei bedurft hatte, dann vermutlich Glasgow.
Was nicht heißen soll, dass London ein sicheres Pflaster gewesen wäre. Stepney und das East End waren es ganz gewiss nicht; wir erlebten hier mehr als genug Morde, auch wenn die Opfer nie Smoking und Fliege trugen. Dafür war das einfach nicht der richtige Ort. Die Jungs in der H Division waren jedenfalls immer dankbar für ihre verlässlichen alten Bulldog-Revolver, obwohl ich meinen nie im Einsatz benutzt hatte. Gewöhnlich genügte es, ihn auf den Übeltäter zu richten, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
Meine große Chance kam zwei Jahre später bei einem besonders abscheulichen Doppelmord in der Westferry Road. Die Leichen eines Ladenbesitzers namens Furlow und seiner Frau waren am frühen Morgen von ihrer jungen Angestellten, einer gewissen Rosa, entdeckt worden. Dieses Mädchen tat angesichts einer Szene, die direkt aus einem Groschenroman hätte stammen können, das einzige Vernünftige und schrie sich die Seele aus dem Leib. Ich war zufällig in der Nähe auf Streife, hörte ihre Schreie und war so als erster Polizist am Tatort. Es gab keine Anzeichen eines Einbruchs. Eigentlich gab es überhaupt nicht viele Anzeichen von irgendetwas Ungebührlichem, sah man einmal von den beiden Toten ab, die in Nachtkleidung und mit durchtrennten Kehlen in der Wohnung über dem Geschäft lagen. Kurz darauf trafen weitere Beamten ein, und nachdem alles abgesperrt war, wurde bei einer gründlichen Durchsuchung eine offene, leere Geldkassette unter Furlows Bett gefunden.
Die Presse griff die Story auf, heizte die Stimmung in der Bevölkerung an, und schon bald übernahmen die Kriminalbeamten vom CID den Fall. Nach einiger Überredung ließen sie mich weiter bei den Ermittlungen helfen. Ich überzeugte sie davon, dass ich nützlich sein konnte, schließlich war ich nicht nur als Erster am Tatort gewesen, ich kannte mich in dem Viertel auch aus.
Mit der Bitte um Hinweise wandten wir uns an die Öffentlichkeit, und verschiedene Zeugen meldeten sich. Sie sprachen davon, an diesem Morgen gesehen zu haben, wie zwei verdächtig wirkende Männer das Gebäude verließen. Ein Ehepaar konnte die beiden sogar als die Brüder Alfred und Albert Stratford identifizieren, zwei Schläger, deren Hang zur Gewalt sogar in dieser üblen Gegend maßlos wirkte. Wir holten sie zur Vernehmung, und natürlich leugneten sie alles. Sie taten so treuherzig, dass man hätte glauben können, sie wären zur Zeit der Morde in der Kirche gewesen.
Dann fingen die Zeugen an, ihre Aussagen zu verwässern. Nach und nach änderte sich die Geschichte. Es war zu dunkel gewesen, sie konnten es nicht beschwören, waren sich nicht einmal sicher, dass es der entsprechende Tag gewesen war. Auf einmal hatten wir nicht mehr genug gegen die Gebrüder Stratford in der Hand, und es schien, als müssten wir sie laufen lassen. Die CID-Beamten starteten einen letzten Versuch und kehrten noch einmal zum Tatort zurück in der vagen Hoffnung, eine Spur zu entdecken, die sie zuvor übersehen hatten. Mich ließen sie im Präsidium zurück, wo ich nichts weiter zu tun hatte. Kurz entschlossen ging ich in die Asservatenkammer hinunter. Da der Fall im Sande zu verlaufen drohte, neigte sich wohl auch meine Zeit beim CID ihrem Ende zu, und ich wollte zum Abschied noch einen letzten Blick auf die Beweisstücke werfen, die wir zusammengetragen hatten. Ich nahm die magere Ausbeute in Augenschein: die blutgetränkte Nachtkleidung, eine Taschenuhr mit gesprungenem Glas und die leere Geldkassette. In diesem Moment bemerkte ich an der Kassette, gut verborgen auf der Innenseite der Verschlussklappe, einen rötlichen Fleck. Er war offenbar in all dem Durcheinander bei der Auffindung der Kassette nicht entdeckt worden. Mir war sofort klar, um was es sich handelte, und vor allen Dingen, welche Relevanz er haben konnte. Ich sprang die Treppe hinauf und zeigte mit zitternden Händen einem leitenden Beamten die Kassette. Rasch wurde die noch junge Abteilung für Fingerabdrücke hinzugezogen. Es gelang den Experten, einen Abdruck zu nehmen, der, wie sich herausstellte, exakt dem Daumenabdruck von Alfred Stratford entsprach. Wir hatten ihn überführt. Ich beantragte eine Versetzung zum CID und wurde angenommen.
Was die Gebrüder Stratford betrifft, so wurden sie beide gehängt.
Die nächsten sieben Jahre verbrachte ich beim CID und beschäftigte mich mit Verbrechen, die den meisten Menschen das Abendessen verleiden würden. Mit der Zeit wurde das etwas ermüdend, und Ende 1912 wechselte ich zur Special Branch, die damals vor allem die irischen Unabhängigkeitskämpfer in der Hauptstadt im Auge behielt. Nur wenige wissen heute noch, dass die Special Branch einst als Special Irish Branch gegründet worden war. Der Name änderte sich, die Aufgabe aber blieb stets dieselbe.
Im Sommer ’14 begann der Krieg. Ich gehörte nicht zu denjenigen, die seinen Ausbruch feierten wie Truthähne, die sich aufs Weihnachtsfest freuen. Vielleicht hatte ich einfach schon genug vom Tod gesehen, um zu wissen, dass er meist grausam, in der Regel sinnlos und nur selten ehrenhaft war. Ganz gewiss verfiel ich nicht der fiebrigen Begeisterung, die in jenen frühen Tagen zahllose junge Männer in die Rekrutierungsbüros strömen ließ, weil sie glaubten, bis Neujahr wäre alles vorbei. So viele Menschen gingen von einem raschen Ende aus und erwarteten, dass wir hinüberfahren, dem Kaiser eine Abreibung verpassen, und das war’s dann. Als würde sich ein modern gerüstetes Deutsches Reichsheer ebenso problemlos abfertigen lassen wie die Speerschleuderer, die wir so gerne in unseren Kolonialfeldzügen bekämpften.
Dennoch meldete auch ich mich am Ende freiwillig. Nicht aus Liebe zu König und Vaterland, was allgemein als verdienstvoll gilt, sondern aus Liebe zu einer Frau, was etwas erheblich Komplizierteres ist.
Zum ersten Mal begegnete ich Sarah im Herbst 1913 in einem Bus in Mile End. Die Leute reden gerne von Liebe auf den ersten Blick, von Geigenklängen und explodierendem Feuerwerk. Bei mir ähnelte die Erfahrung eher einem leichten Herzinfarkt. Sie war schön, so schön, wie man sich ein englisches Mädchen immer in seinen Träumen vorstellt, und viel zu hübsch, um in einem Bus auf der Whitechapel Road zu sitzen oder sich überhaupt in einem Fünf-Meilen-Radius rund um diesen Ort aufzuhalten. Bevor ich wieder zu Sinnen kam, war sie bereits ausgestiegen, und ich verlor sie in der Menge aus den Augen. Damit wäre die Sache schon vorbei gewesen, hätte ich sie nicht einige Tage später erneut im Bus entdeckt. Ich begann meine Fahrten mit großer Sorgfalt auf ihren Zeitplan abzustimmen. Es war schön, endlich einmal eine Verwendung für die Observierungstechniken der Special Branch zu haben, die nicht in der Verfolgung von Iren durch die ganze Stadt bestand.
Einige Wochen lang versüßten mir diese morgendlichen Fahrten den Tag. Ich empfand Glück, sobald ich sie sah, und Leere, wenn sie einmal nicht da war. Als der Bus eines Tages besonders vollgepackt war, bot ich ihr meinen Platz an. Sie hielt es für eine Geste der Höflichkeit. Für mich war es eine Gelegenheit, mit ihr ins Gespräch zu kommen.
Mit der Zeit lernte ich sie besser kennen. Sie war Lehrerin, ein paar Jahre älter als ich – und sehr intelligent. Ihre Schönheit hatte mich zu ihr hingezogen, aber ihre Intelligenz war der Grund, weshalb ich mich in sie verliebte. Sie kannte keine Vorurteile und vertrat ihre Ideen mit viel liberalem Geist und Radikalität. Manche Männer fühlen sich von intelligenten Frauen eher abgestoßen. Mich macht es süchtig. Diese Tage waren die glücklichsten in meinem Leben. Sie liebte die Natur, und wir verbrachten so manchen eiskalten Sonntagnachmittag mit Streifzügen durch den Botanischen Garten. Noch heute muss ich in jedem Park sofort an sie denken.
Aber wahre Liebe nimmt selten einen glatten Verlauf, und in unserem Fall wurde es reichlich holprig. Das Problem bestand darin, dass ich nicht der Einzige war, den sie faszinierte. Sie besaß reihenweise Verehrer, hauptsächlich Intellektuelle und Radikale, darunter sogar den ein oder anderen Ausländer. Sie stellte mich ihren Freunden vor. Ernste Männer mit hoher Denkerstirn, glänzenden neuen Ideen und alten zerschlissenen Mänteln, die sich in Kaffeehäusern trafen und erregt über die brüderliche Solidarität innerhalb der Arbeiterklasse und die Diktatur des Proletariats debattierten. Natürlich war das alles reiner Mumpitz. Sie waren aus demselben Grund da wie ich. Allesamt nur Motten, die dasselbe Licht umschwirrten. Um Sarahs Zuneigung zu gewinnen, hätten sie den anderen mit Freuden ein Messer in den Rücken gestoßen und alle brüderliche Solidarität ohne Zögern über Bord geworfen. Eine Sache allerdings gab es, die sie vereinte. Das war ihr Misstrauen mir gegenüber, eine Haltung, die sich nicht gerade besserte, als sie erfuhren, dass ich Polizist war.
Selbstverständlich gab es auch noch andere Frauen in der Gruppe, aber Sarahs Licht überstrahlte stets alle. Sie war sich ihrer Position durchaus bewusst und verteilte ihre Gunstbeweise in gerechten Happen. Ein freundliches Wort hier, ein Seitenblick da, eben so viel, dass keiner der Verehrer sich bevorzugt oder entmutigt fühlte.
Mein freiwilliger Eintritt in die Armee diente dazu, mich deutlich von diesen Männern abzugrenzen. Wie die meisten Radikalen redeten sie gerne, taten aber nichts, und man musste nicht besonders klug sein, um zu sehen, dass Sarah der endlosen Diskussionen langsam überdrüssig wurde. Ich meldete mich zur Armee, weil ich das Gefühl hatte, sie wünschte sich ungeachtet aller emanzipatorischen Ansichten im Grunde, dass ein Mann sich wie ein Mann benahm. Ich meldete mich, weil ich sie liebte. Und dann fragte ich sie, ob sie mich heiraten würde.
Im Januar 1915 rückte ich ein und absolvierte gemeinsam mit zwei Dutzend anderen Männern eine sehr rudimentäre dreiwöchige Grundausbildung. Sarah und ich heirateten Ende Februar, und zwei Tage später bestieg ich mit meiner Einheit das Schiff Richtung Frankreich.
Wir wurden fast sofort in den Kampf geschickt und nahmen an der Offensive bei Neuve-Chapelle teil. Eine ganze Reihe von Kameraden ist in dieser Schlacht gefallen. Es sollten die ersten von vielen sein. Die hohen Verluste rissen damals ständig Lücken in die Ränge, und Feldbeförderungen waren an der Tagesordnung. Meine Vergangenheit als Kriminalinspektor machte mich zu tauglichem Offiziersmaterial, und ich stieg rasch bis zum Second Lieutenant auf. Später folgten noch weitere Beförderungen, die alle schlicht darauf gründeten, dass ich noch am Leben war. Meine Freunde starben einer nach dem anderen. Genau wie meine Verwandten. Mein Halbbruder Charlie fiel 1917 in Cambrai. Vermisst, vermutlich gefallen. Zwei Jahre zuvor war er noch auf meiner Hochzeit gewesen, und auf seiner Beerdigung sah ich zum letzten Mal meinen Vater, der kurz darauf verstarb. Am Ende überlebten von uns zwanzig, die sich gemeinsam freiwillig gemeldet hatten, lediglich zwei. Und davon war ich der Einzige, der seine fünf Sinne noch beieinanderhatte. Obwohl sich darüber streiten ließ.
Während des Kriegs war ich auch zum ersten Mal Lord Taggart begegnet. Ich wurde von der Front abkommandiert, um mich bei ihm in Saint-Omer zu melden. Offiziell trug er zwar das Rangabzeichens eines Majors des 10. Bataillons der Royal Fusiliers, aber es stellte sich rasch heraus, dass er eigentlich dem militärischen Geheimdienst angehörte. Er hatte meine Akte gelesen und meine Erfahrungen in der Special Branch bemerkt. Jetzt hatte er einen Auftrag für mich. Ich wurde nach Calais beordert, um dort einen Holländer zu beschatten, der im Verdacht stand, mit dem Feind zu kollaborieren. Einige Wochen blieb ich dem Mann auf den Fersen, notierte, wen er wann und wo traf, und schon bald hatten wir einen Spionagering aus Hafenarbeitern enttarnt, die Informationen über unsere Logistik an die Deutschen verrieten.
Taggart fragte, ob ich gerne weiter für ihn arbeiten wolle. Die Entscheidung fiel nicht sonderlich schwer. In einem Monat beim Geheimdienst hatte ich mehr zum Kriegserfolg beigetragen als in knapp zwei Jahren im Schützengraben. Die Arbeit war in der Regel eher angenehm, und ich hatte offenkundig Talent dafür. Verglichen mit den Iren, benahmen sich die Deutschen wie Amateure. Ihr Verhältnis zur Spionage ähnelte ein wenig dem von uns Briten zum Feilschen. Sie hielten es für ein eher zwielichtiges Geschäft, das man am besten anderen Völkern überließ.
Im Sommer 1918 während der zweiten Schlacht an der Marne fand der Krieg für mich ein Ende. Es sollte der letzte Versuch der Hunnen sein, das Blatt noch einmal zu wenden. Sie warfen alles hinein, was sie zu bieten hatten, und über Wochen schien der Mörserbeschuss kein Ende zu nehmen. Ich war gerade auf Aufklärungsmission in vorderster Linie, als wir direkt getroffen wurden. Ich hatte noch Glück. Ein Sanitätssoldat fand mich und schleppte mich in ein Feldlazarett. Eine Woche später wurde ich bereits in ein Spital nach England verlegt. Es stand eine Weile lang auf Messers Schneide. Ich erhielt Morphium gegen die Schmerzen und verbrachte viele Tage im Drogendämmer. Erst viel später, als die Ärzte meinen psychischen Zustand für ausreichend gefestigt hielten, erzählten sie mir von Sarahs Tod. Sie sagten, es sei die Grippe gewesen und es habe eine große Epidemie mit einer Unzahl von Opfern gegeben. Als ob es damit irgendwie leichter zu akzeptieren wäre.
Nach Frankreich wurde ich nicht mehr zurückgeschickt. Es hätte keinen Sinn gehabt. Im Oktober stand fest, dass der Krieg zu Ende war. Ich bekam stattdessen meine Entlassung und durfte ins bürgerliche Leben zurückkehren. Aber ein bürgerliches Leben ist nicht viel wert, wenn alle geliebten Menschen auf dem Friedhof oder auf französischen Feldern verstreut liegen, wenn einem nichts bleibt als Erinnerungen und Schuldgefühle. In der Hoffnung, damit meinem Alltag wenigstens einen Hauch von Sinn zu verleihen, trat ich wieder in den Polizeidienst ein – wie um die leere Hülle durch eine Rückkehr ins vertraute Umfeld irgendwie erneut mit Leben zu füllen. Es half nichts. Das Beste an mir war mit Sarahs Tod fortgerissen worden, und nun blieben die Tage leer, und die Nächte hallten wider von den Schreien der Toten, die sich mit nichts ersticken ließen. Mit nichts außer Morphium. Als mir das ausging, nahm ich Opium. Nicht ganz so wirkungsvoll, aber einfach zu besorgen, vor allem für einen Polizisten, der sich im East End die ersten Sporen verdient hatte. Allein in Limehouse kannte ich diverse Opiumhöhlen, und so taumelte ich in einer eisigen Dezembernacht die Narrow Street entlang, genau an der Stelle, wo der Kanal in die Themse mündet, und spielte mit dem Gedanken, allem ein Ende zu setzen. Es war so einfach. Nur ein paar Schritte hinein ins Schwarze. Die Kälte würde den Schmerz betäuben, und schon bald wäre alles vorbei …
Dann musste ich an einen Sergeant bei der Wasserpolizei in Wapping denken, mit dem ich mich einmal furchtbar gestritten hatte. Es war nur die Vorstellung, mit welcher Befriedigung er meine aufgeblähte Leiche aus dem Wasser fischen würde, die mich davon abhielt, es zu tun.
Bisweilen kann ich ungeheuer kleinlich sein.
Wenig später empfing ich ein Telegramm von Lord Taggart, in dem er mir einen Posten anbot. Er war zum Commissioner der Imperial Police Force in Bengalen ernannt worden, brauchte dringend fähige Detectives und bat mich, zu ihm nach Kalkutta zu kommen. In England hielt mich herzlich wenig, und so verabschiedete ich mich Anfang März am Kai von Sarahs Vater und bestieg ein Dampfschiff der P&O, das nach Bengalen fuhr. Vor meinem Weggang war es mir noch gelungen, aus der Asservatenkammer in Bethnal Green einen Vorrat an Morphintabletten beiseitezuschaffen – im Grunde ein Kinderspiel. Ständig verschwanden irgendwo Beweismittel. Gerüchten zufolge brachte manchen Beamten in Wapping der Feierabendverkauf von Schmuggelware mehr ein als ihr Dienst auf der Wache. Allerdings war ich mir nicht sicher, ob die geklauten Tabletten wirklich für die dreiwöchige Überfahrt reichen würden. Der Vorrat war knapp bemessen, doch ich hoffte, bei strenger Einteilung bis Kalkutta damit auszukommen.
Leider ist das Glück ein launisches Wesen. Schlechtes Wetter im Mittelmeer verlängerte die Reisedauer um fast eine Woche, und mehrere Tage, bevor die Küste von Bengalen in Sicht geriet, gingen mir die Tabletten aus.
Bengalen: strotzend vor Grün, freigiebig und rückständig. Das Land schien nur aus dampfendem Dschungel und aufgeweichten Mangrovenwäldern zu bestehen. Mehr Wasser als Land. Das Klima war so unwirtlich, wie man es sich nur denken konnte. Abwechselnd wurde man von einer glühend heißen Sonne geröstet und von Monsunregen durchnässt, als hätte der liebe Gott höchstpersönlich aus einer gereizten Laune heraus sämtliche Naturphänomene zusammengetragen, die ein Engländer besonders unerträglich findet, und sie auf diesen einen verdammten Ort übertragen. Daher erschien es auch nur logisch, dass wir damals ausgerechnet hier, achtzig Meilen landeinwärts, in einem malariaverseuchten Sumpfgebiet am östlichen Ufer des schlammigen Hugli, den idealen Platz zur Errichtung unserer indischen Hauptstadt Kalkutta sahen. Ich schätze, wir lieben einfach die Herausforderung.
Am 1. April 1919 setzte ich erstmals einen Fuß auf indischen Boden. Der erste April, irgendwie passend. Das Dampfschiff hatte sich flussaufwärts gekämpft, der Dschungel war in Felder und Lehmdörfer übergegangen, und dann hinter einer engen Flussbiegung war plötzlich diese herrliche Stadt aufgetaucht, die unter einer aus hundert Fabrikschloten gespeisten schwarzen Dunstglocke lag.
Eine angenehme Erfahrung ist es für jemanden wie mich nicht, sich ohne den Beistand von Drogen als Neuling in Kalkutta einrichten zu müssen. Zuerst einmal ist da die Hitze, diese brütende, erstickende, erbarmungslose Hitze. Aber die Temperaturen allein sind nicht das Problem. Es ist die Luftfeuchtigkeit, die die Menschen verrückt macht.
Der Fluss war vollgestopft mit Schiffen. Riesige hochseetaugliche Handelsschiffe drängelten am Kai um Anlegeplätze. Wenn der Fluss die Pulsader der Stadt war, dann waren diese Schiffe, die ihre Waren in die Welt hinaus exportierten, ihr Lebenssaft.
Auf den ersten Blick könnte man denken, Kalkutta sei eine uralte Metropole. In Wahrheit ist sie jünger als New York, Boston oder ein halbes Dutzend anderer amerikanischer Städte. Nur entstand sie im Unterschied zu diesen nicht aus dem Wunsch nach einem Neubeginn in einer Neuen Welt, sondern aus einem weit profaneren Grund. Diese Stadt sollte allein dem Handel dienen.
Für uns Engländer war Kalkutta einst die Stadt der Paläste, unser Stern des Ostens. Wir hatten sie aufgebaut, hatten Villen und Monumente errichtet, wo vorher nur Wildnis und Gestrüpp gewesen war. Wir hatten unseren Preis mit Blut bezahlt und behaupteten jetzt, Kalkutta sei eine britische Stadt. Doch fünf Minuten in ihren Straßen, und man wusste, dass für sie dies auf keinen Fall zutraf. Das bedeutete natürlich noch lange nicht, dass Kalkutta indisch war.
In Wirklichkeit war Kalkutta einzigartig.
3
In der Lal Bazar Street 18 erhob sich ein wuchtiger Prachtbau, der noch aus der Blütezeit der East India Company stammte, jenen Tagen, in denen noch jeder x-beliebige Engländer, der ausreichend Grips und ein gutes Auge für Möglichkeiten besaß, sich ohne einen Penny in Bengalen niederlassen und es mit ein wenig Geschick zu märchenhaftem Reichtum bringen konnte. Natürlich war es von Vorteil, wenn es ihm dabei nicht allzu viel ausmachte, wie genau ihm das gelang. Angeblich war dieser mondäne Klotz von eben einem solchen Glücksritter errichtet worden, der mit leeren Taschen hier ankam, ein Vermögen erwarb und alles wieder verlor. Er musste an irgendjemanden verkaufen, der es an einen anderen verkaufte, der es irgendwann an die Verwaltungsbehörden verkaufte – und nun residierte hier die Zentrale der Imperial Police Force, Bereich Bengalen.
Erbaut war es in einem Stil, den wir gerne kolonialer Neoklassizismus nennen. Reichlich Säulen, Simse und Sprossenfenster mit Läden. Gestrichen war es in einem bräunlichen Rotton, der typisch für Britisch-Indien ist. Von Polizeiwachen bis zu Postämtern sind die meisten öffentlichen Gebäude braunrot gestrichen. Vermutlich saß irgendwo in Manchester oder Birmingham ein fetter Fabrikbesitzer, der reich geworden war an dem Auftrag, ein Meer an braunroter Farbe für sämtliche Amtsgebäude des British-Raj zu produzieren.
Surrender-not und ich traten zwischen zwei salutierenden Wachleuten hindurch in die Eingangshalle, in der reges Treiben herrschte. Vorbei an Wänden, die mit Plaketten, Fotografien und anderen bedeutenden Erinnerungsstücken aus hundert Jahren kolonialer Verbrechensbekämpfung bedeckt waren, liefen wir zum Treppenaufgang.
Lord Taggarts Büro lag im dritten Stock und konnte nur durch einen kleinen Vorraum betreten werden. Dort saß sein persönlicher Sekretär, ein winziges Kerlchen namens Daniels, dessen einziger Lebenszweck darin zu bestehen schien, seinem Chef zu dienen, eine Aufgabe, die er mit der Hingabe eines vernarrten Cockerspaniels betrieb. Ich klopfte und trat ein. Surrender-not folgte zwei Schritte hinter mir. Daniels erhob sich von seinem Schreibtischstuhl. Er sah aus, wie alle Sekretäre bedeutender Menschen aussehen: blass, unscheinbar und einen guten Kopf kleiner als sein Chef.
»Bitte hier entlang, Captain Wyndham«, sagte er und führte mich zu einer Flügeltür. »Der Commissioner erwartet Sie bereits.«
Ich ging hinein. Surrender-not blieb an der Schwelle stehen.
»Na los, Sergeant«, sagte ich. »Wir wollen den Commissioner nicht warten lassen.«
Er atmete tief ein und folgte mir dann in einen Raum von den Ausmaßen eines kleinen Zeppelin-Hangars. Helles Licht strömte durch verglaste Balkontüren und brach sich in den Kronleuchtern, die von der hohen Decke hingen. Für einen Polizeibeamten war es ein beeindruckendes Büro. Doch vermutlich hatte der leitende Hüter von Recht und Ordnung in einem solch gewichtigen und zugleich heiklen Außenposten des Empire ein derartiges Büro auch verdient. Am anderen Ende des Raums, hinter einem Schreibtisch von der Größe eines Ruderboots und unter einem lebensgroßen Porträt von George V., saß der Commissioner. Ihm gegenüber hatte Digby Platz genommen. Ich versuchte, mir meine Überraschung nicht anmerken zu lassen, und marschierte auf das Trio zu, dicht gefolgt von Surrender-not.
»Setzen Sie sich doch, Sam«, sagte der Commissioner, ohne aufzustehen.
Folgsam setzte ich mich auf den Stuhl neben Digby. Mehr als diese zwei Sitzgelegenheiten waren nicht vorhanden, was Surrender-not nur noch nervöser werden ließ. Verzweifelt sah er sich im Zimmer um. Ich kannte diesen Gesichtsausdruck von Männern, die zwischen den Linien ins Kreuzfeuer geraten waren.
Digby lief knallrot an. »Was glauben Sie, wo Sie hier sind, Sergeant? Auf irgendeinem Außenposten in Haora? Hier haben Leute wie Sie nichts …«
»Einen Moment«, sagte Taggart und hob die Hand. »Der Sergeant soll bleiben. Ich halte es für zweckdienlich, dass wenigstens ein Inder anwesend ist.« Er wandte sich zur Tür und rief: »Daniels! Bringen Sie einen Stuhl für den Sergeant.«