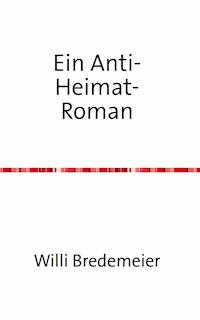
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Karriere eines Bildungsenthusiasten querbeet durch die Schichten einer zunächst extrem bildungsfeindlichen Republik, bis auf einmal alle formal gebildet waren. Was haben wir gewonnen, was verloren? - Eine Familiensaga über das Revier und seine ländlichen Herkunftsregionen: Vom verzehrenden Heimweh zur Zerbröselung allen Zusammenhalts. - Von der partiellen Modernisierung des Ruhrgebiets und den Mächten, die es am Boden fesselten: Das meiste "too little", alles "too late"?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Anti-Heimat-Roman
Bildungseisen durch ein unbekanntes Land 1943 – 2012
Für G.
Inhalt
1. Kapitel 1626 - 1943 Erinnerungen eines Mammakindes
Als Kind habe ich meine Mamma gesucht und nicht wieder gefunden. Als Erwachsener suchte ich weiter, obgleich ich wusste, ich würde erfolglos sein. Das ist in zwei Sätzen meine Geschichte.
Drumherum lassen sich Fragen stellen: Warum sehe ich die Dinge in meinem Umfeld anders als die anderen Leute? Bin ich wie verrückt traumatisiert? Oder bin ich als einziger in der Lage zu erkennen, wie die Verhältnisse sind? Offenbarte ich mich, wie ich mich gelegentlich überschätze, schriebe man mir eine besonders schwerwiegende Variante des Wahnsinns zu.
Ich kann meine Geschichte auch in mehr Sätzen erzählen. Dann begänne ich damit, dass ich ein doppeltes Mammakind bin. Einfache Mammakinder sind Kinder, die sich an die perfekte Symbiose mit ihrer Mutter im Mutterleib erinnern. Wir nennen diese Symbiose das Urparadies. Unsere Vorstellungen von der umfassenden harmonischen Gemeinschaft und vom Sozialismus, der mit eherner Notwendigkeit kommen wird, stammen aus dieser Zeit. Während der Studentenrevolte debattierten wir in verräucherten Nächten, wie die perfekte Gesellschaft mit uns zu konstruieren sei. Tatsächlich meinten wir immer nur die umfassende Einheit mit unseren Müttern.
Als wir uns im Mutterleib befanden, waren wir glücklich. Wir gaben das empfangene Glück an unsere Mütter zurück. Wir kommunizierten höchst differenziert auf vegetativer Ebene. Das fürchterlichste aller Erlebnisse ist die Geburt. Die Trennung von der Mutter zerreißt allen Mitgliedern der menschlichen Spezies das Herz. Wie können wir glücklich sein, da wir solches erlebt haben?
Ein doppeltes Mammakind ist ein Kind, das seine Mamma zweimal verliert. Wie das geschehen ist, daran erinnert es sich allenfalls in Fragmenten. Oder es bildet sie sich ein, weil es sich ohne Erinnerungen mit möglichst plastischen Bildern schwer aushalten lässt.
Ein doppeltes Mammakind ist nicht damit einverstanden, dass es seine Mamma verloren hat. Das ist allerdings so, als ob man ununterbrochen protestierte, dass man irgendwann stirbt. Da es seine Mutter nicht wiederhaben kann, verbringt es sein Leben damit, die Bruchstücke seiner womöglich nur eingebildeten Erinnerungen an die Mamma zusammenzukitten. Sollte dazu ein vollständiges Bild entstehen, möchte es einen Altar errichten und das Bild darauf stellen. Aber dazu wird es nicht kommen.
*
Ein Mammakind darf nicht mit einem Muttersöhnchen verwechselt werden. Muttersöhnchen sind auch traumatisiert, und zwar so, dass sie sich nicht an das Urparadies mit ihrer Mutter erinnern. Sie sind unfähig, die Liebe, die sie durch ihre Mutter erfahren, an sie oder irgendeinen anderen Menschen zurückzugeben. Vielmehr nutzen sie erst die Mutter und danach ihre ganze Welt aus.
Mutersöhnchen werden für ihr späteres Leben nicht durch das Urparadies, sondern durch die Ursituation am Wickeltisch determiniert. Kaum ist das künftige Muttersöhnchen auf die Welt gekommen, liegt es auf den Tisch und schreit sich die Seele aus dem Leib. Rund um den Wickeltisch findet eine Gesellschaft zusammen, um das Baby zu versorgen. Keiner will wissen, in was für ein Monster das Baby sich später verwandeln mag.
Sobald sich die Gesellschaft am Wickeltisch kümmert, liefert das Baby eine Gegenleistung ab, indem es die Gesellschaft erfreut. Diese Gegenleistung wird mit den Jahren auf Null reduziert. Wer könnte einen Zwei-Zentner-Moloch süß finden? Das Baby lernt vor allem zwei Dinge: Es kann selbst nichts Konkretes bewirken. Es ist ein Leichtes, die Umwelt zu bewegen, etwas für das Baby zu tun. Es muss nur ein Geschrei machen. Sobald sich die Gesellschaft rund um den Wickeltisch (oder später den Chefsessel) auf vorauseilenden Gehorsam eingestellt hat, reicht ein Gequengel.
Innerhalb der Gesellschaft zur Versorgung des Wickelkindes steht an vorderster Front herrschend, koordinierend und aus vollem Herzen liebend die Mutter. Wenn ein „Du, du“ nicht reicht, nimmt sie das Baby auf den Arm und gibt es womöglich an andere Arme weiter. Es ist ein Privileg und ein Glück, das Baby halten zu dürfen. Wenn alles nicht hilft, legt die Mutter das Baby an die Brust. Oder sie gibt ihm das Fläschchen. Gierig nuckelt und schaufelt das Baby Welt in sich hinein. Anders als im Mutterleib geht es nicht um die Entwicklung und Entfaltung von Potenzialen, vielmehr um die Lösung eines Mengenproblems, also das Gewinnen von Pfunden.
Die gleichförmig wiederkehrenden Situationen am Wickeltisch prägen sich dem künftigen Muttersöhnchen ein. Es denkt sein Leben lang, es gäbe nichts anderes. Wenn Muttersöhnchen zu Pickelträgern, Couch Potatoes und Neervensägen herangewachsen sind, konstituieren sich neue Gesellschaften für sie um den nunmehr hypothetisch gewordenen, aber mit realer Macht begabten Wickeltisch.
Wie schafft es ein Muttersöhnchen, seine Umwelt immer wieder aufs Neue zu unterwerfen? Das Muttersöhnchen ist auf dem Wickeltisch liegen geblieben und hat sich so einen kindlichen Charme bewahrt. Da schmelzen ganz andere Frauen als die Mutter dahin. Wollten sie sich nicht ohnehin kümmern? So lernt das Mutersöhnchen nie, verpflichtungsfähig zu sein. Bald ist von der wundervollen Symbiose zwischen Mutter und Kind nichts außer Vorhaltungen, Beschwerden und kleinliches Wünschen übrig geblieben. Ein Muttersöhnchen bleibt ein solches, selbst wenn es vierzig Jahre und älter geworden ist, weil es immer wieder neue Dienstboten findet.
Mittlerweile hat das Muttersöhnchen Menschen kennen gelernt, die sich seinem Herrschaftsanspruch nur bedingt unterwerfen. Da hilft auch kein Quengeln. Also kehrt das Muttersöhnchen zu seiner Mutter zurück. Auf sie, das weiß es seit Babyzeiten, ist immer Verlass. Sie hat sich ihrem Baby auf ewig dienstbar gemacht. Spätestens, wenn die Mutter hinfällig wird, hält das Muttersöhnchen nach Ersatzmüttern Ausschau. Zum Glück gibt es viele passende Gefährtinnen, die, auch wenn sie es nicht wissen, unterworfen sein wollen.
Mammakinder möchten weder zornig werden noch eingreifen, wenn sie die Erniedrigung der Mütter und Ersatzmütter durch Muttersöhnchen beobachten. Aber leicht fällt ihnen das nicht. Andererseits packt sie die irre Wut, wenn sie, was gelegentlich vorkommt, mit Muttersöhnchen verwechselt werden.
*
Viktoria ist das erste Mädchen, mit dem ich es über längere Zeit aushalte. Wenn ich sie auf eine meiner Reisen in die Vergangenheit mitnehme, gehe ich höhere Risiken ein.
Für heute habe ich beschlossen, mich näher an mein Geburtshaus zu wagen. Wir haben meinen Wagen oben am Berg geparkt. Das Zechentor und die Zeche dahinter haben aufgehört zu existieren. Hinter der Mauer wuchern, vom ständigen Fieseln in unserem Regenloch gedüngt, Pflanzen, die unter Naturschutzverdacht stehen. Vielleicht gibt es deswegen weit und breit keinen Gewerbepark. Viktoria und ich gehen den Berg hinunter. Früher gingen die Kumpels zu Hunderten vor Schichtbeginn in düsterem Schweigemarsch diesen Berg herauf. Diesmal sehe ich vor meinem hypothetischen Auge nicht, wie sie mir entgegenkommen.
Die Fassaden meines Geburtshauses sind die alten geblieben. Ich kam als Hausgeburt oberhalb einer Kneipe mit Dortmunder Kronen Bier zur Welt, während die Kumpels im Erdgeschoss ihren Zehntageslohn vertranken. Ich gehe am Haus vorbei, ohne einen Blick seitwärts oder zurück zu werfen. Da ich mich allem Anschein nach nicht aufgeregt habe, kehre ich zu meinem Geburtshaus zurück.
Der Gastwirt hat seine Kneipe dicht gemacht. Mit der Bergbaukrise sind ihm die durstigen Seelen abhanden gekommen. Ein einsamer Mann kommt aus dem Haus und ballert die Tür hinter sich zu. Er geht an mir vorbei die Straße herunter. Die Tür zu meinem Geburtshaus ist wieder geschlossen. Man benötigte einen Schlüssel, um das Haus zu betreten. Das gab es in den Vielfamilienhäusern in Bergarbeiterkolonien nicht. Die Besucher stiefelten die Treppen hoch und klopften an meistens nicht abgeschlossenen Türen. „Ey, Gerd, bist du da? Komm in die Puschen.“
Mittlerweile dürfte der Vermieter die Toiletten von den Zwischenstocks in die Wohnungen der Mieter verlegt haben. Sanierungen wie diese sind heute für jeden Hausbesitzer notwendig. Der Vermieter hat seinen Mietern eine Badewanne gestiftet. Danach erhöht er ihnen die Mieten. Die Bergschäden mit ihren schräger werdenden Wänden und dem sich täglich vergrößernden Fleck an der Decke bekommt er weniger leicht weg. Er kann nur hoffen, dass sein Haus unter Denkmalsschutz gestellt wird und die entsprechenden Fördergelder fließen.
Irgendwie komme ich den Berg hoch und kehre zu meinem Auto zurück. Während ich mich auf dem Fahrersitz niederlasse, wimmere ich als kleines Kind, in das ich mich gelegentlich rückwärts verwandele. „Was ist los mit dir?“ fragt Viktoria. Damit meint sie, dass sie sich einen anderen Freund suchen wird, damit ich mich ungestört mit den Freunden meiner Mutter auseinandersetzen kann.
*
Niemand verbietet uns, von unserer Mamma zu reden. Dennoch halten sich alle, die von meiner Familie übrig geblieben sind, an das Gebot, das es nicht gibt. Zwischen uns gibt es nur noch wenige Gemeinsamkeiten, außer dass wir uns anschweigen.
Wir haben unser Bestes gegeben, uns auseinander zu leben. Meine Schwester hat aus dem Wenigen, was ihr die Welt bot, das Bestmögliche gemacht. Wenn wir uns sehen, was selten genug vorkommt, vermeiden wir alles in unseren Gesprächen, was die Leichen unter unseren Betten in Versuchung führen könnte, sich zu wälzen, zu knarren und mit uns zu flüstern.
Mittlerweile bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der sich für meine Mamma interessiert, auch wenn ich mich kaum an sie erinnere. Aber manchmal unterläuft meiner Schwester ein Satz über unsere Mutter. Sie sagt, dass sie zur Ungeduld neigte. „O ja“, bekräftigt sie, als habe die Angst des kleinen Mädchen vor ihrer Mutter nach all den Jahren weiter Bestand.
In der Mitte des Sommers kehre ich aus der Badeanstalt zurück. Ich hätte den Bus nehmen sollen, aber mir fehlte das Geld. Während ich von einer Straße in die andere biege, beknallt mich die Sonne. Sobald ich in unsere Wohnung zurückgekehrt bin, eile ich ins Badezimmer und hänge mich unter den Wasserhahn. Mein Vater beobachtet mich durch die offene Tür. Er schüttelt den Kopf und sagt: „Deine Mutter war ähnlich hastig. Für sie musste alles Schnell, schnell gehen.“ Wut kommt hoch in mir und verflüchtigt sich wieder, sobald ich ihn ansehe. Mein Vater ist von der Rolle, wenn es um mich geht. Ich habe vom ersten Tag meines bewussten Lebens an bedauert, dass ich ihm nicht weiter entgegenkommen kann. Ich haue mich auf die Couch und wende mein Gesicht der Wand zu. Das war ein anstrengender Tag, denke ich.
*
Meine Eltern wandern getrennt voneinander ins Ruhrgebiet ein. Sie fühlen sich in den Städten verloren. Die Romantiker der Arbeiterliterliteratur bedachten nicht, dass sämtliche Einwanderer Bauernlümmel waren. Sie wollten nicht in die Hölle der Städte, nur weil die Hölle in den Dörfern eine andere war. Als meine Eltern einander kennenlernen, stellen sie fest, dass sie aus benachbarten Dörfern gekommen sind. Sie dürften über vier wenn nicht drei Ecken miteinander verwandt sein. Das wäre ein weiterer Grund, sich aneinander zu klammern.
Die Menschen im Ruhrgebiet wissen, dass sie nicht ins Landleben zurückkehren können. Das verdrängen sie zum Teil. Warum sollte man nicht, wenn einem die Maloche eine halbe Stunde übrig gelassen hat, mit dem Träumen beginnen? Für die lange Zeit, in der sie weder der Stadt noch dem Land angehören, richten sich die Einwanderer mit Kaninchen und Tauben eine Kleingartenidylle ein. Wenn sie zu Familienfeiern in die Dörfer zurückkehren, sprechen sie gebrochenes Platt und reden ihren Verwandten nach dem Munde, nur weil sie sich aus Heimweh nach dem Lande verzehren. Dafür schämen sie sich. Aber näher an die alte Heimat kommen sie nicht.
Auf dem Land kommt die Propaganda des Ruhrgebiets gegen sich selbst prächtig an. In Grotebühl hat sich herumgesprochen, wie tierisch im Ruhrgebiet malocht werden muss. Das soll schlimmer sein, als im Großen Moor Torf zu stechen. Haben nicht alle gesehen, wie verdreckt wir sind, wenn wir aus der Waschkaue kommen? Wenn wir ein weißes Hemd angezogen und uns einmal umgedreht haben, ist es vom Kokereistaub grau. Wühlen im Ruhrgebiet nicht Agitatoren, die verlangen, dass man den Bauern ihre Höfe wegnimmt? Allerdings staunen die Grotebühler, wenn sie hören, was im Ruhrgebiet verdient wird. Aber sie staunen noch mehr, wenn man ihnen sagt, was das Gemüse kostet, das man sich am Großen Moor umsonst aus dem Garten holt.
Meine Schwester hat die Begeisterung meiner Eltern für das Land übernommen. Ich sage ihr, dass das Leben hüben wie drüben weitgehend Ausschuss ist. So sehr die Leute sich abmühen, es reicht nur für ein Einkommen, nicht für ein Auskommen. Da gehen sie her und sterben dahin. So etwas will meine Schwester nicht noch ein anderer hören. Die geleckten Broschüren über das Ruhrgebiet mit ihrer verschwiemelten Sprache gibt es noch nicht.
Gleichwohl sind wir, dass muss ich widerwillig zugeben, mit den Leuten in der Knüste verwandt. Die Stimme des Blutes darf es nicht geben, aber Blut mag dicker als Wasser sein. Meine Tante kann unsere verwandtschaftlichen Beziehungen auf den Dörfern bis in entlegene Verästelungen wiedergeben. Mein älterer Bruder fragt sie dennoch nicht, weil er Abschriften benötigt, die von den Behörden zu beglaubigen sind. So schlägt er stattdessen in Kirchenbüchern nach.
Diese reichen bis ins Jahr 1636 zurück, als der Feldherr Tilly sein Lager unter der großen Eiche auf dem Marktplatz von Grotebühl errichtete. Die Eiche hat bis heute den Untergang vieler Generationen und mehrere Kulturen überlebt.
Tilly gibt seinen Landsknechten freien Lauf, weil die Grotebühler seiner Forderung nach Herausgabe von ihm aufgelisteter Reparationen nicht nachkommen wollen. Selbst wenn sie wollten, sie könnten es nicht. Sie behaupten frech, sie besäßen nichts. Erst nehmen sich die Landsknechte die Dorfmitte vor. Später machen sich kleinere Trupps zu den Höfen an der Peripherie auf. Einige Bewohner von Grotebühl sind vorher ins Große Moor geflohen. Als die Flüchtlinge zurückkehren, sind die Höfe niedergebrannt und die zurückgebliebenen Bewohner gefoltert und erschlagen. In Grotebühl ging es schlimmer als im Simplicissimus zu.
Seit Tilly weiß man in den Dörfern am Großen Moor, dass die nächste Katastrophe um die Ecke lauert. Es kann nicht lange dauern, sagen sie sich, dann kommt sie über uns. Leider behalten sie in den meisten Fällen recht.
Einer meiner Cousins mütterlicherseits blättert in den Kirchenbüchern ab 1636 bis zur Gegenwart. Soweit er das nachprüfen kann, stammen meine Vorfahren alle aus Grotebühl. Oder sie kommen aus den um Grotebühl liegenden Ortschaften oder seltener aus Gemeinden, die an der anderen Seite des Großen Moores liegen. Auch für die Zeugung bleibt man geographisch zusammen, weil die Fortbewegungsmittel wenig entwickelt sind. Im besten Fall schwingt man sich aufs Pferd oder lässt sich von ihm ziehen. Das reicht, um einmal im Leben bis in die Kreisstadt zu kommen. Einige Grotebühler gehen im 19. Jahrhundert aus Verzweiflung ins Große Moor, weil seit Tilly nichts in ihren Gemeinden passiert ist. Sie ertragen nicht, Spökenkieker, die sie sind, Gespenster zu sehen und kehren nicht wieder.
Unser Genpool verbessert sich, als Handel und Wandel über unsere Dörfer kommen, so erzählt meine Tante. Mein Urgroßvater väterlicherseits soll einer der Paten im Tabakschmuggel zwischen den Königreichen Hannover und Preußen gewesen sein. Während die junge Generation Grotebühls dem Schmuggel nachgeht, wirft sie verstohlene Blicke auf die fremdländisch blickenden exotisch blühenden Mädchen aus dem Westfälischen.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kommen die Jungen aus dem westfälischen Stapelloh, um mit den Grotebühler Mädchen zu tanzen. Das schaffen sie, weil das Fahrrad mittlerweile erfunden ist und die junge Generation die Verbreitung des Drahtesels in beide Hände genommen hat. Jahr für Jahr holen sich die Stapelloher bei uns blutige Nasen.
Damit habe ich das meiste zur Verwandtschaft meines Vaters gesagt. Von meinen Verwandten mütterlicherseits weiß ich nichts, außer das sie in denselben Dörfern gehaust haben.
*
Meine Eltern ziehen häufig im Ruhrgebiet um. Sie scheinen hierhin und dorthin geworfen. Das wundert uns Nachgeborene nicht. Die Kumpels hauen in den Sack, sobald sie eine Möglichkeit sehen, dem Pütt zu entkommen. Oder sie werden in den Sack gehauen, weil die Nachfrage nach Kohle zurückgegangen ist. So kommt es, dass meine Schwester in einer anderen Stadt als die kommenden Kinder geboren wird.
1936 oder 1937 könnte meine Familie in das Gasthaus mit Dortmunder Kronen Bier gezogen sein. Das ist erneut in einer anderen Stadt. 1937 wird meine Mutter abermals schwanger. Die Hausgeburt klappt diesmal nicht. Die Hebamme taucht ihre Hände in Blut. Das Mädchen schreit einmal, als es geboren ist, und dann niemals wieder. Meine Mutter erholt sich nicht von dieser Geburt. Sie nimmt merkwürdige Züge an, meinen einige Leute.
1939 wird meine Mutter abermals schwanger. Meine Eltern suchen den Knappschaftsarzt auf. Sie tragen ihre Bedenken vor. Sie verweisen auf die fehlgeschlagene Geburt drei Jahre zuvor. Müsste meine Mutter nicht, wenn es soweit ist, ins Krankenhaus kommen? Der Knappschaftsarzt hört nur mit halbem Ohr zu. Was reden ihm die Patienten die Hucke voll, solange ihm die Knappschaftsversicherung ein Gebietsmonopol schenkt? "Haben wir nicht eine tüchtige Hebamme in der Kolonie?" fragt er, als meine baldigen Eltern immer noch drucksen.
Als ich 1940 geboren bin, scheint alles reibungslos vonstatten gegangen. In meinem Fall hat der Knappschaftsarzt recht behalten. Die paternalistische Gesundheitsversorgung, in der nur Befehle befolgt und keine Fragen gestellt werden, hat, wie auch die steigenden Geburtenrate zeigt, funktioniert.
Von 1941 und 1942 ist mir nichts haften geblieben. Es dürfte mir wie den Kurzgeratenen in anderen Familien ergangen sein. Wir schwingen die Rassel. Wir machen ein Bäuerchen. Wir gestatten uns einen Pup.
Meine Schwester sieht das später ganz anders. Ihre Geschichten über mich haben drei Merkmale: Ich komme gut weg. Mein Vater tut immer das richtige. Meine Mutter dräunt als gefürchteter Schatten.
Mein Cousin mütterlicherseits versteht nichts von kleineren Kindern. Das zeigt sich, wenn er zu uns in die Wohnung kommt. In seiner Jugendorganisation wird er gedrillt, sich gegen schwächere Kinder durchzusetzen. Dafür wird er von seinen Oberen gefördert. Abermals hat mich mein Cousin geärgert. Ich klettere von meinem Stuhl herunter. Als ich auf dem Boden stehe, halte ich mich am Stuhl fest, weil ich nicht von selber umfallen will. Derweil bin ich weiter empört. Mein Cousin begibt sich nur scheinbar auf die Flucht, während er mich gleichzeitig auslacht. Als ich ihn nicht einhole, verhöhnt er mich: „Bist du zu dumm oder zu klein, dass du nie was verstehst?“ Ich verstehe dennoch. Er hat die langen Beine, ich die ganz kurzen. Also breite ich die Arme aus und rufe: „Wer kommt in meine Arme?“ Mein Cousin kehrt in meine Arme ein. Ich verhaue ihn kraftlos. Sogar mein Onkel, der meinen Cousin ins Haus gebracht hat, ringt sich ein müdes Lächeln ab. Ich war Odysseus, denke ich einige Jahre später, der, knapp dem Kinderwagen entronnen, ein erstes Mal seinen Verstand bewegt hat..
*
Mein Großvater väterlicherseits hat den größten Hof in Grotebühl vertrunken. Alle seine Vorfahren und Nachgeborenen waren anständige Menschen. Aber wir erinnern uns ausschließlich an ihn.
Mein Großvater setzt sich in einem benachbarten Dorf kleiner. Sollte ihm der bescheidenere Hof eine Strafe sein, lässt er sich nichts anmerken. Vielmehr ist er unternehmungslustig geblieben. Zu den drei Kindern, die ihm seine erste Frau geschenkt hat – die wollte aus Scham über den Verlust eines Hofes nicht mehr leben und hustete sich darüber die Schwindsucht an –, gesellen sich fünf von der zweiten. Jetzt hat er fünf Jungen und drei Mädchen.
Der älteste Sohn, der folglich der Hoferbe ist, würde sich sorgen, selbst wenn er keinen Grund dafür hätte. Er nimmt sich eine Frau, die ausschließlich in künftigen Kalamitäten denkt. Andererseits müssen sie sich Sorgen machen. Hat der Großvater nicht gerade den kleineren Hof mit einer größeren Hypothek belegt? Noch ein solcher Schritt, und er hätte Wucherzinsen an den Juden zu zahlen. Immerhin braucht sich der Sohn keine Sorgen um den heraufziehenden Krieg zu machen. Er ist zu alt, um eingezogen zu werden.
Die Mädchen müssen zusehen, wo sie einen Hoferben abbekommen. Wenn ihnen das nicht gelingt, geistern sie als Magd auf dem Hof ihres ältesten Bruders und werden für den Rest ihres Lebens nicht wahrgenommen, insbesondere von der angeheirateten Frau des Hoferben nicht. Die drei anderen Söhne wandern nach Hamburg, ins Ruhrgebiet und nach Sachsen aus. Dem Ältesten ergeht es in Hamburg besser als meinem Vater im Ruhrgebiet, aber schlechter als seinem Bruder in Sachsen.
Zwar bleibt es eine Plackerei, die Schiffe im Hamburger Hafen zu entladen und zu beschicken. Aber der ältere Bruder hat das Glück, eine Frau aus dem Bürgertum kennenzulernen. Die Familie der Frau ist nicht begeistert, bis der Familienvorstand seine Leute daran erinnert, dass er sich vom Schauermann aufwärts hochgedient hat. Der Frau des Hamburger Bruders wird in Grotebühl und der weiteren Verwandtschaft übel genommen, dass sie glaubt, etwas Besseres zu sein. Vielleicht ist es nur ihr Hamburger Dialekt. Wenn sie durch ihre Nase spitzer als der spitzeste Stein spricht, weiß keiner in Grotebühl, was er antworten soll. Allenfalls lässt sich etwas sagen, wenn man hinter ihrem Rücken spricht.
Der Schwiegervater ist beruflich ein Pfeffersack und in der Lage, weiter zu blicken. Deshalb weiß er nicht nur, dass der heraufziehende Krieg unvermeidlich ist. Vielmehr versteht er, wie man an ihm verdient. Wenn sein Schwiegersohn nicht an der Front erschossen werden will, sollte er sich freiwillig rechtzeitig bei der Wehrmacht melden. So würde er sich einen Druckposten sichern. Sofern er sich militärisch verpflichtet, kommt er von seiner Arbeit im Hafen weg. Die passt sowieso nicht in seine Familie. Also das Militär wäre gut für ihn, vergewissert sich der Hamburger Bruder, weil er es seinem Schwiegervater und der Familie, in der er eingeheiratet hat, recht machen will. „Wenn du in deiner Uniform an der Binnenalster marschierst und Heute gehört uns Deutschlandund morgen die ganze Welt singst, gefiele das meiner Tochter und sogar meiner Frau“, sagt der Schwiegervater. "Das fänden sie schick. Es muss ja nicht gleich die schwarze Uniform sein."
Als der Krieg ausbricht, hat sich der Hamburger Bruder zum Feldwebel hochgedient. Er lehrt die zwangsverpflichteten Rekruten, an immer neuen Fronten zu kämpfen. Die Soldaten, die vom Hamburger Bruder in den Krieg geschickt werden, eilen von einem Sieg zum nächsten, bis sich das Kriegsglück gewendet hat. Danach werden die Ausbildungszeiten kürzer. Der Feldwebel kann den Soldaten man eben das richtige Grüßen der Vorgesetzten beibringen, bevor der Oberbefehlshaber sie an die Front schicken muss.
Als sich der Krieg seinem Ende nähert, werden pubertierende Jugendliche ohne Ausbildung und fast ohne Bewaffnung an die Front geworfen. Sogar das Grüßen gilt fast als vernachlässigbar. „Ihr müsst sehen, wie ihr mit der Panzerfaust zurechtkommt“, sagt der Feldwebel. „Hier habt ihr ein Merkblatt. Lasst es euch gegebenenfalls von einem Spieß mit Fronterfahrung erklären, sollte genügend Zeit vor den Kampfhandlungen übrig geblieben sein.“ Am Ende ist der Feldwebel in seiner Rolle als Ausbildungsleiter überflüssig geworden. In den letzten Wochen des Krieges muss er selbst an die Front. „Untersteh dich, von unseren Feinden erschossen zu werden“, sagt der Schwiegervater. „Dafür gab ich dir nicht meine Tochter zur Frau.“
Der Bruder aus Hamburg wird von den heranrückenden britischen Truppen ins Bein geschossen. Das ist Glück im Unglück, da seine Kameraden zur Rechten und Linken tot umfallen. Nachdem sein verwundetes Bein unterhalb des Knies amputiert ist, humpelt er mit einem Holzbein einher.
Nach Kriegsende weiß die Hansestadt Hamburg die Verdienste des Bruders um unser Volk zu würdigen. Hat er nicht genügend viele junge Menschen in den Tod geschickt? Also vertraut ihm die Senatsverwaltung eine Position als Gerichtsvollzieher an. In dieser Eigenschaft entdeckt er ein Schnäppchen in Wandsbeck und ersteigert das Haus. So kann er seiner Frau ein schöneres Zuhause bieten als jemals in Grotebühl erbaut wurde. Er überlegt, ob er die buckelige Verwandtschaft einladen soll. „Bist du endlich zufrieden?“ fragt seine Frau. „Deine Familie wird mich nie akzeptieren“, antwortet der Hamburger Bruder, „und wenn ich dir ein Schloss geschenkt hätte.“ „Solches hättest du bei mir nicht nötig gehabt“, sagt die Frau. „Das hätte ich hören wollen, als ich Hafenarbeiter war“, sagt der Bruder aus Hamburg. "Damals hättest du nicht einmal Hochdeutsch verstanden", sagt seine Frau.
In einem Punkt trifft mein Vater es besser als seine Brüder in Hamburg und Sachsen. Als Bergmann muss er nur auf die siebente Sohle und nicht an die Front. Ohne den laufenden Abbau der Kohle ließe sich die Kriegsmaschine nicht in Gang halten.
Der jüngste Bruder ist der Liebling seiner Schwestern. Haben sie ihn nicht vom Tage seiner Geburt an hochgepäppelt? Zusätzlich ist er der Liebling seines Vaters. Das kommt, weil er von allen der Jüngste ist. Den jüngsten Sohn trifft es in Sachsen am besten. Er heiratet nicht in die bürgerliche Gesellschaft ein. Er bedient sie. Als Kellner hat sich der jüngste Bruder schick anzuziehen. Er stolziert mit Schwalbenschößen über die Weiden des Kirchspiels. Er zeigt den Bewohnern von Grotebühl soviel Geld, wie sie noch niemals gesehen haben. „Das ist alles Trinkgeld, das mir die Großen der Gesellschaft übereignet haben“, erklärt er.
Die Mädchen des Dorfes himmeln ihn an. So hätte er jede von ihnen bekommen können. Aber er zieht ein sächsisches Mädel vor. Als dieses zu Besuch nach Grotebühl kommen und ein kleines Mädchen vorzeigen will, sind alle gespannt. Kaum trifft sie ein, fällt die Verwandtschaft des Kirchspiels vor ihr auf die Knie. So was von Arbeitsamkeit und Hilfsbereitschaft und Bescheidenheit und Herzenswärme, sagen sie, und grenzen sich so von ihrer Hamburger Schwägerin ab. Die könnte beinahe eine von uns sein. Sogar der sächsische Zungenschlag ist weniger schlimm als er sich anhört. Kaum bricht der Krieg aus, wird der Bruder in Sachsen für die kommenden Kriegshandlungen in der Wehrmacht geschliffen. Bald marschiert er mehrere tausend Kilometer gen Osten. Dort und in Grotebühl und dazu in Sachsen wird er bis zum heutigen Tage vermisst.
Der Besuch meiner Schwester hat sich länger hingezogen als ich vorhatte. „Was sind das für Geschichten, die keinen was angehen?“ frage ich. "Das sind alles deine Verwandte", sagt meine Schwester, die mir wieder zu viel von Menschen erzählt hat, die mich nicht interessieren.
*
Mein Großvater genießt seine Tage, was auf dem Lande im Grunde verboten ist. Seine Kinder haben ihn zum vielfachen Großvater gemacht. Mittlerweile hat er derart viele Enkel, dass er sich nicht ihre Namen merken kann. Überall, wo er hinkommt, wird er von Enkelkindern erwartet. Die mittlere Generation spielt auch eine Rolle, aber die besuchte er ohne seine Enkel nicht.
Was das alles kostet, sagt der älteste Sohn verbittert zu seiner Frau. Es sind nicht nur die Reisekosten, die dermaßen ins Geld gehen. Der Großvater muss seinen Enkeln was mitbringen. Für die Enkelkinder stimmt nicht, dass der Großvater zu Weihnachten kommt. Vielmehr ist Weihnachten dann, wenn der Großvater kommt. So findet das große Fest für die Familie mehrere Male im Jahr statt. Mein Großvater fährt zu seinen Enkeln, wann er dazu Lust hat. Die Arbeiten auf dem Hof überlässt er seinen Erben. „Ne, ne, dat schöne Geld“,, sagt die Schwiegertochter.
Das wichtigste Ritual großväterlicher Besuche findet unmittelbar nach der Ankunft des Großvaters statt. Kurz zuvor ist mein Cousin mütterlicherseits mit seiner Familie eingetroffen. Mein Großvater hat an die Tür geklopft. Ihm wird aufgemacht. Der Großvater stellt sich in die Tür und lacht, weil er in Wahrheit der Weihnachtsmann ist. Wir Kinder stoßen uns mit den Ellenbogen an. Das ist eine Überraschung, dass der Großvater zu uns gekommen ist. Das mimen wir, wie unsere Eltern von uns erwarten.
Wir erfahren nicht, ob die Eltern wussten, dass der Großvater kommen wird. So oder so spielen sie das Spiel des Großvaters mit. Mit übertriebenen Gebärden stoßen sie ihre Kinder darauf, dass der Großvater gekommen ist. "Das hätten wir selbst nie herausgefunden", rufen wir. Beide Elternteile fragen uns, was gleich passieren mag. „Überraschung, Überraschung“, rufen wir, weil wir nach wie vor wissen, was sie erwarten.
Der Großvater holt hinter seinem Rücken einen Sack hervor. Er ist prall gefüllt. „Ho, ho, der war nicht einfach zu schleppen“, ruft er. Mit großer Gebärde schüttet der Großvater seinen Sack vor uns aus. Bei den Geschenken handelt es sich um kleine Süßigkeiten. Dazu kommt vielleicht eine Tafel Schokolade. Das eine und andere Spielzeug aus Holz oder Blech mögen dabei sein. Die Geschenke springen in alle Ecken. Unter den Enkelkindern des Großvaters setzt ein lustiges Gebalge ein. Der Großvater sieht auf das Darüber und Darunter wie das Holterdiepolter und erkennt statt seine Enkelkinder nur einen Wirbel. In unserer Familie wird das Einsammeln der Geschenke von meinem Cousin gewonnen. Im Wettbewerb vergisst er, dass er seine Beute später in Teilen wieder herausrücken muss. Damit verdient er sich ein Sonderlob, indem beide Väter sagen, mein Cousin habe gezeigt, dass er ein richtiger Junge sei.
„Das ist eine Geschichte über meinen Großvater“, sage ich. „Es ist keine Geschichte über mich. Wenn der Großvater war, wie du ihn beschrieben hast, hat er uns nicht einmal als individuelle Person erkannt.“ „Als du ein Kind warst, konntest du dich über rollende Schokoladenkugeln freuen“, hält meine Schwester dagegen. „Ich fand es sehr schade, dass unser Oppa so früh gestorben ist.“ „Wäre er seltener gereist und hätte er weniger für seine Enkelkinder ausgegeben, hätte ihn seine Schwiegertochter vielleicht nicht mit Rattengift umgebracht“, mutmaße ich.
Das sei eine Verleumdung des alten Dürkopp gewesen, wendet meine Schwester ein. Der habe es nicht verknusen können, dass sein Hof noch kleiner als der vom Oppa gewesen sei. Alle Mitglieder unserer erweiterten Familie seien anderer Meinung als der alte Dürkopp gewesen. Hatte unsere Familie nicht ein Interesse daran, ein Vorkommnis wie dieses unter den Teppich zu kehren, frage ich. Aber ich erkenne an, dass sich mein Großvater von den in Grotebühl herrschenden Zwängen so weit wie ihm möglich war freigemacht hat. Allerdings hat ihm das sein Leben gekostet.
*
1943 prägen sich die eigentümlichen Merkmale meiner Mutters stärker aus. Oder so meinen die Leute. Sie zieht mir des öfteren Mädchenkleider an. Sie schenkt mir Puppen statt Panzer zum Spielen. Gelegentlich spricht sie so zärtlich zu mir als sei ich ein Mädchen. Sie knuddelt mich manchmal, als ob sie von Sinnen sei. Mein Vater sagt meiner Mutter: „Wie soll aus dem Kind ein richtiger Junge werden, wenn du ihn verzärtelst?“ Ich werfe ihm böse Blicke zu. Vielleicht ärgere ich dich später, denke ich, und lese viele Bücher. Nicht, dass mein Vater 1943 meine Blicke bemerken könnte.
Ich habe drei Erinnerungen an meine Mamma, die möglicherweise nicht durch die späteren Erzählungen meiner Schwester verfälscht werden. Oder ich glaube, sie zu haben. Diese ist die erste: Ich sitze im Wohnzimmer und spiele mit Klötzchen. Meine Mamma wuselt im Wohnzimmer um mich herum. Ich merke, dass meine Mamma nicht im Wohnzimmer ist. Ich stehe auf und laufe auf wackeligen Beinen ins Nebenzimmer. Das ist unser Schlafzimmer. Dort finde ich sie. Sie nimmt mich auf den Arm und lacht. Sie fragt: „Hast du mich gesucht?“ Ich schmiege mich an sie. Meine Mamma redet weiter. Mir genügt der Klang ihrer Stimme. Ich atme ihren Duft ein. Meine Mamma war nicht da. Ich habe sie gesucht und gefunden.
Dies ist die zweite Erinnerung an meine Mutter: Wir sitzen im Keller und rücken zusammen. Über uns bombardieren die Flotten der Alliierten solange das Ruhrgebiet, bis nichts übrig bleiben wird. Die Leute sind auch außerhalb des Bombenkellers freundlich zu mir. Aber jetzt sind sie noch freundlicher, weil ich sie von ihrer Furcht ablenke. Eine Person nach der anderen kommt bei mir vorbei, sagt: „Du, du“ und kneift mir die Wange. Ich spiele mit meinen Puppen Theater im Bombenkeller. So entsteht die eine und andere Geschichte. Die Leute im Keller haben sich um mich gruppiert. Am Ende gibt es Beifall und danach Applaus. Anschließend nimmt mich meine Mamma auf den Schoß. Bald gehen wir gemeinsam nach oben.
Das ist meine dritte Erinnerung an meine Mutter: Auf unserer Etage wohnen vier Parteien. Frau Bondzio ist eine von ihnen. Herr Bondzio tut, als erweise ihm seine Frau einen Gefallen, wenn er bei ihr wohnen darf. Den spräche keiner an, wenn er etwas von den Bondzios will. Der Mann hat genug damit zu tun, in den Schacht einzufahren und lebendig zurückzukehren, sagen die Kollegen. Ist das nicht der Mann mit zwei linken Händen, der auf jeder Schicht vom Unfall bedroht ist? Herr Bondzio wird von der Zeche entlassen, damit er nicht mehr sich und andere gefährdet. Als er ohne Lohntüte nach Hause zu kommen versucht, wirft ihn Frau Bondzio aus der gemeinsamen Wohnung.
Bis dahin scheint eine Art Gleichgewicht zwischen ihrem Mann und dem Kostgänger bestanden zu haben. Als der Ehemann aus dem Rennen geschieden ist, geht Frau Bondzio allein mit ihrem Kostgänger aus. Wer regelmäßig in die Gaststätte mit Dortmunder Kronen Bier einkehrt, sollte Frau Bondzio kennen. Wer hätte nicht ihr lautes Lachen gehört? Frau Bondzio fährt ihrem Kostgänger in der Kneipe im Erdgeschoss schroff über den Mund. Sie scherzt mit einem anderen Mann an der Theke. "Das muss ich mir nicht ein Leben lang antun", sagt der Kostgänger und zieht aus der Wohnung von Frau Bondzio aus.
Unsere Nachbarin bleibt guter Dinge und lädt zu Feierlichkeiten auf unserer Etage ein. Wer bald zur Schicht muss, ärgert sich, weil er bei diesem Lärmen auf der anderen Seite des Flurs schlecht einschläft.
Frau Bondzio umschmeichelt meine Mutter. Mein Vater sieht nicht gern, dass die beiden sich anfreunden. Er grummelt, Frau Bondzio führe ein leichtfertiges Leben. Was soll daran schlimm sein, ab und an ein Plausch an der Treppe? Das hat vielleicht meine Mutter gesagt.
Frau Bondzio deutet an, das Geld liege heutzutage auf der Straße. Einmal mit den Leuten lachen und scherzen, schon habe man sich einen schönen Abend gemacht. Danach könne man sich ein schönes Teil kaufen. Wie das? Meine Mutter ist verwundert. Frau Bondzio lacht. Schöne Sachen kaufen, sagt sie, wer möchte das nicht? Meine Mutter sieht Frau Bondzio aus großen Augen an. Sie träumt von einem Leben in der Stadt, das aus mehr als zwei Zimmern auf der dritten Etage oberhalb einer Kneipe mit Dortmunder Kronen Bier besteht. So stelle ich sie mir mitunter vor.
Komm mit, sagt Frau Bondzio. Wir machen uns einen schönen Tag. Hat nicht dein Mann Mittagsschicht? Dann fällt keinem was auf. Die anderen Kinder sind versorgt, sagt meine Mutter. Aber was mache ich mit meinem kleinen Jungen? Den nehmen wir mit, sagt Frau Bondzio. Ich sitze in Mädchenkleidern in der Kneipe mit Dortmunder Kronen Bier. „Der fängt ja früh an“, könnte einer der Gäste gesagt haben. Ein anderer fragt: „Was, das ist ein Junge?“ Ansonsten sind alle Gäste freundlich zu mir.
Gibt es nicht viele Sachen, die man sich kaufen möchte, fragt Frau Bondzio anlässlich ihres morgendlichen Plausches. Hast du das wunderschöne Teil im Fenster gesehen? Ich fand unseren gemeinsamen Abend auch lustig, sagt meine Mutter. Komm, ich beteilige dich an meinen Einkünften, sagt Frau Bondzio. Wir gehen gemeinsam einkaufen. Aber frage mich nicht, wie ich an das Geld komme. Wenn du darüber nichts sagen willst, musst du auch nicht, sagt meine Mutter. Du bist gar nicht neugierig, wie, fragt Frau Bondzio.
Über meine Mutter wird getuschelt. Was hat sie mit Gottfried Vacek im Sinn? Ein Kumpel sagt zum anderen: "Oberhalb der Kneipe mit Dortmunder Kronen Bier leben zwei Frauen." Mein Vater ist der letzte, der etwas erfahren wird. Das sind alles nur Andeutungen. Aber als er misstrauisch geworden ist, meint er, dass er Bescheid wissen müsse. „Ey, Steiger“, sagt er. „Kannst du dafür sorgen, dass ich vor Schichtende rauskomme?“ Mein Vater hat selten gefehlt. Er ist nur widerwillig in die Gewerkschaft gegangen, als man noch durfte. Wenn der Steiger ausnahmsweise eine Ausnahme macht, womöglich bei ihm. Andererseits kennt der auf Massenproduktion fixierte Bergbau keine abweichenden Fälle.
Mein Vater kommt unverhofft früher nach Hause. Ausnahmsweise ist die Wohnungstür abgeschlossen. So muss er den eigenen Schlüssel nehmen. Im Wohnzimmer ist keiner. Er macht die Tür zum Schlafzimmer auf. Dort ist auch niemand. Wo sind nur wir Kinder? Sollten wir uns in der Wohnung aufhalten, dann sieht uns mein Vater nicht.
Ein Mann kommt aus dem Kabuff hinter dem Wohnzimmer. Er grinst meinen Vater an und geht an ihm vorbei. Er verlässt die Wohnung. Es ist zu hören, wie er die Treppe herunter läuft. Mein Vater geht in das Kabuff hinter dem Wohnzimmer. Dort ist meine Mutter. Sie nestelt an ihrer Kleidung. Es gibt ein Geschrei. Mein Vater reißt meiner Mutter die Klamotten vom Leib. Er will sehen, ob er Samenspuren des Mannes am Unterleib meiner Mutter erkennen kann. So hat mir das später meine Stiefmutter erzählt.
Meine Schwester und ich kommen ins Spiel oder auch nicht. Jedenfalls sitzen wir im Wohnzimmer. Meine Mutter ist in das Schlafzimmer geflüchtet und hat die Tür zum Schlafzimmer abgeschlossen. Mein Vater hockt vor der Tür. Ich schaue auf sein Gesicht, das von Wut und Schmerz verzerrt ist. Meine Mutter schreit, mein Vater möge ihr verzeihen. Mein Vater ruft zurück, nein. Meine Mutter schreit, dann springe sie aus dem Fenster. Mein Vater sagt, dann tu´s doch.
*
Man hat mich aus dem Ruhrgebiet gefahren und aufs Land katapultiert. So schlimm ist das nicht, nachdem ich mich an die neuen Leute gewöhnt habe. Meine Tante hat den Ofen im Wohnzimmer angemacht, weil Besuch erwartet wird. Jetzt bullert er kräftig. Als der Besuch gekommen ist, nimmt mich mein Onkel auf den Schoß. Ich werde schläfrig. Die Leute unterhalten sich. Ich wundere mich, weil ich auf einmal alles verstehe. Bald werde ich selbst Plattdeutsch sprechen. Mit diesem Gedanken schlafe ich ein.
Am nächsten Morgen sitze ich am Fenster. Ich schaue hinaus auf den vielen Schnee. Mein Onkel kommt herein. Sonst spricht er selten mit mir. Diesmal haben sich um seine Augen Fältchen gebildet. Ich bin sicher, dass er einen Scherz machen will. Mein Onkel behauptet, ein Zigeuner befinde sich im Anmarsch. Der wolle mit mir sprechen. Er fragt: „Wutte mol kieken?“
Mein Herz rast. Ich springe vom Stuhl herunter und laufe nach draußen. Zwischen dem dritten und vierten Telegrafenmasten vom Hof aus gesehen kämpft sich eine Person durch die Schneewehen in meine Richtung. Sie ist zurückgekommen, denke ich. Ich laufe ihr entgegen. Zwischen dem ersten und zweiten Telegrafenmasten bleibe ich stehen. Die Enttäuschung schnürt mir den Hals ab. Es ist nur mein Vater. Die rote Wut steigt in mir hoch. Sie verfliegt wieder. Ich habe vergessen, was ich eben gedacht habe. Langsam gehe ich meinem Vater entgegen.
2. Kapitel 1943 - 2013 1000 tote Geschichten von der Liebe zum Land
Vom Land, wie ich es einst kennen gelernt habe, sind nur tausend tote Geschichten übrig geblieben. Von Grotebühl werden nur der Name und ein Punkt auf der Landkarte weiter geführt. Ich wollte nie zurück, aber 2013 reitet mich der Teufel. Ich fahre dorthin.
Grotebühl hat sich politisch und wirtschaftlich zu einer Vorstadt von Brackenberg, kulturell zu einer alle Grenzen überwindenden Gemeinschaft, bestehend aus den Zuhörern von RTL und SAT1, entwickelt. Wenn ich mich mit dem Wagen beeile, kann ich dort in zwei Stunden physisch präsent sein. Der Flughafen Hannover ist nicht so weit entfernt, dass ich nicht binnen 24 Stunden überall auf der Welt meinen Auftritt haben könnte, nachdem ich meine Vortragsfolien in letzter Minute auf einem Zwischenstopp am Großen Moor rekombiniert und rekonfiguriert habe. In Grotebühl haben sich neuerdings Planungsbüros, Unternehmensberatungen, Werbeagenturen, Praxen für alternative Medizin und Kunsthandwerker niedergelassen. Die sich allmählich entfaltende Gastronomie hat sich dank der Entwicklungshilfe italienischer und griechischer Unternehmer gegen beharrliche norddeutsche Widerstände fast normalisiert. Es gibt keine Bauernhöfe und keine Landwirtschaft mehr, allenfalls industrialisierte Milchfabriken fast ohne Betreiber.
Soweit die neuen Dienstleister die Bauernhöfe übernommen haben, halten sie am Prinzip der Musealisierung fest. Es wird wichtig, ob die Milchkannen früher rot angestrichen waren oder metallisch glänzten. Folklore ist zu einem Wirtschaftsfaktor geworden und wird mit Kultur gleichgesetzt. Aber sie muss, so entnehme ich den geleckten Broschüren, die mittlerweile sogar Grotebühl erreicht haben, wahr und authentisch sein. „Wir sollten uns noch einmal diese Kennzahl ansehen“, sagt der Unternehmensberater, während er mit seinem Kunden über die Deele schreitet und nebenbei einen Rhythmus auf eine der herumstehenden Milchkannen trommelt. „Schön haben Sie es hier“, sagt der Kunde. „Diese historisierten Bauernhöfe lassen sich erstaunlich gut refinanzieren“, sagt der Berater und legt ihm geeignete Anlagemodelle dar.
Die Gemeinde Grotebühl hat sich in ein Potemkinsches Dorf verwandelt. Sie gibt vor, etwas zu sein, was sie seit langem nicht mehr ist. Ich steige aus dem Wagen und umrunde den Marktplatz. Als ich woanders hinfahren will, wo mich keine Erinnerungen plagen, werde ich von einem Mann meines Alters angesprochen. „Sech mol“, sagt er, „biss du nicht Mörkers Gerd?“ Ich sage, der sei ich gewesen. „Ja, kennsse mich nicht mehr?“ fragt der Mann. „Ick bin der Walter, dien Cousin.“ „Mensch, Walter“, sage ich und tue, als ob ich ihn wieder erkenne.
Für heute abend hat die Volkshochschule zu einem Fernsehabend mit anschließender Diskussion eingeladen. Die Männer kommen auch zu den Abenden, aber erst, seit ihnen Schluck eingeschenkt wird. Ich möge auch kommen, sagt Walter und zählt auf Anhieb drei weitere meiner Cousins auf, die gleichfalls kommen dürften. "Was, nur drei meiner Vettern?" frage ich zurück. "Er kürnt uk mehr würn", sagt Walter. "Et sünd ower uk schon feerle doode" Gemeinsam wollen wir auf Desperate Housewives und Sex and the City schauen. Anschließend wird mit der stellvertretenden Vorsitzenden der Volkshochschule Brackenberg über die Not in den Suburbs und den Metropolen diskutiert.
Heidi Klum und Dieter Bohlen wurden gleichfalls auf den Sitzungen zur Programmplanung der VHS Brackenberg als des Ansehens und der anschließenden Diskussionen für würdig vorgeschlagen. Das hat die stellvertretende VHS-Direktorin aus Qualitätsgründen abgelehnt. Die nicht ganz so anspruchsvollen Programme sollte man sich besser direkt auf den früheren Höfen ansehen.
*
Wir sind auf dem Hof angekommen, das sind mein Vater, meine Schwester und ich. Die Betreiber des Hofes haben sich am Hauseingang aufgestellt. Das sind meine Tante, mein Onkel und die jüngere Tochter. Die ältere Tochter befindet sich auf einem der größeren Höfe in einer Nachbargemeinde in Stellung. Das jüngste Kind, ein Junge, ist seit Jahren im Krieg. Der schwarze Hund neben meinem Onkel ist einen halben Kopf größer als ich. Er hechelt, als habe er ein Rennen hinter sich gebracht. Er sieht zum Fürchten aus, aber nur für Menschen, die älter als drei Jahre sind. Es zuckt in seinem Schwanz, während er mich anschaut. Ich gehe dem Hund mehrere Schritte entgegen und kommuniziere mit ihm auf vegetativer Ebene. „Datt issn Hund for die, watt?“ fragt meine Tante.
Als eine unter drei Schwestern hat meine Tante den kleinsten Hof abbekommen. Als einzige hat sie sich spontan bereit erklärt, die Kinder ihres Bruders aus dem Ruhrgebiet aufzunehmen. Das rechnet ihr mein Vater hoch an. Meine Tante hat ihr Versprechen voreilig abgegeben. Daher muss sie meinen Onkel im Nachhinein beknien, damit dieser einverstanden sei. Mein Onkel macht nie viele Worte und sagt auch diesmal nur: „Ja.“
Ich lerne meine anderen Tanten väterlicherseits in den nächsten Monaten kennen. Sie kommen zu Besuch auf den Hof, kneifen mir in die Wange und sagen: „Du, du.“ Oder sie hocken zusammen und reden über mich: „Der arme Kleine ist erst drei Jahre alt. Aber er stapft tapfer einher.“ Ich werfe böse Blick um mich, als ich das höre. Ich stapfe keineswegs tapfer einher. Ich merke mir, dass sie meine Schwester übersehen.
Als es Abend geworden ist, stellt sich heraus, dass ich auf dem Hof übernachten soll. Meine Tante spricht in verschwörerischem Ton, als würde mir ein größeres Geschenk gemacht: „Heute nacht kriegst du ein eigenes Bett.“ Mein Vater sagt ähnlich: „Du wolltest doch immer dein eigenes Bett haben.“ Das ist alles nicht wahr. Ich wette, dass ich über den Tisch gezogen werden soll, und begreife dennoch nicht, wie mir geschieht. Zorn steigt in mir hoch und verflüchtigt sich.
Am nächsten Morgen stehe ich auf, ohne gerufen zu sein. Die Betreiber des Hofes sind längst aufgestanden, weil das Vieh zu früher Stunde versorgt werden muss. Mein Onkel und seine Tochter arbeiten auf den Feldern. Meine Schwester hat ein Mädchen kennen gelernt, das vielleicht ihre Freundin wird. Sie spielt mit ihm auf einem der benachbarten Höfe. Wo ist mein Vater? Ich warte, bis meine Tante von den Feldern zurückgekehrt ist. Sie erklärt mir, dass mein Vater am frühen Morgen ins Ruhrgebiet zurückgefahren ist. Ich setze mich an den Tisch und beginne zu weinen. Zwar nütze ich jeden Anlass, meinem Vater Widerstand zu leisten, aber hier und jetzt tue ich das nicht. „Deine Schwester kommt gleich wieder“, sagt meine Tante. Er hat mich und meine Schwester zurückgelassen, denke ich und weine weiter. „Nu, nu“, sagt meine Tante. Sie sagt das in freundlichem Ton, so dass ich meiner Tante den Gefallen tue und still bin.
Meine Tante fragt mich, ob ich mit dem schwarzen Hund spielen möchte. Er sei im Stall und warte auf mich.
*
Die Landbevölkerung weist ihre Überlegenheit gegenüber den Städtern über einen Scherz nach. Diese wollen keine Butter von den Kühen. Sie wollen sie aus der Molkerei. So werden die Stadtmenschen als ignorant und anspruchsvoll wenn nicht frech hingestellt.
Meine Schwester ekelt sich bei dem Gedanken, etwas zu sich zu nehmen, was aus mächtigen ihr unheimlichen Kühen kommt. Sie will die Butter, nein, nicht aus der Molkerei, die sie nicht kennt, sondern aus dem Geschäft. Meine Tante weiß Rat. Sie geht in die Futterküche und kehrt mit einem guten Pfund weiterer Butter in die Wohnstube zurück. Diese Butter sieht zwar aus wie die von den Kühen, aber sie kommt, wie meine Tante weiß, aus dem Geschäft. Meine Schwester isst das Brot mit der Butter aus dem Geschäft. Mein Onkel, meine Tante und ihre älteste Tochter lächeln einander an. Es ist Besuch aus der ferneren Verwandtskopp gekommen. Die muss gleichfalls lachen.
Ich empöre mich. Finden sich unsere ländlichen Verwandten in den Städten zurecht? Mussten wir sie nicht an die Hand nehmen und ihnen erklären, was eine Straßenbahn ist? Wären sie nicht elend zugrunde gegangen, hätten wir sie auf dem Ostenhellweg zurückgelassen? Wut überwältigt mich. Erst hat man uns alles genommen und sich dann über uns lustig gemacht. Die Leute am Tisch sehen meinem Wutausbruch entgeistert zu. Wie schafft es ein Dreijähriger, so ungebärdig zu werden?
Wohl nehme ich wahr, dass ich den Grund meiner Wut nicht erklären kann. Also zeige ich auf die identischen Butterhaufen. „Das esse ich nicht“, schreie ich. Meine Tante weiß abermals Rat. „Das musst du nicht essen“, sagt sie auf hochdeutsch und streut Zucker auf mein Brot. „Honig esse ich auch nicht“, sage ich, weil ich unter diesen Umständen nicht daran denke, Kompromisse zu schließen. Das versteht auch keiner. „Äht man, äht“, sagt meine Tante und schiebt mir das Zuckerbrot zu. „Nöhdicht watt nich.“ Ich weiß, sie meint das nicht so. Sie würde mich immerdar nötigen, wenn ich nicht äße. Ich beruhige mich und beiße ins Brot. Dieser Kompromiss mit den Zuckerbroten wird mir in frühen Jahren viele Zähne kosten, aber das weiß ich jetzt nicht.
*
Meine Magenschmerzen bekomme ich, sobald ich aufs Land gezogen bin. Ich habe sie für meinen Geschmack viel zu oft. Es schadet nur, über meine Krankheit nachzudenken. Kaum fällt sie mir ein, fliegt sie mir zu. Es mag mittlerer Nachmittag sein, bis sich ein klarer Schmerz herauskristallisiert. Danach wird es jede Stunde schlimmer. Irgendwann gehe ich ins Bett. Meine Tante gibt mir eine Wärmflasche. Das lindert die Schmerzen. Mitten in der Nacht wache ich auf. Die Schmerzen sind unerträglich geworden. Manchmal holen mein Onkel und meine Tante mich zu sich ins Bett. Ich liege zwischen ihnen. Mein Onkel legt mir eine starke Hand auf den Magen, um ihn zu beruhigen. Ich schlafe entspannt ein.
In anderen Nächten ist es ganz anders. Meine Schmerzen streben ihrem Höhepunkt zu. Mir wird übel. Ich erbreche mich. Meine Tante hat mir einen Eimer hingestellt. Bis dahin schaffe ich es meistens. Danach bin ich erschöpft. Ich rolle mich zusammen und schlafe ein. Am nächsten Morgen stehe ich auf wackligen Beinen. Aber die Magenschmerzen sind bis zum nächsten Mal weg.
Als mein Vater zu Besuch kommt, werden meine Schmerzen nur nebenbei erwähnt. Krankheit ist auf dem Lande, was man haben kann und vorübergeht. Sie wird ungern gesehen, weil der Mensch zum Arbeiten auf die Welt gekommen ist und Simulieren verachtenswert ist. Man kann an einer Krankheit sterben, aber da muss man durch.
Mein Vater ist knappschaftsversichert und kostenfreie ärztliche Betreuung gewöhnt. Aber so schlimm schätzt er meine Schmerzen nicht ein, dass er mit mir zu seinem Knappschaftsarzt ins Ruhrgebiet fährt. Die Landbevölkerung ist nicht krankenversichert. Die Ärzte sind dünn über die Dörfer gesät und verlangen viel Geld. Meine Tante meint, dass es Ärzte gäbe, die nicht Bescheid wüssten. Diese Aussage ist so formuliert, dass sie nicht zu beanstanden ist. Das Gespräch mit meinem Vater bleibt offen. Als er ins Ruhrgebiet zurückgekehrt ist, wird nichts unternommen. Beiläufig erwähnt meine Tante ihre Schwiegermutter. Die ist fast siebzig und hat ihr Leben lang keinen Arzt gesehen.
Die Schwiegermutter ist zu Besuch gekommen. Sie kleidet sich wie alle älteren Frauen auf dem Lande in Schwarz. Wenn sie geht, weicht ihr Oberkörper zu mehr als dreißig Grad von ihrem Unterteil ab. Das kommt, weil sie sich zu lange beim Jäten der Rübenfelder gebückt hat.
Die Schwiegermutter hat sich auf einem Stuhl in der Futterküche unseres Hauses niedergelassen. Eine Hand hält sie auf ihren Stock. Mit der anderen Hand rührt sie den Muckefuck nicht an, den ihr meine Tante hingestellt hat. „Drink man, drink“, sagt meine Tante. „Nöhdicht watt nich.“ Aber die Schwiegermutter hat im Haus ihrer Schwiegertochter noch nie etwas getrunken. Mein Onkel kehrt von der Arbeit auf den Feldern nach Hause zurück. Er nickt seiner Mutter zu. Die Schwiegermutter bricht auf, ohne ein Wort gesprochen zu haben. Ich stehe am Zaun und schaue hinter ihr her. Die Schwiegermutter steht zwischen dem zweiten und dritten Telegrafenmasten. Sie bewegt sich nicht. Ich spiele längere Zeit mit meinem Hund. Als ich zum Zaun zurückkehre, hat sie sich doch bewegt und den dritten Telegrafenmasten erreicht.
Kurz darauf stirbt sie. Ich bin zu klein, um ihr den Abschied zu geben, obgleich jede Beerdigung auf dem Land eine willkommene Abwechslung ist. „Als es zu Ende ging, wollte sie nicht mal mehr ihre beiden Söhne sehen“, sagt meine Tante.
*
Wider alle Erwartungen kehrt mein Vater wieder, wenngleich nur auf Besuch. Es kann Monate dauern, bis er sich abermals ein paar Tage freimachen kann. Aber irgendwann kommt er. Wenn mein Vater nicht selbst kommen kann, schickt er Pakete. Während anderswo in den deutschen Städten gehungert wird, werden den Bergleuten Care-Pakete zugeteilt. Der Bergmann muss etwas auf die Rippen bekommen, damit er weiter malochen und die deutsche Wirtschaft aus Ruinen auferstehen lassen kann.
Wir packen ein besonders großes Paket aus dem Ruhrgebiet aus. Wir stellen die Geschenke aus den Vereinigten Staaten auf den Tisch und schauen sie andächtig an. Alle diese fremdländischen Verpackungen, die wir nicht verstehen. Wir kapitulieren vor einer gigantischen geriffelten Wurzel in gelb. Der Tochter des Hauses, die in der Schule einiges aufgeschnappt hat, verkündet: „Das ist Mais.“ Wir wissen immer noch nicht, ob das Viehfutter ist oder wir das essen dürfen.
Mein Vater ist persönlich gekommen, um nach seinen Kindern zu sehen. Ich laufe ihm entgegen und treffe zwischen den dritten und vierten Telegrafenmasten auf ihn. Ich spreche meinen Vater auf Platt an. Mein Vater versteht mich, auch wenn ihn jedes meiner plattdeutschen Worte verlegen zu machen scheint.
Ich sitze mit meinem Vater und meiner Tante am Tisch. Wie bei anderen Anlässen bleibe ich unbeachtet. Auf dem Lande kommt man fast ohne Geld aus, sagt meine Tante, obgleich, ganz stimme das nicht. Überraschenderweise habe sich ergeben, dass sie für die beiden angenommenen Kinder Ausgaben gehabt haben. Dafür komme er selbstverständlich auf, sagt mein Vater. Das sei keineswegs mit seinen monatlichen Überweisungen von 35 Reichsmark abgegolten. Meine Tante sagt, sie wolle nicht mehr Geld, sondern nur sagen, was ist. Mein Vater holt Geld aus dem Beutel und drängt es der Tante auf. Meine Tante sagt, sie wolle kein zusätzliches Geld, aber sie lässt es rasch in ihrer Schürze verschwinden.
Mein Onkel kommt vom Feld und setzt sich zu uns an den Tisch. Die Stimmen werden lauter, als befände man sich unmittelbar vor einem Streit. Ihre Worte wandeln sich zu einer Anklage gegen meinen Vater. Ich begreife, dass von meiner Mamma die Rede ist, aber sonst verstehe ich nichts. Das Gesicht meines Vaters ist von Schmerzen verzerrt. Er sagt: „Sie sagen mir nicht einmal, wo sie begraben liegt.“ Ich laufe nach draußen. Ich habe mir vor einiger Zeit im Garten ein Plätzchen zurecht gemacht. Dort kann ich kaum gefunden werden, weil mich die Rhabarberblätter verdecken. Ich versuche, auf das nächste Rhabarberblatt zu spucken. Das fällt mir leicht, weil Rhabarberblätter sehr groß sind. Zwischendurch weine ich und weiß nicht warum. Nach einiger Zeit gehe ich ins Haus zurück. Ich werde übertrieben freundlich empfangen. Aha, denke ich. Diesmal haben alle gemerkt, dass ich dabei war, als sie sich stritten.
Die Freundin meiner Schwester ist zum Spielen auf unseren Hof gekommen. Als sie mich durch das Fenster sehen, halten sie ein und schneiden mir Grimassen. Wut kommt in mir hoch und lässt sich nicht stoppen. Ich balle die Faust und schlage sie durch die Fensterscheibe. Blut läuft aus der linken Hand. Mein Vater schlägt mir ins Gesicht. Ich sehe ihn an und denke, dieser Mann kann halt nicht anders. Ich bin eine Weile weg. Als ich wieder zu mir komme, haben sie mir die Glassplitter aus der Wunde gezogen. Mein Vater fragt die anderen: „Hat er das öfter?“ „Das kommt ab und an vor“, sagt meine Tante auf Hochdeutsch. „Aber er kommt immer wieder zu sich.“ „Hattest du etwas?“ fragt mich mein Vater. „Was hattest du nur?“ „Weit ick nech“, sage ich. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen, weil er mich geschlagen hat.
Meine Schwester wird ernsthaft gescholten, aber erst, nachdem ihre Freundin nach Hause gegangen ist. Sie habe mich grundlos geärgert, behauptet meine Tante. „Jetzt kiek up das kaputte Fenster“, sagt sie. Wäre ich nicht wütend gewesen, hätte ich meine Schwester verteidigt. Immerhin verstehe ich sie. Sie wollte sich vor ihrer Freundin in Szene setzen. Mädchen müssen so sein, weil sie sich vor ihren Freundinnen fürchten.
*
Ist es wahr, frage ich meinen Vater anlässlich eines seiner Besuche. Wir sind spazieren gegangen. Mein Vater versucht, meine Fragen zu beantworten, aber er verliert häufig den Faden. Wenn wir nichts sagen, stapfen wir schweigend daher. Wir kehren in die Gaststätte des Zentrums von Grotebühl ein. Neben der Kneipe steht eine Kolonialwarenhandlung. Die Wirtschaft bietet ausschließlich Bier und Schnaps an. Mein Vater bestellt mir das erste Bier meines Lebens. Ich versuche des widerlichen Gesöffs Herr zu werden, indem ich mir ausschließlich den Schaum hereinziehe. Wie immer ich mich abmühe, zu viel bleibt von der ekligen Brühe zurück.
Ich habe gelernt, dass man nicht wütend sein darf, und wenn doch, einen Grund für seine Wut haben sollte. Diesmal habe ich mir für einen Zorn einen entlegenen Anlass gewählt. Es gibt Leute, die versuchen, meinen Hund schlecht zu reden. Die Rassehundevereine züchten immer einseitigere Merkmale in die Hunde, bis sie zur Zirkusattraktion werden. Ist das wahr, frage ich. Sie züchten ausschließlich nach dem Aussehen und nicht nach dem Charakter? Die überkandidelten Hunde sind von Geburt an so traumatisiert, dass sie nach der Möglichkeit hündischer Erkenntnis und dem Sinn ihres Lebens fragen? „Trink dein Bier aus“, sagt mein Vater. „Oder bist du angetrunken?“
Auf dem Lande werden Hunde aus großen Würfen verschenkt. Anders als wir haben sie alle ein unersättliches Bedürfnis nach Liebe. Mein Hund ist in Teilen ein Wolfsblut. Ansonsten ist er ein Mischling. Er kann den Hof bewachen und Schafherden umrunden. Es gibt keinen besseren Gefährten als ihn. Mein Hund und ich haben sich, kaum dass wir uns sahen, füreinander entschieden. Seitdem bleckt er die Zähne und beginnt leise zu knurren, sobald einer lauter mit mir spricht. Seine Haare sträuben sich, wenn man weiter mit mir redet. Das ängstigt die Menschen, so dass sie aufhören, mich zurechtzuweisen. Wenn mein Onkel mir etwas zu sagen hat, sperrt er den Hund zuvor in den Kuhstall. Bald beginnt mein Hund an der Stalltür zu kratzen und zu jaulen, weil er einen sechsten Sinn dafür hat, wann er mir beistehen soll.
Gemeinsam mit meinem Hund erobere ich die Welt. Wenn mein Hund und ich an einem der Höfe vorbei kommen, rufe ich: „Meuen.“ Mein Hund sagt auch: „Meuen“. Aber ihn hören die Nachbarn nicht. Die Nachbarn sagen: „Kiek mal, de Lütge.“ Oder sie fragen einander: „Ist dat Mürkers Gerd?“ Oder sie rufen mir zu: „Bisse am Spazeien?“ Nur unser nächster Nachbar, Heinrich Dürkopp, tippt sich an die Stirn, wenn ich vorbeikomme. Dieser Mann ist ein Enkel des alten Dürkopp. Mittlerweile wird er selbst der alte Dürkopp genannt. Er ist so unbeliebt ist wie seinerzeit sein Großvater, auch weil er die Kirche verspottet. So sagt er: "Ich glaube nur, was ich sehen und anfassen kann.“.
Dürkopp hat einen Sohn, der allgemein Bubi genannt wird, weil ihn seine Mutter im Kleinkindalter so rief. Bubi Dürkopp ist ein Jahr älter als ich und zwei Köpfe größer. Jeder unserer Versuche, miteinander zu spielen, endet damit, dass er mich verprügelt. Wenn ich mit meinem Hund vorbeigehe, kommt Bubi Dürkopp nicht aus dem Haus. Sogar der Bauer hat sich bis zu seiner Scheune zurückgezogen. Er beobachtet uns finster. Aber komme ich ohne Hund, lehnt Bubi Dürkopp hinter dem Zaun und fragt: „Wutte speerln?“ Neuerdings finden Bubi und ich wenig Zeit zum Spielen, weil der alte Dürkopp mir jedesmal Arbeiten auf seinem Hof zu verrichten gibt, um mich von seinem Haus fernzuhalten. Der Alte mag keine Kinder, nicht einmal den eigenen Sohn.
Die Dürkopps haben wie wir einen Hund. Das hätte ein guter Hund werden können, meint mein Onkel. Dazu schüttelt er den Kopf. Das ist das Äußerste, was er gegen einen Nachbarn zu sagen bereit ist. Nach der Arbeit des Tages kümmert sich der alte Dürkopp um seinen Hund, indem er ihn auspeitscht. Oder er setzt sich mit seinem Hund vor dem Hauseingang und quält ihn an den Geschlechtsteilen. Wenn der Hund seinen Schmerz herausjault, hört man ihn auf allen benachbarten Höfen im Brauk.
Links vom Dürkopp´schen Hof liegt der Brökelsiep`sche Hof. Der alte Brökelsiep ist ein freundlicher Bauer. Wenn ich an seinem Hof vorbeikomme, ruft er: „Bisse am Spazeien?“ Jetzt steht er hinter dem Zaun und hört zu, wie der alte Dürkopp seinen Hund foltert. Er geht ins Haus und wird an diesem Abend nicht mehr herauskommen.
Mein Hund und ich gehen dennoch in den Busk. Als wir aus dem Waldstück heraustreten, haben wir keine Hexen gefunden. Man möchte nicht, schließe ich, dass ich das Waldstück betrete, weil man uns in diesem Fall nicht von weitem über die Norddeutsche Tiefebene beobachten kann.
Auf dem Hof gibt man mir freiere Hand als früher den eigenen Kindern. Gegebenenfalls denken die Leute an meinen Hund. Auch fürchten sie meine Wut. Meine Schwester wird hingegen zur Arbeit herangezogen. Allerdings ist sie sieben Jahre älter als ich. Für was wäre ein Mädchen nütze, wenn es nicht arbeitet?
Mit den Hexen ist es ähnlich wie um den Weihnachtsmann bestellt, behauptet Bubi Dürkopp. Es gäbe sie beide nicht. „Ich will das nicht hören“, sage ich. Damit spreche ich ein erstes Mal aus, dass die schönere Geschichte die wahre sein könnte.
Ich sitze auf dem Boden mit etwas Spielzeug um mich herum. Als mein Cousin auf unserem Hof auf Fronturlaub war, hat er mir einen Panzer aus Holz geschnitzt.
Die alte Brökelsiep ist gekommen, um Klatsch zu verbreiten. Meine Tante zählt ihr auf, wer den Kindern bei uns was zu Weihnachten geschenkt hat. In meinem ersten Jahr in der Fremde hat mich nicht nur mein Vater beschenkt. Auch ein Teil der entfernteren Verwandtschaft hat mir Süßigkeiten und Spielsachen mitgebracht, weil ihnen ein mutterloser Junge von drei Jahren so was von leid getan hat. Ein Jahr weiter, und meine Verwandtschaft wird zu ihrer üblichen Knauserigkeit zurückfinden. Ich breche in Tränen aus, weil am Ende nichts übrigbleibt, was mir der Weihnachtsmann mitgebracht haben könnte. „Bin ick overhaupt nicht brav wähn?“ frage ich. Meine Tante nimmt mich ausnahmsweise in die Arme. „Junge, Junge“, sagt sie und hört rasch mit dem Tätscheln auf, „musse jümmer tauhörn?“
*





























