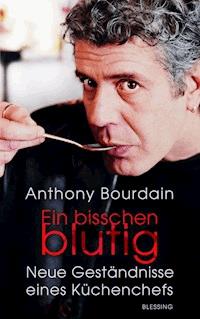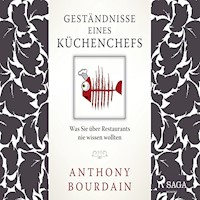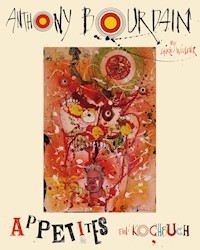Inhaltsverzeichnis
Widmung
Inschrift
Familientreffen
Ausverkauf
Copyright
Für Ottavia
Im großen Ganzen habe ich im Leben eine bessere Behandlung erfahren als der Durchschnitt der Menschen und vielleicht mehr liebevolle Güte erhalten, als ich verdiente.
Frank Harris
Familientreffen
Ich kenne die Männer an der Bar. Die Frau auch. Das sind die angesehensten Köche der USA. Die meisten sind Franzosen, aber alle haben sie hier Karriere gemacht. Jeder von ihnen ist ein Vorbild für mich, und das gilt auch für aufstrebende Postenchefs, Möchtegernköche und Kochlehrlinge im ganzen Land. Sie wundern sich offensichtlich, dass sie einander hier begegnen, dass sie ihre Kollegen auf den nur begrenzt zur Verfügung stehenden Barhockern aufgereiht vor sich sehen. Wie ich wurden sie von einem vertrauenswürdigen Freund unter einem Vorwand zu dieser nächtlichen Zusammenkunft in das berühmte New Yorker Restaurant gelockt. Wie ich wurden auch sie gebeten, Stillschweigen zu bewahren. Selbstverständlich werden wir alle kein Wort darüber verlieren.
Na ja … zumindest die meisten von uns.
Meine Reise-, Schriftsteller- und Fernsehkarriere, besser gesagt: Nichtkarriere, ist noch ganz jung, und mir wird immer noch abwechselnd heiß und kalt, weil ich mit diesen Leuten in einem Raum bin. Ich bemühe mich zu verbergen, dass es mir angesichts der Stars hier die Sprache verschlägt, dass ich vor freudiger Erwartung bebe. Ich bestelle mir einen Drink und bemerke, dass die Worte »Wodka auf Eis« seltsam piepsig klingen, die Hände sind feucht. Ich weiß nur so viel, dass ein Freund mich Samstagabend anrief, fragte, was ich am Montag vorhabe, und mich mit seinem markanten französischen Akzent beschwor: »Töö-nie … Du musst kommen. Das wird etwas ganz Besonderes.«
Nachdem ich das Tagesgeschäft in meinem einstigen Restaurant Les Halles abgegeben habe und mich - nach mehreren Lesetouren und vielen Reisen - (wieder) mit der bürgerlichen Gesellschaft vertraut gemacht habe, besitze ich mittlerweile mehrere Anzüge. Jetzt trage ich einen solchen und bin, wie ich meine, für den Besuch eines so renommierten Restaurants angemessen gekleidet. Der Hemdkragen ist zu eng und schneidet mir in den Nacken. Die Krawatte ist, wie mir jetzt schmerzlich bewusst wird, alles andere als perfekt gebunden. Als ich wie verabredet um dreiundzwanzig Uhr hier eintraf, hatten viele Gäste das Restaurant bereits verlassen. Man führte mich diskret hierher, in eine kleine, schwach beleuchtete Bar, die auch als Wartebereich dient. Ich war erleichtert, dass der Oberkellner nicht verächtlich die Nase rümpfte.
Ich kann es kaum fassen, X zu sehen, von dem ich gewöhnlich in demselben gedämpften und ehrfürchtigen Ton spreche wie vom Dalai Lama - ein Mann, der auf einer niedrigeren Frequenz zu schwingen scheint als andere, bodenständigere Küchenchefs. Überrascht stelle ich fest, dass er genauso aufgeregt ist wie ich und auf seinem Gesicht unübersehbar eine erwartungsvolle Spannung liegt. Er ist umgeben von der zweiten und dritte Welle von Franzosen der alten Garde, außerdem einigen jungen Rebellen und ein paar amerikanischen Küchenchefs, die es in ihrem Restaurant zu etwas gebracht haben. Und da sitzt die Patin der französischen Küchenmafia … Das ist das verdammte Who’s who der Spitzenküche im heutigen Amerika. Wenn dieses Gebäude jetzt in die Luft flöge? Die gesamte Haute Cuisine läge in Schutt und Asche. Ming Tsai müsste künftig bei jeder Folge der Kochsendung Top Chef als Gastrichter auftreten, und Bobby Flay und Mario Batali würden Vegas unter sich aufteilen.
Die letzten Gäste verlassen nach einem opulenten Mahl das Restaurant. Einigen von ihnen fallen die an der Bar versammelten, verschwörerisch flüsternden Köche auf, deren Gesichter ihnen irgendwie bekannt vorkommen. Die große Flügeltür zum privaten Bankettsaal öffnet sich, und wir werden hineingebeten.
Da steht eine lange Tafel mit dreizehn Gedecken. An der Wand biegt sich eine Anrichte unter dem Gewicht von Fleisch- und Wurstspezialitäten. So etwas hat - auch in dieser Gruppe - schon lange keiner mehr gesehen: klassische Wildterrinen nach Carême, Galantinen aus verschiedenen Geflügelarten, Pasteten, Rillettes. In der Mitte thront eine Wildschweinpastete en croûte mit bernsteinfarbenem Aspik zwischen Farce und Teigmantel. Ober schenken Wein aus. Wir bedienen uns selbst.
Einer nach dem anderen nehmen wir Platz. Am anderen Ende des Raums öffnet sich eine Tür, und unser Gastgeber erscheint.
Es ist wie die Szene aus Der Pate, als Marlon Brando die Vertreter der fünf Familien begrüßt. Fast schon warte ich auf die Worte: »Ich möchte Don Passini dafür danken, dass er mir geholfen hat, diese Konferenz hier heute zu organisieren. Danken möchte ich auch den Häuptern der anderen Familien aus New York und New Jersey, Carmen Cronio aus der Bronx und Brooklyn, Philip Tattaglia, Staten Island.«
Ein veritables Mafiatreffen. Mittlerweile spricht sich am Tisch herum, was man uns servieren wird. Die Spannung wächst. Es folgen eine Begrüßung und ein Dankeschön an denjenigen, der die Spezialität, die uns dargeboten werden wird, beschafft und ins Land geschmuggelt hat.
Zunächst folgen Ravioli in Brühe (herrlich) und ein Hasenpfeffer. Doch die Gänge driften an uns vorüber wie im Traum.
Die Teller werden abgeräumt. Die Ober in Livree, bemüht, ein Lächeln zu unterdrücken, legen neue Gedecke auf. Unser Gastgeber erhebt sich, und ein Servierwagen mit dreizehn schmiedeeisernen Kokotten wird hereingefahren. In jeder liegt ein winziger, brutzelnder Vogel, mit Kopf, Schnabel und Füßen, die Innereien noch im winzigen runden Bäuchlein. Wir lehnen uns alle vor und drehen den Kopf in dieselbe Richtung, als unser Gastgeber die Vögelchen mit Armagnac übergießt - und anzündet. Das ist es. Der Grand Slam der raren und verbotenen Gerichte. Wenn diese Zusammenkunft namhafter Küchenchefs schon kein Anlass ist, mich zu kneifen! So ein Mahl bekommt man, verdammt noch mal, nur einmal im Leben - die meisten Sterblichen, auch in Frankreich, gar nicht! Was wir jetzt essen werden, ist dort wie hier verboten: Fettammer.
Der Ortolan, auch Gartenammer genannt, Emberiza hortulana, ist ein finkenähnliches Vögelchen, das in Europa und Teilen Asiens heimisch ist und auf dem Schwarzmarkt bis zu 250 Dollar kostet. Die Art steht unter Schutz, weil ihre Nistmöglichkeiten schwinden und der Lebensraum schrumpft. Fang und Verkauf sind deshalb überall verboten. Der Ortolan ist außerdem ein Klassiker der französischen Landküche, eine Delikatesse wahrscheinlich schon seit der Römerzeit. Der französische Präsident François Mitterrand soll, so eine berühmte Anekdote, auf seinem Sterbebett als letzte Mahlzeit eine Fettammer zu sich genommen haben; der schriftliche Bericht darüber zählt bis heute zu den opulentesten Werken der Küchenpornografie, die je zu Papier gebracht wurden. Die meisten Menschen empfänden es wohl als abstoßend: ein sterbenskranker alter Mann, der darum ringt, ein Häppchen brühheißer Vogelinnereien und Knöchelchen hinunterzuschlucken. Aber Küchenchefs macht das an, diese Beschreibung des Heiligen Grals, des einen Gerichts, das man einmal im Leben zu sich nehmen muss, wenn man guten Gewissens von sich behaupten will, ein wahrer Feinschmecker zu sein, ein Weltbürger, ein Spitzenkoch mit Gaumenerfahrung - einer, der weit herumgekommen ist.
Es heißt, die Vögel werden in Netzen gefangen und durch das Ausstechen der Augen geblendet, um die Nahrungsaufnahme zu stimulieren. Ich bezweifle nicht, dass in früheren Zeiten tatsächlich so verfahren wurde. Angesichts der europäischen Arbeitsgesetze rechnet sich die Beschäftigung eines Augenausstechers heute jedoch nicht mehr. Eine einfache Decke oder ein Handtuch über dem Käfig ersetzt daher diese grausame Methode und sorgt dafür, dass sich der Ortolan unablässig mit Feigen, Hirse und Hafer vollfrisst.
Wenn die Vögel lange genug gemästet wurden und sich die erwünschte Fettschicht angefressen haben, werden sie getötet, gerupft und gebraten. Oft hört man, die Vögel würden gar in Armagnac ertränkt, doch auch das ist ein Mythos. Ein kleiner Spritzer von dem Zeug, und der nunmehr krankhaft fettleibige Ortolan kippt um und ist mausetot.
Die Flammen in den Kokotten verlöschen, und die Fettammern werden serviert, jedem Gast eine. Wir warten einen Moment, bis das Brutzeln von Fleisch und Fett ein wenig nachlässt. Wir sehen uns schmunzelnd an, legen uns dann alle gleichzeitig die Serviette über den Kopf - verbergen das Gesicht vor Gott - und nehmen den Vogel behutsam am heißen Schädel, wobei wir uns die Fingerspitzen verbrennen. Dann schieben wir ihn uns mit den Füßen voran in den Mund - nur Kopf und Schnabel schauen noch heraus.
Es ist dunkel unter dem Tuch, und in dem Bemühen, das Geschmackserlebnis voll und ganz auszukosten, habe ich unwillkürlich die Augen geschlossen. Erst kommt die Haut und dann das Fett. Es ist heiß. So heiß, dass ich kurz und panisch ein- und ausatme wie ein Trompeter bei einem schnellen Musikstück, rund um den Ortolan puste, ihn schwungvoll mit der Zunge im Mund herumschiebe, damit ich mich nicht verbrenne. Ich horche, ob um mich herum das Knacken brechender Knochen ertönt, höre die anderen aber nur atmen, unter einem Dutzend Leinenservietten gedämpft die Luft durch die Zähne ziehen. Ich rieche einen Rest Armagnac, einen Dunst von Fettpartikeln, der in der Luft liegt, eine berauschende, köstliche Mixtur. Die Zeit verrinnt. Sekunden? Momente? Ich weiß es nicht. Irgendwo in der Nähe höre ich das erste Knacken winziger Knochen und beschließe, es auch zu wagen. Mit einem feuchten Knirschen schließe ich langsam die Backenzähne um den Brustkorb des Vogels und werde belohnt von einem brühheißen Schwall von Fett und Innereien, der sich in meine Kehle ergießt. Mir wird schwindelig, ich atme in kurzen, kontrollierten Stößen, während ich weiterkaue, langsam, sehr langsam. Mit jedem Bissen vermischen sich die Knöchelchen und das Fett, Fleisch, Haut und Organe, ergeben sich mannigfaltige und wunderbare Aromen aus uralten Zeiten: Feigen, Armagnac, dunkles Fleisch und ein Anflug des salzigen Geschmacks, der von meinem eigenen Blut ausgeht, denn die scharfen Knochen stechen mir in den Gaumen. Während ich schlucke, ziehe ich auch Kopf und Schnabel hinterher, die noch aus dem Mund gehangen haben, und zermalme munter den Schädel.
Übrig bleibt Fett. Eine Schicht aus kaum wahrnehmbarem Bauchfett mit einem Geschmack, den man nie vergisst. Ich nehme die Serviette ab, und auch um mich herum sinken die Tücher auf den Tisch, und dahinter tauchen verzückt glasige Augenpaare auf, derselbe Ausdruck auf jedem Gesicht, mit dem Anflug eines schuldbewussten Lächelns, wie nach einem guten Fick.
Keiner nippt an seinem Wein. Alle wollen diesen Geschmack in Erinnerung behalten.
Rückblende, nicht allzu weit in die Vergangenheit. Immerhin kann ich mich noch lebhaft an den Gestank von lange nicht gewechseltem Frittierfett erinnern, an das abgestandene Warmhaltewasser, den versengten Grillrost mit der dicken Schicht alten Bratfetts.
Nicht gerade der Duft der Fettammer.
Ich arbeitete in einer Snackbar in der Columbus Avenue. Es war eine »Übergangsphase« in meiner Laufbahn, das heißt, ich vollzog gerade den Übergang von Heroin auf Crack, und ich trug ein weißes Polyesterhemd mit dem Namen der Wäscherei auf der linken Brusttasche, dazu eine schmutzige blaue Jeans. Ich machte Pfannkuchen. Und diese verdammten Eggs Benedict, also getoastete englische Muffins mit pochierten Eiern. Nur auf einer Seite gebräunt; mir war alles egal. Ich bereitete Spiegeleier mit vorgebratenem Speck zu, der nur in der Grillpfanne erwärmt wurde, und eine Joghurtspeise mit fiesem Obstsalat und Körnern drin. Ich konnte Omeletts mit verschiedenen Füllungen machen, und die Leute, die sich an die Theke setzten und ihre Bestellung aufgaben, sahen geradewegs durch mich hindurch. Das war auch gut so, denn hätten sie mich wirklich angesehen, mir in die Augen geblickt, dann hätten sie vielleicht gemerkt, dass der Typ vor ihnen jedes Mal, wenn ein Kunde eine Waffel bestellte, ihn am liebsten an den Haaren gepackt, ihm mit einem schmierigen stumpfen Messer die Kehle aufgeschlitzt und ihm das Gesicht anschließend auf das verdreckte, klebrige Waffeleisen gedrückt hätte. Hätte das blöde Ding auch nur annähernd so schlecht funktioniert wie mit Waffelteig, hätte man dem Opfer das Gesicht anschließend mit einem Buttermesser abkratzen müssen.
Ich war, wie man sich denken kann, nicht sonderlich glücklich. Immerhin, so rief ich mir immer wieder ins Gedächtnis, war ich Küchenchef gewesen. Ich hatte ganze Küchenbrigaden angeleitet, hatte die Macht kennengelernt, die Adrenalinschübe, wenn zwanzig oder dreißig Leute für einen arbeiten, die geballte Freude, die in einem Küchenteam herrscht, wenn es mit vollem Einsatz Gerichte kocht, auf die es zumindest im gegebenen Zeitrahmen und unter den jeweiligen Umständen stolz sein kann. Wer das sanfte Schmeicheln ägyptischer Baumwolle auf der Haut gespürt hat, dem fällt es besonders schwer, zu Polyester zurückzukehren, zumal wenn darauf als Firmenlogo ein dicker, freundlicher Koch prangt, der sich den Schnurrbart zwirbelt.
Damals glaubte ich, mich am Ende eines langen, absurden, merkwürdigen, wunderbaren, in letzter Zeit aber zunehmend schrecklichen Weges zu befinden, auf den stolz zu sein ich keinen Anlass hatte. Abgesehen von der Suppe vielleicht. Ich kochte Suppe. Gulaschsuppe.
Ich kratzte mit dem Pfannenwender die Bratkartoffeln aus der Pfanne und drehte mich um, weil ich sie neben die bestellten Spiegeleier auf den Teller geben wollte, als ich am anderen Ende des Raums ein bekanntes Gesicht sah. Ein Mädchen, das ich vom College kannte, saß mit Freunden am letzten Tisch. Damals hatte sie viele Bewunderer gehabt, weil sie so sagenhaft war (wir sprechen von den Siebzigerjahren, als sagenhaft sein zu den größten Tugenden zählte). Sie war wunderschön, glamourös - in künstlerisch angehauchter, ein bisschen dekadenter Zelda-Fitzgerald-mäßiger Art und Weise, schamlos, teuflisch klug - und angemessen exzentrisch. Ich glaube, sie ließ mich mal an ihrem Busen fummeln. Nach dem College stieg sie in Downtown Manhattan zu einer »Persönlichkeit« auf, stand mit ihren diversen Lyrik- und Akkordeonabenteuern immer kurz vor dem Durchbruch. In der alternativen Presse jener Tage las ich regelmäßig über sie. Als ich sie nun sah, versuchte ich instinktiv, mich in mein Polyesterhemd zurückzuziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht auch noch das spitze Papierkäppi trug, aber es kam mir ganz bestimmt so vor. Ich hatte sie nicht mehr gesehen seit der Schule, als auch ich in den Augen vieler eine Karriere vor mir hatte, die nicht ausgerechnet in einer Snackbar enden sollte. Ich betete, sie möge mich nicht erkennen, aber es war schon zu spät. Ihr Blick streifte mich, es folgte ein kurzer Moment des Erkennens - und der Traurigkeit. Doch dann war sie gnädig. Sie tat so, als habe sie mich nicht gesehen.
Ich glaube, damals schämte ich mich für die Imbissbude. Heute nicht mehr. Von meinem relativ luxuriösen Blickwinkel aus betrachtet - es duftet noch nach bedrohten Arten und gutem Wein, ich sitze im Bankettsaal und lecke mir das Ortolanfett von den Lippen -, wird mir klar, dass eins direkt zum anderen führte. Hätte ich in den Ferien nicht einen chancenlosen Job als Tellerwäscher angenommen, wäre ich nicht Koch geworden. Wäre ich nicht Koch geworden, hätte ich nie Küchenchef werden können. Wäre ich nicht Küchenchef geworden, hätte ich es nie dermaßen spektakulär vermasseln können. Hätte ich nicht die Erfahrung gemacht, wie es ist, etwas in den Sand zu setzen - und zwar so richtig -, und hätte ich nicht jahrelang in billigen New Yorker Klitschen Brunch zubereitet, wäre meine abscheuliche, aber wahnsinnig erfolgreiche Autobiografie nicht halb so interessant geworden.
Denn, nur damit wir uns verstehen: Ich sitze nicht mit den Göttern der Gastronomie hier an einem Tisch, weil ich so gut koche.
Das Dessert wird serviert, es ist Île flottante. Ein einfaches Baiser, das seinen Charme in einer Pfütze Crème Anglaise entfaltet. Alle sind begeistert von diesem prähistorischen Klassiker, der altmodischer nicht sein könnte. Wir aalen uns in der Wärme der Jovialität, unserer gemeinsamen Wertschätzung für dieses außergewöhnliche Mahl. Mit Calvados und Cognac stoßen wir auf unser Glück an.
Nein, das Leben ist durchaus nicht beschissen.
Aber die offensichtliche Frage bleibt unbeantwortet. Ich stelle sie mir im Stillen.
Was zum Teufel habe ich hier verloren?
Ich kann keinem Mann, keiner Frau hier am Tisch das Wasser reichen. Keiner von ihnen hätte mich, egal wann, je eingestellt, nicht einmal der Bursche neben mir. Und der ist mein allerbester Freund.
Was sollten Menschen, die so viel erreicht haben, mit meinem Buch, meinen Erinnerungen an ein mittelmäßiges, ja, erbärmliches Leben, anfangen können? Und wer sind diese Leute eigentlich? Sie sehen aus wie Prinzen, wie sie sich nach dem Essen zurücklehnen und eine Zigarette genießen. Sind das etwa die Verlierer, Sonderlinge und Außenseiter, die ich beschrieben habe?
Oder habe ich das alles nur falsch verstanden?
Ausverkauf
Als ich Geständnisse eines Küchenchefs schrieb, war ich in mancherlei Hinsicht himmelschreiend naiv, auch, was meine Abneigung gegen den Sender Food Network angeht. Aus meiner Perspektive der hektischen Restaurantküche wirkten Emeril und Bobby auf dem Bildschirm wie Wesen von einem anderen Stern: groteske Geschöpfe, die in einer bonbonfarbenen Galaxie, Welten entfernt von der meinen, aufgesetzte Fröhlichkeit verströmten. Sie hatten in etwa so wenig mit meinem Leben zu tun wie Barney, der lila Dinosaurier, oder das Saxofonspiel eines Kenny G. Dass die Leute, völlig fremde Leute, sie offenbar mochten und jedes Mal johlten und klatschten, wenn Emeril das Wort »Knoo-blauch« benutzte, steigerte meine Abneigung nur noch. In meinem Leben, in meiner Welt war es ein Grundprinzip, dass ein Küchenchef nicht liebenswert ist. Deshalb ist er Küchenchef. Im Grunde waren wir schlechte Menschen, und deshalb lebten wir auch so: Das halbe Leben bestand aus Arbeit und etwas Freizeit, die wir mit unseresgleichen verbrachten, gefolgt von der fragmenthaften Kopie richtigen Lebens, die uns dann noch blieb. Niemand liebte uns. Warum auch? Als Köche waren wir stolz auf unsere Außenseiterstellung. Wir waren Sonderlinge. Wir wussten, dass wir Sonderlinge waren, spürten die Leerstellen in unserer Seele, die Lücken in unserer Persönlichkeit, und genau das hatte uns zu unserem Beruf geführt, uns zu dem gemacht, was wir waren.
Mir war die Liebenswürdigkeit dieser Fernsehköche zuwider, denn sie kam einer Leugnung genau der Eigenschaft gleich, die ich immer als unsere herausragendste, charakteristischste betrachtet hatte: unsere Andersartigkeit.
Wie nicht anders zu erwarten, symbolisierte Rachael Ray alles, was ich an der schönen neuen Welt der Starköche für falsch hielt, alles, was mir völlig unbegreiflich war, denn sie war nicht einmal eine von »uns«. Damals fand ich es besonders ärgerlich, dass der Titel »Chef« jedem zugestanden wurde, der eine Schürze trug. Es tat weh. (Das tut es heute noch.)
Was für ein bedauernswerter Narr ich doch war.
Aber meine schlechte Meinung über Food Network reichte schon länger zurück, und zwar bis in die Zeit, als der Sender noch ein winziges und armseliges Unternehmen war. Seine Studios befanden sich in den oberen Stockwerken eines Bürogebäudes in der Sixth Avenue, die Einschaltquote belief sich auf etwa acht Leute, und die Qualität der Sendungen entsprach in etwa der von Kabelfernsehsoftpornos. Bis Emeril, Bobby und Mario den Sender zu einer mächtigen internationalen Marke ausbauten. In den alten Zeiten saßen Leuchten der Restaurantszene wie Donna Hanover (damals Giuliani), Alan Richman, Bill Boggs und Nina Griscom in winzigen, büroartigen Räumen, die kaum groß genug waren für die Kameras, und zeigten vorproduzierte Werbebänder, Schund von der Sorte, die über den Hotelkanal dudelt, wenn man im Sheraton den Fernseher anmacht. Sie kennen das vielleicht: glückliche »Gäste«, die unsicher auf ihren Meeresfrüchten herumkauen. Anschließend löffeln Alan, Donna, Nina oder Bill halbherzig ein paar Bissen vom »Käsekuchen nach Küchenchef Lou …, so was von lecker, oh-là-là!«, der in Wahrheit per FedEx direkt aus dem Ferienort oder irgendeinem anderen Rattennest kommt, das in der entsprechenden Woche beworben wird.
Einmal lud man mich ein, Lachs zuzubereiten. Damals arbeitete ich im Sullivan’s und verramschte gerade meinen Erstling, einen Krimi mit dem Titel Gaumenkitzel, den mein Verleger bereits abgeschrieben hatte. Als ich im Sender eintraf, fand ich einen großen und völlig verdreckten Küchenbereich vor. Das Spülbecken war bis oben hin voll mit schmutzigen Töpfen und Pfannen, im Kühlschrank stapelten sich geheimnisvolle Plastikpäckchen, die niemand je öffnen würde. Auf den Arbeitsflächen lagen alte Essensreste von wer weiß wie vielen Kochsessions vor der Kamera, ein Panorama aus grau oxidierenden und verschimmelnden Lebensmitteln, auf denen sich Fruchtfliegen gütlich taten. Der verantwortliche »Küchenchef« stand mit dem Finger bis zum Knöchel in der Nase da und war sich offenbar des Gemetzels ringsum nicht bewusst. Von Zeit zu Zeit kamen tatsächlich Darsteller und Techniker verschiedener Produktionen herein, nahmen sich etwas von dieser einst essbaren Müllkippe und verspeisten es. Im Studio musste ich dann auf einer elektrischen Herdplatte kochen, die nach den verbrannten Überresten früherer Opfer roch. Aus einem Spülbecken, in dem sich das Geschirr türmte wie die Grabungsschichten im alten Troja, musste ich ganz unten erst einmal eine Bratpfanne herausziehen und sauber schrubben. Doch diese wenig beeindruckende erste Begegnung mit Food Network war durchaus noch kein Grund für echte Abneigung. Distanziertheit wäre wohl das treffendere Wort.
Ich nahm die Leute nicht ernst. Wie auch?
Und ehrlich gesagt hatte ich nie richtig etwas gegen Emeril oder Bobby, nicht einmal gegen Rachael, obwohl ich ihre Sendungen, na ja, grotesk fand, irgendwie sogar peinlich.
Verachtung für den Sender stellte sich erst später ein, nach dem Erscheinen von Geständnisse eines Küchenchefs. Als ich einen satten Reibach damit gemacht hatte, Emeril, Bobby und Rachael durch den Kakao zu ziehen. Als mich die Scheißkerle einstellten.
Noch immer kochte ich Tag und Nacht. Mein Buch stand auf der Bestsellerliste der New York Times, doch ich wurde ein gesundes Misstrauen nicht los, das mir riet, meine Anstellung besser zu behalten. Der Erfolg konnte nicht von Dauer sein, dachte ich mir. Nur ein Zufallstreffer. Eine Eintagsfliege. Würde ein Buch, das ich für ein paar Postenchefs und Barkeeper aus New York und Umgebung verfasst hatte, jenseits des Dreistaatengebiets New York, New Jersey und Connecticut überhaupt jemanden interessieren? Wenn ich in den achtundzwanzig Jahren im Restaurantgeschäft etwas gelernt hatte, dann dies: Was heute wie Glück aussieht, verwandelt sich morgen todsicher in Scheiße.
Zwar bezweifelte ich, dass ich mich länger im Ruhm würde sonnen können, doch war mir durchaus bewusst, dass ich meinem Verleger ganz gute Verkaufszahlen bescherte. Ich war vielleicht Pessimist, aber ein Idiot war ich nicht. Solange also das Eisen noch heiß war, bot ich ihm ein zweites Buch an, mit einem entschieden höheren Vorschuss, schnell, bevor meine Erfolgssträhne vorbei war und ich zwangsläufig wieder in der Mittel- und Bedeutungslosigkeit versank. Kess schlug ich ein Buch über Reisen durch die ganze Welt vor, die ich unternehmen wollte, überall dorthin, wo ich schon immer mal hingewollt hatte und wo ich nach Herzenslust essen, trinken und in die Bredouille geraten konnte. Ich sei bereit, mich auf den Weg zu machen und darüber zu schreiben, so mein Vorschlag. Wenn mein Verleger es bezahlte.
Erstaunlicherweise wollte er es bezahlen.
Kurze Zeit später spazierten zwei unscheinbare Männer ins Les Halles und fragten mich, ob ich Interesse am Fernsehen hätte. Sie dachten sicher an die Verfilmung von Geständnisse eines Küchenchefs, die Rechte dafür hatte ich aber bereits nach Hollywood verkauft (wo mein Buch zu einer sehr kurzlebigen Sitcom verwurstet wurde).
Ich wandte ein, ich hätte ohnehin nicht viel Zeit, da ich ein Jahr lang durch die Welt reisen und meine Kindheitsfantasien vom exotischen Fernen Osten wahr machen wollte. Doch sie zeigten sich unverdrossen interessiert.
Ich muss einschieben, dass ich schon damals, als ich noch meine Kochschürze trug, jeden misstrauisch beäugte, der behauptete, er wolle mir einen Fernsehjob anbieten. Wenn Leute von Film und Fernsehen einem erzählen, sie seien »große Fans« und freuten »sich riesig auf das Projekt«, so viel wusste ich schon, dann hieß das gerade mal, dass sie einem das Mittagessen zahlen würden. Noch skeptischer wurde ich, als sie erwähnten, dass Food Network das Projekt sehr wahrscheinlich einkaufen wollte. Das allein schon ließ vermuten, dass die beiden Schwachköpfe absolut keinen Schimmer und keinen Einfluss hatten. Ich hatte schon eine Weile wild auf die Hauptverdiener bei Food Network eingedroschen. Das war inzwischen so eine Art Nummer, die sich verselbstständigte und auch weiterlaufen würde, wenn ich sie nicht mehr brachte. Dass die beiden Food Network auch nur erwähnten, ließ vermuten, dass mangelnde Fantasie noch ihr geringstes Problem war.
Das Wort »wahnhaft« kam mir in den Sinn.
Dann, eine Woche später, teilten sie mir telefonisch mit, dass sie ein Treffen arrangiert hatten. Ich war sauer. Stocksauer. Das konnte ja nichts werden. Reine Zeitverschwendung, ganz sicher. Vor dem Gespräch hielt ich deshalb weder eine Dusche noch eine Rasur für angebracht.
Danach hatte ich eine eigene Sendung: A Cook’s Tour (Ein Küchenchef reist um die Welt). Entgegen unserer Absicht und ernsten Bemühung entwickelte sie sich zu einem gonzoartigen Reisebericht mit Filmmaterial von unterwegs und zusammengestöpseltem Hintergrundkommentar. Ich war davon ausgegangen, dass ich nur so lange fürs Fernsehen arbeiten würde, wie ich an dem Buch schrieb, doch zu meiner Überraschung wurde eine zweite Staffel gedreht. Und noch unglaublicher war, dass der Sender mich von Anfang an so ziemlich jeden Schwachsinn machen ließ, der mir in den Kopf kam: Ich durfte die Drehorte aussuchen, vor der Kamera rauchen, nach Bedarf fluchen und gemeinsam mit den Kameraleuten und den Produktionshelfern, die in den vielen Monaten gemeinsamen Reisens zu Freunden wurden, die Geschichte auch noch so erzählen, wie ich es wollte. Es kam ziemlich gutes Fernsehen dabei heraus.
Ich muss zugeben, dass ich mich an dieses Leben gewöhnen wollte - rund um den Erdball streifen auf der Suche nach Essen und Abenteuern. Außerdem machte es mir Spaß, mithilfe einer brandneuen Schatzkiste voll mit schönen Spielsachen - Kameras, Editing-Boards, Tonbearbeitung - und richtig kreativen Profis, die wussten, wie man damit umgeht, Geschichten zu erzählen. Ich stelle gern Sachen her. Ich erzähle gern Geschichten. Ich reise gern nach Asien. Und dieser Fernsehgig erlaubte es mir, das alles gleichzeitig zu tun.
Ich kam nicht mehr davon los - nicht etwa des Ruhms oder des Geldes wegen (davon gab es herzlich wenig). Ich hatte schon längst so viel Kokain konsumiert, dass es für ein Leben reichte. Kein Sportflitzer der Welt könnte je mein Verlangen stillen. Die große weite Welt - und die Freiheit, die mir das Fernsehen gab - hatte mich verführt, das Reisen ganz nach meinem Belieben. Ich war besoffen von der aufregenden neuen Macht, Bilder und Klänge so zu manipulieren, dass Geschichten daraus wurden, das Publikum die Orte so erleben zu lassen, wie ich sie erlebt hatte. Ich war zunehmend stolz auf die Qualität der Folgen, die meine Partner - die Kameraleute und die Produzenten Chris Collins und Lydia Tenaglia - und ich abdrehten. Ich lernte die Arbeit der Cutter, der Tonmeister und der Postproduzenten schätzen. Die Fernseharbeit machte … Spaß und war von der kreativen Seite her nicht selten höchst befriedigend.
Ich schrieb das Buch und filmte gleichzeitig weiter. Der Schwanz wedelte mittlerweile mit dem Hund. Ich war süchtig nach Reisen, danach, mir die Welt anzuschauen, und zwar nach meinen Bedingungen. Vereinfacht ausgedrückt: Ich wollte alles für mich. Einerseits war die Welt erheblich größer geworden, andererseits schrumpfte sie. Wie viele Reisende wandte ich mich beim Blick aus dem Fenster zunehmend nach innen, sah, was draußen geschah, durch eine immer enger werdende Linse. Anfangs hatte ich beim Anblick eines Sonnenuntergangs oder eines Tempels meinen Nachbarn rechts oder links gefragt: »Ist das nicht ein herrlicher Sonnenuntergang?« Dieser Impuls ließ rasch nach. Ich hatte Besitzansprüche auf die Welt. Ich wurde egoistisch. Der Sonnenuntergang gehörte mir.
Ich war zwei Jahre fast ständig unterwegs, und in dieser Zeit veränderte sich mein Leben grundlegend. Ich gab meine Arbeit als Küchenchef auf, einen Job also, dessen alltägliche Anforderungen allein zwischen mir und dem Chaos gestanden hatten. Meine erste Ehe ging in die Brüche.
Als ich eines Tages in New York wieder in einem Büro von Food Network saß, war ich ein anderer Mensch und hatte andere Prioritäten als die, mit denen ich meine Küche verlassen hatte. Ich hatte jetzt die groteske Vorstellung, dass die Fernsehsache etwas »Gutes« sei und manchmal sogar »wichtig«.
Auf der jüngsten Reise nach Spanien hatte man mich Ferran Adrià vorgestellt, der mir erstaunlicherweise erlauben wollte, ihn in seinem Kochlabor El Bulli taller und seinem notorisch ausgebuchten Restaurant zu filmen. Adrià war damals bereits der wichtigste und umstrittenste Meisterkoch auf Erden - und sein Restaurant war legendär. Vor allem aber hatte noch nie jemand gefilmt, was er mir und meinem Team zeigen wollte. Wir sollten alles erfahren über seine Kreativität, seine Küchenchefs, seine Lieblingsrestaurants, alles, was ihn inspirierte. Und vor allem wollte man uns in der Küche des El Bulli das gesamte Degustationsmenü servieren, und Adrià höchstpersönlich wollte uns jeden Gang erläutern. Das war ein absolutes Novum und ist meines Wissens auch seither nicht wieder vorgekommen.
Doch während ich auf Reisen war, hatte sich in New York einiges verändert.
Bei Food Network war man plötzlich nicht mehr an Sendungen »aus dem Ausland« interessiert. Den Verantwortlichen, die uns begeistert engagiert und unsere maßlosen und hektischen Unternehmungen unterstützt hatten, war wohl der Einfluss abhandengekommen. Oder das Interesse. Als wir ihnen erzählten, was Adrià für uns tun wollte, schien ihnen das gleichgültig zu sein. »Spricht er Englisch?«, hieß es jetzt, und: »Das ist zu intellektuell für uns.« Beides wurde als Begründung dafür herangezogen, die Folge nicht zu finanzieren - oder jede andere Folge, die außerhalb der USA spielte.
Ein sauertöpfisch dreinblickender Syndikus des Senders nahm fortan regelmäßig an den »Kreativkonferenzen« teil und gab auf subtile Art die Tagesordnung und die Richtung vor.
Für mich hätte das ein Warnsignal der Stufe Rot sein müssen. Das Zugpferd, so hieß es, sei nun eine Sendung namens Unwrapped, in der über die Herstellung von Zuckerwatte und Marsriegeln berichtet wurde. Eine Folge kostete etwa ein Zehntel dessen, was wir brauchten, und hatte selbstredend viel höhere Quoten. Wenn wir, was selten vorkam, in Amerika drehten, so wurde uns erklärt, schossen die Einschaltquoten in die Höhe, besonders, wenn ich mir etwas Gegrilltes in den Mund schob. Konnte ich meine Streifzüge nicht auf mein Heimatland beschränken - Parkplatzpartys und Chili-Kochwettbewerbe besuchen? Der ganze ausländische Kram mit Leuten, die komisch redeten und merkwürdige Sachen aßen, passte, wie mir in perfekter Juristensprache erläutert wurde, nicht ins »derzeitige Geschäftsmodell«.
Dass am Ende des Tunnels kein Licht auftauchen würde, wusste ich, als der Anwalt und die (wie bald klar wurde) ausscheidenden Führungskräfte aufstanden und sagten: »Wir möchten Sie mit Brooke Johnson bekannt machen, die zu unserem Entzücken von [einem anderen Sender] zu uns stößt.« Miss Johnson war ganz offenkundig alles andere als entzückt, meine Partner und mich kennenzulernen. Man spürte förmlich, wie die Luft aus dem Raum entwich, kaum, dass sie eingetreten war. Augenblicklich war hier kein Platz mehr für Hoffnung oder Humor. Während der Kabinendruck abfiel, folgte ein schlaffer Händedruck, und alle Freude verschwand in einem schwarzen Loch, alles Licht, jedes Fünkchen Frohsinn wurde in den Strudel dieser gebeugten missmutigen Erscheinung gerissen. Ihr Desinteresse, das an nackte Feindseligkeit grenzte, war greifbar.
Meine Partner und ich gingen in dem Wissen, dass unser Ende bei Food Network besiegelt war.
Das »Geschäftsmodell«, dessen Speerspitze Miss Johnson offenbar war, erwies sich als unglaublich erfolgreich. Mit jeder Maßnahme, mit der das geistige Niveau des Programms heruntergeschraubt wurde, stiegen proportional die Quoten. Es folgte eine Säuberungsaktion unter den Köchen, die den Sender aufgebaut hatten. Mario, Emeril und so gut wie jeder andere, der sich der Sünde der Professionalität schuldig gemacht hatte, wurden verbannt oder vertrieben wie unter den alten Bolschewiken, da sie für das eigentliche Geschäft gänzlich überflüssig waren. In Wahrheit ging es, so hatte man erkannt, um sympathische Leute und harmlose Bilder, mit denen sich die Zuschauer wohlfühlten.
Mit jedem Frevel - den beschämenden, nur unter Schmerzen zu ertragenden Food Network Awards, dem unbeholfen manipulierten Next Food Network Star, dem kitschig-billigen Produktionsstandard des Next Iron Chef America -, mit jedem dilettantischen Abklatsch, den man auf Sendung schickte, schossen die Quoten in unermessliche Höhen, und mit ihnen stieg der Anteil der hoch geschätzten männlichen Zielgruppe zwischen zweiundzwanzig und sechsunddreißig (oder wo immer das Alter der Erstautokäufer statistisch liegt). Im Zuge dieses erbärmlichen neuen Konzepts durfte nicht einmal mehr die treue Seele Bobby Flay auch nur ansatzweise seine Kochkünste zeigen. In Wettbewerben um Krabbenpasteten musste er gegen linkische Bauerntrampel antreten und verlor merkwürdigerweise fast immer.
Falls es noch eines Beweises für die Alternativlosigkeit, die Überlegenheit des Food-Network-Modells bedarf, für die unbändige Erfolgsdynamik und die brutale Genialität des Fünfjahresplans, den Brooke Johnson aufstellte: Die Zeitschrift Gourmet musste den Betrieb einstellen, und während landauf, landab Hochglanzmagazine in der Klemme sitzen und angesehene 180 Jahre alte Zeitschriften einpacken, florieren Blätter wie Food Network Magazine, Everyday with Rachael Ray und Paula Deens Werbeheftchen. Das Imperium des Mittelmaßes streckt seine Tentakel übers ganze Land aus.
Das ist der Lauf der Welt, das ist mir mittlerweile klar. Sich dem zu widersetzen heißt, sich gegen einen Hurrikan zu stemmen. Man beugt sich (vorzugsweise in der Taille, Arschbacken nach hinten). Oder man zerbricht.
Und ich kann auch mit einem eher intuitiven Hinweis auf die Apokalypse aufwarten:
Rachael Ray hat mir einen Obstgeschenkkorb zukommen lassen. Deshalb ziehe ich jetzt auch nicht mehr über sie her. So einfach bin ich heutzutage zu bändigen. Wirklich. Ein unverlangter Akt der Freundlichkeit, und ich tue mich echt schwer, noch gemein zu sein. Es käme mir … undankbar vor. Ungehobelt. Jemanden durch den Dreck zu ziehen, der mir Obst geschenkt hat, beißt sich mit meinem etwas schrägen Selbstbild als Gentleman. Rachael war da sehr raffiniert.
Andere sind mehr auf Konfrontation gegangen.
Wir befinden uns auf der Premierenfeier zum Film Julie & Julia. Ich stehe mit Ottavia, seit 2007 meine Ehefrau, und zwei Freunden am Rande des Büfetts und nippe an meinem Martini, als mich jemand berührt. Eine Hand fährt unter mein Jackett und den Rücken hinauf. Ich gehe davon aus, dass ich diese Person sehr gut kenne, wenn sie mich so berührt, zumal vor meiner Frau.
Ottavia trainiert schon seit Jahren verschiedene asiatische Kampfsportarten, und das letzte Mal, als mir ein weiblicher Fan solcherlei Avancen machte, packte sie die Frau am Arm und sagte sinngemäß: »Wenn Sie nicht die Hände von meinem Mann lassen, kriegen Sie eins in Ihre verdammte Fresse.« (Das waren sogar genau ihre Worte. Und es war keine leere Drohung.)
Die Sekunde, in der ich mich nun umdrehte, verging in der Art Zeitlupe, wie man sie bei einem Autounfall erlebt, und war geprägt von einem wahrlich beängstigenden Anblick: dem Gesichtsausdruck meiner Frau. Er war so ungewöhnlich, weil ihre Züge zu einem starren Grinsen gefroren waren, das ich noch nie gesehen hatte. Was war das hinter mir, das eine solche Reaktion auslöste, sie geradezu lähmte wie ein Reh, das vom Fernlicht geblendet wird?
Da blickte ich schon in das Gesicht von Sandra Lee.
Jeder anderen Frau, die mir den Rücken gestreichelt hätte, wäre jetzt schon mit einem Faustschlag der Schädel gespalten oder zumindest der Ellbogen in den Brustkorb gerammt worden, gefolgt von einer Links-rechts-Kombination und einem Tritt auf den Kiefer, der dem Opfer auf dem Weg zum Boden den Rest gegeben hätte. Aber nein. Die TV-Königin, Moderatorin der Serie Semi-Homemade, übte eine dermaßen groteske, entsetzliche Macht über uns aus, dass wir dastanden wie hypnotisierte Küken. Dass neben Sandra der Justizminister des Staates New York und Kandidat für den Gouverneursposten Andrew Cuomo stand - ihr Lebensgefährte -, machte die Sache noch bedrohlicher.
»Sie sind ein böser Junge«, sagte Sandra und meinte damit wohl meine beiläufige Bemerkung, sie sei die »Höllenbrut von Betty Crocker und Charles Manson«. Vielleicht hatte ich auch einmal vom »durch und durch Bösen« gesprochen. Angeblich habe ich in Zusammenhang mit Sandras berühmt-berüchtigten Rezepten wie dem »Kwanzaa Cake« auch das Wort »Kriegsverbrechen« verwendet. In diesem Moment habe ich allerdings keinerlei Erinnerung an solche Bemerkungen.
Ich weiß auch nicht mehr, wie ich reagierte, als mir Sandras eiskalte Raubtierkrallen über Rückgrat und Hüfte strichen und wie die grauenvollen Zähne eines Aliens nach einer empfindlichen Stelle tasteten, ehe sie sich tief in die weiche Masse von Nieren oder Leber gruben. Rückblickend stelle ich mir vor, dass ich wie Ralph Kramden in der Sketchshow The Honeymooners: »Homina-homina-homina!« rufe.
Aber so war es nicht. Eigentlich war es eher wie in Kap der Angst. Gregory Peck und seine Familie geraten in den Bann des bösen Robert Mitchum. Da steht er, im Gang, eine kaum verhüllte Bedrohung, knapp an der Grenze des noch akzeptablen Verhaltens. Mit jeder Sekunde, die vergeht, denkt man: »Kann ich die Polizei rufen? … Jetzt? … Oder … jetzt?« Derweil überschreitet der bedrohliche Fast-Eindringling die Grenze noch nicht, lässt sein Gegenüber aber wissen: »Ich komme rein, wenn ich es will.«
Sie erforschte gerade meine Nierengegend, sah meiner Frau dabei auch noch direkt in die Augen und sagte: »Keine Speckröllchen«, was nicht ganz zutrifft, aber präzise Fleischbeschau war wohl auch nicht Zweck der Übung. Meiner Frau - und damit auch mir - wurde unmissverständlich mitgeteilt, dass sie wie Mitchum in Kap der Angst jederzeit schnurstracks in unser Wohnzimmer marschieren und uns nach Belieben allerlei grässliche Grausamkeiten antun konnte - wir konnten gar nichts dagegen ausrichten.
»Sind die Ohren schon rot?«, waren ihre letzten Worte, begleitet von einem Zupfer am Ohrläppchen. Dann war sie mit mir fertig und ging weiter. Sie hatte alles gesagt.
Das ist Sandra Lees Welt. Es ist Rachaels Welt. Sie und ich, wir leben nur zufällig darin.
Falls es mir damals noch nicht klar wurde, als mich Tante Sandy auf den Kopf stellte, schüttelte und nur die Hülse von einem Mann übrig ließ, ähnlich den Resten einer Hummermahlzeit, so begriff ich es letzte Woche endgültig, als Scribbs Howard, das Mutterunternehmen von Food Network, Rupert Murdochs NewsCorp überbot und meinen Sender, den Travel Channel, erwarb - für fast eine Milliarde Dollar. Womit ich wieder in der Galeere landete, auf der ich doch nie wieder hatte arbeiten wollen.
Heute, viel später, fällt mir wieder ein, wie mein früheres, dümmeres Ich vor dem Fernseher saß und zusah, wie Emeril Zahnpasta verscherbelte und Rachael Dunkin’ Donuts und Ritz Crackers anpries. Verständnislos und mit offenem Mund dachte ich bei mir: »Warum gibt sich jemand, der schon Millionen macht, für ein paar zusätzliche Millionen mit so einem Mist ab? Ich meine, es ist doch ein bisschen peinlich, sein Gesicht für Dunkin’ Donats herzugeben, wo so viele Kinder die Sendungen anschauen und der Typ-2-Diabetes schon jetzt explosionsartig zunimmt.… Es muss doch eine Grenze geben, die man einfach nicht überschreitet, oder?«
Später, hinter der Bühne der Sendung Top Chef, stellte ich meinen Kollegen Küchenchefs ebendiese Frage. Wir warteten darauf, dass das Kamerateam die nächste Einstellung aufbaute, und ich unterhielt mich mit zwei Köchen, die erheblich mehr konnten, kreativer und versierter waren als ich und demnach anders als ich tatsächlich einen Ruf zu verlieren hatten. Wo zieht man die Grenze?, fragte ich sie. Sie verglichen gerade, welche Luftlinie ihnen für eine »Menüberatung« am meisten Gratismeilen einräumte und für welche Produkte es wie viel Geld gab. Zu keinem Produkt hörte ich die Aussage: »Burger King: Nie. Mals! Keine Chance!« oder, nach einer nachdenklichen Pause: »Okay, hm, mal überlegen. Gleitgel? Nein, ist mir egal, wie viel Geld die mir bieten. Dafür mache ich keine Werbung!« Deshalb warf ich die Frage ein: »Wo genau ist für euch denn die Grenze?«
Die beiden sahen mich an, als hinge mir ein verkümmerter Zwilling am Hals. Mitleidig. Sie machten sich sogar lustig über mich.
»Du willst wissen, wie viel du hinblättern musst, damit ich einen Popel esse?«, fragte der eine in einem Tonfall, als habe er es mit einem Kleinkind zu tun. Die beiden setzten ihr Gespräch fort, verglichen Limos mit Tiefkühlpizzen, als wäre ich gar nicht mehr da. Es war ein Gespräch unter Erwachsenen, so viel war klar, und ich war in ihren Augen zu unbedarft, zu dumm, zu unerfahren, als dass ich hätte mitreden können.
Sie hatten recht. Was redete ich da nur?
Die Vorstellung, dass man »sich verkauft«, ist ja auch reichlich bizarr. Wann genau ist der Punkt gekommen, an dem man sich verkauft? Für den durchschnittlichen weißen Möchtegernanarchisten mit Rastalocken, der eine Band gründen und »sich selbst treu bleiben« will, während er auf Mamis und Papis Scheck wartet, heißt sich verkaufen, sich einen Job zu besorgen.
Wenn Leute morgens früher aufstehen, als ihnen lieb ist, durch die halbe Stadt fahren und für Leute, die sie nicht besonders mögen, Arbeiten erledigen, die sie in ihrer Freizeit niemals freiwillig machen würden, verkaufen sie sich - sei es, dass sie in einem Kohlebergwerk schuften, bei Popeyes Käsemakkaroni aufwärmen oder im Hinterzimmer eines Stripclubs Kunden einen runterholen. Für mich sind sie moralisch alle auf einer Ebene. Man tut, was man tun muss, um über die Runden zu kommen. Es ist zwar mit einem gewissen Stigma verbunden, wenn man einem Fremden den Schwanz lutscht - was wohl mit spezifisch westlichen Vorstellungen von Intimität und Religion zusammenhängt -, doch was ist daran anders oder schlimmer oder »unrechter«, als wenn jemand Toiletten putzt, einen Schlachthausboden abspritzt, Warzen wegbrennt oder Werbung für Coke light macht? Wer würde sich, wenn er nicht müsste, für irgendeine dieser Tätigkeiten entscheiden?
Wem auf dieser Welt gelingt es, nur das zu tun, was sich mit den eigenen Wünschen oder Prinzipien vereinbaren lässt, und dafür auch noch bezahlt zu werden?
Na ja, mir vielleicht, bis vor Kurzem jedenfalls.
Aber Moment mal. Wenn ich ein Interview gab und Werbung für Geständnisse eines Küchenchefs machte, verkaufte ich mich ja auch, oder? Ich tat das nicht den Journalisten zuliebe, weder für Matt Lower noch Bryant Gumbel noch sonst jemandem. Warum war ich so nett zu ihnen? Inwiefern unterschied ich mich von der gewöhnlichen Hure, wo ich doch Minuten, Stunden, ja Wochen meiner rasch schwindenden Lebenszeit darauf verwendete, mit Leuten Süßholz zu raspeln, die ich nicht einmal kannte? Wenn man Sex verkauft,
Titel der Originalausgabe: Medium RawOriginalverlag: HarperCollins Publishers, New York
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Anthony Bourdain
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010by Karl Blessing Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Herstellung und Layout: Ursula MaennerSatz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
eISBN 978-3-641-06039-8
www.blessing-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de