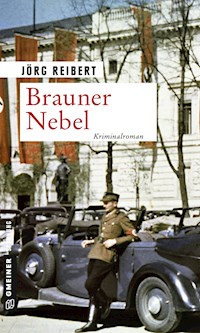Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalkommissar Reinicke
- Sprache: Deutsch
Emil Bachmann erlebt den Ersten Weltkrieg als Frontsoldat. Das Töten ist sein Handwerk. Als er nach Kriegsende nach Berlin zurückkehrt, ist er vollkommen entwurzelt. Mühsam fasst er wieder Fuß im Zivilleben. Doch die Schatten der Vergangenheit lassen ihn nicht los. Als ihn sein Schwager für die SA anwirbt, findet er eine neue Heimat unter den Kameraden. Aber er verstrickt sich in viele Konflikte, und Gewalt ist für ihn die einfachste Lösung. Bald schon wird Mord für ihn zur Gewohnheit …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg Reibert
Ein böser Kamerad
Kriminalroman
Impressum
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur Schoneburg, Berlin
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Katja Ernst
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild
ISBN 978-3-8392-5382-3
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Widmung
Für Eva, Henning und Jana
Zitat
»Es gibt keine Handlung, für die niemand verantwortlich wäre.«
Otto von Bismarck
Teil 1
Schwarz
Schwarz ist die Farbe des Todes. Sie steht für das Böse, für Bedrohung und für die Trauer.
Schwarz bedeutet aber auch Individualität und Eigenständigkeit, Dunkelheit, Leere, Pessimismus und Unglück.
Kapitel 1
Champagne, Sonntag, 26. Mai 1918
Königs Wusterhausen, den 12. Mai 1918
Mein lieber Emil!
Ich hoffe es geht Dir gut. Es fällt mir sehr schwer, Dir diese Zeilen zu schreiben. Ich habe lange überlegt, wie ich es sagen soll. Aber meine Mutter meinte, ich soll es Dir am besten ganz direkt mitteilen, sonst weißt Du nicht, wie es um uns steht. Ich denke doch immer wieder an Dich da draußen und fühle mit Dir. Aber in den letzten Monaten hat sich etwas verändert.
Emil nimmt sich eine Zigarette aus der Schachtel, die in seiner ledernen Patronentasche steckt. Ganz vorne links, wo er beim Nachladen ohnehin nicht so gut herankommt, hat sie ihren festen Platz. Erst vorhin hat er sie erneuert, als sie ihre Abendfourage empfangen haben. Die fiel üppiger als sonst aus, denn morgen früh wird die Offensive beginnen. Nach Blücher ist sie benannt, dem »Marschall Vorwärts«, und wie 1914 geht es wieder Richtung Paris. Alle denken, es wird die letzte große deutsche Anstrengung, bevor die Franzosen zusammenbrechen. Bereits die »Kaiserschlacht« im März hatte die Front weit aufgerissen. So etwas hatte es seit Kriegsbeginn nicht mehr gegeben. Damals war alles in Dreck und Schlamm erstarrt und keine Seite mehr vorangekommen. Seit diesem Jahr läuft es aber wieder gut, auch wenn das deutsche Heer müde und erschöpft ist. Der Sieg ist zum Greifen nah.
Vorhin mit dem Essen gab es auch die Feldpost. Emil hat bis zum Abend gewartet, den Brief aufzureißen, und hat sich in eine Ecke des bretterverschalten Unterstandes mit einem Kerzenstumpen zurückgezogen, um ihn zu lesen. Die Luft ist verbraucht, sie riecht nach Schweiß, Leder, Waffenöl und Angst. Die Männer quetschen sich eng zusammen: doppelte Belegung durch die zusätzlichen Sturmtruppen. Jeder versucht, irgendwie die Zeit bis zum Morgen totzuschlagen. Die meisten dösen, aneinander gelehnt oder mit ihrer Ausrüstung als Kopfkissen. Einige Funzeln an der Decke spenden trübes Licht. Nur ab und zu kommt jemand herein oder verlässt den Bau. Handgranaten und Gewehrmunition sind bereits ausgegeben, jetzt gibt es nichts mehr zu tun, außer abzuwarten.
Du kennst Dr. Löwenthal sicherlich vom Sehen. Er ist unser Kinderarzt, und dadurch habe ich als Amme häufig mit ihm zu tun gehabt, wenn ich eines der Kleinen zu ihm bringen musste. Es ist unglaublich, mit welcher Liebe und Hingabe er seiner Arbeit nachgeht. Nie ist er ungeduldig oder wird gar laut. Er ist ein vorbildlicher Mensch, das konnte ich die vielen Male beobachten, die ich bei ihm war.
Ich schäme mich, es Dir zu schreiben, aber bei ihm habe ich mich viel geborgener gefühlt als bei Dir. Wenn ich an Dich denke, kann ich mir oft gar nicht mehr Dein Gesicht vorstellen. Wir haben ja auch lediglich einige Male vor über einem Jahr miteinander poussiert, bevor Du einrücken musstest. Seither schreiben wir uns nur mehr Briefe. Ich habe sie alle aufbewahrt und noch einmal durchgelesen.
Wie fremd Du mir vorkamst, als Du im Winter auf Urlaub nach Hause kamst. Ich habe Dich kaum noch wiedererkannt. Du hast fast nichts erzählt von dem, was Du in Frankreich erlebt hast. Immer sollte nur ich reden. Du hast auch kein einziges Mal mehr gesagt, dass Du mich lieb hast. Das hat mich verletzt. Es war so völlig anders mit Dir als in der Zeit zuvor.
Vor ein paar Wochen hat Dr. Löwenthal um meine Hand angehalten. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, das kannst Du mir glauben. Er hat mich nicht gedrängt, aber seine stillen Blicke haben heiß in mir gebrannt. Nächtelang habe ich wach gelegen und alles ganz genau abgewogen.
Ich weiß nicht, ob Du mich das auch gefragt hättest, wenn Du aus dem Krieg zurückkommst, aber wann das je sein wird, kann mir niemand sagen. Es sind harte Zeiten, und ich hasse das Schicksal dafür, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Es ist das Bitterste, was mir je passiert ist. Keiner konnte mir helfen.
So habe ich mich dann für Dr. Löwenthal entschieden, und wir haben uns Anfang April verlobt. Seitdem habe ich den Tag immer wieder hinausgeschoben, an dem ich Dir schreibe. Dies wird mein letzter Brief an Dich sein, das verstehst Du sicher. Ich danke Dir für alles, was Du mir Gutes getan hast. Behalte auch Du mich in guter Erinnerung,
Gott schütze und behüte Dich,
in ewiger Freundschaft,
Clara
*
Champagne, Montag, 27. Mai 1918
Die Artilleriegeschütze hauen alles zusammen. Vor ein paar Stunden hat der Zauber angefangen. Wie ein Orkan hat das Toben in der Ferne begonnen und sich näher herangearbeitet. Dann ist das Feuer zurück ins feindliche Hinterland gesprungen. Die Einschläge von schweren und leichten Kalibern mischen sich zu einem ohrenbetäubenden Lärm. Systematisch werden die Gräben und Stellungen des Gegners zerschlagen. Dabei kommt viel Gas zum Einsatz. Die Blaukreuzgranaten setzen einen Stoff frei, der die Atemwege reizt, aber nicht tödlich wirkt. Er dringt durch die Gasmasken, bis die Soldaten sie hustend und spuckend herunterreißen, um wieder frei atmen zu können. Sofort wirkt das gleichzeitig verschossene Grünkreuz und verätzt ihre Lungen.
Seit einer halben Stunde trommelt das gesamte Feuer konzentriert auf dem vordersten französischen Graben, um die Stacheldrahthindernisse zu zerstören und den letzten Widerstand zu brechen. Auch die schweren Minenwerfer aus den frontnahen Stellungen schleudern ihre Doppelzentnergeschosse in das Chaos hinein. Es ist unvorstellbar, dass irgendein Mensch diese Hölle überleben kann.
Um 4.40 Uhr schrillen die Pfeifen der Unteroffiziere, und die Männer klettern aus ihren Gräben heraus. Das Niemandsland um sie herum ist eine frisch umgepflügte Kraterlandschaft. Kaum ein Grashalm hat den Beschuss überstanden. Alles ist mit dem feinen, weißen Kreidestaub der Champagne überzogen. Sie stürmen in kleinen Gruppen nach vorn. Emil Bachmann springt neben seinen Kameraden über Trichter und Erdbrocken.
Heute wird er sterben. Das hat er gestern Nacht beschlossen, nachdem er den Brief ein zweites und ein drittes Mal gelesen hatte. Warum sollte er diesen Krieg auch überleben wollen? Das Einzige, was ihm in den letzten Monaten Halt gab, existiert nicht mehr. In Emil lodert eine grenzenlose Wut. Feige haben sie hinter seinem Rücken ein Verhältnis begonnen, seine liebe Clara und Samuel Löwenthal, der nette Arzt. Ob er ihn kennen würde, welche Frage! Wer weiß denn nicht, wer er ist, in diesem kleinen Städtchen, wo fast jeder jeden beim Namen nennen kann? Die ganze Nacht lang hat er wach gelegen und konnte nicht schlafen vor lauter Zorn. Zum Glück ging’s heute Morgen schon zeitig los mit der Knallerei, da waren die Gedanken an zu Hause wie fortgeblasen.
Bamm.
Bamm.
Bamm.
Emil hat das Gefühl, dass jeder Schlag der Geschütze seine Liebe ein Stück mehr in Stücke schlägt. Inmitten dieses Scherbenhaufens stürmt er gegen den Feind, keucht sich unter der schweren Last des Sturmgepäcks die Lunge aus dem Leib und rennt in die auseinanderspritzenden Einschlagfontänen hinein.
Die Feuerwalze der Artillerie beginnt, planmäßig nach vorn zu verlegen. Alle paar Minuten springen die Einschläge um hundert Meter weiter. Dahinter rücken die Männer dichtauf nach. Besser zu nah den Explosionen zu folgen, auch wenn immer wieder mal einer von eigenen Leuten getroffen wird, als zurückzufallen. Denn sobald die Einschläge weiter entfernt sind, kriecht der Feind aus seinen Deckungslöchern hervor und kann das Feuer auf die schutzlos Vorwärtsstürmenden eröffnen.
Der erste gegnerische Graben wird schnell eingenommen. Die wenigen überlebenden Franzosen heben sofort die Hände, als sie die deutsche Übermacht auf sich zukommen sehen. Benommen von dem Beschuss taumeln die verschmutzten Gestalten den Angreifern entgegen und werden nach hinten abgeführt. Doch die Sturmtruppen machen keine Rast. Sie folgen der Feuerwalze zum zweiten Graben. Drei Grabenreihen hat die Front, im Abstand von jeweils ein paar hundert Metern. Haben sie diese eingenommen, ist der Durchbruch geschafft und die Offensive hat das Hinterland erreicht. Das ist das Ziel des heutigen Tages.
Der Angriff stockt eine Weile im Niemandsland. Vor ihnen befindet sich eine MG-Stellung, die unaufhörlich Feuer spuckt. Das zwingt die angreifenden Truppen in die Trichter, um nicht sinnlos dahingemäht zu werden. Von zwei Seiten nähern sich die Deutschen dem MG, werden aber immer wieder von seinem hin und her pendelnden Rohr in Deckung gezwungen. Eine Geschossgarbe nach der anderen jagt über sie hinweg. Emil liegt neben einem gefallenen Kameraden, hält den Kopf unten und schnauft durch. Den Mann hat es an der Seite erwischt. Der Ausschuss am Rücken bildet einen einzigen blutigen Krater. Der Soldat war sofort tot. Emil hebt langsam seinen erdverkrusteten Stahlhelm über den Trichterrand, um sich einen Überblick zu verschaffen. Vor ihm liegt das MG-Nest, aus dem unaufhörlich die Funken über das Schlachtfeld stieben. Eigene Männer sind in der Nähe nicht zu sehen, weiter entfernt geht der Angriff voran. Die Feuerwalze wandert langsam aus. Emil ist alles egal. Er springt aus seinem Erdloch hoch und läuft direkt nach vorn.
Noch ist er nicht entdeckt worden, da das MG gerade zur anderen Seite hin schießt. Dann schwenkt es jedoch herum und hämmert in seine Richtung. Ein paar Meter schafft er, ehe ihn ein harter Schlag am Bein trifft und ihn kopfüber in den nächsten Trichter stürzen lässt. Mit dem Stahlhelm schlägt er heftig auf dem Boden auf, und der Rand des Helms drückt sich schmerzhaft in seinen Nacken. Emil rollt sich benommen zur Seite und bleibt liegen. Als er sich gesammelt hat, schaut er an sich herab, tastet sich ab, sucht nach Verletzungen, nach Blut. Außer im Gesicht, wo er sich eine Schramme durch den Sturz zugezogen hat, kann er nichts entdecken. Nur der Absatz seines Schnürschuhs hängt in Fetzen herunter, dort, wo ihn das Geschoss getroffen hat.
Emil Bachmann rappelt sich hoch und stürmt weiter. Beim schnellen Laufen merkt er den fehlenden Absatz fast gar nicht. Der MG-Schütze hat inzwischen die Waffe wieder von ihm weg gerichtet, dorthin, von wo aus sich die deutschen Truppen näher an den Posten heranarbeiten. Die ersten Handgranaten fliegen durch die Luft.
Bachmann nimmt humpelnd die letzten Meter. Im Laufen reißt er seine kleine Mauser-Taschenpistole heraus und fängt an zu feuern. Hinter den drei Mann unmittelbar am MG sind noch weitere Soldaten zu erkennen. Der Kampflärm ist so laut, dass niemand ihn bemerkt.
Durch eine Lücke im Stacheldraht rutscht Emil direkt in den Graben hinein. Der Ladeschütze an der Munitionskiste hat sich erst halb zu ihm umgedreht, als ihn ein Schuss aus der Pistole im Bauch erwischt. Er macht noch eine winkende Bewegung mit dem rechten Arm, dann sinkt er in sich zusammen. Der Laderahmen mit den messingblinkenden Patronen fällt ihm aus der Hand. Emil richtet die Pistole auf den nächsten der MG-Bedienung und drückt ab.
Nichts. Leergeschossen, keine Patrone mehr im Magazin. Er schleudert die nutzlose Waffe auf den Mann. Der duckt sich vor dem heranfliegenden Gegenstand. Schnell zieht Emil aus den Gamaschen seinen Grabendolch heraus und wirft sich mit einem irren Schrei nach vorn. Der Franzose kauert vor seinem MG und kann sich nicht schnell genug hochstemmen. Emil rammt ihm den Dolch direkt in den Hals. Wutentbrannt zieht er ihn heraus und stößt ihn wieder und wieder hinein, bis der schlaffe Körper unter ihm wegsackt.
Die Klinge, die Hand, die sie hält, der ganze Arm ist rot, voll Blut. Der Waffenrock über und über besudelt. Emils Gesicht ist nicht mehr unter dem Dreck, dem Schweiß und dem Blut zu erkennen. Seine Augen – weiß aufgerissen – fixieren die verbliebenen Franzosen, als er sich mit dem Dolch in der Hand ihnen zuwendet.
Sie haben den Krieg kennengelernt, das Grauen der Schützengräben, das Trommelfeuer, das Gas. Aber als sich die rote Bestie langsam auf sie zubewegt, denken sie nicht mehr an Gegenwehr. Sie könnten ihn leicht über den Haufen schießen, er steht nur ein paar Meter entfernt, aber sie haben keine Kraft mehr dazu. Zögernd hebt erst der Erste die Hände, sofort folgen die anderen nach.
Für ein paar Sekunden stehen sie sich stumm gegenüber. Dann tauchen deutsche Stahlhelme über der Grabenwand auf. Der Moment ist vorbei. Rasch schieben sich zwei, drei Deutsche zwischen Emil und die Franzosen und entwaffnen sie. Ein Sanitäter zieht Emil beiseite, öffnet ihm den Rock und jagt ihm eine Spritze in die Brust. Anschließend fängt er an ihn abzutasten. Emil Bachmann wird es schwarz vor Augen.
Kapitel 2
Königs Wusterhausen, Mittwoch, 15. Januar 1919
Die Uniform schlackert ihm ohne den Koppelriemen lose am Körper. Emil Bachmann ist kein Soldat mehr. Vor wenigen Wochen wurde er in Brandenburg abgemustert und mit einem Handgeld, Rasierseife und einer Zugfahrkarte nach Wahl Richtung Heimatort geschickt. Doch wohin soll er? Die Mutter ist letztes Jahr gestorben, an Schwindsucht, der Vater schon lang vor dem Krieg. Er hatte in Berlin beim Bau des Wintergartens mitgearbeitet und sich einen Lungenriss zugezogen, als er beim Heben eines Stahlträgers angepackt hat. Danach konnte er nur noch liegen und siechte ein Dreivierteljahr dahin. Die Mutter pflegte ihn und ernährte die Familie. Sie war sehr streng, aber auch sehr geschickt, und konnte dadurch mit allerlei Kleinkram Geld verdienen. Als der Vater starb, gab sie Emil als 15-Jährigen in eine Tischlerlehre.
Seine ältere Schwester Ilse ist nach Berlin verlobt, seine jüngere Schwester Grete in Anstellung im Rheinland. Von ihr hat er seit zwei Jahren nichts mehr gehört. Das Einzige, was ihm noch in Königs Wusterhausen bleibt, sind ein paar Dinge, die er vor seiner Einberufung gepackt hat und die jetzt bei einer alten Freundin seiner Mutter untergestellt sind. Es ist ein Koffer mit Kleidung, Papieren, Sachen aus einem alten, zivilen Leben, die er jetzt wieder braucht, wenn er eine Anstellung finden will.
Emils Zug ruckelt durch die winterliche Landschaft, die sich um halb fünf nachmittags schon grau zu färben beginnt. Nur raus aus dem Hexenkessel Berlin. Hundertausende Menschen stehen in den Straßen, machen mit roten Fahnen in den Händen Revolution. Der Kaiser hat in’ Sack gehauen und seitdem regiert das Chaos. Es ist kein Durchkommen mehr, nirgendwo. Kaum noch Brot zu ergattern, stattdessen Geschrei und Parolen:
»Auf zum Kampfe für den Sozialismus!«
»Auf zum Kampfe für die Macht des revolutionären Proletariats!«
»Nieder mit der Regierung Ebert-Scheidemann!«
Emil ist die ganze Revolution egal. Er wird in seiner Uniform ohnehin schief angesehen: von den Arbeitern und von den Soldatenräten mit ihren roten Armbinden, die nicht wissen können, ob er einer von ihnen ist. Viele tragen Gewehre mit sich herum. Die Mündung nach unten, stehen sie in Grüppchen an den Straßenecken und wissen nichts mit sich anzufangen. Niemand hat einen Überblick, das Zeitungsviertel ist besetzt und keinerlei offizielle Nachrichten erscheinen. Ein Gerücht kommt wilder als das andere daher. Zum Glück kann Emil die Tage bei Ilse unterkommen. Die Massen in der Stadt sind unheimlich, unberechenbar. Es gibt keine Führung, die sie lenkt. Sie wollen die Revolution, aber sie wollen gleichzeitig Ruhe und Ordnung bewahren. Die Wilhelmstraße ist ein einziger Menschenhaufen, die Linden bis zum Alex voll wie ein Rummelplatz. Die Stadt vibriert, gleicht einem Bienenstock, und alle erwarten stündlich, dass die Übermacht der Arbeiter die Regierung davonjagt.
An den Berliner Bahnhöfen gibt es kein Fortkommen mehr, Generalstreik, alle Züge stehen still. Auch hier sind die Gebäude besetzt. Emil überlegt, zu Fuß nach Königs Wusterhausen zu marschieren, die Entfernung hat er schon öfter beim Kommiss zurückgelegt, etwa 40 Kilometer, aber bei dem Wetter biwakieren mag er nicht. In den Straßen vor dem Bahnhof drückt man ihm ein Flugblatt in die Hand.
Arbeiter, Bürger,
Das Vaterland ist dem Untergang nahe.
Rettet es!
Es wird nicht bedroht von außen, sondern von innen:
Von der Spartakusgruppe.
Schlagt ihre Führer tot!
Tötet Liebknecht!
Dann werdet ihr Frieden, Arbeit und Brot haben!
Die Frontsoldaten
Emil wirft es weg. Sollen sie sich doch alle selber totschlagen. Er als heimgekehrter Frontsoldat will einfach raus aus dem Chaos, arbeiten, Schluss mit dem Krieg machen. Tote hat er schon mehr als genug gesehen.
Doch ein paar Tage muss er sich noch gedulden. Solange dauert der Spuk, dann stürmen Freikorps die Stadt. Endlich kommen wieder richtige Truppen zum Einsatz, die dem Unfug ein Ende bereiten. In schweren Kämpfen erobern sie Haus um Haus. Geschütze stehen in den Straßen, MGs sind in den Toreinfahrten aufgebaut, sogar einige Panzer rollen. Die Arbeiter und Kommunisten werden Stück für Stück ausgehoben und abgeführt. Unbestattete Leichen liegen offen herum. Und Emil kommt endlich raus aus Berlin.
*
Königs Wusterhausen, Montag, 20. Januar 1919
Welche Ruhe herrscht hier am Bahnhof, als er in der Dämmerung eintrifft. Emil steigt aus dem Zug und sieht sich in der Gegend um. Fast keine Menschenseele ist um diese Zeit unterwegs. Die wenigen Gesichter, die ihm in der Bahnhofstraße entgegenkommen, kennt er nicht. Ihm ist, als wenn er ewig fortgewesen wäre. Der Krieg hat ihn entfremdet. Mit seinen 22 Jahren hat er hier kein Zuhause mehr.
Das Schloss des Fritzewilhelm hebt sich dunkel gegen den Himmel ab. Emil geht an ihm vorbei zum Kirchplatz. Ein langer Weg voller Erinnerungen, die sich ihm jetzt aufdrängen. Unter den alten Bäumen liegt nasses Laub auf dem Pflaster, das seine Schritte dämpft. Weiter vorn geht Arm in Arm ein Paar. Sie ist klein, trägt ein kurzes warmes Jäckchen über dem Rock, er − mit Mantel und steifem Hut − überragt sie um eine Kopflänge. In der Kälte drückt sie sich eng an ihn. Emil geht über den halben Platz hinter ihnen, bis bei ihm der Groschen fällt.
Das ist doch Clara, seine Clara! Die Jacke kennt er zwar nicht, und auch ihr Rock muss neu sein. Aber der Gang ist unverwechselbar. Dieses fast unmerkliche Hinken, das von einem Beinbruch stammt, den sie sich als Kind zugezogen hatte. Und der Mann neben ihr muss Dr. Samuel Löwenthal sein, der ach so liebe Kinderarzt. Emil lässt sich zurückfallen, damit sie ihn nicht bemerken, und folgt den beiden weiter. Aufgrund der Dämmerung verschwimmen Gesichter in wenigen Metern Entfernung zu Schemen.
Er hat sie lange nicht mehr in ihrer ganzen Schönheit gesehen, doch ihr Bild trug er die ganze Zeit im Herzen mit sich herum. Es stärkte ihn in den Kämpfen an der Front, es gab ihm Halt. Er dachte an sie, wenn er durchnässt und frierend im Stollen saß, wenn er vor Müdigkeit kaum noch die Augen offen halten konnte und zu fantasieren anfing. Und jetzt hat ein Mann seine Pfoten auf ihr, der nie gekämpft hat, der nicht an der Front war, der sich ein schönes Leben machte, während die anderen den Kopf fürs Vaterland hinhielten. Der darf das Land nicht seine Heimat nennen, tobt Emil innerlich. Was sucht er noch hier, dieser Schmarotzer! Es stimmt alles, was in Berlin erzählt wird. Die Kriegsgewinnler haben das Land kaputt gemacht, sind schuld an der Niederlage. Und während arme Kerle wie er selbst im Dreck lagen, hat ihnen dieses feige Gesindel noch das letzte Hemd weggenommen.
Seine gute Clara. Wenn er zu Hause geblieben wäre, wäre das nie passiert, denkt Emil wehmütig. Er hätte sie beschützen und für sie sorgen können. Stattdessen kam dieser gierige Kinderarzt daher mit seinem Geld und seinem Lächeln und machte ihm Clara abspenstig. Was wird er ihr wohl alles für nette Worte ins Ohr geflüstert haben, der belesene Herr Doktor. Clara hatte schon immer eine Schwäche für ältere, wohlhabende Herren und schöne Kleider.
Das alles schießt ihm durch den Kopf, während er hinter ihnen her trottet. Im Feld haben sie Probleme auf einfache Art und Weise gelöst. Da wusste er stets, was richtig und was falsch, wer Freund und wer Feind war. Gewiss gab es auch unter den eigenen Leuten Schweinehunde, Menschenschinder, Verbrecher und Lumpen. Aber an der Front war klar, wo es langging. Dem Feind entgegen.
Da haben sie nicht lange gefackelt, wenn ihnen einer dumm gekommen ist. Wie damals der Pfaffe in Belgien. Den haben sie aus dem Busch gezogen und die Soutane heruntergerissen. An der rechten Schulter der verräterische Fleck, der Abdruck des Kolbens. Der Dreckskerl hatte sich im Hinterhalt auf die Lauer gelegt und geschossen. Gleich an der nächsten Laterne haben sie ihn aufgehängt, da hat ihm sein ganzes Gezeter nichts genützt. So gehört es sich!
Er folgt ihnen weiterhin. Die beiden schlendern durch den Ort bis zu Claras Elternhaus. Vor der Tür lösen sie sich voneinander. Clara holt aus ihrer Tasche ihren Haustürschlüssel. Dann umarmen und küssen sie sich. Emil steht im Schatten eines Eingangs zwei Häuser weiter und beobachtet alles. Heiß pocht sein Blut in den Schläfen, und er fühlt eine dumpfe Wut in sich aufsteigen. Nach einigen innigen Momenten tritt Clara ins Haus und entzieht sich damit seinem Blick. Dr. Löwenthal wendet sich ab und geht die Straße hinunter, entfernt sich von Emil. Er schreitet jetzt weit aus. Emil zögert einen Moment, mag sich von dem Haus nur schwer lösen, aber schließlich läuft er dem Arzt hinterher.
Warum er und nicht ich?, fragt sich Emil. Was ist das für ein Mensch, was hat der für einen Anspruch auf Clara? Liegt es daran, dass er älter ist? Dass er reicher ist? Nein, das Recht ist auf meiner Seite, ist er sich sicher. Zu oft haben sie mich schon im Leben beschissen, das lasse ich mir nicht noch mal bieten!
Wie mit einer unsichtbaren Schnur verbunden, tappen beide durch die Straßen. Rechts, links, hoch − bis sie an Dr. Löwenthals Praxis ankommen, die in einem stattlichen Haus am Hang eingerichtet ist. Der Arzt öffnet die Tür und tritt ins hell erleuchtete Foyer. Durch das Mosaik der Facettenglasscheiben beobachtet Emil, wie Dr. Löwenthal Hut und Mantel ablegt. Ein Dienstmädchen kommt hinzu. Wenig später verlassen beide den Eingangsbereich.
Jetzt weiß Emil, was er noch zu erledigen hat, außer seinen Koffer zu holen. Die Stimmen aus Berlin überschlagen sich in seinem Kopf:
Die Stunde der Abrechnung naht!
Zeigt eure Macht!
Schlagt ihn tot!
Tot!
Tot!
Erst dann wirst du Frieden haben.
Noch ist es zu früh. Noch ist keine Ruhe in dem Städtchen eingekehrt. Noch ist er zu erregt. Noch hat Emil anderes vor.
Er huscht im Dunkel davon. Die Stadt ist klein. Einige Straßen weiter liegt der Hof der Freundin seiner Mutter. Niemand darf wissen, dass er heute hier ist. Er wird nicht anklopfen und sich nicht zeigen. Zum Glück hat sie ihm geschrieben, wo sie seinen Koffer aufbewahrt. Emil lehnt sich an den Zaun und schaut auf das Anwesen. Wenigstens haben sie keinen Hund mehr, und die Gänse sind auch schon geschlachtet. Gänse sind noch schärfer als Hunde und machen einen Höllenlärm. Das Einzige, was er vernimmt, ist ein undeutliches Schnaufen, das aus dem Stall zu ihm herüberweht. Gut so, denkt er sich. Aus dem Küchenfenster fällt ein Lichtschein in den gepflasterten Hof. Emil drückt sich an der Stallwand entlang, das helle Rechteck umgehend, bis zur Remise. Dort führt eine Stiege auf den Dachboden. Langsam, um kein verräterisches Knarren zu verursachen, nimmt Emil Stufe für Stufe. Oben auf dem Sims drückt er langsam die Tür auf. Zum Glück ist sie unverschlossen, hier stiehlt niemand was und wenn, dann kein altes Gerümpel. Freilich, Nahrungsmittel werden besser verwahrt, die stellen zurzeit die wahren Schätze des Hauses dar. Emil hört seinen Magen knurren. Die letzte Stulle hat er im Zug verdrückt. Es ist der immer gleiche Hunger, der seit Jahren in seinem Magen rumort und ihn reizbar macht.
Emil Bachmann steht im Finstern. Undeutlich nimmt er einige Schemen wahr. Er kramt in seiner Rocktasche und holt Zündhölzer hervor. Das erste Streichholz bricht ab, seine Finger sind zu klamm. Er haucht eine Weile in seine Hände. Nun geht es besser. Das zweite Holz reißt er mit einem lauten Ratschen an. Erst leuchtet das Köpfchen grell auf, dann verkümmert die kleine Flamme zu einem dünnen blauen Licht. Nur langsam wird sie größer und erhellt den Raum. Zehn Sekunden Licht. Vor ihm stehen alte, ausrangierte Möbel. Stühle auf einem Tisch. Körbe voller Irgendwas. Wo ist sein Koffer?
Er geht ein paar Schritte weiter in den dunklen Raum hinein. Spürt an seinem linken Arm einen Widerstand. Langsam lässt er sich auf die Knie nieder. Das zweite Streichholz, wieder nur ein paar Sekunden Licht. Nun sieht er Stuhlbeine, Möbelfüße, staubigen Fußboden. Hier vorn, wo er kauert, ist der Koffer anscheinend nicht abgestellt. Er muss tiefer in das Durcheinander kriechen.
Er hat gerade noch drei Streichhölzer übrig, als er ihn endlich findet. Das Gepäckstück aus Korbgeflecht ist kleiner, als er es in Erinnerung hatte. Aber es ist seins, ganz eindeutig. Er hat den Fleck auf dem rechten Schnallriemen gleich erkannt. Langsam zieht er seinen Koffer zwischen den Möbeln hervor. Er öffnet ihn. Der Inhalt liegt noch genau so darin, wie er ihn damals gepackt hat. Unten die Kleidung, obenauf die Papiere. Im Dunkeln schließt er die Lederriemen wieder, dann schnappt er sich einen der Stricke, die er vorhin ganz in der Nähe entdeckt hat, und befestigt ihn als Schultergurt an den Riemen. So wird er den Koffer leichter nach Berlin transportieren können, ohne dass ihm unterwegs der Arm lang wird.
Auf dem Weg zu Dr. Löwenthals Praxis findet Emil Bachmann im Park genau das, wonach er gesucht hat. Ein dunkles Gebüsch aus Lebensbaum, das sich bis in Brusthöhe vor ihm auftürmt. Er kriecht auf dem Boden herum, bis er eine Lücke zwischen den Ästen findet. Er möchte kein weiteres Streichholz verbrauchen und tastet daher alles mit den Händen ab. Genau wie er es sich gedacht hat. Der Bereich um den Stamm liegt voller Nadeln und ist knochentrocken. Der Geruch nach Friedhof steigt in seine Nase. Hier kann er seine Habseligkeiten erst einmal sicher verstauen. Zwei herumliegende helle Birkenäste legt er überkreuz auf den Boden, um die Stelle zu markieren. Sie wird er später auch in der Dunkelheit wiedererkennen können, wenn er den Ort wiederfinden muss.
Im Haus des Arztes sind nur zwei Fenster im Erdgeschoss erleuchtet. Emil schleicht sich durch den Garten und wirft vorsichtig über das Fensterbrett einen Blick ins Innere des Hauses. Er sieht die Küche, in der das Mädchen gerade den Abwasch erledigt. Sie hat beide Ärmel hochgekrempelt. Vor ihr türmen sich Teller, Schüsseln und Kochgeschirr. Ihr Gesicht ist gerötet, sie arbeitet konzentriert, ohne aufzublicken.
Auf der Vorderseite des Gebäudes liegt das andere helle Fenster. Er schaut hinein und entdeckt einen gemütlichen Salon. An den Wänden stehen Bücherregale. Im Ohrensessel sitzt Dr. Löwenthal und liest Zeitung. Eine Zigarre qualmt im Aschenbecher neben ihm. Der übrige Raum liegt im Dunkeln. Der Rest des Hauses ist unbeleuchtet. Also sind wohl nur zwei Personen anwesend, schließt Emil. Er kann nicht einfach in das Haus eindringen, das würde ein Riesengeschrei geben. Also muss er abwarten, bis das Mädchen gegangen ist.
Er drückt sich im Garten herum und lauert. Die Füße werden ihm kalt, aber das ist er vom Postenstehen gewohnt. Er hat den Mantelkragen hochgeschlagen und hält die Arme eng an den Körper gepresst. Wenigstens liegt kein Schnee. Das gäbe Fußspuren. Es hat knapp über null Grad. Die ganzen letzten Tage hängt schon graue Suppe am Himmel, und es nieselt ab und zu ein wenig. Er würde jetzt gern eine Zigarette rauchen, um sich die Zeit zu vertreiben, aber das muss er sich verkneifen, damit kein Lichtschein entsteht.
Etwa eine Dreiviertelstunde später klappt die Eingangstür, und das Dienstmädchen huscht aus dem Haus. Die junge Frau hat einen dunklen Schal eng um den Kopf gewickelt. In der Hand hält sie einen kleinen Henkelkorb, wahrscheinlich Reste vom Abendessen. Emil spürt seinen Magen knurren und verflucht den Arzt. Was gäbe er dafür, in solch einem Haus im Warmen sitzen zu dürfen, ohne Hunger, ohne Not und mit einer festen Arbeit.
Emil überlegt, wie er ihn am besten erwischen kann. Er hat noch seine Pistole einstecken, aber das Ding macht einen Heidenlärm. Zudem kann er nicht sicher sein, dass der erste Schuss gleich vernünftig trifft, dann müsste er noch einmal nachsetzen. Hier in dieser ruhigen Gegend geht das alles gar nicht. Viel geeigneter ist sein Grabendolch. Wenn man ihn richtig einsetzt, kommt der Gegner gar nicht dazu, irgendeinen Laut von sich zu geben. Der Nachteil ist nur die Schweinerei, wenn man nicht aufpasst. Aber das ist egal, da es ohnehin bereits dunkel ist. Emil ist sich sicher, dass in der Nacht keinem Menschen irgendwelche Blutspritzer an seiner Kleidung auffallen werden.
Im Krieg hat er oft einen Dolch oder ein Messer eingesetzt. Eines Tages teilte ihr Zugführer große Schlachtermesser aus, die er irgendwo organisiert hatte. Dann sprangen sie in den französischen Graben und stürzten sich wild auf die Gegner. Auf derart kurze Entfernung hatten diese keine Chance, ihre Gewehre hochzureißen. Es war ein wildes Geschrei und Gemetzel. Die Männer waren, als sie zurückkamen, völlig berauscht. Später setzte die Ernüchterung ein, und das Entsetzen. An diesem Abend bekam jeder eine Flasche Schnaps und besoff sich hemmungslos. Die nächsten Streifzüge in die feindlichen Stellungen fielen ihnen schon wesentlich leichter. Nach einiger Zeit benutzte Emil gerne ein Messer oder den Grabendolch. Das war ihm lieber als das Gewehr mit dem starken Rückstoß, mit dem er sich unbeholfen fühlte. Oder gar die Handgranaten, die mit lautem, trockenem Knall zerbarsten, und bei denen man höllisch aufpassen musste, sie schnell nach dem Abziehen fortzuwerfen. Bei denen man sich selber noch Splitter einfangen konnte, wenn man nicht rechtzeitig den Kopf runternahm. Nein, Emils Waffe war scharf geschliffen und lautlos schön. Das ist das Einzige, was Emil am Krieg wirklich geliebt hat, denn er weiß, im bürgerlichen Leben wird er nie wieder die Gelegenheit haben, mit solcher Lust zu töten.
Es ist Zeit, zum Haus hinüberzugehen. Emil greift sich an den Hals und drückt die Schlagader ab, bis sein Kopf rot angelaufen ist. Mit der anderen Hand reibt er sich die Augen, dass Tränen kommen. Fix und fertig sieht er aus, in seiner abgetragenen, schmuddeligen Uniform. Dann läutet er an der Praxisglocke Sturm. Im Haus hört er Schritte, es flammt das Licht in der Eingangshalle auf. Dr. Löwenthal öffnet die Tür. »Was ist denn los, Mann, um diese Uhrzeit?«, herrscht ihn der Arzt an.
»Ein Kind! Vergiftung, es hat Schaum vor dem Mund!«, ruft Emil. »Kommen Sie schnell!«
Der Zorn ist aus Dr. Löwenthals Gesicht gewichen, als er das hört. Er dreht sich um und greift eine fertig gepackte Arzttasche, die neben der Tür steht. Mit der anderen Hand nimmt er den Mantel vom Haken und wirft ihn sich über den Arm, dann langt er nach seinem Hut und setzt ihn auf.
»Halten Sie mal«, sagt er, dreht sich nach Emil um, reicht ihm den Arztkoffer und zieht die Tür hinter sich zu. Ungelenk versucht er in den Mantel zu schlüpfen, der sich gegen die Eile wehrt. Emil tritt einen Schritt zurück, setzt die Tasche auf dem Boden ab und greift nach seinem Dolch, der mit seiner Scheide in der rechten Gamasche verborgen steckt. Er richtet sich langsam auf. Jetzt hat er Dr. Löwenthal in der richtigen Position vor sich. Der kämpft gerade mit einem Ärmel, als Emil an ihn herantritt. Die linke Hand legt er von hinten auf den Mund des Arztes und zieht dessen Kopf mit einer flüssigen Bewegung zurück. Die Faust mit dem Dolch schwingt in einem Bogen heran.
Emil schärft seinen Dolch immer selbst, den gibt er nicht aus der Hand. Er hat Erfahrung darin. Er weiß, dass die Spitze wie eine Nadel und die Schneide rasiermesserscharf ist. Mit einer glatten Bewegung zieht er die Klinge, fast ohne Widerstand zu spüren, durch die Kehle von Dr. Löwenthal. In seinem Handteller spürt er warm den letzten Atemzug, dann bäumt sich der große, fremde Körper in seinen Armen auf. Emil stößt ihn von sich, mag sich nicht mit Blut bespritzen lassen. Dr. Löwenthal sackt zusammen und schlägt seitlich auf die Freitreppe vor dem Gebäude. Er gibt gurgelnde Geräusche von sich, nicht lauter als ein heiseres Räuspern. Währenddessen rutscht er zwei, drei Stufen nach unten und zuckt. Nach einer Weile gibt der Körper endlich Ruhe.
Emil betrachtet den Todeskampf ohne Regung. Sieht den Arzt tot vor sich liegen. Der Leichnam ist seltsam verdreht, halb in den Mantel gewickelt. Der Eingangsbereich und die Stufen sind mit Blut besprenkelt. Ein dicker Spritzer reicht bis zur weißgestrichenen Hauswand. Emil wirft einen prüfenden Blick in Löwenthals Gesicht und stößt den Toten mit dem Fuß an. Der zeigt keine Reaktion mehr. Nur noch ein wenig Blut sickert aus der klaffenden Halswunde.
Langsam beugt sich Emil zur Leiche hinab und wischt seine klebrigen Hände sowie die blutige Klinge am losen Ärmel des Mantels ab. Anschließend schiebt er den Dolch zurück an seinen Platz.
Erst dann wirst du Frieden haben.
Er steht auf und läuft los, um seinen Koffer zu holen. Jetzt kann er nach Berlin zurückzukehren.
Kapitel 3
Berlin, Dienstag, 10. Oktober 1922
Sie sitzen zu dritt nach der Arbeit zusammen und trinken Bier. Emil hockt auf der Werkbank und reicht seinem Schwager Kurt zwei Flaschen aus dem Kasten. Der gibt eine davon weiter an den Heizer Hermann Schulz, der sie mit einem zufriedenen Grunzen entgegennimmt. Mit einem Plopp öffnen sie die Bügelverschlüsse und stoßen an. Hier, in der Schlosserei des Görlitzer Bahnhofs, direkt am Ringlokschuppen, treffen sie sich gern kurz vor Feierabend noch auf einen Schluck. Es riecht nach Männerschweiß, Maschinenöl und Metall.
Emil arbeitet seit drei Jahren hier und hatte damals riesiges Glück, dass ihn Kurt bei der Eisenbahn unterbringen konnte. Die Umstellung auf Friedenswirtschaft und die gewaltigen Reparationen setzten der Industrie schwer zu. Arbeitsplätze waren Mangelware, da die Massen an ehemaligen Soldaten untergebracht werden mussten. Durch Vermittlung seines Schwagers konnte Emil, der das Tischlerhandwerk erlernte, vorstellig werden und erhielt eine Stelle im Betriebswerk. Auch bei der Bahn gibt es schließlich genug aus Holz, was mit der Zeit morsch wird und erneuert werden muss. Emil ersetzt Lattenroste, hölzerne Sitze, Bretterwände und Ähnliches. Obwohl die Arbeitszeit seit dem Krieg offiziell auf acht Stunden am Tag gesenkt wurde, schuften sie hier in Zehn-Stunden-Schichten an fünf Tagen die Woche. Nur Samstag ist früher Schluss. An einem normalen Wochentag wie diesem läuten sie den Feierabend gerne mit einem Bier ein, bevor es nach Hause geht.
»Was liegt heute Abend noch an?«, fragt Kurt nach einer Weile in die Runde und beginnt, einen Feilkloben, Säge und Hammer in die Werkzeugschublade zu räumen.
»Soll abends noch zu Esch, dem haben sie die Bude gekündigt. Der hat sich mit der Hausverwaltung nicht vertragen, weil immer zu viel Remmidemmi bei ihm war. Jetzt zieht er in irgendein anders Loch, und ich darf den Krempel schleppen helfen«, antwortet Emil und lässt die leere Flasche in den Kasten gleiten.
»Kommst du vorher noch bei uns vorbei und holst dein Essen ab? Aber nicht zu spät, sonst ist der Kleine schon im Bett«, meint Kurt.
»Ist gut, bis nachher.« Emil packt seinen Henkelmann und setzt die Mütze auf. Er schließt die Knöpfe seiner groben Arbeitsjacke.
»Warte, ick komm mit dir.« Hermann Schulz erhebt sich ebenfalls.
Sie verlassen die Werkstatt und gehen über die Gleise dem Ausgang des Bahnhofsgeländes entgegen. Der Görlitzer ist einer der Berliner Kopfbahnhöfe, die rings um die Innenstadt verteilt liegen. Auf dem Gelände stehen neben der eigentlichen Bahnhofshalle noch weitere Wirtschaftsgebäude sowie der runde Lokschuppen mit Drehscheibe, wo die Lokomotiven gewartet und versorgt werden. Alles in allem hat das Areal eine Ausdehnung von fast einem Kilometer Länge und 200 Metern Breite.
Schwarz und Braun sind die vorherrschenden Farben in dieser eigenen kleinen Welt. Braun sind der Rost, die Schienen, die Schwellen und die Ziegelgebäude. Schwarz sind die Lokomotiven, die Kohlen, das Schmieröl und auch der Dreck unter den Fingernägeln der Männer. Die Arbeit ist hart, körperlich anstrengend und manchmal nicht ungefährlich. Sie sind froh, dass sie ihre Schicht für heute geschafft haben. Zusammen gehen sie zur Stechuhr und stempeln aus. Dann verlassen sie das Gelände an der Wiener Straße.
»Mach et jut«, meint Hermann Schulz und wendet sich Richtung Landwehrkanal.
»Mach’s besser«, antwortet Emil und läuft die Wiener Straße hoch, Richtung Bahnhofsgebäude. Auf Höhe der Liegnitzer Straße biegt er ab in den schmalen Fußgängertunnel, der das gesamte Bahngelände unterquert – die sogenannte Harnröhre, die so heißt, wie sie riecht. Er geht hindurch, dann geradeaus weiter in die Oppelner Straße hinein, in das Schlesische Viertel, wo er eine Bleibe gefunden hat. Schnell schaut er noch im Kiosk am Eckhaus bei Jahrschke rein, um sich eine Sechserpackung Eckstein-Zigaretten für zwei Groschen zu holen.
Die Gegend wurde um die Jahrhundertwende mit Mietskasernen bebaut, schnell hochgezogene Häuser mit vielen kleinen Wohneinheiten. Emil wohnt im dritten Hinterhof eines solchen Blocks im fünften Stock. Ein winziges Zimmer unterm Dach hat er ganz für sich allein, immerhin mehr als in der Lehre oder beim Kommiss. Ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch, ein wackeliger Schrank – das langt. Neben seinem Bett steht der Kanonenofen, der in der Früh wohlige Wärme abgibt und auf dem sich Emil auch eine Kleinigkeit kochen kann. Ein schmales blindes Fenster ohne Vorhang mit Blick zum Innenhof sorgt tagsüber für Helligkeit. Immerhin kommt Sonnenlicht in die Wohnung, da sie hoch genug liegt. Das Klo mit dem Wasserkran ist eine halbe Treppe tiefer und versorgt sechs Parteien.
Emil schließt die Tür hinter sich, stellt sein Essgeschirr auf den Ofen und wirft Jacke und Mütze auf den Boden. Dann macht er seinen Oberkörper frei, beugt sich über das Waschgeschirr und beginnt sich zu säubern. Anschließend trocknet er sich den Oberkörper ab, schlüpft wieder in sein Hemd und macht sich auf den Weg zu seiner Schwester Ilse.
Ilse und Kurt Jablonsky wohnen mit ihrem zweijährigen Sohn im Vorderhaus. Sie kocht gegen ein kleines Entgelt für Emil mit, und auch sonst verstehen sie sich gut. Emil klopft an der Wohnungstür, hinter der entsetzliches Geplärr zu hören ist.
»Komm rein«, hört er Kurt von drinnen rufen.
Jablonskys Wohnung besitzt immerhin zwei Zimmer, das Schlafzimmer und die Küche, in der sich das Familienleben abspielt. Ilse steht in ihrer Schürze am Herd und rührt in einem Topf. Der Raum riecht nach Kohl, wie auch das ganze Treppenhaus. Der Kleine sitzt in einem Stühlchen am Tisch. Unter der Sitzfläche hat ein Töpfchen Platz. Was oben reinkommt, kann also praktischerweise gleich durchmarschieren. Emil hat das Möbelstück gebaut, aus Holzresten vom Bahnhof, und hat es den beiden zur Taufe geschenkt. Seitdem steht der kleine Thron an der Stirnseite des Küchentisches und bereichert das Familienglück. Kurt sitzt im Unterhemd daneben und lässt die Hosenträger herunterhängen. Mit der einen Hand hält er eine Zeitung, mit der anderen Hand versucht er, den Kleinen mit einem Löffel zu füttern. Das Meiste geht daneben. Tisch und Kind sind mit Brei verschmiert.
»Lass mich mal«, meint Emil und nimmt ihm den Löffel aus der Hand.
Kurt rutscht mit seiner Zeitung näher unter die Glühlampe, die von der Decke hängt und ein funzeliges Licht verbreitet.
»Was gibt es Neues?«, fragt Emil.
»Sie haben wieder Mitglieder vom Bund Oberland verhaftet. Steht hier auf Seite zwei im Berliner Tageblatt. Die Aufmerksamkeit der Anwaltschaft gilt den ›staatsgefährlichen Umtrieben‹ – Desperados, das schreiben sie hier, sollen eine bedenkliche Rolle spielen. Hört, hört. Der Hauptschriftleiter und vier weitere führende Persönlichkeiten wurden wegen Raubüberfällen auf Reiseomnibusse verhaftet. Na so was«, Kurt reibt sich das Kinn. »Dass die auch nie mit ihrer Politisiererei aufhören können, jetzt machen die Freikorps gar einen auf ganz gewöhnliche Verbrecher. Nur was daran staatsgefährdend sein soll, wenn einer Touristen überfällt, kapier ich nicht. Jetzt guck dir mal an, was mir Kollegen auf der Arbeit zugesteckt haben.« Er holt ein zerknittertes Blatt aus der Jackentasche. »Das ist der ›Alarm‹. Organ für freien Sozialismus. Im Jahre 1919 war er vier Monate verboten gewesen, schreiben sie sogar ganz stolz vorn drauf. Das muss man erst mal hinkriegen, wo doch heutzutage jeder Quatsch gedruckt werden darf. Dann sind die ja wirklich ein ganz gefährliches Revoluzzerblatt. Ich hätt ja noch ’nen Witz gerissen, aber meinem Kollegen war die ganze Sache hochheilig.«
»Schmeiß das in den Ofen, es lohnt sich nicht, den Unfug zu lesen«, meint Emil dazu und schiebt dem Kleinen den nächsten Löffel Brei in den sperrangelweit geöffneten Mund. »Wird Zeit, dass endlich wieder Ruhe im Reich einkehrt. Die Reparationen sind auch ohne den Blödsinn schon schlimm genug.«
»Hast recht«, meint Kurt. »Ilse, jetzt mach dem Emil mal seinen Fraß fertig und dann schmeißen wir ihn raus. Der muss noch was arbeiten gehen.«
Ilse wirft den nassen Lappen nach ihrem Mann und verfehlt ihn nur um Haaresbreite. »Du musst ja nicht den ganzen Tag Windeln waschen und Essen kochen. Seid froh, dass ich euch immer noch was organisiere, was ihr fressen könnt.«
»Der Hunger treibt’s rein und der Ekel runter«, grinst Kurt zurück, während Ilse einen Schöpfer voll Kraut und Graupen in das Essgeschirr haut.
»Bis morgen, Emil!«
»Bis morgen, und dank dir Ilse.« Emil greift sich das Alugeschirr am Drahthenkel und drückt seine Schwester kurz von hinten.
*
Emil Bachmann kommt spät zurück. Der Umzug bei Esch war eine einzige Katastrophe. Sie mussten erst dessen Habseligkeiten zusammenräumen, bevor sie den Krempel auf einen geliehenen Bollerwagen verladen konnten. Zwischendurch schneite noch zweimal die Zimmerwirtin schreiend herein, warum alles so lange dauere. Die Krönung kam zum Schluss, als Esch den Zimmerschlüssel ablieferte. Die Wirtin riss ihn ihm aus der Hand und raste wie eine Furie in das Zimmer, um zu kontrollieren, ob auch alles sauber hinterlassen wurde. Sofort entdeckte sie die Macke in der Blümchentapete und kriegte sich fast nicht mehr ein. Das wurde Esch zu blöd, und er hat ihr in ordentlicher Lautstärke die Meinung gegeigt, was die Frau aber nicht sonderlich beeindruckt hat. Sie ist einfach noch lauter geworden, bis sich ihre Stimme hysterisch überschlagen hat. Als dann die Nachbarn anfingen »Ruhe!« zu brüllen und an die Wände hämmerten, drückte Emil der Guten fünf Mark in die Hand, damit sie endlich abziehen konnten.
Zum Glück war es nicht weit bis zu Eschs neuer Bleibe. Das neue Zimmer lag direkt unterm Dach. Also wieder Treppe rauf, Treppe runter, bis alles oben war. Bis sie fertig waren, war es schon 23 Uhr. Emil hat die Schnauze gestrichen voll, als er endlich nach Hause gehen kann, und hat sogar die angebotene Molle, ein Glas Bier, abgelehnt.
Er stapft durch die dunklen Straßen heim. Als er früh am Abend losmarschiert ist, hatten die Mädels angefangen, sich an den Hausecken aufzustellen. Jetzt ist mittlerweile die beste Zeit vorbei, und wer von denen heute noch nicht das Geschäft gemacht hat, wird es auch in dieser Nacht nicht mehr hinbekommen.
Aus einer Eckkneipe dringt Geklimper. Jemand hämmert auf einem verstimmten Klavier herum. Dazu grölen ein paar Gestalten den Schlager:
»Ernst, ach Ernst, was du mir alles lernst …«
»Verkauf mir Mund und Beine – für eine Nacht du Kleine …«
Vor dem Lokal, im schummrigen Licht, das aus der halbgeöffneten Tür dringt, stehen zwei ältere, aufgekämmte Damen und taxieren die vorübergehenden Passanten. Bei männlichem Publikum werfen sie sich in Position: Bauch rein, Brust raus. Emil beeilt sich, um schnellstmöglich vorbeizugehen.
»Hallooo«, dröhnt ihm eine verstellte, verlebte Stimme entgegen.
Emil schaudert’s tief im Inneren.
»Und, wie wär et mit uns beeden?«, fragt die andere der beiden Frauen.
»Nu renn doch nich so schnelle.«
»Muss weiter«, entgegnet Emil, und hastet vorbei. Was widert ihn diese Gegend nachts an.
Ein paar Ecken weiter dasselbe. Ein Mädchen stellt sich ihm in den Weg. Sie ist aber ein anderes Kaliber: groß, gut gebaut, schöne, klare Augen. Blonde Haarsträhnen fallen ihr ins Gesicht.
»Na, hast du nicht Lust?«
»Lust immer, aber kein Geld«, erwidert Emil und will sich an ihr vorbeidrücken. Sein Körper berührt ihren, und er riecht ihren Duft nach Haut und Seife.
»Dann gibt es heute ein Sonderangebot. Diesmal darfst du umsonst mit. Wenn’s dir gefällt, kommst du wieder, musst aber zahlen. Abgemacht?«
Emil bleibt abrupt stehen. Was hat er gerade gehört? Das kann nicht wahr sein. »Und was is der Trick dabei?«, fragt er.
»Es gibt keinen. Ist ein ehrliches Angebot. Kann mir kaum vorstellen, dass du nein sagst. Wärst ja schön blöde.«
In Emil arbeitet es. Die Kleine ist süß und nicht auf den Mund gefallen. Warum zum Teufel zögert er? Weil er noch nie erlebt hat, dass ein Mädchen von der Straße irgendwas ohne Hintergedanken gemacht hat. Was will sie von ihm? Soll er ausgeraubt werden? Er hat ohnehin nur ein paar Groschen einstecken. Und an das Märchen von der Liebe auf den ersten Blick glaubt er sowieso nicht. Er fühlt ein komisches Ziehen im Bauch.
»Und? Brauchst du ’ne Extraeinladung?«
Emil schnauft. Er wird aus der Situation nicht schlau, aber was hat er zu verlieren? »Ist gut, ich komm ja schon mit.«
Sie hakt sich bei ihm unter und schaut ihn schräg von der Seite an. Emil blickt stur geradeaus und hält sich stocksteif. Ein leichtes Lächeln umspielt ihre Lippen, als sie gemeinsam losgehen.
*
Emil liegt in ihrem Bett und wartet darauf, dass sie ihn rauswirft, um wieder an die Arbeit zu gehen. Als sie keine Anstalten dazu macht, angelt er sich seine Zigaretten aus der Hosentasche. Sie sieht es und holt sich ebenfalls eine aus einem hölzernen Kistchen, das auf dem Nachttisch steht. Sie reißt ein Streichholz an, zündet erst ihre Zigarette an, dann gibt sie Emil Feuer.
»Sag mal, wie heißt du eigentlich?«, versucht Emil, ein Gespräch in Gang zu bringen.
»Aurora. Gefällt dir das? Ich bin die Göttin der Morgenröte.«
»Schon.«
»Wir Frauen heißen alle ganz toll, mit bürgerlichem Namen bin ich bloß Ruth Stern. Hast du ein Problem damit?«
»Nein, warum?«, wundert sich Emil, der nicht weiß, weshalb sie das fragt.
»Nur so, dann ist ja gut.«
»Und wieso hast du mich nun mitgenommen?«
Ruth Stern nimmt einen tiefen Zug und stößt den Rauch langsam aus. Anschließend lässt sie den Kopf aufs Kissen zurückfallen. »Unser Leben ist kein Zuckerschlecken. Du stehst draußen, bei Wind und Wetter. Suchst nach Männern, um etwas Geld zu verdienen. Manchmal klappt es gut, dann könntest du ein paar Tage Pause machen. Manchmal musst du aber