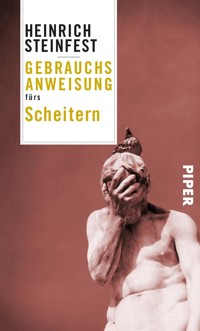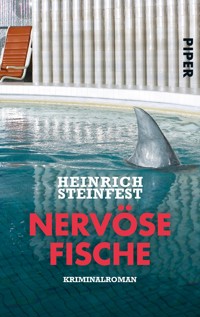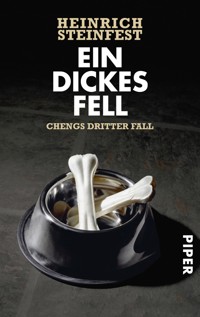
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Kartäusermönch soll im 18. Jahrhundert die Rezeptur für ein geheimnisvolles Wunderwasser erfunden haben – 4711 Echt Kölnisch Wasser. Als in Wien ein kleines Rollfläschchen mit dem Destillat auftaucht, beginnt eine weltweite Jagd nach dem Flakon: Seinem Inhalt werden übersinnliche Kräfte nachgesagt, wer es trinkt, erreicht ewiges Leben. Ausgerechnet der norwegische Botschafter muss als erster sterben, und Cheng, der einarmige Detektiv, kehrt zurück nach Wien. Sein Hund Lauscher trägt mittlerweile Höschen, hat sich aber trotz Altersinkontinenz ein dickes Fell bewahrt. Und das braucht auch Cheng für seinen dritten Fall in Heinrich Steinfests wunderbar hintergründigem Krimi.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Taschenbuchausgabe
3. Auflage Januar 2011
ISBN 978-3-492-95803-5
© 2006 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagfoto: Karen Zukowski / Zefa / Corbis Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
I
Einführung in das Töten, den Biedermeier und den Hauskauf
Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns und Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenze der Sprache geholt hat. Sie, die Beulen, lassen uns den Wert jener Entdeckung erkennen.
PHILOSOPHISCHE UNTERSUCHUNGEN, LUDWIG WITTGENSTEIN
1
Eine Frau namens Gemini
Es ist wichtig, eins von Anfang klarzustellen: Daß nämlich Anna Gemini ihr Kind in keiner Weise benutzte, um ihre Aktivitäten zu tarnen. Vielmehr ergab sich diese Tarnung als unabwendbare Begleiterscheinung. Der Umstand, an einem jeden Tag, praktisch zu jeder Stunde mit diesem Kind zusammen zu sein, bedeutete im Gegenteil eine immense Erschwernis und ein großes Risiko. Die Tarnung stellte somit einen Ausgleich für all die Komplikationen dar, die daraus erwuchsen, gleichzeitig Mutter und Killerin zu sein, gleichzeitig einen schwerbehinderten Jungen zu betreuen und im Auftrag wildfremder Menschen wildfremde Menschen umzubringen.
Gemini. Was für ein merkwürdiger Name, wenn man keine Raumkapsel war. Auch verfügte Anna nicht etwa über einen Zwilling, was dann immerhin einen Bezug zum lateinischen Original ergeben hätte. Vielmehr war sie zusammen mit einem sehr viel älteren Bruder aufgewachsen, und zwar in einem kleinen niederösterreichischen Dorf, das in einem engen Tal wie zwischen zwei prähistorischen Schulterblättern eingeschlossen lag. Diese Enge hatte Anna als Geborgenheit aufgefaßt und den ausbildungsbedingten Wechsel in die Stadt mit einer Art religiöser Demut ertragen. Die religiöse Demut war von Beginn an ihre Domäne gewesen, ihr eigentlicher »Knochen«, wenn man sich den Menschen aus einem einzigen wirklichen Knochen bestehend vorstellt.
Freilich hatte sie in der Stadt eine Existenz entwickelt, die sich auch außerhalb dieser Demut abspielte. Das bereute sie bis zum heutigen Tag, nämlich ein richtiger, ein lebendiger Mensch geworden zu sein, in erster Linie also ein geschlechtlicher Mensch. Und es lag ein verteufelter Widerspruch darin, daß das letztendliche Produkt dieser Geschlechtlichkeit, ihr Sohn Carl, ihr großes Glück bedeutete. Trotz jener Behinderung, die beträchtlich war und Carl mit seinen vierzehn Jahren auf dem geistigen Niveau eines Zweijährigen zurückhielt (eines brillanten Zweijährigen, muß allerdings gesagt werden). Dazu kamen diverse Probleme mit der Motorik. Mitunter war es so, daß Carls Gliedmaßen ein unkontrollierbares Eigenleben zu führen begannen, schlenkerten, rotierten, ausbrachen, den eigenen Rumpf und Schädel attackierten und Carl als eine Puppe erscheinen ließen, in die der Hauch des Lebens stromstoßartig geblasen wurde. Carl war eher großgewachsen und ausgesprochen dünn. Seine Haut besaß die Farbe eines ewigen Winters. Sein Gesicht war voller als der Rest, das blonde Haar wiederum dünn wie gehabt. Die hellbraunen Augen standen im Schatten herrlicher Wimpern, als wollten eben auch diese Wimpern den Zustand des Kleinkindes erhalten. Die meiste Zeit über hatte er seinen Mund leicht geöffnet und seinen Kopf etwas schräg gestellt, woraus sich wiederum ein nach oben gerichteter Blick ergab, der dem geneigten Betrachter heilig erscheinen konnte.
Phasenweise, in Momenten der Erregung, vielleicht auch in Momenten bloßer Langeweile, entließ Carl schrille Laute von einer solchen Intensität, daß Nachbarn schon mal die Polizei riefen. Selbige Polizei, die ja ständig mit dem Vorwurf konfrontiert war, nie dort zu sein, wo man sie brauchte, bewies nach einer ersten Phase der Gewöhnung viel Feingefühl. Diese beamteten Männer und Frauen waren schließlich nicht die Barbaren, als die der Bürger, diese ganze geistlose Autofahrergemeinde, sie gerne ansah. Wenn Polizisten bei Anna anläuteten, so nicht, um sich schikanös zu verhalten, sondern um Hilfe anzubieten. Und nicht selten tat Anna genau das: Sie nahm die Hilfe an. Woran sich die Polizisten freilich auch erst einmal gewöhnen mußten. In der Regel bat Anna die Beamten herein und animierte sie, wenn denn Zeit bestand, sich ein wenig mit Carl zu beschäftigen. So unverschämt konnte Anna Gemini sein.
Ein Kindsvater existierte nicht. Nicht einmal der Name eines solchen. Selbst sein Gesicht lag so weit zurück in der Geschichte, daß Anna es beim besten Willen nicht hätte beschreiben können. Genaugenommen hatte sie nur die Haare dieses Menschen in Erinnerung, Haare, die ihm in der allerdekorativsten Weise ins Gesicht gehangen waren. Ja, das war es gewesen, was sie damals – dreißigjährig, also mitnichten ein Küken – an diesem Mann in erster Linie beeindruckt hatte, seine rankenartig geschwungenen Strähnen dunkelblonden Haares, die sowohl seine Stirne als auch wesentliche Teile seines Augenpaares verdeckt hatten. Nicht in die Augen dieses Mannes hatte sie sich also verliebt, sondern in den Umstand ihres Verborgenseins, als schätze man an einem Gegenstand, ihn nicht ansehen zu müssen.
Jedenfalls war der Träger dieser Haare am Morgen danach verschwunden gewesen, ohne eine Adresse oder auch nur einen wirklichen Eindruck hinterlassen zu haben. Dafür war Anna schwanger gewesen. Und bloß ein klein wenig unglücklich, mit dieser Schwangerschaft alleine zu sein.
Eine Behinderung ihres Kindes hatte sich in keiner Weise angekündigt. Auch war immer unklar geblieben, woher der Defekt stammte und ob er sich möglicherweise erst aus dem Geburtsvorgang ergeben hatte. Carls »Unvollkommenheit« fehlte ein richtiger Name. Statt dessen Vermutungen. Was diverse Behandlungsmethoden zur Folge hatte, die sämtlich weite Bahnen um das eigentliche, aber eben namenlose Thema zogen. Ohnehin ging es natürlich nicht darum, einen Unheilbaren zu heilen, sondern eine gewisse Kontrolle über dessen Unheilbarkeit zu erlangen. Mit den Jahren aber ermüdete nicht nur Anna, es ermüdeten auch die Ärzte. Man reduzierte jene Unheilbarkeits-Kontrolle auf ein Minimum und überließ es der Mutter, im Rahmen des Verantwortbaren und der Regeln zu entscheiden, was zu tun oder zu unterlassen war. Und sie entschied sich nun mal – wie unter modernen Eltern so gesagt wird –, das Kind wachsen zu lassen. Was in Carls Fall auch bedeutete, in mancher Hinsicht eben nicht zu wachsen.
Die Liebe zu diesem Kind konnte größer nicht sein. Nicht wenige sprachen von Affenliebe und Übertreibung. Allerdings vertrat niemand die Ansicht, daß eine solche übertriebene Liebe Carl schadete. Wie denn, bei einem Kind, das nie und nimmer in eine selbstbestimmte Art von Erwachsensein würde entlassen werden können. Zudem schien es, daß auch Anna Gemini ohne ihr Kind vollkommen verloren gewesen wäre, im eigentlichen Sinn obdachlos. Der eine verkörperte den Flaschengeist des anderen, der eine im anderen wohnend.
Das war nicht das Schlechteste, was zwei Menschen passieren konnte. Freilich barg das Leben auch Schwierigkeiten, die mittels einer solchen Verbundenheit nicht zu lösen waren. Und es nichts nutzte, das Schicksal demütig anzunehmen. Bankkredite beispielsweise sind kleine, blinde, blöde Frösche, die sich von der gottgefälligsten Demut nicht beeindrucken lassen. Sie hocken auf Steinen, halten sich für Prinzen oder Autorennfahrer oder noch Besseres und wollen bezahlt werden.
Anna, welcher als Alleinerzieherin eines schwerbehinderten Kindes natürlich eine staatliche Unterstützung zustand, war wegen mehrerer banaler Gründe dennoch gezwungen gewesen, einen Kredit aufzunehmen, wie andere Menschen auch, die auf dem Nagelbrett »banaler Gründe« über Frösche stolpern.
Nach einiger Zeit ergab sich nun die Notwendigkeit, in irgendeiner Form zusätzliches Geld zu verdienen, wollte Anna das Maß der Bescheidenheit, das sie sich und ihrem Kind zumutete, nicht unterschreiten. Und das wollte sie keinesfalls. Sie hielt es für unverzichtbar, ein Auto zu erhalten, mit dem man Tag für Tag Ausflüge unternahm, auch mal nach Italien fuhr, sogar nach Finnland. Carl tat sich schwer in öffentlichen Verkehrsmitteln, in der dröhnenden Kühle der Flugzeuge, in all diesen darmähnlichen Passagierschlünden. Er fühlte sich dann eingeschlossen wie in eine rollende Wassermelone, begann nicht selten zu schreien, erregte die Aufmerksamkeit. Woran sich Anna nie hatte gewöhnen können, an das Gestiere der Herschauenden, und noch weniger an das der Wegsehenden, deren Blicke gewissermaßen die Kurven kratzten und dabei unangenehme Geräusche verursachten. Kratzgeräusche eben.
Ein Auto war also unbedingt vonnöten. Auch war Anna wichtig, daß sie und der Junge gut gekleidet waren. Nicht auffällig, das nicht. Auch nicht teurer als nötig. Aber doch im Rahmen einer gehobenen Qualität und zeitgenössischen Verankerung. Einer Verankerung, die ihrer beider Alter entsprach: Annas in jeder Hinsicht schlanker Vierundvierzigjährigkeit und Carls Jungenalter, in dem ein jeder Bursche, der gesündeste noch, behindert aussieht. Vierzehnjährige machen einen verbogenen, körperlich instabilen Eindruck. So sportiv können sie gar nicht sein, um nicht doch an mißlungene Architektur zu erinnern. An Gebäude, die im Mischmasch der Stile auseinanderzufallen drohen. Es bedeutet somit eine unnötige Liebesmüh, einem Vierzehnjährigen mittels Kleidung so etwas wie Schick andichten zu wollen. Weshalb der Schick in diesem Alter zur Gänze vom Trend ersetzt wird, dessen soziale Komponente darin besteht, unabhängig von den einzelnen Körpern oder deren jeweiliger Verbogenheit zu bestehen. Die Kostenfrage ist leider Gottes eine andere. Die Kostenfrage führt die ganze Sache auf das übliche Niveau zurück.
Jedenfalls lief Carl nicht wie jemand herum, dessen Behindertenstatus man bereits allein an seiner Hose oder seinem Hemd hätte ablesen können, ganz abgesehen von den Brillen oder der Frisur. Nein, Carls Kleidung entsprach seiner Zeit und seinem Alter, entsprach jener Ästhetik des Amöbalen, der bis zu den Kniekehlen abgesackten Hosenböden, dieser ganzen textilen Expansion, hinter welcher der Körper – fett oder schlank oder verschwindend – etwas Geisterhaftes besaß. Daß diese Jungs zur Sexualität fähig waren, oder demnächst fähig sein würden, war nicht wirklich glaubwürdig. Ihr pubertierender Leib schien sich in diesem Outfit zu erschöpfen, diesen weiten Hosen und diesen Turnschuhen, die aussahen wie geschwollene Backen, diesen flatterigen Gymnastikjacken und kopfschluckenden Wollmützen. Samt Accessoires, die als nahe und ferne Trabanten den vierzehnjährigen Körper wie einen bloß theoretischen Planeten begleiteten. Einen Planeten ohne wirklichen Sex.
Auch Anna war ohne Sex, nur daß man ihr das nicht ansah. Gut, sie war ein wenig der verhungerte Typus, der Typus mit Schatten unter den Augen und kantiger Nase und einem eher kleinen Busen und dünnen, blonden Haaren und einer insgesamt verbitterten Erscheinung. Aber das war nun mal auch die Art von Frau, die hervorragend in hautfreundliche Sportunterwäsche paßte und somit in eine Kleidung, die sehr viel mehr die Phantasie der Männer beschäftigte als jene sogenannte Reizwäsche, deren Bedeutung auf dem Irrtum beruhte, die Farbe Rot habe in der Erotik dieselbe Bedeutung wie in der Politik und der Malerei. Und auf dem Irrtum, man könnte den Liebreiz einer gestickten Tischdecke auf einen Büstenhalter übertragen. Die Oberbekleidung, die Anna Gemini trug, stellte eigentlich nichts anderes dar als ein Anführungszeichen, das jene Sportunterwäsche gleichzeitig verdeckte, aber eben auch apostrophierte. Wobei die Tragebänder des BHs im Falle sommerlicher oder festlicher Kleidung des öfteren von der Verdeckung ausgenommen waren und solcherart die Nacktheit bloßer Schultern noch betonten, ja, sie verdoppelten. Doppelt nackt, das war wie weißer als weiß, unmöglich zwar, aber gut vorstellbar.
Darum ging es Anna. Jene Nachlässigkeit zu vermeiden, mit der nach allgemeiner Vorstellung alleinstehende Mütter mit ihren behinderten Kindern durch die Gegend liefen. Statt dessen kultivierte sie den strengen Reiz einer dürren, eleganten Blondine und stattete ihren Sohn soweit als möglich mit passender Markenware aus. In dem Maße, in welchem es der mittelständischen Lebenswelt entsprach. Oder auch der kleinbürgerlichen. Die Zeiten waren vorbei, da man das wirklich auseinanderhalten konnte. Die Stände waren verschmolzen wie die Schichten heller und dunkler Schokolade.
Diese Maxime Annas, und einiges andere, führte nach dem ersten Jahrzehnt ihrer Mutterschaft, in dem sie mit ihrem Kind wie im Fraßgang einer Raupe gelebt hatte, dazu, ihr finanzielles Problem in den Griff bekommen zu wollen und sich um einen Job zu bemühen. Einen Job natürlich, bei dem sie Carl dabeihaben konnte. Sie vertrat den Standpunkt, daß wenn Tausende von Arbeitnehmern ihre Haushunde mit ins Büro nahmen, es doch wohl möglich sein müßte, von einem Zehnjährigen begleitet zu werden, dem völlig die Möglichkeit fehlte, durch penetrante Altklugheit irgendwelche Arbeitsprozesse zu stören. Aber da hatte sie sich getäuscht. Ein Zehnjähriger sei kein Haushund, sagten die Leute, bei denen sie vorsprach. Das war so richtig wie verlogen. Man wollte sich ganz einfach Probleme ersparen, von denen schwer zu sagen war, worin genau sie hätten bestehen können. Was machte so ein behindertes Kind? Wozu war es fähig? Und inwieweit widersprach sein Verhalten jeglicher Bürosituation? Während ja zumindest kleine Hunde sich in die meisten Bürosituationen wie in eine letzte, dackelförmige Lücke einfügen ließen.
Verzweifelte Menschen stellen naturgemäß verzweifelte Überlegungen an. Und verzweifelt war Anna nun mal gewesen, nachdem sich eine Jobmöglichkeit nach der anderen zerschlagen hatte. Und zwar im Rahmen größter Freundlichkeit. Die meisten ihrer Gesprächspartner verhielten sich ausgesprochen aufgeklärt, zeigten Verständnis und Interesse und nahmen sich viel Zeit, mehr Zeit, als sie sich eigentlich für jemand nehmen durften, dessen Bewerbung sie längst abgehakt hatten. Man schenkte ihr Zeit. Komisch, diese Menschen waren mächtig stolz darauf, Anna Gemini etwas zu schenken, was sie nicht brauchen konnte.
In dieser Verzweiflung bildete sich nun ein Gedan ke, der Anna überraschte und erschreckte, wie es einen überrascht und erschreckt, morgens neben einem völlig fremden Menschen zu erwachen. Ein Schrecken, der noch verstärkt wird, indem dieser fremde Mensch seinerseits mit aller Vertraulichkeit sich nähert.
Anna Gemini war mit der ihr bislang fernen Idee erwacht, wie es denn wäre, den Beruf einer Auftragsmörderin zu ergreifen. Wobei sie sich bereits schwertat, die richtige Bezeichnung zu wählen. Die für sie richtige. Sie mußte innerlich stottern, weshalb es ihr wesentlich erschien, einen neuen, passenden Namen für diese Sache zu finden. Einen Namen, der etwas von der Poesie besaß, die eine solche Tätigkeit ja auch beinhalten konnte.
Aber ein solcher Name fand sich nicht. Wen wundert’s?
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Anna Gemini nie auch nur eine Waffe in Händen gehalten. Jemand umzubringen war außerhalb ihrer Gedankenwelt gestanden. Wie auch außerhalb ihres Weltbildes, das als ein katholisch-fortschrittliches für die Ermordung von Menschen aus Verdienstgründen kaum Berechtigungen anbot.
Aber da war er nun mal gestanden, der Gedanke, ziemlich massiv und nicht ohne Reiz. Sicher auch darum, weil Anna Gemini überzeugt gewesen war, daß der Gedanke ein Gedanke bleiben würde. Was auch sonst?
Doch der Gedanke erwies sich als ein Kobold.
Es war dann jener berühmte Film Léon – der Profi mit Jean Reno als schüchternem, Milch trinkenden, melancholischen Killer gewesen, welcher Anna Gemini veranlaßt hatte, sich diesen Beruf anders als widerwärtig zu denken. Im Gegenteil: Der Killer avanciert hier zur absolut sympathischen Figur, welche bezeichnenderweise das mittels der Tötungen verdiente Geld kaum anrührt. Die Figur hat etwas Weihevolles, Christliches, ist allerdings frei von Prophetie. Der Held verkündet nicht, er leidet, leidet mit jedem Blick, der aus feuchten Augen fällt. Wenn er zum Schluß stirbt und einen niederträchtigen Bullen mit sich zieht, stirbt er einen Passionstod.
So ein Film ist natürlich kein Programm für die Wirklichkeit, umso mehr, als dieser Léon eine zirkusartige Perfektion an den Tag legt und Anna weit davon entfernt war, sich aufwendige gymnastische Kunststückchen vorstellen zu wollen. Obgleich sie ja nicht unsportlich war. Aber nicht unsportlich zu sein, brauchte noch lange nicht zu heißen, an Wänden hochzuklettern und ein Dutzend Scharfschützen auszutricksen. Vor allem aber mußte Anna natürlich bedenken, daß ganz gleich, wozu sie möglicherweise in der Lage sein würde, die Anwesenheit Carls zu berücksichtigen war. Fassadenkletterei und ähnliches kamen also keinesfalls in Frage. Aber Fassadenkletterei war ja ohnehin ein Element eher der Fiktion. Die Fassaden der Wirklichkeit waren viel zu glatt oder zu brüchig oder zu schmal, um eine vernünftige Kletterei zu gewährleisten. Zudem lag der Sinn eines Auftragsmordes ja in einer größtmöglichen Zurückhaltung, die der Dramatik einer jeden Fassade und der diesbezüglichen Kletterei widersprach.
Um die Sache nun irgendwie anzugehen, mußte Anna die Frage nach der Moral zunächst einmal zur Seite stellen. Statt dessen widmete sie sich dem Handwerk. Sie begann, sich für Waffen und ihren Gebrauch zu interessieren, erwarb einen sogenannten Waffenführerschein und trainierte an einem Schießstand.
Ein wenig hatte sie erwartet, beziehungsweise erhofft, über ein Talent zu verfügen, von dem sie dann selbst hätte erstaunt sein können. Ein Talent fürs Schießen, das auf einen höheren Plan verwies. Doch das Talent fehlte. Zwar hielt sich der Ekel, den Anna beim Anfassen der Pistolengriffe empfand, in Grenzen, aber die Gabe, mit dem anvisierten Ziel eins zu werden, also mittels des Projektils einen Faden zu spinnen, der sie mit einem gewollten Punkt verband, diese Gabe blieb ihr verwehrt. Wohin sie traf, schien von Faktoren abhängig zu sein, die sie kaum erriet. Immerhin war die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit nicht so enorm, daß Anna davon hätte ausgehen müssen, später einmal alles und jeden zu treffen, nur das ausgewählte Opfer nicht. Auch nahm ihre Unsicherheit nach und nach ab, blieb aber dennoch eine Unsicherheit. Dazu kam, daß Anna nicht die Zeit und das Geld besaß, ewig in eine Ausbildung zu investieren, deren eigentlichen Zweck sie zu verheimlichen hatte. Vor allem bedauerte sie, ohne einen dezidierten Instrukteur auskommen zu müssen. Sie hätte jenen Zauber dringend nötig gehabt, den sogenannte Meister mitunter in ihre Schüler einzupflanzen verstehen. Den Zauber, der auch Talente hervorbringt, die im Grunde gar nicht bestehen.
2
Ein Gott namens Smolek
Anna Gemini zweifelte an ihren Fähigkeiten. So sehr, daß sie es weiterhin unterließ, sich um die ethische Frage zu kümmern. Sie war wie jemand, der angesichts einer ungeöffneten Weinflasche wenig Lust verspürt, einen möglichen Alkoholismus zu diskutieren. Zudem blieb völlig unklar, wie sie jemals an einen Auftrag herankommen sollte.
Aber wenn der einmal gedachte Gedanke ein Kobold war, dann war das nun folgende Schicksal ein Superkobold. Anna Gemini sollte einen Mann kennenlernen, mit dem sich alles veränderte. Und das, obgleich er weder ihr Lehrmeister noch ihr Mentor wurde und genaugenommen auch von einem Agenten nicht die Rede sein konnte. Denn dieser Mensch, der als mittlerer Beamter im Wiener Stadt- und Landesarchiv beschäftigt war, blieb an einem finanziellen Profit desinteressiert.
Will man ihm gerecht werden, so muß man ihn wohl als eine diabolische Figur bezeichnen. Wobei das Diabolische hier nicht mit dem Teuflischen oder eindeutig Negativen gleichgesetzt werden sollte. Es schien, als wollte dieser Mann aus purem Interesse am Leben den Tod fördern. Und zwar aus jener Distanz heraus, die einen vernünftigen Beobachter von einem unvernünftigen unterscheidet. Siehe Journalisten. Sein Name: Kurt Smolek.
Dieser Smolek gehörte zu jenen unauffälligen Leuten, welche die Unauffälligkeit aber nicht auf die Spitze treiben, also nicht etwa in ihr oder mit ihr explodieren und solcherart Lärm verursachen.
Eine solche Übertreibung der Unauffälligkeit hätte beispielsweise darin bestanden, nicht nur explizit unverheiratet auszusehen, sondern es auch zu sein. Smolek in seiner untersetzten, durch und durch gräulichen Gestalt – er badete geradezu im Grau –, mit seinem runden Gesicht, den wenigen Haaren, die seine Glatze schüchtern umkreisten, und der altväterischen Hornbrille wirkte zwar ziemlich unverheiratet, war es aber nicht. Vielmehr führte er eine Ehe ohne offenkundige Geheimnisse, und zwar mit einer Frau, die wie er selbst nicht den geringsten Anlaß bot, sich irgendeine Abartigkeit oder auch nur Abenteuerlichkeit vorzustellen. Das Ehepaar Smolek stand vor der Welt wie die beiden Figuren eines Wetterhäuschens, sich also im Einklang mit der Gesetzmäßigkeit des Wetters befindend, durch dieses Wetter gleichzeitig verbunden und getrennt.
Die Wirklichkeit freilich war eine andere. Aber die Wirklichkeit ist natürlich immer eine andere.
Kurt Smolek, der auf die Sechzig zuging wie auf einen ozonbedingten Klimawechsel, betrieb seinen Beruf mit großer Akribie und ohne Verzettelung. Von den Kollegen wurde er geachtet, aber nicht wirklich wahrgenommen. Bei Diskussionen gleich welcher Natur hielt er sich zwar nicht heraus, vertrat jedoch eine unpersönliche, eine statistische und mathematische Position. Dazu gehörte auch, in Gesellschaft ein, zwei Gläser Wein zu konsumieren, also jene Menge der Vernunft und der Mitte. Ja, er war ein Musterbeispiel für einen Vertreter der Mitte, in welcher er wie in einem bequemen, unverrückbaren, nicht zu großen und nicht zu kleinen Fauteuil saß. Er galt als langweilig und ungefährlich.
Was für ein Irrtum! Denn wenn Herr Kurt Smolek etwas durch und durch war, dann gefährlich.
Die, die von seiner Macht wußten, hatten nicht das geringste Interesse, sie publik zu machen. Wahrlich nicht. Es handelte sich um Leute, die Smolek zu größtem Dank verpflichtet waren und denen der Tod eines bestimmten Menschen irgendeine Form von Erleichterung verschafft hatte. Eine Erleichterung, die in der Regel ohne Gewissensbisse auskam, natürlich aber nicht ohne Furcht vor Enthüllung. In diesem Punkt stand Smolek wie ein Schutzpatron über der Sache. War ein Fall abgeschlossen, ein Mensch ermordet, ein anderer erleichtert, so verhielt sich Smolek wie der Archivar, der er war. Verschwiegen, unbestechlich, korrekt, die Fäden in Händen haltend, ohne sie wirklich zu regen. Mehr am Stillstand als an der Bewegung interessiert.
Begonnen hatte alles, nachdem ein großer Förderer des Stadt- und Landesarchivs sich mit seiner Not ausgerechnet an den subalternen Smolek gewandt hatte. Ohne freilich von Smolek eine Lösung des scheinbar unlösbaren Problems zu fordern. Der Mann hatte einfach reden wollen, über einen jüngeren Bruder, der trickreich das Familienerbe an sich zu reißen drohte. Eine dieser üblichen üblen Familiengeschichten, die dem Teufel mehr Freude bereiten als jeder politische Konflikt.
Smolek, der ja bei aller Unauffälligkeit auch überraschen konnte, erklärte nun, daß in einem solchen »juristisch ungünstigen Fall« man die Regeln in Richtung auf eine »freie Handhabung« verschieben müßte.
»Was meinen Sie, was ich tun soll?« zeigte sich der Hilfesuchende verwirrt.
»Sie sollen gar nichts tun. Zumindest nicht viel mehr, als einen angemessenen Geldbetrag investieren, um das Problem für alle Zeit aus der Welt zu schaffen.«
»Um Himmels willen, Herr Smolek …«
»Den Himmel kümmert nicht, wie der Mensch sich aus einem Dilemma befreit. Die Welt wäre eine andere, wollte der Himmel, daß wir etwas Bestimmtes tun oder etwas Bestimmtes unterlassen.«
»Das mag Ihre Meinung sein …«
»Sie haben mich, denke ich, um einen Rat gebeten«, sagte Smolek. »Und es wäre unstatthaft, Ihnen einen zu geben, der sich zwar als korrekt, aber wenig effektiv herausstellt. Was soll ich Ihnen denn vorschlagen? In die Kirche gehen und beten? Einen weiteren inkompetenten Anwalt engagieren? Ihre Füße in kaltes Wasser tauchen? Mit dem Bauch atmen? Auch habe ich nicht gesagt, Sie sollen Ihren Bruder eigenhändig erwürgen, um für den Rest Ihres Lebens eingesperrt zu werden.«
»Aber ich bitte Sie! Auch einem Anstifter droht Gefängnis.«
»Wer stiftet hier wen an?« fragte Smolek. »Ich bin es doch. Es handelt sich um meine Idee.«
»Ich wäre mein Lebtag an Ihre Verschwiegenheit gebunden«, stellte der irritierte Mann fest.
»Manche Bindung geht man ein«, erklärte Smolek, »um nicht eine andere eingehen zu müssen. Es ist wie mit dem Heiraten. Wir heiraten jemanden, um nicht jemand anders zu heiraten. Wir handeln in einer Weise, um nicht in einer anderen zu handeln. Wir bestellen Gemüse, um nicht Fleisch zu bestellen. Gehen in die Fremde, um nicht in der Heimat zu bleiben. Alles was wir tun, bedeutet eine Verhinderung oder Unterdrückung von etwas anderem.«
»Großer Gott, Smolek. Seit wann sind Sie Philosoph?«
»Eine Unart«, meinte der Archivar, »die es eigentlich zu unterdrücken gilt. Aber wenn man schon mal so weit ist, über einen Mord zu sprechen …«
»Wovon ich nichts mehr hören will.«
Smolek nickte auf seine graue, steinerne Art und wandte sich ab. Aber der andere war natürlich so wenig konsequent wie die meisten, die eine große Sorge gepackt hat. Nach einer kurzen, einer sehr kurzen Pause, kam er hinterhergelaufen und fragte: »Wie genau, Herr Smolek, stellen Sie sich das eigentlich vor? Sie wären doch wohl kaum bereit, das selbst in die Hand zu nehmen.«
»Wo denken Sie hin? Ich würde jemand engagieren.«
»Wen?«
»Das ist genau das, was Sie nicht zu interessieren braucht.«
»Und worin bestünde Ihr eigener Nutzen?«
»Kein Nutzen.«
»Das ist nicht Ihr Ernst.«
»Kein Nutzen im klassischen Sinn. Vor allem nichts, was zwischen uns beiden stehen würde. Kein Geld, keine Versprechungen, keine Schuld.«
»Den … Killer … müßte man aber wohl bezahlen. Nur einmal angenommen.«
»Das ist etwas anders«, erklärte Smolek, »einem Profi seine Arbeit abzugelten. Das gehört schließlich dazu. Bleibt aber folgenlos, womit ich meine, daß solche Leute sich niemals auf nachfolgende Erpressungen einlassen. Zumindest nicht, wenn sie einen guten Ruf zu gewinnen oder zu verlieren haben. Derartiges ist zu beachten: ein guter Arzt, ein guter Installateur, ein guter Killer.«
»Sagen Sie nicht, Sie kennen einen guten Arzt. Das wäre dann ein kleines Wunder.«
»Nein. Aber einen hervorragenden Installateur. Und von einem Wunder zu sprechen, wäre übertrieben. Man muß sich umsehen und zu vergleichen wissen.«
Was Smolek bei alldem verschwieg, war der Umstand, über einen solchen Killer gar nicht zu verfügen. So überlegt und überlegen er sich auch gab, als spreche er von etwas längst Vertrautem, so bestand die Wahrheit darin, daß ihm jener ungewöhnliche Vorschlag gleichsam als Laune über die Lippen gekommen war. Wobei der Einfall an sich seine Geschichte besaß. Smolek hatte also nicht über etwas gesprochen, was ihm nicht schon mehrmals durch den Kopf gegangen war. Er stand in diesem Thema mit festen Beinen. Doch ein Killer, wie gesagt, fehlte. Andererseits hatte bislang auch der Anlaß gefehlt, einen solchen zu engagieren.
Und dabei blieb es zunächst auch. Denn jener hilfesuchende Mann beendete unversehens die Unterhaltung und erklärte in einem übertrieben distanzierten, geradezu kindischen Ton, alles Gesagte aus seinem Gedächtnis verbannen zu wollen. Nie und nimmer hier gestanden und mit Smolek gesprochen zu haben.
Der Ton aber überholte sich. Wie auch die Distanz. Wenige Tage später erschien derselbe Mann erneut bei Smolek, diesmal wütend und entschlossen.
»Ihr Bruder treibt’s auf die Spitze, nicht wahr?« schätzte der Archivar.
»Er kennt kein Pardon.«
»Ja, diese Pardonlosigkeit ist es, die die Menschen in ihr Unglück stürzt. Sie wollen einfach nicht aufhören. Wenn es dann zu spät ist, können sie es kaum fassen.«
»Sie werden es also übernehmen …?«
»Ich halte mich an mein Angebot«, sagte Smolek.
»Aber der Verdacht …«
»Es wird keinen Verdacht geben, jedenfalls keinen, der Sie oder mich betrifft.«
»Und die Frage der Bezahlung? Ich spreche von der Person, die dann …«
»Ja, das ist ein wichtiger Punkt«, meinte Smolek mit gespielter Nachdenklichkeit, seine Brille wie ein zweites Gesicht hin und her schiebend. Er hatte sich das bereits gründlich überlegt und erläuterte nun, daß dieser Aspekt nicht nur in einem sicherheitstechnischen, sondern auch in einem sittlichen Sinn beantwortet werden müsse, da ja die Ermordung eines solchen Menschen auf dessen eigenes, asoziales Verhalten zurückzuführen sei. So könne man das sehen, so müsse man das sehen. Es sei somit nur folgerichtig, den zu Ermordenden die Ermordung selbst bezahlen zu lassen. Wenngleich dies leider ohne dessen Wissen geschehen müsse. Jedenfalls wäre es sinnvoll, etwas in der Art einer Schuldverschreibung zu konstruieren, die dann aus dem Nachlaß des Toten beglichen werden müsse.
»Das ist nur fair«, betonte Smolek, »und hat den Vorteil, daß sich die Polizei kaum darum kümmern dürfte. Wer kommt schon auf die Idee, daß die Tilgung einer Schuld, die ein Toter hinterlassen hat, der Bezahlung seiner Ermordung dient. Somit, mein Guter, bleiben Sie in dieser Geschichte vollkommen unbehelligt. Und auch das ist nur fair.«
»Klingt traumhaft. Aber wie wollen Sie …?«
»Lassen Sie das meine Sache an. Denn wie man so sagt: Umso weniger Sie wissen, umso besser.«
Nun, leicht war das natürlich wirklich nicht. Aber es stachelte Smoleks Intelligenz an, die so gering nicht war.
Leider erwies es sich als nötig, eine Menge Leute zu involvieren, was grundsätzlich ein großes Risiko bedeutet. Ein Risiko, das sich aber vermindern läßt, wenn man diese Leute mit Bedacht auswählt, das Geflecht der Verbindungslinien gering hält und jeden Beteiligten vernünftig entlohnt. Darin bestand Smoleks oberstes Gebot, das eines adäquaten Honorars. Das Unglück der Welt, fand er, rühre zu großen Teilen daher, daß arbeitende Menschen nicht ordentlich bezahlt wurden. Nicht zuletzt im Bereich des Illegalen, wo jeder einen jeden zu betrügen versuche. Als bedürfe nicht gerade das Illegale einer strengen Disziplin und strengen Rechnung. Und einer hohen sittlichen Maxime. Denn wenn das Illegale ein Spiegelbild des Legalen war, dann war es auch mit jener Fragilität versehen, die ein verspiegeltes Glas nun mal mit sich bringt. Dennoch meinten die Leute, gerade im Bereich des Illegalen sich unverschämt, rücksichtslos und … nun, sie meinten sich kriminell aufführen zu müssen. Was für eine Dummheit!
Anders Smolek. Und Smolek war es also, der die Position des Dirigenten übernahm und die Regeln vorgab.
Ein Dirigent, der seine Musiker im Griff hatte. Etwa jenen Antiquitätenhändler, der knapp vor der Ermordung jenes »jüngeren Bruders« diesem eine Rechnung für eine nie erhaltene Orpheus-Tischuhr aus dem sechzehnten Jahrhundert, ein äußerst wertvolles Stück, zusandte. Eine Rechnung, über die zu wundern und gegen die Einspruch zu erheben das Opfer nicht mehr kam.
Entscheidend war bei alldem natürlich die Ermordung selbst. Bei der Auswahl des Ausführenden verzichtete Smolek auf Personen aus der Unterwelt. Aus gutem Grund und eigenem Vorurteil. Er hielt diese Figuren für unverläßlich, nicht wirklich Fachleute, sondern Laien, die ihren Dilettantismus so oft wiederholten, bis sich daraus ein quasi professioneller Charakter ergab. Man kennt das ja aus der Kunst.
Smolek suchte nach einem absoluten Außenseiter, einem einzelgängerischen Amateur ohne eigene Handschrift. Handschriften waren das schlimmste. Ihr Zweck schien allein darin zu bestehen, daß ein halbwegs aufmerksamer Kriminalist daraus ein naturalistisches Porträt des Täters entwickeln konnte. Darum wurden sie ja auch gefaßt, all diese Ganoven, die sich für Genies hielten und deren Verbrechen so leicht zu verifizieren waren wie ein kleiner Ausschnitt aus einem Gemälde. Man sieht einen Farbflecken und weiß: Monet.
Smolek suchte und fand, und zwar einen jungen Mann, einen Studenten, der zwischen echtem Fleiß und echter Faulheit hängengeblieben war und vollkommen paralysiert auf der Stelle trat. Smolek holte ihn von dieser Stelle weg und war auch gar nicht überrascht, wie rasch sich der junge Mann dafür begeistern ließ, einen Mord zu begehen. Dieser Mord würde – so pervers das klang – aus dem jungen Mann einen Menschen machen. Und das spürte der junge Mann. Er drang also mit dem Geschick seines Alters in die Villa des Opfers ein und ließ sich von diesem bei einem fingierten Einbruch überraschen. Beziehungsweise natürlich nicht überraschen. Sondern schlug ihn nieder und tötete ihn mit einem Dutzend, scheinbar ungezielter Hiebe auf den Hinterkopf. Die vorgetäuschte Brutalität sollte auf eine Täterpersönlichkeit verweisen, die wenig bis nichts mit dem tatsächlichen Mörder zu tun hatte. Der ja auch kein Mörder war, sondern ein bezahlter Killer. Und das ist ein Unterschied wie zwischen einem Mann, der eine fettige Currywurst verzehrt und einem Mann, der ein Buch über Currywürste schreibt.
Nachdem nun der Hausherr tot war, wurde die Täuschung vervollständigt, indem der junge Mann mehrere wertvolle Tischuhren aus der Sammlung des Opfers entwendete. Wobei dieses »Diebesgut« niemals wieder auftauchen sollte. Smolek achtete auf solche Dinge, ja, er wies den Killer an, die gesamte Ware von nicht unbeträchtlichem Wert noch in derselben Nacht zu zerstören, wobei sich herausstellen sollte, daß es einfacher war, einen Kerl von neunzig Kilogramm zu erschlagen als fünf Tischuhren bis zur Unkenntlichkeit zu demolieren und zu entsorgen. Aber es funktionierte. Und was vor allem funktionierte, war Smoleks Annahme, daß man im Zuge der Nachforschungen auch jene in Rechnung gestellte Orpheus-Tischuhr in die Liste der gestohlenen Objekte aufnehmen würde.
Die Sache zog sich natürlich eine Weile hin. Die Polizei operierte mit verständlicher Neugierde, auch aus dem Grund, da man lieber in vornehmen Kreisen herumstocherte, als sich in die Schicksale armer Schlucker einzufühlen. Lieber Tischuhren umdrehte als grindige Bierdeckel. Lieber die Stockwerke einer Villa hinauf- und hinuntermarschierte, als sich in Zwei-Zimmer-Wohnungen auf die Zehen zu steigen.
Nachdem aber die Kriminalisten einfach nichts hatten entdecken können, was über das Faktum eines brutalen Raubmordes hinausgegangen wäre, oblag es der Witwe, ein beträchtliches Erbe anzutreten und die Geschäfte ihres Mannes fortzuführen. Eine aufwendige, teils erfreuliche, teils unerfreuliche Aufgabe. Zu den bitteren Momenten gehörte es, jene Rechnung zu bezahlen, die ihr Gatte nicht mehr hatte begleichen können. Darin lag eine tiefe Tragik, für eine Uhr aufzukommen, die einerseits als gestohlen galt und andererseits noch nicht versichert worden war, und derentwegen man ihren Mann offensichtlich umgebracht hatte. Während sie selbst – und Smolek hatte dies frühzeitig in Erfahrung gebracht – nicht das geringste Interesse an solch altertümlichen Großuhren besaß und auch nie verstanden hatte, wie man ein kleines Vermögen dafür ausgeben konnte. Was zudem bedeutete, daß ihre Kenntnis der Sammlung eine geringe war und sie keinesfalls bemerkt hätte, daß jene Orpheus-Tischuhr niemals geliefert und aufgestellt worden war. Das waren Dinge, welche die Witwe stets von sich ferngehalten hatte. Aber selbstverständlich wußte sie um ihre Pflicht, Ordnung zu schaffen, und beglich die Rechnung anstandslos. Sodaß die Ordnung in diesem Augenblick – da jeder auf seine Weise seinen Frieden gefunden hatte – nicht hätte größer sein können.
Nachdem nun alles erledigt war, stellte Smolek fest, wie sehr der Tod eines bestimmten Menschen sich eignen konnte, eine Situation zum Guten zu wenden. Was soweit ging, daß die kinderlose Witwe nach einer angemessenen Zeit den Bruder des Verstorbenen heiratete, wodurch nicht nur zwei Menschen, sondern auch zwei Vermögen zueinanderfanden. Und zwar in idealer Weise. Die beiden Menschen wie die beiden Vermögen vermehrten sich.
Für all das hätte sich Smolek eigentlich bedanken und belohnen lassen müssen. Doch er blieb seiner eisernen Regel treu, indem er nie wieder ein Wort über die Sache verlor, die beteiligten Personen ohne Umstände bezahlte, dem Bruder des toten Bruders ausschließlich im Stadtarchiv begegnete und sich selbst allein die Freude des Gelingens zugestand. Er hatte bei alldem kein einziges Telefonat geführt, keinen einzigen Fingerabdruck hinterlassen, er hatte niemandem gedroht, niemanden betrogen. Die Perfektion seines Dirigats hatte darin bestanden, daß er – obwohl hinter dem Rücken seiner Musiker stehend – von diesen wahrgenommen worden war. Man muß es sagen: Kurt Smolek war sich wie ein kleiner Gott vorgekommen, ein kleiner wohlgemerkt, der eine alte Welt durch eine neue Welt ersetzt hatte, eine schlechtere durch eine bessere, wie unschwer zu erkennen war. Dieses Gefühl, eine göttliche Kontrolle zu besitzen, machte ihn ein wenig süchtig, obwohl er eigentlich das Gegenteil eines suchtabhängigen Menschen darstellte. Aber da bestand nun mal das Bedürfnis nach Wiederholung. Allerdings auch der Wille, sich zu beherrschen, also nicht etwa nach einem neuen Kunden zu suchen oder die eigenen Dienste in halboffizieller Weise anzubieten. Er wartete ab. Er war kein zorniger Gott, er war ein geduldiger. Er wartete zwei Jahre, dann war es soweit.
Jener glücklich verheiratete Förderer des Stadtarchivs, dessen Förderung parallel zu seinem Vermögen angewachsen war, erschien bei Smolek und fragte vorsichtig an, ob er Smoleks Namen einer Dame, einer guten Freundin, nennen dürfe, die sich in einer ähnlich prekären Situation befinde, wie er damals. Eine Dame, die nicht wisse, wie damit umzugehen sei. Es scheine so, als lasse sich ihr Problem kaum noch in gütlicher Weise lösen. Eine Eskalation sei unvermeidlich. Frage sich nur, welche Art von Eskalation. Laut oder leise?
»Sie kennt die Bedingungen?« fragte Smolek.
»Das versteht sich. Eine Frau, wenn ich das sagen darf, die imstande ist, den Mund zu halten.«
»Das kann ich glauben oder nicht.«
»Und wenn Sie mit ihr sprechen, um sich zu überzeugen?«
»Dann ist es zu spät für einen Rückzieher. Ich muß mich hier und jetzt entscheiden.«
Smolek dachte nach. Natürlich hätte er sich über diese Frau in Not genau informieren, ihre Persönlichkeit aus der Ferne studieren können. Das aber wäre seinem »göttlichen Instinkt« zuwidergelaufen, mit dem er seinen ersten Fall so erfolgreich gelöst hatte.
Er schob seine Brille in der bekannten Manier quer über den Nasenrücken und sagte: »Gut. Der Dame soll geholfen werden.«
Die Dame erwies sich als gescheit genug, die Arbeitsprinzipien Smoleks zu begreifen und zu akzeptieren. Sie sagte, was zu sagen war, dann schwieg sie. Smolek verabschiedete sich und trat nie wieder in einen persönlichen Kontakt mit ihr. Dafür aber löste er ihr Problem. Und in den folgenden Jahren noch die Probleme einiger anderer Personen.
Die Leute, die Smolek dazu engagierte, waren nicht immer die gleichen. Manche kamen öfters zum Einsatz, andere nur ein einziges Mal. Was hingegen als durchgehendes Prinzip die ganze Zeit über erhalten blieb, war die Regel, daß die Mordopfer ihre Liquidation selbst zu bezahlen hatten. Eine Lösung, die Smolek sehr schätzte, da sie ihn ästhetisch befriedigte. Ihm allerdings auch den einzigen Wermutstropfen bescherte. Er fand es betrüblich, daß die Opfer zu ihren Lebzeiten nichts von jenem Finanzierungsmodell erfuhren, in das sie selbst so stark eingebunden waren. Darin allein bestand ihre Macht, in dieser glücklichen Unwissenheit. Ein Punkt, der an dem kleinen Gott Smolek nicht unwesentlich nagte.
3
Reiz und Nutzen intakter Schutzbrillen
Anna Gemini und Kurt Smolek lernten sich im August 1999 kennen, genau an dem Tag, an dem der Kernschatten des Mondes sich endlich einmal wieder über jene stark bewohnten Teile Europas legte, wo die Begeisterung für Naturphänomene es eigentlich rechtfertigen würde, weit mehr Mond- und Sonnenfinsternisse stattfinden zu lassen. Aber die Natur ist nun mal ein bockiger, ungerechter Geist, und ihr bockigster, ungerechtester Charakterzug ist sicherlich das Wetter. Kein Wunder also, daß ausgerechnet an diesem besonderen Tag sich über vielen Regionen Europas eine deprimierende Phalanx von Wolken zusammenzog, Wolken, die sich in bösartiger Weise zwischen die Europäer und das Weltall zu schieben versuchten, obgleich doch niemand das Weltall so sehr liebt wie die Europäer, weit mehr als die Amerikaner, deren Weltallbegeisterung bloß politisch und ökonomisch zu verstehen ist. Die Europäer denken anders, sie sind allesamt sentimentale Astronomen.
Verständlich also, daß die Aufmerksamkeit der Medien und des Publikums sich gar nicht so sehr auf das eigentliche Schauspiel bezog, sondern vielmehr auf die Gefahr, es als ein bloß theoretisches, hinter tränenden Wolken verborgenes Ereignis zu erleben.
Beziehungsweise nicht zu erleben. Bereits am Morgen lag viel weniger eine Vorfreude denn eine Verzweiflung in der Luft. Allerorts bereitete man sich auf ein Scheitern vor. Und inwieweit dieses Scheitern zu kompensieren sei. Es war ganz klar: Eine Sonnenfinsternis, die nicht zu sehen war, war auch keine. Auf eine unsichtbare Corona wurde, wie man so sagt, geschissen. Die Radio- und Fernsehkanäle berichteten in einer selbst für ihre Verhältnisse ungewöhnlich hysterischen Weise über die jeweilige Entwicklung der Wetterfronten und unterschieden das Land und den Kontinent nur noch in wolkenfreie und wolkenverhangene Orte, wobei diese beiden Zustände häufig einem Wechsel unterzogen waren. Die Wolken hatten einen ganzen Vormittag Zeit, das Publikum an der Nase herumzuführen, Meteorologen in den Wahnsinn zu treiben, Europa zu verunsichern und also eine Irritation zu verursachen, hinter der das eigentliche Ereignis wie ein Glück hinter ein Unglück zurückfiel. Das Wetter war eine Krankheit, und jeder hatte Angst sich anzustecken.
Im Falle der Stadt Wien kam nun noch hinzu, daß sie aus einer tragischen Bestimmung der Verhältnisse heraus – einer Bestimmung, die ja seit Anbeginn der Zeit existierte, als es noch kein Wien und keinen einzigen Wiener gegeben hatte –, daß die Stadt also knapp außerhalb des Kernschattens lag und somit eine bloß partielle Sonnenfinsternis zu erwarten hatte. Der Umstand, daß dieser Anteil am Halbschatten ein sehr hoher sein würde, tröstete die meisten Wiener in keiner Weise.
Natürlich war niemand so kindisch, dem lieben Gott wegen der Konstellation der Gestirne einen Vorwurf machen zu wollen, was sich aber sehr wohl ergab, war eine tiefe Aversion gegen den Mond. Einen Mond, der zwar abstruse Orte wie Stuttgart und Bad Ischl mit einer lückenlosen Totalität versah, dem Weltzentrum Wien jedoch die Schmach eines nachlässigen Anstrichs antat. Eines Anstrichs, der gerade wegen seiner Neunundneunzigprozentigkeit als purer Hohn begriffen wurde. Als werde man von jemand geküßt, aber eben bloß auf die Wange, während dieselbe hübsche Person jemand anders die ganze Zunge in den Mund schiebt. Es ist nicht übertrieben zu sagen, daß das Verhältnis der Wiener zum Mond aus diesem Grund einen negativen Beigeschmack erfuhr, der sich nie wieder ganz verflüchtigen sollte.
An diesem elften August warteten nun eine ganze Menge Wiener die Wetternachrichten ab, bevor sie sich entschieden, ob sie in der Unvollkommenheit Wiens verbleiben wollten oder aus der Stadt hinaus und in den Kernschatten (den man eigentlich als Kronschatten hätte bezeichnen müssen) hineinfuhren. Denn eines war natürlich klar, daß es nämlich besser war, eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen als eine totale nicht zu sehen (die armen Stuttgarter etwa standen im Regen und fühlten sich einmal mehr als eine benachteiligte Spezies, eine Spezies, deren materieller Reichtum nichts daran änderte, in eine permanente Pechsträhne eingeschlossen zu sein).
Auch Anna Gemini, die schon wegen ihres Familiennamens eine gewisse Vorliebe für Satelliten aller Art und diese gewisse Einsamkeit ihres Wesens besaß (auch wenn diese Einsamkeit eine zwillingshafte sein mochte), wünschte sich, die Finsternis in ihrer Gänze zu erleben, ließ sich aber viel zu lange Zeit und geriet dann mit ihrem Sohn am Stadtrand von Wien in einen Stau der Zögerlichen.
Als das Ereignis nun eintrat und der Verkehr völlig zum Erliegen kam, tat Anna das, was alle taten. Sie verließ mit ihrem Sohn den Wagen und verfolgte vom Straßenrand aus die Wiener Beinahe-Verfinsterung der Sonne.
Wenn nun immer wieder jene Stille der Natur, jenes Schweigen der Vögel, jener irrtümliche Glaube der Tierwelt, die Nacht breche an, beschrieben wird, so ergab sich im Falle Anna Geminis und der anderen betroffenen Verkehrsteilnehmer ein Erschlaffen der Welt, das seinen primären Ausdruck im Stillstand der Autos, vor allem aber im Stillstehen der Autobenutzer fand. Ansonsten hatte alles seine Ordnung. Das Licht wurde nicht etwa schwächer, sondern verstärkte sich in der Verwandlung, sodaß auch die Konturen der Gegenstände schärfer hervortraten, als stünden sie im Schein einer mit bläulichen Filtern versehenen Bühnenbeleuchtung. In die Lautlosigkeit hinein tönte ein Wind, oder auch nur die Einbildung eines Windes. Man traute sich nicht, etwas anzufassen, alles wirkte verstrahlt, vor allem natürlich die Karosserien, die jetzt an verlassene Kernkraftwerke erinnerten. Eine beängstigende Stimmung, als sei es also doch möglich, mit allen Sinnen in einem Traum zu erwachen und sich zu denken: Und was, wenn ich da nicht wieder rauskomme?
In diese windige Stille hinein, in diese glasartige Konsistenz einer hinter einem Röntgenschirm stehenden Welt, brachen ohne jegliche Vorwarnung die Schreie Carls, die zu beschreiben unmöglich ist. Sie waren zu fundamental, als daß ein Bild oder Wort ihnen hätte gerecht werden können. Das waren nun mal Carls Schreie, die dem unbedarften Zuhörer ziemlich außerweltlich erscheinen mußten. Erst recht in dieser Situation, die zwar auch zutiefst außerweltlich anmutete, aber nach allgemeinem Verständnis der ungeeignetste Moment war, welchen Lärm auch immer zu erzeugen. Die Leute fühlten sich in ihrer Andacht mehr als nur gestört, sie fühlten sich bedroht.
Anna Gemini nahm ihren Sohn in die Arme, hielt ihn fest. Mehr tat sie nicht. So unangenehm es ihr war, von anderen Menschen begafft zu werden, wäre sie niemals auf die Idee gekommen, Carl anzufahren. Zu zischen oder so. Statt dessen umfaßte sie seinen knochigen, schiefen Körper, vollzog einen sanften Druck, als stütze sie eine Hülle aus Packpapier, und wartete ab.
In der Regel beruhigte sich Carl nach dem siebenten oder achten Schrei und wechselte in die aufgeregte Wiederholung eines jener Wörter, die seinem Sprachschatz entstammten, der nun wirklich ein Schatz war, bestehend aus wenigen Begriffen, die einen rätselhaften Glanz besaßen. Wie man sich vielleicht vorstellt, daß eine Maschine sprechen würde, wenn sie denn mit wirklichen Gefühlen ausgestattet wäre. Eine Maschine mit einer komplizierten, mysteriösen Intelligenz.
In diesem Moment aber, da ein kleiner, wienfeindlicher Mond eine große, gleichgültige Sonne zu neunundneunzig Prozent abdeckte, hörte Carl nicht auf, in den verdunkelten Himmel zu schreien. Einige der Umstehenden begnügten sich nun nicht mehr damit, herüberzustieren und den Kopf zu schütteln, sondern keiften Richtung Anna und erklärten es für verantwortungslos, ein behindertes Kind einer derartigen Situation auszuliefern. Einer Sonne, die zur falschen Zeit erlosch.
Das war nun der Moment, da der kleine Gott Smolek in Anna Geminis Leben trat. Der Archivar, der mit seinem Wagen auf der Nebenspur zum Halten gekommen war und wie alle anderen mit schwarzen, in Kartongestellen eingerahmten Gläsern zur Sonne gesehen hatte, kam jetzt herüber. Anna nahm augenblicklich eine Abwehrhaltung ein, befürchtete weniger einen Vorwurf als eine Hilfestellung. Hilfestellungen waren das schlimmste. Überall rannten Leute herum, die sich für Experten in Sachen Kinder, erst recht in Sachen behinderte Kinder hielten.
Nun, eine Hilfestellung bot Smolek tatsächlich an. Allerdings keine pädagogische. Vielmehr erklärte er in seiner ruhigen, sachlichen Art – nicht ohne sich zuvor förmlich vorgestellt zu haben –, daß eine Menge desolater Schutzbrillen im Umlauf seien, durch die man so gut wie nichts erkennen könne, oder viel zu viel, oder einfach einen Unsinn. Jedenfalls sei er gerne bereit, seine eigene zur Verfügung zu stellen.
»Ach was denn!« fuhr Anna den Mann verärgert an. Und folgerte: »Sie meinen also, mein Kind schreit, weil es die falsche Brille trägt?«
»Sie entschuldigen, gnädige Frau. Das war so ein Gedanke. Eine defekte Schutzbrille ist ein Ärgernis. Ich selbst mußte mir drei besorgen, bevor ich endlich eine hatte, die auch wirklich funktioniert hat. Ich hätte auch schreien mögen, glauben Sie mir.«
Anna zögerte. Dann sagte sie: »Gut. Probieren wir’s.«
Sie zog Carl seine Brille vom Gesicht, während sie gleichzeitig seinen Kopf nach unten neigte. Tatsächlich beendete er augenblicklich sein Geschrei und verfiel in ein unregelmäßiges Schnaufen, wie nach einer beträchtlichen Anstrengung. Eigentlich hätte es sich angeboten, diesen willkommenen Zustand nicht zu gefährden. Aber Anna wollte unbedingt, daß ihr Sohn in die verdunkelte Sonne sah. Alle Kinder taten das in diesem Augenblick. Und es war ihr durchaus wichtig, daß Carl soweit als möglich all das tat, was die anderen taten. Tolle Klamotten tragen, laute Musik hören, ein Skateboard fahren, in Schuhen schwimmen, Farben trinken und eben zur rechten Zeit in die Sonne sehen, wenn sie mit ihrer Mondmaske am Himmel stand.
Nun verfügte Anna natürlich auch selbst über eine Schutzbrille, die aber noch in ihrer Tasche steckte. Doch anstatt nach dieser zu greifen, nahm sie jene, die ihr Smolek entgegenhielt. Nicht nur, weil diese Brille mit Sicherheit intakt war, wie Smolek versichert hatte, sondern auch aus Respekt vor dessen freundlicher Geste.
Es klappte. Carl begann nicht wieder zu schreien, sondern gab ein schmatzendes Geräusch von sich. Was auch immer er sah und fühlte, es beruhigte ihn. Er öffnete seine Hände, spreizte die Finger und griff in die Höhe, als berühre er das Ereignis.
»Wollen Sie meine Brille?« fragte Anna und zog die ihre aus der Tasche.
»Wechseln wir uns ab«, schlug Smolek vor.
Das taten sie dann auch. Und man darf sagen, daß es eine gelungene Sache für alle Beteiligten wurde. Natürlich auch aus dem simplen Grund heraus, daß die Wolken, die kurz zuvor noch diesen Abschnitt Wiens überdacht hatten, im einzig richtigen Moment davongezogen waren. Brave, gute Wolken.
Als nun der Mond nach und nach aus dem Sonnenhintergrund heraustrat – wie einer dieser Jack-Lemmon-Typen, die beleidigt ein Restaurant verlassen, nicht ohne sich die Namen sämtlicher Kellner notiert zu haben –, da kehrten auch die Geräusche und der Hang zur Aktivität in die Welt zurück. Nicht wenige zückten ihre Mobiltelefone, um in Erfahrung zu bringen, wie es Freunden oder Familienmitgliedern ergangen war, die sich im Bereich des Kernschattens aufgehalten hatten. Und ob auch in ihrem Fall ein kleines Wolken-Wunder oder aber ein wettertechnisches Desaster sich ergeben hatte. Insgesamt war natürlich eine euphorische Stimmung unter diesen Menschen am Straßenrand zu spüren. Partiell hin oder her, sie hatten etwas zu sehen bekommen. In ihrem Fall hatte das Jahrhundert seine Pflicht erfüllt, seine letzte Möglichkeit gewahrt, nicht nur schlecht dazustehen.
Anna nahm Carl die Brille vom Gesicht und reichte sie Smolek, freilich feststellend, daß man all diese Dinger jetzt wegwerfen könne. Denn bis zur nächsten totalen Sonnenfinsternis …
»Wann ist die überhaupt?« fragte Anna.
»Juni 2001«, antwortete Smolek, »aber man müßte nach dem südlichen Afrika fliegen. Und ich finde, in der Fremde verliert diese Sache ihren Reiz. In irgendeiner Wüste hockend, auf irgendeinem Berg. Es geht ja darum, das Vertraute in einem unvertrauten Licht zu betrachten. Was in unserem speziellen Fall bedeutet, es in etwa zu sehen, wie es einst Adalbert Stifter gesehen hat.«
»Stifter?« fragte Anna. »Habe ich Sie richtig verstanden?«
»Oh, verzeihen Sie. Ich vergesse manchmal, in welcher Zeit ich lebe. Und daß man eigentlich nicht mit Stifter daherkommen sollte. Zumindest nicht, wenn man ihn nicht zumindest mit einem Stückchen Handke unterlegt hat. Stifter ohne Handke ist für den gebildeten Zeitgenossen wie eine Torte ohne Tortenboden, eine Torte, die zerfällt.«
Anna aber, erneut ärgerlich, meinte: »Für Stifter braucht man sich nicht entschuldigen.«
»Nicht?«
»Nein, sicher nicht«, bekräftigte Anna Gemini und erklärte, eine große Freundin des Stifterschen Werks, der Stifterschen Sprache und jener Präzisierung der Idylle zu sein. Daß dieser Autor ein fetter Reaktionär gewesen war, störe sie dabei nicht. Das sei ja wohl ein Sinn hoher Literatur – mitunter, nein, eigentlich sehr oft, eigentlich notwendigerweise –, von Monstren verfaßt zu werden.
»Das freut mich«, sagte Smolek. »Ich meine, daß Sie Stifter mögen. Man trifft selten jemand, der das ernsthaft von sich behauptet.«
»Halten Sie mich für ernsthaft?«
»Das tue ich. Auch wenn ich gestehen muß, daß wenig an Ihnen eine Begeisterung für Stifter vermuten ließe.«
»Wie müßte ich aussehen, um Stifter lieben zu dürfen?«
»Weniger elegant, weniger heutig. Aber lieben darf man natürlich auch die Dinge, die nicht zu einem passen.«
»Ich könnte eine Germanistin sein. Elegante, heutige Germanistinnen soll es ja wohl geben.«
»Germanistinnen lieben nicht. Schon gar nicht die Literatur. Wußten Sie das nicht? Wenn eine Frau sich für dieses Fach entscheidet, entspringt das ihrer Verachtung gegen das Wort und die Sprache.«
»Wie? Und bei Männern ist das anders?«
»Sie halten mich jetzt sicher für parteiisch.«
»Der Gedanke könnte einem kommen.«
»Wenn Männer Germanistik studieren, steckt dahinter eine Leidenschaft, eine dumme und lächerliche, mag sein, aber eine Leidenschaft. Bei Frauen ist es immer die Verachtung.«
»In der Brigitte haben Sie das aber nicht gelesen. Klingt nach eigenem Vorurteil.«
»Ein gebildetes Vorurteil. Sie müssen wissen, ich arbeite für das Stadt- und Landesarchiv. Da trifft man natürlich auf eine Menge Damen vom Fach. Übrigens wäre zu sagen, daß die Verachtung nichts mit der Qualität zu tun hat. Vielleicht ist sogar das Gegenteil der Fall. Die Distanz der Frauen zur Materie ist selten ein Nachteil. Aber wie gesagt, von Liebe kann nicht die Rede sein. Schon gar nicht bei Stifter.«
»Tja, eine Germanistin bin ich wirklich nicht. Ich bin Mutter. Bis vor kurzem dachte ich, das genügt. Aber es genügt nicht. – Meine Güte, warum erzähle ich das? Geht Sie ja nichts an.«
»Das müssen Sie schon selbst wissen.«
»Wahrscheinlich macht mich das sentimental, die Sache mit der Brille.«
»Daß uns das ein klein wenig verbindet, gnädige Frau, finde ich, ist kein Unglück.«
»Stimmt auch wieder. Ein Unglück ist das nicht.«
Und das war es ja nun wirklich nicht. Denn obwohl Anna Gemini die Position Smoleks gegenüber österreichischen Germanistinnen für einen therapiewürdigen Altherren-Spleen hielt, war ihr seine unverblümte und zugleich trockene Art sympathisch. Ungeachtet des zutiefst Persönlichen seiner Sichtweise, war er ja nicht wirklich persönlich geworden.
Smolek wiederum konnte sich nur wundern, wie offen er gesprochen hatte. Im Kreis seiner Kollegen und Freunde hätte er sich nie und nimmer zu einer solchen Behauptung verstiegen. Und wenn er tausendmal recht hatte. Recht zu haben war kein Argument. Er war Beamter, nicht Rechthaber.
Hingegen ergab sich durchaus ein Argument aus der Notwendigkeit, einen Verkehrsstau aufzulösen. Die meisten Lenker saßen wieder in ihren Autos, und da nun Gemini und Smolek je eine Spur versperrten, ertönte ein forderndes Gehupe.
»Ja, wir müssen wohl«, sagte Smolek. »Wenn Sie einmal Lust haben, besuchen Sie mich im Rathaus. In meinem Büro, soweit man das als Büro bezeichnen kann.«
»Ich dachte«, erwiderte Anna, »daß Stadt- und Landesarchiv sei nach Simmering gezogen, in einen dieser Gasometer.«
»Richtig. Aber mich hat man zurückgelassen. Um das Unwichtige zu ordnen, das Übriggebliebene, den Rest der Historie.«
»Im Rest kann so manche Überraschung stecken.«
»In meinem Rest nicht. Also, wenn Sie Lust haben …«
Anna Gemini hatte Lust. Nicht sofort, da sie zunächst einmal überlegte, daß dieser ältliche Mann sich möglicherweise einbildete, irgendeinen Eindruck auf sie gemacht zu haben, und daraus die falschen Konsequenzen zog. Doch als sie dann einige Wochen später mit Carl eine vormittägliche Veranstaltung besuchte, die auf dem Rathausplatz stattfand, jener Fläche, die wie ein betonierter Truppenübungsplatz das Wiener Burgtheater und das Wiener Rathaus weniger trennt als verbindet, da beschloß sie kurzerhand, jenem »Archivar der Reste« einen Besuch abzustatten.
Während sie jetzt mit Carl in den zentralen Innenhof des sandburgartigen Rathauses trat, wurde ihr allerdings bewußt, sich nicht einmal mehr an den Namen des Mannes erinnern zu können. Auch wäre ihr schwergefallen, die äußerliche Unauffälligkeit seiner Person beschreiben zu wollen. Was natürlich gar nicht nötig war. Es hätte gereicht, sich nach jener im Rathaus verbliebenen Stelle des Stadt- und Landesarchivs zu erkundigen. Doch Anna beschloß, dies bleiben zu lassen. Etwas in ihr wehrte sich. Etwas in der Art eines hellsichtigen Antikörpers.
In diesem Moment spürte sie Carls festen Griff. Er hatte sie am Ärmel gepackt und zog sie in Richtung auf einen vom Schatten verstellten Teil des Hofs. In diesem Schatten, zunächst für Anna kaum erkennbar, stand Smolek und unterhielt sich mit einer Frau. Besser gesagt die Frau unterhielt sich mit ihm. Er selbst wirkte kleiner und beleibter als noch im toxischen Licht der Sonnenfinsternis. Die Frau redete mit dem gestreckten Finger auf ihn ein, wobei Smolek keinesfalls gebeugt anmutete, sondern stämmig in der Art eines Steinquaders, der einen Weg markiert. Auf einen solchen Stein konnte man vielleicht einreden, ihn aber heben, das war eine andere Sache. Und tatsächlich erwies sich die Position Smoleks innerhalb des Archivs bei aller Bedeutungslosigkeit und inselhaften Isolierung gefestigt wie kaum eine. Wer wollte den Mann versetzen, der die Reste verwaltete?
Anna sah ihren Sohn an, lächelte und sagte, sich jetzt des Namens erinnernd: »Ja, du hast recht, das ist Smolek.«
»Smooolek«, wiederholte Carl, wie man sagt: Guuute Reise. Oder wie man sagt: Schööönen Abend.
Ganz offensichtlich hatte Carl nicht vergessen, wer ihm einen einwandfreien Blick auf jene Sonnenfinsternis ermöglicht hatte. Der Junge besaß ein gutes Gedächtnis und einen scharfen Blick. Vielleicht sogar für die Dinge an sich, in jedem Fall für ihre sichtbare Gestalt. So liebte er etwa Katzen und katzenartige Wesen, und zwar in jeder Form. Ein Löwe, der steinern in einer Fassade steckte, an der man mit der Straßenbahn vorbeifuhr, blieb Carl unter keinen Umständen verborgen. Bloß, daß man kaum verstand, wenn er, auf seine Entdeckung weisend, »Löwe« sagte. Aber das war ja auch nicht der Punkt. Was nützte es denn umgekehrt, das Wort »Löwe« richtig und deutlich auszusprechen, wenn man blind für Löwen war und sie unentwegt übersah?
Carl übersah keine Löwen. So wenig wie eine vertraute Person. Und offensichtlich empfand er Smolek als eine solche. Er winkte. Smolek bemerkte ihn, winkte zurück. Die Dame mit dem Finger sah verärgert herüber. Sie mochte es wohl nicht, gestört zu werden. Ihr Gesicht war ein böser Strich.
»Bleib hier«, sagte Anna.
Carl blieb stehen, hörte aber nicht auf zu winken. Er hätte Stunden so stehen können. Denn bei aller Hektik, die seinen Körper des öfteren erfaßte, verfügte er auch über eine erstaunliche Geduld, mit der er etwas tat oder etwas beobachtete. Es war die Geduld eines Kleinkindes, das Wasser von einem Becher in einen anderen schüttet und wieder zurück, den Vorgang unentwegt wiederholend, wie um eine Kleinigkeit zu entdecken, eine wesentliche Kleinigkeit, etwas, das sich als besonders richtig oder besonders falsch erweisen würde. Aber auf den ersten Blick nicht zu erkennen war.
Von Geduld konnte im Falle der Dame mit dem gestreckten Finger keine Rede sein. Sie fühlte sich von dem winkenden Jungen regelrecht unter Druck gesetzt, wobei ein Junge nun mal winken durfte, solange er wollte. Mitten in Wien stehend, im Herzen des Rathauses, sowieso.
Die Dame mit dem Strichgesicht redete noch eine halbe Minute auf Smolek ein, wandte sich sodann tiefer in den Gebäudeschatten und verschwand hinter der Schwärze der Arkaden.
Smolek kam auf Anna und Carl zu und reichte zuerst der Mutter, dann dem Jungen die Hand, wobei er nach den noch immer winkenden Fingern griff, Carls Hand sachte nach unten führte, um sie dann aber ordentlich zu schütteln. Es beeindruckte Anna Gemini, wie selbstverständlich und respektvoll sich dieser Mann verhielt, indem er nicht etwa Carl über die Haare strich oder ihn schamvoll übersah. Smolek schien nicht zu vergessen, daß er es mit einem Vierzehnjährigen zu tun hatte, nicht mit einem Baby. Die wenigsten Menschen waren dazu in der Lage.
»Schön, Sie beide zu sehen«, sagte Smolek. »Und entschuldigen Sie, daß ich Sie habe warten lassen.«
»Eine Germanistin?« fragte Gemini.
»Wer?«
»Die Frau, mit der Sie sprachen.«
»Wie kommen Sie auf die Idee?«
»Diese Verbissenheit des Ausdrucks«, konstatierte Anna und erinnerte Smolek an seine geäußerte Theorie über das Wesen mancher studierter Frauen.
»Ach, und das konnten Sie auf die Distanz feststellen? Sie haben nämlich recht. Die Frau ist wirklich Germanistin. Eine Dame aus der Bibliothek. Eine, gelinde gesagt, ungemütliche Person.«
»Eigentlich sollte es bloß ein Scherz sein.«
»Der Scherz ging ins Schwarze, Frau Gemini. Kommen Sie, ich zeige Ihnen mein Reich.«
Smolek führte seine beiden Gäste zur Nordflanke des Gebäudes, dirigierte sie ins Innere und einige Stufen hinauf, um sodann eine schwarz lackierte, schmiedeeiserne Türe zu öffnen, die hinunter in den Keller führte, dorthin, wo mehrere langgestreckte Räume hohe Zettelkästen bargen.
»Der Rest«, stellte Smolek vor und vollzog eine umfangreiche Geste.
Im hintersten Teil, abgeschieden und fensterlos, befand sich sein Büro, nicht irgendein Kämmerchen, sondern ein Raum, der von allen »Smolek’s End« genannt, eine buchtitelartige Bedeutung innerhalb des nach Simmering umgezogenen Archivs sowie auch der Rathausverwaltung besaß. Eine gewisse surreale Konnotation haftete dieser ganzen unterirdischen Situation an, etwas Gestriges. Obsolet, aber spannend. Als habe sich ein kafkaeskes Element in seiner ursprünglichen Form erhalten, als ein lebendes Fossil, während man überall anders dem Kafkaesken die Haut abgezogen hatte, um es sodann einer Revitalisierung zuzuführen, die sich gewaschen hatte. Wie ja ganz Wien einer aufpolierten Geisterbahn glich.
Smolek’s End wirkte bei alldem aber weder spukhaft noch ungemütlich. Sämtliche Wände waren bis zur Decke hin mit Büchern ausgekleidet, selten aufrecht gereiht, zumeist in Stapeln plaziert. Aus vielen Bänden ragten zungenartig Lesezeichen. Obgleich alles sehr sauber war, roch man den Staub. Obgleich mehrere Lampen brannten, herrschte Dunkelheit. Der Bildschirm eines Computers präsentierte die Abbildung eines Aquarells. Anna Gemini erkannte augenblicklich, daß es sich um eine Arbeit Peter Fendis handelte. Mit derselben Bestimmtheit, mit der ihr Sohn Löwen aus Fassaden filterte.
»Sie begeistern sich scheinbar nicht nur für Stifter.«
»Ich liebe den ganzen Biedermeier«, sagte Anna Gemini.
»Es gab bessere und schönere Zeiten in dieser Stadt.«
»Halten Sie mich für einen Trottel«, fuhr Anna den Archivar an, »daß ich das nicht weiß? Ich habe nicht behauptet, ich würde das Elend dieser Epoche lieben. Ich liebe allein die Weise, mit der man dieses Elend ertragen hat.«
»Soll das heißen, Sie lieben die Verdrängung?«
»Verdrängung wäre etwas anderes. Ich spreche aber von Ausgleich. Von Gestaltung. Von der Erhöhung der Dinge, eben der wirklichen Dinge, der wirklichen Menschen und tatsächlichen Ereignisse. Etwa die Würde, mit der Waldmüller seine bäuerlichen Figuren ausgestattet hat. Ist diese Würde denn Kitsch, nur weil sie nicht wirklich existiert hat? Um ehrlich zu sein, mir ist eine erfundene Würde lieber als keine. Drehen Sie den Fernseher auf, dann wissen Sie, was ich meine.«
»Ich bin trotzdem verwundert, Frau Gemini. Wie schon beim letzten Mal. Sie sehen einfach nicht aus, als wären Sie ein Feind der Zeit, in der Sie leben. Sie sehen nicht aus, als wäre Ihnen Stifter näher als Ally McBeal oder Sex and the City. Ich aber, ich sehe so aus.«
»Ja, das tun Sie wirklich.«
Eine Weile schwiegen Anna und Smolek. Carl brabbelte vor sich hin und tippte mit einem Finger auf die nachgebende Kunststoffscheibe des Monitors, wodurch sich kurzlebige Spuren ergaben, Spuren wie auf Wasser. Als liege der Fendi in einem seichten Bach, was nun zwar ein passender, aber konservatorisch unglücklicher Ort für ein Biedermeier-Aquarell gewesen wäre.
Anna Gemini fühlte sich unwohl. Warum bloß meinte sie diesem Mann gegenüber so offenherzig sein zu müssen? Nur, weil er einen Fendi auf seinem Schirm hatte? Nur, weil er höflich gegen Carl war?
»Ich tarne mich«, sagte Anna Gemini. »Ich tarne mich und mein Kind. Ich möchte modern aussehen und modern leben. Ich möchte nicht wie eine Oma daherkommen, bloß weil ich für den Biedermeier schwärme. Und denken Sie jetzt bitte nicht, ich hätte Kunstgeschichte studiert, was ja alles erklären würde. Diese Stifter-Liebe und Fendi-Liebe trotz kurzem Rock und Lippenstift.«
»Soll ich Ihnen sagen«, fragte Smolek, »was ich von Kunstgeschichtlerinnen halte?«
»Ich kann es mir denken. Frauen, die für die Germanistik zu blöd sind.«
»Das wäre übertrieben. Aber die Richtung stimmt.«
»Ihr Haß auf Akademikerinnen scheint mir krankhaft zu sein. Zumindest ziemlich auffällig.«
»Da mögen Sie recht haben. Ich bin ein alter Mann, der sich schwertut mit einer bestimmten Art gebildeter Frauen.«
»Nun, da haben Sie aber Glück, daß sich meine Bildung in Grenzen hält.«
Smolek erwiderte, daß einen Fendi auf Anhieb zu identifizieren, nicht gerade für Unbelesenheit spreche.
»Ich werde doch noch die Objekte meiner Liebe erkennen«, sagte Anna, und das war kein bißchen kokett gemeint. Ihr Wissen war tatsächlich alles andere als enzyklopädisch oder auch nur umfangreich. Sie suchte sich aus, was ihr gefiel. Um das übrige kümmerte sie sich nicht. Alles von Stifter, nichts von Grillparzer. Alles von Fendi (also auch seine berüchtigten pornographischen Arbeiten), nichts von Gauermann.
Bevor Smolek den Aspekt der Liebe kommentieren konnte, äußerte Anna, daß man im Falle eines Peter Fendi doch wohl kaum von einem »Rest« oder »Abfall« der Historie sprechen könne.
»Natürlich nicht«, sagte Smolek. »Aber hin und wieder darf ich mich auch um Wesentliches kümmern. Mein Alltag aber …«
Er zog eine Mappe von einem Stoß, hielt sie stoppschildartig in die Höhe und erläuterte, daß sich darin Briefe aus den Achtzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts befänden, die von einem unbekannten Arzt stammten und an einen nicht minder unbekannten Patienten adressiert seien. Zeithistorisch aufschlußreich, aber natürlich nichts, was die Welt bewege. Derartiges zu bearbeiten, darin bestehe sein Geschäft. Nun, bearbeiten sei genaugenommen der falsche Begriff. Eher müsse von einem Ablegen die Rede sein. Er habe die Aufgabe, all diese verzichtbaren Dokumente und Kunstwerke endgültig zu Grabe zu tragen, nachdem verabsäumt worden sei, dies zur rechten Zeit zu tun. Was habe denn irgendein im Grunde bedeutungsloser, hundertzwanzig Jahre alter Briefverkehr im Jetzt verloren? Obgleich Archivar, sei er der Ansicht, daß viel zu viel aufgehoben werde. Wahrscheinlich aus dem Irrtum heraus, ein vollständiges Bild führe zu einer objektiven Sichtweise. Als wäre das überhaupt möglich. Als entspreche nicht jede Sichtweise notgedrungen einem Tunnelblick.
»Das mag schon sein«, sagte Anna Gemini. »Wer aber will bestimmen, was aufzuheben sich lohnt und was nicht?«
»Die Gegenstände selbst. Es ist wie mit den Menschen. Manche wollen leben, andere sterben. Manche wollen erfolgreich sein, andere in Ruhe gelassen werden. Es gibt Objekte, die man geradezu nötigen muß, erhalten zu bleiben. Die Objekte fallen auseinander, wir kleben sie zusammen. Bilder dunkeln nach, wir hellen sie auf. Die Objekte wehren sich, unternehmen immer neue Versuche des Verfalls, wir aber zwingen sie unter lebenserhaltende Glasstürze und Vitrinen, in temperierte Schaukästen und Tresore. Eigentlich widerwärtig. Lauter Komapatienten.«
»Merkwürdige Sicht für einen Wissenschaftler.«
»Wer sagt Ihnen, daß ich Wissenschaftler bin. Ich bin Bürokrat, genauer gesagt Totengräber. Einer, der die Dinge lebendig begräbt.«
»…öwe!« kam es von Carl her, während er noch immer über den Bildschirm tippte. Gleichzeitig jedoch hatte er seinen Kopf aufgerichtet und sah hinauf zur vorletzten Regalreihe. Zwischen zwei Büchern, auf einem Stapel überbreiter Zündholzschachteln plaziert, befand sich ein hamstergroßer, metallener Löwe, der knapp außerhalb des Lichtkegels einer nach oben gebogenen Schreibtischlampe stand. Eigentlich schwer zu erkennen, wäre da nicht Carl gewesen, der mit sicherem Blick das Katzentier ausgemacht hatte.
»Wozu die Zündhölzer?« fragte Anna. »Zündhölzer in einem Archiv haben etwas Unheimliches.«
»Die lagen bereits dort oben, als ich vor dreißig Jahren hier anfing. Wie auch der Löwe. Carl ist der erste Mensch, der ihn bemerkt. Erstaunlich. Ich hatte ihn schon längst vergessen, den Löwen.«
»Es gibt keinen Löwen, der Carl entgeht«, erklärte Anna. »Und mir entgehen keine Brandwerkzeuge.«
»Eine gute Kombination«, sagte Smolek, sah auf die Uhr und schlug vor, auf eine Schale Kaffee ins Landtmann hinüberzugehen. Eines jener Wiener Kaffeehäuser, die von einer Atmosphäre leben, welche die Gäste in das Lokal hineindichten und hineinschwärmen, wie jemand, der in einem leeren Swimmingpool steht und behauptet, nie schöner geschwommen zu sein.
Anna nahm die Einladung an. Bevor man aber ging, stieg der Archivar auf eine Leiter, holte den Löwen von seinem Hochsitz und fragte Carl, ob er ihn haben wolle. Carl sagte etwas, was Smolek nicht verstand. Das Lächeln des Jungen jedoch war eine kleine Grube voll Glück. Smolek drückte ihm die Figur in die Hand, die der Hamstergröße zum Trotz das Gewicht einer Kanonenkugel besaß. Ein Gewicht, das Carl nicht störte. Im Gegenteil. Ein Löwe, wie klein auch immer, hatte schwer zu sein.
Nach diesem ersten und auch letzten Besuch in Smolek’s End und dem darauffolgenden Kaffeehausbesuch, sahen sich der »Archivar der Reste« und die beiden Geminis alle paar Wochen. Man wurde vertrauter und blieb sich dennoch auf eine unkomplizierte Weise fremd. Es war ein guter Zustand. Nicht zuletzt für Carl, der in Smoleks Nähe einen Übermut an den Tag legte, der niemals kippte.
Smoleks Gattin spielte bei alldem keine Rolle. Sie schien nicht eigentlich vorhanden zu sein, wenngleich ihre Präsenz in anderen Zusammenhängen durchaus deutlich sein konnte. Allerdings achtete Smolek darauf, auseinanderzuhalten, was sich empfahl auseinanderzuhalten.
Natürlich hatte er nie vorgehabt, Frau Gemini in sein Geheimnis einzuweihen oder sie gar in seine Mannschaft zu holen. Das wäre ein verrückter Gedanke gewesen, einer solchen Frau einen Mordauftrag zukommen zu lassen. Einer Frau, die täglich in die Kirche ging, jedoch die Messen mied, um – mit Carl die Intimität eines leeren Gotteshauses nutzend – zu ihrem himmlischen Favoriten, dem heiligen Franz von Sales zu beten, dessen Festtag, der vierundzwanzigste Jänner, mit Carls Geburtstag zusammenfiel. Ja, diese Frau sprach Gebete voller Demut, schätzte die Naturverehrung Stifters, die Menschenverehrung Waldmüllers, die Mutterverehrung Amerlings, und war selbst eine liebende Mutter, wie selten eine. Das war keine Frau, der man antrug, für Geld einen Menschen umzubringen.
Sie war es dann selbst, die an einem späten Abend – Smolek war zu Besuch und Carl schlief bereits – das Thema erstmals ins Spiel brachte, indem sie von ihren Schießübungen erzählte und in einer betont humorigen Weise erklärte, von dieser Fähigkeit irgendwann einen Nutzen ziehen zu wollen.
»Wie meinen Sie das?« fragte Smolek. »Was wollen Sie tun? Försterin werden? Legionär?«
»Gibt es denn weibliche Legionäre?«
»Ich weiß nicht.«
»Nun, das ist es auch nicht, woran ich dachte«, sagte Gemini.
»Und woran dachten Sie?«
»An etwas, mit dem man auch wirklich Geld verdienen kann.«
»Haben Sie Geldsorgen?«