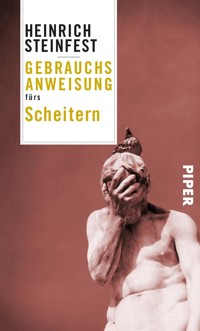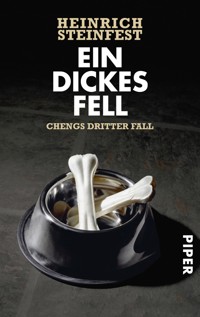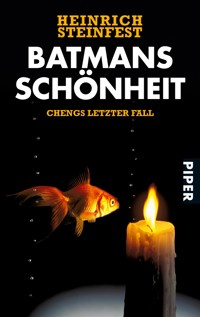11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein literarisches Kleinod Die »Amsterdamer Novelle«, knapp, pointiert und rasant, endet, wie sie beginnt, mit einem Foto: Es zeigt den Kölner Roy Paulsen, wo er nicht sein kann, in Amsterdam. Er ist nie dort gewesen, und doch sieht man, wie er mit dem Rad an einer Gracht entlangfährt. Paulsen könnte dieses Bild als kuriose Verwechslungsgeschichte abtun. Genau das aber tut er nicht – Paulsen fährt nach Amsterdam und macht sich auf die Suche nach dem Haus, das hinter dem Radfahrer zu sehen ist. Und gerät in eine tödliche Auseinandersetzung, die sein Leben in eine neue Richtung lenkt – genau auf den Moment des Fotos zu. »Steinfest schreibt die amüsanteste und intelligenteste Literatur unserer Gegenwart.« Denis Scheck
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: Heinrich Steinfest
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1
2
3
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1
Wenn gesagt wird, Fotos lügen, dann eigentlich nur, weil wir mit der Wahrheit, die in einem bestimmten Foto steckt, nicht einverstanden sind. Der empörte Protest »So sehe ich ja gar nicht aus!« macht es sehr deutlich. Dieses Unbehagen angesichts der im Foto festgehaltenen Wahrheit des Augenblicks. Ein Augenblick, dem zu Ewigkeit, zumindest zu großer Dauer verholfen wird. Wenn wir längst unter der Erde sind und auch wenn sich niemand mehr an uns erinnert, werden wir noch im Foto fortbestehen.
Es ist nie das Foto, das uns zu täuschen versucht, sondern nur unsere willentliche oder unwillentliche Interpretation. Und eben nicht die ungünstige Perspektive, die aus einem dünnen Menschen einen dicken macht, aus einem Lachen einen hasserfüllten Aufschrei, aus einer freundlich winkenden Hand einen unfreundlichen Stinkefinger, aus einem Mann, der wie Brad Pitt aussieht, einen Mann, der Brad Pitt ist, beziehungsweise umgekehrt. Aus einem Angriff von Polizisten auf Demonstranten einen Angriff von Demonstranten auf Polizisten, beziehungsweise umgekehrt. Das Foto täuscht nicht, natürlich nicht. Sondern wir täuschen uns.
»Nein, so alt und unsympathisch sehe ich doch gar nicht aus.«
»O ja, so alt und unsympathisch siehst du eben manchmal aus. Und in diesem Moment sogar ganz sicher.«
Ein Foto, so verwaschen oder wackelig oder verblasst es auch sein mag, sagt uns auf eine gleichzeitig brutale wie liebevolle Art, wer wir sind, was wir machen, wie wir aussehen. Und was es in der Welt so gibt.
Jetzt wird man sagen, dass die vergangenen und erst recht die heutigen Möglichkeiten, ein Foto zu bearbeiten und zu verändern, enorm waren und sind. Aber ein solches Foto zeigt natürlich noch immer die Wahrheit einer Täuschung oder Lüge. Ein solches Foto offenbart den Betrug. Um das zu erkennen, braucht es kein technisches Instrument, sondern allein die Bereitschaft des Betrachters, die Qual des Fotos zu erkennen, das von einem verbrecherischen Geist verunstaltet wurde.
Und so leuchtet die Wahrheit praktisch durch die Lüge hindurch. Das gefälschte oder manipulierte oder mittels Text gefälschte oder manipulierte Foto stellt genau genommen die Verdoppelung der Wahrheit dar, indem es sowohl – wenn auch in Form einer Hintergrundstrahlung – die tatsächlichen Verhältnisse dokumentiert als auch den von Mensch und Maschine vorgenommenen Betrug, somit die Wahrheit einer Lüge.
Das Foto erzählt letztlich immer von dem, was wirklich geschah. Dies gilt es zu erkennen.
Zu erkennen, was wirklich geschah, machte sich Paulsen zur Aufgabe. Er konnte gar nicht anders. Sosehr er sich anfangs dagegen gewehrt hatte. Und sosehr er anfangs bemüht gewesen war, das, was er auf dem Foto sah, als ein Zusammenspiel von Faktoren anzusehen, die zu einer Täuschung führten.
Vor allem sagte er: »Ich bin noch nie auf einem Rad gesessen, wirklich!«
Das stimmte zwar nicht ganz, denn auch Paulsen – zwischenzeitlich sechsundfünfzig Jahre alt – war einmal jung gewesen, hatte das Fahrradfahren erlernt und war als Gymnasiast sogar einige Jahre lang täglich zur nahe gelegenen Schule geradelt. Doch bereits in seiner Studentenzeit hatte er trotz günstiger Lage seiner Wohnung aufgehört, sich auf ein Rad zu setzen. Obwohl nicht unsportlich, bevorzugte er den Komfort des öffentlichen Verkehrs, später dann auch den Komfort jener beweglichen Hülle, die wir Auto nennen.
Seit vielen Jahren arbeitete er fürs Fernsehen, was sich ein wenig unanständig anhört, aber so schlimm nicht ist. Er war dort als Visagist angestellt, traditionellerweise ein Frauenberuf. Und in der Tat hatte er sich nach einem abgebrochenen Wirtschaftsstudium zunächst einmal zum Tontechniker ausbilden lassen und war in diesem Bereich auch lange beschäftigt gewesen. Allerdings hatte er zusammen mit seiner zweiten Frau einen zweimonatigen Visagistenlehrgang besucht. Es war mehr etwas wie eine Wette gewesen, weil sich ihrerseits seine Frau bereit erklärt hatte, gemeinsam mit ihm den Taucherschein zu machen. Richtige Taucher waren dann aber beide nicht geworden, und Paulsens zweite Frau hatte auch nie als Visagistin gearbeitet, sondern war nach der Scheidung ins Fach der Geistheilerei gewechselt und dort erstaunlich erfolgreich geworden.
Paulsen hingegen verlor seinen Job als Toningenieur eines Werbefilmunternehmens und hatte sich – ohne ernsthaft an eine Chance zu glauben – um einen Visagistenjob beworben. Doch es gefiel einer leitenden Dame des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, mal ausnahmsweise einen Mann in dieser Funktion anzustellen. Keine Visagistin, sondern einen Visagisten, noch dazu einen, dem die Ausbildung zum Maskenbildner fehlte, wie das eigentlich vorgeschrieben war. Aber es sollte eben so sein, dass das Schicksal in Form dieser mächtigen Dame vom Fernsehen den damals bereits vierzigjährigen Paulsen dorthin brachte, wo er dann vor allem im Bereich der Nachrichtensendungen und diverser Talk-Formate tätig wurde.
Die Ausbildung zum Maskenbildner holte er später nach, wechselte aber nicht etwa zum Theater oder in die Werbung, sondern blieb gut fünfzehn Jahre am gleichen Ort, um seine gesichtspflegerische Tätigkeit auszuüben und Tag für Tag Sprecherinnen und Sprechern, Moderatoren und Interviewgästen ihre Gesichter … zu verschönern?
War das wirklich das passende Wort?
Nun, die Leute wurden selten richtig schöner, Paulsen war schließlich kein plastischer Chirurg mit der Fähigkeit zur Sekundenkorrektur. Und eben auch nicht beauftragt, ein langweiliges Gesicht in ein heroisches zu verwandeln, ein altes in ein junges, sich also als »Verwandlungskünstler« zu betätigen. Vielmehr bestand sein Job darin, Unebenheiten und Unreinheiten zu kaschieren, einer hohen nackten Stirn ein Zuviel an Glanz zu nehmen oder eine Falte, Rötung oder Narbe zu überdecken, von der sein Besitzer oder seine Besitzerin meinte, die müsse nicht auch noch im Fernsehen zu sehen sein.
Paulsen war kein Beauty-Artist, der einer Braut an ihrem schönsten Tag zu einem – vorsichtig ausgedrückt – unrealistischen Aussehen verhalf. Wenn er etwa für eine Literatursendung dem Schriftsteller Martin Walser ein klein wenig die dichten Augenbrauen zur Seite strich, damit man dessen weise Augen besser sehen konnte (ohne wiederum den Eindruck von der Weisheit der Augenbrauen zu schmälern oder gar den Autor zu verärgern), so ging es nicht darum, dass in der Folge jemand auf die Bühne trat, den die Zuseher eher für – sagen wir mal – Curd Jürgens oder Rutger Hauer gehalten hätten, abgesehen davon, dass die schon tot waren, sondern es sollte keinerlei Zweifel darüber bestehen, dass trotz gestalterischer Eingriffe hier soeben Martin Walser Platz genommen hatte.
Letztlich kann man sagen, dass Roy Paulsens Aufgabe also nicht in einer Verfälschung, sondern in deren Gegenteil bestand. Es sollte niemals ein Missverständnis darüber geben, dass die Personen, die vor die Kamera traten, sofort als die zu erkennen waren, als die man sie kannte. Gesichter, die den Zusehern mitunter seit Jahrzehnten vertraut waren, durchaus auch im Sinne von deren natürlicher Alterung, aber stets in einer bereinigten Form.
Ja, er war kein Verwandlungskünstler, sondern ein Reinigungskünstler.
Und dieser Roy Paulsen sagte, nachdem ihm sein erwachsener Sohn, der aus seiner zweiten Ehe stammte, ein Handyfoto vors Gesicht gehalten hatte: »Ich bin noch nie auf einem Rad gesessen, wirklich!«
»Trotzdem«, erwiderte Tom und lachte, »das bist du doch, oder? Also zumindest sieht der Typ auf dem Rad dir wirklich unglaublich ähnlich.«
»Nicht nur bin ich noch nie auf einem Rad gesessen«, erklärte Paulsen, »sondern ich war auch noch nie in Amsterdam.«
Wenn nun erstere Behauptung bloß mit Einschränkung galt, die zweite nicht. Roy Paulsen war tatsächlich noch nie in seinem Leben in Amsterdam oder auch nur in den Niederlanden gewesen. Einige Male in Belgien, in Brüssel, ja, mit einem Fernsehteam auch in Luxemburg, aber eben nie in Holland und nie in Hollands Hauptstadt, wohin Paulsens Sohn Tom kürzlich gezogen war, um für eine Computerspielfirma zu arbeiten (er war soeben dabei, ein Spiel zu entwickeln, in dem Rembrandt van Rijn als Zeitreisender auftritt, der – durch eines seiner eigenen Bilder fallend – ins 21. Jahrhundert gerät und verschiedene künstlerische wie anderweitige Versuche unternimmt, um zurück in seine Epoche zu gelangen, immerhin das sogenannte Goldene Zeitalter der Niederlande. Nun freilich in Kenntnis seiner ungemeinen Bedeutung für die spätere Kunstgeschichte, allerdings ebenso in Kenntnis der finanziellen Misere, die laut Geschichtsschreibung seine letzten Lebensjahre bestimmen sollte. – So war dieses Spiel auch der Frage nach der Veränderbarkeit der Geschichte gewidmet. Etwa die Vorstellung, dass der in seine Zeit zurückgekehrte Rembrandt zwar seine Zahlungsunfähigkeit zu verhindern wissen würde, allerdings kaum mehr in der Lage wäre, ein geniales Alterswerk zu schaffen. Nicht nur wegen der dann besseren Lebensverhältnisse, sondern weil er praktisch unfähig sein würde, sich selbst – denn natürlich hatte er im 21. Jahrhundert in Museen und Katalogen sein eigenes Werk studiert – zu kopieren. Sodass eine Aufgabe der Spieler darin bestand, einen Weg zu finden, um den Verlust eines wichtigen Teils des Rembrandt’schen Œuvres zu verhindern).
Tom hielt sich bereits seit einigen Wochen in Amsterdam auf und war nur kurz in seiner Heimat zu Besuch. Und hatte sich mit seinem Vater in Köln zum Abendessen getroffen.
Während man da also bei Weißwein und einem Spargelsalat mit Garnelen und Feta saß, hielt der Sohn dem Vater grinsend das Display seines Smartphones entgegen und verwies auf das Foto, das er in der ersten Woche seines Amsterdamaufenthalts irgendwo zwischen der Oude Kerk und dem Hortus Botanicus aufgenommen hatte. Er war da bereits durch Amsterdam marschiert auf der Suche nach Orten für jenes Computerspiel, das den Arbeitstitel Rijns Reise trug (es war wirklich geplant, das Spiel auf der ganzen Welt unter dem deutschsprachigen Namen zu vertreiben, denn das Deutsche, hieß es, passe einfach am besten zum Umstand der Zeitreise). Natürlich bevorzugte er die Gegend, in der das Museum Het Rembrandthuis steht, immerhin das ehemalige Wohnhaus des Künstlers, das nach dessen Bankrott versteigert worden war.