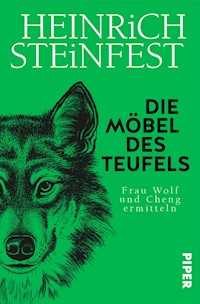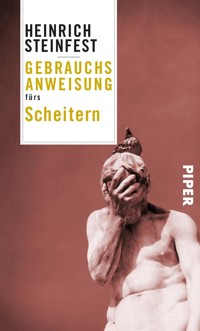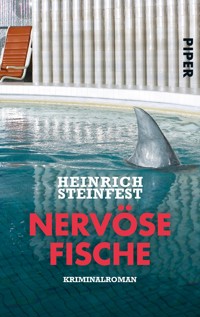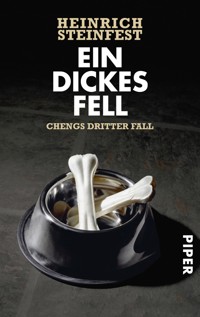19,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben als Sprung ins Leere, die Kunst als Täuschung und Zufluchtsort Klara Ingold arbeitet im Kunsthistorischen Museum in Wien. Sie ist beseelt von einer tiefen Liebe zu den Gemälden. Deshalb interessiert sie sich anders als ihre Mutter auch für die künstlerische Hinterlassenschaft ihrer ungeliebten Großmutter Helga, die die Familie 1957 ohne ein Wort verließ – und deren Werke jetzt in einer Lagerhalle wieder entdeckt werden. Darunter findet sich eine Fotografie, die einen vagen Hinweis liefert, wohin sie gegangen sein könnte. Klara Ingolds emotionale Spurensuche führt nach Japan, zu einem Gemälde mit dem Titel »Die blinde Köchin«, das vielleicht ihre Großmutter zeigt. »Heinrich Steinfest erzählt lustvoll, klug, mitreißend.« SZ
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: »Landschaft«, Karl Kaufmann (1843 - 1905) (Pseudonym J. Rollin)
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitate
Disclaimer
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
II
26
27
III
28
29
30
31
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Der japanische Schriftsteller Umeo Susa, 1944 – 2025, Autor des Kurzgeschichtenbandes An der Bar mit Brendan:
Unglücklicherweise genügt es nicht, Alkoholiker zu sein, um berühmt zu werden.
Brendan Behan, 1923 – 1964, in einem Interview im Jahre 1964 auf die Frage des Reporters, ob er sich vollständig von seinem Unfall kürzlich in Dublin erholt habe:
No, as a matter of fact I died.
Dieser Roman ist ein Produkt der Fantasie, die Figuren sind frei erfunden, soweit etwas frei erfunden sein kann, das in einer Geschichte lebt und dort sich selbst durchaus als real wahrnimmt. Und nicht etwa glaubt, bloß aus einem Traum zu stammen.
Die Schauplätze entstammen unserer Welt, das wunderbare Kunsthistorische Museum in Wien, Wuppertal mit seiner märchenhaften Schwebebahn, Japan mit dem Ort Magome und der sonderbaren Vulkaninsel Aogashima, nicht zuletzt der Semmering und das dort stehende Looshaus.
Manche Kunstwerke im Roman existieren wirklich, andere sind Teil der Erfindung, aber alle sind sie miteinander verwoben. Wie auch die Zeit, diese eigentliche Hauptfigur des Sprungs ins Leere.
Die Geschichte spielt im Jahre 2025.
Und dass George Clooney und Kim Novak demnächst in stummen Nebenrollen in einem Film mit dem Titel Woman at the Bath zu sehen sein werden, gehört zwar ebenfalls zur Erfindung, darf einen aber trotzdem freuen.
I
1
Ein Mann springt in die Leere.
Eine Frau springt ins Leere.
Die Frau allerdings drei Jahre vor dem Mann.
Bloß, dass der Sprung des Mannes zu einem der ikonischen Kunstwerke einer ganzen Epoche führte.
Und die Frau?
Es geht hier gar nicht darum, dass der Sprung der Frau schlichtweg aufgrund ihres Geschlechts verschwiegen oder verdrängt wurde und also die Kunstwelt praktisch drei Jahre darauf gewartet hatte, bis endlich auch ein Mann auf die Idee kam, in die Leere beziehungsweise ins Leere zu springen. Nein, es schien einfach Pech gewesen zu sein. Vielleicht aber hatte die Frau auch gar nicht vorgehabt, mit diesem speziellen Sprung berühmt zu werden, so wie der Mann mit seinem Sprung dann berühmt wurde. Das war schwer zu sagen.
Klara Ingold konnte es im Moment nicht beurteilen. Sie war auf dieses Foto gestoßen, als sie nach München gefahren war, um die Sachen zu begutachten, die ihre Großmutter bei ihrem Verschwinden vor achtundsechzig Jahren zurückgelassen hatte. Ein paar Malereien, einige Zeichnungen und Aquarelle, diverse Fotos und Fotomontagen, ein paar kleine Objekte aus Papier und Stoff, dazu Habseligkeiten und einen Haufen Bücher. Das alles zusammengedrängt im hintersten Winkel des Lagerbereichs einer Münchner Gerüstbaufirma. Eine Firma, die nach sechseinhalb Jahrzehnten auf diesen hinter Planen versteckten Nachlass jener Frau gestoßen war, die anscheinend im Nachbarhaus ihr Atelier gehabt hatte. Wie auch immer ihre Sachen in dieses Lager geraten waren.
Denn das konnte der Gerüstbauer, der dieses Geschäft vor zwanzig Jahren von seinem Vater übernommen hatte, nicht sagen. Es gab schlichtweg keine Unterlagen dazu. Allerdings war es ihm nicht nur gelungen, den Namen der ehemaligen Besitzerin all der Gegenstände zu eruieren, Helga Blume, sondern auch deren Nachfahrin ausfindig zu machen. Blumes Tochter, die in Wien lebende Britta Ingold, die sich jedoch vollkommen desinteressiert an den Sachen ihrer Mutter zeigte. Eine Mutter, die verschwunden war, als sie selbst, Britta, noch keine zwei Jahre alt gewesen und in der Folge zunächst bei ihrem Vater, dann aber bald bei ihren Großeltern väterlicherseits aufgewachsen war. Später hatte sie das Allgäu verlassen und war von Kempten nach Wien gegangen, der Heimat ihrer so gut wie nie gesehenen Mutter. Wo sie studierte und viele Jahre ein ziemlich wildes Leben führte – die späten Siebziger und die frühen Achtzigerjahre –, zudem fest entschlossen war, eines ganz sicher nicht zu tun, nämlich ein Kind in die Welt zu setzen, so wie sie selbst in die Welt gesetzt und dann von ihrer Mutter verlassen worden war. Eine Mutter, die sie bewusst nie erlebt hatte. Ihr Fehlen, ihre Abwesenheit aber sehr wohl. Was auch immer aus dieser Frau geworden war, die heute vierundneunzig Jahre alt wäre, allerdings bereits vor langer Zeit für tot erklärt worden war.
Britta hatte versprochen, kein Kind in die Welt zu setzen. Tat sie dann aber doch, nachdem sie einen Herrn Ingold geheiratet hatte, wobei sie genau genommen auch nie hatte heiraten wollen. Aber manches geschieht gegen jegliche Überzeugung, manches geschieht mit der Wucht einer Erfindung, die zwar nicht von einem selbst stammt, deren Auswirkungen man aber trotzdem zu spüren bekommt. Britta heiratete Herrn Ingold, einen nicht mehr ganz jungen Unternehmer, und bekam, als sie dann selbst nicht mehr ganz jung war, eine Tochter: Klara. Das war 1994.
Einmal sagte Britta, es sei völlig absurd und unnötig gewesen, so spät noch Mutter zu werden, nachdem sie genau das doch so lange unterbunden hatte. Dennoch müsse sie zugeben, dass es letztlich das Beste gewesen war, was ihr in ihrem blödsinnigen Leben zugestoßen sei. Die Mutterschaft sei dummer Kitsch. Aber sie sei diesem Kitsch vollkommen verfallen.
Wozu ihre Tochter Klara, eine nun einunddreißigjährige Frau, meinte, für sie sei es ein Segen gewesen, dass ihre Mutter so ganz und gar dem Kitsch der Mutterschaft erlegen war. Das habe ihr selbst nämlich zu einer durchaus glücklichen Kindheit verholfen. Zu einer Einzelkindschaft, in der sich Mutter und Tochter als Gefährtinnen und nicht als Konkurrentinnen gegenüberstanden. Wozu auch, so hart das klingen mochte, der frühe Tod des Herrn Ingold beitrug, der nur wenige Jahre nach Klaras Geburt sich in eine noch wesentlich jüngere Frau verliebte, mit dieser jungen Frau in den Urlaub fuhr und aus diesem Urlaub nicht wieder lebend zurückkehrte. Er war da schon einiges über sechzig gewesen und hätte etwas mehr Rücksicht auf sein angegriffenes Herz nehmen sollen, anstatt auf Teufel komm raus einen Gewaltmarsch durch die Tiroler Bergwelt zu absolvieren. Der Teufel kam auch wirklich heraus, sprang gewissermaßen aus Herrn Ingolds Herzen.
Es war nicht so, dass Klara sagen konnte, ihr sei der Vater nicht abgegangen. Nicht speziell dieser eine kaum gesehene, sondern ganz grundsätzlich einer, während die Liebhaber ihrer Mutter immer nur etwas Ephemeres an sich gehabt hatten, so schnell, wie sie kamen und gingen. Viel wichtiger war das innige Verhältnis zur Mutter gewesen, die zwar die Wildheit ihrer frühen Jahre nicht völlig aufgegeben hatte, aber in Bezug auf das Kind stets etwas geboten hatte, was man schlicht als Präsenz bezeichnen könnte. Sie war einfach da gewesen. Präsenz allein macht es natürlich nicht aus, ist aber eine gute Basis. Auch dann, wenn die Kinder ihre Ruhe haben wollen und es sinnvollerweise um eine zurückhaltende Präsenz geht, da zu sein und doch nicht da zu sein.
Der entscheidende Beitrag des verstorbenen Herrn Ingold war sicherlich gewesen, seiner Frau ein mittelgroßes Unternehmen hinterlassen zu haben. »Irgendwas mit Metall«, pflegte Britta kokett zu sagen, wenn man sie nach der Art der Firma fragte. Die Geschäftsleitung hatte sie einem alten, nie erhörten Verehrer übertragen, während sie selbst nur an den diversen Gewinnausschüttungen interessiert war.
Sie sagte einmal, es sei völlig ungerecht, dass sie, anstatt an einer Supermarktkasse zu stehen oder alten Leuten den Hintern auszuwischen oder sich wenigstens mit Gewalt in eine Spitzenposition gekämpft zu haben, einfach nur die Hand aufhalte. Das sei im Grunde unwürdig, aber sie sei nicht bereit, dieses Unwürdige ausgleichen zu wollen, indem sie den Spott auf die Spitze treibe und irgendeinem Wohltätigkeitsverein vorstehe oder junge Künstler vor dem Verhungern bewahre. Stattdessen ein wildes Leben, aber auch eine kitschige Mutterschaft.
Und Verdrängung. Zu dieser bekannte sie sich in einer ähnlichen Weise wie zur Unwürdigkeit ihres aus purem und nicht einmal selbst verwaltetem Erbe resultierenden Privilegs. Sie wollte rein gar nichts über das Zeug erfahren, das da achtundsechzig Jahre nach dem Verschwinden ihrer Mutter im Lager eines Münchner Gerüstbauers aufgetaucht war. Sie verspüre keinerlei Bedürfnis, sagte sie, zu erfahren, wer ihre Mutter überhaupt gewesen war.
»Von mir aus«, sagte sie, »können die das Ganze zur Müllverbrennung bringen.«
Nun war es aber ganz sicher nicht die Aufgabe der Münchner Firma, auch noch die Entsorgung dieses Nachlasses zu übernehmen, der da jahrzehntelang unbezahlt in einer vergessenen Ecke des Betriebsgeländes gelagert worden war.
Doch ohnehin war es so, dass Brittas Tochter Klara die Dinge völlig anders sah. Für sie war es ein Geschenk, diese Möglichkeit, etwas über ihre unbekannte Großmutter zu erfahren, noch dazu – wie sich jetzt herausstellte, weil zuvor nie darüber gesprochen worden war –, dass es sich bei ihr um eine Künstlerin gehandelt hatte.
Aus diesem Grund war Klara nach München gereist, hatte sich in einem kleinen Hotel nahe dem Viktualienmarkt für einige Tage einquartiert und damit begonnen, in der einst dunklen, nun von mehreren aufgestellten Leuchten erhellten Ecke der weitläufigen, tief in das Gebäudeinnere vorstoßenden Anlage aus Lagerräumen den Nachlass ihrer Großmutter zu sichten. Zu sortieren und für den Transport nach Wien vorzubereiten.
Der Besitzer der Gerüstfirma erklärte ihr, dass dieser Bereich des Areals in den späten Sechzigerjahren, als sein Großvater das Unternehmen führte, verschlossen und seither nur im Zuge irgendwelcher Inspektionen betreten worden sei, ohne dass man unter all dem hier abgelegten Schrott die mit Planen zugedeckten Kunstwerke der Helga Blume entdeckt habe. Was eben jetzt erst geschah, nachdem er selbst und seine Mitarbeiter begonnen hatten, in einer Weise, die etwas von Stadtarchäologie besaß, den vergessenen Teil des Gebäudes freizulegen. Er benutzte wirklich diese Worte: Archäologie und freilegen. Und ergänzte, dass es sein Großvater gewesen sein musste, der hier einst diesen Lagerplatz für Blumes Werke zur Verfügung gestellt hatte.
Was also, wenn man das Verschwinden Helga Blumes bedachte, um das Jahr 1957 gewesen sein dürfte.
Klara selbst bezeichnete sich als »gewesene Kunstgeschichtlerin«, was bedeutete, dass sie nach der Matura ein Kunstgeschichtestudium begonnen hatte, und zwar mit dem Hinweis, in die Kunst verliebt zu sein, gerade auch in die Vorstellung der Herstellung von Kunst, aber genau zu wissen, dass sie über keinerlei eigene kreative Energie verfügte. Nicht die Energie, die nötig wäre, etwas Originales und Originelles zu schaffen, sondern nur etwas Nachgemachtes, etwas Kopiertes, etwas ganz und gar Überflüssiges. Das hatte sie von ihrer Mutter, diese Einsicht in ein Unvermögen (auch wenn Brittas Einsicht in das Unvermögen der Mutterschaft sich dann als falsch herausgestellt hatte).
Um nun aber bei der Kunst bleiben zu können, bei einer unerwiderten Liebe, hatte sich Klara für die Theorie entschieden. Sich allerdings nach zwei Semestern eingestehen müssen, wie wenig sie das befriedigte und wie sehr ihr die Kunstgeschichte gleichzeitig zu nahe und zu fern zur Kunst stand. Die Wissenschaft besaß für sie eine ungemeine Anmaßung, indem sie das Unerklärliche zu erklären versuchte und unter einem Schwall von Begrifflichkeiten und Analysen ihre Impotenz verbarg. Wie jemand, der aus seiner Unfähigkeit zu zaubern sich entschlossen hatte, den Zauber zu entzaubern.
Abgesehen davon fand sie, dass es sich bei den meisten ihrer Kommilitonen und erst recht bei der Professorenschaft um schlichtweg unsympathische Menschen handelte. Unsympathische Menschen gab es sicherlich auch woanders, aber dieser Hang, sich ausgerechnet bei den wunderbarsten Schöpfungen menschlicher Schaffenskraft zu bedienen, eine Form von Plünderung zu betreiben, führe, so Klara, zu einer beschämenden Intensivierung des Unsympathischen. Und das Schlimmste dabei sei sicher der Beruf des Kurators. Kuratoren seien Leute, die in Wirklichkeit einen einzigen Gegenstand ausstellten, nämlich sich selbst.
Das war natürlich alles vollkommen übertrieben, aber dennoch nicht ohne Wahrheit. Und führte letztlich dazu, dass Klara ihr Studium aufgab und den wohl konsequentesten Weg überhaupt ging, indem sie sich einfach für einen Job als Museumsaufseherin bewarb und diesen auch erhielt. Und zwar in dem Museum überhaupt, dem Kunsthistorischen Museum in Wien. Nicht, weil sie die Alten Meister über die Moderne stellte, nicht einmal über die noch zwischen Ewigkeitsanspruch und völligem Verwelken schwankende zeitgenössische Kunst, aber sie bevorzugte das gedämpfte Licht, welches mit den Alten Meistern einherging. Sie war keine Anhängerin weißer Wände, wie man sie der Moderne und der Avantgarde aufzwang. Klara meinte, dass nichts so sehr von der Kunst ablenke wie der weiße Raum (auch wenn ja allgemein genau das Gegenteil behauptet wird). Der weiße Raum, sagte sie, sei das schwarze Loch der Kunst, das alles verschluckt.
Sie war also Museumsaufseherin geworden, und da hatte ihre sie liebende Mutter auch noch so sehr den Kopf schütteln können. Wie sie ja auch den Kopf schüttelte, als ihre Tochter sich auf den Weg nach München machte.
»Was erwartest du dir davon?«, hatte sie gefragt. »Antworten auf nie gestellte Fragen. Woher du kommst? Wer du bist? Diesen ganzen Quatsch der Herkunft. Und was aus deiner Großmutter in Wirklichkeit geworden ist. Wohin sie verschwand? Und warum überhaupt?«
»Ach, eigentlich«, sagte Klara, »erwarte ich mir nur ein paar interessante Bilder. Vielleicht ist es ja eine echte Entdeckung.«
»Meine Güte, kehrst du jetzt zur Kunstgeschichte zurück?«, spottete Britta. Ihr Grinsen war wie ein Biskuit, das in schwarzen Kaffee getaucht wird.
»Betrachtungsgeschichte«, hatte Klara korrigiert. »Und simple, reine, pure Neugierde. Zudem ein guter Grund, nach München zu fahren.«
»Was soll das denn bringen?«, fragte Britta. »Diese Stadt, die davon lebt, sich selbst zu überschätzen.«
»In der du immerhin deine ersten Lebensjahre zugebracht hast.«
»Eine Erinnerung, von der man nicht einmal sagen kann, sie stecke in einem Nebel«, meinte die Mutter und ergänzte: »Die ersten Lebensjahre eines Menschen sind von demselben Phänomen wie München bestimmt: Selbstüberschätzung.«
»Und du leidest unter deinem Zynismus«, sagte Klara.
»Nein, ich liebe ihn, und er hält mich am Leben.«
»Ja, aber wie ein Vampir.«
»Ach, du hältst mich also für untot, du Schlawiner«, sagte Britta und lachte. Das Biskuit tauchte wieder aus dem Kaffee hoch. Erstaunlich intakt.
»Schlawi(e)nerin muss es heißen«, verbesserte Klara ihre Mutter.
Das war ein alter, wirklich sehr alter Scherz zwischen ihnen beiden. Ein Kinderschmäh, der die wundersame Wirkung besaß, noch immer, nun zwischen der Einunddreißigjährigen und ihrer inzwischen siebzigjährigen Mutter, zu einer Umarmung zu führen.
Und da stand Klara also vor der von Scheinwerfern beleuchteten Ansammlung aneinandergelehnter Leinwände, gerahmter Zeichnungen, der Objekte und Fotografien, die ihre Großmutter geschaffen hatte, dazu Stühle, Bücher, Platten, Kartons voller Geschirr, alte Vasen, alte Lampen, diverse Haushaltsgeräte aus den späten 1950er-Jahren, darunter ein wirklich wunderschöner weinroter Miele-Staubsauger, der aussah wie ein Vehikel aus einem Jules-Verne-Roman, auch ein nicht minder eleganter Bartisch aus gelbem, polsterartigem Stoff, an dem man sich auch mit noch so spitzen Knien nicht hätte verletzen können.
Die Malereien und Zeichnungen erschienen Klara eher mittelmäßig, eine Mischung aus kubistischen und abstrakten Elementen, von einer erdigen Farbigkeit, Nachkriegsmoderne halt, als die deutschen Künstler einiges aufzuholen hatten. Viel interessanter war das Konvolut an experimentellen Fotografien, die fast alle auf ihrer Vorderseite signiert und datiert waren, vor allem aber mit einem Titel versehen, der mit schwarzem Filzstift geschrieben eine Prominenz besaß, die ihn zu einem Teil der Fotografie werden ließ. Etwa ein Bild – alle Fotos waren schwarz-weiß –, auf dem man ein paar sich beschnüffelnde Hunde sah, die so aufgenommen waren, als wären sie aus dem Blickwinkel eines Kindes betrachtet worden, das kaum größer als diese Hunde sein konnte. Und darunter, beziehungsweise darüber stand geschrieben: Vier Damen erklären einander den Biedermeier.
Eine beeindruckende Handschrift, fand Klara. Eine Schrift, die den großen Vorteil besaß, zugleich eigenwillig und höchst grafisch zu sein, und dennoch leserlich, während ja in der Regel entweder das eine oder das andere der Fall war und man sich zwischen Kinderhandschrift und Hieroglyphen entscheiden musste.
Klara fühlte sich bei dieser Handschrift an jene von Joseph Beuys erinnert, etwa: Wer nicht denken will fliegt raus, nur dass Helgas Schrift noch ein wenig eigenwilliger und noch ein wenig leserlicher war.
Während die Malereien und Zeichnungen mit einer gewissen Verbissenheit die Moderne verarbeiteten und dabei etwas entstand, was Klara als einen »abstrakten Waldboden« definierte, besaßen diese Fotos samt ihrer Titel weniger eine Verbissenheit als eine Bissigkeit, und zwar eine humorvolle und philosophisch-anspielungsreiche.
Und dann fiel ihr Blick auf diese eine bestimmte Fotografie, von der sie natürlich sofort dachte, es handle sich um eine Hommage an jenes berühmt gewordene Foto des französischen Künstlers Yves Klein, das von den beiden Fotografen Harry Shunk und János Kender aufgenommen worden war. Aber selbstverständlich als eine Arbeit Yves Kleins galt, diesem Hauptvertreter des Nouveau Réalisme, der auf dem Foto, die Arme ikarusartig ausgebreitet, sich von der Mauer oder dem Dach eines Hauses in die Tiefe stürzt.
Freilich kein Hochhaus, aber ein paar Meter sind es wohl schon, zudem springt er mit Brust und Kopf voran, unter ihm der Beton der Rue Gentil Bernard. Sodass für den Betrachter der Eindruck entsteht, dass sich der Künstler bei seiner Landung entweder heftige Verletzungen zuziehen müsste oder aber es irgendwie schafft, tatsächlich ins Fliegen oder Schweben zu gelangen. Oder sich in Luft auflöst.
Angeblich aber war es so, dass, als dieses Foto entstand, ein Dutzend Judokämpfer – Yves Klein war ein fanatischer Judoka – unten auf der Straße eine Matte oder ein Sicherheitstuch hielten, in dem Klein wohlbehalten und unverletzt landen konnte. Diese Judokas und diese Matte wurden dann aus dem Foto herausretuschiert, weshalb nur noch die leere Straße und ein im Hintergrund vorbeiziehender Radfahrer zu sehen sind. Die Montage würde später unter dem Titel Le Saut Dans Le Vide, auf Deutsch Sprung in die Leere, weltberühmt werden.
Die Aufnahme war im Oktober 1960 entstanden und am Sonntag des 27. Novembers 1960 in einer nur für einen einzigen Tag konzipierten Zeitung namens Dimanche erschienen, dort unter dem Titel Der Maler des Raumes stürzt sich in die Leere.
Oktober und November 1960 also, dachte Klara.
Obwohl es eigentlich so klar und eindeutig war – allerdings auch so unglaublich –, brauchte Klara eine Weile, um zu verstehen, dass es sich bei dem Foto ihrer Großmutter, das sie soeben in der Hand hielt, nie und nimmer um eine Anlehnung an jenes berühmte Yves-Klein-Bild handeln konnte. Ganz sicher nicht, war diese Frau doch im September des Jahres 1957 verschwunden und nie wieder aufgetaucht.
Und da stand es ja, das Entstehungsdatum dieses Bildes: 3. September 1957. Dazu die Signatur Helga Blume und der Titel Sprung ins Leere. Das war also ein kleiner Unterschied, nicht »in die Leere«, sondern »ins Leere«. Und auf dem Foto war natürlich kein Mann, sondern eine Frau zu sehen, die mit ausgebreiteten Armen von der Brüstung eines im ersten Stock gelegenen Balkons springt, unter ihr eine menschenleere Straße, keine Judokas, die eine Matte halten, auch sonst keine sichtbare Konstruktion, in der sie wohlbehalten landen könnte. Sie trägt einen Rock, den es nach oben weht, eine helle Bluse, die den Eindruck des Flügelschlags verstärkt, und ihr dunkles Haar ist zu einem Zopf gebunden, der sich in einem hübschen Bogen himmelwärts schwingt. Es ist jedoch die absolut gleiche Haltung, die gleiche »fliegende Pose« wie auf dem Klein-Foto. Und auch wenn es ein anderes Haus ist sowie eine andere Straße, in München möglicherweise, und der Radfahrer im Hintergrund fehlt, so ist die Anmutung dieser Umgebung von frappierender Ähnlichkeit. Zudem: So wie man vielleicht sagen kann, dass Yves Klein auch im Sprung ein ausgesprochen gut aussehender Mann gewesen war, war diese Frau bei ihrem Sprung eine ausgesprochen gut aussehende Frau. Aber eben drei Jahre früher, wenn das hier keine Fälschung war.
Eine Fälschung? Also in dem Sinne, dass jemand dieses Bild vordatiert hatte. Was dann hätte bedeuten müssen, dass das Foto in Wirklichkeit einige Zeit nach dem Entstehen von Yves Kleins Bild von 1960 hergestellt worden war, dann aber vordatiert wurde, um schließlich in diese spätestens seit Ende des Jahres 1957 bestehende Ansammlung aus Kunstwerken und Habseligkeiten eingeschleust zu werden. Somit erst nachträglich unter die festen Kunststoffplanen gelangt war (Planen, wie man sie vielleicht auch verwendet hatte, um eine vom Balkon springende Aktionskünstlerin aufzufangen).
Doch ein derartiges Manöver war nur schwer vorstellbar.
In jedem Fall musste es sich um eine Fotomontage handeln, wie es im Falle des Bildes von Yves Klein eine Fotomontage war. Oder? Wer auch immer dieses Bild fotografiert haben mochte. Denn darauf bestand selbst auf der Rückseite des Abzugs keinerlei Hinweis. Und es wäre auch wirklich zu viel des Guten gewesen, wären da etwa die Namen der beiden Fotografen Shunk und Kender gestanden.
Klara war schlichtweg betört. Betört von der Vorstellung, dass ihre Großmutter drei Jahre vor Yves Klein den Sprung in die Leere beziehungsweise ins Leere gewagt hatte. Und dass es beinahe so aussah, als hätte der hübsche Franzose ihre Großmutter kopiert, was gewiss nicht der Fall war. Sosehr man Derartiges etwa von Picasso kannte, dessen Konkurrenten ihre Bilder verhängten, wenn er sie besuchte, auch wenn er selbst nicht von kopieren, sondern kokett von stehlen sprach und es verstand, aus fremdem Gold eigene Diamanten herzustellen. Picasso, der so alt wurde wie Helga Blume jetzt sein mochte, vierundneunzig, während Yves Klein keine zwei Jahre nach seinem »Sprung« im Alter von vierunddreißig Jahren an einem Herzinfarkt gestorben war. Höchstwahrscheinlich als eine Folge der Vergiftungen, die er sich bei der Arbeit an seinen monumentalen Schwammbildern zugezogen hatte. Bilder in dem für Klein typischen, von ihm selbst entwickelten und patentierten Blau. Kleins Organe seien danach, so seine Witwe Rotraut Klein-Moquay, als rede sie von Objekten, »wie aus ganz dünnem Glas« gewesen.
Natürlich fiel es Klara auf, wie sehr das Foto ihrer Großmutter in einem zeitlichen Zusammenhang mit deren Verschwinden zu stehen schien. Als sei’s ein Requiem, ein Abschiedsbrief, eine Vorahnung.
Vielleicht aber war die Verbindung noch viel unmittelbarer. Was, wenn es sich gar nicht um eine Fotomontage handelte?
Nicht, dass Klara sich vorstellte, ihre Großmutter sei durch diesen Sprung vom Balkon in eine Art von Zeitloch gefallen, in ein Paralleluniversum oder Zwischenreich, aber doch, dass sie ohne Sicherung gesprungen war, nicht wie Klein in eine Matte oder ein Tuch hinein, sondern …
Wie sondern?
Wollte sich Klara ernsthaft ausmalen, dass ihre Großmutter in ihrer Kunst so radikal realistisch gewesen war wie manche späteren Aktionskünstler? Und sie als Folge dieses Sprungs auf dem Boden der Straße gelandet war, sich verletzt hatte, leicht oder schwer oder auch lebensgefährlich, oder aber – wie das vielleicht Judokas tun würden – in einer Weise abgerollt war, die ihr eine heftige Verletzung erspart hatte. Sie aber gerade dieses Überlebthaben zum Anlass nahm, aus dem Leben zu verschwinden. Trotz zweijähriger Tochter, so schwer etwas Derartiges zu begreifen war.
Hier war einiges nicht zu verstehen. Aber es reizte Klara, es reizte sie ganz ungemein.
Sie packte alles in Kisten und Kartons und ließ es von einer Spedition abholen und nach Wien bringen. Auch dort würden die Sachen in ein Lager kommen, allerdings eines, das sich weit weniger eignete, die nächsten achtundsechzig Jahre in Vergessenheit zu geraten.
Das Foto Sprung ins Leere hingegen – signiert, datiert, betitelt – tat sie in ihre Tasche. Sie war fest entschlossen, diesem Bildnis auf die Spur zu kommen. Und damit eben auch ihrer Großmutter, ihrer so lange verschwiegenen und verdrängten Großmutter. Auf die Spur, vielleicht sogar auf die Schliche.
Wollte sie die Kunstgeschichte umschreiben?
Irgendeine Geschichte auf jeden Fall.
Das Atelier freilich, das einst im Nachbarhaus der Gerüstbaufirma gewesen war, existierte nicht mehr, das Atelier und das Haus nicht. Es gelang Klara ebenso wenig, die Straße zu entdecken, in der das Foto aufgenommen worden war. Sie zog zahlreiche Kreise um das Areal der Lagerhalle und des Neubaus, wo einst das Atelier gewesen war, aber keine dieser Straßen erinnerte an jene auf der Fotografie ihrer Großmutter.
Sie sprach noch einmal mit dem Besitzer der Firma und fragte ihn nach seinem Großvater, wollte wissen, ob dieser hochbetagt am Leben sei.
»Sie haben Glück«, meinte der, »er lebt tatsächlich noch. Wenngleich schon einige Zeit in einer anderen Welt.«
Der Firmenchef erklärte, dass sein Großvater jetzt siebenundneunzig sei, allerdings schwer dement, und seit Jahren in einem Pflegeheim am Rande Münchens wohne. Er erkenne niemanden mehr aus seiner Familie, sei aber ein freundlicher, zufrieden wirkender Mann von erstaunlicher Mobilität. Was auch dazu führe, dass er immer wieder das Gelände des Pflegeheims verlasse, marschierend wie ein junger Gott, wie es die Pflegerinnen liebevoll ausdrückten, um sich dann in der Gegend um den Perlacher Forst heillos zu verirren und von dem einen oder anderen Anrainer zurück ins Heim gebracht zu werden.
Klara ließ sich die Adresse geben, bestellte ein Taxi und fuhr zu jenem Pflegeheim, in dem der alte Herr Urban drauf und dran war, hundert zu werden. Und sie hatte tatsächlich Glück, nicht nur weil der Mann noch lebte, sondern auch weil er sich im Zuge eines kleinen Geburtstagsfestes für einen anderen Heimbewohner im Haus und nicht drüben im Forst aufhielt.
Natürlich wurde ihr gleich gesagt, dass der alte Herr kaum zu einem normalen Gespräch in der Lage sei. Doch Klara setzte sich zu Herrn Urban, der in einem tiefen Fauteuil saß und der, so klein und rosinenhaft runzelig, vor dem Hintergrund des dunklen Stoffs schwer auszumachen war. Eigentlich nur seine leuchtenden, geradezu strahlenden Augen. Als schaue er aus einer anderen Sphäre herüber, einer Sphäre, in der alles zu größter Klarheit und Brillanz reifte.
Während Klara noch sagte, wer sie sei und mit einfachen Worten zu beschreiben versuchte, wieso sie ihn aufsuchte, sprach er aus einem Mund, der schmal und dunkel, geradezu unsichtbar, unter dem freundlich glänzenden Augenpaar stand. Er sagte: »Helga!«
Er hatte es mit erstaunlich kräftiger Stimme ausgerufen, sodass sich mehrere Leute im Raum zu ihnen hindrehten. Als hätte er »Feuer!« gerufen.
Und ein Feuer schien es durchaus, das in ihn gefahren war. Denn obgleich Klara jetzt darlegte, nicht Helga, sondern Klara zu sein, die Enkelin der Frau Blume, sprach Urban sie weiterhin mit Helga an. Und entschuldigte sich. Es tue ihm wirklich leid, aber er habe es einfach nicht übers Herz gebracht.
»Was hast du nicht übers Herz gebracht?«, ging Klara zum Du über. Denn das hatte sie nun begriffen, wie sehr die Ähnlichkeit, die zwischen ihr und ihrer Großmutter bestand, als diese jung gewesen war, dazu führte, dass der verwirrte Herr Urban sie für Helga Blume hielt.
Wenn behauptet worden war, der alte Mann könne sich kaum noch verständlich artikulieren, dann stimmte das nicht. Zumindest nicht im Moment. In einem Moment, da er meinte, die jugendliche Helga Blume vor sich zu haben. Welcher er nun – mit einer Stimme zwischen Wiedersehensfreude und Selbstvorwurf – erklärte, nicht getan zu haben, worum sie ihn so eindringlich gebeten habe. Nämlich ihre Kunstwerke zu zerstören. Alles, vor allem die Fotografien, zu vernichten, alles dem Feuer zu opfern. Stattdessen habe er die Sachen in eine entlegene Ecke eines der Lagerräume geschafft, gut verpackt, gut verborgen unter Planen, umgeben von altem Plunder, der dort abgestellt worden sei wie Müll, der in der Zeit verloren geht.
So drückte er es aus: in der Zeit verloren geht.
Und indem er das sagte, schien es, er gehe selbst in der Zeit verloren, fiel zurück in ein stummes Lächeln, kein Mundlächeln, sondern ein Augenlächeln, erhob sich mit juveniler Flinkheit aus der Tiefe des Sessels, setzte sich eine eigentümliche Brille auf, die etwas von einer goldbeschichteten Blindenbrille an sich hatte, und eilte hinüber zu der Geburtstagsgesellschaft, ohne dass er Klara, die für einen Moment Helga gewesen war, noch einmal beachtete.
Klara hätte ihm gerne das Foto der 1957 vom Balkon springenden Helga Blume gezeigt, aber da war nichts zu machen, er verschwand in der Feiergesellschaft in einer ähnlichen Weise, wie er des Öfteren aus seinem Zimmer und dem Heim zu verschwinden pflegte. Aber immerhin, sie wusste nun, was für einem kafkaesken Umstand es zu verdanken war – man könnte auch sagen brodesken –, dass sie dieses eine Foto in ihren Händen halten konnte, anstatt bloß auf einen Haufen Asche gestoßen zu sein.
Mit besagtem Foto in der Tasche kehrte Klara nach Wien zurück, wo ja immerhin ein Beruf wartete, ein Museum, das Leute wie sie benötigte. Was wäre ein Museum ohne Aufseher und Aufseherinnen? Auch wenn der Begriff doch sehr an ein Gefängnis erinnerte. Mit dem Unterschied, dass hier die Gefangenen, also die Gemälde und Skulpturen, vor den Besuchern geschützt werden mussten.
Wobei die Bilder nicht etwa den Status von Kleinkriminellen und Straßendealern und Verkehrssündern besaßen, natürlich nicht, sondern den Rang wahrhafter Großverbrecher: Bosse, Paten, Superschurken, Gentlemangauner, Millionenbetrüger. Und darum war es auch nötig, dass eine ständige Präsenz, ja eine würdevolle Präsenz der Aufseher gegeben war. Die gleichsam als ein bewegliches Ornament den Wert der ausgestellten Werke betonten, den »kriminellen« Wert. Und sich nicht etwa von den Besuchern allein dadurch unterschieden, dass sie langsamer gingen, selten oder nie ein Gemälde ansahen, sich beim Abwechseln verschwörerische Blicke zuwarfen und die Macht besaßen, zur Ordnung zu rufen. Sie waren in einer fast schon mystischen Weise Teil der Objekte, die sie bewachten. Und das spürte ein jeder Besucher, wie merkwürdig und unpassend es nämlich ist, sich in einem Museumsraum aufzuhalten, in dem gerade kein Aufseher oder keine Aufseherin zu sehen sind.
Zurück nach Wien also, zurück ins Museum. Nach drei Tagen Urlaub in München.
Im Gepäck einen Schatz. Und ein Rätsel.
2
»Sex mit mir ist eine Katastrophe.«
Das war der erste Satz in einem Roman, einem nie veröffentlichten Roman, der den Titel Erkenntnisse eines kopflosen Mannes trug.
»Mein Gott, was für ein beschissener Anfang!«
Der Mann, der auf solche Weise schimpfte, trug den Namen Georg Salzer. Die Seite, ein bedrucktes Blatt Papier, war ihm aus irgendeinem halb vergessenen Schreibtischfach, das er versehentlich geöffnet hatte, entgegengeflattert. Und anstatt das Blatt rasch zurückzulegen, war er so unvernünftig gewesen, es mit großer Selbstverachtung zu lesen.
Wie hatte er einst gesagt?
Auf die erste Seite komme es an. Die erste Seite sei alles. Das ganze Gelingen und das ganze Scheitern. Wenn die erste Seite auf zwei linken Beinen stehe, dann würde die Geschichte, gleich, wie viele Hunderte von Seiten noch folgen mochten, immer auf zwei linken Beinen durch die Gegend marschieren, beziehungsweise wackeln. Das sei das Drama. Weshalb es klug wäre, nach einer ersten Seite den Umstand zweier linker Beine einzusehen und nicht so töricht zu sein, sich quasi auf diesen zwei linken Beinen noch ein paar Hundert Seiten fortzubewegen.
»Faktum ist«, sagte er, »dass mir nie eine erste Seite gelungen ist, die nicht auf zwei linken Beinen gestanden hätte. Oder von mir aus auf zwei rechten, was ja genauso ein Unglück ist. – Was daraus folgt, ist klar.«
Er hatte das so oft von sich gegeben, dass es etwas von einer chronischen Krankheit besaß. Nicht einer, die einen umbringt, aber halt doch ein Leben lang zu einem Unwohlsein, einem Schmerz und einer Wut gegen das Schicksal führt. Auch noch, als er längst mit dem Unsinn der Schreiberei aufgehört hatte. Er, der zuerst als Wissenschaftler, dann als Literat, schließlich als Biograf eines Industriellen und zuletzt als Verfasser von Trauerreden gearbeitet hatte. Zwar war er in diesen fünfzehn Jahren seiner Schreibarbeit immer wieder über diese verfluchte erste Seite hinausgekommen, notgedrungen, um dann aber am Ende auch immer wieder feststellen zu müssen, wie unsinnig sein Unterfangen gewesen war. Mitunter die Unsinnigkeit einer kurzen Abhandlung in Kauf nehmend, dann wieder die erschöpfende Tortur eines ganzen Romans. Und bei alldem hatte er sich auf zwei linken Beinen durch die Seiten seiner Fiktionen gekämpft. Wobei nach seinem Ermessen alles Fiktion war, auch die Wissenschaft, auch der Journalismus, und die Trauerrede sowieso. Die Trauerrede war eigentlich der Höhepunkt des Fiktiven. Glücklicherweise selten länger als eine kurze Kurzgeschichte. Was aber das Scheitern auf der ersten Seite nicht weniger schlimm machte.
Seine letzte Trauerrede hatte er zur Verwirrung der Trauergäste mit dem Satz beendet: »Ich schreibe nie wieder ein Wort, jawohl. Vor allem keine erste Seite. Und auch keinen ersten Satz. Einen ersten Satz schon gar nicht. Keinen einzigen Funken.«
Das war bei aller Verwirrung als ein Gleichnis in Bezug auf den Verstorbenen ausgelegt worden, der, vom Diesseits befreit, somit keine Wörter und Sätze mehr zu schreiben brauchte. Immerhin war der Mann Gebrauchtwagenhändler gewesen und hatte sicherlich den einen oder anderen Satz, vor allem aber die eine oder andere Zahl zu Papier gebracht. Zuletzt auch diverse Briefe an seine Kläger, bevor er sich eine Pistole in den Mund gesteckt hatte.
Jedenfalls hatte Georg Salzer damals Mitte der 1990er-Jahre, knapp dreißigjährig, beschlossen, endlich mit dem Schreiben aufzuhören, endlich den Kampf gegen das Unglück einer ersten Seite, die alles Nachkommende verdarb, zu beenden und seinem Leben eine andere, neue Gestalt zu verleihen.
Freilich war eine Mail oder die in das Smartphone hineingetrommelte kurze Nachricht nicht mit einem Text zu vergleichen, bei dem das Scheitern einer ersten Seite sich auf den folgenden Seiten gleich dem Fallen von Dominosteinen auswirkte. Doch Salzer würde sich auch in diesen Jahren allgemeiner Schreibwut stark zurückhalten, nicht zuletzt mit dem Argument, er halte es für dubios, ausgerechnet ein Gerät, welches für das Sprechen und Zuhören entwickelt worden war, für eine Art von Schnellschreiben zu missbrauchen. Dabei war er nicht jemand, der die neue Technik leugnete, er hasste sie. Sie nutzend, hasste er sie. Was bedeutete, dass er sich all diese Geräte anschaffte, ja, dass er, als man in der Mitte der 2020er-Jahre angelangt war, sagen konnte, er habe jede Generation von Rechenmaschinen und missbrauchten Telefonen mitgemacht.
Er war übrigens nie verheiratet gewesen. Dabei war er ein Mann, der gefiel, auch jetzt, mit seinen neunundfünfzig Jahren. Vielleicht waren es auch bloß achtundfünfzig. Die Zeit war merkwürdig verschwommen. Viele Menschen waren sich nicht ganz sicher, ob sie ein Jahr älter oder jünger waren als in ihrer Vorstellung. Natürlich, man konnte nachschauen, in Ausweisen, auf Dokumenten, auf dem Impfzeugnis, das man ja dank Handy stets bei sich trug. Und doch, viele kamen ins Grübeln, sobald ihr genaues Alter zur Sprache kam. Jemand sagte einmal, es stecke eine gewisse Demenz in der gesamten Gesellschaft, bei alt wie bei jung. Eine gewisse Unschärfe. Eine »falsche Brille«.
Georg trug auch tatsächlich eine Brille. Ein massives, schwarzes Gestell, von dem gerne behauptet wurde, Architekten trügen eines, oder früher Existenzialisten, oder Leute, die den Sinn einer Brille auch darin sahen, hinter ihr Schutz zu finden, ohne dass es eine Sonnenbrille sein musste. Vielmehr etwas, mit dem man nicht nur besser sah, sondern das Gesehene dank der Brille ein Stück weit auf Distanz halten konnte.
Er drückte es tatsächlich so aus: »Zwischen mir und den anderen sind ein paar Dioptrien. Und das ist gut so.«
Das war sicherlich übertrieben, aber in dieser Übertreibung steckte Georgs Wesen wie eine gedachte Skulptur in einem Steinblock, die herauszuschlagen ein bestimmter Bildhauer für nicht mehr nötig hielt.
Wie hatte man ihn sich vorzustellen, jenen Georg Salzer? Jetzt, Mitte eines Jahrzehnts, das zwar bereits das zweite dieses Jahrhunderts war, sich aber noch so welpenhaft schusselig anfühlte, als sei es erst jüngst aus der Asche und dem Schatten der vorausgegangenen Epoche hervorgetreten. Das zwanzigste Jahrhundert war schrecklich und monströs gewesen, aber ebenso voller ungemeiner Einsichten in das Leben. Das einundzwanzigste schien sich dagegen noch immer vom Mutterkuchen des zwanzigsten zu ernähren und darauf stolz zu sein, Dinge hervorzubringen, die alle etwas von einem Staubsaugerroboter besaßen.
Und in diesem Jetzt befand sich Georg Salzer. Er war eher groß als klein, aber eine Größe, die vernünftig anmutete und bei der man nicht gleich überlegte, wie denn wohl die Eltern dieser Person ausgesehen hatten. Seine Gestalt verriet den einstigen Sportler gleichermaßen wie den späteren Verächter des Sports, dabei war er nicht fett, überhaupt nicht, aber es war etwas Träges und Zur-Ruhe-Gekommenes in seinen Bewegungen. Überhaupt war er ein Mann, der im Sitzen viel besser als im Stehen aussah, und im Stehen besser als im Gehen. Und der, Gott weiß, warum, auch besser im Freien als im Geschlossenen wirkte, was absolut nicht für jeden gilt – manche Menschen erinnern, sobald sie ins Freie gelangen, augenblicklich an die Verfallsprozesse, die die Natur nicht ganz unwesentlich mitbestimmen. Georg hingegen blühte im wahrsten Sinne im Freien auf, und das wusste er, auch wenn dieses Freie zumeist die Stadt war. Darum gehörte er zu denen, die man stets in den Gastgärten der Cafés und Restaurants anzutreffen pflegte, häufig in den Außenlokalen des sogenannten MuseumsQuartiers. Und fast immer allein. Er war gerne alleine, aber gerne alleine unter Leuten.
Viele, die ihn grüßten, hätten nicht sagen können, wer er eigentlich war. Und die, die es wussten, wussten es nur sehr ungenau. Was die Leute sagen konnten, war, dass dieser Mann in seinen Dreißigern damit begonnen hatte, zusammen mit einem Konditormeister, den er noch aus der Schule kannte, eine kleine Kette spezieller Konditoreien zu eröffnen, die den Namen Annes Liebe trugen. Wobei sich aufgrund der klanglichen Ähnlichkeit bei nicht wenigen Kunden wissentlich oder unwissentlich der Name Alles Liebe durchgesetzt hatte.
Wie auch immer man es aussprach, und wer auch immer jene Anne gewesen war, in diesen ungewöhnlich modern eingerichteten Läden wurde bereits in den 1990ern eine große Palette an veganen Süßwaren angeboten, zudem eine Reihe von Kreationen, die diverse österreichische Künstler zitierte, etwa ein von Valie Export inspiriertes Marzipantörtchen, das eine Chimäre aus Hund und Mann darstellte. Am berühmtesten freilich die vielfarbig spiralige Hundertwasserschnitte. Für die hatte Hundertwasser noch selbst seine Erlaubnis gegeben, dennoch war es nach dessen Tod zu einem Prozess mit dem Verwalter des Hundertwasser’schen Erbes gekommen. Ein endloser Prozess, der geradezu symbolisch das Unglück in diese eigentlich so erfolgreiche Geschichte einer Konditoreikette brachte, auch wenn das wirkliche Unglück ein anderes war.
Georgs als Konditormeister so genialer Geschäftspartner hatte sich bedauerlicherweise als Besucher von Casinos, Wettbüros und Pokerrunden als weit weniger genial herausgestellt. Raffiniert eigentlich nur dann, wenn er in ruinöser Weise in die Kasse seines und Georgs Unternehmens griff. Er nahm sich schließlich 2011 in größter Not das Leben. Georg wiederum musste froh sein, dass er den Verkauf der bei allem äußeren Erfolg in Wirklichkeit stark verschuldeten Kette so weit über die Bühne brachte, um aus der ganzen Geschichte mit einem winzig kleinen Vermögen auszusteigen. Ein Vermögen, das es ihm bei einiger Bescheidenheit ermöglichen sollte, sich nach Schriftstellerei und Konditoreikette kein drittes und letztes Betätigungsfeld suchen zu müssen. Denn er hatte stark seinen kommenden Fünfziger gespürt und hätte kaum sagen können, was er noch großartig in Angriff nehmen sollte. Er selbst drückte es so aus: »Mit fünfzig ist alles vorbei, egal, wie sehr man uns neuerdings einzureden versucht, dass es dann erst so richtig losgeht, weil die Kinder groß sind und man genug gespart hat und es jetzt auch Kosmetikserien für Senioren gibt und die Haut so schön straff ist und der Lack auf dem Porsche jung und frisch und so weiter und so fort. In Wirklichkeit heißt fünfzig sein, dem Tod ins Gesicht zu sehen, selbst wenn das noch dreißig Jahre dauert. Muss man halt dreißig Jahre und mit relativ straffer oder gestraffter Haut dem Tod ins Gesicht sehen und kennt dieses Gesicht halt ganz gut, wenn es dann so weit ist.«
Aber seine Rechnung ging nicht auf. Das Vermögen erwies sich als zu gering, oder Georgs Bescheidenheit war nicht bescheiden genug, jedenfalls stand er, als sein achtundfünfzigster oder neunundfünfzigster Geburtstag sich wie eine dieser Wellen näherte, auf denen manche zu reiten verstehen, die meisten aber eher untergehen, vollkommen ohne jegliche Reserven da. Und war somit doch gezwungen, für die paar Jahre, die ihm bis zur Pension blieben, eine Arbeit zu finden. Eine Pension, die ein wenig an eine der Konditoreikreationen seines ehemaligen Geschäftspartners erinnerte: ein rosafarbenes Küchlein mit dem ironischen Namen petit malheur, also Kleines Unglück.
Zuerst einmal gab er sein Appartement auf und zog als Untermieter in die wirklich winzige Kammer einer Dachgeschosswohnung, die von einem verrückten dicken Mann und seiner verrückten alten Mutter bewohnt wurde. Ihnen gehörte das ganze Haus. Sie hätten es sicher nicht nötig gehabt, auch dieses Zimmer als Zimmerchen in der letzten Ecke eines ehemaligen Ateliers zu vermieten. Räume, durch dessen stark verdreckte, nie gereinigte Glasfenster das Licht sickerte wie Tröpfchen verzweifelter Milch. Doch die beiden waren unheimliche Sparmeister, in deren Wohnung, die nicht unbedingt die sauberste auf der Welt war, sich Berge alter Zeitungen, Kartons und Trödelware stapelten. Weder lasen die beiden in diesen Zeitungen, noch trieben sie mit den Altwaren Handel, sie waren einfach Sammler an sich, verschroben, missmutig, dunkel wie das Zeug, das überall herumstand. Und doch, Georg zog dort ein, in dieses Zimmerchen, das von allerlei Schmutz zu befreien ihn einige Mühe kostete. Denn obgleich er meinte, bereits seit einiger Zeit dem Tod ins Auge zu sehen, wollte er dennoch nicht wie in einer Grabkammer hausen.
Eine bedeutende Ironie ergab sich nun daraus, dass Georg die Vermieter darum kannte, weil sich im Erdgeschoss dieses Hauses eine Filiale jener Konditoreikette befand, die er einst besessen hatte. Obwohl der Verkauf der Kette schon ein Jahrzehnt zurücklag, bemerkte Georg erst bei seinem Einzug in die neue Wohnung, dass die Kette zwischenzeitlich den Namen geändert hatte. Das zwischen Hellblau und Altrosa changierende Leuchtschild mit den Lettern über der Eingangstüre offenbarte es. Man war von Annes Liebe tatsächlich zu Alles Liebe gewechselt, hatte also im Grunde einen »Fehler«, ein Missverständnis institutionalisiert.
Er wusste nicht, wieso er das tat, aber als er vor dem Haus stand, in dem er nun wohnen würde, trat er in den kleinen Konditoreiladen, dessen Tische im Inneren wie auch draußen auf der Straße alle besetzt waren, und stellte sich an die Verkaufstheke. Er blickte ein wenig verträumt in die Vitrine, wo neben den vielen ihm bekannten Kreationen ebenso Neues und Aktuelles ausgestellt war. Und auch der vegane Anteil hatte weiter zugenommen. – Mein Gott, die Hundertwasserschnitte! Hätten er und sein Kompagnon doch einfach darauf verzichtet, dieses Ding in die Welt zu setzen.
»Herr Salzer?«
Er blickte auf und schaute in das Gesicht einer Frau. Er hätte nicht sagen können, wer sie war, wusste aber natürlich, dass sie hier als Verkäuferin arbeitete, sie stand ja hinter der Theke, trug allerdings keinerlei Uniform. Nur eine weiße Schürze mit dem Emblem der Kette, einem in sich verschlungenen L. Uniformen hatte Georg schon zu seiner Zeit abgelehnt, und dabei war es offensichtlich geblieben.
»Sie erinnern sich nicht, oder?«, sagte die Verkäuferin, eine von dreien, die hier abwechselnd die Laufkundschaft sowie die Sitzengebliebenen bedienten.
»Tut mir leid …«, meinte Georg und empfand einen gewissen Schrecken bei der Vorstellung einer verdrängten Intimität. Dabei war es ganz sicher nicht so gewesen, dass er auch nur einer seiner Angestellten Avancen gemacht hätte, so dumm und dreist war er nicht gewesen. Und wäre auch echter Zuneigung ausgewichen – an die er sowieso nie geglaubt, sondern sie für ein Konstrukt der Neuzeit gehalten hatte.
Er sagte also, es tue ihm leid, sich nicht erinnern zu können.
»Macht ja nichts«, sagte die Frau, die etwas älter als ihre Kolleginnen war und deren Schönheit hinter einem Zug von Strenge weniger verschüttet wirkte als wie etwas, das anderswo lebte, in Australien oder so. Sie fragte: »Was darf ich Ihnen denn geben?«
»Ehrlich gesagt, ich wollte nur mal schauen … Also, mir wäre eher nach einer Zigarette.«
Er wollte sich schon für seine Bemerkung entschuldigen, schließlich war das hier keine Trafik, doch die Frau meinte: »Gerne. Ich wollte ohnehin eine Pause machen. Gehen wir nach hinten?«
Sie gab einer ihrer Kolleginnen ein Zeichen, indem sie mit Daumen und Zeigefinger die ikonische Gestalt zur dünnen Röhre gedrehten Papiers in der Luft nachzeichnete. Derart geschickt, dass man hätte meinen können, wenn schon nicht die Marke, so doch den Umstand eines orangefarbenen Filters auf dieser Luftzeichnung feststellen zu können.
Georg nickte, trat an der Theke vorbei und folgte der Frau durch einen rückwärtigen Raum hinaus auf einen Lichthof, der äußerst schmal war, aber viele Stockwerke nach oben führte und im graublauen Quadrat des Himmels endete.
Die Frau holte eine Packung aus ihrer Schürze, rüttelte sie etwas, sodass ein paar von den Zigaretten vorrutschten, und hielt sie Georg entgegen. Er zog eine heraus und sagte: »Danke, Frau …«
»Sylvia«, sagte sie und meinte, dass, auch wenn die Nachnamen der Angestellten außen auf den Hemden und Blusen klebten, man doch eigentlich vor allem aus seinem Vornamen bestehe. Nicht wahr?
»Es tut mir wirklich leid«, sagte Georg, »dass ich mich nicht an Sie erinnere. Das ist wirklich dumm.« Dabei versuchte er, einen Nachnamen irgendwo auf der Brust der Frau auszumachen, vergeblich.
»Übertreiben Sie nicht«, sagte die Frau, die Sylvia war. »Sie waren der Chef von Annes Liebe, ich eins von den Mädels hinter Bergen von Süßgebäck. Dass die neuen Besitzer jetzt aber aus der Anne was anderes gemacht haben, ist lächerlich.«
»Ich mochte Anne auch lieber«, sagte Georg.
Sylvia gab ihm Feuer. Dabei hielt er die Zigarette so tief in die Flamme, als versuchte er, sich im Feuer wie in einem kleinen Spiegel zu betrachten. Als sei ihm mit einem Mal der Sitz seines Haars wichtig. Sein Haar, das früher blond gewesen war, nun aber zwischen hellbraunen und grauen Tönen wechselte, und das am Hinterkopf lichte Stellen offenbarte, nach vorne hin jedoch eine geschwungene Linie über die Stirn zog, die man schon hässlicher gesehen hatte.
Auch Sylvia zündete sich jetzt ihre Zigarette an.
Sie kamen ins Gespräch. Und Georg war so offen, davon zu berichten, wieso er heute in den Laden gekommen war. Weil dieser sich in dem Haus befand, in dem er demnächst wohnen würde. Billig wohnen würde, da er sich ein teures Wohnen nicht mehr leisten konnte. Sich eigentlich gar nichts mehr leisten konnte. Und darum auch auf der Suche nach einem Job war, ohne die geringste Vorstellung zu haben, was für einer das sein könnte.
Sylvia hatte nach Jahren hinter den Theken der verschiedenen Konditoreifilialen die Personalleitung bei Alles Liebe übernommen. Die Reduktion auf ihren Vornamen zuvor war eine Mischung aus Reminiszenz und Sarkasmus gewesen, sie war für alle Frau Martinek (und ganz sicher nicht Frau Sylvia). Wenn sie heute im Laden stand, dann nur wegen einer Personalnot an diesem Tag.
»Die da drinnen sind beide neu eingeschult«, sagte sie, »und ich wollte das Boot nicht sinken lassen.«
Und dann erklärte sie: »Ich weiß nicht, ob ich Sie damit jetzt kränke, aber wenn Sie schon mal in diesem Haus wohnen werden … Könnten Sie sich vorstellen, bei uns im Laden als Verkäufer zu arbeiten?«
»Sie scherzen, oder? Wollen Sie mein petit malheur vergrößern?«
Sie wusste ja, worauf er anspielte, und erklärte, nein, sie bräuchte dringend jemanden, der all die frischen kleinen Unglücke verkaufe. »Oder schmerzt Sie die Vorstellung? Immerhin waren Sie einmal Besitzer dieser Kette.«
Er lachte ungläubig und meinte: »Trauen Sie mir das echt zu?« Und fügte an, eingedenk eines früheren Bildes, das sich auf zwei linke Füße bezogen hatte: »Vielleicht stellt sich heraus, dass ich zwei linke Hände habe.«
Frau Martinek schüttelte den Kopf und sagte: »Die Art, wie Sie Ihre Zigarette halten – und Sie halten sie ja in der Rechten –, zeigt mir, dass Sie maximal zwei rechte Hände haben, aber gewiss nicht zwei linke.«
»Sie wissen aber schon, wie alt ich bin.«
»Nein, weiß ich nicht, aber ich finde, dass Sie einfach gut in diesen Laden passen.«
»Nächstes Jahr sechzig«, gab er dennoch eine Antwort, auch wenn er unsicher war, ob das nicht erst übernächstes Jahr der Fall war.
»Nun, wie heißt es doch«, meinte die Personalchefin schulterzuckend, »die Frauen, mit denen Sie da zusammenarbeiten, könnten Ihre Töchter sein. Sehen Sie es familiär.«
Er fragte sich, was es bloß war, was diese Frau derart antrieb, ihm diesen Job geben zu wollen. Etwas Heiliges oder etwas Teuflisches?
Wie auch immer, es geschah. Praktisch mit seinem Einzug in dieses Haus und in seine neue Wohnung begann er auch, für Alles Liebe als Verkäufer zu arbeiten. Wobei er selten nach vorne zu den Tischen geschickt wurde, um die sitzenden Kunden zu bedienen. Er blieb der Mann, der hinter der Vitrine stand, obgleich manche Kundschaft glaubte, hier würde der Chef des Hauses mal aushelfen, oder zumindest der Architekt von nebenan. Wozu auch sicher beitrug, dass Georg stets in einem seiner sehr gut sitzenden Anzüge hinter der Verkaufstheke zu sehen war, nicht selten mit Krawatte, oder aber das reinweiße oder vanillegraue, aber niemals irgendwie gestreifte oder gar gemusterte Hemd mit dem obersten Knopf geöffnet hatte, sodass sich der untere Teil seines Halses wie bei einem Gemäldeausschnitt offenbarte.
Die Süßwaren wurden im Übrigen angeliefert. Georg brauchte also nicht, so wenig wie schon zu seinen Eigentümerzeiten, zum Konditormeister zu werden. Es genügte, den Überblick darüber zu bewahren, was hier was war, was welchen Preis hatte, worin eine ordentliche Verpackung bestand, wie die Kaffeemaschine zu bedienen war – die aussah wie eine zu Chrom verdichtete Elefantenherde – und welche von den Kundinnen und Kunden man so zu behandeln hatte, als erkläre man einem Monster, wie adrett es ist.
Dieser Laden und damit auch die neue Wohnadresse Georgs befanden sich in einer Straße hinter jenem MuseumsQuartier, wo Georg die letzten Jahre so gerne in einem der Cafés oder Restaurants gesessen hatte. Und des besseren Aussehens wegen gerne im Außenbereich.
Selbiges Quartier mit mehreren Museen und dem riesigen Innenhof samt seiner bunten Sitz- und Liegeformen, die aussahen wie aus dem Kindertraum eines Styroporproduzenten, befand sich auf dem Gelände der ehemaligen Hofstallungen. Dort, wo einst »des Kaisers seine Pferde wohnten«, während das Areal heutzutage vor allem die Bilder aus dem Besitz eines einstigen Augenarztes beherbergte. Von der kaiserlichen Tiersammlung zur bürgerlichen Kunstsammlung. Man konnte nicht sagen, dass alles auf der Welt schlechter geworden war.
In diesen Museen war Georg allerdings noch nie gewesen, nicht einmal, um sich die zu touristischen Ikonen aufgestiegenen Gemälde von Schiele und Klimt anzusehen. Schiele hielt er für einen überschätzten Verrenkungskünstler im Sinne des chinesischen Staatszirkus und Klimt für einen verirrten Goldschmied (was nicht für die Zeichnungen galt, die Georg insgesamt als die Fälschungen mehrerer Generationen einer Fälscherfamilie interpretierte und damit wohl nicht ganz unrecht hatte). Was aber nicht hieß, dass er aller Kunst mit Verachtung begegnete, wie er ja dem eigenen Schreiben mit Verachtung begegnet war. Ganz im Gegenteil. Denn er pflegte so gut wie jede mittägliche Pause im nordöstlich des Quartiers gelegenen Kunsthistorischen Museum zuzubringen. Jenem gewaltigen Ringstraßenbau, der bei allem übermächtigen Prunk und geradezu den Betrachter erschlagenden Gemäldereichtum etwas erstaunlich Gemütliches und Heimeliges an sich hatte. Georg sagte gerne, es handle sich eigentlich um eine Parkanlage mit bequemen Bänken allerorts.
Diesen Park suchte er also regelmäßig auf, wobei er die meisten Kunstwerke eher im Rahmen ihrer Gesamtheit wahrnahm, oder als eine Reihe, eine Allee, einen bewachsenen Gang. Allerdings gab es ein Gemälde, vor dem er durchaus zu stehen kam. Ja, das sein eigentliches Ziel war. Wie man etwa über einen Friedhof marschierend endlich vor ein bestimmtes Grab tritt und innehält, darin sich ein geliebter Mensch befindet. Oder halt jemand Berühmtes. Warum es nun aber ausgerechnet dieses spezielle Gemälde war, auf das er sich regelmäßig zubewegte, davor stand und es lange und eindringlich betrachtete und nach und nach immer mehr Details erkannte und verinnerlichte, hätte er nicht sagen können. Es war ein tolles Bild, keine Frage. Aber welches Bild in diesen hohen Hallen wäre kein tolles gewesen? Wie man auch in einem Park oder Wald kaum sagen würde: »Ach was, großteils sind das ziemlich banale Bäume«.
Bei diesem einen Gemälde, das ihn scheinbar grundlos begeisterte und das er zum Ziel und Umkehrpunkt seiner Wanderungen machte, handelte es sich um das Bild eines Waldes. Gemäß seinem Titel um einen »großen Wald«. Ein Gemälde von der Länge eines recht langen liegenden Mannes und der Höhe eines recht kleinen stehenden Mannes, wobei diese beiden Männer, stehend und liegend, auch Frauen hätten sein können. Allerdings war der Maler ein Mann gewesen, Jacob van Ruisdael, ein angeblich eheloser Niederländer, dessen Tod 1682 in Amsterdam etwas im Unklaren blieb. Er wurde jedenfalls in Haarlem begraben, sofern die Dinge so geschehen waren, wie sie niedergeschrieben wurden. Und der dank seiner Landschaftsgemälde von großem handwerklichem Geschick, viel Stimmung und einiger Bedeutungsschwere in die Kunstgeschichte eingegangen war. Wieso er aber ebenso in das Hirn und das Ritual Georgs eingegangen war, blieb rätselhaft. Man hätte Georg schon zwingen müssen, sich irgendeinen Grund auszudenken.
Ungehindert gelangte er dorthin, wo das Bild hing, und blieb vor diesem auch recht ungestört, da es nicht zu den magnetischen Anziehungspunkten wie etwa dem im gleichen Saal ausgestellten Vermeer und den in der Nähe befindlichen Bruegels gehörte.
Dort, vor dem großen Wald, stand er dann also, zehn Minuten mindestens, gleichermaßen konzentriert wie verträumt, nicht zuletzt über die drei in diesem Gemälde dargestellten winzigen Personen nachdenkend, und ging danach wieder durch die Hallen und das monumentale Stiegenhaus zurück zum Ausgang. Hinaus und hinüber zu einer Liebe, die einst Annes war. Und die auf eine angestellte und verkäuferische Weise auch die seine geworden war.
Es mochte nun bereits einige Wochen her sein, seitdem er in der Konditorei angefangen hatte und viele Stockwerke darüber in ein verzwergtes Untermietzimmer gezogen war. Wieder war Mittag, wieder nutzte er seine Pause, um vor van Ruisdaels Der große Wald zu treten und ihn, den Wald, zu betrachten. Diesmal aber … er bemerkte etwas. Etwas Neues in diesem Bild, das er doch fast täglich sah und studierte, vor allem die drei kleinen Figuren, die da unter hohen Bäumen waren: etwas mehr im Vordergrund der eine einsame Mann, ein Wanderer mit Hut und Stock und einem Bündel, vielleicht erschöpft, vielleicht sinnierend. Während weiter hinten ein Paar durch den Wald spaziert, vielleicht ins Gespräch vertieft, vielleicht schweigend nebeneinander herschreitend, auf einem Weg, der im vorderen Bildteil in der Furt eines seichten Baches verschwindet und am untersten Bildrand wieder ein Stück aus diesem Bach herausführt. Daneben, am linken Bildrand, ein Baumstumpf, der wohl als das dient, was man in der Kunst als Repoussoir bezeichnet: der Hinweis, dass letztlich alles, was ein Ende hat, dieses Ende auch erlebt, gleich ob Pflanze oder Mensch.
Hinter dem Baumstumpf wiederum tat sich der westliche Abschnitt des Waldes auf, sehr viel dunkler als der dominante rechte Bildteil, fast schwarz. Und in diesem schwärzlichen Dunkel einer von Büschen und Bäumen eingesegneten Nacht bei Tage meinte Georg für einen Moment eine Figur zu erkennen, eine vierte Person auf diesem Bild. Eher ein Mann als eine Frau, jedenfalls jemand, der zwischen zwei Stämmen hervorlugte, während bei diesem Gemälde offiziell immer nur von drei Figuren gesprochen wurde. Und auch er selbst, Georg, hatte nie mehr als diese drei Figuren wahrgenommen.
Indem er nun einen kleinen Schritt seitwärtstrat, um diese vierte Figur besser zu erkennen, verlor er sie aus dem Auge. Und schwenkte darum rasch zurück in die alte Position. Da war er wieder, der Mann im Wald, wenn auch sehr, sehr vage. Eine Gestalt, die sich hinter dem ansteigenden Waldboden und zwischen zwei Stämmen als teeriger Fleck abzeichnete. Und dessen Blick – gemäß einer häufig praktizierten künstlerischen Strategie – aus dem Bild heraus auf den Betrachter gerichtet schien. Um diesem quasi mitzuteilen: Du, mein Lieber, bist es, der hier beobachtet wird. Du bist das Bild!
Doch mit einem Mal, vielleicht auch nur, indem Georg unwillkürlich um eine Winzigkeit seine Stellung veränderte, verschwand der Mann wieder. Tauchte vollkommen zurück in die Schwärze, aus der er gekommen war.
Natürlich, Figuren auf einem Gemälde kamen oder gingen nicht, wie es ihnen passte und wie es vielleicht Geister oder Gespenster oder Parlamentarier zu tun pflegten, sondern sie waren gemalt. Simple Farbe auf simpler Leinwand, vollkommen an die Materie gebunden. Allerdings geschah es nicht selten, dass wegen der Spiegelungen gerade auf der Oberfläche alter Gemälde – schließlich auch dies ein Ausdruck der Materie – manche dieser in dunkle Ecken gemalten Figuren mal sichtbar, mal unsichtbar waren, beziehungsweise schwer erkennbar.
Doch sosehr sich Georg auch bemühte, es gelang ihm an diesem Tag nicht noch einmal, in genau jene Position zu geraten, die ihn diese Figur wahrnehmen ließ. Während er umgekehrt davon ausgehen musste, dass das für die Figur selbst nicht galt. Die also dort im dunklen Wald versteckt ihn, Georg, der bestens beleuchtet im Saal XII des Kunsthistorischen Museums stand, sehr wohl die ganze Zeit über im Blick behielt.
Was nun leider schlecht ging, war, ganz nahe an das Gemälde heranzutreten, um in einem Abstand von wenigen Zentimetern besagte Stelle zu untersuchen, als würde man der Figur in den Wald hinein folgen. Erstens war da eine oberschenkelhohe Barriere, über die sich Georg hätte beugen müssen. Und außerdem wäre ein Alarm losgegangen, hätte er es getan. Das war ja gar nicht so selten zu hören, wenn irgendwelche unverschämten Touristen sich nicht an die Abstandsregeln zu den Kunstwerken hielten und dabei eine markante, schrille Folge von Warntönen auslösten. Um dann auch noch von einem der wachhabenden Museumsangestellten gemaßregelt zu werden. Wenn nicht gar eine Durchsage in mehreren Sprachen erfolgte und all die Aufmerksamkeit von den Bildern weg zu dem im wahrsten Sinne Angreifer überging.
Etwas, worauf Georg unbedingt verzichten wollte. Das war ihm seit seiner Kindheit und Jugend zuwider, in irgendeine Maßregelung zu geraten, sich von irgendeinem Kontrollorgan oder Lautsprecher anschnauzen lassen zu müssen. Er hielt Regeln oft genau darum ein, nicht weil er an ihre Sinnhaftigkeit glaubte, sondern um jeglicher Zurechtweisung zu entgehen.
Also unterließ er eine solche Annäherung, griff allerdings nach seinem ungeliebten Smartphone, um die eingebaute Kamera zu nutzen (man stelle sich vor, man hätte etwa irgendwann um 1970 den Leuten erklärt, dass die Menschen der nahen Zukunft mit ihren überallhin mitgeschleppten Telefonapparaten Fotos machen würden. – Und warum nicht mit ihren tragbaren Kaffeemaschinen? Was hätte man gelacht und den Kopf geschüttelt und die nahe Zukunft für eine Parodie der Vergangenheit gehalten).
Mithilfe der eingebauten Kamera holte Georg das Gemälde näher an sich heran und schoss mehrere Fotos aus verschiedenen Positionen. Fotos, die er sich später am Abend eingehend ansah, nachdem er als Letzter die Konditorei zugesperrt hatte und nach oben in seine kleine Wohnung gegangen war.
Natürlich hoffte er, auf diesen Fotos die Figur wiederzuentdecken. Aber die Hoffnung zerschlug sich. Auf keinem der Bilder, wie sehr er sie auch auseinanderzog, war so etwas wie eine aus dem Dunkel herausblickende Gestalt zu erkennen. Kein Mann, keine Frau. Kein Mysterium. Sondern gemalter Wald, sonst nichts.
Es versteht sich, dass Georg in den folgenden Tagen immer wieder vor das Gemälde trat und versuchte, die Figur ausfindig zu machen. Was ihm aber nicht mehr gelang.
War halt bloße Einbildung gewesen, sagte er sich. Wobei eine innere Stimme erwiderte, na ja, vielleicht bestehe die Einbildung darin, die vierte Person einfach nicht mehr erkennen zu wollen. Sie zu verdrängen. Weil das dann doch besser zusammenpassen würde mit dem Umstand, dass absolut nirgendwo etwas von einer solchen vierten Person geschrieben stand. Und somit der Anblick von nur drei Figuren auf diesem Gemälde die eigene geistige Gesundheit bestätigen würde.
Das mochte einige Tage so gehen, das Hin und Herr betreffs der Frage, was denn nun eigentlich die Einbildung sei. Nur drei Personen zu sehen, also eingebildet gesund zu sein, oder doch vier, und somit ein bisschen krank im Kopf, aber dadurch auch imstande, die Wahrheit erkennen zu können so in der Art eines Kaisers ohne Kleider.
Und dann … Beinahe hätte er es doch getan, war mit zwei Schritten dicht an die Barriere getreten und befand sich wie auf einer Schanze, die ihn ganz nahe an das Bild bringen würde, sodass er mit der Nase an die Oberfläche der mit Ölfarbe besetzten Leinwand stoßen und in das Gemälde tauchen würde, hinein in die Landschaft, auf der Suche nach der vierten Person.
Aber er spürte in diesem Moment einen Blick auf sich, einen Blick voller Autorität, einen Blick voll bremsender Energie.
3
Klara war eine dieser dünnen Personen, die dennoch etwas Kräftiges an sich haben, etwas Athletisches. Dabei war sie alles andere als sportlich. Ihre Kondition war wie ein schwacher Regen, der an schwülen Tagen alles nur noch schlimmer machte. Und doch hielten viele sie für sportlich. Ein Kollege etwa war überzeugt – vielleicht auch, weil sie recht groß war –, dass sie einmal Stabhochspringerin gewesen war. Es gefiel ihr, ihn in dem Glauben zu lassen, dabei war gerade Stabhochsprung für sie ein Symbol für die Dummheit allen Sports. Da hätte sie Olivenweitspucken für genauso berechtigt gehalten, eine olympische Disziplin zu sein.