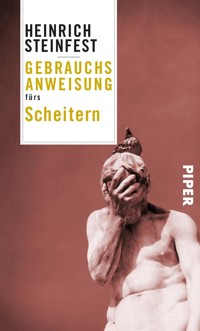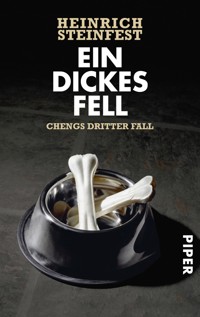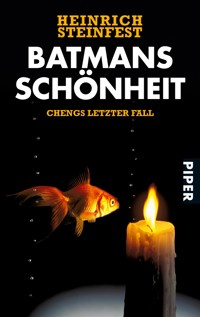9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wer ist die Mörderin, die ihre Opfer porträtiert und anschließend mit ritueller Präzision köpft? Und was hat sie mit dem Wiener Privatdetektiv Cheng zu tun? Denn als er sich selbst porträtiert findet, startet sein Wettlauf gegen die Zeit, und er muss feststellen, dass nicht nur sein Mischlingsrüde Lauscher ein sturer Hund ist ... Der zweite Roman um den einzelgängerischen, sympathischen Detektiv Cheng. Ausgezeichnet mit dem 3. Preis des Deutschen Krimi Preises 2004.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-95809-7
Februar 2017
© 2003 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagfoto: C. Sagel / ZEFA Visual Media
Datenkonvertierung: CPI – books GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Bruchlandung und andere Niederlagen
Dieser Platz war sein Platz. Natürlich konnte man das so nicht sagen. Zumindest nicht laut. Immerhin befand sich Moritz Mortensen in einer öffentlichen Bücherei, also an einem ausgesprochen demokratischen Ort, an dem eine Sitzplatzreservierung unmöglich war. Was nichts daran änderte, daß gewisse Stammgäste ganz bestimmte Plätze bevorzugten. Weshalb auch die meisten dieser Leser, war ihr durch Jahre und Jahrzehnte territorialisierter Platz einmal besetzt, sich mit einem bösen Blick und einer im Vorbeigehen hingemurmelten Bemerkung begnügten. Nur einige wenige drehten durch, wurden ausfällig oder gar gewalttätig. Bedauernswerte Figuren, für die mit dem Verlust ihres gewohnten Platzes praktisch ein Verlust an Identität und Sicherheit einherging, ja, die in einem solchen Moment meinten, die ganze Welt sei ihnen abhanden gekommen. Kein Wunder also, wenn sie zu toben begannen oder damit drohten, jemandem die Zähne auszuschlagen.
Mortensen gehörte nicht zu jenen nervenschwachen Personen, welche Fäuste oder scharfe Worte bereithielten. Dennoch war seine Wut beträchtlich, als er jetzt in der Ferne erkannte, daß an dem kleinen Tisch am Ende der gläsernen Brüstung jemand saß.
Nach Mortensens Einschätzung war es der entlegenste Ort dieser Bibliothek: geographisch wie thematisch. Einerseits lag er im äußersten Winkel des obersten Stockwerks, andererseits handelte es sich bei den dort untergebrachten Büchern um Schriften zum Leben und Werk der Dichter dieser Welt. Mortensen war dankbar für eine solche Umgebung. Er schätzte das Spröde und Kühle, welches von der Sekundärliteratur ausging.
Seinen Stammplatz empfand Mortensen auch deshalb so ideal, weil er zwar abgeschieden lag, jedoch gleichzeitig die Möglichkeit bot, über die Brüstung auf das darunterliegende Stockwerk zu sehen. Denn Mortensen zählte zu den Menschen, die süchtig danach waren, das Leben und die darin eingesponnenen Personen zu beobachten. Er selbst fühlte sich dabei ausschließlich als Chronist, als leibhaftig gewordener Feldstecher. Und der Tisch in dieser Bücherei war nun mal einer seiner bevorzugten Aussichtsplätze.
Während sich Mortensen über die schmale Längsseite der Galerie bewegte, blickte er schräg hinüber zu dem Mann, der auf seinem Platz saß, vor sich zwei Bücher auf dem Tisch, während er in einem dritten las. Er mochte Mitte Zwanzig sein, wirkte schlank unter dem dunklen Anzug und dem weißen Hemd, hatte schwarzes, glattes Haar, eine schwarze Brille, war durchaus attraktiv zu nennen, ließ aber jegliche Auffälligkeit vermissen. Ein Mann zum Heiraten, wenn man so will. Gepflegt. Aber auch nicht wieder so gepflegt, daß man hätte Angst bekommen müssen. Für Mortensen jedoch war dieser Kerl einfach nur ein »Stuhldieb«.
Im Grunde hätte Mortensen sich damit begnügen können, von einem verdorbenen Nachmittag zu sprechen und an anderer Stelle nach einem freien Platz zu suchen. Oder gleich die Bibliothek zu verlassen. Das wäre – in bezug auf das, was nun kommen sollte – fraglos das beste gewesen. Hinsichtlich der Zukunft ist »Verzicht« ohnehin die einzig vernünftige Medizin.
Mortensen aber bewegte sich trotzig auf die fatale Version seiner Zukunft hin.
Als er sich auf wenige Meter besagtem Stuhldieb genähert hatte, bemerkte er den Buchdeckel des obenauf liegenden Bandes. Freudiger Schrecken ist eine milde Bezeichnung für das Gefühl, das ihn schlagartig in Erregung versetzte. Es handelte sich nicht um irgendein Buch, nicht um irgendeinen Thomas Mann oder irgendeinen Frisch oder Grisham, sondern um sein Buch. Es konnte kein Zweifel bestehen. Es besaß einen zitronengelben Einband, auf dessen Vorderseite eine aufrecht stehende, geöffnete Kokosnuß abgebildet war. Wobei die Öffnung sich aus dem Umstand ergab, daß die obere Polkappe gleich einem Frühstücksei abgetrennt worden war. Auf der Schnittkante waren Buchstaben aufgereiht, welche den Titel dieser zweihundertsechzig Seiten ergaben: Bruchlandung.
Bruchlandung war das erste von den drei Büchern, welche Mortensen bei einem kleinen Verlag publiziert hatte. Doch bei aller zitronengelben Heftigkeit war diesem Roman nicht der geringste Erfolg beschieden gewesen. So wenig wie den beiden anderen Bänden, grasgrün und weichselrot. Im Wust der Neuveröffentlichungen besaßen Mortensens Bücher den Charakter von Elementarteilchen, deren Existenz bloß von ein paar schrägen Vögeln behauptet wurde. Nicht eine einzige Rezension war erschienen. Mortensen hielt sich zunächst für einen Boykottierten, mußte aber bald einsehen, daß es noch viel schlechter um ihn bestellt war. Zumindest, wenn man unter einem Boykott eine bewußte Handlung verstand. Denn nichts wies darauf hin, daß Mortensen und sein Werk mit Absicht übersehen wurden. Wenn er bei den Kulturredaktionen anrief, um eine Stellungnahme einzufordern, spürte er geradezu das hilflose Achselzucken. Keine dieser Personen machte ihm die Freude zu erklären, nie und nimmer einen solchen Unfug wie Bruchlandung besprechen zu wollen. Nein, es war einfach so, daß absolut niemand seine Bücher je wahrgenommen hatte, niemand sich auch nur an einen einzigen Titel erinnern konnte. Oder auch nur daran, einen dieser von giftiger Farbe bestimmten Einbände in Händen gehalten zu haben.
Auch der Leiter des Kleinverlages, der die drei Bücher herausgegeben hatte, konnte sich das Fehlen jeglicher Reaktion nicht erklären. Andere Werke aus seinem Programm fanden immerhin die Aufmerksamkeit einiger Fachzeitschriften und stießen auf ein kleines, engagiertes Publikum. Mortensens Bücher jedoch gingen nicht bloß auf dem Weg in die Stuben der Kritiker verloren, sondern tauchten in so gut wie keinem Buchladen auf. Es war wie verhext. Und daß der Verleger nicht gleich nach dem Flop von Bruchlandung aufgegeben hatte, sondern auch noch Die Lust, ein Hemd zu bügeln sowie Unglück eines Lottospielers hatte drucken lassen, war einer Dickköpfigkeit zu verdanken, die dem Herausgeber selbst nicht ganz geheuer gewesen war. So, als habe er sich höchstpersönlich mit jenem Fluch anlegen wollen, welcher wie der Geruch alten Bratöls über dem Schriftsteller Moritz Mortensen zu liegen schien.
»So schlecht sind Ihre Bücher doch wirklich nicht«, hatte der Verleger nach dem unbemerkten Erscheinen der weichselroten Biographie eines Lottospielers gesagt. Eine Äußerung, die für Mortensen nicht wirklich ein Trost gewesen war und in der bereits das Ende gesteckt hatte, wie einer von diesen häßlichen Apfelflecken, die ja den meisten noch zu verspeisenden Äpfeln innewohnen. Ein viertes Buch würde es kaum geben. Nicht bei diesem Verleger, der ohnehin über Gebühr das Schicksal herausgefordert hatte. Unglück eines Lottospielers war der geeignete Abschluß dieser dreifüßigen Katastrophe gewesen.
Alles ging so überaus schnell. Anstatt seinen Schritt zu verlangsamen, trieb die Aufregung Mortensen gegen seinen Willen an. Es gelang ihm nur schwer, den lesenden Mann näher zu betrachten. Vor allem aber war er nicht in der Lage zu erkennen, in welchem Buch der Stuhldieb gerade las, da er es gegen die Kante des Tisches stützte, so daß bloß das obere Drittel des Umschlags schräg über die Tischfläche stand. Allerdings meinte Mortensen in der minimalen Spiegelung, die sich auf dem Tisch ergab, einen weichselroten Schimmer zu erkennen. Aber ganz sicher konnte er nicht sein. Zudem hielt er es für unwahrscheinlich, daß dieser Mann nicht bloß eines, sondern gleich zwei oder gar alle drei Mortensen-Bücher aus dem Regal gezogen hatte. Warum auch? Bei nur einem Buch, eben jenem zitronengelben, konnte ein Zufall angenommen werden. Schließlich gab es auch Bibliotheksbesucher, die recht planlos in die Bücherreihen griffen. Aber warum sollte jemand gleich alle drei Erscheinungen dieses einen Autors auswählen? Das wäre dann kaum noch als planlos zu bezeichnen gewesen.
Nachdem Mortensen an ihm vorbeigegangen war, bog er nach rechts ab, vollzog eine Kurve von hundertachtzig Grad und geriet hinter ein im Raum stehendes Regal. Durch den in Kopfhöhe befindlichen Spalt, der sich zwischen einem Fach und der darunter liegenden Buchreihe ergab (Ringelnatz bis Rosegger), konnte Mortensen nun den Stuhldieb beobachten, allerdings nur von schräg hinten. Mit der Seite seines Oberkörpers verdeckte der Mann das Exemplar, in dem er las. Er wirkte steif und verbissen. Und er wirkte leicht verzweifelt. Zumindest kam es Mortensen so vor, obwohl er den Gesichtsausdruck des Mannes gar nicht sehen konnte. Gut zu erkennen war hingegen auch von hier der zitronengelbe Einband von Bruchlandung. Und endlich besaß Mortensen die Ruhe, sich auf den darunterliegenden Band zu konzentrieren. Allerdings war dieser so plaziert, daß allein der Block der Seiten zu sehen war, nicht aber der Rücken. Und Mortensen somit nur etwas über die Dicke dieses Buches erfahren konnte. Eine grasgrüne Spiegelung ergab sich nicht.
Während Mortensen mit zusammengekniffenen Augen den Lesenden betrachtete, erinnerte er sich der Anstrengungen, die es gekostet hatte, bis man schließlich bereit gewesen war, seine drei Bücher in den Bestand dieser Bibliothek aufzunehmen. Denn natürlich waren die zuständigen Einkäufer nicht von selbst auf sein Werk gestoßen. Vielmehr war es notwendig gewesen, die Bibliothekare mit Telefonaten und Briefen zu traktieren. Mortensen hatte diese Leute geradezu weichgeklopft. So lange, bis sie wohl keinen anderen Ausweg mehr gesehen hatten, als die drei Bücher anzukaufen und in der Belletristik einzuquartieren. In etwa, wie man faule Früchte unter die frische Ware schmuggelt. Bloß um einen Dämon zu bannen.
Jedenfalls hatte sich endlich einmal Mortensens Aufdringlichkeit in Sachen des eigenes Werks gelohnt. Eine Aufdringlichkeit, die ihm selbst durchaus peinlich gewesen war. Aber er hatte sie als einen Teil seines schriftstellerischen Kampfes akzeptiert. Und ein jedes Mal, wenn er dieses Gebäude betrat, war es ihm eine Genugtuung, sich zumindest an diesem Bücherhort der Gegenwart seiner Romane sicher sein zu können. Wenn schon nicht der eines Lesers. Aber genau das schien sich an diesem Tag zu ändern.
Mortensen ging aus seiner Deckung heraus und den Weg wieder zurück. Als er an dem lesenden Mann vorbeikam, sah er über dessen Schulter in das offene Buch hinein. Die Größe und Art der Buchstaben sowie der schmale Balken zu Beginn einer jeden Seite waren Mortensen vertraut. Nach zwei weiteren Schritten drehte er sich rasch um. Zwischenzeitlich hatte der Stuhldieb das Buch leicht angehoben, so daß Mortensen jetzt deutlich die weichselrote, glänzende Färbung erkennen konnte. Es war fraglos seine zweite Veröffentlichung: Die Lust, ein Hemd zu bügeln. Der Roman, in den er seine größten, wildesten Hoffnungen gesetzt hatte.
Er konnte nicht länger den lesenden Mann beäugen, wollte er nicht auffallen. Und das war das letzte, was er vorhatte. Weshalb er seinen Schritt erneut aufnahm und erst in dem Moment einen beobachtenden Blick wagte, als er sich bereits auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes befand, zwischen Treppenhaus und Belletristik. Freilich war auf diese Entfernung nicht viel zu erkennen. In einem der umliegenden Regale jedoch – zwischen Morrison und Mulisch – mußte nun eine bedeutende Lücke klaffen, etwa so breit wie eine Doppelliterflasche Wein.
Mortensen sah, daß der Stuhldieb immer noch in seine Lektüre vertieft war, nun jedoch um einiges entspannter wirkte. Aber eine solche Interpretation war natürlich Unsinn. Und das wußte Mortensen. Er hatte sich endlich ein wenig beruhigt und versuchte die ganze Angelegenheit mit der nötigen Sachlichkeit zu betrachten. Wozu auch ein Gefühl des Stolzes gehörte. Stolz ob der simplen Tatsache, daß sich jemand für seine Romane interessierte. Etwas derartiges konnte passieren, sogar seinen Büchern. Wahrscheinlich gab es in einer öffentlichen Bibliothek wie dieser kein einziges Buch, welches nicht nach einiger Zeit gelesen, angelesen, zumindest berührt und betrachtet worden wäre.
Mortensen verließ den Raum und stieg die Treppen hinab ins nächste Stockwerk, wo er eine große Runde zog, vorbei an Sachbüchern.
Seine persönliche Einteilung des dreigeschossigen Gebäudes brachte es mit sich, daß er den großen mittleren Bereich als Grabstätte begriff, die das Zentrum der Welt bildete. Darüber lag die Literatur und darunter die Hölle. Mit Hölle war der Eingangsbereich gemeint, jenes mächtige Foyer, das die Tageszeitungen beherbergte. Während in einem Seitentrakt die Kinder- und Jugendbücher untergebracht waren. Nicht nur darum empfand Mortensen diesen Ort als die Hölle, sondern auch wegen der Nähe zum eigentlichen Leben, zur Außenwelt, die wohl am deutlichsten durch die Garderobe zum Ausdruck kam. Zumindest jetzt im Winter, wenn die Mäntel und Jacken wie abgestreifte Schutzanzüge von den Haken baumelten.
In diese ebenerdige Unterwelt tauchte Mortensen nun ein, griff nach einer Zeitung und ließ sich auf einem jener Stühle nieder, welche seitlich einer Längswand aufgereiht standen. Von hier aus hatte er die Treppe im Blick. Jetzt, kurz vor Schließung des Hauses, hatten sich drei Reihen mit Besuchern gebildet. Soweit Mortensen sehen konnte, war der Stuhldieb nicht unter ihnen. Möglich, daß er noch oben saß. Vielleicht aber hatte er längst das Gebäude verlassen. Wie auch immer, es brauchte Mortensen nicht zu kümmern. Weshalb er sich entspannte, die Zeitung auseinanderfaltete, Politik und Kultur nur kurz streifte, eigentlich mit Verachtung links liegen ließ, das Fernsehprogramm überflog und sich dann dem Sportteil zuwandte, der ihm als einziger wert schien, die Schlagzeilen zu durchbrechen und im Detail von Minuten und Metern die eine oder andere Erkenntnis zu finden.
Doch lange hielt dieser Zustand inneren Friedens nicht an. Denn als Mortensen über den Zeitungsrand hinweg zur Ausleihe sah, erkannte er am Ende der ersten Reihe die schlanke Gestalt des großgewachsenen jungen Mannes. Als er im Armwinkel des Mannes einen Stoß aus mehreren, höchstwahrscheinlich drei Büchern feststellte, wobei auch diesmal der zitronengelbe Einband von Bruchlandung herüberleuchtete, erschrak er wieder freudig. Minutenlang beobachtete Mortensen, wie der Mann näher zur Theke rückte, schließlich an die Reihe kam, den kleinen Stapel auf der Platte ablegte, einen Büchereiausweis aus der Brusttasche seines dunkelblauen Jacketts zog und nach einer Weile mit den Büchern hinüber zur Garderobe marschierte. In diese jedoch nicht gleich eintrat, sondern ebenfalls nach einer Zeitung griff, sich an einen Tisch setzte, die Bücher darauf deponierte und die Zeitung auf seinen übereinandergeschlagenen Beinen ausbreitete. Es handelte sich um die Süddeutsche Zeitung.
»Gott, dieses Revolverblatt«, dachte Mortensen, der aber so gut wie jede mit einem Feuilletonteil ausgestattete Zeitung für ein Revolverblatt hielt. Eine Ansicht, die er auch schon vertreten hatte, als noch keines seiner Bücher erschienen war, um dann von eben diesen Revolverblättern ignoriert zu werden. Das Revolverhafte bestand für ihn in der wortgewaltigen Schießwut der Journalisten, ihrer Selbstherrlichkeit, mit der sie über Gott und die Welt, den Sport und die Literatur herzogen und mit der sie sich selbst in Szene setzten. Ja, hinter der Schießwut der Journalisten verschwand das eigentliche Thema. Das Thema war wie die Zielscheibe, die – von unzähligen Projektilen durchlöchert – gar nicht mehr existierte, pulverisiert worden war oder bloß noch als unförmiger Fetzen herabhing. Im Journalismus löste sich alles und jedes auf. Fand Mortensen.
Was ihn in diesem Moment jedoch weit mehr interessierte, war die Frage nach dem dritten Buch. Es lag nun obenauf. Unverkennbar grasgrün. Aber natürlich gab es mehrere Werke der Literatur, deren Einbände grasgrün waren. Mortensen wollte völlig sicher gehen. Er hängte die Zeitung zurück auf die dafür vorgesehene Metallstange und schritt auf die Garderobe zu. Dabei kam er dem Fremden so nahe, daß er die Linie weißer Haut sehen konnte, die den seitlichen Scheitel bildete. Das nur nebenbei. Wesentlich war für Mortensen der Umstand, daß er nun sicher sein konnte, daß sich dieser Mann alle drei Bücher ausgeliehen hatte. Auf dem grasgrünen Einband war eine für Lottoziehungen typische Kugel zu sehen, welche die Zahl fünfundzwanzig trug. Wie auch im Falle der Kokosnuß von Bruchlandung war die obere Polkappe abgetrennt worden. Aus dem Inneren ragte – vom Scheitel bis zur Oberlippe – der Schädel eines Mannes, Mortensens Schädel. Um die Kugel und diesen Schädel waren in einem Kreisausschnitt die Buchstaben des Buchtitels gruppiert: Unglück eines Lottospielers.
Mortensen war für einen Augenblick stehengeblieben, um Haarscheitel, Buchdeckel und auch die Kulturseite der Süddeutschen Zeitung zu betrachten, dann hatte er seinen Weg zur Garderobe fortgesetzt. Er legte sich den dünnen Wollschal um, schlüpfte in seinen Mantel und trat aus dem Gebäude. Blieb dann aber unter dem massiven, von Säulen gestützten Vordach stehen und blickte über die stark befahrene Straße hinüber auf die von Lichtpunkten gegliederte nächtliche Innenstadt. Dabei dachte er: »Schön wie eine Schalttafel.«
Es hatte zu regnen begonnen. An den oberen Hängen der Stadt würde das Wasser wohl als kurzlebiger Schnee herunterkommen. Nicht aber hier unten im Kessel, wo der Winter sich nur selten als solcher gebärdete.
Um die Treppe zur U-Bahn zu erreichen, hätte sich Mortensen kaum mehr als zwanzig Meter im Freien bewegen müssen. Dennoch scheute er es, in den Regen zu treten. Er war ohne Schirm. Weshalb er sich jetzt gegen eine der Säulen lehnte, eine Zigarette anzündete und den stockenden Verkehr betrachtete, der den Platz vor der Bücherei kanalartig abgrenzte. Hinter sich spürte er die Personen, die in rascher Folge das Foyer verließen und über die beiden seitlichen, großzügig auskragenden Abgänge davoneilten. Als er eine weitere Zigarette anzündete war es eine halbe Minute vor sieben Uhr. Die letzten Besucher wurden aus dem Gebäude entlassen. Mortensen hatte sich – indem er kein einziges Mal nach hinten gesehen hatte – eine letzte Chance gegeben. Die Chance, diesen jungen Mann, diesen Leser seiner Bücher aus den Augen zu verlieren. Er rauchte seine Zigarette ohne Hast zu Ende und schnippte den bereits angekohlten Filter in die Luft. Noch bevor die Hülse gelandet war, hatte Mortensen sie aus dem Blick verloren. Dann machte er sich auf den Weg, durchaus zufrieden damit, eine Peinlichkeit vermieden zu haben.
»Bücher werden gelesen«, sagte er sich. »Daran ist nichts Erstaunliches. Und schon gar nicht etwas Unheimliches.«
Aquariumspflege
Das Aquarium ist Welt.
(Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen, Konrad Lorenz)
Auf dem Bahnsteig herrschte großes Gedränge. Dennoch erkannte Mortensen auf einer der Bänke eine schmale Lücke. Die beiden Frauen, zwischen die er seinen Körper preßte, betrachteten ihn widerwillig. Sein eigener Widerwille war kaum geringer, aber es war nun mal so, daß er die Beengtheit im Sitzen jener im Stehen vorzog.
Seit einigen Wochen registrierte er einen Schmerz in seinen Beinen. Einen Schmerz, vergleichbar einem Geräusch, das völlig undefinierbar bleibt. Das so wenig zunimmt, wie es abklingt. Ein Klopfen an der Wand, wobei nicht genau zu sagen war, gegen welche Wand eigentlich geklopft wurde. Ein Schmerz ohne Geographie, sieht man davon ab, daß mit Sicherheit die Beine bis hin zu den Hüften betroffen waren. Dabei hätte Mortensen nicht einmal zu sagen gewußt, ob es sich um einen wandernden Schmerz handelte und ob wirklich beide Beine gleichzeitig betroffen waren. In jedem Fall wäre es sinnvoll gewesen, einen Arzt zu konsultieren. Bei einem Sechsundvierzigjährigen, der sein Leben zur Hauptsache dem Verschleiß gewidmet hatte, war ein gleichbleibender Beinschmerz wohl kaum geeignet, um in Büchereien und auf den Bänken der Stadtbahn ausgesessen zu werden.
Doch Mortensen gehörte zu den Menschen, die in einem jeden Arzt einen Handlanger des Todes sahen. Da er aber andererseits auch nicht zum Privatgelehrten in Sachen des eigenen Körpers geworden war und die alternative Medizin bloß als verschämte Version der üblichen Handlangerdienste verstand, war ihm nichts anderes übrig geblieben, als Probleme mit dem eigenen Körper zu ignorieren oder eben auf Zeit zu setzen. Eine Strategie, die bisher gar nicht so schlecht funktioniert hatte.
Freilich meinten viele von Mortensens Bekannten und Freunden, Mortensen würde seine Nachlässigkeit noch bereuen und demnächst halbtot, in jedem Fall recht willenlos auf dem Operationstisch eines der von ihm so gefürchteten Zuarbeiter des apokalyptischen Reiters landen.
Mortensen hingegen war fest entschlossen, niemals lebend zwischen die Finger eines Mediziners zu gelangen. Und wie sagte einer seiner Freunde, der sich als Chirurg verdingte: »Die Freude können wir dir machen.«
Dabei war nicht die Rede davon, daß es Mortensen am nötigen Geld oder einer Krankenversicherung gemangelt hätte. Obzwar nicht eigentlich vermögend, verfügte er durchaus über eine finanzielle Sicherheit. Seine Frau, die Anfang der Neunzigerjahre bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen war, hatte ihm zwei Grundstücke hinterlassen, welche sich zunächst als reine Belastung, dann aber – im Zuge eines städteplanerischen Meinungswechsels – als nachgerade bedeutsam herausgestellt hatten.
Mortensen war nicht ungeschickt vorgegangen, hatte sich ein wenig geziert, dann jedoch die beiden Liegenschaften zu einem Preis veräußert, der bis dahin abseits seiner Zukunftsträume gelegen hatte. Für ihn war die Rechnung eine simple gewesen. Würde er weiterhin das ihm vertraute durchschnittliche Leben führen, die Zwei-Zimmer-Wohnung nahe dem Südheimer Platz behalten und sich auch sonst zu keinen Prassereien versteigen, so wäre er in der Lage, bis an sein von ihm selbst prognostiziertes Lebensende in den Jahren 2020 bis 2025 ein sorgenfreies, allein der Schriftstellerei gewidmetes Dasein zu führen. Den ebenso durchschnittlichen Fortlauf der gesamten Gesellschaft vorausgesetzt. (Daß er sich jedoch an die Ausschließlichkeit der Romanherstellung nicht ganz hielt, davon wird noch die Rede sein.)
Auch wenn es hart klingt: Der Tod seiner Frau hatte sein eigentliches Schriftstellerleben begründet. Denn bis zu diesem Moment war ihm weder die Zeit noch die Kraft zur Verfügung gestanden, um über einige Kurzgeschichten hinauszufinden. Doch mit dem Tod Paulas und in der Folge mit dem Grundstücksverkauf hatte sich Mortensen geradezu gezwungen gesehen, in das Romanschreiben und in die Ganztagskunst hinüberzugleiten. Nicht, um irgend etwas zu bewältigen. Sondern da ihm jede andere Entscheidung als eine Ignoranz gegenüber dem Schicksal erschienen wäre. Eine Sichtweise, die allerdings auch dazu führte, daß ihm hin und wieder der Gedanke kam, er hätte dieses Schicksal unbewußt herbeigewünscht. Nicht, daß er etwas für den Tod seiner Frau konnte. Weder hatte er den Absturz einer Boeing 767-300 verschuldet, noch war er mit Absicht zwei Tage vor dem Abflug erkrankt, so daß eine Freundin Paulas seinen Platz eingenommen und die Reise nach Thailand angetreten hatte, um dann bei ihrem Rückflug Opfer der Katastrophe zu werden. Richtig ist allerdings, daß Mortensens Krankheit eine eingebildete gewesen war und die angebliche Darmgrippe sich in dem Moment rapide in Luft aufgelöst hatte, da die Freundin, eine gewisse Elda Kull, sich bereit erklärte, einzuspringen. Weshalb Moritz an diesem letzten Tag, den er mit seiner Frau zusammen gewesen war, ein Weiterbestehen der Krankheit vorgetäuscht und ein ganz abscheuliches Darmgrippentheater zum besten gegeben hatte.
Noch heute fragte er sich, ob er nicht doch das Unglück vorausgesehen hatte, ob also die imaginäre Infektion weniger als ein Ausdruck seiner latenten Flugangst gelten mußte denn als eine Folge seiner seherischen Fähigkeiten. Wobei Mortensen mit okkulten Praktiken oder einer esoterischen Weltsicht so gut wie nichts am Hut hatte. Trotzdem quälte ihn der Verdacht, daß er sich selbst gerettet, jedoch Paula in den Tod habe gehen lassen. Wie auch Frau Kull. So gesehen war er der Mörder Frau Kulls. Zu alldem gehörte dann auch freilich die unglaubliche Annahme, er hätte zu diesem Zeitpunkt die Wertsteigerung der beiden bis dahin belanglosen Liegenschaften geahnt.
Mortensen hielt eine solche Deutung für absurd, eigentlich krankhaft. Konnte aber nicht anders, als sich immer wieder vorzustellen, daß sein Überleben kein Zufall gewesen war. So wenig wie der Tod seiner Frau. Dabei hatte er Paula geliebt, auch im letzten gemeinsamen Jahr, dem achten ihrer Ehe. Aber was heißt das schon? So groß die Zuneigung zu Paula sich auch dargestellt haben mochte, seine Liebe zur Schriftstellerei war um nichts geringer gewesen. Besser gesagt: das Verliebtsein in die Vorstellung von einer Existenz, in der die Arbeit an einem Roman dem eigenen Leben eine romanhafte Würde verleihen könnte. – Menschen lieben Menschen, sagte Mortensen. Und sie lieben Kakteen und Zierfische und Erstausgaben und einen Schrank voll von Schuhen. Unentwegt wird eine Liebe um einer anderen willen verraten. Der Begriff ist nichts wert. Jeder Mensch liebt tausend Sachen, eben, weil er so voll von Liebe ist. Er geht geradezu über davon. Darum schluchzen und heulen die Leute ja angesichts diverser Filmszenen. Ihre Rührung ist Ausdruck eines Potentials an Liebe, welches sie kaum noch auf eine vernünftige Weise loszuwerden verstehen.
So sehr er seine Liebe zu Paula zu relativieren versuchte, muß gesagt werden, daß Mortensen das Leben eines treuen Witwers führte, also nie versucht hatte, sich nach einer neuen Partnerin umzusehen. Auch nicht nach einer Bettgeschichte, wofür ihm ohnehin das Format oder was auch immer fehlte. Er pflegte Paulas Grab mit Hingabe, jedoch geringem Geschick. Er konnte es selbst sehen. Die eingesetzten Blumen wollten nicht so richtig gedeihen. Aber sein Bemühen war offensichtlich und wurde von den benachbarten Grabbesuchern mit Wohlwollen registriert.
Man hielt Mortensen für eine tragische Figur. Nicht ganz zu Unrecht. Seine Treue zu der Verstorbenen beruhte viel weniger auf einem Gefühl der Zärtlichkeit oder des Nichtvergessenkönnens als auf dem Umstand ewiger Verzahnung. Eine Verzahnung, die eben deshalb ewig anmutete, da sich Mortensen mittels der Einbildung einer Darmgrippe dem gemeinsamen Tod entzogen hatte. Allerdings war er auch nicht wirklich unglücklich ob dieses Gebundenseins an seinen Witwerstatus. Solcherart ersparte er sich die üblichen Mühen eines alleinstehenden Mannes seines Alters. Sein Umfeld schätzte seine Gattentreue hoch ein, Männer wie Frauen. Für einige Damen besaß diese über den Tod hinausgehende, ja eigentlich durch den Tod gefestigte Loyalität sogar einen massiven erotischen Reiz. Man kann durchaus sagen, daß der wenig attraktive Moritz Mortensen ein begehrter Mann war. Und dies sicher nicht wegen seiner literarischen Tätigkeit, die auch im engsten Freundeskreis fast völlig unbemerkt blieb.
Einen Moment war er eingenickt, ein paar Sekunden oder auch Minuten. Die Lautsprecherstimme holte ihn zurück auf den Bahnsteig, der jetzt schwarz von Menschen war. Wegen eines »Personenschadens« müsse mit größeren Verspätungen gerechnet werden.
»Ist also wieder einer gesprungen«, dachte Mortensen wehmütig. Und wie die meisten anderen auch, die hier standen oder saßen, kam er ins Grübeln. Nicht, daß er ernsthaft an Selbstmord dachte. Aber groß war die Verführung schon. Allerdings nicht minder groß der Aufwand, den das Abfeuern einer Pistolenkugel bedeutete, die Einnahme ausreichend vieler Tabletten oder etwa das Steuern des Wagens gegen ein wirklich robustes Objekt der Natur. Dies alles bedingte Vorbereitungen und Anlaufzeiten, die dazu angetan waren, von der Lebensmüdigkeit in eine Suizidmüdigkeit zu verfallen und zu erkennen, daß es wahrscheinlich leichter war, weiterzuleben als sich umzubringen. Der Sprung auf die Gleise jedoch war – zumindest für die Person, die sprang – herrlich unkompliziert. Nicht gerade sauber, aber einfach und sicher. Und die ganze Schweinerei, die dabei entstand und die ja irgend jemand wegzuschaffen hatte, nur für jenen potentiellen Selbstmörder ein Problem, der sowohl in sozialen als auch in postumen Kategorien dachte.
Mortensens Wehmut war rasch verflogen. Stattdessen erfüllte ihn nun Ärger: So ein Selbstmord stelle ja im Grunde eine Frechheit dar. Was wäre gewesen, hätten es sich alle, die des Lebens überdrüssig waren, so einfach gemacht? Hätte ein jeder dem Bedürfnis nachgegeben, mit einem einzigen Schritt einen Fluß zu überqueren, in dem die anderen erbärmlich absoffen? Nein, es störte ihn keineswegs, wenn jemand Hand an sich legte, vorausgesetzt, daß der Betreffende sich dabei auch wirklich der eigenen Hand bediente. Aber jemand, der vor die Bahn sprang und damit eine ganze Strecke der Stuttgarter Stadtbahn lahmlegte, kam Mortensen wie einer von diesen Fettsäcken vor, die nicht mittels quälenden Sports oder quälender Diäten abzunehmen versuchten, sondern sich das Fett absaugen ließen. Ja, das war der Vergleich, den er für passend hielt.
Zwanzig Minuten später fuhr der erste Zug in die Station ein. Was aber kaum zu einer Lockerung der kompakten Menschenmasse führte, da sich bereits zu viele Fahrgäste in den Waggons befanden. Bei alldem blieben die Leute erstaunlich gelassen. Kein Fluch war zu hören. Bloß eine leichte Unruhe beherrschte den Menschenschwarm. Eine summende Woge.
Es brauchte noch zwei, drei weitere Züge, bevor eine sicht- und spürbare Erleichterung eintrat und Mortensen es an der Zeit fand, sich zu erheben. Als wären sie zwischenzeitlich an ihm festgewachsen, standen auch die beiden Frauen auf, um sich den auseinandergleitenden Türen zu nähern. Doch mit einem Mal stoppte Mortensen seinen Schritt. Die Frauen lösten sich gleich Raumkapseln von seinen Flanken und zogen in die gelbe Hülle des Waggons ein.
Mortensen war stehengeblieben, da er auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig – durch die offene Tür und die dahinter befindliche Scheibe des Stadtbahnwagens hindurch – die schlanke, großgewachsene Gestalt des jungen Mannes erkannt hatte, welcher jetzt eine schwarze Tasche trug. Trotz der Kälte, die sich hier unten erheblicher ausnahm als an der Oberfläche, hatte er seinen Regenmantel über den Arm geworfen. Er wirkte nun ein wenig blasiert, nicht gerade wie ein Dandy, aber doch wie jemand, der in der Regel die stallartige Atmosphäre öffentlicher Verkehrsmitteln mied. Und auch bereute, sich wieder einmal darauf eingelassen zu haben.
Da die Verzögerungen für beide Fahrtrichtungen galten, ging Mortensen davon aus, daß auch der andere –den er jetzt bei sich, des Anzugs wegen, den »Dunkelblauen« nannte – auf einer Bank gesessen hatte, zumindest in den hinteren Reihen verblieben war, um erst im Moment der Normalisierung nach vorn zu treten.
»Na und?« sagte sich Mortensen. »Was ist schon dran? Ich fahre nach Hause. Er fährt nach Hause. Ein Autor und sein Leser. Noch dazu bewegen wir uns in zwei verschiedene Richtungen. Ein Abschied für immer. Davon darf man wohl ausgehen.«
Doch so sehr Mortensen in Gedanken das nochmalige Auftreten des Dunkelblauen zu bagatellisieren versuchte, unterließ er es, das einzig Vernünftige zu tun, nämlich endlich in seinen Zug einzusteigen. Erst als dieser bereits abfuhr, registrierte Mortensen sein Scheitern. Ihm wurde klar, daß mit dieser Bahn auch die Möglichkeit abgefahren war, sich einer Versuchung zu entziehen. Vorbei! Er gab seinem Drang nach, verließ den Bahnsteig und fuhr die Rolltreppe nach oben. Mit einem Mal erfüllte ihn die Angst, er könnte den anderen verlieren. Rasch stieg er die fahrenden Stufen aufwärts. Oben angekommen, verfiel er in einen Laufschritt, begann schließlich zu rennen, sprang die Treppen abwärts und erreichte in dem Augenblick den Bahnsteig, als der andere in das Innere eines eben eingefahrenen Zuges trat. Es gelang Mortensen nicht mehr, in denselben Wagen einzusteigen. Er sprang in den dahinterliegenden, um sich in den vorderen Abschnitt zu begeben, wo er sich in den Gang stellte und durch die beiden Sichtscheiben zu dem Mann stierte, den er verfolgte. Auch der Dunkelblaue verzichtete darauf, sich zu setzen, lehnte stattdessen gegen eine Stange und zog eines der Bücher, diesmal das grasgrüne, aus der Tasche. Er begann nicht wirklich die Geschichte zu lesen, sondern blätterte herum, schien sich für einzelne Zeilen oder Kapitelüberschriften zu interessieren und studierte dann den biographischen Vermerk auf der Umschlagklappe: Moritz Mortensen, geboren am 2.5.1955 in Reckholder nahe Chicago, aufgewachsen in Westberlin und im vorarlbergischen Dalaas, lebt seit zwanzig Jahren in Stuttgart. War in verschiedenen Berufen tätig, als Kranführer, Gymnastiklehrer, Altenbetreuer und Mitglied der Rockgruppe »Treibende Knospen weinen nicht«. Eigentlich gelernter Dachdecker, einen Beruf, den er wegen seiner Höhenangst nie ausübte.
Die Sache mit der Höhenangst war schlichtweg gelogen. Was einem konzentrierten Leser auch sofort auffallen mußte. Zwar war es durchaus denkbar, daß ein Jugendlicher von seinen Eltern in eine Dachdeckerlehre gezwungen wurde, um dann den Rest seines Lebens jeglicher Tätigkeit in höher gelegenen Regionen auszuweichen. Dann aber konnte es wohl nicht stimmen, daß so jemand einen Job als Kranführer annahm. Die Erwähnung der Kranführerstelle war eine Peinlichkeit sondergleichen, die dem Lektor ins Auge hätte springen müssen. Was aber nicht geschehen war. Mortensen selbst hatte sich seinem Verleger gegenüber nie dazu geäußert, was denn der Widerspruch zwischen Höhenangst und Kranführertum zu bedeuten habe. Wie auch hätte er diese Unwahrheit, dieses grobe Spiel mit einer an Hitchcock gemahnenden Phobie erklären können? Seine Entscheidung, nach Beendigung seiner Lehre nie wieder auf ein Dach zu steigen, war gegen seinen Vater, nicht aber gegen die luftige Höhe gerichtet gewesen.
Eine weitere Unredlichkeit bestand darin, daß jener Beruf unerwähnt blieb, in dem Mortensen die längste Zeit seines Lebens tätig gewesen war. Beinahe zehn Jahre hatte er als ehrgeizloser Büroangestellter verbracht, während hingegen sein Job als Gymnastiklehrer in die Zeit nach Beendigung der Dachdekkerlehre fiel und nur wenige Wochen gedauert hatte. Aber selbst »Altenpfleger« hörte sich noch besser an als »Büroangestellter«. Gerade so, als reiften in den Etagen der subalternen Schreibtischarbeiter immer nur Herzinfarktkandidaten und Langeweiler heran, niemals aber Menschen, die sich auf eine scheinbar rücksichtslose Weise der Sprache bedienten. Vergleichbar den Züchtern ominöser Schoßhündchen und fleischfressender Pflanzen.
Auch, daß er in der Nähe von Chicago das Licht der Welt erblickt hatte, klang spannender, als es war. Seine aus Norwegen stammenden Eltern waren Anfang der fünfziger Jahre ausgewandert und hatten in Reckholder einen kleinen Blumenladen eröffnet. Sie waren jedoch mit dem amerikanischen Lebensstil nicht wirklich zurechtgekommen und bald nach der Geburt des Sohnes zurück nach Europa gegangen.
Aber in ihre alte Heimat wollten beide nicht. Das ging so weit, daß keiner von ihnen je norwegisch sprach. In Westberlin, wo Frau Mortensen als Haushaltshilfe einer Diplomatenfamilie arbeitete, besuchte Moritz die Schule. Vater Mortensen, eigentlich Biologe, trieb sich in den Hinterzimmern einschlägiger Lokale herum und erlernte die nehmende und gebende Fertigkeit diverser Glücksspiele. Sein Haß gegen alles Studierte, gegen den akademischen Menschen als parasitäre Erscheinung, nahm immer fanatischere Formen an. Dabei wurde er in keiner Weise von einer ideologischen Haltung angetrieben. Zumindest keiner offiziellen. Er hielt alles Politische für überflüssig, nämlich für eine Erfindung von Akademikern, die seit jeher versuchten, ihre sogenannte Gelehrtheit als reines Kriegswerkzeug zu gebrauchen, um die Nichtgelehrten in Schach zu halten. Seinen eigenen Ausflug in die Biologie betrachtete er als die bitterste Lehre seines Lebens. Biologen seien echte Schweine, Verfälscher der Wirklichkeit, die allesamt von einem religiösen Komplex geleitet würden. Und deren persönliche Krise also das allgemeine Weltbild bestimme, gerade so, als würden ein paar Zwerge mit schlechten Zähnen alles und jeden auf schlechte Zähne reduzieren.
Weshalb er zur Überzeugung gekommen war, allein mittels Glücksspielen ein anständiges Leben führen zu können, einerseits wegen des illegalen Charakters, andererseits weil das Spiel selbst außerhalb einer politischen Ordnung stand. Da nun aber auch in der Berliner Unterwelt durchaus Regeln existierten, geriet der Freigeist Mortensen – der so frei war, falsch zu spielen – in bedeutende Bedrängnis. Es blieb ihm nichts anders übrig, als mit seiner Familie aus Westberlin zu flüchten. Diese Flucht war wie ein beliebig in die Luft geworfener Ball, der dann ausgerechnet auf jenem geographischen Punkt landete, den das vorarlbergische Dalaas ausfüllte. Frau Mortensen – eine Person von großer Geduld und nicht unerheblicher Schönheit – wurde Sekretärin am Pfarramt und ehrenamtliche Mitarbeiterin des Bürgermeisters in Fragen der Brauchtumspflege. Sie entwickelte sich rasch zum gern gesehenen Gast diverser gesellschaftlicher Anlässe und galt allgemein als der gute Geist zwischen Kirche und Politik, als eine ganz und gar menschlichweibliche Idealbesetzung.
Währenddessen trat ihr Gatte etwas kürzer und lenkte sein Falschspiel in moderatere Bahnen. Zudem war man in Dalaas zu dieser Zeit erstaunlich tolerant. Weder stieß man sich daran, daß die Brauchtumspflege ausgerechnet in den Händen einer Norwegerin lag, noch meinte man, der geplagten Frau Mortensen die nicht ganz sittlichen Aktivitäten ihres Mannes vorwerfen zu müssen.
Dessen Entscheidung, seinen Sohn Moritz bei einem der hiesigen Dachdeckermeister in die Lehre zu schicken, war natürlich eine, die sich vor allem gegen die Möglichkeit richtete, der Sohn könnte langfristig mit einer akademischen Karriere liebäugeln. Offensichtlich glaubte Peter Mortensen, daß gerade die schwindelerregende Dachdeckerei eine aseptische Wirkung in bezug auf den Drang nach universitärer Bildung besaß. Nun, der gute Mann war sicher nicht ganz normal. Was seine Frau besser zu ertragen schien als sein Sohn. Welcher übrigens nie wieder nach Chicago kam.
Nach abgeschlossener Lehre ging Moritz nach Dornbirn, fort von den Eltern und der Dachdeckerei, arbeitete sich stückchenweise nordwärts, zog nach Bregenz, wechselte ein Jahr später nach Deutschland, lebte in Konstanz, später in Rottweil und blieb schließlich wie ein erlahmter Handlungsreisender in Stuttgart hängen. Ohne große Begeisterung für diese Stadt, aber eben doch zu müde, um sich noch einmal aufzumachen.
Selbst der Hinweis in seiner Vita, Mitglied einer Rockband gewesen zu sein, war nicht wirklich korrekt. Zwar hatte Mitte der Achtzigerjahre tatsächlich eine Gruppe namens Treibende Knospen weinen nicht existiert, welche Texte der deutschen Romantik mit einem schwermetallischen Sound verbunden hatte, aber eben ohne Beteiligung Moritz Mortensens. Er war bloß mit der Leadsängerin liiert gewesen und hatte aus rein stilistischen Gründen auf dem Coverfoto einer LP posiert. Mit der Musik selbst hatte er absolut nichts zu tun gehabt und selbige auch für schwachsinnig gehalten. Dennoch fand er es eineinhalb Jahrzehnte später – die »Knospen« waren längst im Eis eines überraschenden Winters zu Grunde gegangen – für opportun, seiner Biographie eine wilde musikalische Vergangenheit anzudichten.
War Moritz Mortensen ein Lügner? Nun, so konnte man das eigentlich nicht sagen. Er tat das, was die meisten Menschen taten, die angesichts eines wenig bedeutsamen Lebens das Gegebene mit leichter Übertreibung zu dramatisieren versuchten. Wer konnte oder wollte darauf verzichten? Wer machte nicht aus zwei Überstunden drei? Wer unterließ es, eine konventionelle Sauferei zu einem ultimativen Besäufnis umzudeuten? Wer versuchte nicht, den üblichen Unbill einer Urlaubsreise als abenteuerlichen Ritt durch die Fremde zu verkaufen? Wer erzählte nicht überall herum, einmal in einer Rockband gespielt zu haben? Wer hätte nicht aus dem Umstand, vor Jahren Gregory Peck im Flugzeug erkannt zu haben, eine kleine charmante Geschichte gedeichselt? Natürlich würde kaum jemand auf die Idee kommen, eine solch zufällige Begegnung einfach zu erfinden, aber wenn sie nun tatsächlich passierte, war es nur normal, ein wenig mehr daraus zu machen. Würde der Mensch die Fakten seines Lebens nicht ornamentieren, konturieren oder kolorieren, wären die meisten Gespräche eine traurige Angelegenheit. Und daß allein die reine, ungeschmückte Darstellung von Geschehnissen der Wahrheit dienlich sei, darf ebenfalls bezweifelt werden.
Der Dunkelblaue klappte das Buch zusammen, steckte es zurück in seine schwarze, flache Ledertasche und stieg aus dem Waggon. Da die Stadtbahn inzwischen den Untergrund verlassen hatte, blieb er zunächst unter dem Dach der Haltestelle, schlüpfte in seinen Mantel und holte einen Knirps aus seiner Tasche, den er ohne Umstände entfaltete. Dann ging er in Fahrtrichtung der davonbrausenden Stadtbahn los.
Der Regen war heftiger geworden, wirkte auf eine trommelnde Weise sommerlich, wie die Entladung eines Gewitters. Tatsächlich meinte Mortensen, der dem Dunkelblauen nun durch den Schauer folgte, einen Donner vernommen zu haben. Mit einem Finger mimte er die Bewegung eines Scheibenwischers, um das Glas seiner Brille einigermaßen freizubekommen. Er verteufelte den Umstand, so ganz ohne Schirm und Verstand durch den Regen zu marschieren, hinter dem anderen her, der nicht nur der Witterung gemäß ausgerüstet war, sondern wohl auch wußte, warum er sich hier und nicht woanders befand. Mortensen hingegen wußte es nicht. Und während er jetzt spürte, wie die Nässe zwischen Kragen und Hals eindrang, dachte er daran, daß es eigentlich schicklich gewesen wäre, wenn der Leser dem Autor hinterherläuft und nicht umgekehrt. Es waren naturgemäß immer die Leser, die für einen bestimmten Autor schwärmten und manchmal ihre Schwärmerei zu einer obsessiven Belästigung steigerten, Telefon- und Postkartenterror betrieben, ihren Idolen bei Lesungen auflauerten oder ungesetzliche Manöver unternahmen, um an Kleidungsstücke oder andere Devotionalien zu gelangen. Und die im Extremfall ein paar ekelhafte Dinge taten, um den angehimmelten Buchautor auf sich aufmerksam zu machen. Doch in diesem Fall war die Welt eine verkehrte. Der Schriftsteller verfolgte seinen Leser. Seinen vielleicht einzigen. Das mochte bitter sein. War es auch.
Die ihn umgebende Feuchtigkeit puppte Mortensen geradezu ein. Aber er gab nicht auf. Sah jetzt, wie der Dunkelblaue durch eine Metalltür in ein Lokal trat. Über der breiten Fensterfront prangte ein roter Schriftzug aus Neonröhren, der im Regen undeutlich blieb, wie zerschnitten. Mortensen schob seine Brille vom Gesicht, um mit zusammengekniffenen Augen den Namen zu entziffern: Tilanders Bar. Eine Weile noch stand er unschlüssig davor, dann trat er ein.
Gleich neben dem Eingang befand sich eine Garderobe, an die er seinen Mantel hinhängte. Eine Alge von einem Mantel. Aber auch ohne Mantel tropfte Mortensen, als sei er Teil einer Schneeschmelze, weshalb er sich beeilte, auf die Toilette zu gelangen.
Seine regennasse Brille hatte er in der Innentasche des Sakkos untergebracht. Wo er sie auch bleiben ließ. Er ging einfach los, nicht wirklich blind, nicht wirklich sehend, bewegte sich auf den hinteren Teil des Raums zu und schlüpfte durch einen schmalen Durchgang. Ohne auf ein Schild zu achten, drückte er eine Türklinke. Ob Glück oder sechster Sinn, auf jeden Fall landete er dort, wo er hingehörte, stand jetzt vor einem modischen Waschbecken aus Stahl und Design, über dem sich ein rahmenloser Spiegel bis zur Decke streckte. Mortensen öffnete die oberen Knöpfe seines Hemds, wusch sich das Gesicht mit warmem Wasser und zog mehrere Papiertücher aus einem dieser futternapfartigen Behälter, um Kopf, Nacken und Brust zu trocknen. Schließlich war die Brille an der Reihe, die – nachdem er sie wieder aufgesetzt hatte – für einen Moment an den Rändern anlief. Mit den beiden Krallen seiner zehn Finger kämmte Mortensen sein Haar nach hinten. Dann lehnte er sich mit seinem Hinterteil gegen einen Heizkörper und tat gar nichts. Erst als jemand eintrat, löste sich Mortensen aus dem aufsteigenden Dampf des eigenen Körpers und ging nach draußen.
Der Hauptraum zeichnete sich durch eine kühle Eleganz aus, die im Rahmen des Gemütlichen blieb. Was vor allem für die kompakten Stühle aus hellem Leder galt, in denen die Gäste nicht bloß hübsch, sondern auch friedfertig aussahen. Erst jetzt fiel Mortensen auf, daß die langgestreckte, von zwei Pfeilern unterbrochene Auslagenseite aus Scheiben bestand, die sich abwechselnd aus Fenster- und Milchglas zusammensetzten. Ein Prinzip, das an den Wänden des Raums fortgesetzt wurde, nur daß hier die alternierenden Balken in einmal glattem und dann wieder angerauhtem Spiegelglas geordnet waren. Weshalb man an diesem Ort ein Gefühl permanenter Gebrochenheit entwikkelte. Was allerdings nicht für den Bereich der Bar galt, die völlig ohne Streifen auskam.
Gegen die Theke eben dieser Bar gelehnt, stand der Dunkelblaue und unterhielt sich mit einem Mann, der zwar einen silbergrauen Anzug trug, aber die gleiche dunkelblaue Ausstrahlung besaß. Die beiden paßten gut ins Ambiente, fand Mortensen, der sich selbst für deplaziert hielt und aufzufallen meinte. Was nicht der Fall war. Tilanders Bar mochte schick anmuten, die Gäste brauchten es nicht zu sein. Mortensen hätte schon Radau schlagen müssen, um sich Aversion und Ablehnung einzuhandeln. Nun, das war das letzte, was er vorhatte.
Er stellte sich in einigen Metern Entfernung zum Dunkelblauen und seinem silbergrauen Freund an den Tresen und drückte sich eine Zigarette zwischen die Lippen. Der aufmerksame Barkeeper hielt ihm die Flamme eines Feuerzeugs entgegen. Mortensen sog einen ersten Schwall Rauch ein, den er tief inhalierte, einen Moment wie eine steckengebliebene Münze stehenließ, um ihn sodann wieder aus sich herauszublasen. Er dankte dem Mann hinter der Theke und bestellte ein Glas Aquavit. Eigentlich hätte er lieber ein Bier gehabt, meinte aber, es würde besser aussehen, ein kleingläsriges Getränk zu nehmen. Warum das denn nun? Der Dunkelblaue hatte auf jeden Fall sein Bier.
Und der Dunkelblaue schien auch seinen Spaß zu haben. Sein Lachen war auffälliger als der Rest an ihm. Es war eigentlich das Lachen eines viel älteren Mannes. Vielleicht, weil seine Lustigkeit wie die Reaktion auf einen von diesen derben Witzen klang, wie sie beinahe nur von Männern geschätzt werden, die jegliche Jugend hinter sich haben. Witze sind etwas für Kinder und ältere Männer. Auch Mortensen hatte in den letzten Jahren begonnen, sich Witze zunächst anzuhören, dann sie sich zu merken und schließlich – zu allem Überfluß – sie auch noch vorzutragen. Er haßte das, verachtete weniger den Witz als die überfallsartige Penetranz des Witzeerzählens. Aber er konnte nichts dagegen tun. Die Witze bemächtigten sich seiner. Sie waren gekommen wie die Schmerzen in seinen Beinen.
Er redete sich nun ein, daß die beträchtliche Amüsiertheit des Dunkelblauen darin begründet lag, daß dieser gerade von den drei Büchern erzählte, die er einer reinen Juxerei halber eingesteckt habe. Der kuriosen Einbände wegen. Oder auf Grund des Höhenangst-Kranführer-Widerspruchs. Oder auch nur, um einige der mißglücktesten Formulierungen herauszusuchen und in eine Sammlung sprachlichen Unfugs aufzunehmen.
Darin bestand Mortensens Angst, die er auch bestätigt haben wollte. Er rückte ein weniger näher heran. Allerdings befanden sich zwischen ihm und dem Dunkelblauen weitere Gäste, einmal der Silbergraue, und dann auch noch zwei Frauen, die sich unterhielten. Als diese aber in ein kurzes Schweigen verfielen, konnte Mortensen die Stimme des Dunkelblauen klar vernehmen, welcher zwar nicht mehr lachte, sich aber noch immer im Zustand der Belustigung befand. Mortensen erfuhr nun, daß die Heiterkeit des Dunkelblauen der Dummheit eines Arbeitskollegen galt, der sich an die falsche Frau herangemacht hatte. An die Frau eines Vorgesetzten. Oder die Frau eines Geschäftsfreundes. Etwas in dieser Art also. Kein Witz, bloß eine Alltagsschnurre, über die man lachen konnte, wenn man sonst nichts zu lachen hatte und die beteiligten Personen kannte. Auf jeden Fall war keine Rede von Büchern. Schon gar nicht fiel der Name Mortensen.
Er war erleichtert, aber auch irgendwie enttäuscht. Das war überhaupt seine häufigste Befindlichkeit, jene des Hin- und Hergerissenseins. Er nannte das gerne: Zufriedenheit, von Kummer durchlöchert.
Er bestellte einen zweiten Aquavit. Und endlich auch ein Glas Bier. Der Barkeeper nickte wie über eine weise Entscheidung.
Nachdem die beiden Frauen das Lokal verlassen hatten, war Mortensen auf einen der freigewordenen Barhocker gerutscht und ein knappes Stück an den Dunkelblauen und seinen Freund herangerückt. Ohne daß dies bemerkt worden wäre. Es kümmerte sich niemand um ihn.
Mortensen sah jetzt praktisch in den Rücken des Silbergrauen hinein, dessen Stimme einen weichen, milden Klang besaß. Auch wenn er wohl alles andere als ein milder Typ war. Eher einer von denen, die es verstanden, ihre Mitmenschen mit einem treuherzigen Gesichtsausdruck zur Sau zu machen. Er sprach mit gespielter Ernsthaftigkeit: »Weißt du, Thomas, wir sollten mit Kollegen Nanz nicht zu hart ins Gericht gehen. Er mag eine jämmerliche Kröte sein, aber wer in diesem Unternehmen ist das nicht? Uns beide einmal ausgenommen. Nanz hat unwissentlich die Herzensdame des Chefs bestiegen, und jetzt geht ihm die Muffe eins zu tausend. Das ist ein Fehler. Ich meine, daß ihm die Muffe geht, ist ein Fehler. Daß er auf seinen kleinen Knien herumwetzt und um Vergebung bettelt. Wem sollte das nützen? Ihm selbst am allerwenigsten. Ich meine, wir müssen Nanz klarmachen, wie ungeschickt er sich verhält, daß es weit besser wäre, er würde zu dem, was passiert ist, auch stehen. Denn wie muß das auf unseren lieben Chef wirken, wenn sich Nanz derart von dieser Dame distanziert? Wenn er vorgibt, eine bloße Betrunkenheit seinerseits sei schuld gewesen. Was soll das denn bitte heißen? Daß er, wäre er nüchtern gewesen, sich niemals mit dieser dämlichen Schachtel eingelassen hätte? So muß sich das für unseren Chef anhören, denke ich. Ein Kompliment ist das nicht.«
Mortensen hörte nicht weiter zu. Was interessierten ihn die Interna irgendeiner Firma. Doch immerhin wußte er jetzt, daß der Dunkelblaue mit Vornamen Thomas hieß. Dessen Gesicht er nur dann zu sehen bekam, wenn sich dieser nach vorne beugte, um nach seinem Glas zu greifen. Mortensen konnte dann das breite Grinsen erkennen. Der Fall Nanz schien für Thomas eine überaus unterhaltende Wirkung zu besitzen. Sein dunkelblauer Körper wippte geradezu vor Vergnügen.
»Und das also ist mein Leser«, dachte Mortensen, trank sein Bier aus und war im Grunde entschlossen, nach Hause zu fahren.
Der Mann hinter der Theke hob das leere Glas in die Höhe und vollzog einen Blick, der nicht fragend war, sondern bloß abwartend. Als ginge es ihm, dem Barkeeper, keineswegs darum, ein weiteres Bier zu verkaufen. So wenig, wie er dies ausschließen wollte.
Mortensen jedoch meinte, er müsse aus purer Höflichkeit noch eine Bestellung in Auftrag geben, und tat dies auch. Vielleicht war aber doch das Bedürfnis nach Alkohol im Spiel, obgleich Mortensen sicher kein Trinker war. Zumindest nicht nach seinen eigenen Kriterien. Für ihn war ein Trinker jemand, der auch genauso aussah, also zerstört, aufgedunsen, debil und ungepflegt. Und obwohl er selbst nicht gerade das blühende Leben verkörperte, fand er, daß von Zerstörung keine Rede sein konnte. Er sagte von sich, daß er hin und wieder trank, nie vormittags, selten während der Arbeit, kaum ohne eine vernünftige Unterlage. Und er sagte von sich, er kenne seine Grenzen. Daß er selbige ab und zu verschob wie eine von diesen praktischen, weil variablen Polizeiabsperrungen, war allerdings auch eine Tatsache.
»Hübsche Frau. Schon mal gesehen?«
Der Silbergraue hatte die Frage gestellt. Und sie natürlich an Thomas gerichtet. Aber auch Mortensen – der die letzten Minuten offenen Auges vor sich hingedöst hatte – hob seinen Kopf leicht an. Ein reiner Reflex, der jedoch in die Ordnung eines suchenden Blicks überging. Rasch hatte Mortensen den Grund für die leichte Unruhe gefunden, die Thomas und den Silbergrauen erfaßt hatte. In der schräg gegenüberliegenden Ecke des Tresen hatte soeben eine Frau auf einem der hohen Hocker Platz genommen. Und zwar mit einer Bewegung, die an das virtuose Erreichen eines Ziels erinnerte. Wie ein Pfeil, der einen anderen spaltet, um im Mittelpunkt zu landen. Die Frau war alleine, und man konnte spüren, daß sie es auch bleiben wollte. Sie besaß ein merklich breites Gesicht, das dieser Breite wegen unnatürlich groß erschien. Dieses physiognomische Übergewicht wirkte weit weniger irritierend als anziehend. Der slawische Typ, dachte Mortensen und meinte damit wohl eine gewisse bäurische Herbheit, als würden alle Slawen direkt aus dem Kartoffelacker herauswachsen. Und tatsächlich besaß ihr Gesicht eine strenge, wenn man so will eine landschaftliche Kontur. Aber als herb konnte man es wirklich nicht bezeichnen. Und noch weniger als bäurisch. Es war ein Gesicht, in dem eben alles Feine auch einen groben Anteil besaß und umgekehrt. Keines von den Kleinmädchengesichtern, aber auch keine von den Visagen, die allein von ihrer Fahlheit lebten. Wollte man einen Vergleich zu einer bekannten Schauspielerin herstellen, so hätte man am ehesten Hanna Schygulla nennen müssen.
Diese Frau, die ein wenig älter als der Dunkelblaue und der Silbergraue sein mochte, besaß langes, leicht gewelltes, dunkelblondes Haar, hatte ein helles Make-up aufgesetzt und trug einen weißen, dünnen, enganliegenden Pullover mit V-Ausschnitt. Das V bestand aus zwei roten Streifen, rot wie ihre Lippen, aber um einiges dünner. Denn sie besaß kräftige Lippen, woraus sich jedoch kein Schmollmund ergab. Überhaupt schien sie nicht die Frau zu sein, die irgendeine Art von Schmollen nötig hatte.
Weder trug sie Ohr- noch Halsschmuck, bloß eine Uhr zog einen Äquator um das rechte Handgelenk. Sie hatte kräftige, feingliedrige Hände. Das galt für ihren ganzen Körper, soweit dies zu beurteilen war. Athletisch ohne Übertreibung. Vielleicht Wassersportlerin. Aber keine Schwimmerin, sondern Turmspringerin. Eine, die ihre Karriere bereits hinter sich hatte. Und die nun rauchen durfte. Was sie auch tat. Schon war der Barmann zur Stelle und gab ihr Feuer.
»Hast du die hier schon mal gesehen?« fragte der Silbergraue.
»Kann mich nicht erinnern«, sagte Thomas. Und: »Ich hätte sie wohl kaum übersehen.«
»Ich finde, sie sieht irgendwie polnisch aus«, meinte der Silbergraue. »Eine polnische Nutte. Keine von der Straße, natürlich nicht. Sondern Luxusklasse. Ohne Klimbim, ohne Reizwäsche, ohne kleinbürgerliche Handstände der Liebeskunst. Sondern straight, präzise, glatt.«
»Hör auf, Mike. Sie könnte uns hören.«
»Na und?«
»Ich will das nicht. Sie sieht nett aus«, sagte Thomas.
»Wie? Weil sie nett aussieht, kann sie keine Hetäre sein?«
»Weil sie nett aussieht, will ich nicht, daß wir so über sie sprechen. Egal, was sie ist.«
»Und was wäre, würde sie nicht nett aussehen?«
»Würden wir uns mit Sicherheit über etwas anderes unterhalten.«
Doch der Mann, dessen Vorname Mike war, ließ nicht lokker. Mit seiner routiniert milden Stimme erklärte er: »Thomas. Du hast ein Nuttenproblem. Du tust so, als dürfe man nicht darüber reden. Als gebe es nichts Verdorbeneres, Unanständigeres als die Prostitution. Aber das ist … «
»Stop, Mike. Darum geht es doch gar nicht.«
»Sondern?«
»Daß du eine völlig unsinnige Vermutung darüber anstellst, wer oder was diese Frau dort drüben darstellt.«
»Eventuell eine polnische Nutte. Ist das so schlimm?«
Thomas, welcher ohnehin bereits gedämpft gesprochen hatte, wurde jetzt noch leiser. Dennoch konnte Mortensen mit seinen gespitzten Ohren verstehen, daß … ja, daß Thomas jetzt über ihn, Mortensen, sprach, indem er zu Mike sagte: »Der Kerl neben dir – dreh dich nicht um! –, also, der Typ da, der wäre wohl auch nicht unbedingt begeistert, würden wir ihn angaffen und dann etwa meinen, daß er wie ein … na, sagen wir, wie ein belgischer Hilfskoch aussieht. Nichts ist schlecht daran, ein belgischer Hilfskoch zu sein, aber vielleicht ist der Mann in Wirklichkeit ein ungarischer Reiseleiter und fühlt sich extrem beleidigt, für einen belgischen Hilfskoch gehalten zu werden. Ich bin einfach überzeugt, daß Frauen, die keine Prostituierten sind, auch nicht dafür gehalten werden möchten. So edel dieser Beruf deiner Meinung nach sein mag.«
»Eine solche Anschauung spiegelt bloß dein eigenes Vorurteil wider. Dein Problem mit Nutten.«
»Du liebst dieses Wort, nicht wahr?«
»Ich sehe nur gerne zu, wie du zuckst, wenn ich es ausspreche.«
»Ich zucke nicht«, erklärte Thomas.
»Meinst du also? Tja, ich sehe was anderes.«
»Sieh, was du willst, Mike. Aber laß mich in Frieden mit deinem psychologisierenden Quark.«
»Merkwürdig. Über das Schicksal des Kollegen Nanz konntest du lachen. Und jetzt steckt dir die Ernsthaftigkeit im Genick. Willst du was von dieser Frau dort?«
»Ich will bloß, Mike, daß du mich in Frieden läßt.«
»Gerne«, sagte der Silbergraue, winkte dem Barkeeper und zahlte seine Rechnung. Ging dann zur Garderobe, schlüpfte in seinen Mantel, kam aber wieder zurück, beugte sich zu Thomas und sagte, jetzt ebenfalls flüsternd: »Ich finde, der gute Mann sieht weder wie ein belgischer Hilfskoch noch wie ein ungarischer Reiseleiter aus.«
»Sondern?« fragte Thomas.
Mortensen hatte jedes geflüsterte Wort verstanden. Mit verschränkten Armen und versteinertem Blick betrachtete er die Reihe von Flaschen im Rückteil der Bar. Er löste die Verschränkung und plazierte seine Ellbogen auf der Theke, stützte mit den zu einem Doppelbett zusammengeschobenen Handballen sein Kinn und legte dabei die geschlossenen Fingerreihen über seine Ohrmuscheln. Er wollte nicht hören, wofür ihn dieser Mike hielt, dieser schreckliche silbergraue Mensch. Doch es half nichts, denn Mike sprach mit einem Mal recht deutlich, als er meinte: »Wie ein deutschsprachiger Südtiroler.«
»Ist deutschsprachig denn ein Beruf?« fragte Thomas.
»In Südtirol vielleicht schon«, erklärte Mike so anzüglich wie ernsthaft.
»Geh jetzt endlich! Sonst kriegen wir noch Ärger.«
»Reg dich ab, Junge. Und konzentrier dich auf unsere polnische Schönheit.«
Damit verließ der Silbergraue endlich Tilanders Bar.
Als sich die Tür hinter ihm schloß, trat bei Thomas und Mortensen eine deutliche Erleichterung ein. Vielleicht auch bei der Dame, die in der Ecke saß und an ihrem Rotwein nippte. Es war schwer zu sagen, ob sie etwas von dem Gespräch mitbekommen hatte. Auf jeden Fall ließ sie sich nichts anmerken, wirkte abwesend, in Gedanken versunken. Sie brauchte keine zwei Handballen, um ihren Kopf zu stützen. Ein abgewinkelter, gegen das Jochbein gestellter Zeigefinger genügte. Nach Mortensens Empfinden wirkte sie viel zu entspannt, um den sie betreffenden Aspekt der Nuttendiskussion aufgeschnappt zu haben.
Gäste gingen und kamen. Mehrmals sah Thomas auf die Uhr, gab dann aber doch eine weitere Bestellung auf. Die Zeit tröpfelte mehr, als daß sie verging. Nur die Frau in der Ecke schien, wenn schon nicht ohne Uhr, so doch ohne das Bedürfnis, sich um dieses Tröpfeln zu kümmern. Sie saß da, einen Stift in der Hand, mit dem sie hin und wieder einen Strich über ein Stück Karton zog, einen Bierdeckel. Dann sah sie auf, warf einen kurzen, scheinbar ziellosen Blick in den Raum und war auch schon wieder in sich versunken.
Es kam Mortensen vor, als versuche Thomas einen Kontakt zu der Frau herzustellen, sie auf sich aufmerksam zu machen. Es war die Art, wie er sein Glas hob. Als stemme er mit großem Feingefühl irgend etwas Neugeborenes in die Höhe. Bezeichnenderweise hatte er ebenfalls zu Rotwein gewechselt und behielt das Glas eine ganze Weile in der Schwebe. Offenkundig wartete er auf die Möglichkeit, der Frau zuzuprosten. Eine Möglichkeit, die ausblieb. Der einzige, dem die Frau beizeiten einen Blick zuwarf, war der Barkeeper. Er bediente sie ohne großes Theater, auch ohne Worte, indem er auf ihr Nicken hin den Wein nachfüllte.
Ende der Leseprobe