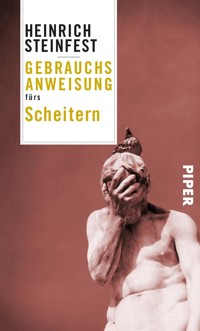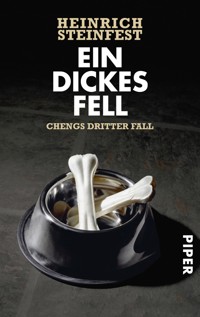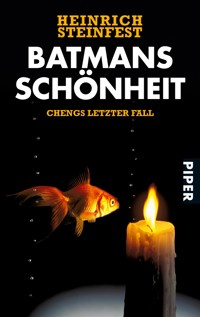9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Welt des Chauffeurs Paul Klee herrschen Übersicht und Präzision. Aber das Leben hält keine Garantie für unendliche Ordnung bereit: Nach einem schweren Autounfall und einer nicht minder schweren Fehlentscheidung beschließt er, ein kleines Hotel ganz nach seinen Vorstellungen zu führen. Und das Glück will es, dass er sich in die Maklerin Inoue verliebt. Also planen sie das Haus gemeinsam, von den Zimmern bis zur Bar, von den Sesseln bis zum Frühstück. Aber Klees ideale Welt zerbricht ein zweites Mal - und er entschließt sich zu einem für ihn sehr überraschenden Schritt ... "Der Chauffeur" ist Heinrich Steinfests intensivster Roman und die Geschichte eines Mannes, den die Liebe und der Tod einmal zu oft behelligen. Heinrich Steinfest war zweimal für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde mit dem Heimito-von-Doderer Literaturpreis sowie dem Bayrischen Buchpreis ausgezeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München, 2020
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Zitat
Erster Faden
1 –Feuer
2 –Waldrand
3 –Rugby
4 –Ablenkung
Zweiter Faden
5 –Zauber
6 –Ohrfeige
7 –Kuchen
8 –Kapsel
9 –Gespenster
10 –Rettung
11 –Übergabe
Dritter Faden
12 –Wasser
13 –Meditation
14 –Wesen
15 –Bier
16 –Heilung
17 –Sake
18 –Tennis
19 –Schönberg
20 –Wald
Vierter Faden
21 –Aufschlag
22 –Sand
Textnachweise
Faden […] asächs. fathmos Mz. ›die ausgebreiteten umfassenden Arme; Klafter‹
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache
Erster Faden
1Feuer
Es waren zwei Sekunden, die das Unglück brauchte.
Zwei Sekunden, in denen der Fahrer das Steuer herumriss. Also nicht etwa auf die Bremse trat, was auch wenig genutzt hätte bei dieser Geschwindigkeit, nein, er beschleunigte und versuchte, an dem vorderen Wagen vorbeizukommen. Ein Wagen, der sich mit bösartiger Plötzlichkeit in dem zweispurigen Tunnel quer gestellt hatte.
Er hätte es auch geschafft, beinahe. Er hätte es geschafft, wäre der quer gestellte Wagen, ein fünftüriger Toyota, nicht von einem auf der Gegenfahrbahn herankommenden Kleinlaster getroffen worden. Die Audi-Limousine, die er lenkte, wurde von dem Toyota in Richtung der Tunnelwand gedrückt, sodass es seinen Wagen praktisch aus dem Sattel der Straße hob. Ja, der Fahrer spürte jetzt, wie es aufwärtsging und es den fünf Meter langen, zweieinhalb Tonnen schweren Wagen, in dessen Lenkrad er sich verkrallt hatte, in einer seitlichen Rolle in die Luft wirbelte, um mit dem Dach voran auf der Fahrbahn aufzuschlagen. Wo sich der Wagen mehrfach drehte, bevor ein weiterer auf der Gegenfahrbahn herankommender Wagen der Drehung ein Ende setzte und den Audi wieder zur eigentlichen Unfallstelle zurückschob.
Er hing nun kopfüber im Seil seines Sicherheitsgurtes und sah an den Airbags vorbei durch die zersplitterte Scheibe des Seitenfensters. Es handelte sich bei dem Audi nicht um seinen eigenen Wagen, sondern um das Auto des Mannes auf dem rechten Rücksitz. Dieser baumelte seinerseits im Gurt wie in einer strengen Umarmung. Ein Mann, in dessen Diensten der Fahrer seit gut zehn Jahren stand.
Er, der Chauffeur, hieß Paul Klee. Klar, die meisten Leute, die nur ein klein wenig Ahnung von Kunstgeschichte hatten, erstaunte es, dass jemand, der nicht der berühmte Maler war, so hieß. Als sei es abstrus, wenn die Namen berühmter oder auch gefürchteter Leute ein zweites Mal in der Welt und in der Geschichte auftauchten. Etwa eine Frau namens Lauren Bacall. Oder ein Mann namens Albert Einstein. Oder ein Außerirdischer, der sich ausgerechnet mit dem Namen Alf vorstellte.
Oder eben jemand, der ein Chauffeur im 21. Jahrhundert war und denselben Namen trug wie jener 1940 verstorbene Künstler, der nicht nur viele Engel gemalt hatte, sondern seine Kunst dabei in einer Weise betrieben hatte, als sei er selbst einer: ein Engel der Moderne. Allerdings hatten Paul Klees Eltern – also die des Mannes, der soeben seinen Sicherheitsgurt löste und sich mit der anderen Hand gegen die Innenseite des Autodachs stützte –, hatten also diese Eltern, das Ehepaar Ernst und Marita Klee, in völliger Unkenntnis der klassischen Moderne ihrem Sohn den Namen Paul gegeben. Dabei war nicht einmal auszuschließen, dass eine ferne Verwandtschaft bestand, aber davon hatten die Klees, als ihr Sohn 1974 auf die Welt kam, nichts gewusst. Und niemand hatte sie darauf aufmerksam gemacht. Sie fanden diesen Vornamen einfach schön und passend. Passend nicht zuletzt darum, weil zu den vier Buchstaben des Nachnamens, den man sich nun mal nicht oder nur sehr bedingt aussuchen konnte, die vier Buchstaben eines Vornamens kamen, der frei zu wählen war. Nicht, dass sie es genau auf diese Weise ausdrückten, und doch war es das, was sie als gelungen empfanden: das Gleichgewicht.
Paul Klee war natürlich spätestens im schulischen Kunstunterricht damit konfrontiert worden, einen berühmten Namen zu tragen, ohne selbst berühmt zu sein. Was oft wie ein Vorwurf daherkam. Und nicht minder vorwurfsvoll fielen die Kommentare zu seinem geringen Talent im Zeichnen und Malen aus. Immer wieder dieses Kopfschütteln im Angesicht seiner »grafischen Ungelenkigkeit«, die genau genommen eher durchschnittlich zu nennen war, aber wegen seines Namens als absolut mangelhaft wahrgenommen wurde. Es wäre kaum schlimmer gewesen, hätte er wie ein berühmter Kraulweltmeister geheißen, um dann mit mediokrer Langsamkeit die hundert Meter Freistil zu bewältigen. Nicht unbedingt zu ertrinken, aber doch provokant spät am Beckenrand anzuschlagen.
Er selbst sah sich in keiner Weise verpflichtet, seines Namensschicksals wegen ein Künstler zu werden oder sonst wie in die Kunst geraten zu müssen.
Nachdem er das Gymnasium und letztlich das Abitur mit einer stillen, aber effektiven Gleichgültigkeit absolviert hatte, durchlebte Paul einige Jahre eine Phase so plötzlichen wie überraschenden Ehrgeizes für das selbst gewählte Studium der Rechtswissenschaften. Eine Zeit, in der er nicht nur äußerst rasant allerlei Wissen einatmete und ausatmete, sondern nebenbei auch noch als Fahrer jobbte. Zuerst für ein Taxiunternehmen, später als privater Chauffeur einer Antiquitätenhändlerin.
Es ist mitunter gar nicht so leicht zu sagen, worin der Zustand von Kranksein und worin der Zustand von Gesundsein besteht. Aber eines von beidem musste es wohl sein – also entweder wurde Paul krank oder aber er wurde endlich wieder gesund –, was dazu führte, dass er nach eineinhalb Jahren äußersten Fleißes sein Studium aufgab, seine Freunde verwirrte, seine Eltern enttäuschte und die anfangs als bloßen Studentenjob praktizierte »Kunst, ein Auto zu fahren« zu seinem Hauptberuf machte. Nach seiner Zeit bei der Antiquitätenhändlerin arbeitete er als Ausfahrer für ein Möbelhaus, danach für eine Sicherheitsfirma, um schließlich, dreiunddreißigjährig, von jenem Mann angestellt zu werden, der nun also, zehn Jahre später, im Fond des umgestürzten Audi hing und leise Töne des Schmerzes von sich gab, was immerhin zeigte, dass er noch am Leben war.
Bei diesem Mann handelte es sich um Martin Rehberg, einen ehemaligen Minister einer ehemaligen Regierung, der nach seinem Rücktritt vom Amt und seinem Rückzug aus der Politik wieder in die Wirtschaft gegangen war und nun in den Aufsichtsräten und Verwaltungsgremien und Vorständen diverser Konzerne saß, allerdings nie aufgehört hatte, weiterhin Fäden in der Partei zu ziehen, der er angehörte, wobei es ziemlich unerheblich war, hier zu sagen, um welche Partei es sich handelte und nach welcher Ideologie sie äußerlich ausgerichtet war, das war wirklich einerlei. Rehbergs Macht und Einfluss waren fundamental, nicht ideologisch. Um günstige Koalitionen für den von ihm vertretenen Wirtschaftsliberalismus zu schmieden, wäre er Bündnisse mit dem Teufel genauso wie mit dem lieben Gott eingegangen.
Rehberg war gelernter Jurist und zu Beginn seiner Karriere als Rechtsanwalt tätig gewesen. Es hatte ihm ein gewisses Vergnügen bereitet, sich kurz nach seinem Austritt aus der Politik nicht nur einen neuen Wagen bereitstellen zu lassen – wie zur Belobigung –, sondern zugleich einen neuen Chauffeur anzustellen, noch dazu einen, der über einige Ahnung in Fragen des Rechts und der Rechtsphilosophie verfügte, denn Klee verheimlichte sein tobleroneartig angebrochenes, beziehungsweise abgebrochenes Jurastudium bei seiner Bewerbung keineswegs. Aber nicht nur darum ging es. Denn kurz bevor Rehberg diesen Chauffeur aus einer Gruppe von Kandidaten ausgewählt hatte, war es ihm gelungen, ein lange ersehntes kleines Aquarell von Paul Klee zu erwerben. Ein Künstler, dessen Werke er überaus schätzte, und noch mehr, sie zu besitzen. So pragmatisch und nüchtern Rehberg war, erschien es ihm dennoch symbolhaft, dass auf den Kauf dieses Bildes ausgerechnet die Bewerbung eines Fahrers gefolgt war, der ebendiesen Namen trug.
Rehberg hatte sich also in der vergangenen Dekade mit schlangenhafter Beweglichkeit durch die Bereiche ökonomischer Landschaften bewegt, die ja stets internationale Landschaften sind, selbst wenn sie deutsche Namen tragen und in Düsseldorf ihren Hauptsitz haben. Doch diese Landschaften verfügen über exakt dieselbe Rundlichkeit, mit der die Erde ausgestattet ist. Weshalb man oft den Eindruck bekommt, Geld sei eine Art Weltreisender, ein Weltumsegler und Weltumflieger. Und sich nicht leugnen lässt, wie dieses Geld sich im Zuge der Weltreisen gleich allen Weltreisenden verändert. Niemand kommt nach einer Umrundung so an, wie er aufgebrochen ist.
Allerdings hatte Rehberg in all diesen Jahren in der Wirtschaft auch einiges unternommen, um seine Rückkehr auf die politische Bühne vorzubereiten. Und sah nun den Zeitpunkt gekommen, da er mehr würde erreichen können als damals als Minister in einer Regierung, deren Mitglieder er sich ja nicht hatte aussuchen können. Ihm war nach höheren Weihen. Und er war gut vorbereitet. Er hatte einige Falltüren und einige Trampoline konstruiert und wollte jetzt zusehen, wer in die Falle ging und wer mittels Sprung auf dem Trampolin zusammen mit ihm ganz nach oben geraten würde.
Paul Klees eigene politische Anschauungen, sofern vorhanden, waren gänzlich andere als die seines Arbeitgebers. Aber das war für ihn kein Thema. Er hatte sich von Beginn an vollkommen in das Moment der Dienstleistung begeben und damit auch in die Loyalität gegenüber der Person, die ihn beschäftigte. Und keine Frage, er wurde gut bezahlt. Zudem fiel es ihm nicht schwer, seine Uhr nach der seines Chefs zu stellen, jederzeit verfügbar zu sein, selbst dann, wenn es sehr spät oder sehr früh wurde oder wenn Kurzfristigkeit die Planung bestimmte.
Als Paul Klee zehn Jahre vor dem schicksalhaften Unfall das erste Mal in den Wagen Rehbergs gestiegen war – auch damals schon ein Audi, es würden immer Audis sein –, da war ihm deutlich bewusst geworden, dass sein eigentliches Leben in Zukunft allein in diesem Wageninneren und auf den zu fahrenden Strecken stattfinden würde. Und dass ein anderes Leben als das, der Fahrer in diesem Wagen zu sein, von geringer Bedeutung sein würde. Ganz sicher kein Familienleben. Frauen ja, Freizeit ja, Sport ja, eine Pokerrunde hier und da, die kurzen Pausen halt, die entstanden, wenn Rehberg sich im Ausland aufhielt und der Wagen in der Garage gleichsam in eine kleine Ohnmacht fiel.
Klees schwindsüchtige Privatheit und seine geringe Leidenschaft in Bezug auf jene »Pausen« führten genau zu jener Flexibilität, derer Rehberg bedurfte. Er war ja nicht nur ein viel beschäftigter Mann, der sich ständig zwischen den Orten der Macht hin und her bewegte und im Gegensatz zu seinem Fahrer daneben auch so etwas wie ein Familienleben führte, sondern gleichfalls ein extrem unruhiger Geist, dem es mitunter gefiel, mitten in der Nacht seinen Fahrer aus dem Bett zu läuten, um dessen Dienste in Anspruch zu nehmen. Zwar wohnte Klee nicht in Rehbergs Haus, aber doch in unmittelbarer Nähe und kam stets rasch herübergejoggt. Rehberg selbst schien noch nie einen Wagen gesteuert zu haben. Früher vielleicht, in einer halb vergessenen Zeit.
Wohin genau sein Chef in solchen Nächten gebracht werden wollte, interessierte Klee nicht. Er fuhr Rehberg an eine bestimmte Adresse oder an einen bestimmten Ort, und danach wartete er im Wagen auf dessen Rückkehr – lesend, Musik hörend, manchmal dösend. Hätte man aber Klee gezwungen, eine Vermutung auszusprechen, er hätte weniger angenommen, dass Rehberg irgendwelchen sexuellen Abenteuern folgte, sondern vielmehr, dass er Leute traf, mit denen sich in der Nacht zu besprechen einfach eine tiefere Wirkung besaß. Tiefer, als hätte er dies untertags und sodann im Rahmen des Offiziellen getan. Klee hätte es so ausgedrückt: »Rehberg bereitet die Zukunft des Tages vor, logischerweise tut er das in der Nacht.«
Klee war nicht blind. Auch er konnte nur staunen, welch ungeheure Gagen Rehberg für seine Beratertätigkeiten bezog, deren Legalität sich genau daraus speiste, dass Leute aus Rehbergs »Stamm« diese vergnügte Praxis vergoldeter Ratschläge rechtlich absicherten. Gleichzeitig arbeitete Rehberg daran, das allgemeine Sozialsystem auszuhebeln und Errungenschaften wie den Kündigungsschutz zu eliminieren. Nicht zuletzt die Vorstellung davon zu korrigieren, was einem Menschen zur Existenzsicherung zur Verfügung stehen sollte. Ein Mann Darwins, könnte man sagen, leider kein Mann Christus’, sosehr Rehberg das Christliche als die wesentliche und fundamentale kulturelle Stütze der hiesigen Gesellschaft ansah. Man könnte auch sagen, er war ein in seinen Widersprüchen gefestigter Mann. Damit freilich nicht allein.
Trotzdem, Klee behielt sein Staunen für sich und war seinem Vorgesetzten absolut verbunden. »Symbiotisch« wäre ein zu starkes Wort gewesen, beziehungsweise bestand eine Symbiose eher zwischen dem Fahrer und dem Auto, dem schließlich auch Rehberg stark verbunden war, immerhin der Ort, an dem er viele wesentliche Entscheidungen traf. Klees Verhältnis zu Rehberg war jedenfalls ein grundsätzlich vertrauensvolles, ein beziehungshaftes, bei dem es eben nicht darum ging, wie unsympathisch Klee diesen Mann gefunden hätte, wäre er nicht sein Fahrer gewesen. Er war sein Fahrer.
Und als solcher natürlich für das Wohlergehen seines Dienstgebers verantwortlich, für die Sicherheit im Auto. In dem übrigens so gut wie nie einer jener Leibwächter saß, die Rehberg an verschiedene öffentliche Orte begleiteten. Mitunter verlegte Rehberg die Verhandlung mit einem Geschäftspartner in die muschelartige Intimität dieser um dreizehn Zentimeter gestreckten Langversion eines Wagens, der am Ende einer Entwicklung dessen stand, was ein Auto ist. Ein Auto, das ganz selbstständig in der Lage war, sich kurz vor einem Crash um acht Zentimeter anzuheben – sich aufzublasen wie ein kämpfendes Tier –, um auf diese Weise den Aufprall in den stabilen Wagenboden statt in die weiche Flanke zu leiten (was freilich nicht so recht nutzte, wenn man praktisch auf dem Rücken lag).
Obgleich also manchmal ein Geschäftsfreund oder selten ein Leibwächter zusammen mit Rehberg im Fond saß, befand sich nie jemand auf dem Beifahrersitz, auch kein zweiter Leibwächter oder zweiter Geschäftspartner. Wenn einmal Frau Rehberg den Wagen nutzte, so stets ohne ihren Mann. Und natürlich saß sie dann ausschließlich auf dem rechten der rückwärtigen Sitze. Sitze, in denen jeder sich so fühlte, als sei er in den Schoß einer lieben Mutter zurückgekehrt. Das galt für sehr dünne wie für sehr dicke Menschen in gleichem Maße, allerdings besaß Martin Rehberg eine Figur, die vollkommen unauffällig zu nennen war. Wäre er nicht so ein mächtiger Mann gewesen und sein Gesicht tausendfach aus den Nachrichten bekannt, man hätte meinen können, er sei ein kleiner Beamter, aber so einer aus dem 19. Jahrhundert. Es war eine bittere Akkuratesse in seinem Gesicht, selbst wenn er lachte. Und er lachte eigentlich nur, wenn er im Fernsehen war, niemals, wenn er im Wagen saß. Dort war es schließlich nicht nötig, zu beweisen, dass er auch lustig und fröhlich sein konnte.
Auf dem Beifahrersitz, der somit stets unbesetzt blieb, lagen in der Regel die zwei Bücher, in denen Klee gerade las. Naturgemäß hatte er viel Zeit, wenn er wartete, bis Rehberg ein Meeting beendet hatte und zu einem nächsten gebracht werden sollte. Zeit zum Lesen. Zum Lesen sehr schwieriger und sehr leichter Bücher. Es reizte Klee auf unerfindliche Weise, sich abwechselnd – gedanklich sogar gleichzeitig – mit Texten von höchster Banalität wie mit solchen zu beschäftigen, die ihm ein faszinierendes Kopfzerbrechen bereiteten. Immer zwei Exemplare, ein leichtes und ein schweres Buch, die dann leicht und schwer auf dem Beifahrersitz lagen, während ihr Leser den Wagen von Ort zu Ort steuerte.
Nachdem Klee sich nun aus seiner hängenden Position befreit hatte und auf die Innenseite des Autodachs gerutscht war, sah er dort für einen Moment das leichte und das schwere Buch, die es zwar während des Unfalls durch den Innenraum gewirbelt hatte, die aber auch am neuen Platz in der vertrauten Nachbarschaft zueinander lagen.
Klee blickte hin: Jean Baudrillards Agonie des Realen und Utta Danellas Vergiss, wenn du leben willst. Also das schwere Buch eines supergescheiten Franzosen und das leichte Buch einer supererfolgreichen Deutschen.
Er betrachtete die zwei Bände, als seien sie Pforten und als wäre es zwar möglich, beide Bücher zu lesen, aber logischerweise unmöglich, durch beide Pforten gleichzeitig zu treten. Er würde sich für eine entscheiden müssen.
Er schaute nach hinten. Zwischen den breiten Stützlehnen konnte er erkennen, wie Rehberg bewegungslos in seinem Gurt hing, die Augen halb geöffnet, die Gesichtszüge stark verrutscht von Benommenheit und Kopfüberstellung. Es war keine Wunde und kein Blut in diesem Gesicht, nur eine Unordnung, ein Verfall, wie von einem viel zu raschen Altern, einem ruinösen Überspringen der Zeit.
In diesem Augenblick vernahm Klee die quietschenden Reifen eines weiteren Gefährts. Dann spürte er die Wucht des Aufpralls. Der Audi wurde nach vorne geschoben und gegen jenen Toyota gedrückt, dessen plötzliche Querstellung all dies verursacht hatte (letztlich waren sieben Wagen an dem Unfall beteiligt). Der Audi geriet mit seinem Frontteil nochmals in die Höhe und landete auf der Motorhaube des Toyota.
Kurz war Klee von einem Dunkel erfüllt, doch als er jetzt die Augen öffnete und es kleine Teile der Innenverkleidung von seinen Lidern regnete, da konnte er durch die eingedrückte Frontscheibe hinüber zu dem Toyota sehen. Keine zwei Meter von ihm entfernt erkannte er zwei Erwachsene im vorderen Teil des Wagens, dahinter aber die Gestalt eines Jungen, alle drei ohne Regung.
Wenn man sich später fragt, wann man den entscheidenden Fehler seines Lebens begangen hat, mag man nicht immer gleich erkennen, zu welchem Zeitpunkt genau das geschah. Und ob man das überhaupt so punktgenau festlegen kann. Klee konnte es. Es war genau dieser eine Moment, dieser Moment, da er sich entschied. Nun, er würde es so ausdrücken, in dieser Situation nicht durch die richtige, sondern durch die falsche Pforte gegangen zu sein, ohne aber sagen zu können, welche davon Utta Danella und welche Jean Baudrillard gewesen war.
Nur falsch war sie in jedem Fall!
So viel war sicher. Indem er nicht etwa aus dem Wagen geklettert war, um als Erstes nach dem Kind zu sehen und es so rasch als möglich aus dem zerstörten Wagen zu befreien. Vielmehr war er in seiner absoluten Loyalität gegenüber dem Mann, dem er als Fahrer diente, nach hinten gekrochen und hatte den nun gänzlich bewusstlosen Rehberg aus Gurt und Sitz befreit, ihn durch eine der seitlichen Türen nach draußen geschoben und mehrere Meter weg von der Unfallstelle in eine Rettungsbucht gezogen. Gegen die Tunnelwand hin. Keinen Moment zu spät, denn der Kleinlaster hatte Feuer gefangen, ein Feuer, das sich mit einer heftigen Explosion rasch fortsetzte, auf den Toyota wie auch den Audi übergriff, sodass nun drei der sieben beteiligten Wagen in Flammen standen. Es geschah mit einer geradezu bösartigen Schnelligkeit, die exakt jene Zwei-Pforten-Theorie bestätigte, die besagt, nicht gleichzeitig zwei Wege gehen zu können. Klees verzweifelter Versuch, vorbei an dem brennenden Audi zu dem brennenden Toyota vorzudringen, um zumindest das Kind noch herauszubekommen, scheiterte wie auch die Versuche herbeieilender Autofahrer, mittels ihrer Löschgeräte das Feuer einzudämmen. Vielmehr folgte eine weitere Explosion, starker Rauch überall, dazu eine Feuerwehr, die, vom automatischen Tunnelwarnsystem alarmiert, so schnell kam, wie es ging, aber doch viel zu lange brauchte. Und andererseits war der Tunnel zu alt, als dass sich eine Anlage von Wassersprinklern darin befunden hätte. Diese war für eine Tunnelrenovierung im nächsten Jahr geplant. Allerdings hätte herunterregnendes Wasser bei der Macht dieses Brands kaum viel genutzt. Nein, der Einzige, der Zeit gehabt hätte, etwas Wirkungsvolles zu tun – wenn man die Wirkung bedachte, die sich daraus ergibt, ein Kind, einen elfjährigen Jungen, zu retten –, war Paul Klee. Stattdessen hatte Klee jenen Mann vorgezogen, der soeben dabei war, die Führung in seiner Partei zu übernehmen, woran sich dann auch die Führung des ganzen Landes anschließen sollte. Ein Mann, der, so spröde und kalt und berechnend er wirken mochte, dennoch über eine große Gefolgschaft verfügte und der vielen Menschen als »gute Antwort« auf eine von Zweifeln zerrissene Gesellschaft erschien. Und doch war auch unter denen absolut keiner, der das Leben dieses Mannes über das eines Kindes gestellt hätte.
Aber es blieb dabei, Rehberg war am Leben, die Menschen in dem Toyota wie auch der Fahrer des Lasters starben. Unter ihnen der Junge.
Die Namen der Toten wie der Schwerverletzten drangen nicht an die Öffentlichkeit, aber natürlich der prominente Name des Mannes, der von seinem Chauffeur gerettet worden war, dazu aber auch der Umstand, dass diese Rettung im Grunde nur möglich gewesen war, weil die Rettung eines Kindes nicht stattgefunden hatte. Der Zusammenhang mochte nicht ganz korrekt sein, weil Paul Klee ja durchaus vorgehabt hatte, sich nach der Sicherung seines Chefs sofort an die Bergung des Jungen und seiner Eltern zu machen, doch für jedermann war klar, dass Klee eine falsche Priorität gesetzt hatte. Es hätte heißen müssen: zuerst das Kind, dann der Politiker.
Etwas, das ja nicht nur Rehberg, sondern gleichfalls sein Chauffeur sofort unterschrieben hätte. Denn sosehr Klee im Moment des Handelns einem Automatismus gefolgt war, war ihm dies im Nachhinein ein absolutes Rätsel. Wie hatte er eine solche Entscheidung treffen können? Gegen jede Moral! Jene natürliche Regel, die ein Kind unbedingt vor einen Erwachsenen stellte. Das neue Leben vor das mittlere oder zur Neige gehende. Ihm hatte bewusst sein müssen, wie eng es zeitlich werden könnte: ein mögliches Feuer bedenkend, aber auch, dass weitere Wagen in die Unfallstelle hineinrasen könnten. Nein, es existierte absolut keine andere Ausrede als die eine, schier unaussprechliche, nämlich in radikaler Erfüllung seiner Pflicht gehandelt zu haben. Einer aus seinem Dienstverhältnis entsprungenen Treue. Er hatte nicht als Mensch, sondern als angestellter Fahrer gehandelt. Was nicht einmal dann akzeptabel gewesen wäre, hätte Krieg geherrscht. Und Krieg herrschte ja nicht.
Auch Martin Rehberg konnte dies nicht akzeptieren. In einem Statement zum Unfallhergang verurteilte er die Handlungsweise seines Fahrers. Diese Rettung sei – sosehr sie sein Überleben gewährleistet habe – nicht die, die seinen ethischen Vorstellungen entspreche. Weshalb er sich umgehend von seinem Chauffeur trennen wolle.
Und das tat er dann. Fristlos.
Was Klee gut verstehen konnte. Dabei war es aber nicht ein Gefühl von Schuld, das er empfand. Denn sosehr ein tiefes Bedauern wie auch eine immense Verwirrung ob des eigenen Handelns bestand, so dachte Klee allein in den Dimensionen eines Fehlers, nicht einer Schuld. Aber der »Charakter« dieses Fehlers zeichnete sich natürlich durch sein ungemeines Gewicht aus. Dieser Junge war tot und nirgends ein Teufel, dem Klee seine Seele dafür hätte anbieten können, das Kind auferstehen zu lassen.
Zum Gefühl des fundamentalen Fehlers kam noch eine ebenso fundamentale Scham. Letztlich auch die Scham, den Fehler nicht als Schuld zu empfinden. Kein Interesse zu verspüren herauszufinden, wer dieser Junge gewesen war, wie er gelebt hatte und was aus ihm hätte werden können. Nicht trauern zu können. Ja, insgeheim sogar eine gewisse Wut zu verspüren darüber, dass dieser Junge überhaupt in diesem Auto gewesen war. Wäre stattdessen eine achtzigjährige Frau oder ein Mann mittleren Alters im hinteren Teil des Wagens gesessen oder auch allein die beiden erwachsenen Personen auf den vorderen Sitzen, niemand hätte Klees Handeln verurteilen müssen. Es wäre dann einfach Schicksal gewesen, dass Klee und Rehberg überlebt hatten, nicht aber die Personen in dem Toyota.
Weder erfuhr Klee also den Namen des Kindes noch den der Eltern, ebenso wenig wurde publik, welchen Umständen es überhaupt geschuldet war, dass sich der Toyota mit solcher Plötzlichkeit in dem Tunnel quer gestellt hatte. Inwieweit also ein Fehler des Lenkers oder doch eher ein Defekt am Wagen dafür verantwortlich zu machen war. Die Frage blieb nicht zuletzt darum unbeantwortet, weil sich wegen der extremen Zerstörungen im Zuge von Explosion und Feuer Rückschlüsse nur schwer ziehen ließen. Festgestellt wurde allerdings, dass sich im Wagen des Lasters Gefahrgut befunden hatte, das in dieser ungenügend gesicherten Form nicht hätte transportiert werden dürfen. Wofür zwar der Fahrer nicht mehr belangt werden konnte, aber sehr wohl das Unternehmen, für das er tätig gewesen war.
Was gänzlich ausgeschlossen werden konnte, war irgendeine Verantwortung Paul Klees für den fatalen Ausgang der Kollision. Es bestand allein eine moralische Verantwortung, die dann auch Martin Rehberg mittels Kündigung seines Fahrers sanktionierte. Was in den Medien durchaus die Runde machte. Nicht hingegen, dass Rehberg seinem Fahrer dabei eine recht großzügige Abfindung bezahlte. Eine Abfindung von jener Höhe, die an die Lobbyisten- und Beraterhonorare erinnerte, die der Mann, der einst als »sozialpolitischer Sprengstoffgürtel«, aber auch etwas liebevoller als »Meister der Privatisierung« bezeichnet worden war, in den vergangenen Jahren bezogen hatte. Für Leistungen, die allesamt etwas von einem so intelligenten wie raffinierten Schulterklopfen besaßen.
Aber gut, immerhin hatte Klee ihm das Leben gerettet. Und zwar durch weit mehr als bloß ein Schulterklopfen. Hätte ihm Klee bloß auf die Schulter geklopft, um sich dann rasch hinüber zu dem Kind zu begeben, dann wäre Rehberg nun ein toter Mann gewesen.
2Waldrand
Sosehr Klee sich lange sicher gewesen war, seine gesamte berufliche Existenz als Fahrer und damit in einem Wagen zuzubringen, erfolgte nun ein radikaler Bruch. Sein Leben als Rehbergs Chauffeur war zu Ende und damit auch das Leben als Chauffeur an sich. Er war sogar mit einem Foto in eine viel gelesene Boulevardzeitung gelangt. Obgleich natürlich auf der Titelseite das Bild Rehbergs prangte, des prominent Überlebthabenden, so war im Blattinneren Klees unscharfes Gesicht zu sehen, darunter die Zeile: Rehbergs Retter. Allerdings auch gleich die Anmerkung, es handle sich um den Mann, »der für seinen Chef ein Kind opferte«. Das war in selbiger Formulierung fern der Wahrheit und hart an der Grenze des journalistisch Erlaubten, aber ein für Rehberg arbeitender Anwalt empfahl Klee, nicht dagegen vorzugehen. Das würde die Sache nur in die Länge ziehen und schlimmer machen. Zudem war Klee in diesem Artikel bloß als Paul K. bezeichnet worden.
Für Rehberg selbst hatte die Geschichte durchaus Vorteile, ganz abgesehen davon, dass er sie überlebt hatte. So wurde er mehrfach damit zitiert, er hätte gerne sein Leben für das des Kindes gegeben, hätte diese Möglichkeit bestanden. Das ließ ihn, der als harter Verfechter einer neuen sozialen Marktwirtschaft galt, bei der schwer zu sagen war, worin das Soziale bestand, ungemein menschlich erscheinen.
Für Klee hingegen wäre es illusorisch gewesen zu glauben, noch einmal als Chauffeur arbeiten zu können. Rehbergs großzügige Abfindung war für Klee wie ein Schlusspunkt gewesen, mit dem er sich im wahrsten Sinne des Wortes hatte abfinden müssen.
Er erkannte die Notwendigkeit der Zäsur. Er sah den Balken, der sein Leben in ein Davor und ein Danach teilte. Und er sah sehr genau, was sich hinter diesem Balken abzeichnete. Wie die meisten Menschen verfügte er schon lange über eine alternative Fantasie, die in seinem Fall nicht einmal unrealistisch war. Obgleich er nicht so richtig hätte sagen können, woher sie stammte. Aber das war ihm ja auch bei seiner Karriere als Chauffeur so ergangen. Diese Karriere war nicht aus einer Liebe zu luxuriösen oder schnellen Automobilen heraus entstanden oder aus einem Bedürfnis, bedeutende Menschen zu kutschieren.
Er konnte es so wenig erklären, wie er jetzt erklären konnte, wieso er sein angespartes und um jene beträchtliche Abfindung ergänztes Kapital dazu benutzen wollte, ein kleines Gebäude nahe eines Waldes zu kaufen, um daraus ein Hotel zu machen. Mehr eine Pension, aber ihm gefiel das Wort »Hotel« einfach besser, Hotel klang nach Welt, Pension nach Jenseits. Und sosehr dieses Hotel wahrhaftig am Rande eines Waldes liegen würde, so sehr schwebte Klee eben eine weltgewandte Eleganz vor und nicht dieser gewisse Mief, den das Wort Pension suggerierte. Dieser Klang von etwas Vergehendem.
Hotel also!
Und wie alles, was ins Leben gerufen wurde, benötigte dieses Hotel einen Namen. Noch bevor es gekauft und eingerichtet und organisiert und beworben werden konnte, war ein Name vonnöten. Davon war Klee überzeugt. Der Name war das eigentliche Fundament. Der Name war das Wort, das am Anfang stand.
Das Wort war eine Phrase: Zur kleinen Nacht.
Hotel zur kleinen Nacht.
So sollte es heißen. Das war poetisch, und es war rätselhaft. Denn was sollte das sein, eine kleine Nacht? Eine kurze Nacht wäre verständlich gewesen, hätte dann allerdings als problematischer Hinweis auf unruhige und schlaflose Nächte verstanden werden können. Genau das, was man sich für ein Hotel ja weniger wünscht, auch wenn dies im Zuge zu dünner Wände, lauter Zimmernachbarn, diverser mysteriöser Geräusche und als fremd empfundener Betten der Fall sein konnte.
Aber natürlich hatte Klee das Gegenteil im Sinn. Ein Hotel so nahe am Wald, gelegen an einer Straße, die allein von Anrainern befahren wurde und in dem nur wenige Gäste Platz fanden, sollte diesen Gästen eines ganz sicher gewährleisten: Ruhe. Eine so vollkommene wie vornehme Ruhe. Eine im wahrsten Sinne gezimmerte Ruhe.
Der Begriff der kleinen Nacht – und er würde es immer wieder erklären müssen – bezog sich auf ein Spiel seiner Kindheit, bei dem es darum gegangen war, so lange als möglich aufzubleiben, und zwar nicht, um eine Geisterstunde zu erleben, sondern wegen der Vermutung, dass inmitten der langen, vom späten Abend bis zum frühen Morgen stattfindenden Nacht noch eine weitere spezielle Nacht bestehe, eine Nacht in der Nacht, gleich einer Klammer in der Klammer, eben jene »kleine Nacht«. Die jedoch zeitlich nicht präzise einzuordnen war, die einmal länger, einmal kürzer ausfallen konnte, die aber denen, die sie bewusst erlebten, Zugang zu fremden Räumen und Sphären ermöglichte. Zu Dingen wie Zeitreisen und schwarzen Löchern. Schwarze Löcher waren gerade in Mode gekommen, und ihre Existenz spornte auch die Gedanken derer an, die noch nicht mal genau wussten, wie man das Wort Physik richtig schreibt.
Dieses Spiel unter den beiden Brüdern und ihrer Schwester, die Diskussion, worin genau der Sinn der kleinen Nacht bestehe, diente wohl in erster Linie dazu, das Einschlafen hinauszuschieben. Keiner von ihnen schaffte es jedoch, lange genug aufzubleiben, um tatsächlich diese spezielle Nacht zu erleben. Und wie so oft in der Kindheit, führte eine irgendwann einsetzende Fähigkeit – in diesem Fall also die Fähigkeit, entgegen der eigenen Müdigkeit den Schlaf in beträchtlichem Maße nach hinten zu verschieben – zum Vergessen des ursprünglichen Anlasses. So wie ja auch die Kleinsten begierig in der Küche und beim Kochen mithelfen wollen, doch sobald sie dazu in einer effektiven Weise in der Lage sind, also nicht mehr die Hälfte der Zutaten über den Boden verteilen, die Lust verlieren, als Küchenhilfen zu dienen.
Und ebenso war es mit dem Längeraufbleiben. Kein Wort mehr über die Erforschung einer geheimnisvollen »Nacht in der Nacht«. Vielmehr ging es dann nur noch darum, sich Filme im Fernsehen anzusehen, die spätabends oder zu sehr später Stunde gezeigt wurden und deren erregender Charakter genau darin bestand, dass sie irgendetwas besaßen, was sie für das Hauptabendprogramm ausschloss.
Und doch war Klees Begriff der »kleinen Nacht« wie vieles, das man ein Leben lang mit sich herumträgt, tief vergraben in diversen Hosentaschen. Aber so tief sind Hosentaschen halt nicht. Die Dinge geraten nach oben, spätestens beim Waschen, und sei’s in kleinen, vernudelten Stückchen. Als sentimentale Geste, als weichgezeichnete Erinnerung oder schreckliche Erkenntnis. Immer wieder einmal, wenn Klee Rehbergs Audi durch die Nacht lenkte, war ihm der kindliche Gedanke an eine in die große Nacht geheimnisvoll eingebettete kleine Nacht gekommen.
Freilich war es eine absolut intuitive Entscheidung, das Hotel ausgerechnet so zu benennen. Es gefiel ihm einfach, so, wie es seinen Eltern einfach gefallen hatte, ihn dreiundvierzig Jahre zuvor Paul zu taufen, ohne zu ahnen, was sie seinen künftigen Zeichen- und Kunstlehrern damit antun würden.
Er hatte also den Namen für das Hotel, und er hatte den Ort, nicht aber das Objekt. Den Ort kannte er von einem einzigen Besuch. Es war drei Jahre her, als er Rehberg dorthin chauffiert hatte, draußen am Land, in einer hügeligen Landschaft, an einen kleinen Ort mit schmucken Einfamilienhäusern. Häuser von Leuten, die sich entweder die unbezahlbaren Preise der nahe gelegenen Stadt nicht leisten konnten oder aber die Großzügigkeiten an Luft und Raum und Natur bevorzugten, die ihnen dieser Ort bot. Ein Ort, dessen Gebäude an verschiedene, einander zugewandte steile Hänge gebaut worden waren, Ortsteile bildend, die wie kleine Heere die Hügel unterhalb der bewaldeten Höhen besetzten und auf einen guten Anlass warteten, wieder Krieg führen zu können. Aber der Anlass blieb aus, und die Heere schienen vom Warten wie freundlich versteinert.
Damals vor drei Jahren hatte sich Rehberg in einen äußeren Winkel der Ortschaft, ans Ende einer längs zum Hang führenden, zu beiden Seiten bebauten langen Straße bringen lassen, um einen dieser Besuche abzustatten, die in diskreter Abkehr vom Offiziellen auch mal tagsüber stattfanden. Und von denen Klee nicht zu wissen brauchte, wem sie galten.
Entgegen seiner Gepflogenheit, den Wagen so gut wie nie zu verlassen, wenn er auf Rehberg wartete, gleich zu welcher Tageszeit, hatte es Klee diesmal doch getan. Es war vielleicht die Luft gewesen, die an einem milden Herbsttag durch das offene Fenster des Audi drang, vielleicht auch die Farben, die vom nahen Wald herüberleuchteten, so ziemlich alles, was Gelb, Orange, Rot, Braun und ein scheidendes Grün zu bieten hatten, wenn sie allesamt den Untergang der warmen Jahreszeit feierten.
Klee war also aus dem Wagen gestiegen und das kurze Stück hinüber in den Wald spaziert, auf einem schmalen, höhlenartigen Pfad wie in eine farbenfrohe Gruft. So hatte er sich durch den Regen der fallenden Blätter bewegt.
Nichts Außerordentliches geschah, keine Magie, zudem war es ja nicht so, dass sich Klee zum ersten Mal unter Bäumen befand. Vielmehr pflegte er zum Joggen regelmäßig einen Stadtpark aufzusuchen, wo es schließlich ebenfalls Bäume und Blätter gab und es auch Jahr für Jahr wieder Herbst wurde. Aber dort joggte er eben und war so vollkommen auf sich selbst konzentriert, auf die Routine und die Pflicht und die Notwendigkeit, einen athletischen Körper zu erhalten.
Hier und jetzt war das anders. Er war für einen Moment … ja, er konnte nicht anders, als zu sagen, er sei verliebt. Verliebt in einen Ort. Und wie man so sagt: auf den ersten Blick.
Natürlich, er war hier nicht zum Verliebtsein, sondern zum Arbeiten, kehrte bald wieder aus dem Wald zurück zu seinem Wagen, griff zu einem der Bücher auf seinem Nebensitz, einem sehr leichten Buch, las darin und wartete, bis Rehberg erschien und man die achtzig Kilometer lange Fahrt zu jenem Flughafen antreten konnte, wo Rehbergs Privatjet wie ein großer, müder Albatros wartete.
Klee hatte den Wald sofort wieder vergessen. Doch man könnte vielleicht sagen, der Wald ihn nicht. Der Wald rief sich in Erinnerung. Und zwar genau in dem Moment, als Klee sich entschied, in Zukunft nicht mehr als Fahrer arbeiten zu können und den alten Traum vom Hotel erneut aufzugreifen. Der Traum war da, und der Wald war da. Mag sein, dass auch ein wenig der Umstand mitspielte, dass wieder Herbst war und eine milde Frische in der Luft lag, als Klee seinen Entschluss traf und zu diesem Zweck Kontakt zu einem Makler aufnahm, der im entsprechenden Landkreis Immobilien anbot.
Es war schon klar, dass es sich bei den drei Gebäuden, die infrage kamen, um Wohnhäuser handelte und sich somit die Notwendigkeit einer behördlichen Umwidmung zur Nutzung eines Beherbergungsbetriebs ergeben würde. Wobei Klee nur in geringem Maße an eine Veränderung der äußeren Anlage dachte, sondern vor allem der inneren. Und natürlich entsprach die Konzeption dem, was als »Pension« klassifiziert wurde, vor allem in Bezug darauf, dass nur wenige Zimmer entstehen sollten und es auch keine große Küche und schon gar kein Restaurant geben würde. Zugleich aber schwebte Klee eine absolute Schönheit dieses Inneren vor: vier oder fünf unterschiedlich gestaltete Gästezimmer, in denen eine Klarheit der Form nicht auf Kosten von Wärme und Gemütlichkeit gehen sollte. Weiters ein kleiner Frühstücksraum, in dem er etwas zu servieren plante, was seine Gäste verblüffen sollte: ein Weltklassefrühstück. Zudem hatte er einen Raum im Sinn, den Pensionen selten besaßen, nämlich eine Lounge. Und nicht zuletzt eine kleine Bar, der er den Namen Riff geben wollte und in der dann auch alle Benutzer sich wie Riffbewohner fühlen sollten.
Es war nicht das Substantiv Luxus, an das er dachte, sondern das Adjektiv perfekt. Ein perfektes Inneres. Ein perfektes Leben in einem dem Phänomen kleiner Nächte gewidmeten Hotel aus der Ordnung der Pensionen.
Wie oft in seinem Leben war er denn verliebt gewesen? Jetzt abgesehen von diesem Verliebtsein im Moment, da er einen herbstlichen Wald betreten hatte, und sich dieser Wald Jahre später, als es galt, einen Platz für das geplante Hotel auszuwählen, wieder ins Gedächtnis drängte.
Wie oft also? Paul Klee hätte trocken geantwortet: einige Male. Aber er hätte auch sogleich daran gedacht, wie wenig diese Momente des Verliebtseins je in echte Liebe übergegangen waren. Und ihm stets vorgekommen war, die betreffenden Zustände mit übertrieben starkem Willen herbeizuführen. Zustände der Lust, des Begehrens, auch der Freude, Freude über Gespräche, Freude über gutes Essen und hoffentlich guten Sex. Und wenn der Sex schlecht war, ein geringes Bedauern, und wenn er gut war, die Gewissheit, dass es das zum Glück halt auch gab. Mehr aber nicht.
Und was spürte er nun, als er diese Frau sah?
Diese Frau dort, die am Eingang zum Grundstück stand, gegen die Motorhaube ihres Wagens gelehnt, dabei auf ihr Smartphone sah und mit ihrem Finger über die kleine Scheibe strich. Wäre jetzt ein Zeitreisender aus einer früheren Epoche vorbeigekommen, er hätte sich wohl gedacht, dass hier eine schöne Frau in ihren Schminkspiegel sieht und soeben ein Insekt verscheucht, das sich auf dem Glas niedergelassen hatte. Und vielleicht hätte er überlegt, welcher Hersteller von Schminkspiegeln wohl einen angebissenen Apfel als Firmensymbol benutzte.
Schön war sie, die Frau. Aber was heißt das? Er, Klee, war ja kein Mann aus der Vergangenheit, der in den Dimensionen der Schminkspiegel zu denken pflegte. Und doch erkannte er die Anmut dieser Person: dreißigjährig etwa, definitiv blond und definitiv langhaarig, schlank, aber auf eine sportliche Weise kräftig, groß gewachsen, elegant, gerade. Ja, der Typ, der selbst noch im Anlehnen an eine Motorhaube einen absolut aufrechten Eindruck hinterließ.
Als diese Frau nun ihr Gesicht hob – nicht, weil sie Klee sah, sondern das Geräusch des sich nähernden Wagens vernahm, in dem er saß –, stellte Klee trotz der Entfernung fest, wie ungemein perfekt ihr Gesicht war. Genau so, wie er sich das für die Zimmer und die Lounge und die Bar dachte, die er dort oben, in dem weißen, an den Hang gebauten Gebäude, einrichten wollte. Ein Gesicht in Form.
Gibt es Wunder? Vielleicht nicht. Aber dann gibt es zumindest passende Zufälle. Ideale Zufälle. Wegweisende Zufälle. Und als ein passender, idealer, wegweisender Zufall erschien es Klee durchaus, dass ausgerechnet eine solche Frau mit einem solchen Gesicht und einer solchen Anmut – obgleich mit einem leichten Ausdruck von Ungeduld, weil wohl noch andere Termine anstanden – hier auf ihn wartete, gegen das Auto gelehnt. Schöner konnte man gar nicht lehnen. Hätte sie sich gegen einen Schreibtisch von Marcel Breuer gelehnt, es hätte nicht besser aussehen können.
Klee parkte seinen Wagen hinter dem ihren und stieg aus. Sie wandte sich ihm zu.
»Herr Klee, nicht wahr?«
»Ja.«
»Sander«, stellte sie sich mit ihrem Nachnamen vor und erklärte, für das von ihm beauftragte Maklerbüro zu arbeiten. Dann fragte sie, mit einem Blick auf ihr Smartphone: »Und Paul ist tatsächlich Ihr Vorname?«
»Wieso?«
»Ich dachte, unsere Sekretärin hat sich vielleicht verschrieben. Also entweder beim Vornamen oder beim Nachnamen.«
»Nein, Paul Klee ist schon richtig. Ich male aber nicht, wenn es das ist, wonach Sie fragen.«
Sie verzog ihre Lippen zu einem leichten Schmunzeln. Und indem sie das tat, erkannte Paul die Narbe, die in zwei voneinander fortlaufenden Bögen ihren linken Mundwinkel verließ: ein kleiner, konvexer Bogen, der nach unten führte, und ein etwas größerer konkav geformter in Richtung auf die Mitte der Wange.
Wenn Paul kurz zuvor, aber eben von fern und aus seinem Wagen schauend, die Perfektion dieses Gesichts wahrgenommen hatte, dann änderte der Umstand dieser Narbe rein gar nichts daran. Die Narbe führte zu keinerlei Entstellung, eher wirkte sie wie eine zarte Signatur. Und das gab es ja, nicht nur Tattoos und Piercings, sondern auch tatsächlich Ziernarben. Und als solche erschien ihm diese Narbe. Wie mit einem Zirkel gezogen. Aber keine Frage, die beiden Bögen verwiesen auf irgendeine Katastrophe im Leben dieser Frau. Und klar auch, dass Paul jetzt bemüht war, von der Narbe wegzusehen, seinen Blick auf ihre Augen richtete, Augen von sehr hellem, rötlichem Braun, rehbraun, wie das heißt, aber mit ein paar dunkleren Flecken gleich länglichen Schatten. Wie von einer späten Sonne geworfen.
Natürlich konnte er nicht ewig in diese Augen hineinschauen, drehte seinen Kopf und blickte nach oben zu dem Haus, das er ja bisher allein von den Abbildungen und Plänen kannte, die ihm das Maklerbüro zugesandt hatte. Das Anwesen eines ehemaligen Zahnarztes, der hier seinen Alterswohnsitz gehabt hatte und vor Kurzem verstorben war. Seine Frau war zu ihrem Sohn gezogen und bot nun das Haus zum Verkauf an. Ein zweistöckiger, großzügiger Bau mit einer mächtigen, halbkreisförmigen Terrasse, die einen seitlichen Gebäudeteil dominierte. Ein Haus, das aber im Übrigen wie die meisten in dieser Ortschaft ohne architektonische Extravaganzen auskam, vor allem ohne Anklänge an die Moderne. Es war etwas, was Klee ein »Haushaus« nannte und damit einen für die Gegend typischen Konservatismus meinte. Häuser, deren Anblick eine einzige Assoziation zuließ, die darin bestand, zu sagen: Hier steht ein Haus. Und nichts anderes. Also kein Raumschiff oder Organismus oder gebautes Gefühl. Keine Verbeugung vor der Natur und kein Stück Poesie. Sondern eben ein Haushaus.
Das war Paul aber nicht unrecht. Sein Ziel würde es sein, in diese konventionelle Hülle ein unkonventionelles Inneres zu fügen. In eine Hülle, die natürlich nicht umsonst war, wie es auch nicht gerade umsonst sein würde, die Umgestaltung und Einrichtung der vielen Räume und Räumlichkeiten vorzunehmen. Allerdings verfügte Klee nicht nur über ein ganz ordentliches Eigenkapital, sondern außerdem – auf Vermittlung seines ehemaligen Arbeitgebers und als dessen letzte Tat für ihn – über einen Bankkredit, der die Umsetzung von Klees Projekt ermöglichte. Ein Projekt, das naturgemäß zuerst einmal eine Menge Geld verschlingen würde, bevor ein erster Euro damit zu verdienen war.
Zusammen betraten sie das Grundstück, betraten das Gebäude und durchwanderten die Räume. Frau Sander beschrieb das Sichtbare und ließ sich auch ein wenig über das Unsichtbare aus: Leitungen, die in der Wand verliefen; einen Wasserschaden, den sie nicht verheimlichen wollte, der aber bereits behoben worden war; der jüngst kontrollierte, einwandfreie Schornstein über dem großen offenen Kamin.
Zu Klees Überraschung gab es auch einen Raum, in dem ein hochmoderner Zahnarztstuhl aufgestellt war, dazu sämtliches Zubehör. Sauber, glitzernd, dental, unheimlich. Die anderen Räume waren vollkommen leer, aber hier schien alles nur darauf zu warten, dass der Zahnarzt zurückkam, um erneut seine Tätigkeit aufzunehmen.
»Ich dachte«, sagte Klee, »der Besitzer wäre schon lange in Rente gewesen.«
»Ich weiß auch nicht«, sagte Frau Sander, »vielleicht hat er sich das aus Sentimentalität so eingerichtet. Oder er hatte noch Privatkunden. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wir müssen da noch mit den Eigentümern reden, damit sie die Sachen abholen. Das muss natürlich fort.«
»Der Stuhl ist ein kleines Vermögen wert«, meinte Klee.
»Ja, es kommt alles weg«, sagte Sander, was so klang, als meine sie das Vermögen.
Nachdem Sander und Klee sämtliche Räume begangen, zusätzlich Keller und Dachboden begutachtet hatten, traten sie über einen Wintergarten hinaus in den auf der Rückseite gelegenen größeren Teil des Gartens, dorthin, wo sich ein Schwimmbecken befand, nicht zentral, sondern in unüblicher Weise in die äußerste Ecke gebaut, und auch nicht in einem rechten Winkel zu dieser Ecke, sondern … nun, Klee sagte dazu schräg, womit er meinte, der Pool stehe quer zum Winkelscheitel. Die Poolwände schienen recht angegriffen, als sei das Bassin schon länger nicht mehr genutzt worden. Auf dem Grund des Beckens hatte sich eine dicke Schicht herabgefallener Herbstblätter gebildet.
Frau Sander schlug nun vor: »Wenn Sie wollen, können wir uns jetzt die anderen beiden Häuser ansehen.«
»Nein, ich glaube, ich bleibe bei dem hier«, antwortete Klee, was sich so anhörte, als hätte er gerade beschlossen, sich einen besonders hübschen Anzug zurücklegen zu lassen.
»Im Ernst?«, fragte Frau Sander. »Sie wollen sich die anderen Objekte nicht mal anschauen?«
»Es ist die Lage«, sagte Klee, »die Nähe zum Wald. Die übrigen Häuser befinden sich zu sehr in der Ortschaft. Nein, dieses hier ist das richtige. Ich würde mich später ärgern, wenn ich jetzt nachgebe, wir die anderen zwei besichtigen und ich zu zweifeln beginne. Ich mag nicht zweifeln.«
»Gut«, sagte Frau Sander. »Wollen wir gleich die Formalitäten durchgehen?«
»Gerne«, antwortete Klee und schlug vor, dies hier draußen im Garten zu tun. Drinnen war ohnehin kein Tisch mehr, an den man sich hätte setzen können, nicht einmal Stühle, von dem einen abgesehen, der den einen großen, mit einer breiten Fensterfront ausgestatteten Raum im oberen Stockwerk beherrschte und dessen zahnmedizinischer Anblick einem Albträume bescheren konnte.
Klee zeigte auf den kleinen runden, weiß lackierten Metalltisch und die beiden Stühle auf der anderen Seite des Gartens. Frau Sander nickte, und gemeinsam ging man hinüber. Sander trug übrigens Sportschuhe zu ihrem von einem hellen Rosa – so ein Sandrosa – bestimmten Hosenanzug und einem cremefarbenen Mantel. Was nicht weniger elegant wirkte, aber doch so, als sei sie eine Frau, die in absolut jeder Situation um eine ideale Beweglichkeit bemüht war. Zum Beispiel, wenn sie über einen von Laub bedeckten, ein wenig holprigen Grasboden marschieren musste, weil ihr Kunde auf ein Vertragsgespräch im Freien bestand.
»Das Licht ist einfach zu schön«, erklärte Klee.
»Jetzt könnte man doch meinen, Sie seien ein Künstler.« In ihrem Lächeln schien die Narbe ein wenig mitzuschwingen. Feine Fühler.
»Im Herbst neige ich etwas zur Träumerei«, meinte Klee, »das ist einfach meine Jahreszeit.«
»Sogar bei Nebel?«
»Nun, ich war die letzten zehn Jahre Chauffeur, da wird man nicht gerade zum Freund des Nebels. Jetzt aber ist das anders. Ich freue mich, dem Nebel als Hotelier und nicht als Fahrer zu begegnen.«
Sander sah Klee auf eine Weise an, als überlege sie, ob er ein bisschen verrückt sei. Wobei ihr Blick aber auch verriet, dass ihr die Vorstellung ganz gut gefiel, es mit einem leicht verrückten Mann zu tun zu haben.
Klar, Verträge waren nicht mittels Verrücktheit zu bewerkstelligen, wenngleich ihr Zustandekommen und ihre Folgen nicht immer nur geistige Gesundheit enthielten.
Die beiden nahmen Platz. Frau Sander positionierte ihr ungemein dünnes MacBook auf der Tischplatte. Es war von dem gleichen hellen Rosa wie ihre Kleidung, unterschied sich allein mittels der Textur, also das polierte Metall des Geräts kontrastierte das raue Leinen des Hosenanzugs.
Sie öffnete ihr Gerät.
Wäre jetzt noch einmal der Zeitreisende aus der Vergangenheit vorbeigekommen, er hätte vielleicht verwundert festgestellt, welche Größe und welchen Stellenwert manche Schminkspiegel im 21. Jahrhundert eingenommen hatten.
Die Frage nach der Möglichkeit einer Umwidmung des Gebäudes war bereits erörtert worden und dazu von der zuständigen Behörde unter einigen Auflagen ein positiver Bescheid in Aussicht gestellt worden. Die Auflagen betrafen vor allem eine mögliche Umgestaltung von Fassade, Baukörper und Garten, bezogen sich aber ebenso auf eine Erweiterung der Abstellfläche im Garagenbereich, die gewährleisten sollte, die Wagen sämtlicher Gäste aufnehmen zu können, um nicht etwa die schwierige Parksituation auf der schmalen Straße vor dem Haus zu verschärfen.
Sander ging mit Klee die einzelnen Punkte des Vertragsentwurfes durch und schickte sofort eine Mail an den Anwalt der Besitzerin. Die es unter dem Einfluss ihres Sohns eilig zu haben schien, an das Geld aus einem Hausverkauf zu gelangen.
»Man sollte mir etwas entgegenkommen«, meinte Klee, »das ist schon ein stolzer Preis. Ich meine, wenn zum Beispiel der schräge Pool picobello wäre, okay, aber der ist in einem eher schäbigen Zustand. Ich hoffe, man wird mir nicht anbieten, stattdessen den Zahnarztstuhl behalten zu dürfen.«
Sander versicherte nochmals, dafür zu sorgen, dass der Stuhl und das restliche Zahnarztinventar baldmöglichst abgeholt werde. Wie sie auch versprach, einen Preisnachlass zu verhandeln.
»Die Verkäuferin«, sagte sie, »wird das einsehen müssen.«
Klee überlegte.
Es war aber nicht der Kauf, den er überlegte. Er würde das Objekt selbst dann nehmen, wenn der Preis der gleiche blieb. Nein, was er jetzt sagte, war: »Es gehört sich, Sie so was erst zu fragen, wenn alles erledigt und der Kaufvertrag unterschrieben ist und ich also einen guten Vorwand habe … aber ich möchte Sie heute schon fragen, ob ich Sie zum Essen einladen darf.«
»Ach was!?«
»Ja!«, sagte Klee, so wie man Zehn! sagt, wenn man bei einem Fangspiel hochgezählt hat und bei der letzten Zahl angekommen losläuft.
»Finden Sie«, fragte Sander, »dass ich so aussehe, als hätte ich keinen Freund oder Mann?«
»Ich könnte Glück haben und Sie gerade in einer Pause erwischen.«
Pause war wirklich ein dummes Wort. Er schüttelte den Kopf und bat um Verzeihung.
»Was haben Sie denn im Sinn?«, fragte sie.
Er verstand nicht genau. Meinte sie das Essen?
Er sagte: »Wäre Ihnen Japanisch recht?«
»Nein, mich interessiert, was Sie sich vorstellen, dass passieren könnte, wenn Sie mich zum Essen einladen. Dass dann das Haus hier billiger wird?«
»Es würde reichen«, antwortete er, auf eine Bestrafung anspielend, »wenn es nicht teurer wird.«
Noch einmal versprach sie, sich mit dem Anwalt der Besitzerin bezüglich einer Preisminderung in Verbindung setzen zu wollen.
Klee dachte, dass sie es nach dem kurzen Geplänkel vorziehen würde, seine Einladung im Weiteren zu ignorieren. Doch als sie beide dann unten bei ihren Autos standen – er noch immer mit einem Audi, allerdings von 8 auf 3 heruntergerutscht, sie bei ihrem kleinen alten Renault-Cabrio mit schwarzem Stoffverdeck, bei dessen Anblick Klee an eine Koffernähmaschine denken musste –, da reichte sie ihm die Hand und fragte: »Und wann?«
»Das Essen?«
»Was sonst?«
»Morgen. Unten in der Stadt?«
Er meinte die nahe gelegene Stadt, bei der es sich eigentlich um eine Großstadt handelte, die aber kein Mensch als solche bezeichnet hätte. Selbst die Einwohner nicht. Dort, in der Stadt, war Klee in diesen Tagen in einem großen Hotel untergekommen und sah sich sehr darin bestätigt, der Besitzer und Betreiber eines kleinen Hotels sein zu wollen. Einer von Übersicht und Intimität geprägten häuslichen Anlage. Große Häuser mit noch so vielen Sternen wirkten auf ihn wie Bahnhöfe verzweifelt Gestrandeter.
Er nannte eine Uhrzeit, und er nannte den Namen eines Lokals, in dem er am Vortag gewesen war, in der Tat ein japanisches Restaurant, allerdings kein Edelschuppen, eher ein Lokal für jedermann. Jetzt, da jedermann Sushi zu sich nahm, als sei’s eine hübsch angerichtete Ansammlung von etwas Beiseitegelegtem, das nicht nur kalt, sondern auch im Beiseitelegen und Kaltwerden ein bisschen teurer geworden war.
Sie kannte das Restaurant. Sie sagte, sie wohne unweit davon. Und sie sagte, sie freue sich.
Hinterher würde Klee darüber grübeln, was es gewesen sein mochte – egal, ob Frau Sander nun einen Mann oder einen Freund hatte oder gerade eine Pause machte –, das sie dazu gebracht hatte, seine Einladung anzunehmen.
Wie konnte man eigentlich sagen, dass Paul Klee aussah?
Ziemlich gut, hätte man antworten können. Aber war nun dieses »ziemlich« eine Einschränkung oder eine Verstärkung?
Es war ähnlich wie bei einer Serie von Rissen, die eine gesprungene Scheibe durchziehen. Vielleicht eben beides: Einschränkung und Verstärkung. So wie bei dem berühmten Kunstwerk von Marcel Duchamp mit dem Titel Das Große Glas, bei dem es sich um eine bemalte, zweiteilige Glasplatte handelt, die beim Rücktransport von einer Ausstellung zerbrochen war, Duchamp jedoch bei der Instandsetzung des Objektes die Zersplitterung des Glases erhalten und zu einem wesentlichen Teil des Kunstwerks gemacht hatte. Und es ist gar keine Frage, dass dieses surrealistische Objekt – das eine Braut darstellt, die von Junggesellen begehrt wird, deren Begehren wiederum eine Schokoladenreibe in Gang setzt –, dass dieses Bild mit seinen Sprüngen, also den Fehlern, sehr viel besser wirkt als ohne. Und doch sind die Sprünge ein Makel. Aber eben ein gelungener Makel.
Anders als in Frau Sanders Gesicht, wo sich eine deutliche Narbe abzeichnete, waren die Sprünge in Klees schmalem, länglichem und kantigem Männergesicht nicht sichtbar, bildeten aber gewissermaßen den Geist in diesem Gesicht. Es war vielleicht etwas, was man am ehesten als Schwermut definieren konnte. Eine Schwermut wie bei Menschen, die selbst in Momenten größten Eifers oder Ehrgeizes ein Gefühl der Sinnlosigkeit entwickeln. Zumindest das Gefühl, dass alles, was je Sinn hatte, längst vergangen ist.
Zu Klees Körper war zu sagen, dass dieser vollkommen ohne Splitterung war. Absolut durchtrainiert, ohne Hinweis auf eine Verzweiflung. Bei einem langjährigen Chauffeur ungewöhnlich, aber Klee hatte sich eben immer auch als eine Art Leibwächter empfunden und dementsprechend seinen Körper ausgerichtet. Was ihn schließlich überhaupt erst in die Lage versetzt hatte, mittels Wendigkeit, Kraft und Schnelligkeit Rehberg aus dem Wagen zu befreien und in Sicherheit zu bringen.
Natürlich, er war nicht dreiundzwanzig, sondern dreiundvierzig, und selbst das Durchtrainierte besaß den Anklang jenes noch immer nicht gänzlich verstandenen Phänomens, das man als die »Begrenzung der Lebensdauer« kennt. Allerdings nicht in Form von Rissen in einem Glas, sondern als Ausdruck einer Verwunderung, eines Erstaunens darüber, nicht ewig zu leben.
War es das, was Frau Sander interessierte? Indem sie hinter dem gut sitzenden Anzug Klees einen gut trainierten, aber bereits im Zustand der Verwunderung befindlichen Körper vermutete? Oder doch eher das schöne, jedoch von Zersplitterungen gemaserte Gesicht? Oder gar die Art, wie er recht offen erklärt hatte, einfach nicht auf einen günstigeren Zeitpunkt warten zu wollen, um sie einzuladen? Oder war es die Summe aus Attraktivem und Befremdlichem?
Vielleicht ging es Frau Sander mit Klees Gesicht ähnlich wie Marcel Duchamp mit seinem Großen Glas, als er 1956 in einem Interview erklärte: »Aber umso länger ich es betrachte, umso mehr mag ich die Sprünge: Sie sind nicht wie gebrochenes Glas. Sie besitzen eine Gestalt. Es ist eine Symmetrie in diesen Sprüngen.« Um dann anzufügen, dass darin beinahe so etwas wie eine Absicht zu erkennen sei. »Eine eigentümliche Intention, für die ich nicht verantwortlich bin, in anderen Worten eine Readymade-Intention, die ich respektiere und liebe.«
Vielleicht war es genau das. Klees »liebenswerte Symmetrie der Brüche« in seinem gut gebauten Männergesicht und seiner gut gebauten Männerseele.
Vielleicht aber etwas ganz anderes. Er würde schon noch draufkommen. So wie er auch noch draufkommen würde, wie Sander mit Vornamen hieß, denn im Moment war sie einfach nur Frau Sander.
3Rugby
Als die Frau ohne Vornamen das Lokal betrat, saß Klee bereits am reservierten Tisch. Er erhob sich. Sie schlüpfte aus dem Mantel, den er ihr abnahm und an einen Haken hängte. Angesichts der Kälte draußen handelte es sich um einen ungemein dünnen Mantel, der sich in Klees Händen eher wie ein Nachthemd anfühlte. Ganz offensichtlich war Sander nicht der verfrorene Typ. Oder aber sie fror lieber, als sich in das Ungraziöse dicker Mäntel oder wattierter Jacken zu fügen.
Gemeinsam nahmen sie Platz. Ein Kellner erschien und legte ihnen zwei Karten auf den Tisch.
Sander bestellte einen Sake, kalt. Das war nicht weiter verwunderlich, bemerkenswert aber, dass sie sich dabei mit dem Kellner auf Japanisch unterhielt. In einer Weise, die in Klees Ohren einen absolut fließenden Eindruck hinterließ. Aber was wusste er schon?
Nachdem der Kellner gegangen war, fragte Klee: »Wo haben Sie Ihr Japanisch her?«
»Unter anderem von meinen Eltern«, antwortete Sander.
»Diplomaten?«
»Nein, Lehrer.«
»Japanischlehrer?«
»Nein, Deutschlehrer«, sagte Sander. »Mehr noch als mein Japanisch habe ich von ihnen mein Deutsch.«
»Das müssen Sie mir jetzt erklären«, meinte Klee.
Und das tat Sander, indem sie eine Geschichte präsentierte, die den Charakter von etwas Ausgedachtem besaß. Nichtsdestotrotz aus dem echten Leben stammte.
Ihre Eltern waren Adoptiveltern. Ein japanisches Lehrerehepaar, das an verschiedenen Hochschulen in Osaka, später in Tokio Deutsch unterrichtetet hatte.
»In Japan adoptiert?«, zeigte sich Klee verwundert.
»Meine Geburt und Herkunft sind ein wenig rätselhaft«, sagte Sander.
Sie erzählte davon, als Neugeborenes vor einem Krankenhaus in Osaka abgelegt worden zu sein. Das war 1984 gewesen. Natürlich sei sofort festgestellt worden, dass sie kaum das leibliche Kind japanischer Eltern sein konnte. Ein Grund mehr, der eine frühe Adoption verhinderte. Wie ja überhaupt erst 1988 ein geregeltes Adoptionssystem für Kinder in Japan eingeführt wurde. Im Gegensatz zur Erwachsenenadoption mit ihrer jahrhundertealten Praxis, die dazu diente, das männliche Erbfolgesystem zu sichern, zwischenzeitlich aber auch half, die familiäre Pflege alter Japaner zu gewährleisten.
»Ich kann nicht sagen, wer meine Mutter war«, erklärte Sander. »Vielleicht eine Rucksacktouristin, die ihrerseits nicht sicher sein konnte, wer der Vater ihres Kindes ist, vor allem wo der Vater ihres Kindes ist. Vielleicht, vielleicht nicht. Ich kann die Umstände nicht benennen, und wahrscheinlich werde ich das auch nie können.«
Jedenfalls sei sie in einem japanischen Waisenheim aufgewachsen, und zwar mit einem – wie man sagen kann – falschen Augenpaar. Sie habe sich wie ein Monster gefühlt, obgleich viele junge Japaner heutzutage versuchen würden, mittels Lidoperationen westlichen Idealen zu folgen. Aber nicht dort, wo sie ihre ersten Jahre verbracht hatte.
»Wenn es eine böse Strafe war«, sagte Sander, »dass mich meine Geburt an diesen Ort befördert hat, dann war die gute Antwort auf diese Strafe dieses Lehrerehepaar. Ich war bereits sechs Jahre alt, als die beiden das Heim aufsuchten. Zwei Japaner mit einer ungeheuren Liebe zur deutschen Sprache und Literatur. Sie konnten einfach nicht der Verführung widerstehen, mich auszusuchen. Dabei war doch recht ungewiss, woher meine Eltern stammen, sie hätten ebenso … also, verstehen Sie, das Deutsch, das ich spreche, ist das Deutsch meiner japanischen Adoptiveltern. Ein präzises Hochdeutsch. Und sollte darin irgendein kleiner Akzent sein, dann ist es ein japanischer.«
Nicht, dass Klee diesen herausgehört hätte.
»Mit neunzehn«, erzählte sie, »reiste ich mit meinen Eltern nach Deutschland. Es sollte eine große Tour werden. Eine kulturelle Erfüllung. Aber sie starben, und zwar auf eine völlig absurde Weise. Ein zugekiffter Autofahrer, der mitten im Stadtverkehr auf den Gehweg raste, wo wir alle brav vor einer roten Ampel standen. Ich war ein Stück hinter ihnen, meine Eltern aber hat es erwischt. Sie waren beide sofort tot. Ich habe sie hier begraben, im Land ihrer Sehnsüchte, im Land von George und nahe dem Land von Trakl. Für sie waren George, Rilke und Trakl die Götter. Eigentlich hätte ich einen Teil von ihnen in Österreich beerdigen sollen, wenn das ginge. Es ist für manche Menschen schade, nicht an mehreren Orten begraben zu sein.«
Während man ihr den Sake in einer kleinen, schmalen Karaffe servierte und in eine Schale füllte, erklärte sie, weder für George noch für Trakl zu schwärmen, überhaupt nicht für die Dichtung oder Literatur. Aber es sei eben das, was sie an ihre Eltern erinnere. Und als sie dann die beiden im Land ihrer Sehnsüchte begraben hatte – immerhin war ein kleines Erbe vorhanden –, war sie in diesem Sehnsuchtsland geblieben, das ja möglicherweise das Land ihrer leiblichen Mutter war.
Klee meinte, dass heutzutage eine solche These anhand der eigenen DNA leicht zu stützen oder zu widerlegen wäre.
»Ja, sicherlich. Aber so genau will ich es nicht wissen. Mir genügt die Vermutung. Und mir genügt das Deutsch, das mir meine Eltern beigebracht haben, als ich sechs war und sie mich zu sich nahmen.«
»Sander ist aber nicht japanisch, oder?«
»Der Name meines Mannes, von dem ich geschieden bin. Meine Eltern hießen Himori. Sie haben mir den Vornamen Inoue gegeben.«
»Ach, und den tragen Sie aber noch, oder?«
»Genau.«
»Also Inoue Sander.«
Sie nickte.
»Mein Gott«, sagte er und schien deutlich betört, »das klingt ganz wunderbar.«
Und wie um die Betörung etwas einzudämmen, fragte Klee, wie Inoue Sander denn dazu gekommen war, sich mit dem Verkauf von Immobilien zu beschäftigen. Als frage er, wie man mit einem so hübschen Namen einen derart hässlichen Beruf ergreifen könne.
»Das ist nichts«, erklärte die Frau mit dem schönen Namen, »wovon ich geträumt habe. Es ist ein Job, nicht mehr. Das Beste daran ist, wie wenig ich im Büro sitze und eher selten am Computer, sondern viel unterwegs bin, Türen aufschließe und Leute herumführe und ihnen die Vorzüge eines bestimmten Objekts erkläre.«
»Kein Objekt, das nicht auch Nachteile hätte.«
Ende der Leseprobe