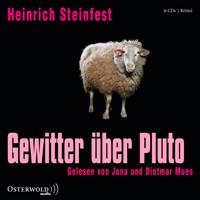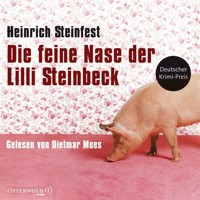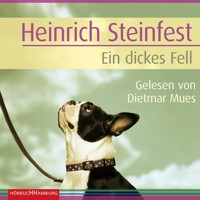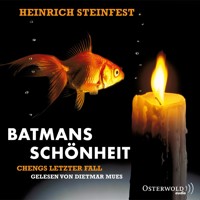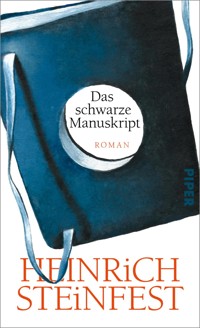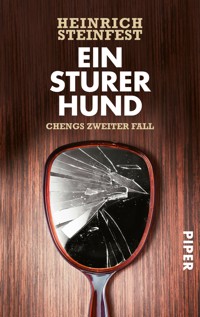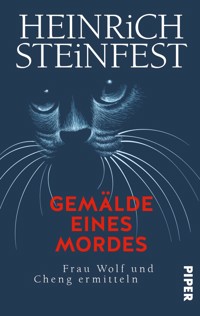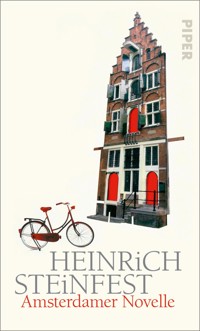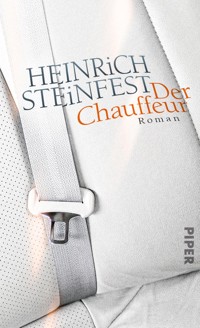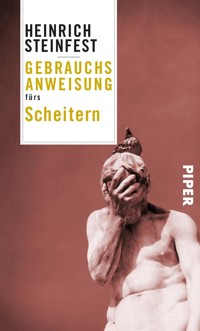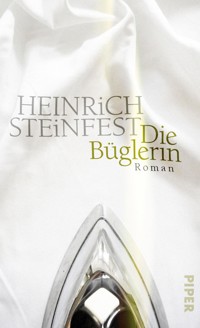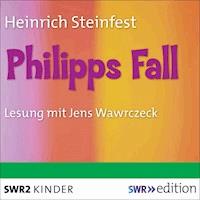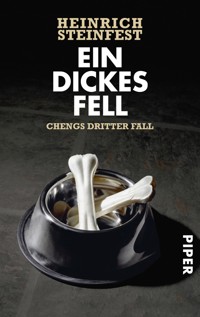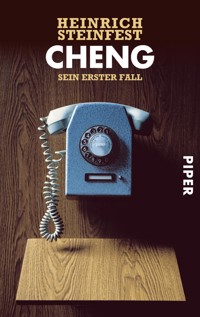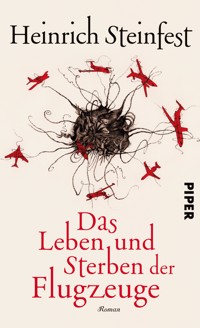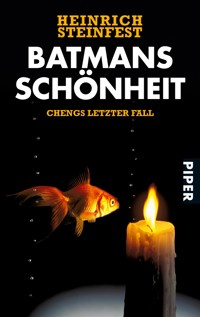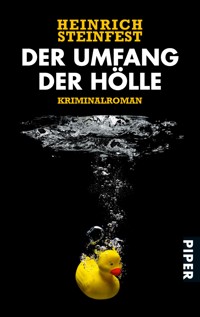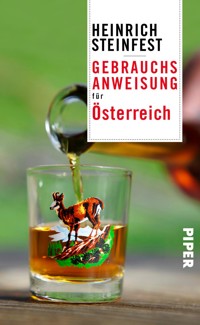
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wiener Schnitzel und Schwedenbombe, dramatische Bergkulissen und pompöse Architekturen, Zwölftonmusik und Alpenjodler, Burgtheater und Kasperltheater – Österreich hat viele Seiten, und Heinrich Steinfest kennt sie alle. Der preisgekrönte Autor und leidenschaftliche Österreicher geht auf Tauchfahrt in die kakanische Seele, ergründet die Riten der Einheimischen, führt uns zum Heurigen und weiht uns ein in das dunkle Geheimnis des österreichischen Fußballs. In einem Feldversuch entwirft er ein eigenwilliges Landschafts- und Sittenbild seiner Heimat; er fragt sich, wieso die Kunstform der Operette endgültig das gesamte Staatswesen erobert hat und wie viele Kilos man in sieben Tagen Österreich zunehmen kann. Oder abnehmen. Ein Vademekum für jede Reise auf die abgründige »Insel der Seligen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deISBN 978-3-492-96553-8Überarbeitete und erweiterte NeuausgabeMai 2017© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2008Redaktion der überarbeiteten Neuausgabe: Sabine Wünsch, München
Karte: cartomedia, KarlsruheCovergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaasbuchgestaltung.de
Coverabbildungen: Kärnten, Biosphärenpark Nockberge, regionaler Zirbenschnaps; Robert Haidinger/Laif)
Datenkonvertierung: Fotosatz Amann, MemmingenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Es steht geschrieben: Wir haben mitder Vergangenheit abgeschlossen,aber die Vergangenheit nicht mit uns.(aus Magnolia, Film von Paul Thomas Anderson)O gutes Land! O Vaterland! InmittenDem Kind Italien und dem Manne DeutschlandLiegst du, der wangenrote Jüngling, da:Erhalte Gott dir deinen JugendsinnUnd mache gut, was andere verdarben!(aus König Ottokars Glück und Ende von Franz Grillparzer)Es ist ganz einfach.Wenn es wackelt,dann ist es Fett.(Arnold Schwarzenegger als Arnold Schwarzenegger)
Bevor es losgeht
Grundsätzlich wäre zu sagen, daß der Reisende auch dort, wo Grenzkontrollen wegfallen und er etwa mittels eines Flugzeugs seine »Wanderung« als ein langgezogenes Beamen erlebt, niemals vergessen sollte, eine Trennlinie passiert zu haben. Es muß ihm klar sein, daß, wenn er dieses Flugzeug oder einen Zug verläßt oder aus seinem Wagen steigt, er sich nicht nur bloß auf einem anderen Staatsgebiet befindet, sondern in einer anderen Welt, einer anderen Sphäre. – Eine Grenze ist der stark geschrumpfte Raum zwischen zwei Sonnensystemen.
Vor allem sollte der Reisende sich nicht von den Ähnlichkeiten zur eigenen Kultur täuschen lassen. Die Unterschiede sind immer größer als die Gemeinsamkeiten. Die Teekannen in gewissen wundersamen Geschichten sehen auf den ersten Blick genauso aus wie jene, welche die Helden von zu Hause kennen, aber diese hier können sprechen und sich bewegen. Und es gibt ja wohl kaum einen größeren Unterschied als den zwischen sprechenden und nichtsprechenden Teekannen.
Des öfteren kommt das Überschreiten der Grenze dem Durchdringen eines Spiegels gleich, so wie man das aus Jean Cocteaus Orphée kennt, wenn Jean Marais durch eine wasserartige Scheibe die Unterwelt betritt. Das Land auf der anderen Seite der Grenze ist immer das Jenseits. Und daß im Reich der Toten andere Regeln gelten als im Reich der Lebenden, das sollte Ihnen wohl klar sein. Vergessen Sie das also nicht, wenn Sie nach Österreich kommen. Lassen Sie sich niemals von Ihrer grundsätzlichen Vorsicht abbringen, nur weil so manches Ding, so mancher Mensch und Gegenstand stark mit dem verwandt scheint, was Sie aus Ihrem eigenen Land kennen. Lassen Sie sich nicht irreführen, etwa von einer Kaffee- oder Teekanne, die harmlos und ohne ein Wort zu reden vor Ihnen steht. Daß sie stumm scheint, bedeutet nicht, daß sie nicht reden kann, wenn sie will. Und daß Geschirr, welches derartige Fähigkeiten besitzt – also im richtigen Moment den Mund zu halten (welcher Mensch schafft das schon?) –, daß solches Geschirr noch zu ganz anderen Hexereien in der Lage ist, versteht sich.
Wie spreche ich einen Österreicher an, um ihn nicht zu beleidigen? Wie spreche ich einen Österreicher an, um ihn richtig zu beleidigen?
Der famoseste unter allen österreichischen Nestbeschmutzern, Thomas Bernhard, läßt in seinem als Komödie titulierten Prosawerk Alte Meister seine Hauptfigur Reger einen bemerkenswerten Satz aussprechen: »Der Österreicher ist tatsächlich der interessanteste Mensch von allen europäischen Menschen, denn er hat von allen anderen europäischen Menschen alles und seine Charakterschwäche dazu.« Und gleich darauf heißt es: »… die ganze Welt hat sozusagen immer einen Narren gefressen an ihm, eben weil er der interessanteste europäische Mensch ist, gleichzeitig ist er aber doch immer auch der gefährlichste. Der Österreicher ist mit großer Wahrscheinlichkeit der gefährlichste Mensch überhaupt …«
Dies ist natürlich in erster Linie in einem politischen und historischen Kontext zu verstehen, sollte aber auch prinzipiell und en détail so gesehen werden. Im Umgang mit Österreichern empfiehlt es sich, ob deren »Schönheit« nicht deren »Giftigkeit« zu übersehen. Diese Warnung gilt vor allem für den deutschen Reisenden, der sich nicht selten eine Artverwandtschaft einredet, mitunter sogar eine Blutsverwandtschaft, und sich darum eine Nähe und Vertraulichkeit erlaubt, die unvernünftig ist. Man würde ja auch nicht mit einer hochgiftigen Staatsqualle in Berührung treten, nur weil man selbst zufälligerweise ebenfalls zum Stamm der Hohltiere zählt.
Nein, Vorsicht ist eine gute Basis, um in Kontakt zu einem Österreicher zu treten, der zwar ständig zum Fraternisieren einlädt, es aber nicht wirklich schätzt, wenn man diesen Einladungen auch folgt. Ausschlagen sollte man die Einladungen natürlich ebensowenig, sondern dem Österreicher signalisieren, daß man an ihm interessiert ist, ganz in der Art, wie man zu einer Frau oder einem Mann sagt: »Sie gefallen mir, aber ich bin schon verheiratet.« Flirten darf man ja trotzdem. (Der Unterschied zwischen Flirten und Fraternisieren ist der, daß bei ersterem die Grenze erhalten bleibt, bei zweiterem nicht.)
Da der Österreicher sehr stark im Bewußtsein jener von Thomas Bernhard definierten Besonderheit lebt, eben der Interessanteste und der Gefährlichste von allen zu sein, schätzt er es natürlich gar nicht, auf seine Kleinstaatlichkeit heruntergestuft zu werden. Auf seine geographische Schrumpfform. Vielmehr sieht er sich als »Kulturmensch«, ja als der Kulturmensch. Und weil sein Selbstbewußtsein in bezug auf die Kultur enorm ist, widerstrebt es ihm, genaue Definitionen vorzunehmen. Sowenig ein Engel erklärt, warum er ein Engel ist. Engel wird man einfach. Jedenfalls ist der Kulturbegriff der Österreicher sehr viel weniger konkret, als man das bei anderen Europäern erlebt. Für den Österreicher ist praktisch alles Kultur. Und alles ist sein eigenes Verdienst. Selbst die Natur. Der Österreicher hält die Natur in seiner Umgebung für einen Ausdruck der eigenen Kulturleistung. Jedes Blatt, jeder Zweig, jedes Vogelzwitschern, jeder schmackhafte Pilz stellt ein aus dem Wollen und dem Denken heraus geborenes hiesiges Produkt dar.
Das erkannte bereits Adalbert Stifter, der in seiner Erzählung Bergkristall über die Erhebung nahe einer Ortschaft schreibt: »Dieser Berg ist auch der Stolz des Dorfes, als hätten sie ihn selber gemacht, und es ist nicht so ganz entschieden, wenn man auch die Biederkeit und Wahrheitsliebe der Talbewohner hoch anschlägt, ob sie nicht zuweilen zur Ehre und zum Ruhme des Berges lügen.«
Für einen Berg lügen, das ist dem Österreicher ganz selbstverständlich. Überhaupt das Lügen, obgleich man es natürlich so nicht ausdrücken würde. Man lügt nicht im Bewußtsein einer Verfälschung der Fakten, sondern ganz im Gegenteil, man lügt, um einer Sache gerecht zu werden, die Wahrheit in die richtige Richtung zu verbiegen. Wie sich das bei schöpferischen Menschen gehört oder Menschen, die sich für schöpferisch halten. Sie lügen nicht, sie erfinden.
Die Dinge, die natürlichen wie die künstlichen, sind dem Österreicher so vertraut und naturgemäß, daß er etwa mit Leichtigkeit über Bücher redet, die er nie gelesen hat. Das hat nichts zu tun mit dem Improvisieren anderswo. Der Österreicher denkt ja, auf eine gewisse Weise dieses bestimmte Buch tatsächlich gelesen zu haben, es quasi von innen heraus gelesen zu haben. Er ist derart überzeugt davon, daß er mit Leichtigkeit stundenlang über Nestroy und Schnitzler und Musil, vor allem aber über Haßfiguren wie Handke, Jelinek und eben Thomas Bernhard reden kann, ohne je ein Wort davon gelesen zu haben. Und es wäre weder höflich noch ratsam, als der Gast, der Sie sind, zu versuchen, genau diesen Umstand ruchbar werden zu lassen. Sie dürfen ruhig kritisch sein, das ist kein Problem, Sie können auf Widersprüche hinweisen, Ihre eigene Meinung zum besten geben, heftig debattieren, aber kommen Sie bitte nicht auf die Idee, dem Österreicher vorzuwerfen, er könne besagtes Buch doch gar nicht gelesen haben. Der Österreicher würde sich nämlich nicht ertappt, sondern völlig zu Unrecht beschuldigt fühlen. Noch dazu als der Kulturmensch, der er nun mal – höchstwahrscheinlich gottgegeben – seit jeher ist.
Der Österreicher gibt viel auf das Gottgegebene. Aber als der spezielle Katholik, als der er sich fühlt, ein an Missionierungen und Weltrettungen desinteressierter Barockmensch, versucht er nicht, aus den göttlichen Entscheidungen weltliche Rechtfertigungen herauszufiltern. So überzeugt er davon ist, daß Gott sich bei allem etwas gedacht hat, so wenig spekuliert er darüber, was Gott sich gedacht hat. Der Österreicher ist ein untheologischer Mensch, der mehr auf die Macht des Rituals hört als auf die Stimmen aus dem Himmel. In dieser Hinsicht ist er ein äußerst weltlicher Charakter, der sich selbst von einem Wunder nicht wirklich beeindrucken lassen würde. Weil er nämlich auch das Wunder als Ornament erkennt, als eine Schmückung, nicht als einen Fingerzeig. Was wiederum auf eine gewisse Unbelehrbarkeit hindeutet. Und das ist ja sicherlich der Fall. – Glauben Sie bitte nicht, der Österreicher würde sich von der Stichhaltigkeit eines Arguments beeindrucken lassen. Er ist kein Formelmensch, allerdings auch kein Bauchmensch, sondern eben ein Kulturmensch, für den die Art, wie ein Argument vorgetragen wird, mehr zählt als das Argument selbst. Wenn Sie ihn überzeugen wollen, dann achten Sie also auf Ihre Fabulierkunst, bemühen Sie sich um Witz und Charme und Eleganz, und vernachlässigen Sie das Prinzip exakter Wissenschaft. Lieber ein schöner falscher Satz als ein richtiger Satz, der den Verdacht nährt, Sie seien fade, kleinmütig und phantasielos. Das aus der experimentellen Mathematik bekannte Prinzip, nach dem einfache Lösungen die schönsten sind, gilt dem Österreicher wenig. Man kann sagen, er ist ein Meister des Umständlichen, ein Meister der Umwege und der Verwicklungen. Wenn man etwas kompliziert sagen kann, wieso einfach?
Es ist darum auch ganz bezeichnend, daß einer der bekanntesten österreichischen Maler, der Spiral- und Zwiebelturmvirtuose Friedensreich Hundertwasser, die gerade Linie als »gottlos« einstufte. Die gerade Linie ist die logische Verbindung zwischen zwei Punkten. Der Österreicher widersetzt sich dieser Logik, geht dahin und dorthin, entdeckt neue Aussichten, produziert im Stile einer Schnecke kurvige Schleimspuren, verliert sich, gelangt aber dennoch irgendwann – ein Meisterwerk gekonnter Verirrungen hinter sich lassend – zu Punkt B, freilich mit einiger Verspätung. Woraus sich für Sie, lieber Reisender, zwei wichtige Aspekte ergeben:
Erstens: Wenn Sie einen Österreicher nach dem Weg fragen, wundern Sie sich nicht über die Weitschweifigkeit seiner Ausführungen (er ist schließlich kein Navigationssystem, sondern ein literarisch begabtes Wesen), und genießen Sie die Orte, an welche diese Ausführungen Sie bringen werden (man weiß sowieso nicht, ob es nicht eh besser war, nicht gleich dort anzukommen, wo man hinwollte).
Zweitens: Gehen Sie davon aus, daß, wenn Sie sich mit einem Österreicher verabreden, er mit großer Wahrscheinlichkeit zu spät kommt. Nehmen Sie es nicht persönlich. Und seien Sie nicht so vermessen zu meinen, der Österreicher könnte doch ausnahmsweise – dem Gast zuliebe – pünktlich sein, ausnahmsweise den direkten Weg zwischen zwei Punkten nehmen. Das wird er nicht tun, besagter »Gottlosigkeit« wegen.
Daraus resultiert der Irrtum, Österreicher seien besonders langsame und träge Menschen. Das stimmt nicht. Eher ist der Österreicher hochaktiv, ja hyperaktiv. Wo ein Deutscher zwei Schritte macht, macht er vier, von denen aber einer zur Seite und einer nach hinten führt. Auch in dieser Hinsicht besteht wieder die so überaus prägende Liebe zum Ornament. Das Ornament unterstreicht die Bedeutung der Dinge. Man geht oder fährt lieber einen bestimmten Umweg, wenn dieser dem Charakter des Ziels eher entspricht. Und das hat ja etwas für sich. Darum auch werden hohe Berge über schwierige, gefährliche Routen erklommen. Ginge es allein um das Erreichen des Gipfels, würde der Wanderweg auf der windgeschützten Rückseite ja völlig ausreichen. Der Österreicher ist ein verrückter Alpinist, selbst wenn er sich in Eisenstadt oder Graz befindet und ein Kaffeehaus aufsucht. Der Wert des Kaffeehauses erhöht sich mit der Umständlichkeit der Anfahrt.
Österreicher wollen natürlich, wie fast alle Menschen, nicht nur gelobt und hofiert und mit Rücksicht ob ihrer Eigenheiten behandelt werden, sondern sie wollen auch geärgert werden. Von Deutschen besonders gerne. Überhaupt ist der Österreicher eher dem Ärger verpflichtet. Seine in volkstümlichen Ritualen gepflegte Lustigkeit ist bloß eine kunstvolle Verniedlichung seines Ärgers, seiner fundamentalen Wut.
Die banalste, leider immer wieder praktizierte Form, einen Österreicher zu ärgern, besteht darin – ist man denn ein Deutscher –, so zu tun, als würde ein aus der gleichen Produktion stammender nagelneuer Mercedes, nur weil er von einem Deutschen in Deutschland erstanden wurde, schneller, schöner, sparsamer, luxuriöser, haltbarer und fahrerfreundlicher sein als das von einem Österreicher gefahrene, vollkommen identische Pendant. Ganz sicher stammt diese Manövertechnik aus einer Zeit, als deutsche Urlauber tatsächlich die größeren und stärkeren Wagen besessen haben. Nun ist diese Zeit zwar vorbei, aber es gibt Wunden, die braucht man nur einmal schief anzuschauen, schon sind sie offen.
Was dem einen sein Mercedes ist, ist dem anderen sein Hochdeutsch. Der Deutsche ohne Mercedes, aber mit Intellekt hat die Möglichkeit, sein österreichisches Gegenüber dadurch zu ärgern, indem er so tut, als wäre ein in Hochdeutsch vorgetragenes Argument richtiger als ein in Kärntnerisch oder Steirisch oder Wienerisch vorgebrachtes. Das ist ein Unsinn, den kein Deutscher wirklich glaubt, sehr wohl aber der Österreicher, zumindest je weiter es nach Osten geht. Vielleicht hat auch dies alte Wurzeln. Gebildete Österreicher leiden unter dem Dialektvorwurf, unter ihrer Hochdeutschunfähigkeit. Sie mögen das überspielen, sich vernünftig geben, die Leistungen der großen österreichischen Denker ins Spiel bringen … dennoch, sie ärgern sich. Und indem sie sich ärgern und vor allem ihr Vorurteil vom überheblichen Hochdeutschler bestätigt finden, fühlen sie sich gleich viel besser.
Jedoch ist auch dies natürlich eine eher simple Methode, zudem ist es mit dem Hochdeutsch der meisten Deutschen auch nicht weit her. Hochdeutsch ist mehr ein Gerücht. Die, welche es anzuwenden meinen, sind Blender. Blender, die Österreicher blenden.
Am besten kann man den Österreicher vielleicht damit ärgern, ihn nicht als Österreicher wahrzunehmen, sondern als halben Deutschen oder ganzen Europäer oder als Missing link zwischen Ost und West oder doch als Teil der internationalen Gemeinschaft. Denn der Österreicher will mitnichten irgendwo dazugehören. Wenn er es tut, wenn er sich sogar mehrheitlich, wie im Falle der EU, dafür entscheidet, dann zähneknirschend und aus Gründen einer ökonomischen Vernunft. Österreich ist schweizerischer als die Schweiz. Und man kann sagen, daß sich viele Österreicher selten so gut gefühlt haben als zu der Zeit, da wegen der Nazivergangenheit des Bundespräsidenten Waldheim eine gewisse Ächtung Österreichs, zumindest seines Staatsoberhaupts, stattfand. Damals erblühte ein mehr als notgedrungenes Wir-sind-wir-Gefühl. Die isolierte Position entsprach genau dem Selbstverständnis der Österreicher, nach dem Österreich eine »Insel der Seligen« ist – ein Kulturland, in dem sogar die Teekannen reden können – und rundherum bloß öde Weiten stumpfsinnig machender Ozeane.
Also nochmals: Österreicher sind Umwege suchende Alpinisten und Insulaner. Wenn Sie sie ärgern wollen, weigern Sie sich einfach, dies anzuerkennen, und quasseln Sie von den Parallelen innerhalb der europäischen Kulturen.
Der Österreicher und das Theater (und das Theater an sich)
Der Fall Peymann oderDer Feind in meinem Bett
Es gibt Deutsche, die der Österreicher mag, und Deutsche, die er haßt.
Zu ersteren zählen natürlich die Touristen, nicht nur des Geldes wegen, welches sie im Land lassen. Man schätzt sie wirklich, sehr viel mehr als noch vor zwanzig Jahren, als sie mit einer gewissen Überheblichkeit auftraten und so taten, als könnten sie sich so gut wie alles unter den Nagel reißen. Heute aber scheint es, als hätte ausgerechnet die Wiedervereinigung den Deutschen ihre Großmannssucht ausgetrieben, als sei das Land mit seiner Vergrößerung geschrumpft. Als hätten die Deutschen einsehen müssen, daß sie auch nur Menschen sind, selbst wenn sie siebzehnjährig das Tennisturnier von Wimbledon gewonnen haben. Mit solchen »geschrumpften« Deutschen kann der Österreicher gut. Für sie macht er auch hin und wieder den Kasperl, trägt Lederhosen oder reinweiße Strickmützen, erfüllt Erwartungshaltungen wie die von der Gemütlichkeit und Urigkeit, zeigt sich aber mit dem neuen Selbstbewußtsein des in seiner vorteilhaften Kleinstaatlichkeit prosperierenden Kultur- und Naturmenschen.
Im neuen Europa fühlen sich die Österreicher als das »Reich der Mitte«. Und am liebsten lassen sie sich dabei vom deutschen Urlauber betrachten. Dies freilich ist eine alte Sache, daß Deutsche und Österreicher sich gerne in einem spiegelnden Verhältnis gegenüberstehen. Der andere ist der Spiegel, in den man schaut. Man hält sich selbst für wirklich, und das, was man im Spiegel sieht, im geringsten Fall für ein seitenverkehrtes Abbild. Oder aber eine erschreckende Verdeutlichung. Oder eine mirakulöse Infamie (»Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist …«). Oder als eine willkommene Kompensation (à la Dorian Gray, was bei Österreichern bedeutet, daß immer die Deutschen die Nazis sind, sie selbst aber bloß »traditionell« und »volkstümlich«).
Zu den Deutschen nun, die die Österreicher hassen, gehören natürlich jene, welche hierherkommen, um eine führende Position zu übernehmen und den Einheimischen zu erklären, wo es langgeht. Um noch einmal das Spiegelbeispiel zu bemühen: Mittels eines deutschen Vorgesetzten erkennt der Österreicher sich selbst als Monster. Und wer bitte schön möchte ein Monster sein?
Das mit Sicherheit berühmteste Monster dieser Art war der »Theatermacher« Claus Peymann, welcher 1986 das Wiener Burgtheater übernahm, jene kakanische Staatsbühne, auf welcher seit jeher Schauspieler agieren, die eine österreichische Urkrankheit auf das Kunstvollste praktizieren: den Größenwahn. Peymann wiederum ist der geborene Alleinherrscher. Von Anfang an war klar, daß etwas anderes als Krieg nicht in Frage kommen würde. Und bekanntermaßen fallen im Krieg alle Hemmungen, und der Mensch erweist sich als Bestie.
Bei alldem wirkte Claus Peymann zumindest in der ersten Kriegshälfte souverän, elegant, weltmännisch und unbesiegbar. Während nicht nur Teile der österreichischen Presse sowie die konservativen und sozialdemokratischen Vaterlandsverteidiger ausgesprochen hölzern, humorlos und spracharm auftraten, als schlechte Verlierer sowieso, sondern erstaunlicherweise auch die Schauspieler des Burgtheaters. Allen voran deren Ensemblesprecher Franz Morak, dem sodann eine typisch österreichische Karriere beschieden war.
Der Mann hatte einst als Punkrocker mit Liedern wie »Sieger sehen anders aus« den Austropop an seiner Peripherie nicht ungeschickt beackert. Als dann aber Peymann, mit Bochumer Theaterleuten bewaffnet, nach Wien kam, verwandelte sich Morak in eine Supermimose, einen gnomhaften Zornbinkel. Auch wenn natürlich so getan wurde, als diskutiere man Fragen der Theaterführung, der Kunst, der Stückewahl etc., so ging es, worum es immer in Österreich geht: den Erhalt von Privilegien. Um etwas Heiliges. Die Rechten sehen das Privileg als mal von Gott, mal naturgegeben an, die Linken als Kulturleistung. Das Privileg ist fundamental.
Und es war der arme Franz Morak, der an vorderster Front gegen Peymann anzustürmen hatte, bis hin zur Selbstverstümmelung, welche ihren perfekten Ausdruck darin fand, daß Morak nach Peymanns Weggang aus Wien als Kunststaatssekretär in die Regierung des ÖVP-Kanzlers Wolfgang Schüssel gelangte. Was für ein Lohn! Was für ein Hohn! In Österreich ist Komödie keine dramatische Gattung, sondern eine bakterielle – kein Stück, sondern ein Zustand. Diese Feststellung wiederum soll nicht als Witz oder Gleichnis verstanden werden. Mit Bakterien ist nicht zu scherzen (dies sei für jene gesagt, die vorhaben, längere Zeit nach Österreich zu gehen). Zwischen Peymanns Einzug in Wien und Moraks Gang in die Regierung lagen dreizehn Jahre, in denen der Kampf kaum eine Pause kannte. Neben Morak waren es vor allem Fritz Muliar (ein Mann, der immer nur Fritz Muliar spielt) und Erika Pluhar (eine auch im Alter wunderschöne Frau, aber auch sie eigentlich mehr eine Erscheinung als eine Schauspielerin), welche die Attacken gegen Peymann ritten. Wobei es in keiner Sekunde darum ging, Peymann von irgend etwas – etwa der Qualität der Alteingesessenen – zu überzeugen, sondern ihn aus dem Land zu jagen. Die Manöver führten so weit, daß bei den Vorstellungen die Platzanweiser dem Publikum vom Besuch des Theaters abrieten. Eine Welle der Solidarität ging durchs Land.
Und wenn zu Beginn dieser »Gebrauchsanweisung« gesagt worden war, Österreicher würden mit Vorliebe über Bücher reden, die sie nie gelesen haben, dann gilt dies für Theaterstücke in noch größerem Maße. Das ungesehene Theaterstück ist unvergleichlich interessanter, aufregender und diskussionswürdiger.
Um nun in solche Diskussionen etwas Konkretes einbauen zu können, gibt es die Presse, welche über die Stücke berichtet oder Auszüge aus einem Text veröffentlicht. In schönster Weise erfolgte dies 1988, als Peymann – zielsicher wie so oft – das hundertjährige Bestehen der »Burg« dadurch feierte, Thomas Bernhards Stück Heldenplatz zur Uraufführung zu bringen. Noch vor der Premiere wurden einzelne Passagen unkommentiert zuerst im Wochenmagazin Profil, dann, sehr wohl kommentiert, in Österreichs Lieblingszeitung, der unglaublichen Kronen Zeitung, abgedruckt. (Ich empfehle dem Österreichurlauber ganz grundsätzlich, sich als erstes ein Exemplar der Kronen Zeitung zuzulegen. Er wird dann aufs schnellste und schmerzhafteste über den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Meinungsstand in Kenntnis gesetzt. Die Kronen Zeitung ist nämlich keine Boulevardzeitung, sondern eine bitterernste Kampfschrift. Bitte nicht mit der BILD-Zeitung gleichsetzen. BILD ist gegen die Kronen Zeitung ein Satiremagazin.)
Und weil also eine solche Kampfschrift, war die Kronen Zeitung natürlich federführend am Krieg gegen Peymann beteiligt. Die in der Kronen Zeitung publizierten Bernhardschen Textausschnitte heizten die Stimmung beträchtlich an und gaben jedem einzelnen Österreicher die Möglichkeit, eine Vorkritik des Stückes zu entwickeln, bequem von zu Hause aus oder in einer Nische seines Wirtshauses oder Cafés verweilend. Man muß dabei erwähnen, daß Thomas Bernhard in dieser gleichzeitig frühen wie heißen Phase die Arbeit an seinem Stück noch gar nicht beendet hatte und die Art und Weise der Kritik an seiner Person quasi eine Bestätigung seines Dramas darstellte. Was nicht heißt, daß ganz Österreich wie ein Mann und eine Frau hinter der Ablehnung eines noch ungesehenen Bühnenwerks stand. Für die jüngeren Leute war dies eine aufregende, gute Sache und der »konservative« Bernhard ein Held des Wortes, der Apologet einer Antihaltung, die frei war von ideologischen Fußbädern.
Was bei alldem am typischsten scheint, ist, daß der Skandal im Vorfeld stattfand und daß mit der Premiere von Heldenplatz die Erregung deutlich abnahm. Man kann sagen, der Österreicher ist lieber schwanger, als es mit einem auf die Welt gekommenen Kind zu tun zu haben. Mit einem Kind muß man sich beschäftigen. Man muß in der Nacht aufstehen, Windeln wechseln, Milch wärmen … Der für Österreicher ideale Zustand im Hinblick auf ein umstrittenes Kunstwerk wäre jener ewiger Schwangerschaft. Woraus dann eine ewige Erregung resultieren könnte.
Nach dreizehn Jahren Wien ging Peymann 1999 nach Berlin – was sehr viel logischer ist, als von Stuttgart nach Bochum zu wechseln, wobei ich nicht wüßte, welcher Ort nach einem Weggang von Stuttgart ernsthaft logisch zu nennen wäre. – Die Komödie dieser Aufgabe Wiens bestand darin, daß Peymann gar nicht wirklich aufhören, sondern bloß theatermachermäßig damit drohen wollte. Die Drohung jedoch vom damaligen Bundeskanzler Viktor Klima mit Freude ernst genommen und die Verlängerung des Vertrages unterbunden wurde. In diesem Moment galt für Peymann, zumindest auf Wien bezogen, dasselbe, was er so viele Jahre später über den Berliner Musikproduzenten und Staatssekretär Tim Renner sagte, nämlich, dieser sei ein toter Mann, wisse es nur noch nicht. Wobei jener Tim Renner passenderweise ein Buch geschrieben hat, welches heißt: Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm.
Man muß auch sagen, daß seit Peymanns Fortgang das österreichische Theaterwesen zwar nicht überflüssig geworden ist, sich jedoch beispielhaft an den Fernsehduellen zwischen den beiden Stichwahlkandidaten der Bundespräsidentschaftswahl 2016 zeigt, wie sehr die Verquickung von Schauspielkunst und Politik eine unmittelbare geworden ist und sich die Genregrenzen irrwitzig vermischen. Würde ein Außerirdischer diese »Duelle« beobachtet haben, er hätte mitnichten eine Wahlempfehlung abgegeben, sondern eine Theaterkritik verfaßt.
Der stärkste Aspekt in Heldenplatz ist nun sehr viel weniger die pointierte Qualifizierung Österreichs als ein Staat aus alten und neuen Nazis, sondern die Darstellung der österreichischen Sozialdemokraten als »Staatsverschacherer«. Da heißt es etwa in bezug auf die Gewerkschaftsführer: »… und sehen ihre Hauptaufgabe in skrupellosen Bankgeschäften …« Tatsächlich kann man sagen, daß die Geschichte der SPÖ seit der Kanzlerschaft des »Sonnenkönigs« Bruno Kreisky ein myzelartiges Gebilde der Skandale ist, Skandale, deren entscheidendes Merkmal die Nonchalance ist, mit der sie begangen wurden. Man kann sagen, SPÖler sind Skandalkünstler, keine Trickser wie anderswo, sondern Leute mit einem aristokratischen Selbstverständnis, die meinen, sich nur zu nehmen, was ihnen qua Abstammung zusteht. Thomas Bernhard war dank seines tiefgehenden Gefühls des Auserwähltseins einer der wenigen wirklich unabhängigen Autoren Österreichs, welcher sich erlaubte, jene Sozialistenclans anzugreifen, zu deren für Aristokraten ganz typischen Hobbys es gehörte und gehört, die Kunstschaffenden zu fördern und zu versorgen.
Im Ausland, vor allem natürlich in Deutschland, hat man fast immer nur die Bedrohung durch Gestalten wie Jörg Haider wahrgenommen, die prinzipielle Anfälligkeit der Österreicher für die rechten Abgründe festgestellt und selten erkannt, wie sehr das »Problem Haider« aus der immer unverschämteren Machtnahme der sozialistischen Aristokratie resultierte. Diese Aristokratie hat einige Schrammen und Niederlagen wegstecken müssen, ist nun aber wieder ganz oben. Und ein Schelm, wer denkt, sie hätte etwas dazugelernt. Das Dazulernen ist sowieso unösterreichisch. Es gilt als unsportlich, defätistisch und stillos. Es ist etwas, was man gerne den Deutschen zuordnet. Die Deutschen sollen aus der Geschichte lernen, gleich Versuchstieren, die durch Bestrafung und Belohnung beim nächsten Mal einen besseren Weg aus dem Labyrinth finden. Die Österreicher aber sehen sich selbst als Labyrinth. Was also sollten sie lernen?
Bezeichnenderweise gehörten auch die Peymanngegner Fritz Muliar und Erika Pluhar dem Dunstkreis jener Genossen an, welchen es gelang, das Prinzip des Ornaments und das Prinzip des Privilegs zu verschmelzen. Pluhar war übrigens mit gleich drei bedeutenden Männern verheiratet beziehungsweise liiert. Mit Udo Proksch, André Heller und dem wunderbaren Schauspieler Peter Vogel, der sich 1978 das Leben nahm.
Vogel war der erste Major Adolf Kottan aus der Krimiserie Kottan ermittelt, diesem Geschenk des österreichischen Fernsehens an die deutschsprachige Welt. Der »Kottan« des Peter Vogel war noch nicht die pure Persiflage, war noch frei von der rasanten Zellteilung rennender Gags, dafür ausgestattet mit der für diesen Schauspieler typischen Verbindung des Komischen mit dem Traurigen.