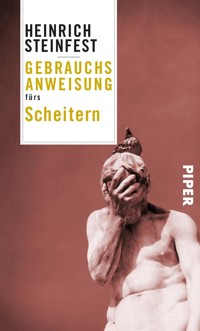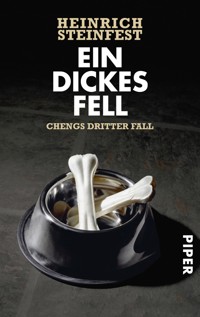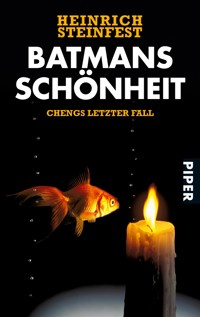11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tonia Schreiber ist Büglerin. Mit der Hand bügelt sie die Wäsche ihrer vermögenden Heidelberger Kunden. Die Arbeit erledigt sie mit Sorgfalt und Präzision, obgleich sie schlecht bezahlt wird. Denn das Bügeln ist ihre Form der Buße. Sie büßt für eine Tat, die ihr Leben unwiderruflich verändert hat. Ein Leben, das unter den besten Vorzeichen stand: Als Tochter renommierter Botaniker verbrachte sie ihre Kindheit auf einer Segeljacht. Später lebte sie in Wien in der elterlichen, mit Aquarien ausgestatteten Villa und zog gemeinsam mit ihrer Halbschwester ihre Nichte Emilie auf. Bis Emilie auf tragische Weise starb. Und Tonia alles aufgab, ihre Freunde, ihren Reichtum, die Wissenschaft. Sie verließ ihre Heimatstadt Wien und begann zu bügeln. Doch das Leben ist noch nicht ganz fertig mit ihr. Denn der Zufall spielt ihr etwas in die Hände, das Emilies Tod in ein anderes Licht rückt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de/literatur
ISBN 978-3-492-99098-1
März 2018
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Datenkonvertierung: Kösel, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
– 1. Das Schönste waren ...
0. Antonia war der ...
1. Viele von uns ...
2. Die Frage, die ...
3. Tonia Schreiber überlegte ...
4. Was wusste Tonia ...
5. Die Tage vergingen. ...
6. Donnerstag war der ...
7. Nachmittags, als Tonia ...
8. Die beiden traten ...
9. Am nächsten Tag ...
10. Nachdem sie eingetreten ...
11. Mein Gott, wie ...
12. Ein halbes Jahr ...
13. Als sie im ...
Später
Anmerkung
– 1
Das Schönste waren die weißen Hemden.
Und das Schönste hob sie sich immer für den Schluss auf. Vorher kamen die Socken und die Handtücher, die leichten Hosen und die Bettwäsche, die Unterhemden in Feinripp und die Geschirrtücher für die Köchin, nicht zuletzt die Krawatten und Anzüge, die einer besonderen Vorsicht sowie einer tiefen Einsicht in das Material bedurften. Einen Anzug zu bügeln war gewissermaßen so, als bügle man den ganzen Mann, seine äußere Erscheinung, den Schatten, den er in die Welt hineinwarf und durch den er maßgeblich wahrgenommen wurde.
Natürlich bügelte sie ebenso die Kostüme und Blusen und die zart schimmernde Unterwäsche der Dame des Hauses sowie all die Kleidungsstücke der Kinder, drei an der Zahl, die im Abstand von jeweils zwei Jahren, gleich den Figuren eines Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiels, ins Leben gestartet waren. Nicht zuletzt auch die Kleidung des Vaters der Mutter, der allerdings darauf bestand, dass seine Unterhosen ungebügelt blieben. Er hatte diesbezüglich eine strikte Anweisung erteilt. Anscheinend störte ihn die Vorstellung, die Büglerin könnte mit ihren Händen und dem von ihr geführten und gelenkten Bügeleisen jene »zweite Haut« berühren, die sein Geschlecht umschloss. Er war jetzt knapp über achtzig. Ein missmutiger, verbitterter, zur Ruhe gesetzter Mensch und Witwer, der es hasste, zu altern und sich beim Altern zusehen zu müssen.
Für diese Leute bügelte sie also. Seit etwa zwei Jahren, jeden Dienstag und jeden Donnerstag, immer zur gleichen Nachmittagszeit, immer in der Bibliothek des herrschaftlichen Hauses am Rande einer Ortschaft des südlichen Odenwalds, in einem weiten Raum mit Regalen aus altem, glänzendem Holz, die an den hohen Wänden aufragten, während zum Vorgarten hin eine breite Fensterfront selbst an dunklen Tagen eine Menge Licht hereinließ. Was auch der Grund dafür war, dass sie hier ihre Arbeit erledigte. Das Licht war von der allergrößten Bedeutung. Bügeln stellte eine besondere Form von Malerei dar. Jedenfalls, wenn man die Bügelarbeit so ernst nahm, wie sie es tat.
Und wie es auch der alte Mann im Haus tat, der alte Hotter, Professor Hotter, dem die Bügelfalten seiner Anzughosen so wichtig waren wie die absolute Faltenfreiheit seiner Hemden. Selbst zum Frühstück erschien er in einer Weise sorgsam gekleidet, als sei das Fernsehen gekommen, um einen Beitrag über sein Frühstück zu senden. Die äußere Erscheinung war ihm verpflichtend, gleich einer moralischen Haltung. Als Hotter kurz nach der Entführung und Tötung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer 1977 durch die RAF als eine gefährdete Person von der Polizei über gewisse Sicherheitsmaßnahmen unterrichtet worden war, da hatten ihn zwei Dinge gestört. Einerseits gefiel ihm nicht, bloß als »minder gefährdet« eingestuft zu werden – was für ihn bedauernswerterweise das Primat der Politik und Wirtschaft vor der Forschung und Medizin aufzeigte; er in seiner Funktion als Universitätsprofessor und Leiter einer Klinik für Augenheilkunde –, andererseits empfand er einen großen Ekel gegenüber den Manieren, der optischen Selbstdarstellung und der, wie er es nannte, »kleinkriminellen bis räuberbandenhaften Vorgehensweise« der RAF. Die nach seiner Meinung so gar nicht den Namen »Armee« verdiene. »Wenn Sie mir sagen«, hatte er damals gegenüber einem Journalisten erklärt, »es sei doch ganz egal, ob man von einem rasierten oder einem unrasierten Menschen erschossen wird, dann muss ich Sie fragen, ist es Ihnen denn egal, wenn auf Ihrem Grabstein zum Beispiel Ihr Name falsch geschrieben steht. Nein, es ist mir nicht gleichgültig, wie der Mensch aussieht, den ich als Letztes anschauen muss. Und ob ich für diesen Menschen bei aller Unterschiedlichkeit der Ansichten – er möchte mich tot, ich möchte mich lebendig –, doch so etwas wie Respekt aufbringen kann. Kann ich aber nicht bei diesen Gestalten, die ja ihrerseits jeglichen Respekt vermissen lassen. Das sind die gleichen Leute, die es für progressiv halten, ohne Krawatte in die Oper zu gehen. Und ein paar von denen haben jetzt Pistolen in der Hand und betteln schießend um unsere Aufmerksamkeit.«
Die Zeit der RAF war lange vorbei. Der Herbst vergangen. Hotter lebte im Winter seines Lebens. Und auf eine gewisse Weise trauerte er sogar der früheren Bedrohung nach, die bei aller Unrasiertheit doch etwas Bedeutungsvolles besessen hatte. Einen hohen Ton. Eine satte Farbe. Die neuen Gefahren hingegen – Islamisten, Flüchtlinge, faule Griechen oder eine Wirklichkeit, die hinter den dünnen Scheiben der Mobiltelefone zu verschwinden drohte – erschienen Hotter so ungemein seicht, merkwürdig undramatisch selbst im Moment von Bombenattentaten. Er hielt es für bezeichnend, dass etwa im Fall von 9/11 die Attentäter die banale Inszenierung eines amerikanischen Actionfilms kopiert hatten.
Seine eigene Tochter, sein eigener Schwiegersohn, seine eigenen Enkel kamen ihm verkümmert vor, fahl und träge auch in Phasen größter Agilität. Nirgendwo erschien ihm seine jetzt achtundvierzigjährige Tochter und Besitzerin einer Filmproduktionsgesellschaft besser getroffen, als wenn er sie sah, wie sie frühmorgens und spätabends auf einer ihrer Fitnessmaschinen saß oder stand und dabei tiefe Furchen in die sie umgebende Luft grub.
Keine Frage, die einzige Person in diesem Haus, die er wirklich respektierte, war die Büglerin. Das Unterhosenverbot somit ein Ausdruck seiner Achtung, auch wenn er sich hin und wieder danach sehnen mochte, die weiche Glätte, mit der die Büglerin eine jede Textilie versah, würde sich auch in der körpernahesten Schicht um seinen Unterleib schmiegen. Anstatt dieser gewissen Grobheit einer ungebügelten Unterwäsche. – Wenn er mitunter seinen schlaffen, welken Penis betrachtete, dachte er, dass Gott das Alter geschaffen habe, um dem Tod eine Pein vorauszuschicken. Schließlich hätte der Allmächtige ja genauso gut auf die Idee kommen können, den Menschen im Zustand der Schönheit sterblich werden zu lassen.
Hotter war der Alte im Haus, ein Haus, das ihm noch immer gehörte.
Aber es gab auch einen »neuen Mann«, den Gatten der künftigen Erbin. Er hieß Glanz, Dr. Glanz, und war ebenfalls im Filmgeschäft tätig. Er fungierte als Miteigentümer einer konkurrierenden Produktionsfirma und kam in dieser Funktion auch immer wieder mal seiner Frau in die Quere. Privat aber pflegten die beiden einen friedvollen Umgang.
Und da waren dann noch die Kinder, die Mensch-ärgere-Dich-nicht-Kinder des Glanz’schen Ehepaars. Vierzehn, zwölf und zehn – die Büglerin nannte sie bei sich einfach nur Eins, Zwei und Drei. Für die Büglerin waren diese Kinder unsichtbar, sichtbar allein deren Wäsche.
Die Büglerin ließ sich pro Stunde bezahlen, wobei man die Perfektion und tief greifende Wirkung ihrer Arbeit eher der Kunst als der Hausarbeit hätte zuordnen müssen (oder der Alchemie, die der praktische Arm der Kunst ist). Allerdings war der Stundenlohn weit davon entfernt, ihr ein gutes Einkommen zu sichern. Keine Frage, sie hätte mehr verlangen können. Hotter schwor auf ihre Fähigkeiten, und auch das Ehepaar Glanz hatte begriffen, dass es nicht einerlei war, wer hier ihre Wäsche in einen Zustand zusammengelegter oder frei hängender Vollkommenheit versetzte. Doch die Verführung war zu groß, die gute Arbeit der Büglerin schlecht zu bezahlen. Denn sie ließ es ja geschehen. Nur konnten Hotter und das Glanzpaar nicht ahnen, wieso sie es geschehen ließ.
Diese Frau bestrafte sich.
Sie bestrafte sich mit dem Leben, das sie führte. Wobei diese Strafe in Teilen den Reiz einer ungeheuren Erhöhung besaß. Vor allem der Akt des Bügelns an sich. Dafür besser als andere bezahlt zu werden, hätte die Strafe stark gemindert. Denn schließlich stellte es einen grundlegenden Aspekt dieses Berufs dar, eine schlechte Bezahlung nach sich zu ziehen, in der Regel betrieben von Frauen. Alle diese Frauen schienen irgendeine Art von Strafe zu erdulden, wobei viele von ihnen nicht wussten, eine Strafe wofür.
Tonia schon.
0
Antonia war der Name auf ihrer Geburtsurkunde und der Name in ihrem Pass. Antonia Schreiber. Aber da war niemand, der sie mit der vollständigen Form ihres Vornamens angesprochen hätte. Von Anfang an hatte sich die Kurzform Tonia durchgesetzt. Und das war sicher ein guter Name, um durchs Leben zu marschieren. Oder zu segeln. Dieser Name hatte etwas von dem schnellen, kräftigen Wind, der unter ein Segelleinen fährt, es aufbläht und eine Bewegung verursacht.
Tonia wurde auf einem Schiff geboren, einer Segelyacht, die sich im Augenblick ihrer Geburt – an einem Februartag des Jahres 1974 – zwar auf dem Weg zu einem Hafen und dem dort auf festem Grund stehenden Krankenhaus befand, aber halt nur auf dem Weg. Denn als sie zur Welt kam, war die Küste noch weit entfernt und rundherum allein die pure, glatte See. Somit gehörte Tonia zu den wenigen Menschen, deren Geburtsort auf eine Stelle auf dem Meer verwies, einen Punkt im südlichen Pazifik, etwa auf Höhe der chilenischen Insel Chiloé, deren Hauptstadt Castro rechtzeitig anzulaufen der Plan gewesen war.
Obgleich also überpünktlich und obgleich allein ihr Vater als Geburtshelfer fungierte – mehr in der Art eines guten Zuhörers –, wurde es eine einfache Geburt, ähnlich glatt wie die See an diesem Tag. Die Körpergröße und das Gewicht des Kindes befanden sich in einem Bereich, den man den grünen nennt, wie der Vater feststellte, der ein Maßband ansetzte und das Neugeborene sorgsam auf die bordeigene kleine Waage legte.
Der Meeresabschnitt, wo dies geschah, war allgemein bekannt als Chilenische Schwelle, wobei Tonia bald anfing, von einem Rücken zu sprechen. Ja, anstatt auf die Frage nach ihrem Geburtsort die ungefähren Koordinaten zu nennen, erklärte sie gerne, oberhalb eines Meeresrückens das Licht der Welt erblickt zu haben. Was sie hingegen so gar nicht sagen konnte, war, von wo aus ihre Eltern eigentlich losgesegelt waren. Denn wenn man sich diesen Teil des Ozeans auf einer Landkarte ansah, zeigte sich eine ausgesprochen große Fläche von keinerlei Land gebremsten Wassers.
Was waren das für Leute, die nicht darauf achteten, dann an Land und in der Zivilisation zu sein, wenn ihr Kind zur Welt kam?
Die Antwort: zwei Botaniker.
Aber das taugt natürlich nicht als Erklärung, wie es vielleicht eine gewesen wäre, wären sie Meeresbiologen gewesen. Waren sie aber nicht, sondern mit Landpflanzen beschäftigt. Beide mit einem Abschluss der Universität Wien, er ein gebürtiger Berliner, sie aus Salzburg stammend, die unabhängig voneinander Ende der 1960er-Jahre in die österreichische Bundeshauptstadt gezogen waren. In eine Stadt, die damals zwischen Vergangenheit und Zukunft schwankte und sich darum für einen Moment tatsächlich in der Gegenwart aufhielt, weil man ja irgendwo stehen muss und das Schwanken allein noch nicht als Stehen gilt.
In diesem Moment ersatzweiser Gegenwärtigkeit hatten die zwei sich kennengelernt. Zwar an der Uni, jedoch nicht bei einer Vorlesung zur Pflanzenkunde, sondern bei der später in die Kunstgeschichte eingegangenen sogenannten Uni-Ferkelei. Jener Kunstaktion, bei der Protagonisten des Wiener Aktionismus unter dem Titel Kunst und Revolution versuchten, sich richtiggehend zum Berühmt- und Berüchtigtsein »hochzuscheißen«, indem sie auf der universitären Bühne ihre Notdurft verrichteten. Und so ziemlich alles taten, was anerkannterweise den Markenartikeln von Obszönität, Blasphemie und Nestbeschmutzung entsprach, optisch gesehen aber den Reiz einer Tortenschlacht besaß.
Tonias künftige Eltern waren beide von Freunden zu dieser Veranstaltung »mitgeschleppt« worden, um dann im allgemeinen Gedränge aneinanderzugeraten wie Tiere in einem Schwarm. Sie blieben einer am anderen hängen. Und vielleicht waren es wirklich ihre Augen, beziehungsweise ihre Blicke, die praktisch ineinanderfielen, als könnte man sagen, ein See »köpfelt« in den anderen.
Es war übrigens das erste und auch einzige Mal, dass die beiden in Bezug auf eine Sache absolut einer Meinung waren. Nämlich betreffs der Performance, die da vor ihren so rasch verliebten Augen stattfand. Weder fanden sie große Freude an der bürgerlichen Provokation noch an der bürgerlichen Erregung, sondern konstatierten eine gewisse Kindlichkeit der Avantgarde. Dieses Begehren nach Aufmerksamkeit. Dieser ungestüme Ruf nach Liebe.
Zudem waren sie in dieser Situation beide – und das sollte sich dann noch sehr ändern – vollkommen nüchtern. Alkoholfrei.
Vom ersten Moment an waren sich Tonias Eltern in einer großen Ausschließlichkeit verbunden. Ohne darum in reiner Liebe und reinem Frieden aufzugehen, wahrlich nicht, eher erwiesen sich die zwei als streitbare Geister, aber sie waren eben auch im Streit selig verknotet und schienen wenig Gefallen daran zu finden, mit anderen, fremden Leuten zu streiten. Sie studierten zusammen und hatten später den gleichen Doktorvater, welcher erklärte: »Ich habe noch nie zwei so unterschiedliche Arbeiten gelesen. Sie, Philippa, chaotisch, aber genial, macht aus einer Arbeit über Alpinpflanzen – scheinbar mit links, scheinbar Hokuspokus – eine Abhandlung über das Weltganze und das Versagen der Menschheit; er, Max, diszipliniert, präzise, makellos, liefert einen Text, picobello, den man, zu Pulver zerrieben, als Beruhigungsmittel verkaufen könnte. Mögen sie auf ergänzende Weise glücklich werden.«
Max wurde Millionär. Das Geld kam über Nacht. Fast so, dass Max den Eindruck gewann, es sei Geld aus einem Traum, einem Traum, aus dem er nicht wieder aufgewacht war. Aber nicht, weil der Traum so schön war, sondern so stur. Faktum war, dass Max ein Vermögen erbte, und zwar aus dem simplen Grund, eine Katze gerettet zu haben. Eine alte Katze, die ohnehin nicht mehr allzu lange zu leben gehabt hätte. Aber das konnte er nicht wissen, als das Tier von der obersten Etage eines sechsstöckigen Hauses in der Wiener Porzellangasse fiel.
Max wohnte um die Ecke. Zusammen mit Philippa in einer kleinen Wohnung, die mit Pflanzen vollgestopft war. Der reinste Dschungel, wo ständig etwas vom Grün starb, aber dann halt rasch durch lebendes Grün ersetzt wurde. Diese ganze Wohnung lebte. Ein Horrorkabinett eigentlich. Jedenfalls war Max soeben zur Straßenbahn unterwegs, als diese Katze von hoch oben aus dem Fenster fiel. Es handelte sich um einen fetten, alten, von Krebsgeschwüren geplagten Kater, der kurz zuvor auf einer Blumenkiste gehockt war und möglicherweise in einem Anfall von Wahnsinn versucht hatte, den letzten Vogel seines Lebens zu erwischen. Was auch immer, Max war in diesem Moment vorbeigekommen und hatte instinktiv nach oben gesehen. Das Schicksal bot ihm genau zwei Möglichkeiten an: schnell zur Seite zu treten, um nicht etwa von dem herabfallenden Objekt erschlagen zu werden, oder aber es aufzufangen. Ein Objekt, von dem Max bei aller Plötzlichkeit und Rasanz nicht hätte sagen können, ob es sich um ein Mauerstück, den Teil einer Regenrinne oder ein kleines Kind handelte. Oder um eine Katze.
Max schob seine Arme nach vorn und formte Hände und Unterarme zu einem Korb, in dem sich – entgegen der bekannten Zeitlupenaufnahmen, die man von geschickt fallenden Katzen kannte – der mit dem Rücken voran stürzende Kater verfing. Um sich erst dort, in diesem Korb, in der üblichen Katzenmanier um 180 Grad zu drehen und an der Brust seines Retters festzukrallen.
Es war Sommer, Max trug ein T-Shirt und konnte am gleichen Abend seiner jungen Ehefrau die von verkrustetem Blut markierten Kratzspuren zeigen, die der Kater hinterlassen hatte. Immerhin auch davon berichten, wie glückselig die Besitzerin des Tiers dank der Rettung gewesen war. Eines Tiers, das nur wenige Wochen später eingeschläfert werden musste. Und dem die alte Frau kurz darauf in den Tod folgte. Doch davon erfuhr Max erst, als er der Einladung eines Notars folgte, der den Letzten Willen der Verstorbenen umzusetzen hatte.
Dem Notar gegenüber erwähnte Max verwundert, der alten Dame ja nicht einmal seinen Namen genannt zu haben.
»Wollen Sie das Geld etwa nicht?«, fragte der Notar. Sichtlich unzufrieden mit der Erfüllung seiner Pflicht.
»Von welchem Geld sprechen Sie?«, fragte Max. Er war ja immerhin in der Wohnung der alten Frau gewesen und hatte nicht den geringsten Hinweis auf einen sonderlichen Reichtum festgestellt.
»Frau Schuch«, erklärte der Verwalter des Nachlasses, »hat ursprünglich bestimmt, ihr Vermögen hälftig der Österreichischen Volkspartei sowie dem Wiener Tierschutzverein zu vermachen. Doch nach dieser Episode mit ihrer Katze hat sie eine Testamentsänderung vornehmen lassen und – wenn ich mich so ausdrücken darf – die Partei hinausgeworfen und Sie hineingenommen.«
Max grinste und meinte: »Na, ich werde mir von dem Geld kaum ein Haus leisten können.«
Darauf der Notar: »Ich weiß ja nicht, an welche Art von Haus Sie denken, aber wenn Sie eine Villa in bester Lage meinen, oder eher zwei Villen, dann könnte es sich gut ausgehen.«
Und wirklich handelte es sich um etwas über zehn Millionen. Zehn Millionen Schillinge, wie damals die Währung hieß und was zu dieser Zeit eine Menge Geld darstellte. Ohne dass aber der Notar in irgendeiner Weise die Herkunft des Vermögens beschrieb. Immerhin musste er bestätigen, dass die Testamentsänderung in einer Situation erfolgt war, in der die Erblasserin sich bei klarem Verstand befunden habe. So ungewöhnlich der Wechsel von einer konservativen Volkspartei zu einem privaten Katzenretter auch sei, verstoße selbiger – juristisch gesehen – in keiner Weise gegen die guten Sitten. Sagte der Notar, obgleich sein Gesichtsausdruck eine andere Sprache sprach. Tatsache blieb, dass alles seine Ordnung hatte und dass Max mit einer einzigen Unterschrift zu einem reichen Mann wurde.
»Wie hat der Kater eigentlich geheißen?«, fragte er, als er seine Signatur an die Stelle setzte, auf die der Notar wie auf den Schatten auf einem Röntgenbild zeigte.
»Wieso?«
»Na, ich meine, ich verdanke diesem Wesen einen gewissen zukünftigen Komfort.«
»Lachs.«
»Was meinen Sie mit Lachs?«
»Nun, das ist der Name des Katers.«
»Was denn, sie hat ihn nach einem Fisch benannt?«
»Einerseits wegen der Farbe seines Fells«, erklärte der Notar, »aber auch, weil er Lachsfilets so gerne mochte. Manchmal hat Frau Schuch ihn auch Lachstiger gerufen, meistens aber einfach Lachs. Sie war in dieses Tier absolut verschossen. Dabei war sie eine ansonsten kluge Frau, aber auch kluge Menschen … Nun, das hat hier nichts verloren.«
»Sie haben sie ganz gut gekannt, nicht wahr?«
»Roswitha? Ja!«
Es kam Max vor, als spüre er eine deutliche Bitterkeit in der Haltung und Stimme dieses Mannes. Nicht auszuschließen, dass er Anhänger besagter Partei war. Oder ein Anhänger der Frau, die Roswitha gewesen war.
Als Philippa am Abend von ihrem Reichtum erfuhr, brach sie nicht etwa in Jubel aus, sondern meinte trocken: »Wäre vielleicht besser, das Geld zu verschenken.«
Sie vermutete hinter dieser ganzen Katzengeschichte etwas wie eine Falle. Ihr war dieses Geld verdächtig.
Wenn sie vom Verschenken sprach, dann meinte sie ein Loswerden des Geldes, was nur dann wirklich funktionierte, wenn es sich um ein ideologie- und damit politikfreies Loswerden handelte. In der Art, wie Wittgenstein vorgegangen war, indem er sein Vermögen an seine ohnehin reichen Schwestern verschenkt hatte (denn niemand bewundert einen dafür, die eigenen reichen Schwestern noch reicher gemacht zu haben).
Aber Philippa war nun mal nicht Wittgenstein, und auch Max, der eigentliche Erbe, war nicht Wittgenstein. Die beiden verzichteten zwar darauf, sich einen Jaguar oder einen Ferrari anzuschaffen, aber eine Villa wurde es dann doch. Wobei sie anstelle der zweiten Villa, von welcher der Notar gesprochen hatte, eine Segelyacht kauften, ein ungemein elegantes Boot. Von all den Dingen, über die sie diskutierten, war dieser Gegenstand, dieser Luxusgegenstand, der einzige, auf den sie sich problemlos einigen konnten. Die Villa hingegen war aus einem Streit über die Schönheit und Hässlichkeit von Häusern hervorgegangen, einem Streit vor allem darüber, inwieweit diese Häuser durch eine exklusive Lage veredelt oder auch verdorben werden konnten. Beziehungsweise umgekehrt. Jedenfalls bewohnten sie die Villa, zu der sie sich »zusammengerauft« hatten, nur kurze Zeit. Bald waren sie fast ausschließlich mit ihrem Boot unterwegs. Sie führten ihr Leben auf den Weltmeeren mit der gleichen Beharrlichkeit, mit der sie sich in der Liebe und im Streit zugetan waren. Sie lebten auf diesem Boot, ohne die Pflanzenkunde aufzugeben, unterließen es aber, auf ihrer Yacht den gleichen unheimlichen Dschungel entstehen zu lassen wie in ihrer alten Wohnung nahe der Stelle des folgenreichen Fenstersturzes einer Katze.
Gingen sie an Land, studierten sie die einheimische Flora, sammelten Proben, analysierten Proben, verschickten Proben, verschickten sie in die ganze Welt, wobei sie sogar ein eigenes Postversandsystem für Pflanzenteile entwickelten, eine Belüftungs- und Befeuchtungseinheit – Post als mobiles Biotop –, die ihnen in Fachkreisen zu einiger Berühmtheit verhalf.
Mitunter stießen sie auch tiefer ins Landesinnere vor, wenn die Suche nach einer bestimmten Pflanze dies erforderte, allerdings in Maßen. Es war ihnen wichtig, sich nicht allzu lange von ihrem Boot zu entfernen. Ein Boot, das den Namen Ungnadia trug, benannt nach der Pflanze Ungnadia speciosa, der mexikanischen Rosskastanie, die ihren lateinischen Namen einem gewissen David Baron von Ungnad verdankte. Der Baron war einst als Gesandter nach Konstantinopel geschickt worden, um im Auftrag der Habsburger die Osmanen diplomatisch weichzukochen. 1575 hatte der Baron einige Samen der Rosskastanie nach Wien gebracht, die im Zuge der Initiative des niederländischen Botanikers Charles de l’Écluse den Beginn des europäischen Kulturbaumwesens bildeten. Ja, es existierte bei einigen Historikern die Anschauung, diese paar Samen des Herrn Ungnad seien praktisch die Urmütter aller Gewöhnlichen Rosskastanien, die je auf unserem europäischen Kontinent aus einem Park oder Volksgarten hochgewachsen waren und noch hochwachsen werden.
Vom Baron zur Pflanze, von der Pflanze zum Schiff.
Bei der Ungnadia handelte es sich um eine sechzehneinhalb Meter lange Glasfaseryacht, gebaut 1971 von der finnischen Werft Nautor’s Swan. Freilich war die vorhandene Einrichtung mit einigem Aufwand nach den Wünschen des Ehepaars Schreiber umgestaltet worden – ein schwieriges Unterfangen, weil dessen Anweisungen zum Teil weit auseinandergingen. Die beauftragte Werkstatt musste mit diversen Widersprüchen kämpfen, und es folgten zahlreiche Korrekturen bereits vorgenommener Eingriffe. Dennoch gelang letztlich ein ideales Boot, dessen Innenausstattung die bekannte Dominanz von dunklem Holz erspart blieb. Vielmehr entstanden helle, mondäne und bequeme Räume. So, als befinde man sich in einem Designerappartement, das im Zuge einer radikalen Kur der Welt auf eine Breite von viereinhalb Metern verschlankt worden war. Verschlankt, nicht zusammengepresst. Kein Benutzer brauchte zu meinen, in eine modisch eingerichtete Makkaroninudel geraten zu sein.
Innerhalb dieser viereinhalb Meter kam Tonia zur Welt, auf dem mit weißen Laken abgedeckten Schurwollbezug eines Sofas, das 1954 vom Dänen Hans J. Wegner entworfen worden war, um genau zwanzig Jahre später zum Zwecke dieser Geburt zu einem Daybed ausgezogen zu werden. Ein Sofa, auf dem Tonia noch viele Jahre sitzen und liegen und viele Bücher lesen sollte. Denn sie wurde nicht nur auf dieser finnischen Segelyacht mit ihrem hauptsächlich dänischen Interieur geboren, sondern verbrachte dort ihre gesamte Kindheit und einen Teil ihrer Jugend. Bis zu ihrem vierzehnten Lebensjahr befand sich Tonia überwiegend auf diesem schlanken Schiff, zusammen mit ihren segeltüchtigen und trinkfesten Eltern. Natürlich sah sie auch die Küstenstädte, lernte andere Menschen kennen und wurde auf die Expeditionen mitgenommen, wenn die Erforschung einer gewissen Flora dies erforderte. Und doch handelte es sich um »Ausflüge«, das eigentliche Leben fand auf diesem Boot statt und auf den Meeren, die dieses Boot befuhr. Da war es nur natürlich, dass Tonia früh lernte, Wasser sowie die dem Wasser einsitzenden Farben besonders gut zu beschreiben. So kam sie nicht umhin, etwa beim Anblick einer bestimmten blauen Bluse an exakt jenen Himmel zu denken, den sie als Elfjährige nahe Hawaii gesehen hatte. Ein Blau, in dem bereits das kommende Unwetter steckte, das zwar noch nicht zu erkennen war, aber bald stattfinden würde. Ja, es gab Farben – erst recht in den Gesichtern von Menschen –, die auf etwas Zukünftiges verwiesen. Manchmal sah Tonia die Farbe in einem Gesicht und ahnte das Gewitter im Leben dieses Menschen.
Tonia verbrachte also eine Menge Zeit ihrer Kindheit auf jenem Fünfzigerjahre-Sofa, wobei ein braun umrandeter, perlmuttern schimmernder Fleck auf dem sandfarbenen Überzug an ihre Geburt erinnerte. Sie begriff erst mit den Jahren, dass sie praktisch immer, wenn sie hier lag und las oder träumte oder in ihr Tagebuch schrieb oder kleine Zeichnungen verfertigte, sich auf ihrem Geburtsplatz befand, ihrem – wie sie es dann nannte – Quellursprung.
Philippas und Max’ Entscheidung war von Anfang an eine gegen die Schule gewesen, also dagegen, spätestens im sechsten Lebensjahr ihres Kindes dauerhaft »an Land zu gehen«, um den Besuch einer Schule zu gewährleisten. Da Tonia die österreichische Staatsbürgerschaft der Mutter erhielt, bedeutete dies auch, allein einer Unterrichtspflicht folgen zu müssen. Trotz ihrer umfangreichen Bereisung der Weltmeere hatten die Schreibers weiterhin in Wien ihren Hauptwohnsitz, jene Villa, die von einem darin lebenden älteren chinesischen Ehepaar in vorbildlichster Weise in Schuss gehalten wurde. So konnte das Elternpaar beim zuständigen Bezirksschulrat den Antrag stellen, die Unterrichtspflicht im Rahmen eines von ihnen selbst vorgenommenen »häuslichen Unterrichts« zu erfüllen. Auch wenn »schifflich« richtiger gewesen wäre, aber so redet halt keiner, besonders nicht, wenn man sich die Zurechtweisungen des Bezirksschulrates ersparen will.
Sowenig die Schreibers dafür religiöse Gründe angeben konnten, weltanschauliche durchaus. Nicht zuletzt, indem tatsächlich von einem »Anschauen der Welt« die Rede war, einer Horizonterweiterung. Entscheidender war freilich, dass die finanziellen Verhältnisse der Antragsteller sowie das Faktum zweier abgeschlossener Studien – Herr und Frau Doktor Schreiber – jeden Zweifel ausschlossen, sie würden ihr Kind irgendeiner Form von Freibeuterei oder seemännischer Hippiekultur ausliefern. Zusätzlich waren am Ende eines jeden Schuljahres Prüfungen zu absolvieren, die zeigen sollten, ob Tonia an Bord dieses Schiffes genau jene Fortschritte machte, die neben der umfangreichen Beschreibung der Farbe Blau als notwendig galten.
Wenn sich Tonia später an ihre schulfreien Jahre erinnerte, dann wurde vor ihrem geistigen Auge stets dieses zum Daybed ausgezogene Sofa sichtbar, und wie ihre Mutter darauf lümmelte und dabei so gut wie immer ein mächtiges Glas in der Hand hielt, und wie darin eine hellgelbe bis goldbraune Flüssigkeit schaukelte, in der sich wiederum ein paar Eiswürfel drehten. Dazu der Klang, der sich ergibt, wenn sie zusammenstoßen, beziehungsweise in der Drehung die Innenwand des Glases touchieren. Dies hatte sich in ihrem Gedächtnis ähnlich festgesetzt wie der Geruch von Diesel, mit dem der Perkins-Motor des Schiffs angetrieben wurde. Oder auch der Geruch der Fische, die die Eltern auf das hölzerne Deck zogen und ihnen mit einem raschen, gezielten Schlag das Leben nahmen.
Überhaupt die Fische! Mit acht Jahren las sie ein Buch über Fische und das Fischen – kein Kinderbuch, sondern Hemingways Der alte Mann und das Meer – und beschloss, in Zukunft auf den Verzehr von Fischen zu verzichten. Für sie bestand die Lehre aus diesem Buch darin, nicht erst einen Fisch töten zu müssen, um seine Würde zu erkennen. Denn sie begriff durchaus die Tragik des alten Mannes, den bereits gefangenen und schließlich auch getöteten Fisch – dessen Fleisch zu verkaufen nun gar nicht mehr sein Anliegen darstellt – gegen die vom Blut angelockten Haie zu verteidigen. Einen Toten zu schützen, auch wenn die Rettung letztlich allein darin besteht, sein Skelett an Land zu befördern.
Sicher erstaunlich, dass Tonia in diesem Alter bereits in der Lage war, ein solches Buch zu lesen. Und obgleich sie wohl kaum alles verstand, zog sie eben eine Lehre daraus, eine Moral. Moral ist immer eine Konsequenz. Welche in ihrem Fall bedeutete, sich künftig weder am Fangen von Fischen noch ihrem Verzehr beteiligen zu wollen.
Ihre frühe Lesefähigkeit, ihr Interpretationsbedürfnis sowie ihre Einsicht, der Sinn und Zweck von Büchern bestehe darin, eigenes Verhalten zu relativieren, dies alles bewies, wie erfolgreich ihre Mutter den Unterricht gestaltete. So verstand Philippa es trotz ihres gepflegten Alkoholismus – der sie dazu brachte, bereits an den Vormittagen ihre Eiswürfel in einem Alkoholbett zu wiegen –, durch häufiges Vorlesen und ebenso häufiges Erzählen nicht nur Tonias Sensibilität für die Sprache zu wecken, sondern auch ein Gefühl für den Geist, der in all diesen Geschichten steckte. Ein Geist, dessen Auswirkungen durchaus den Intentionen des Autors zuwiderlaufen konnte. Darum auch unterließ Philippa es zu argumentieren, der Verzicht auf frisch gefangenen Fisch würde in keiner Weise Hemingways Haltung gerecht werden, der ja immerhin ein leidenschaftlicher Hochseeangler gewesen war. »Ein Buch«, sagte Philippa einmal – und später sagte es auch ihre Tochter –, »tut im Kopf eines Lesers mehr, als jeder Autor sich erträumen oder wovor er sich fürchten mag.«
Dennoch wurde Tonia nicht etwa Vegetarierin, sondern verzichtete einzig auf den Genuss von Fisch und aß sehr wohl das Rindfleisch, das in ihrem Lieblingsgericht Ravioli eingepackt war, Ravioli aus der Dose. Wie überhaupt das Essen aus der Dose ihr favorisiertes blieb. Noch als Erwachsene ereilte sie des Öfteren ein Heißhunger auf Dosenravioli, während ihr dasselbe Gericht frisch zubereitet wenig zusagte. Egal, wie nobel das Restaurant und wie exquisit die Herstellung. Sie sagte dann: »Da fehlt etwas.« Und wenn sie gefragt wurde, was da fehlt, erklärte sie: »Der Geschmack von Maggi.« Und hätte sie diesen »Maggigeschmack« definieren müssen, sie hätte gesagt: »Der Speichel von Göttern.«
Und bei den Suppen war es genauso. Sie würde ein Leben lang Suppen aus der Dose wie auch Trockensuppen bevorzugen (die sie gemäß der österreichischen Sprache ihrer Mutter »Packerlsuppen« nannte und nicht gemäß dem Hochdeutsch des Vaters »Tütensuppen« – sie gab dem Österreichischen einen Vorzug, den jeder verstehen wird, dem Sprache mehr bedeutet als eine Krücke für Lebewesen, die der Kommunikation durch Telepathie nicht mächtig sind). Es kam später sogar vor, dass sie in Restaurants extra nach Fertigsuppen fragte und sich mit einigen Köchen sehr klug über die verschiedenen Marken und Sorten unterhielt. Wobei sie selbstverständlich auf jene Instant-Nudelsuppen verzichtete, in denen irgendeine Art von Meerestier oder Süßwassergeschöpf verarbeitet war. Ihre lebenslange Fischabstinenz schloss sämtliche Bewohner sämtlicher Gewässer ein.
Es war übrigens nicht nur ihre Mutter, die an Vormittagen wie an Nachmittagen trank – und nicht gewusst hätte, wieso sie ausgerechnet abends damit aufhören sollte –, sondern auch ihr Vater. Klar, ein Segelschiff benötigte eine gewisse Achtsamkeit und körperliche Fitness. Und wenn man auf diesen Planken lebte, erforderte es außerdem eine dieses Leben schützende Disziplin. Aber die beiden zeigten sich in hohem Maße geschickt und versiert. Und sosehr sie über die Ziele und die Routen ihrer Reisen diskutierten, gelang ihnen gerade in schwierigen Situationen ein harmonisches Agieren. Vor allem ihr Vater besaß ein Gespür für das Boot, als sei er damit verwachsen, oder das Boot mit ihm. Und auch wenn er nicht immer ganz nüchtern war, das Boot war es.
Wenn Tonia später über die Streitereien ihrer Eltern berichtete, dann stellte sie gerne einen Vergleich an. Sie lernte nämlich einen Antiquitätenhändler kennen, welcher zu cholerischen Anfällen neigte und dabei häufig mit dem Fuß in eines seiner vielen gegen die Wand gelehnten Gemälde trat, jedoch bei aller Raserei und Wut stets darauf achtete, nur Bilder von geringem Wert zu ruinieren. Es lag eine Beißhemmung in seinem Zorn, die wertvolles Gut verschonte. Genauso war das bei ihren Eltern gewesen.
Wenigstens in all den Jahren, da Tonia auf diesem Schiff groß wurde, das Lesen beigebracht bekam, mehrere Sprachen erlernte, das Rechnen, die Mathematik und was sonst noch dazugehörte, um die jährlichen Externistenprüfungen zu bestehen, für die man in den acht Jahren bis zu ihrem vierzehnten Geburtstag achtmal nach Wien reiste. Prüfungen, die Tonia jedes Mal wie Babykram erschienen. Freilich nutzten die Eltern diese Pausen vom Meer, um kurz nach dem Haus zu sehen und den Verwalter ihres Vermögens zu treffen. Ein Mann, der die beiden Schreibers ständig reicher machte, obgleich sie selbst nichts anderes taten, als Geld auszugeben und Pflanzen zu sammeln. Pflanzen, die sie regelmäßig auch nach Wien schickten, wo diese von dem chinesischen Hausmeisterehepaar eingesetzt und nicht ohne Geschick gepflegt wurden. So entstand unter der Regie von Herrn und Frau Liang ein mächtiges Gewächshaus. Die beiden entwickelten sich folgerichtig auch zu einem Gärtnerehepaar und bildeten somit einen Widerhall der absenten Botaniker, derart, dass nach Jahren manche Nachbarn die Liangs mit dem Namen Schreiber ansprachen.
Als Tonia vierzehn wurde, änderte sich alles. Mit einer Plötzlichkeit, die ihr geradezu animalisch erschien. Als wäre sie ein mit der größten Liebe und Sorgfalt großgezogenes Bärenjunges, das von einem Tag auf den anderen von seiner Mutter einfach stehen gelassen wird, an irgendeiner Stelle eines verdammten Flusses.
Tonias »verdammter Fluss« war ein Internat.
Ganz sicher war zwischen den Eltern darüber ein heftiger Streit entbrannt. Bei dem sich die Mutter, die Bärin, durchgesetzt hatte. Davon war Tonia überzeugt, ohne einen Beweis dafür zu haben, denn sobald sich ein Elternteil in einer wichtigen Sache behauptete, trug der andere die Entscheidung in einer Weise mit, die man als bedingungslos bezeichnen musste.
Die Entscheidung bestand darin, Tonia auf ein Internat zu schicken, kein österreichisches, sondern ein italienisches, nahe Genua gelegen. Einerseits, weil Tonia perfekt Italienisch sprach, andererseits wegen der Nähe zum Hafen, was es den Schreibers erleichterte, zu gewissen Anlässen ihr Kind zu besuchen. Denn ganz so bärenhaft konsequent sollte es nicht zugehen. Natürlich war geplant, dass Tonia die Ferien mit und bei ihren Eltern verbrachte, also auf der Ungnadia. Und im ersten Jahr war dies auch der Fall. Allerdings musste Tonia feststellen, dass ihre Mutter sich verändert hatte, dass die Trinkerei, die ihr in all den Jahren eine Leichtigkeit, etwas Schwebendes und im wahrsten Sinne Geistvolles verliehen hatte, nun ins Schwere gekippt war, ins Schwermütige. Dennoch wurde der Sommer nach diesem Schuljahr ganz wunderbar. Endlich wieder an Bord sein zu dürfen. Denn es war wirklich nicht einfach gewesen, sich nach vierzehn Jahren auf einem Schiff in das Landleben einer Internatsschülerin zu fügen, als Mädchen unter Mädchen, und nicht als »Mädchen unter Fischen«, wie Tonia es selbst ausdrückte (nicht zuletzt, da sie in den Jahren ihrer Kindheit eine perfekte Schwimmerin, Schnorchlerin und sehr frühzeitig auch Taucherin geworden war). Vor allem war sie einen weiten Blick gewohnt, bei gleichzeitiger Enge der Innenräume. Das Leben im Internat hingegen, das Leben an Land, gab ihr das Gefühl, dass der äußere Raum viel zu klein sei, während umgekehrt die Innenräume unübersichtlich groß wirkten. Nur das eigene Zimmer erweckte diesen Eindruck nicht, die eigene Zimmerdecke, die Tonia mittels eines herabhängenden, gespannten Leintuchs niedriger erscheinen ließ, als sie war.
Und dann der Sommer auf dem Meer. Glücklich selbst mit einer Mutter, die sich zusehends mit den Eiswürfeln in ihrem Whiskyglas mitzudrehen schien. Ein Glas, das im Laufe des Tages immer voller wurde. Während der Vater um einiges langsamer trank als in den vergangenen Jahren, ja, man konnte den Eindruck gewinnen, es sei eher so, dass er sein Glas spazieren führte, beziehungsweise recht geschickt in der Hand hielt, während er steuerte. Er war vom Trinker zum Träger gereift und schien noch stärker als früher mit dem Boot verbunden. Die Art, wie er steuerte, hatte etwas von einem Mann, der auf einem Wal steht und die Zügel in der Hand hält. Auf einem willigen Wal. Einem geheilten Wal. Darauf ein zweibeiniger Kapitän und wortwörtlicher Einhandsegler.
In diesem letzten Sommer ihres gemeinsamen Familienlebens bemerkte Tonia nicht nur die Schwermut der Mutter, sondern auch, wie viel seltener ihre Eltern miteinander stritten. Wie da eine Ruhe eingekehrt war, die ihr wie die Ruhe vor dem Sturm erschien. Und ein Sturm war es dann in der Tat, der den Schlusspunkt unter das Leben der beiden segelnden Botaniker setzte. Es geschah im darauffolgenden Dezember des Jahres 1989, als Tonia von der Direktorin des Internats gerufen wurde und in Anwesenheit zweier Polizisten vom Tod ihrer Eltern erfuhr. Die Ungnadia war südlich der Kapverdischen Inseln in ein heftiges Unwetter geraten und gesunken. Die Leiche des Vaters wurde geborgen, die der Mutter blieb verschwunden, wobei sich keinerlei Verdacht ergab, es hätte irgendeine Art von Verbrechen stattgefunden und die Mutter wäre weiterhin am Leben. Immerhin wurden auch Teile der zerstörten Ungnadia entdeckt. Die Mutter wiederum wurde nach vergeblicher Suche für tot erklärt. Tonia meinte später, es sei ganz typisch für ihre Eltern, dass sich die Leiche des Vaters finden ließ, ihre Mutter hingegen noch im Tod auf einer gewissen Exklusivität beharrte: »Meine Mutter besaß eine Erscheinung wie Elizabeth Taylor, ein bisschen schlanker und natürlich jünger, aber mindestens so mondän und mindestens so betrunken, mein Vater aber … nein, er war nicht wirklich wie Richard Burton. Er war ja ungemein sportlich. Er war eher wie Burt Lancaster. Er war der Mann, der mir das Schwimmen beibrachte. Mitten im Indischen Ozean. Unter uns zweitausend Meter bis zum Grund.«
So wenig mysteriös das Ende des Vaters im Vergleich zu dem der Mutter war, besaß dieser Mann dennoch ein Geheimnis, eines, das mit der Meldung von seinem Tod aufbrach. Wie sich herausstellte, war Tonia nicht das einzige Kind, das Max Schreiber gezeugt hatte. Er war im ersten Jahr seiner Ehe mit Philippa, also 1970, auch mit einer anderen Frau zusammen gewesen. Zumindest einmal. Ein Zusammensein, aus dem eine Tochter hervorgegangen war. Es wurde nie richtig klar, ab welchem Zeitpunkt Max von diesem Kind erfahren hatte. Möglicherweise erst, als es bereits auf der Welt gewesen war. Auch blieb ungewiss, ob die Kindesmutter sich erst an ihn gewandt hatte, als ihr sein Millionenerbe bekannt wurde. Jedenfalls hatte Max, um das Geheimnis zu bewahren, in all diesen Jahren eine hohe monatliche Summe an die Mutter des Kindes, Emma Kossak, ausbezahlt. Wovon allein jener Vermögensverwalter wusste.
Aber die Lüge hielt nicht, nicht, nachdem Max gestorben war und sich Frau Kossak gemeldet hatte, um den Anspruch auf ein Erbteil für ihre Tochter geltend zu machen. Man schrieb immerhin 1990, ein Jahr nach der Erbrechtsänderung in Österreich, die uneheliche Kinder den ehelichen gleichstellte. Ein Kampf begann, wie er dazugehört, wenn Geld frei wird. Und der in erster Linie zwischen Emma Kossak und Max Schreibers Eltern geführt wurde, die meinten, ihre eigenen Ansprüche wie die ihrer legitimen Enkelin gegen eine Frau verteidigen zu müssen, die sie für eine Betrügerin hielten. Letztlich bekamen sie recht, da zwar die regelmäßigen Zahlungen von Max Schreiber an Emma Kossak belegt waren, allerdings nie ein Eingeständnis seiner Vaterschaft oder auch nur eine Vaterschaftsklage erfolgt waren. Und das Gesetz sah nun mal vor, dass kein Erbrecht entstand, wenn der Vater noch vor der Erhebung einer Vaterschaftsklage verstarb. In diesem Punkt obsiegten Max’ Eltern, konnten aber nichts dagegen unternehmen, dass ein Vermögensanteil aus Grundstücksgeschäften, die jener famose Finanzberater kontrollierte, laut der letztwilligen Verfügung des Verstorbenen an Emma Kossak ging. Ein Geld, das in den nächsten Jahren nicht kleiner, sondern größer wurde und welches Emma Kossak, die nur zwei Jahre später bei einem Autounfall verstarb, zur Gänze ihrer Tochter Hannah hinterließ. (Es ist eine dieser ausgesprochen erfunden und gestellt anmutenden Zufälligkeiten, dass der LKW-Fahrer, der am Steuer eingeschlafen war und den tödlichen Unfall verursacht hatte, Manfred Ungnad hieß, ein wirklich seltener Name.)
So gesehen ist es vielleicht doch nicht ganz verwunderlich, dass im Zuge dieser Erbschaftsstreitigkeiten die beiden Mädchen in Kontakt miteinander traten und einen Briefverkehr begannen, der alleine der Annahme geschuldet war, sie könnten Halbschwestern sein. Sie entwickelten eine Freundschaft, die blütenhaft aus den dummen Querelen der Erwachsenen hervorwuchs. Wobei die zwei Mädchen, als sie dann selbst erwachsen wurden, sich entschieden, ihre finanziellen Interessen weiterhin von genau jenem Vermögensberater vertreten zu lassen, dem schon ihr gemeinsamer Vater vertraut hatte. Weniger an den Profit denkend als an das Symbol, sich in monetären Dingen diesem einen Mann anzuvertrauen. Dessen Aufgabe nun nicht mehr nur darin bestand, in der bewährten Mischung aus Stillstand und Bewegung eine Vermögensvermehrung zu bewirken, sondern auch Teile dieser Vermehrung abzustoßen. Beide, Hannah wie Tonia, waren durchaus zufrieden ob ihrer gesicherten Existenz, fürchteten jedoch das Übel eines abnormen Reichtums. Dann nämlich, wenn von dem Geld zu viel vorhanden war, um es noch auf eine Weise auszugeben, die dem entsprach, was man den guten Geschmack nennt. Der gute Geschmack endet bei einer gewissen Grenze von Reichtum. Das ist zwangsläufig. Ein Gesetz der Physik. Und wenn man wusste, dass knapp drei Jahrzehnte nach diesen Ereignissen die zweiundsechzig reichsten Menschen auf der Erde – nach anderen Rechnungen bloß acht – zusammengenommen mehr besaßen als der halbe ärmere Teil der Welt, dann konnte man sich vorstellen, was aus der Physik des guten Geschmacks geworden war.
Es war absolut konsequent, es gleichfalls diesem Mann zu überlassen, über die Abstoßung eines Vermögens zu entscheiden, dessen Vermehrung von ihm selbst betrieben wurde. Ihm somit die gemeinnützige Verteilung beider »Überschüsse« oblag. Ohne dass die Halbschwestern auch nur einmal nachfragten, ob er dabei eher hungernde Kinder oder hungernde Tiere oder die Förderung der schönen Künste bevorzugte. Oder einen schönen Unsinn förderte.
Nach dem Segeltod ihrer Eltern zog Tonia weder zu den Großeltern mütterlicherseits noch zu den Eltern des Vaters. Diese Menschen waren ihr allesamt fremd. Es fehlte eine Bindung des Herzens. Stattdessen verblieb sie die Jahre bis zur staatlichen Abschlussprüfung in Italien und in der Obhut der Internatsleitung, wurde zudem regelmäßig besucht von jenem Vermögensverwalter, der nie persönlich oder gar väterlich wurde und dennoch Tonia etwas Familiäres vermittelte. Den Willen ihres Vaters. Einen Willen, der wie ein Schirm war, in dessen schützendem Schatten sie stand.
1992 zog Tonia achtzehnjährig nach Wien, in jene Stadt, in der ihre Eltern nur sehr kurz gelebt hatten, dafür aber das Ehepaar Liang bereits seit zwanzig Jahren einen Haushalt pflegte, der zwar nicht ihr eigener war und den sie auch nicht etwa als ihren eigenen gestalteten, ihn aber in exzellentem Zustand erhielten – und darin das Eigene erkannten: im Erhalten. Wozu gehörte, auch nach dem Tod der Schreibers die über die Jahre aus aller Welt per speziellem Postversand zugeschickten Pflanzen in dem ausgebauten Gewächshaus zu pflegen. Max Schreibers Testament schrieb ein fortgesetztes Wohnrecht der beiden Liangs vor wie auch deren Entlohnung. Und selbstverständlich den Erhalt der Villa zugunsten seines »einzigen Kindes«, bis dieses selbst entscheiden konnte, ob es einen Verkauf vornehmen wollte. Seine Frau Philippa hingegen blieb völlig unerwähnt, als hätte Max vorausgesehen, einmal gemeinsam mit ihr zu sterben.
Die Villa zu verkaufen, das kam für Tonia freilich nicht infrage. Vielmehr fragte sie ihre Halbschwester, als sie diese endlich persönlich kennenlernte – Hannah, die zu dieser Zeit bereits an der Wiener Universität studierte –, ob sie zu ihr ziehen wolle, um mit ihr gemeinsam das obere Stockwerk zu bewohnen. Das untere sollte den Liangs vorbehalten bleiben, wozu natürlich auch der Garten zählte und alles, was zur Pflanzenpflege gehörte (der Garten stellte gewissermaßen ein Freigehege dar, das Gewächshaus wiederum versuchte, exotische Welten zu kopieren – eine Orgie von Chlorophyll). So selten Tonia die beiden Liangs in den Jahren ihrer Kindheit und Jugend gesehen hatte, und so schwierig es war, sich mit den beiden zu verständigen – denn ihr Deutsch erinnerte noch immer an einen aus einem völlig unbekannten Fruchtfleisch gepressten Saft –, bestand dennoch von Anfang an ein herzliches Einverständnis zwischen der Tochter der Schreibers und dem Hausmeisterehepaar.
Hannah zog nach einem ersten Zögern tatsächlich zu Tonia, und die beiden teilten das oberste Stockwerk schwesterlich in den – wie sie das nannten – »T-Teil« und »H-Teil«, trafen sich aber des Öfteren in der Mitte, in einem langen, auf einen Balkon zuführenden Schlauch, den sie mit der Bezeichnung »Halm« versahen. Dort richteten sie eine Küche ein, kochten jedoch so gut wie nichts, manchmal Dosenravioli, das schon, in erster Linie aber bereiteten sie Unmengen von Kaffee und Tee zu und entkorkten an den Abenden die eine oder andere Flasche Wein. Wobei sie, ohne dies irgendwie ausgemacht zu haben, nie Burschen mitnahmen. Nicht in den Halm. Freilich schon in ihre jeweilige Wohneinheit, aber eben keinesfalls in die Küche. Gegessen wiederum wurde, wenn nicht auswärts, dann bei den Liangs, die ganz wunderbare Gerichte auf den Tisch zu zaubern verstanden. Chinesisches Essen, das wenig mit jenem chinesischen Essen zu tun hatte, wie man es aus den Restaurants kennt, wobei viele der Ingredienzien aus dem eigenen Garten und dem eigenen Gewächshaus stammten. Beziehungsweise bezogen die Liangs manches Material aus ihrer Heimat mittels jenes von den Schreibers erfundenen Frischhaltesystems für den Postversand.
Alle paar Tage erschienen Tonia und Hannah zum Abendessen, ohne sich vorher angekündigt zu haben. Es geschah spontan, und die Plötzlichkeit wurde von den Liangs damit beantwortet, sich augenblicklich an den Herd zu stellen – wenn sie nicht ohnehin schon dort standen – und etwas zuzubereiten, was einem das Gefühl gab, nicht nur in eine gänzlich fremde Welt einzutreten, sondern auch in eine bessere. Was nicht heißen soll, in China zu leben wäre schöner, sicher nicht, aber in China achtsam Zubereitetes zu essen, das schon.
Keine Frage, die Liangs wussten natürlich, dass sie alles verwenden durften, nur keine Meerestiere. So entstanden die einzigen Speisen, denen Tonia mit der gleichen Liebe zugetan war wie ihren Dosenravioli.
Auch sie begann nun zu studieren. Während es bei Hannah Jus war (wie man die Jurisprudenz in Österreich abkürzt und ihr solchermaßen zu einer Schlankheit verhilft, die sie nicht besitzt), scheute sich Tonia nicht, in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Allerdings nicht ganz exakt hinein, sondern knapp daneben. Biologie, natürlich, aber nicht mit dem Plan, sich auf die Botanik zuzubewegen, sondern in Richtung auf die Meeresbiologie, was zu ihrer Zeit in Wien bedeutete, nach einem ersten Studienabschnitt in allgemeiner Biologie die Fachrichtung Zoologie zu wählen. Und sich in der Folge auf das Studium mariner Lebensräume zu konzentrieren. Keine wirkliche Überraschung, wenn man um die Umstände von Geburt und Kindheit dieser Studentin wusste. Auf die Frage, was sie denn studiere, antwortete sie gerne: das Wasser.
Wasser war nun mal der entscheidende Aspekt von allem. Wenn es irgendwo eine Antwort auf die Frage nach dem Großen und Ganzen gab und man sich nicht mit Lösungen wie der Zahl »42« zufriedengeben oder mittels gewaltiger Teilchenbeschleuniger sein Heil im Nachbauen von Kollisionen finden wollte, dann war es eindeutig am besten, sich mit dem Wasser zu beschäftigen. Und mit denen, die noch immer dort lebten und sich vermehrten. Die sich noch immer oder schon wieder am Anfang befanden. Den Anfang zu studieren war darum so interessant, weil man von dort so systematisch auf das Ende schließen konnte. Nicht zuletzt auf ein Ende ohne Wasser. Übrigens ging Tonia weiterhin viel ins Wasser, nicht nur in einer studierenden, auch in einer sportlichen Weise. Wie sie überhaupt auf ihre Fitness achtete und sich in ihrer Villa einen dieser Räume eingerichtet hatte, den die Österreicher »Kraftkammer« nennen.
Jus und Biologie also.
Botanik der Eltern als Erbe.
Haus- und Gartenpflege der Liangs.
Das waren die Grundpfeiler, auf und zwischen denen sich Tonia und Hannah in den Neunzigerjahren bewegten. Während sich die Stadt Wien aus der notgedrungenen Gegenwärtigkeit des Unentschlossenseins verabschiedet und eindeutig für die Zukunft entschieden hatte. Gleich einem Ball, der, bevor er noch geworfen wird, sich bereits in den Armen des Fängers wähnt und auf diese Weise niemals ein echtes Gefühl für den Flug entwickelt, diesen bloß als Reminiszenz erlebt.
Es wurden gute Jahre. Jahres des Lernens. Wobei die zwei Frauen nicht nur mit großem Ehrgeiz und Fleiß ihre Studien betrieben, sondern es zugleich auch verstanden, Freizeit zu kultivieren: Kino, Theater, Tanzen, die schwarmartigen Bewegungen in Diskotheken, die schwarmartige Beruhigung der Bewegung in Kaffeehäusern, das weite Areal des Flirtens, die politische Diskussion als eine praktische Variante der Hirnforschung. Und natürlich der Sex, wobei Hannah sich mit dem Sex auseinandersetzte, indem sie ihn häufig praktizierte, Tonia, indem sie sparsam damit umging. Dabei hatte Tonia mehr Verehrer. Nicht, weil sie hübscher war, hübsch waren beide, aber Tonias nach und nach zum Gerücht gewordene Enthaltsamkeit, ihre mitunter nonnenhafte Praxis, stellte eine verführerische Herausforderung gerade für jene Männer dar, die meinten, sich mit ihrem Intellekt zwischen die Beine einer jeden Frau manövrieren zu können. Dass ein »gescheiter Satz« eine magische Wirkung besaß und viele »gescheite Sätze« den Weg ebneten, in eine Frau zu gelangen. Was bei Tonia aber nur selten funktionierte. Beziehungsweise bevorzugte sie Männer, die nicht ganz so gescheit daherkamen und die den oft zitierten, aber leider selten befolgten Rat, man müsse nicht immer reden, auch wirklich ernst nahmen.
Liebe entstand daraus keine. Aber für die Liebe wollte sich Tonia auch Zeit nehmen, abwarten und nicht die Schwärmerei für eine solche halten. Konservativ gesprochen: Sie wollte zwar nicht ihren Körper für jemand Bestimmten aufsparen, aber ihre Seele durchaus.
Es ist eine tragische Wahrheit, dass genau das nicht so richtig gelingen sollte. Auch wenn Tonia einen Moment daran glaubte, als sie im dritten Jahr ihres Studiums mit einem gescheiten Mann, einem ihrer Professoren, ein Verhältnis einging. Der verheiratete Mann war berüchtigt für seine jungen Geliebten, die er aus dem Chor seiner Studentinnen bezog, und Tonia war weder so naiv, dies zu übersehen, noch blind für das Faktum, mit einem Mann zusammen zu sein, der nicht nur ihr Vater, sondern mit seinen über sechzig Jahren auch ihr Großvater hätte sein können. Aber die psychologische Seite – Vaterersatz plus Großvaterersatz – kümmerte sie nicht. Zudem war sie der Meinung, dass die Liebe sich ja nicht über die Zeitdauer definierte, beziehungsweise bezweifelte sie sogar, selbige könne über einen langen Zeitraum bestehen. Lebenslange Liebe hielt sie für eine romantische Illusion, die ihre Berechtigung hatte, doch allein im Rahmen träumerischer und fiktiver Vorstellungen. Nicht lebbar, aber im wahrsten Sinn denkbar. Weshalb sie auch überzeugt war, dass das Lebensende ihrer Eltern einem baldigen Liebesende zuvorgekommen war, ja, manchmal überlegte sie sogar, es könnte eine Form von Absicht bestanden haben. Nicht direkt im Sinne eines gemeinsamen Selbstmordes. Aber die Frage war schließlich berechtigt, wieso derart erfahrene Segler in einen angekündigten Sturm geraten konnten.
Ende der Leseprobe