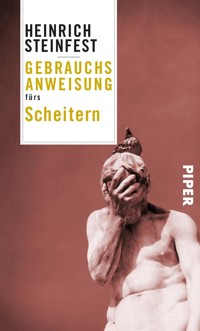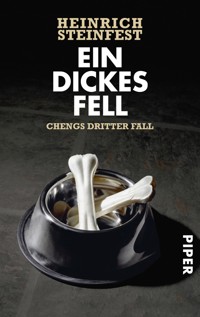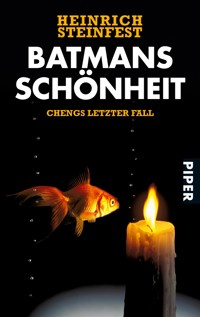
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Markus Cheng hat sich in eine Privatidylle zurückgezogen und fühlt sich in keiner Weise davon berührt, als in Wien mehrere Schauspieler ermordet werden, die allesamt »frankiert« wurden: Eine norwegische Briefmarke klebt ihnen auf der Zunge. Cheng hingegen ergibt sich ganz der Aufzucht winzig kleiner Salzkrebse, von denen er einen Batman tauft. Aber wie man so sagt: Die Vergangenheit holt ihn ein und lässt ihn zwischen Madeira und Wien, zwischen Urzeit und Jetztzeit, zwischen Himmel und Hölle alsbald das Gefüge der Welt begreifen. Heinrich Steinfest hat 2010 den Heimito von Doderer-Literaturpreis erhalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage Februar 2010
ISBN 978-3-492-95807-3
© 2010 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagfoto: Chris Collins / Corbis Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Bilder einer Ausstellung
Vorraum
The Importance of Being Earnest
(Titel einer Komödie von Oscar Wilde)
0
Das Thermometer an der Wand zeigte auf die Vierundzwanzig, die Uhr auf der Kommode zeigte auf die Drei, der Kalender in der Küche zeigte auf die Zwölf, der Wärmeregler drüben im Schlafzimmer zeigte auf Aus. Hätte Ernest mitgezählt gehabt, dann hätte er gewußt, daß die Summe der Projektile, die in seinen Körper eingedrungen waren, auf die Fünf zeigte. Aber wer, bitteschön, zählt schon mit, wenn man auf ihn schießt? Das müßte dann schon ein extrem zahlenbewußter Mensch sein.
Immerhin, daß es mehrere Kugeln gewesen waren, hatte er mitbekommen. Wobei er zu seinem Erstaunen immer noch nicht tot war. Er hatte sich das sehr viel rascher vorgestellt. Möglicherweise war es so, daß keins dieser Geschosse ihn an einer Stelle getroffen hatte, die geeignet gewesen wäre, seinen sofortigen Tod zu bewirken. Die Betonung liegt auf »sofortig«, denn er fühlte durchaus, wie er schwächer und schwächer wurde, was vielleicht aber auch mit dem Mittel zusammenhing, das ihm der Mann, der gefeuert hatte, nachdem er gefeuert hatte, verabreicht hatte. Faktum war jedenfalls, daß aus den verschiedenen Perforationen seines Körpers das Blut floß, und zwar nicht zu wenig.
Sollte das sein Ende sein?
Er sah über sich die Todesanzeige schweben, das schwarze, schmale Kreuz, darunter die Buchstaben, die vom Wind getragen, leicht vibrierend in der Luft standen und jenen Namen bildeten, den er so lange verleugnet hatte: Ernest Hemingway.
Er hatte es immer gehaßt, so zu heißen. Daß der eigene Familienname mit dem einer Person identisch war, die diesen Namen berühmt gemacht, ihm eine Aura, einen Glanz verliehen hatte, nun gut, das kam vor. Andere Menschen mußten auch damit leben, den Namen Brahms oder Churchill zu tragen, das war nicht so schlimm, solange man nicht auch noch Johannes oder Winston zu heißen brauchte. Doch genau das war in seinem Fall geschehen, weil seine Eltern auf eine dümmliche Weise stolz gewesen waren, wenn schon nicht verwandt, so eben namentlich mit dem großen amerikanischen Romancier verbunden zu sein. Und welche diesen Stolz auf die Spitze getrieben hatten, dadurch, ihren einzigen Sohn auf den Namen Ernest zu taufen. Ohne sich jemals vorzustellen, wieviel Spott und Hohn ihr Kind dank dieser Unsinnigkeit würde ertragen müssen. Vor allem natürlich wegen der halbgebildeten Erwachsenen, etwa den Lehrern in der Schule, die bei jedem falsch geschriebenen Wort, jeder unglücklichen Formulierung den kleinen Ernest darauf verwiesen, daß es sich bei ihm offensichtlich um den falschen Hemingway handle. Nun, da hatten sie absolut recht, es allerdings zu erwähnen, es mit billigen Wortspielereien vor aller Welt – und was wäre eine Klasse anderes als alle Welt? – breittreten zu müssen, hatte dazu geführt, daß die anderen Schüler diesen Umstand ebenfalls benutzten, um ihre Späße zu treiben, anfangs in Unkenntnis der eigentlichen Bedeutung, später dann mit konkreten Hinweisen auf den Nobelpreisträger, sein Werk und seine Lebensumstände. Wie oft hatte sich Ernest, bevor er eins auf die Nase bekommen hatte, den Spruch »Wem die Stunde schlägt« anhören müssen, so daß das Gesagte mehr geschmerzt hatte als der eigentliche Schlag, wie oft hatten Lehrkräfte, bevor sie ihm eine an der Kippe stehende Benotung bekannt gegeben hatten, süffisant vom »Haben und Nichthaben« gesprochen. Außerdem mußte er Fingerzeige in Bezug auf den Stierkampf – eins der ekelhaftesten Dinge, die er kannte: lebende Tiere aufspießen – sowie Anspielungen auf alte Männer, Meere und die Trunksucht über sich ergehen lassen, vor allem aber Bemerkungen über die Unart, sich eine doppelläufige Schrotflinte an den Mund zu halten und sich damit aus dem Leben zu befördern. Kaum ein Konflikt mit Gleichaltrigen, bei dem nicht am Ende die Empfehlung gestanden hatte, es dem versoffenen Großwildjäger gleichzutun.
Das Prinzip fast jeden Unglücks ist es, sich zu steigern, ganz wie Gäste oder Fieber. Gäste und Fieber kommen ja nicht, um gleich wieder zu gehen, sondern mal eine Weile zu bleiben und solange zu nerven, bis irgend eine Art von heimlicher oder lauter Eskalation eintritt und hernach die Heilung beginnen kann.
Ernests Unglück steigerte sich nun geradezu ins Unermeßliche, indem er mit zehn Jahren, als er sich bereits die längste Zeit dumme Witze über Safaris und das Boxen und tote Stiere und den Schnee auf dem Kilimandscharo hatte anhören müssen, zu stottern begann. Ja, anfangs schien er sich nur im Zuge einer Nervosität oder Aufgeregtheit in den Worten zu verfangen, wie Kinder manchmal reden, wenn die Gedanken ihnen davoneilen. Doch es wurde schlimmer, und bald konnte er keinen Satz mehr sprechen, ohne mühselig und verzweifelt über die Schranke zu steigen, die sich in seinem Mund gebildet hatte. Eine verknotete Zunge als Resultat einer verknoteten Seele. Woraus sich in der Folge jene Lösung ergab, die sich einem jeden Stotterer unweigerlich aufdrängt: nämlich den Mund zu halten.
Es versteht sich, daß ihn seine Eltern zu diversen Ärzten brachten, denen alle möglichen Ursachen in den Sinn kamen, schließlich ist die Stotterei ein Eldorado freier Interpretation. Ärzte, die ihrerseits nicht ohne Amüsement den berühmten Namen des Kindes feststellten, ohne jedoch einen Bezug zu dessen verbaler Irritation herzustellen. Statt dessen übten sie sich im Kaffeesatzlesen. Ernests Eltern wiederum reagierten alsbald mit unterdrückter bis offener Aggression gegen ihren Jungen, weil sie sein Stottern als ein für alle sicht- beziehungsweise hörbares, beziehungsweise ab einem bestimmten Moment eben nicht mehr hörbares, dafür um so markanteres Zeichen des eigenen Scheiterns begriffen. Etwas, das sie als eine Ungerechtigkeit empfanden, als eine Bösartigkeit ihres Sohnes, dem sie doch mit so viel Liebe und Zuneigung begegnet waren. Nur leider nicht der Liebe, die darin besteht, einem Kind einen vernünftigen Namen zu geben.
Doch Rettung nahte. Und die Rettung hieß Europa. So heißt ja nicht nur einer der Monde des Planeten Jupiter, sondern auch das zerfranste Fünftel einer Landmasse auf der Erde. Ernests Vater wurde von seiner Firma nach Deutschland entsendet, um dort eine Zweigstelle aufzubauen. In Hamburg. Auf diese Weise kam der seit einem Jahr stotternde, zuletzt aber kaum noch aus seiner Verstummung herauszulockende Elfjährige in eine Stadt, die er sofort liebte, vor allem, wie man hier redete. Ohne, daß er vorerst ein einziges Wort verstanden hätte. Er war ja soeben noch mit dem Schweigen in Englisch beschäftigt gewesen. Aber die neue Sprache klang so schön, sie roch so gut, sie schmeckte so gut, und vor allem war sie fremd. Das war das Beste an ihr. Daß kein Mensch hier Ernest hieß und auch niemand von einem Ernest redete, sondern, wenn schon, dann von einem Ernst, und das mag nun zwar die deutsche Urform sein, klingt aber völlig anders, überhaupt nicht nach Safari und ähnlichem Unfug.
Ernest beschloß, ein Ernst zu werden. Weshalb er begann, die neue Sprache zu erlernen, und zwar mit einer Geschwindigkeit, die seine Eltern und jedermann verblüffte. Vor allem aber, daß er nicht mehr stotterte, so daß man hätte meinen können, er sei geheilt. Aber er war nicht geheilt, nicht auf Englisch, sondern nur auf Deutsch.
Nach einem Jahr war er so gut darin, um von der Sprachschule, auf die er gegangen war, in ein konventionelles Gymnasium zu wechseln. Die Versuche seiner Eltern, ihn in eine internationale, bilinguale Schule zu schicken, hatte er mit dem sofortigen Rückfall in sein altes Schweigen beantwortet, so daß man rasch von dieser Idee wieder abgekommen war. Auch von der Idee, den eigenen Sohn davon abhalten zu wollen, sich den Vornamen Ernst zu geben. Er setzte sich durch, so daß er von nun an also Ernst Hemingway hieß. – Man mag nun einwenden, daß es doch viel effizienter gewesen wäre, hätte er gleich einen völlig anderen Vornamen angenommen, doch möglicherweise war es gerade diese feine Abstufung, die so stark wirkte, stärker als die dramatische Flucht in Namen wie Daniel oder Sven oder Torsten. Nein, mit dem Namen Ernst war er zufrieden und parierte die natürlich auch in Deutschland stattfindenden literarischen Anspielungen mit frischgewonnener Bravour. Wobei sich die Menschen hier ohnehin sehr viel weniger für den großen alten Amerikaner und seine Kubageschichten und seine Fischgeschichten interessierten. Zumindest in den Freundeskreisen, in denen Ernst jetzt verkehrte. Hamburger Kleinbürgertum. Er liebte das Hamburger Kleinbürgertum, das sich freilich Mittelschicht nannte. Egal, er war zufrieden mit diesen Leuten und beherrschte ihre Sprache bald in einer Weise, als hätte er immer schon unter ihnen gelebt. Hatte somit auch kein Problem, dem in Deutsch vorgetragenen Unterricht zu folgen. Ein Fach allerdings verweigerte er, wie man sich denken kann. Was eigentlich an diesem Gymnasium gar nicht ging, sich des Pflichtgegenstands Englisch zu enthalten, aber nachdem ein gütiger und weiser Arzt ein Attest in der Art einer Befreiung vom Turnunterricht ausgestellt und dabei die nicht ganz unlogische Meinung vertreten hatte, daß ein Kind, das ohnehin schon perfekt Englisch erlernt habe, es nicht noch einmal zu erlernen brauche, nach dieser medizinischen und menschlichen Einsicht also wurde für Ernst von der nicht minder einsichtigen Schulleitung eine unbürokratische Speziallösung geschaffen. Man sagte sich wohl: Lieber ein Englischschüler weniger als ein Stotterer mehr. Eine Einstellung, die für Ernst einen weiteren Beweis darstellte, inwieweit die alte Welt die bessere war. Und Hamburg sowieso.
Als er acht Jahre später sein Abitur machte, war es bloß noch sein Familienname, der daran erinnerte, daß Ernst aus einem anderen Land stammte. Nicht, daß er in einem breiten Plattdeutsch redete, aber das taten ja auch seine Freunde nicht. Der Jargon dieser jungen Leute war in den meisten Fällen neutral zu nennen, von der Region, in der sie lebten, bloß leicht eingefärbt, wie man halt in der Sonne ein bißchen braun und vom andauernden Fernsehen und Computerspielen ein bißchen bleich wird. Diese Jugendlichen sprachen also nicht wie in einer Echtzeit-Parodie. Und schon gar nicht wäre es Ernst eingefallen, sich mittels eines massiv hervorquellenden Dialekts über das Land und die Sprache lustig zu machen, welche ihn gerettet hatten.
Leider geht aber nicht nur das Fieber mal vorbei und müssen auch die ungeliebtesten Gäste mal nach Hause, auch Rettungen finden irgendwann ihr Ende. Wobei es Ernst, wie er da jetzt in seinem Blut lag und das Gefühl hatte, sich Partikel für Partikel aufzulösen, klar wurde, was für ein schrecklicher Fehler es gewesen war, Hamburg zu verlassen und nach Wien zu reisen. In Hamburg wäre er trotz aller Schwierigkeiten sicher gewesen, beschützt von der Stadt an sich, von allen guten Geistern. Doch genau von solchen war er hier in Wien völlig verlassen. Er hatte Hamburg verraten, er hatte Silvia verraten und solcherart auch sich selbst. Auf eine so symbolische wie fatale Weise war er in seine alte Sprache, in sein Trauma und – obgleich er seinen Mund nicht aufbekam und auch gar nicht aufbekommen wollte – in sein Stottern zurückgefallen.
Aus Ernst wurde wieder Ernest.
Durch den glitzernden Vorhang seiner im Tränenwasser schwimmenden Augen bemerkte er nun, wie sich jemand über ihn beugte, ein Mann wohl, höchstwahrscheinlich derselbe, der auf ihn geschossen hatte. Eine überaus mächtige Gestalt, wobei einem, wenn man am Boden hingestreckt liegt und nach und nach sein ganzes Blut verliert, so gut wie alles und jeder auf dieser Welt mächtig, ja übermächtig erscheinen muß.
Ernest spürte die Hand des Mannes an seiner Unterlippe, spürte, wie die Lippe nach unten gezogen wurde und die Finger des Mannes sodann die Zunge berührten.
»Mein Gott«, dachte Ernest, »will er sie mir abschneiden? Denkt er wirklich, ich könnte ihn verraten? Ich bin fast tot und kann ihn kaum sehen. Außerdem wird da nie wieder ein Wort aus meinem Mund kommen. Wenn ich sterbe, nehme ich alle Wörter mit in mein Grab.«
Nun, das war auch nicht der Grund, daß der so riesenhaft wirkende Mann nach Ernests Zunge gegriffen hatte. Er schnitt sie nicht ab, sondern führte sie bloß ein Stück aus dem Mund heraus. Und dann …
Ernest konnte nicht sehen, was geschah, sein Blick verlor jeden Halt, so, wie wenn Steine ins klare Wasser fallen und die ganze Klarheit somit perdu geht. Doch auch wenn er nichts erkannte, so spürte Ernest deutlich, daß der Mann ein kleines Stück Papier auf seine Zunge auflegte und es auf eine behutsame Weise festdrückte, bevor er die Zunge nicht minder behutsam wieder in den Mund zurückschob.
Ernest wartete. Worauf eigentlich? Daß seine Zunge zu brennen begann? Daß sich das Papierchen in etwas Teuflisches verwandelte? Nichts dergleichen geschah. Ernest mußte schon selbst handeln. Mit einem Rest an Kraft und Wille preßte er seine Zunge gegen den Gaumen, ohne daß der Fremdkörper jedoch freikam. Allerdings meinte er dabei festzustellen, daß die Ränder des Papiers sich aus einer Anordnung kleiner, spitzer Zähne zusammensetzten. Und da nun dieses rechteckige Gebilde jenen bitteren, an alte Petersilie erinnernden Geschmack einer Gummierung besaß, kam Ernest nicht umhin, anzunehmen, daß es sich so schlichter- wie erschreckenderweise um eine Briefmarke handelte, welche da auf seiner Zunge auflag und durchaus in Briefmarkenart festklebte.
Nun, das war nicht ganz unoriginell, daß ein Mann, der starb, mit einer Briefmarke frankiert auf seine Reise in den Tod geschickt wurde. Möglicherweise war dies sogar unerläßlich für den Eintritt in die Unterwelt. Vielleicht schwirrten hier im Diesseits nur darum so viele Engel und Geister und Halbtote herum, weil man unterlassen hatte, sie mit einer ordentlichen postalischen Kennzeichnung auszustatten.
War dies der Fall, so erwies sich der Mann, der Ernest mit fünf Schüssen niedergestreckt hatte, wenigstens als so korrekt, die Beförderung des demnächst Toten mittels Briefmarke zu bezahlen. Für welchen Betrag auch immer dieses Postwertzeichen stellvertretend stand.
Stellte sich freilich die Frage, wer diese Marke stempeln würde. Und vor allem: wie?
Nun, Ernest wußte ganz gut, daß das gummierte Papier bereits im gestempelten Zustand auf seine sterbende Zunge aufgelegt worden war. Gestempelt vor langer Zeit auf einem englischen Kriegsschiff, das über den Südatlantik gefahren war. Es fiel ihm jetzt alles wieder ein. Schließlich war er selbst es gewesen, der diese Briefmarke beschafft und genau diesem Mann ausgehändigt hatte, der hier im Raum stand und mitleidlos auf sein Opfer hinuntersah. Ganz in der Art eines letzten kontrollierenden Blikkes. Die Arbeit war getan.
Auch Hemingways Arbeit schien getan zu sein. Er würde nicht mehr lange zu atmen brauchen. Doch während er nun aus dem Zustand lautloser Klage in ein Gefühl der Gelassenheit hinüberschwang, ja sogar ein wenig heiter und zuversichtlich war ob der Briefmarke auf seiner Zunge, bemerkte er von der Seite her einen Schatten. Mit der Plötzlichkeit eines Bebens ergab sich eine heftige Bewegung im Raum, ein Aufleuchten, ein Bersten, eine Verschiebung der Verhältnisse, alles sehr rasch. Dann, ebenso plötzlich, Ruhe. Eine Frau kniete sich zu ihm herunter, wenn es denn kein Mann war, der eine blonde Perücke trug. Dahinter gewahrte sein verschwommener Blick eine weitere, gleich einer schwärzlichen Säule dastehende Gestalt. Und in diesem Schwarz ein bläulicher Schimmer. So desolat Hemingway auch war, er wußte sofort, wem dieser Schimmer gehörte: Markus Cheng.
Das Thermometer an der Wand zeigte noch immer auf die Vierundzwanzig, die Uhr auf der Kommode, die wohl stehengeblieben war, noch immer auf die Drei, der Kalender noch immer auf die Zwölf und der Wärmeregler noch immer auf Aus.
Erster Saal
Du hast Geschmack und schläfst mit ’nem totalen Loser.
Ich auf der anderen Seite hab’ keine Ahnung
von Schönheit und darf die schönste Frau auf dem
Planeten vögeln. Wie nennst du das, wenn so was passiert?
(Harvey Keitel in Manuel Pradals Film A Crime)
Das ist das einzige,
von dem ich weiß,
daß es immer zurückkommen wird.
(derselbe im selben Film während der Benutzung eines Bumerangs)
…, denn es ist wahr,
und die Wahrheit redet sich selber.
(Meister Eckhart)
Erstes Bild: Ein Jude, der keiner ist
Die Stadt befand sich in der Tiefe des Frühlings. Es herrschte ein Zustand wie in einem dieser stark überwässerten, weil von fremder, ungelenker Hand betreuten Blumentöpfe. Menschen, die ihre Blumentöpfe alleine lassen beziehungsweise sie anderen Menschen ausliefern, kommen ganz sicher nicht in den Himmel. Überhaupt muß gesagt werden, daß jemand, der seine Pflanzen im Stich läßt, irgendwann auch seine Kinder im Stich lassen wird. So ist das leider.
An einem solchen an Überwässerung sterbenden Frühlingstag saßen Cheng und Lena in dem kleinen italienischen Restaurant und sägten an ihren Pizzen (genauer gesagt sägte Lena für sie beide). Es wurden hier mitnichten die besten Pizzen der Stadt serviert. Zudem war die Einrichtung auf eine völlig uninspirierte Weise schäbig und verstaubt zu nennen. Immerhin jedoch war es so, daß der Patron und sein Koch – selten ergab sich eindeutig, wer hier wer war – schrecklich viel Ahnung vom Fußball hatten. Ihre Gespräche darüber waren nicht nur leidenschaftlich, sondern zudem versiert und analytisch und gescheit. Freilich wurden davon die Pizzen nicht besser. Wie ja überhaupt auffällt, daß am Ende dieses ersten Jahrzehnts im neuen Jahrtausend eine beeindruckende Zahl unterschiedlichster Menschen extrem viel über den Fußballsport wußte. Lauter potentielle Experten von Weltniveau. Doch bedauerlicherweise verdingten sich alle diese mit hoher Professionalität ausgestatteten Laien in ganz normalen Berufen, wo sie nicht annähernd das leisteten, was sie als Trainer oder Kommentatoren oder Sportdirektoren hätten bewirken können. So gesehen, gab es nicht zu viel Fußball, sondern zu wenig. Und genau darum erwies sich die Welt, zumindest die Welt der Männer, als eine verkehrte.
Nicht hingegen die Welt, in welcher Markus Cheng nun seit einigen Jahren lebte. Noch nie war es ihm so gut gegangen. Er hatte seinen Job als Detektiv aufgegeben, diese ganze elendigliche, schutzengelhafte Arbeit. Er war sich jetzt sein eigener Schutzengel. Vor drei Jahren hatte er Lenas Mutter, Ginette Rubinstein, geheiratet. Er sagte gerne zu ihr: »Ich verdiene dich gar nicht.« Einmal hatte sie darauf geantwortet: »Stimmt.« Und sodann ergänzt: »Wobei man das als einen Gottesbeweis ansehen könnte. Nämlich etwas zu bekommen, was man nicht verdient. Wäre es nämlich umgekehrt, wäre die Welt gerecht, dann wäre sie auch sinnlos.«
In der Tat. Denn zumindest für die, welche ernsthaft an ein Jenseits glauben, würde sich ein gerechtes Diesseits als ziemlich unlogisch ausnehmen. Wenigstens ungesund. Wie man ja auch Kindern verbietet, sich kurz vor der offiziellen Mahlzeit mit Schokolade vollzustopfen und sich solcherart den Appetit zu verderben, wenn nicht gar den Magen. Nein, die Ungerechtigkeit in der Welt scheint System zu besitzen, und die Frage ist nur, ob man das auch begreift und nicht etwa meint, eine bestimmte Sache, ein bestimmtes Glück allen Ernstes zu verdienen, sich selbiges Glück aufgrund von Fleiß und Willenskraft erarbeitet zu haben. Wo doch keine Größe so beliebig ist wie die, die hinten beim Fleiß herauskommt. Der Fleiß ist vergleichbar einer Roulettkugel, die mal auf Schwarz, mal auf Rot fällt und dabei auf irgendeiner Zahl zu liegen kommt, ähnlich diesen Leuten, denen es völlig gleichgültig zu sein scheint, mit wem sie Verkehr haben oder was sie essen.
Das alles erkannte Cheng. Und darum war seine Bemerkung, Ginette nicht zu verdienen, in keiner Weise kokett gemeint. Er verdiente sie wirklich nicht. Daß er sie dennoch hatte heiraten dürfen, mit ihr und ihrer Tochter zusammenlebte und zudem das Leben eines Müßiggängers führte, empfand er als ein Geschenk, welches durch nichts begründet war. Nicht einmal durch Faulheit, wie vielleicht ein fauler Mensch gerne hätte meinen können. Nein, bei seinem Lebensglück handelte es sich um pure Natur.
Das Glück war einfach aus dem Boden gewachsen.
Da nun Cheng das Bedürfnis verspürt hatte, die hinter ihm zurückliegenden Jahre, vor allem seine Tätigkeit als Detektiv, endgültig abzuschließen, hatte er bei seiner Heirat den Namen seiner Frau angenommen. Er hieß von da an also Rubinstein. Woraufhin einer seiner Wirtshausfreunde ihn sehr direkt gefragt hatte: »Bist du jetzt Jude?«
Und tatsächlich ergab sich durch die Namensänderung eine weitere »Undeutlichkeit« in der Person dieses Mannes, der ja aufgrund seiner lupenrein chinesischen Abstammung und seines nicht minder lupenrein wienerischen Wesens eine gewisse Widersprüchlichkeit verkörperte: sein Gesicht, sein asiatisch zierlicher Körperbau auf der einen Seite, seine Geburt, seine Sprache, seine Ansichten, sein durchaus rassistisch zu nennender Widerwille gegen alles Chinesische auf der anderen Seite. Wobei Chengs fernöstliche Aura allein in der Betrachtung der anderen existierte. Er selbst erklärte, definitiv kein Chinese zu sein. Leider fanden nicht wenige von den alteingesessenen Hiesigen, daß Cheng auch kein Wiener sei, zumindest kein richtiger. Und natürlich galt auch trotz der Namensänderung, daß er kein Jude war.
Doch so, wie er wegen seiner elterlichen Herkunft eben doch irgendwie, wenngleich uneingestanden, als ein Chinese gelten mußte, und er natürlich entgegen mancher Anschauung nicht minder einen Wiener darstellte, und zwar den leidenschaftlichsten, der sich denken läßt, so war er nun auch irgendwie ein Jude, weder uneingestanden noch überzeugt, eher … Man sollte noch erwähnen, daß Cheng nur einen Arm besaß. Beziehungsweise hatte er seinen linken verloren. Und vielleicht konnte man ja sagen, daß Chengs »Judentum« eine gewisse Ähnlichkeit mit jenem Arm besaß, der gar nicht da war.
Da sich nun aber die wenigsten Leute damit anfreunden konnten, Cheng nicht mehr Cheng, sondern Rubinstein zu nennen, und weil dieser im Grunde sehr wohlriechende Name allein mit der wunderbaren Erscheinung der Ginette Rubinstein und ihrer fünfzehnjährigen, quasi aus der Schönheit der Mutter hervorgesprossenen Lena in Verbindung gebracht wurde, blieb die Namensänderung eine bloß rechtliche Angelegenheit. Cheng wurde weiterhin mit seinem alten Namen gerufen und akzeptierte dies. Er war in diesem Namen gefangen.
Doch davon abgesehen, hatte sich alles zum Guten gewendet. Cheng kam mit seiner Stieftochter sehr viel besser zurecht als befürchtet. Weder wurde von ihm verlangt, eine tiefe Einsicht in die pubertierende Seele vorzunehmen, noch den Launen Lenas mit Verständnis und Großzügigkeit zu begegnen. Lena war viel zu elitär, als daß ihr Großzügigkeit oder eine äffische Vaterliebe etwas bedeutet hätten. Sie schätzte an Cheng seine beträchtliche Verfügbarkeit. Denn er war so vernünftig, auf das übliche Beschäftigungstheater der Unterbeschäftigten zu verzichten. Nein, wenn Lena etwas Bestimmtes benötigte, diese oder jene Hilfestellung, dann nahm Cheng sich einfach die Zeit dafür. Zeit, die ihm ja in Übermaßen zur Verfügung stand. Die meisten Väter hingegen zeigen sich zwar prinzipiell willens … nun ja, prinzipiell eben. Wie Früchte in einer Schale, die verführerisch leuchten, sich dann aber als aus Glas erweisen.
Da es so gut wie nichts gab, was Cheng nicht auch hätte später erledigen können, zog er die Dinge, um die Lena ihn bat − wenn man das bitten nennen konnte −, und die immer auf eine verspätete Weise dringend waren, einfach vor. Eine Anmeldung, eine Abmeldung, eine Besorgung, lauter harmlose Sachen. Aber auch das Harmlose muß getan werden, und im Unterschied zu Cheng wirbelte Lena durch den stressigen Alltag ihres Alters. Sie befand sich unter dem Diktat ihres Handys. Und nur ein Schalk, der auf die Idee gekommen wäre, man könnte diese Geräte richtig ausschalten. Dies wird immer bloß von Leuten behauptet, die noch nie ein Handy in der Hand hatten und also auch noch nie versucht haben, es außer Betrieb zu setzen. Es nützt ja ebenso wenig, zu warten, bis diesen Dingern der Saft ausgeht. Sie benötigen weder Essen noch Schlaf. Und daß gewisse Firmen für ihren Gebrauch Gebühren einheben … irgendwann werden die sogar die Atemluft besteuern.
Lenas Handy lag neben dem Teller, durchaus wie eine dritte Person am Tisch. Genau eine solche war es ja auch. Lenas beste Freundin.
Cheng hingegen schätzte sein eigenes Handy weit weniger und ließ es im Dunkel seiner Rocktasche versauern. Während er seine Pizza aß, las er in einem Buch. Die Bücher waren die Konkurrenten der Handys im Wettstreit um die Liebe der Menschen. Wobei die Dominanz der Taschenbücher gegenüber den gebundenen Exemplaren eine darwinistische Note bedeutete. Im Kampf um die Aufmerksamkeit der Benutzer mußte ein Buch eine ähnlich praktikable Form aufweisen wie ein Handy. Das Prinzip vom Überleben der Stärkeren bedeutete, daß die Bücher wie die Handys unentwegt versuchten, ihre Attraktivität zu steigern, also schöner, handlicher, kultiger und mittels ihrer Funktionen verführerischer zu werden.
Für Cheng, den »alten Mann«, stand fest, den Büchern den Vorzug zu geben. Auch wenn sein Handy selten Ruhe gab, immer wieder mal klingelte. Aber erstens verstand es Cheng, dieses Klingeln zu überhören, und indem sein Handy immer tiefer in die Rocktasche abrutschte, immer tiefer in der textilen Finsternis versank, immer mehr ins Überhörte abdriftete, sich immer mehr in Selbstgesprächen verlor und keinen Funken Zuneigung abbekam, verlor es an Kraft, ja man darf sagen, an Lebenskraft. Dazu kam natürlich, daß auch das Buch keine Ruhe gab, gewissermaßen mit dem Finger auf sich zeigte und mit allem protzte, was es besaß.
Es handelte sich dabei um Samuel Becketts frühen Roman Traum von mehr bis minder schönen Frauen, ein Buch, das Cheng vor allem wegen des Titels gekauft hatte. Der Titel strahlte geradezu in die Welt hinaus, verzauberte Chengs Umgebung, verzauberte diese häßliche Kneipe, verzauberte das wirkliche Leben, welches ja eher recht ungenial daherkommt, während natürlich ein von Beckett geschaffener Text, gelesen oder auch ungelesen, eine genialische Aura verströmt und gerade die häßlichen und schäbigen Dinge vergoldet. Ohne freilich auch nur ein bißchen Gold zu benötigen. Pure Alchemie.
»Ich habe nächste Woche Geburtstag«, erinnerte Lena, keinen Moment den Blick vom Display ihres Handys nehmend.
»Ich weiß«, antwortete Cheng, seinerseits in inniger Umarmung mit einem Buch, das er nicht verstand und sich gerade darum mit besonderer Zuneigung darin vertiefte.
Lena erklärte, sie wolle jetzt endlich einen Hund.
»Schatz, hör zu«, meinte Cheng, die Ernsthaftigkeit dadurch unterstreichend, daß er nun von seiner Lektüre aufsah, »wir haben für einen Hund wirklich keinen Platz in unserer Wohnung.«
»Du hattest auch mal einen Hund«, erinnerte Lena. »Genau in dieser Wohnung.«
»Das war keine Absicht damals.«
»Trotzdem.«
»Genügt dir denn dein Pferd nicht?« fragte Cheng.
»Blödsinn«, antwortete Lena. »Ein Pferd ist kein Haustier. Außerdem hab ich nur ein Drittel davon. Ich will endlich ein richtiges Haustier.«
»Mit fünfzehn ist es eigentlich zu spät dafür«, fand Cheng.
Lena schmollte.
»Es ist doch immer das gleiche«, meinte Cheng. »Zuerst wird ein Tier gekauft. Und dann will es keiner haben. Zumindest will keiner die Arbeit. Würde ich jetzt nachgeben, dann wäre es bald so, daß nicht du einen Hund hast, sondern ich. Ich will aber keinen mehr. Bräuchte ich ein Haustier, würde ich Batman zurückholen.«
»Batman?«
»Meine Katze von früher. Ein Kater, schwarz, versteht sich. Mit spitzen Ohren, klar. Er ist jetzt schon lange bei meiner ersten Frau. Ein Wunder, daß er noch lebt. Er muß uralt sein. Ein robustes Viech.«
Lena behauptete, Katzen nicht zu mögen. Dabei hatte sie selbst durchaus etwas von einer Katze. Souverän und kaltblütig und geschmeidig und eigensinnig. Nun gut, wenn Lena eine Katze war, dann war es verständlich, daß sie auf eine weitere Katze im Haushalt verzichten konnte. Sie sagte: »Ich möchte einen Labrador.« Sie sagte es in der Art, wie sie zwei Jahre später sagen würde: »Ich will den Typen mit den langen Haaren und dem Tattoo am Hals.«
Nun, diesen Typen würde sie auch bekommen. Nicht aber einen Labrador. Darüber waren sich Cheng und Ginette einig. Kein Hund. Und auch sonst kein Tier. Ein drittel Pferd mußte reichen. War auch nicht gerade billig. Aber Lena tat in den folgenden Tagen das, was man nerven nennt. Sie behauptete, daß ihre Entwicklung schaden nehmen könnte. Daß ein Haustier eine Quelle der Zuneigung sei, wie kein Mensch sie verkörpern könne. Und dann fügte sie an, als sei dies eine wissenschaftlich belegte Erkenntnis, daß Eltern, die ihren Kindern Haustiere verweigerten, dies aus purer Angst um ihre Möbel tun würden.
Doch Ginette konterte: »Hunde in einer Stadtwohnung zu halten, ist ein Verbrechen.«
»Kinder in einer Stadtwohnung zu halten, ist auch ein Verbrechen«, erwiderte Lena in dieser für ihr Alter typischen Art, einen Blödsinn zu sagen, der irgendwie stimmt. Sodann lief sie in ihr Zimmer und knallte die Türe zu.
Zweites Bild: Ein Krebs wird getauft
Als nun Cheng am nächsten Tag während eines Spaziergangs in einen heftigen Regen geriet und in eins der großen Kaufhäuser flüchtete, gelangte er im Zuge seines ziellosen Flanierens durch die Abteilungen auch in den Bereich der Spielwaren, betrachtete mit einem leicht neidvollen Gefühl die erstaunlichen Wucherungen der zeitgenössischen Legowelt und erreichte schließlich die Regale mit den Gesellschaftsspielen, zu denen neuerdings auch eine Menge Experimentiersets gehörten, nicht so sehr die im Verdacht der Explosionslastigkeit stehenden Chemiebaukästen früherer Tage, sondern eher Versuchsanordnungen im Stil derer, wie die Schweizer sie in ihrem CERN-Institut unternehmen. Teilchen jagen und dergleichen.
Dank dieser lehrreichen Anordnungen konnte man Saurierknochen ausgraben, Vulkane zum Ausbruch bringen oder Kristalle erzeugen. Anders gesagt: Mit ihnen konnte man die Natur imitieren oder Gott spielen. Ganz ohne Computer und Animation, sondern wirklich und richtig.
Mit einiger Faszination betrachtete Cheng die verschiedenen Schachteln, in die zum Teil nicht mal Kinderschuhe gepaßt hätten und in denen sich dennoch eine Welt, wenn nicht ein ganzer Kosmos, verbarg. Unter all diesen Produkten stieß ihm nun eins besonders ins Auge, ein sogenanntes Mitbring-Experiment, bei dem es sich um ein Aufzucht-Set für Salzkrebse handelte, die hier dramatischerweise als Urzeit-Krebse bezeichnet wurden. Wobei das Cover eben nicht nur die in Orange und Gelb schillernden, wie alles Plankton aus der Nähe monströs häßlichen Tierchen zeigte, sondern auch eine urzeitliche Meeresechse, die da mit spitzzahnigem Maul dahergeschwommen kam.
»Neun Euro und Sie sind dabei«, sagte der Verkäufer, der von der Seite herangetreten war und mit seinem im Lachen begriffenen, offenen Mund und den etwas dunklen und etwas schief stehenden Zähnen wie das traurige Ende einer Entwicklung anmutete, die vor langer Zeit mit eben jenen majestätischen Reptilien begonnen hatte.
Neun Euro also. Cheng überlegte, wie weit ihn die Österreichische Bundesbahn für neun Euro transportieren würde. Oder Germanwings, die ja immer so angeben mit ihren Preisen. Um sich sodann als Meister der Zuschläge zu erweisen. Nein, für neun Euro kam man nicht sehr weit. Während mit dem Inhalt dieser kleiner Schachtel … Aber Cheng fürchtete nun, daß auch hier – siehe Fütterung, siehe aufwendige Aquariumsanlagen – zuschlagartige Kosten den Kunden ereilen würden.
Der Verkäufer jedoch versicherte, daß das einzige, was Cheng noch beizutragen habe, ein wenig Meersalz und ein großzügiger Schuß Leitungswasser sei, wie natürlich auch jene Liebe zur Kreatur, die eine erfolgreiche Aufzucht bedinge.
»Meine Tochter wird das machen«, äußerte Cheng, nahm die Schachtel, ließ sie dem feierlichen Anlaß entsprechend verpacken, zahlte die neun Euro und verließ das Warenhaus mit dem Gefühl, etwas Vernünftiges getan zu haben.
»Das ist kein Labrador«, sagte Lena, weniger verärgert denn belustigt, so, als habe sie in diesem Moment die jüngst eingetretene Demenz ihres Stiefvaters erkannt.
»Schau’s dir mal genau an. Es ist hochinteressant«, warb Cheng für sein Geschenk.
Im Ton deutlicher Verachtung blies Lena einen Strom warmer Luft durch ihre wie von Eiklar glänzenden Mädchenlippen und öffnete die Schachtel ein wenig ungestüm, weshalb Cheng meinte: »Du sollst die Tiere nicht umbringen, sondern züchten.«
»Schon gut, Papa«, sagte Lena. Sie sagte nicht oft »Papa«, aber wenn sie es tat, klang es zärtlich, milde und echt. Ganz offensichtlich war es auch ohne Labrador ein guter Tag für sie – immerhin hatte sie von ihrer Mutter die ersehnte Karte für ein Konzert von Tokio Hotel geschenkt bekommen −, so daß sie sich die Mühe gab, ihrem Stiefvater (der wegen dieser Karte ziemlich verwirrt war, weil er bei »Hotel« auch wirklich an Hotel dachte) die Freude zu machen, sein Geschenk halbwegs ernst zu nehmen. Obgleich ihr das zunächst schwerfiel. Vor allem angesichts der Gebrauchsanweisung, die sich offenkundig nicht an Fünfzehnjährige richtete, sondern eher an Achtjährige, wenn schon nicht an Dreijährige, wegen der verschluckbaren Kleinteile. Zudem gab es eine kleingedruckte Stelle, die sich zu allem Überfluß an die »lieben Eltern« richtete, worin diese aufgefordert wurden, ihre Kinder bei dem Experiment zu unterstützen und darauf zu achten, daß selbige Kinder die Tiere »nicht verletzen oder töten, sondern nach Möglichkeit gut behandeln.«
Doch Lena verzichtete darauf, zu erklären, daß das Babykram sei. Im Gegenteil. Sie begann nun mit einigem Interesse die Anleitung und Information zu lesen. In der Tat schien es möglich zu sein, in dem fingerhohen, sehr schmalen, an eine Minivase erinnernden Plastikaquarium Krebse zu züchten, deren Verwandtschaft an die 100 Millionen Jahre zurückreichte. In einem Päckchen lagerten winzige Eier zusammen mit der Warnung, diese nicht einzunehmen.
Schwer vorstellbar, daß ein solcherart verschweißtes, sandartiges Zeug sich in Lebewesen verwandeln könnte. Nun, es handelte sich um winzige »Dauereier«, deren vornehmste Eigenschaft darin bestand, warten zu können. Etwa bis zu dem Moment, wo eine Wiener Familie auf die Idee kam, ein kleines Gefäß mit Leitungswasser zu füllen und dieses mit einer kräftigen Prise Meersalz zu versetzen. – Das Wiener Leitungswasser ist ja bekanntermaßen das beste auf der Welt und jeder Salzkrebs, der darin groß wird, zu beneiden. Bloß fehlte im konkreten Fall das Meersalz. Cheng hatte, obwohl er ja vom Verkäufer darauf hingewiesen worden war, vergessen, ein solches zu besorgen.
»Das kann nicht wahr sein«, beschwerte sich Lena.
»Aber wirklich«, gab Ginette ihr recht.
Cheng machte ein betroffenes Gesicht, erhob sich, zog sich an und verließ das Haus, um hinüber zum Drogeriemarkt zu gehen. Als er nun dort in der Schlange stand, die sich vor der Kassa gebildet hatte, zwei Packungen Meersalz in der Hand – ein in Wien typisches Verfahren, ein Versäumnis durch Verdoppelung ausgleichen zu wollen −, da war die Betroffenheit einem tiefen Glücksgefühl gewichen. Cheng stand in diesem Drogeriemarkt wie in einer Kirche und dachte sich: »Ich liebe das Leben.«
In einer Kirche, und sei sie auch nur ein Drogeriemarkt, läßt sich das natürlich eher denken, als etwa mitten auf einem Schlachtfeld oder eingedenk einer Ehekrise. Aber Krise war für Cheng in diesem Moment ein fernes Land.
Am gleichen Abend wurde das kleine Gefäß mit abgekochtem Wiener Leitungswasser gefüllt, darin sieben Millilitereinheiten griechischen Meersalzes verrührt und mittels eines überaus schmalen Stäbchens vier Spatelspitzen der getrockneten Salzkrebschen-Eier in das Wasser befördert. Sodann platzierte Lena das kleine Aquarium auf einem vom Tageslicht begünstigten Fensterbrett und sprach ein kleines Gebet. Das tat sie hin und wieder, obwohl auch sie lieber in den Drogeriemarkt ging als mit ihrer Mutter in die Synagoge.
Tatsächlich begann am dritten Tag nach der Instandsetzung dieses mittels einer papierenen Abdeckung vor dem bekanntermaßen gefährlichen Hausstaub abgeschirmten Beckens das Leben zu erwachen. So wie die Anleitung versprochen hatte, zuckte es im Wasser. Das waren noch keine Krebstiere, sondern Larven, die sich in derselben raschen, ja hektischen Weise bewegten, wie man das auch von menschlichen Kindern kannte, die mit hochgerecktem Hals sich durchs Wasser schaufeln, ständig den nächsten Beckenrand im Blick. Nun, ein solcher Beckenrand existierte zwar auch hier, war aber unerreichbar, so daß die Naupliuslarven sich wie in einem Zustand andauernden Untergehens und andauernder Panik durch ein Element kämpften, das nicht das ihre schien. Und auch so könnte man die nun nach und nach eintretende Metamorphose verstehen, daß sich nämlich die in einer latenten Not befindlichen Nauplien in herrschaftliche, souveräne, den Zustand fortwährenden Ertrinkens als Lebenselixier begreifende Salinenkrebse verwandelten. Wozu es aber nötig war, alle zwei Wochen sparsam nachzufüttern, durch regelmäßiges Umrühren die Zufuhr von Sauerstoff zu garantieren, nicht nur das verdunstete Wasser nachzufüllen, sondern auch den Salzgehalt stabil zu halten, ja ihn zu erhöhen, um den Einfall vom Schimmelpilzen abzuwehren und zugleich den Tierchen eine attraktive rote Färbung, eine kardinalische Note zu verleihen.
Natürlich vollzog auch das Wasser eine Metamorphose, kehrte praktisch in seinen Urzustand zurück, wechselte den Status abgekochter Klarheit mit dem einer von Algenbewuchs und damit eigener Sauerstoffgewinnung geprägten teilweisen Selbständigkeit. Ein Teich war entstanden, ein Biotop − ein Pessimist würde sagen: ein Pfuhl. In diesem Pfuhl und im Licht eines feinen grünlichen Schleiers tauschten die Tierchen nun ihre Gestalt, entwickelten eine lange Schwanzgabel, fügten dem einen Naupliusauge zwei weitere an, zudem rippenförmige Ruderbeine, ja, bildeten einen Körper heran, der sich auch wirklich zum Schwimmen eignete und mit dem sie elegant – auf eine zahnradartige Weise elegant – durch das Wasser drifteten, geradeso, als würden verschiedene Ströme dieses stehende Gewässer in verschlungene, aber feststehende Bahnen unterteilen. Ihre Schwimmbeine fungierten zusätzlich als Nahrungszuträger und Kiemen, so daß sich aus der ständigen Bewegung ein abgerundeter Haushalt ergab, welcher deutlicher als sonst das Prinzip eines jeden Lebewesens darstellte: nämlich eine Fabrik zu sein. Hier war die Fabrik durchsichtig, der Arbeitsprozeß offenkundig wie selten. Natur als Industrie. Und das wohl wesentlichste Kennzeichen der Industrie ist das Fehlen echter Pausen, echter Besinnung. Ja, so hübsch und perfekt diese Tiere anmuteten, eben auch besinnungslos. Wenngleich nicht ohne Verstand, soweit man das sagen darf. Ein Verstand ohne Seele, ein Industrieverstand, der sein Heil in der reinen Produktion sucht.
In den ersten Wochen der Aufzucht und Pflege war Lena mit einigem Engagement bei der Sache. Sie fand die Nauplien »süß«. Im Falle der adulten Krebse hingegen war ihre Bewertung eindeutig negativ. Obgleich sie ansonsten überhaupt nicht heikel war, problemlos eine Schnecke oder einen Regenwurm anfassen konnte, empfand sie angesichts der ausgewachsenen Exemplare einen Ekel, der sie davon abhielt, sich länger mit der Sache zu beschäftigen. Nicht, daß sie meinte, man sollte darauf verzichten, weiterhin in dem Gefäß herumzurühren oder mittels einer Pipette Luft zuzupumpen. Aber sie war der Ansicht, daß diese Aufgabe Cheng zukam. Er hatte diese Tiere ausgesucht, also sollte er auch ihre Pflege übernehmen. Sie sagte es ganz klar: »Ich wollte einen Labrador und habe ihn nicht bekommen. Ein Labrador hätte zu mir gepaßt. Die Krebse nicht.«
Da hatte sie schon recht. Zudem fühlte sich Cheng, der ja als »liebe Eltern« angesprochen worden war, verantwortlich für die aus der Geborgenheit ihrer Eierschalen gelockten Kreaturen. Wie es nämlich heißt, ist das Schicksal des Einzelnen immer auch das Schicksal der Welt. Und es konnte ja wohl nicht sein, daß Lebewesen, deren Stamm seit vielen Millionen Jahren existierte, im Zuge der Verwahrlosung eines in der Wiener Lerchenfelder Straße aufgestellten Neun-Euro-Mini-Aquariums zugrunde gehen sollten.
Es kam also so, wie Cheng es erwartet hatte und wie es dem üblichen Lauf der Dinge entsprach. Wobei festzustellen wäre, daß Cheng wenigstens nicht gezwungen war, zu unchristlichen Zeiten einen dank Zuchtverfahren verblödeten Labrador zur Verrichtung seiner Geschäfte nach draußen zu führen. Und ihm somit auch erspart blieb, mit jenen anderen Hundebesitzern zusammenzutreffen, die er ja noch aus der Zeit kannte, als der gute, alte Lauscher gelebt hatte. Hundebesitzer waren eine Plage. Der Kot auf den Straßen war sehr viel weniger ein Verweisschild auf die Därme der Vierbeiner als auf die Köpfe ihrer Besitzer. Nein, da war es schon sehr viel besser, ein- bis zweimal täglich etwas Luft ins Wasser zu blasen und sich ansonsten in der meditativen Betrachtung der kleinen Schwimmer zu verlieren.
»Du und deine Krebse«, meinte Lena bei Tisch, vielleicht im Angesicht der servierten Shrimps, und lächelte abfällig.
»Eigentlich sind es deine Krebse«, antwortete Cheng.
»Das sind kleine Monster«, erwiderte Lena. »Da wäre mir sogar eine Schlange lieber.«
»Schlangen töten Menschen«, stellte Cheng fest. »Manchmal.«
»Bei diesen Krebsen wäre ich mir da auch nicht sicher«, sagte Lena. »Tu bloß nicht deinen Finger rein.« Dann sprach sie über ihr Pferd. Etwas mit den Hufen. Cheng hörte bald nicht mehr hin. Das Besitzen von Pferden kam bei ihm gleich nach dem Besitzen von Hunden.
Cheng verließ die Küche und ging ins Wohnzimmer, um sich die Nachrichten anzusehen. Dies entsprach mehr einem Ritual denn Interesse. Die Abendnachrichten stellten gewissermaßen eine sehr lose Verbindung des Individuums mit den äußeren Geschehnissen dar, wobei die Politik im eigenen Lande nicht minder exotisch anmutete wie Waldbrände in Australien. Merkwürdig nahe waren nur Flugzeugabstürze und Amokläufe, denn bei aller Seltenheit, mit der sie geschahen, schien die Chance, in selbige zu geraten, um einiges wahrscheinlicher als in ein politisches Amt zu schlittern. Ein Mann wie Cheng würde niemals in die Verlegenheit kommen, als Funktionär einer Partei aufzutreten, als Passagier eines Flugzeugs hingegen, das …
Cheng schenkte sich ein Glas Wein ein, lagerte seine Beine hoch und verfolgte mit nur einem Auge und nur einem Ohr den Bericht über eine dramatische Insolvenz. Hellhörig – also beide Augen und beide Ohren einsetzend – wurde er erst in dem Moment, da von einem Verbrechen die Rede war, welches in den Vormittagsstunden dieses Tages entdeckt worden war. Die Polizei hatte einen Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden, offensichtlich das Opfer einer Art von Exekution, wobei der Nachrichtensprecher von »mehreren Projektilen« sprach, weitere diesbezügliche Details aber verschwieg. Nicht jedoch verschwieg er – und nur darum war diese Meldung es wert, in den Abendnachrichten genannt zu werden −, daß es sich bei dem Toten um einen bekannten Schauspieler handelte, der zuletzt in einem großen Wiener Theater als Professor Bernhardi brilliert hatte.
So bekannt dieser Bühnenstar auch sein mochte, Cheng war der Name in keiner Weise vertraut. Was freilich nicht viel bedeutete. So sehr Cheng eine zutiefst wienerische Seele besaß, war er am Theater und der Schauspielkunst desinteressiert. Er hielt diese Kunst für ziemlich unnötig. Da war ihm die Oper noch lieber, die ihm zwar nicht minder lächerlich erschien, aber welche das Lächerliche zum Thema hatte, das Lächerliche im Zuge pompöser Übertreibung kultivierte. Oper war immer Kasperltheater, komische Leute in komischen Kleidern in komischen Posen, die nur darum zu singen schienen, um einen obskuren Text in erträgliche Unverständlichkeit zu transferieren. So besaß die Oper aber wenigstens einen die eigene Klamottenhaftigkeit reflektierenden Zug, und auch die Opernsänger bewiesen in ihren Interviews gerne, wie wenig sie sich ernst nahmen und wie sehr alles in ihrem Leben, ob auf der Bühne oder nicht, eine Farce darstellte. Opernsänger mochten dumme Figuren in Szene setzen, sie selbst waren ganz und gar nicht dumm.
Ganz anders die Schauspieler, die sich sämtlich für den Mittelpunkt der Erde hielten und dabei der Ansicht waren, nichts weniger als die Wahrheit zu verkörpern. Die Wahrheit des Lebens, während sie in Wirklichkeit allein die Wahrheit des Schauspiels, der Schauspielerei, des Als-ob vertraten: Tränen, die keine waren, falsches Lachen, falsche Wut, falscher Mut und falsche Feigheit, vor allem falsche Liebe. Alles, was sie darboten, war im wahrsten Sinne gespielt, die reine Pose, echt bloß die Künstlichkeit, mit der sie Gefühle vorspiegelten, zu denen sie nie und nimmer im Stande waren. Wer Schauspieler wird, verliert seine Gefühle, hat möglicherweise nie welche besessen, weil er ja sonst kein Schauspieler geworden wäre.
Der wohl stärkste Ausdruck eines Schauspielers ist jener falscher Bescheidenheit, etwa Demut vor dem Stück oder dem Publikum, während der Schauspieler nichts anderes im Sinn hat, als das Publikum zu verhexen, auch wenn er es »verzaubern« nennt, aber wie gesagt, er lügt, sobald er den Mund aufmacht. Wieso Autoren Dramatiker werden und somit Schauspielern zu ihren Rollen verhelfen, ist eine gute Frage, aber Cheng konnte sie nicht beantworten. Er empfand bloß einen Ekel vor dem Theater, so wie Lena beim Anblick der ausgewachsenen Krebse. Bei Krebsen wie bei Schauspielern konnte bereits ein einziger Zentimeter dazu führen, einen Horror zu erzeugen.
Die Umstände der Ermordung, wie jetzt der Nachrichtensprecher erklärte, würden sich noch im Dunklen befinden. Eine Beziehungstat werde allerdings derzeit ausgeschlossen, da die Machart der Tötung einen professionellen Hintergrund nahelege.
Cheng grinste verächtlich. Er hatte es in seinem Leben als Detektiv des öfteren erlebt, daß gerade die Verbrechen aus Leidenschaft oder im Zuge familiärer Auseinandersetzungen mit der größten Ruhe und Sorgfalt, ja man könnte sagen, auf eine handwerkliche Weise vollzogen wurden, während umgekehrt nicht wenige der sogenannten Profis Blutbäder anrichteten, als seien sie total meschugge. Manche Profis waren wie Schauspieler, die das Leben spielten, es aber nicht beherrschten. Jedenfalls bedeutete für Cheng eine kaltblütig und sachlich anmutende Hinrichtung nicht, man könne einen Laien oder ein intimes Verhältnis zwischen Täter und Opfer ausschließen. Übersicht war so wenig ein Privileg der Profis wie Raserei eins der Privatiers. Was übrigens auch für den Bereich der Wirtschaft in beträchtlichem Maße galt.
Was soll’s? Nur, weil er einmal Detektiv gewesen war, brauchte es ihn nicht zu kümmern, was Menschen Menschen antaten. Nachrichten waren für ihn nichts anders als bewegte Gemälde im nüchternen Rahmen eines wurstscheibenartig flachen Geräts. Es gab solche und solche Gemälde, doch aus Farbe waren sie alle.
Cheng sah sich in der Folge noch ein Fußballspiel an, schaltete aber in der Halbzeit aus, nahm sein Beckettbuch und legte sich zu Ginette ins Bett.
»Ich habe es gerade im Radio gehört«, sagte Ginette. »Der Winter ist tot.«
Jahreszeitlich gesprochen war das natürlich ein wenig eine Tautologie, wenn man bedachte, daß der Winter an sich das Sterben, das Begrabensein, das Ende darstellte und Ginettes Äußerung so klang, als hätte sie von einem toten Tod gleich einem lebenden Leben gesprochen. Aber sie meinte natürlich den Schauspieler. Ja, sein Name war Erich Winter. Ginette sagte: »Ein häßliches Gesicht, aber eine schöne Stimme.«
Mein Gott, wie perfekt Ginette die Dinge auf den Punkt zu bringen verstand. Im Grunde konnte man ihre Definition auf fast alle Schauspieler, männlich wie weiblich, anwenden. Mehr Fratzen als Gesichter, aber die Stimmen hatten es wahrlich in sich, egal, was da geschwätzt wurde. Die Stimmen waren es, die das Publikum verführten. Schauspieler waren Sirenen. − Menschen, die ins Theater gingen, dachte Cheng, sollten sich eigentlich die Ohren zuhalten.
Mit einem kleinen Seufzer, als könnte man seufzend eine Wahrheit in die Luft schreiben, nahm er sein Buch, schlug es auf und benutzte es wie eine Sprungschanze, um hinunter in den Schlaf zu stürzen.
Ginette durfte wie immer ausschlafen. Sie arbeitete Teilzeit, als Sekretärin in einem Verlag, wo sie erst am frühen Nachmittag begann. Es bedeutete für Cheng durchaus ein Vergnügen, seine geliebte Frau im Bett zu belassen, wo sie bestens aufgehoben schien. Zumindest legten ihre Züge – ihr vollendetes Schlafgesicht – nahe, daß ihre Träume ohne Alp auskamen. Lena hingegen war leider nun mal Opfer einer Gesellschaft, in der das frühe Aufstehen zum guten Ton gehörte und man vor allem junge Menschen, die eigentlich mehr Schlaf nötig hatten – nicht zuletzt, weil sie an den Abenden das während Schulzeit und Nachmittagsstreß verlorene Leben nachzuholen versuchten −, daß man also gerade die zwang, den Tag so zeitig zu beginnen. Die Vermutung, daß unser Schulsystem eine bewußte und gewollte Bösartigkeit gegen junge Menschen darstellt, denen man ihre Jugend neidet, wäre zwar eine gewagte Annahme, hat aber etwas für sich.
An diesem Umstand konnte nun leider auch Cheng nichts ändern, wollte aber Lena wenigstens die Freude eines guten Frühstücks angedeihen lassen. Um selbiges genießen zu können, mußte Lena freilich noch ein wenig früher aufstehen. Was sie tat, nicht ohne Murren, nicht ohne einen mißmutigen Blick auf den sie weckenden Cheng, so, als sei er für dieses ganze Unglück verantwortlich. Doch auf das frische Croissant, das manierlich geöffnete Sechs-Minuten-Ei, das von der Rinde befreite und liebevoll gestrichene Marmeladebrot sowie die Tasse warmen Tees wollte sie nicht verzichten. Umso mehr, als Cheng, der sich um diese Zeit nur Kaffee zugestand, in keiner Weise um ein Gespräch bemüht war. Statt dessen lief Musik, Lenas Musik, Hotelmusik also. Wogegen Cheng nichts hatte, auch wenn sie ihm fremd blieb. Er war schon lange in keinem Hotel mehr gewesen. Die Dinge änderten sich, das war normal.
Nachdem er Lena verabschiedet hatte – er küßte sie auf die Stirn, als schließe er eine kleine, vom Schlaf noch offene Lücke ihrer Schädeldecke –, kehrte er ins Wohnzimmer zurück, setzte sich ans Fenster und betrachtete im Schein einer warmen, klaren Morgensonne das Treiben der Salzkrebschen. Zwischen den zuckenden Larven einer neuen Generation schwammen mit besagter Eleganz sieben erwachsene Exemplare von unterschiedlicher Länge und Beweglichkeit. Am Boden hatte sich etwas gebildet, was Cheng schlichtweg als »Müll« bezeichnete, Abgestorbenes eben, nicht zuletzt die Häute der Krebse. Denn die Häute wuchsen nicht mit, weshalb sie nach einiger Zeit abgelegt werden mußten. Gleich zu engen Kostümen. Allerdings wurden sie nicht wie bei den Westeuropäern gesammelt und sodann irgendwelchen armen Eskimos oder armen Kaukasen aufgedrängt, sondern verblieben im eigenen Land, in unmittelbarer Nähe. Auch trieben die ersten toten Krebse durch das Wasser, bevor sie ebenfalls vom Bodensatz eingefangen wurden. Ein Bodensatz, welcher eigentlich – würde Cheng die Anleitung genau gelesen haben – mit der mitgelieferten Pipette hätte abgesaugt werden müssen. Statt dessen ging Cheng davon aus, daß der »Müll« dazugehörte. Und im Grunde stimmte das ja auch.
Wenn nun die Sache auch ohne Entsorgung funktionierte, sprich die Wasserqualität des Pfuhls eine gute blieb, dann darum, weil Cheng regelmäßig Bewegung in eben diese Sache brachte, die Pipette vorsichtig ins Becken führte und damit kreisend einen moderaten Strudel erzeugte, bevor er mehrmals Luft ins Wasser pumpte. Dabei geschah es eben nicht nur, daß es die Tierchen herumwirbelte, sondern gleichfalls den Dreck, der sich über den gesamten Raum verteilte, um in der Folge wieder abzusinken und ein erneutes Konglomerat zu bilden.
Zuerst fiel es ihm nicht auf. Natürlich nicht. Auch wenn die Krebse größenmäßig ein wenig voneinander abwichen und die Weibchen mitunter Eiersäcke hinter sich herzogen, war es nicht so, daß Cheng den einen Krebs vom anderen hätte unterscheiden können. Auch führte er nicht Buch. Noch nicht. Zudem waren das hier keine Pinguine oder Albatrosse oder Delphine, die man markieren und mit Peilsendern ausstatten konnte. Wohin hätten sie auch ziehen sollen? Sie waren quasi in Wien und in der Lerchenfelder Straße gefangen. Wie allerdings auch einige Menschen.
»Täusche ich mich?« fragte sich Cheng, weil er nur sich selbst fragen konnte. Lena und ebenso Ginette schenkten den Tierchen zu wenig Aufmerksamkeit, um beurteilen zu können, ob Chengs Eindruck stimmte, daß einer der Krebse aus der stammbildenden ersten Generation sich in die zweite Generation hinübergerettet hatte, somit noch lebte, als seine ursprünglichen Zeitgenossen längst verstorben waren. Es war jedenfalls bereits Sommer und das von frühlingshafter Überwässerung kranke Wien im Zustand einer heilenden Diät, als Cheng sich nach und nach dessen gewiß wurde, daß einer der Krebse mit einer erstaunlichen Robustheit ausgestattet war.
Ende der Leseprobe