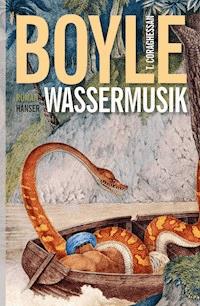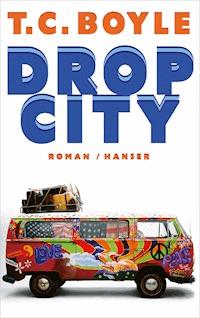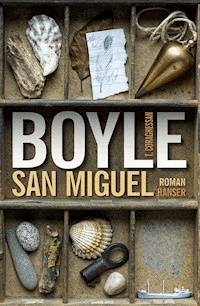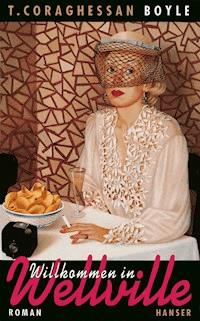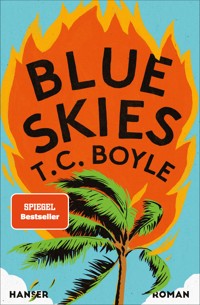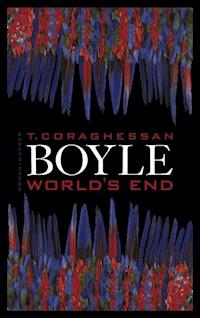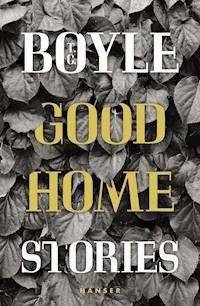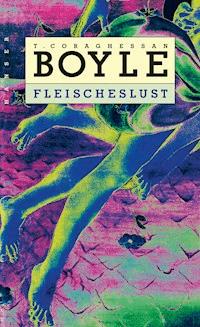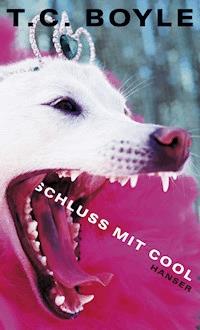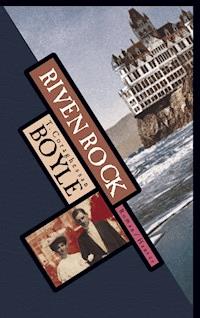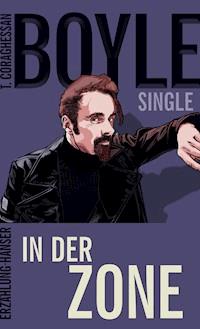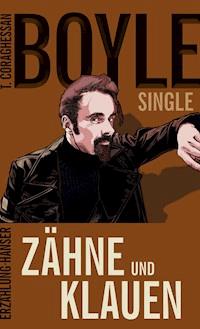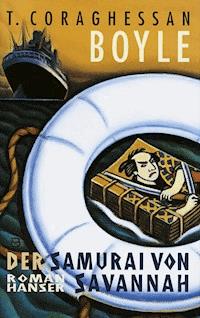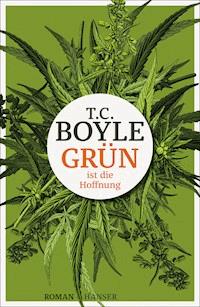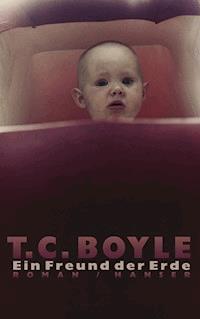
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 2025: Der Treibhauseffekt hat voll zugeschlagen, im Loiretal wird nicht mehr Wein, sondern Reis angebaut, die meisten Säugetiere sind ausgestorben und das Essen ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Ty Tierwater, militanter Umweltschützer, verbrachte mehr Zeit im Knast als in der freien Natur. Da taucht eines Tages seine zweite Frau Andrea mit einem ganz besonderen Anliegen auf...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
4,6 (34 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Hanser eBook
T. Coraghessan Boyle
Ein Freund der Erde
Roman
Aus dem Amerikanischen von Werner Richter
Carl Hanser Verlag
Die amerikanische Originalausgabe erschien
erstmals 2000 unter dem Titel A Friend of the Earth
bei Viking Penguin in New York.
Danksagung
Der Autor bedankt sich bei Marie Alex,
Russell Timothy Miller und Richard Goldman für Rat und Hilfe.
ISBN 978-3-446-23967-8
© T. Coraghessan Boyle 2000
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München Wien 2012
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Datenkonvertierung eBook: Beltz Bad Langensalza
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
www.tc-boyle.de
INHALT
Teil 1
Bring sie lebend zurück!
Teil 2
Unser wichtigstes Produkt heißt Fortschritt
Teil 3
Wildnis Amerika
Für Alan Arkawy
Ein jeder Geist baut sich ein Haus und hinter seinem Haus eine Welt und hinter seiner Welt einen Himmel. Wisse also, daß die Welt für dich existiert.
Ralph Waldo Emerson, Natur
The earth died screaming While I lay dreaming
Tom Waits, The Earth Died Screaming
PROLOG
Santa Ynez, November 2025
Ich verfüttere gerade Kraftkekse und Hühnerrücken an die Hyäne und tue mein Bestes, um nach dem letzten Unwetter einigermaßen aufzuräumen, als das Telefon klingelt. Es meldet sich Andrea. Meine Exfrau Andrea Knowles Cotton Tierwater, meine Ehegattin von vor tausend Jahren, als ich noch jung und kraftvoll und gnadenlos männlich war – die Frau, die sich damals, als wir noch glaubten, so etwas hätte einen Sinn, regelmäßig an Kräne, Bulldozer und siebenhunderttausend Dollar teure Holzharvestermaschinen ketten ließ, die Frau, die mir half, meine Tochter großzuziehen, die Frau, die mich in den Wahnsinn trieb. Verdammt noch mal. Wenn schon jemand von damals wiederauftaucht, wieso dann nicht Teo? Bei dem wäre es leichter – ihn könnte ich einfach umbringen. Peng. Dann hätte Lily auch gleich was anderes als Hühnerfleisch zum Abendessen.
Auf jeden Fall sind hier überall Bäume umgestürzt, und der Schlamm zerrt an meinen Gummistiefeln wie ein gierig saugendes Maul, das mich irgendwann bestimmt in den Abgrund reißen wird, aber einstweilen noch nicht. Mag sein, daß ich fünfundsiebzig bin und meine Schultern sich anfühlen, als wären sie mit Angelhaken an den Gelenken befestigt, aber die neue Niere, die sie mir eingesetzt haben, verrichtet ihre Klärfunktion ganz hervorragend, danke der Nachfrage, und ich kann immer noch besser arbeiten als die meisten der verzärtelten Halbidioten hier. Außerdem kann ich Dinge, die nicht jeder kann – ich bin ein Tierexperte, von denen sind heutzutage nicht mehr viele übrig, und Maclovio Pulchris, mein Chef, weiß das zu schätzen. Übrigens will ich hier nicht unnötig mit Namen um mich werfen, keineswegs – ich nenne nur die Fakten. Mir untersteht seine Privatmenagerie, die letzte dieser Art in unserem Teil der Welt, und es ist ein wichtiges – ich korrigiere: ein essentielles – Reservoir für das Zoocloning und die Verteilung dessen, was von den bekannten Säugetierarten noch geblieben ist. Und man kann sagen, was man will, über Popstars im allgemeinen oder die Qualität von Macs Musik im speziellen oder sogar darüber, wie es aussieht, wenn er seinen Hut und die Sonnenbrille abnimmt und man sehen kann, mit was für einer lächerlichen kleinen Quetschkartoffel von Kopf er gesegnet ist, aber eines sag ich euch: er ist ein echter Tierfreund.
Allerdings wird von seiner Menagerie nicht allzuviel übrigbleiben, wenn dieses Wetter nicht nachläßt. Es ist nicht mal Regenzeit – oder was wir früher die Regenzeit genannt haben, als verstünden wir irgendwas davon –, trotzdem reihen sich über dem Pazifik die Gewitter wie Billardkugeln auf einem Pooltisch, und nirgends eine Tasche zum Einlochen. Vor zwei Tagen blies nachts ein starker Wind, der von einem der hinteren Gehege das Dach abriß und wie ein Riesenfrisbee in die Apartmentsiedlung Lupine Hill gegenüber krachen ließ. Mac war das eher egal – niemand ist heute noch gegen Wetterschäden versichert, Klagen vor Gericht werden automatisch abgewiesen, also was soll’s –, aber das Bittere daran war, daß der Patagonische Fuchs ausbüxen konnte, vermutlich das letzte in Freiheit geborene Exemplar seiner Art auf diesem abgewrackten Planeten, und bis jetzt haben wir das Vieh noch nicht wiedergefunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Keine Spuren, gar nichts. Die Füchsin ist einfach weg, als hätte der Sturm sie mitgerissen wie Dorothy Gale und in irgendeinem Zauberland abgesetzt, wo die ausgestorbenen Fleischfresser aller Epochen zwischen Massen von gefesseltem Wildbret wahre Orgien feiern – oder aber mitten auf einer Schnellstraße, wo das Tier für den Durchschnittsfahrer wohl nichts als ein Hund auf Stelzen wäre. Und die Pangoline sind auch alle weg. Dabei gibt’s weltweit nicht mal mehr fünfzig dieser Schuppentiere. Es ist eine Schande, aber was soll man machen – den Suchdienst anrufen? Es hat uns alle hart getroffen. Überschwemmungen, Sturm, Donner und Blitz, sogar Hagel. Eine Menge Leute haben kein Dach mehr überm Kopf, und zwar hier bei uns in Santa Barbara County, nicht nur in Los Andiegoles oder San José Francisco.
Jetzt aber Lily. Sie betrachtet mich lange aus ihren eidottergelben Augen, und ich bin froh, daß ich angesichts der Fleischsituation in letzter Zeit wenigstens Hühnerrücken habe, als das Bildtelefon läutet (man denke hier an Dick Tracy, denn inzwischen ist die ganze Welt ein Comic strip). Der Himmel ist schwarz – nicht grau, schwarz –, dabei kann es kaum drei Uhr nachmittags sein. Alles ist still, und ich rieche ihn wie eine sich ballende Wolke: den Tod, den Tod von allem, hoffnungslos und stinkend und kaputt, die Farben haben kein Pigment mehr und die Gebäude keine Farbe, Autos liegen verlassen neben der Fahrbahn, und schon fängt es wieder an zu regnen. Ich spreche zu meinem Handgelenk (ohne Bild allerdings – der Bildknopf ist fest und für immer auf OFF geschaltet: weshalb sollte ich diese Ruine von einem Gesicht irgendwem zeigen wollen?). »Ja?« rufe ich, und der Regen wird jetzt heftiger, vom Wind gepeitscht, schlägt mir ins Gesicht wie ein nasses Handtuch.
»Ty?«
Die Stimme klingt rissig und zerfurcht, wie die Erde hier, wenn die Unwetter nach Nevada und Arizona weiterziehen und die Sonne zurückkehrt, um mit ihrer vollen ungefilterten melanomischen Macht auf uns niederzuknallen, aber ich erkenne sie sofort, auch nach zwanzig Jahren. Es ist eine Stimme, die mich körperlich berührt, mich aus dem Nichts heraus anspringt und an der Gurgel packt wie ein Wesen, das vom Blut anderer Wesen lebt. »Andrea? Andrea Cotton?« Kurze Pause. »Gütiger Gott, du bist es, oder?«
Leise und verführerisch, während der Wind auffrischt und Lily mich hinter dem Maschendrahtzaun fixiert, als wäre ich der Hauptgang, fragt sie: »Kein Bild für mich?«
»Was willst du, Andrea?«
»Ich möchte dich sehen.«
»Tut mir leid, mich kriegt keiner zu sehen.«
»Ich meine persönlich, von Angesicht zu Angesicht. So wie früher.«
Der Regen rinnt von meinem Hut herunter. Einer der inzüchtigen Löwen fängt an, sich seine armselige Lunge rauszuhusten, ein rasselndes, eigenartig mechanisches Geräusch, das über die mit Unkraut bewachsene Wiese schallt und an der monolithischen Fassade der Apartmenthäuser als Echo abprallt. Ich bemühe mich, einen ganzen Schwall von Gefühlen zu unterdrücken, aber sie tauchen dauernd wieder auf, durchstoßen die Oberfläche, drohen sich loszureißen und ein für allemal aus dem Ruder zu laufen. »Wozu?«
»Was glaubst du wohl?«
»Ich weiß nicht – um meine Kontokarten zu überziehen? Mir ins Hirn zu scheißen? Die Erde zu retten?«
Lily rekelt sich und gähnt, zeigt mir ihre langen gelben Fangzähne und die großen, malmenden Molaren weiter hinten im Maul. Eigentlich sollte sie draußen auf der Steppe sein und Giraffenknochen knacken, das Mark aus den Wirbelkörpern saugen, Hufe zernagen. Nur daß es keine Steppe gibt, nicht mehr jedenfalls, und Giraffen auch nicht. In meinem Hirn hat sich etwas losgerissen und schreit: ES IST ANDREA! Und sie ist es. Andreas Stimme meldet sich wieder. »Nein, du Narr«, sagt sie. »Aus Liebe.«
Ja, ich bin ein Narr, ein Narr der tausend Kostüme und bunten Hüte, und zum Beweis dafür willige ich in ein Treffen mit ihr ein, ohne viel Gegenwehr und nach nur höchst kümmerlichem Vorspiel, denn die vertraute Stimme wütet in meinem Kopf wie eine Faust, die einen abgenagten Knochen hält. Wann genau haben wir uns zum letztenmal gesehen? Entweder 2002 oder 03. Wir gingen damals gemeinsam klettern, wir tanzten, bis die Musik uns taub werden ließ, und wir vögelten, bis die Vögel erwachten und sangen und an Altersschwäche starben. Einmal brachten wir dreißig Tage nackt in der Sierra Nevada zu, und wenn das auch nicht gerade so wie in Die blaue Lagune ablief, war es doch eine Erfahrung, die man nie vergißt. Und, na ja, meine edelsten Teile sind durchaus noch in Ordnung, Viagra Supra hab ich nicht nötig und auch keine Penisimplantate, besten Dank, und ich frage mich, wie sie nach so langer Zeit wohl aussieht. Sie ist acht Jahre jünger als ich, und falls die Regeln der Mathematik nicht ebenso zusammengebrochen sind wie alles andere, dann müßte sie jetzt siebenundsechzig sein, was aus meiner Perspektive ein höchst interessantes Alter für eine Frau ist. Also klar, ich werde mich mit ihr treffen.
Aber nicht hier. So ein großer Narr bin ich auch wieder nicht. Ich vereinbare für heute abend sechs Uhr ein Stelldichein in Swensons Wels-und-Sushi-Restaurant in Solvang, trotz des strömenden Regens und der ausgewaschenen Straßen, denn ich hab den Geländewagen von Mac, und was sie hat oder wie sie hinkommt, ist nicht mein Problem. Jedenfalls noch nicht.
Aber sie wird dasein, darauf wette ich. Sie will irgendwas – Geld, ein Bett zum Übernachten, Kleider, eine gute Flasche Wein, meine letzte Dose mit Alaska-Königskrabben (inzwischen ausgestorben, so wie alles andere, was im Meer schwimmt oder krabbelt, außer vielleicht Zebramuscheln) –, und sie kriegt immer, was sie will. Ich versuche, sie mir vorzustellen, wie sie damals war, Mitte Vierzig, und ich sehe als erstes ihre Augen – Augen, die einen packen und nicht wieder loslassen, heiß und hart und versengend wie zwei Fackeln. Und ihre Brüste. An die erinnere ich mich auch. Ich glaube, sie ist nie im Leben aus dem Haus gegangen, wenn sie nicht etwas anhatte, das an ihr klebte wie frischer Lack. Bis auf diesen Monat in der Sierra Nevada; da trug sie nichts als eine Schicht Dreck und Mückenstiche.
Andrea. Ja, sicher, es wird Laune machen, sie wiederzusehen, auch wenn gar nichts passiert – und wie gesagt, ich bin noch nicht jenseits von Gut und Böse, was Sex angeht, noch nicht, und obwohl ich mich nicht mal ansatzweise sexuell betätigt habe, seit Lori gestorben ist, bei der Mucosaepidemie vor drei Jahren hier, denke ich dauernd daran. Ich sehe mir die Frauen an, die Macs Leibwächter anschleppen, und male mir aus, wie sie unter den Regenmänteln gebaut sein müssen, ich betrachte die langbeinigen Dinger in ihren Khakikleidern, die ihre Einkaufswagen durch die verlassenen Supermarktgänge schieben, wenn ich den Geländewagen nehme, um Trockenfutter zu holen und was sie gerade so an halbverfaulter Pflanzenkost dahaben, für den Brillenbären und die Nabelschweine. Sex. Eine feine Sache. Auch wenn ich es vermutlich kaum öfter als etwa einmal im Monat aushalten könnte, und selbst dann nur, wenn das ganze gefühlsduselige Drumherum – all das Händewringen und Naseputzen, die Betrügereien und Schreiduelle und die animalische Intimität, die um keinen Deut höher auf der Gefühlsskala steht als das Lecken, Schlecken und Sabbern der Hyänen – aus dem Vorgang strikt ausgeblendet bleibt.
Liebe, hat sie gesagt. Aus Liebe. Und wider Willen, trotz allem, was ich erfahren und erlitten hatte, trotz der Narben ihrer Krallen auf meinem Rücken, fühle ich mich jenen fatalen Moment lang schwach werden, und da weiß ich, daß sie mich erwischt hat.
Ich starre in Lilys Gehege, der gesamte Regen des Universums tropft mir von der Krempe dieses albernen gelben Hutes und meiner übergroßen, demütigend langen Altmännernase, als ein Ruf vom Wind über den Hof getragen wird. Es ist Chuy, beleuchtet von einem phantastischen Blitzschnörkel, der mich zurückwirft in meine Tage der Batikhemden, von LSD auf Löschblatt, von Stroboskoplichtern in Tanzschuppen und Jane, meiner ersten Frau und ersten Liebe, aber Chuy ist nicht Jane, er ist Chuy, der keinen Nachnamen hat, weil er sich nicht mehr darauf besinnen kann seit dem Unfall beim Unkrautsprühen, der ihm sein Haar, seine Männlichkeit und das halbe Hirn geraubt hat und ihn ständig herumzappeln läßt wie eine Kakerlake auf dem Insektengrill. Er schleppt irgendwas hinter sich her, einen eingerollten nassen Teppich oder alte Zeitungen, der Regen verdeckt ihn in breiten grauen Bahnen, die an die ausgeschütteten Wassereimer in den alten Stummfilmkomödien erinnern – frühe Spezialeffekte also.
»Ist ein Hund«, sagt Chuy keuchend durch den Ozean der Luft, und es stimmt, genau das ist es, ein Hund. Zwei, drei Tage lang tot, der Bauch schon ein bißchen aufgetrieben, eine Collie-Schäfer-Mischung, hab ihn noch nie gesehen, wenigstens ist es nicht der Patagonische Fuchs, das hätte gerade noch gefehlt. »Hab ihn tot im Gebüsch gefunden, Mr. Ty, und ich denke mir, ist vielleicht was para Lily zum Fressen, nein?«
Ich, nachdenklich, alt, knochig und regengepeitscht: »Vergiftet? Denn wenn er...«
Chuy linst zu mir hinauf, mein ganz privates Aufbauprojekt, sein Blick ist leicht bekloppt, er hat weder den Unterkiefer noch die Zunge unter Kontrolle, jeder Nerv gebraten und noch immer brutzelnd. »Nicht vergiftet, Mr. Ty, ist überfahren worden«, und er hebt das Hinterteil des Viehs, zeigt mir die zermanschten Beine und das gebrochene Rückgrat.
Gut so, das kommt gerade recht, ein richtiger Bonus, und während wir gemeinsam den klatschnassen Kadaver auf Schulterhöhe heben und dann über den Drahtzaun wuchten, hinter dem sich Lily, neugierig geworden, aus dem Schlamm hochrappelt, muß ich schon wieder an Andrea denken und daran, welches Hemd ich anziehen und ob ich mir ein Jackett antun soll. Ich stelle mir uns beide an der Bar von Swensons Kneipe vor, ihr unbezwingbarer Blick und die vollkommenen Brüste, sie hat sich nicht verändert, denn Veränderung ist undenkbar, Andrea mit dreiundvierzig, einfach umwerfend, eine Wucht, schau mir in die Augen, Kleiner, und dann schnappt sich Lily den Hund, und alles, was ich noch höre, ist das Krachen der Knochen.
Die Löwen haben ihr Pferdefleisch gekriegt, und die Großen Ameisenbären (Myrmecophaga tridactyla) bearbeiten ein paar halbverrottete Balken voller Formosa-Termiten, vermutlich ein ordentliches Mittagsmahl, da verfalle ich endlich auf die kluge Idee, zurück ins Trockene zu gehen. Inzwischen – es muß so vier, halb fünf sein – hat der Regen ein wenig nachgelassen, und auch der Wind, der in letzter Zeit ständig mit den maximalen zehn Beaufort zu blasen scheint, ist wohl etwas abgeflaut. Etwa auf – wie würde man das bezeichnen – Hutwegblasstärke? Volles Programm, starker Tobak, dabei fing der Schlamassel erst an. Böig. Stürmisch. Nicht ganz Orkanstärke. Er zerrt an der Kapuze meines Regenmantels, klatscht mir das nasse Vinyl ins Gesicht, ein Satz warme Ohren, und meine Brille rutscht mir den Nasenrücken rauf und runter, als wäre sie eingefettet. Es herrscht totales Chaos, kein Zweifel, jeder Schritt eine Tretmine, die Büsche sind zerfetzt wie alte Segel, die Bäume mittendurch und dann noch einmal gebrochen. Aber was geht’s mich an? Das überlasse ich Macs Gärtnern und dem masochistischen Schnösel von Landschaftsgestalter, der unverdrossen immer wieder auftaucht, sobald der Regen nur eine Stunde lang nachläßt – aber so wie die Humusschicht mit dem frisch gesäten Gras davongespült wird, ist mir völlig klar, daß wir während der Trockenzeit mitten in einer Wüste leben werden. Falls sie jemals kommt.
Als Teil meiner Abmachung mit Mac bewohne ich ein Zwei-Zimmer-Gästehaus am äußersten Rand seines Grundstücks, direkt an der Mauer von Rancho Seco, der eingezäunten Nobelsiedlung östlich von uns. Das Haus wurde in den Neunzigern mit allem modernen Komfort erbaut, und es ist eigentlich recht gemütlich, außer daß der Wind vor langem schon die Regenrinnen und drei Viertel der Schindeln heruntergerissen hat und daß der Kamin zugemauert ist, Gesetz des Staates Kalifornien. Immerhin hab ich einen Heizlüfter, und so wird es nie wirklich kalt hier, nicht so wie früher – jedenfalls niemals unter fünfzehn Grad –, und ich bin der Feldmarschall einer Armee von Kochtöpfen und Lackdosen, die mit mindestens fünfzig Prozent Wahrscheinlichkeit fünfzig Prozent des Regens einfangen. Und wieso bibbere ich dann trotzdem wie ein Cholerakranker, als ich endlich den Regenmantel abstreife, aus den Stiefeln steige und ein Handtuch um den Kopf schlinge? Weil ich fünfundsiebzig bin, deswegen. Weil Nässe bei fünfzehn Grad in meinem Alter ungefähr dem Gefrierpunkt von Wasser entspricht, als ich neununddreißig war, dem Jahr, in dem ich Andrea kennenlernte.
Überall riecht es nach Schimmel – logisch – und nach Ratten. Die Ratten – eine sogenannte r-Selektion im Überlebenskampf: große Würfe, hochgradig mobil, für praktisch jede Umweltbedingung geeignet – gedeihen prima und vermehren sich, als gäb’s kein Morgen (aber natürlich gibt’s eins, wie sich jeder, der heute lebt, nur allzusehr und allzu schmerzhaft bewußt ist, und dieses Morgen kommt auch für die Ratten). Sie verbreiten einen unterschwelligen, verstohlenen Geruch: wie alte zusammengeknüllte Sportsocken am Boden des Umkleideraums in der Schule, Rohre, die längst einmal gereinigt gehörten, auf dem Teller eingetrocknete Sauce Bolognese, die erst mit etwas Wasser wieder flüssig wird. Es ist ein stiller Gestank, kein Vergleich mit der Hyäne, wenn sie naß geworden ist, was ja jetzt dauernd der Fall ist, undich vergebe den Ratten dafür. Schließlich bin ich ein Umweltschützer – oder war es jedenfalls, hat wohl wenig Sinn, diesen Begriff heute noch zu verwenden – und glaube an leben und leben lassen, die Tiefenökologie und Adat und Keine Kompromisse zur Verteidigung von Mutter Erde.
Andrea. O ja, Andrea. Sie hat mich geschmort in diesem Schmelztiegel, mit ihren glühenden Augen und dieser Stimme wie heiße Asche, und mit ihrem Körper, ihrem wunderschönen, festen Körper einer Rucksackreisenden, den stämmigen Beinen, den fraulichen Hüften und allem anderen. Sie ist jetzt auf dem Weg zu Swensons Kneipe, um mich wiederzusehen. Vielleicht ist sie auch bereits dort, das Gläschen Sake wie ein Fingerhut in ihren großen Frauenhänden, lehnt sie sich an der Theke nach vorn, um herzuzeigen, was sie noch hat, und Shigetoshi Swenson die Sprache zu verschlagen, dem Barkeeper, der höchstens vierundsechzig oder fünfundsechzig sein kann. Der Gedanke an dieses Bild bringt mich in die Gänge, das war schon immer so, und im nächsten Moment bin ich im Schlafzimmer und reiße einen Pullover aus der Schreibtischschublade (einen schwarzen Rolli, um die Truthahnlappen unter meinem Kinn zu verbergen), denke mir, keine Zeit zum Duschen, bin auch so naß genug. Von einem Haken im Schrank greife ich mir eine halbwegs saubere Jeans, schlüpfe in meine Cowboystiefel aus Kunstleder und stürze dann zur Tür hinaus – aber nicht ehe ich das Ensemble mit der Krönung komplettiere: der roten Baskenmütze, die sie mir geschickt hat, als ich zum zweitenmal ins Gefängnis mußte. Ich ziehe sie tief in die Stirn, wie die Strickmütze des Öko-Terroristen. Um der alten Zeiten willen.
Unwetter oder nicht, draußen sind jede Menge Leute unterwegs: Pendler, Einkäufer, Reparaturteams, Teenager, die darauf abfahren, daß die Welt zu Scheiße wird, und ich muß achtgeben auf den Wind, der den Wagen beutelt, auf die Schlaglöcher und Bodenwellen und die ausgewaschenen Stellen. Vor fünfundzwanzig Jahren war das hier Wildnis, wo man Luchse, Maultierhirsche, Kaninchen, Wachteln und Füchse finden konnte, bevor alles niedergemetzelt und weggewildert wurde. Ich erinnere mich noch an Pferderanches, endlose Weideflächen in den Hügeln, riesige Grundstücke wie das vonMac, sogar hie und da eine Emu-Farm (Magerer als Rindfleisch und nur halb soviel Kalorien, probieren Sie noch heute einen Emu-Burger!). Inzwischen sind dort Apartmentsiedlungen. Graue, feuchte Hochhäusercañons. Und wer lebt in diesen Apartments? Verbrecher. Fleischfresser. Hautkrebspatienten. Leute, die über Tiere – oder über die Natur oder die Welt, wie sie früher war – nicht mehr wissen, als ihre Computer sie wissen lassen.
Na schön. Machen wir es kurz. Wir schreiben das Jahr 2025, ich heiße Tyrone O’Shaughnessy Tierwater, ich bin fünfundsiebzig und halb irisch-katholisch, halb Jude. Geboren wurde ich in dem wohlhabendsten Vorort der größten Stadt der Welt, zu einer Zeit, als es noch keine Versorgungsengpässe gab, jedenfalls nicht in diesem Land, keine Unwetter (außer den normalen), keinen sauren Regen und genügend Wildnis und dichten Urwald, wo man tief durchatmen konnte. Momentan bin ich auf dem Weg zu meiner Exfrau Andrea, um mit ihr eine Portion Wels-Sushi aus dem Zuchtteich zu probieren, ein paar zu heben und vielleicht sogar mit ihr ins Bett zu hüpfen, um der guten alten Zeiten willen. Oder aus Liebe. So hatte sie es doch ausgedrückt? Aus Liebe? Die Scheibenwischer bewegen sich im Takt zu meinem arrhythmisch schlagenden Herzen, dem Wind platzen bald die Backen, und der fette Olfputt-Geländewagen stampft wie ein Schiff auf hoher See – und in meinem Kopf habe ich, festgeklebt wie ein Kaugummi an der Schuhsohle, den Fetzen eines Schlagers von vor so langer Zeit, daß ich gar nicht mehr weiß, wie er hieß oder wo ich ihn aufgeschnappt habe. Down the alley the ice wagon flew... Arlene took me by the hand and said, Won’t you be my man?
Dieser Ausflug könnte interessant werden.
Der Parkplatz ist überschwemmt, das sanft schwappende, kackbraune Wasser steht gut einen halben Meter hoch, und das war’s wohl für meine Cowboystiefel – die ich nur aus Eitelkeit angezogen hab, dabei hätten es die Gummitreter ebensogut getan. Ich sitze eine Minute lang da und verfluche meine Blödheit, während die trüben mickrigen Lämpchen von Swensons Kneipe durch den Schleier der regenschlierigen Windschutzscheibe locken. Der benachbarte mexikanisch-chinesische Imbiß ist dauerhaft mit Sandsäcken gesichert und duster wie eine Höhle, dafür stehen die Computerwerkstatt und der Supermarkt gleich daneben in luftiger, trockener Höhe auf drei Meter langen Stützpfählen, die aus dem gebrochenen Hafendamm von Gaviota stammen. Der Regen prasselt jetzt stärker herab – logisch – und spielt Schlagzeug auf dem Dach des Geländewagens, der Wind rüttelt kontrapunktisch an der Fahrerkabine und packt alles, was nicht niet- und nagelfest ist, um es an ein geheimes Ziel zu tragen, zum Friedhof der fortgewehten Sachen. Hier oben in den Hügeln, wo sich die Unwetter gerne festsetzen, nachdem sie vom Meer heraufgerast sind, ist jedes Dach mit Stahltrossen gesichert, und in die Firma, die das anbietet, sollte man sein Geld stecken – »Bombenfest, der Fachmann fürs Dach«, mit Langzeitgarantie. Natürlich ist alles, was ich je zum Investieren besaß, jeder Penny, den ich mal verdient habe, und alles, was mir mein Vater hinterlassen hat, an Andrea und Teo und meine glutäugigen Kumpane von Earth Forever! gegangen. (Nie davon gehört? So eine radikale Umweltgruppe in den Achtzigern und Neunzigern. Bekannt für das Spicken von Bäumen mit Stahlnägeln. Öko-Sabotage. Earth Forever! Fällt der Groschen?)
Sie dauert lange, diese Minute; ich kaue die Dinge durch und zögere das Unvermeidliche hinaus, wie es alte Leute eben tun (dabei bin ich so alt auch nicht, bei all dem medizinischen Fortschritt, der über uns hereingebrochen ist – persönlicher DNA-Code, Telomerasebehandlungen und Epidermisauffrischungen, die ich dank der Großzügigkeit von Maclovio Pulchris reichlich genutzt habe), und dann denke ich mir: Zum Teufel mit der Würde, ziehe die Stiefel aus, stopfe die Socken tief in die Spitzen hinein und rolle die Hose an meinen dürren Beinen hoch. Bis zu den Schienbeinen tauche ich ein in das badewannenwarme Wasser, klemme mir die Stiefel unter den Regenmantel, ziehe die Baskenmütze gegen den Wind in die Stirn, und los geht’s über den Parkplatz. Fast macht es sogar Spaß, das Planschen, soviel Wasser dort, wo es nicht hingehört, und es erinnert mich an ein Erlebnis vor fünfundsechzig Jahren, den Hurrikan Donna und einen schulfreien Tag in Peterskill, New York, auch so eine Riesenplanscherei. (Früher dachten die Leute ja, der Zusammenbruch der Biosphäre wäre das Ende von allem, aber weit gefehlt! Genau das Gegenteil ist der Fall – es gibt einfach von allem noch mehr: mehr Sonne, Wasser, Wind, Staub und Schlamm.)
Ich stehe unter der Behelfsmarkise (dickes Stahlblech, aufgeschweißt auf Stahlpfeilern, die mit Betonsockeln im Boden verankert sind) und versuche gerade auf dem einen bloßen Fuß zu stehen, während ich dem anderen Socke und Stiefel überstreife, da fliegt die Tür auf und zwei Betrunkene, so rot im Gesicht und auf den blasigen nackten Armen, als wären sie in einem Tandoori-Ofen gebacken, torkeln heraus und glotzen in den Regen. »Mist«, sagt der zu meiner Rechten, und ich spähe an ihm vorbei in die Kneipe hinein, um zu sehen, ob Andrea schon da ist, »da können wir ebensogut noch einen trinken.« Sein Begleiter blinzelt die Sintflut an, als hätte er noch niemals Wasser gesehen – und vielleicht ist es so, vielleicht stammt er aus Brasilien oder Neuseeland oder einem der anderen Wüstenstaaten –, dann sagt er: »Geht nicht. Muß nach Hause zu« (man setze einen Vornamen ein) »und den Kindern und dem Hund und den Ratten auf dem Dachboden... aber scheiß auf dieses Wetter, echt zur Hölle damit!«
Ich atme tief durch, mogle mich an ihnen vorbei und betrete das Restaurant. An dieser Stelle sollte ich wohl sagen, daß Swensons Kneipe nicht gerade der eleganteste Laden ist – Eleganz ist nur was für die Reichen: Computerreparaturtypen, Filmheinis, Popstars wie Mac –, aber sie hat ihre Reize. Der Eingang gehört allerdings nicht dazu. Gleich rechts ist ein leeres Aquarium in einem Zementblock eingemauert, links befinden sich Garderobenhaken und ein Schirmständer. Musik dringt auf einen ein – Oldies, die ehrwürdig ergrauten, unentrinnbaren Hits der Sechziger, mörderisch aufgedreht für taube und zahnlose Zeitgenossen wie mich –, dazu ein Gemisch von Körperdüften und eine Feuchtigkeit, wie man sie eher im schwarzen Loch von Kalkutta erwarten würde. Keine Klimaanlage natürlich, bei den Stromsperren und dem schlicht astronomischen Preis pro Kilowattstunde. Geradeaus liegt die Bar, links ist der Speisesaal, getäfelt mit nicht zueinander passenden Kiefernbrettern, die aus den klassischen kalifornischen Ranchhäusern zusammengesammelt wurden, bevor die sich dem historischen Imperativ der Minieinkaufszentren und Apartmenthäuser ergaben. Ich gehe geradeaus, an der Bar herrscht Hochbetrieb, Shiggy sieht kurz von seinem Mixbecher auf und nickt mir zu, aus den gepeinigten Lautsprechern quillt irgendein antiquierter Quatsch von wegen man solle sein Pony reiten.
Keine Andrea. Ride your pony, ride your pony. Mein Ellenbogen findet die Theke, der billige Sake (schmeckt nach Maschinenöl, die Destille ist im Ort) findet mich, und ich schaue mich noch einmal um. Ich nehme sogar die Brille runter und wische sie am Ärmel ab, eine Geste, die mir so vertraut wie das Atmen ist. Setze sie wieder auf. Mustere die Gesichter jetzt ganz genau, tilge Falten, Alters- und Leberflecken, zieheMünder und Augen aus ihren Furchen hervor, glätte hier eine Stirn, lifte dort ein Kinn, und immer noch keine Andrea. (Swensons Publikum, falls sich der Leser wundert, rekrutiert sich ausschließlich aus den Jungalten, dem am schnellsten wachsenden Segment der US-Bevölkerung, von denen ich – in Anbetracht der Alternative – ein widerwilliger, aber doch dankbarer Teil bin.)
Am Ende der Theke fängt eine Frau in Rot meinen Blick auf – das heißt, ich fange ihren auf –, und mein Blut rast wie das eines Teenagers, bis mir klar wird, daß sie keine fünfzig sein kann. Ich sehe noch einmal hin, als sie sich wegdreht und einen Lacher als Reaktion auf irgend etwas ausstößt, das der pensionierte Zahnarzt neben ihr gerade sagt, und ich sehe, daß alles daneben ist: Andrea, und hier ist mir völlig egal, wie alt sie jetzt sein mag – sechzig, fünfundachtzig, hundertzehn –, besitzt das Doppelte an Ausstrahlung. Das Zehnfache. Ja, sicher. Es ist nicht Andrea. Nicht mal entfernt. Aber ist es deshalb weniger deprimierend, mir einzugestehen, daß ich hier im Grunde auf wehen Knien herumstehe, in einem schicken Hemd und mit einer klatschnassen Baskenmütze, die auf meinem kahlen Kopf wie ein Chili-Käse-Omelette aussieht, und auf ein Phantom warte? Noch dazu auf ein blutsaugendes Phantom?
Ride your pony, ride your pony. Was hat Yeats über das Alter gesagt? Nicht, daß man sein Pony reiten soll. Ein alter Mann ist ein erbärmlich Ding, das sagte er. Zerlumpter Rock über einen Stock gehängt. Brillant formuliert.
Aber was fühle ich da imNacken? Etwas Feuchtes. Wasser. Allgegenwärtiges Wasser. Ich blicke auf, von den Platten an der Decke tropft es, dann sehe ich auch den Plastikeimer zwischen meinen Füßen – ich stehe praktisch drin –, als ich auf einmal einen Druck auf dem Arm spüre. Es ist ihre Hand, Andreas Hand, das Gefühl, wie sie sich um meinen Bizeps legt, unwiderruflich wie die Geschichte, und was kann ich schon tun, als aufzusehen zu ihrem neuen Gesicht, diesem Gesicht, das wie feuchter Ton über jenem anderen modelliert wurde, das glasiert und gebrannt auf dem Regal in meinem Kopf steht. »Hallo, Ty«, sagt sie, im Eimer plätschert es leise, die zum Schneiden dicke Luft wird von den plärrenden Lautsprechern zerfetzt, die Gäste brabbeln, und ihr beharrlicher Blick hält mich fest. Mir fällt nichts ein. Shiggy schlendert vom anderen Ende des Tresens zu uns, riesenhaft in seinem Hawaiihemd, auf den Lippen die klassische Barkeeperfrage, und dann lächelt sie wie die Sonne, die sich über den Hügeln erhebt. »Hübsche Mütze«, sagt sie.
Sofort reiße ich sie mir vom Kopf und drehe sie verlegen hinter dem Rücken.
»Aber Ty« – ein Lachen –, »du hast ja eine Glatze!«
»Was darf es sein für die Lady?« schreit Shiggy durch den Lärm, und ehe ich noch ein Wort an sie gerichtet habe, wende ich mich an ihn, einen Ignoranten, mit dem ich jeden Tag reden könnte. »Sake on the rocks«, sage ich zu ihm, »außer sie zahlt selber – und ich nehme auch noch einen.« Die Transaktion schenkt mir eine Minute, um mich zu sammeln. Es ist Andrea. Sie ist es wirklich, hier neben mir, in Fleisch und Blut. Die Freude, so rufe ich mir ins Gedächtnis, ist untrennbar verbunden mit ihrem angetrauten Gefährten, dem Schmerz. »Wir werden alle älter«, rufe ich und drehe mich mit den Drinks in der Hand zu ihr um, »wenn wir Glück haben.«
»Und ich?« Sie tritt ein Stück zurück, wie auf einer Bühne, und hebt theatralisch die Arme. Im ersten Moment denke ich, sie dreht gleich eine Pirouette. Aber ich will hier nicht allzu zynisch klingen, denn es ist lange her, und sie sieht gut aus, sehr gut sogar, acht oder neun auf einer Skala bis zehn, alles in allem. Ihr Mund zieht sich in ein Körbchen aus Furchen und Fältchen zurück, als das Lächeln verblaßt, die Augen haben weniger Farbe und Glanz als in meiner Erinnerung, und sie treten kaum merklich hervor – aber was soll die Haarspalterei? Sie war damals eine Schönheit, und sie ist es noch heute.
»Du siehst toll aus«, sage ich, »und das rede ich nicht nur so dahin – es stimmt. Du siehst... ich weiß nicht, zum Anbeißen aus. Bist du zum Anbeißen?«
Das Lächeln kehrt zurück, aber nur eine Sekunde lang, es blitzt über ihr Gesicht wie vom Wind verweht, der jetzt die Fenster scheppern läßt – und zwar hörbar, trotz des Höllenlärms in der Kneipe und meines lädierten Gehörs (das Jimi Hendrix und The Who vor sechzig Jahren zugrunde gerichtet haben). Sie trägt ein geblümtes Kleid mit Rüschen an den Ärmeln, tief ausgeschnitten natürlich, hat einen halben Zentimeter Make-up aufgelegt, und das – pechschwarz gefärbte – Haar liegt schwer auf ihren Schultern. Sie fixiert mich mit diesem halb verträumten, halb berechnenden Blick ihrer großen Augen, den ich so gut kenne – oder jedenfalls kannte. »Können wir irgendwo miteinander reden?«
Die meisten Menschen haben keinen Bezug zu Hyänen. Kommt das Gespräch auf Hyänen, starren sie einen ratlos an, als wäre von mythischen Wesen die Rede – was sie heute praktisch auch sind. Die Gebildeteren erinnern sich vielleicht an die alten Naturfilme, in denen Hyänen sich rudelweise über einen Kadaver hermachen oder dem neugeborenen Weißschwanzgnu die Gedärme zerfetzen und es in blutige Stücke reißen, bevor noch der Blick in seinen Augen erloschen ist, aber das ist alles, woran sie sich erinnern, an die Häßlichkeit und den Tod. Ich kannte mal einen afrikanischen Großwildjäger (Philip Ratchiss, von ihm später mehr), der minderwertige Elefanten ausmerzte im Auftrag der Regierung von Sambia, als es noch eine Regierung von Sambia gab, und der hatte etliche unangenehme Begegnungen mit allen drei Hyänenarten. Als er im Alter nach Kalifornien ging, nahm er seinen Flintenträger mit, einen Senga namens Mag oder Mug – hab’s mir nie merken können –, dem eine Hyäne das Gesicht abgezogen hatte, als er eines Abends besoffen am Lagerfeuer eingenickt war. Ratchiss kaufte ihm ein paar gute Hosen und Polohemden und schickte ihn zu einem Zahnarzt, aber von kosmetischer Chirurgie wollte Mag – oder Mug – nichts wissen. Ein Auge und die Ohren waren ihm geblieben. Der Rest des Gesichts ähnelte einer großen Dörrpflaume.
Ich erzähle das deshalb, weil keiner begreifen kann, warum Mac unbedingt die Hyänen retten will – in Lilys Fall die Schabrackenhyäne –, wo doch Geparden, Kaffernbüffel, Nashörner und Elefanten ausgerottet sind. Und was sag ich darauf? Weil es sie noch gibt, deshalb. Und wenn es uns nicht gelingt, Lily mit dem Sperma des einzigen überlebenden Männchens im Zoo von San Diego zu schwängern, klonen wir sie eben – und danach klonen wir die Klone, ad infinitum. »Ich will die Tiere retten, die sonst keiner haben will«, sagte Mac zu mir, als wir unser derzeitiges Arrangement aushandelten. »Die, die nur eine Mutter lieben kann. Ist das nicht cool? Ist das nicht selbstlos und cool und mutig?« Ich antwortete, das sei es wohl. Und so wurden wir die Pfauen und die Vietnamesischen Hängebauchschweine los, ebenso die Hunde und Katzen und Ziegen und so weiter, und konzentrierten uns auf die weniger schillernden Viecher dieser Welt, die Warzenschweine, Pekaris, Hyänen und Schakale, die drei Löwen als Dreingabe, der Aufregung halber. Mac hört sie gern husten und brüllen, wenn er nachts heimkommt. Wenn er überhaupt in der Stadt ist. Was herzlich selten der Fall ist zu dieser Zeit des Jahres.
Jedenfalls schießt mir Lily durch den Kopf, als Andrea sich vorbeugt und mich fragt, wie das so ist, für Maclovio Pulchris zu arbeiten. Wir sitzen jetzt im Speisesaal bei Kerzenschein und warten auf unser Essen, mittlerweile tief eingetunkt in Sake und zu zivilisiert – oder zu alt –, um uns unser kleines Wiedersehen von der ganzen Bitternis der Vergangenheit versauen zu lassen. Ich quatsche über Mac und wie er gern die Nacht durchmacht, sich mit einer Flasche Champagner und seiner momentanen Flamme in den Garten setzt und den Ameisenbären beim Schnarchen zuhört, während Lily in ihrem Käfig umherpirscht und sich über die Ratten amüsiert, die sie mit ihren vierkralligen Pfoten erwischt. Und dann bin ich überhaupt bei Lily, bei der Perfektion ihres Verdauungstrakts, ihrem (dank der zermahlenen Knochen) kalkhaltigen Stuhlgang; bei den überfahrenen Viechern, die wir ihr bei Gelegenheit verfüttern – meist Opossums, auch so eine r-Selektion –, als Andrea sich präventiv räuspert.
Ich senke verlegen den Kopf – die glänzende kahle Kuppel meines Kopfes (Flow it, show it/ Long as God can grow it/ My hair). Sauge an dem metallischen Flickwerk meiner Seniorenzähne. Spiele mit dem Sakeglas herum. Ich quatsche permanent, seit wir uns hingesetzt haben – und warum? Weil ich trotz meines Heldenmuts vorhin, trotz meiner Machophantasien, mal eine alte Goldader anzubaggern, ihren Körper in irgendeinem überheizten Motelzimmer auszubeuten und sie dann abzuschreiben, gute Nacht, Wiedersehen und danke für die meisterlichen Lippenabdrücke, doch wieder von ihr fasziniert bin, körperlich und nervlich völlig geschafft, dennoch innerlich bereit, aufgeschlitzt und noch einmal geopfert zu werden. Ich bin nervös, das ist es. Und wenn ich nervös bin, kann ich den Mund nicht halten.
»Erinnerst du dich an ein Mädchen namens April Wind – sie war in Sierras Alter?« Andrea beobachtet mich, sucht nach dem Riß in meinem Gesicht, in den sie den ersten Haken treiben kann, um den Aufstieg zu meinem armen zitternden Hirn in Angriff zu nehmen. Von mir kriegt sie zunächst mal nichts. Gar nichts. Meine Augen sind aus Glas. Mein Gesicht eine Skulptur von Oldenburg, monumental und undurchdringlich. Sierra – die berühmte Sierra Tierwater, Märtyrerin für die Sache der Bäume – ist meine Tochter. War meine Tochter. Von April Wind hab ich noch nie gehört. Hoffe ich zumindest.
»War damals zu Anfang der Baumbesetzung mit dabei, im Sommer 2001?«
Da springen bei mir sämtliche Alarmsensoren an – ich hätte zu Hause bei meiner Hyäne bleiben sollen, hab’s ja gewußt. Ich bin verletzt. Und einsam. Und alt. Ich hab keine Zeit für so was. Aber Andrea wird weitermachen, garantiert – wenn ich eins über sie weiß, dann das. Irgendwas geht hier vor – etwas, was mir überhaupt nicht gefällt, und sobald sie damit rausgerückt ist, wird sie sich praktischeren Dingen zuwenden – sie braucht Geld, Essen, Kleidung, Medikamente, muß unbedingt eine Zeitlang bei mir wohnen, ein paar Wochen, einen Monat, sie braucht mich, will mich wiederhaben, und plötzlich wird sie sich vorbeugen, und wir werden uns küssen, mit Sushi auf den Lippen, und sie wird unter dem Tisch die Hand ausstrecken und mich an dem einen Ort packen, wo ich noch verwundbarer bin als im Kopf.
Ihre Lippen, ich betrachte ihre Lippen – mir wird klar, daß das Kollagenimplantate sind, und ihr Gesicht ist zu strahlend und zu perfekt, um natürlich zu sein, aber wer will in meinem Alter schon Natur? »Du erinnerst dich an sie«, beharrt sie und stochert geistesabwesend mit ihren Stäbchen im Essen herum (sie hat pikante Welsrolle, Tilapia-Sushi, geräucherten Sonnenfisch und koi sashimi bestellt, eine gute Wahl – jedenfalls die beste, die es hier gibt. Und es wird nicht billig werden, aber da ich Andrea kenne, habe ich eine frische Fünfhundertdollarkarte eingesteckt). »Das war die, die damals auch aus Teos Actioncamp zu uns gestoßen ist? Echt klein, sie kann kaum mehr als fünfundvierzig Kilo gewogen haben. Asiatin. Oder Halbasiatin? Hat geschworen, daß die Bäume mit ihr reden, weißt du nicht mehr?«
Langsam erinnere ich mich, aber das will ich gar nicht. Und der Name Teo rammt mir ein glühendes Eisen in die Gedärme, wo er den wasabe in Brand setzt, der dort in einem Fischsud aus Karpfenrogen und halbverdautem Tilapia herumschwappt. »Was ist mit Teo?« frage ich, gerade als der Wind so wuchtig losbläst, daß es den Laden schüttelt, als wäre er aus Stroh.
»Ich hasse das«, zischt sie und wappnet sich gegen die nächste Bö. Wir hören, wie etwas losgerissen wird, dann rasselt irgendein wesentliches Teil des Daches über die Schindeln, zerrt kurz über uns an den stählernen Trossen, bevor es in die Nacht davonsaust. Von herumfliegendem Dachmaterial sind schon Leute geköpft worden, zermalmt, erschlagen, gepfählt – so was hört man täglich in den Nachrichten. Eine Frau in der Apartmentsiedlung Lupine Hill brachte letztes Jahr gerade den Abfall raus, als eine Fahnenstange aus dem Himmel geflogen kam wie ein Wurfspeer und sie an den Müllcontainer nagelte, so daß sie aussah wie ein Insekt auf dem Präparierbrett. Außerdem grassieren Augen- und Lungenschäden wegen der vielen Partikel in der Luft, gar nicht zu reden von Allergien, die man vor zwanzig Jahren noch nicht mal vom Hörensagen kannte. Während der trockenen Jahreszeit, wenn die Luft nur eine Sonderform von Staub ist, tragen viele Leute – mich eingeschlossen – Schutzbrille und Gazemasken. Aber was soll ich dazu sagen? Ich hab’s ja kommen sehen?
Das ist die Welt, die wir geschaffen haben.Und jetzt leben wir auch drin.
»Man gewöhnt sich dran«, sage ich achselzuckend. »Aber in Arizona habt ihr ja auch Probleme – da wohnt ihr doch jetzt, oder?«
Sie nickt, ein knappes, ökonomisches Senken des Kinns, das mir sagen will: Frag nicht weiter.
»Und Teo?« beharre ich und versuche, es so beiläufig wie möglich klingen zu lassen, obwohl es mich innerlich halb auffrißt und ich am liebsten mit einer Flasche Magenschutz zu Hause vor der Glotze säße, wo mich die Löwen in den Schlaf husten würden. »Ist er noch auf der Bildfläche, oder was?«
Genau in diesem Moment merke ich, daß meine Füße naß werden, und als ich erst den einen, dann den anderen hochhebe, reagiert der Teppich wie ein Schwamm. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie eine von Shiggys Töchtern an der Hintertür mit einem Mop und einem Berg von Servietten herumhantiert, hektische Geschäftigkeit, die jedoch nicht genügt, um den Wasserfluß einzudämmen, der unerbittlich in den Raum strömt. Shiggy hätte auf Pfählen bauen sollen, und das weiß er, aber er hat den Laden von seinem Vater geerbt, der hier vierzig Jahre lang ein erfolgreiches Smorgasbord-Bistro geführt hat, und die Kosten für das Anheben des Gebäudes wären astronomisch gewesen. Und wie alle anderen auch wartete Shiggy darauf, daß das Wetter wieder besser würde. »Kein Problem, Sir, kein Problem«, versichert Shiggys Tochter gerade einem allein sitzenden Gast in der Ecke, »das haben wir gleich aufgewischt.«
Solcherart abgelenkt – meine Stiefel sind garantiert hin –, ist mir die Frage entfallen, die ich in der feuchten Luft dieser Kneipe habe hängenlassen, ich habe vergessen, wo ich bin oder warum oder sogar, wer ich bin, einer dieser kleinen Aussetzer, die in meinem Alter das Leben erträglich machen, trotz Gingko biloba, Koffein und allen nervenstärkenden Mitteln. Volle zehn Sekunden lang habe ich so meinen Bauch vom Hirn abgetrennt. »Er ist tot«, sagt Andrea in die Stille hinein.
»Wer?«
»Teo.«
Tot? Teo tot? Da bin ich sofort zurück in der Gegenwart, so wach wie Lily, wenn sie sieht, wie ich in der großen fettigen Tüte nach dem nächsten Hühnerrücken greife. Allmählich gefällt mir die Sache. Auf einmal fühle ich mich phantastisch. Ich möchte Einzelheiten: Hat er gelitten? War es ein langsamer Tod? Hatte er am Ende noch seinen Darm, seinen Pimmel, sein Hirn unter Kontrolle? »Ich dachte, dafür braucht’s ne silberne Kugel«, hörte ich mich sagen. »Oder einen Pfahl ins Herz.«
Sie senkt den Blick, der Vorhang fällt, die Jalousien gehen runter. Sehr leise jetzt: »Es ging schnell.«
»Wie schnell?«
Brr, grollt der Wind, brr, brr, brr, und jetzt tropft das Wasser stetig – Teos Geist, sein aalglatter, wäßriger Puls –, es prasselt nur so auf den Tisch herab, gleich links neben meinen Stäbchen. Ich mustere sie, genieße diese Enthüllung, aber der Rücken tut mir weh – er tut schon immer und für immer weh, das geht so, seit ich Mitte Dreißig bin –, und für die Arthritis in meinem rechten Fuß ist der nasse Boden auch nicht gesund. Außerdem habe ich einen voreiligen Ständer. Ich widerstehe der Versuchung, rasch auf die Uhr zu sehen. »Wie schnell?« wiederhole ich.
»Ich möchte nicht darüber sprechen«, sagt sie, »weil ich nicht deswegen – das wollte ich nicht mit dir... also, es war ein Meteor, okay?«
Ich kann mir das Lachen nicht verkneifen. Laut und schallend explodiert es von meinen unbeherrschten Lippen und läßt ein Pärchen zwei Tische weiter zusammenzucken. »Du nimmst mich auf den Arm?«
»Elfeinhalb Milliarden Menschen leben auf der Erde, Ty, davon sechzig Millionen hier in Kalifornien. Meteoriten schlagen auf der Erde ein, ja? Irgendwo müssen sie schließlich landen.«
»Du meinst, er ist echt von so einem Ding getroffen worden? Wie groß? Und wann? Wann ist das passiert – vor zehn Jahren oder gestern, oder was?«
»Ich will dich nicht anlügen, Ty: ich hab ihn geliebt. Jedenfalls dachte ich das.«
»Tja, und du dachtest auch, daß du mich liebst. Hat mir ne Menge genützt.«
»Hör zu, ich will das alles nicht wieder aufwärmen, ja? Deshalb bin ich nicht...«
»Wie war es, ist er wie von einer Kugel durchbohrt worden? Einschlag durchs Dach?«
»Er kochte sich gerade ein weiches Ei. In der Küche. Er lebte in einer dieser Wohngemeinschaften für Leute wie mich, die nie was für die Rente gespart haben – und frag bloß nicht, denn ich werde kein Wort sagen über meine momentanen Lebensumstände, also laß es.« Sie betupfte sich mit der Serviette die Lippen und nahm einen kummervollen Schluck des leicht fettigen Sake, immerhin der beste des Hauses. (Hab ich erwähnt, daß Weintrauben der Vergangenheit angehören? Napa und Sonoma Valley sind inzwischen Reisfelder, die Winzergebiete von Loire und Rhein sind so naß, daß man dort wohl besser Ananas pflanzen sollte – die gute Nachricht ist wiederum, daß die Norweger angeblich kalifornische Reben in den Vororten von Oslo anbauen.)
»Er hat gar nicht gemerkt, was ihn da traf«, sagt sie gerade und jagt mich mit den Augen. »Sein Sohn hat mir erzählt, daß sie das Ding – es war so groß wie ein Golfball – dann im Beton des Kellers fanden, es qualmte noch.«
Ich staune. Da sitze ich bei Sake und einem Teller mit kaltem Fisch und habe dieses Bild im Kopf – ein weichgekochtes Ei! Die Welt ist schon ein einsamer Ort.
»Ty?«
Ich blicke auf und schüttle immer noch den Kopf. »Willst du noch was trinken?«
»Nein, nein – hör zu. Weshalb ich hier bin: ich möchte dir was über April Wind erzählen...«
Ich tue mein Bestes, um ein wenig verletzt und verblüfft dreinzublicken, obwohl ich weder verletzt noch verblüfft bin, nicht allzusehr jedenfalls. »Ich dachte, du wolltest mich aus Liebe sehen – hast du das nicht gesagt? Korrigier mich, wenn ich mich irre, aber ich hatte den Eindruck, daß du wieder, na ja, mit mir zusammen...«
»Nein«, sagt sie. »Oder ja, doch, das will ich. Aber was mich wirklich hierherbringt, der Grund, weshalb ich dich treffen wollte, das ist April Wind. Sie möchte ein Buch schreiben. Über Sierra.«
Ich werde nicht mehr so leicht wütend, hat ja keinen Sinn. Aber bei allem, was ich durchgestanden habe – nicht nur damals, sondern auch heute, und wer wird wohl nachher dem Patagonischen Fuchs und den behäbigen fetten Pangolinen hinterherjagen, auf Füßen, die sich anfühlen wie Zementblöcke? –, kann ich nicht anders. »Ich will nichts davon hören«, sage ich und stehe auf, der Teppich quietscht unter meinen Sohlen, das ganze Haus vibriert beim Ansturm der nächsten Bö. Mein Arm, mein rechter Arm vollführt eine beschönigende Geste und bewegt sich wie aus eigenem Antrieb, nicht um Cäsar zu rühmen, sondern um ihn zu begraben. »Sie ist tot, reicht das denn nicht? Was willst du – sie in eine Art Jeanne d’Arc verwandeln? Geh mal vor die Tür. Sieh dich draußen um. Wozu soll diese Scheiße gut sein?«
Andrea ist eine große Frau, immer noch – in den Schultern, den langen Beinen, die jetzt unter dem Rock eingezogen sind, die Hände –, jetzt aber macht sie sich klein. Sie ist ein obdachloses Kind. Sie ist ausgenützt worden. Sie ist eine Bedrohung, und auf den Gedanken ist nicht sie verfallen, sondern April Wind, die Frau, die mit den Bäumen redet. »Ich finde es eine gute Idee«, sagt sie. »Für die Nachwelt.«
»Welche Nachwelt?« Ich breite die Arme weit aus. »Das hier ist deine Nachwelt.«
»Komm doch, Ty – tu’s für Sierra. Laß dich interviewen von der Frau, erzähl ihr deine Geschichte – was macht das schon?«
Alles zieht sich zusammen und drängt in die Leere in meinem Inneren, der Wind flaut ab, als hätte sich ein Taktstock gesenkt, auch der Regen nimmt eine Auszeit, und der Mop an der Tür gewinnt endlich die Oberhand. Andrea ist ebenfalls aufgestanden, wir sind ein perfekt zueinander passendes Zweiergespann von Jungalten, so jugendlich-verjüngt wie diese Paare, die man in New York oder Paris oder in der Fernsehwerbung für Transplantate sieht, über den Tisch gebeugt, als wollten wir unvermittelt in einer komplizierten Choreographie durch den Saal fegen. »Und was hast du davon? Finderlohn?«
Keine Reaktion.
»Übrigens, wie hast du mich eigentlich aufgespürt?«
In ihrem Lächeln liegt keine Bosheit – eine Spur von Selbstgefälligkeit vielleicht, aber keine Bosheit. Sie hebt die Finger in die Höhe, alle zehn auf einmal. »Übers Internet. Such nach Maclovio Pulchris, und du wärst erstaunt, wieviel sich da findet – und was ich davon habe? Das ist leicht beantwortet: dich. Um dich geht es mir doch.«
Ich bin gerührt, das läßt sich nicht verleugnen. Mit nach Hause nehmen werde sie ich nicht, niemals, egal, was passiert. Aber ich grinse – ein so klebriges Grinsen, daß man darauf tapezieren könnte. »Sollen wir in ein Motel gehen?«
»Das mußt du aber nicht tun.«
Ich grinse immer noch, stelle meine Dentalkorrekturen zur Schau, von Sakedämpfen anästhesiertes Zahnfleisch und die brennenden Augen hinter den beiden Brillengläsern. »Aber ich will es.«
Der Wind kehrt für eine Zugabe zurück. Musikfetzen wehen von der Bar herüber. Alles lärmt, die ganze Welt, Krach und noch mehr Krach. »Ich werde nicht lange bleiben«, sagt sie. »Und ich werde dir mit den Tieren helfen. Du weißt ja, wie sehr ich Tiere mag...«
Teil 1 Bring sie lebend zurück!
Siskiyou Forest, Juli 1989
So fängt es an, in einer Sommernacht, die so vollgestopft ist mit Sternen, daß die Milchstraße aussieht wie eine weiße Plastiktüte, aufgehängt im Dach des Himmels. Kein Mond allerdings – der hätte nur gestört. Und kein Geräusch bis auf das unregelmäßige Plätschern von Wasser, gedämpfte Schritte von billigen Turnschuhen auf dem gespenstischen Band der Straße, der verhaltene Applaus der Grillen. Es ist eigentlich nur eine Forststraße, ein Schotterweg, und Tyrone Tierwater würde dazu auch nicht Straße sagen wollen. Er nennt es eine Narbe, eine Verletzung, eine offene Wunde im Leib des Waldes. Aber bezeichnen wir es der Einfachheit halber als Straße. Tagsüber donnern darüber Lastwagen, riesige D7-Planierraupen, Ladeschlepper und Shredder. Es ist eine Straße. Und er geht auf ihr.
Er bewegt sich ziel- und zweckgerichtet, nahezu unsichtbar im Abgrund der Schatten unter den großen Douglastannen. Wer gut an die Dunkelheit angepaßt ist und scharf genug hinsieht, der würde auch seine drei Gefährten erkennen, um die sich die Nacht ein klein wenig neu verteilt, wenn sie vorbeikommen: mal sieht man sie, mal wieder nicht. Alle vier haben das gleiche an: billige, mit Schuhcreme geschwärzte Tennisschuhe, zwei Paar Socken, schwarze T- und Sweat-Shirts drüber, und natürlich die schwarzen Strickmützen. Wo wären sie ohne die?
Tierwater hatte noch weiter gehen wollen, das volle Programm, dunkle Fettschminke auf dem Nasenrücken und ein paar Streifen über die Backenknochen – oder noch besser: das Gesicht ganz schwärzen –, aber das hat ihm Andrea ausgeredet. Sie kann ihm alles ausreden, weil sie vernunftbetonter ist als er und aggressiver, weil sie sprachlich einfach mehr Geschick und dazu ein Gespür wie ein Jagdhund hat, mit dem sie jeder Schwäche auf die Schliche kommt – dafür besitzt sie nicht mal die Hälfte seines Potentials für Paranoia und neurotische Verhaltensweisen, Pessimismus und Verzweiflung. Es kann immer schiefgehen. Und das tut es auch. Das wird es. Er hat versucht, ihr das klarzumachen, aber sie wollte nicht auf ihn hören.
Da saßen sie gerade im Motelzimmer, im unfertigen Zentrum des komatösen Ortes Grant’s Pass in Oregon, wo sie als Mr. und Mrs. James Watt abgestiegen waren. Er war nervös – Schmetterlinge im Bauch, Termiten im Kopf –, nervös und wütend. Wütend auf die Holzfäller, auf Oregon, das Motelzimmer und auf sie. Draußen, drei Schritte von der Tür entfernt, stand Teos Chevy Caprice (anonym grau, die Nummernschilder kunstvoll verdreckt) auf dem verabredeten Parkplatz. Tierwater kam aus dem Bad, einen Wachsmalstift in der Hand und eine in Klarsichtfolie eingeschweißte Packung Halloweenschminke in der anderen. Auf dem Bett lag eine zerdrückte Schachtel mit Doughnuts, zwei Pappbecher mit Kaffee trockneten auf dem niedrigen Preßholztisch an. »Vergiß es, Ty«, sagte sie. »Ich sag doch dauernd, das hier ist gar nichts, nur der erste Schritt in einem langen Marsch. Glaubst du denn, ich würde Sierra mitnehmen, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher wäre, daß es ungefährlich ist? Das wird ein Spaziergang im Park, nichts weiter.«
Ein kurzer Moment versickerte. Er sah auf seine Tochter, aber sie hatte ihm nichts zu sagen, hielt nur den Kopf etwas schräg, woran man sah, daß sie zuhörte, aber vor allem in sich gekehrt war. Im Fernsehen sagte jemand: »... und diese einzigartigen Kreaturen, deren Lebensräume immer kleiner werden, finden nicht mehr ausreichend Mastfutter zum Überleben, geschweige denn genug Aas.« Tierwater probierte ein Lächeln, aber irgendwie wollten die entsprechenden Muskeln nicht recht. Er hatte ein ungutes Gefühl bei der Sache, vor allem was Sierra anging – aber während er den Mücken lauschte, die im Insektengrill vor dem Fenster schmurgelten, wurde ihm klar, daß »ungutes Gefühl« nicht ganz das richtige Wort war. Ungutes Gefühl? Wie wär’s mit: rasende Angst, Entsetzen, Nachtschweiß? Kloß im Hals? Glassplitter im Herzen?
Hier draußen gab es Menschen, denen es nicht gefallen würde, was die vier mit der Straße vorhatten, die er nicht Straße nennen wollte. Chefs, Unterchefs, Schwermaschinenführer, geschäftsführende Manager, Spesenritter, Buchhalter und Polizisten. Gar nicht zu reden von all den braven und anständigen, hart arbeitenden und völlig irregeleiteten Holzfällerfamilien, Männern mit Baseballmützen und roten Hosenträgern, Frauen wie Festzelte, alles Leute, die ihre Freizeit damit verbrachten, in jedem Ort entlang der Pazifikküste sämtliche Büsche, Bäume, Türklinken, Briefkästen und Autoantennen mit patriotischen gelben Schleifchen zu verzieren. Sie hatten Hypotheken, Wohnwagen, Motorboote, Pläne für die Zukunft, und auf den verdreckten Stoßstangen ihrer Pickups prangten Aufkleber wie Rette ein Stinktier, überfahr einen Ökofreak und Arbeiten Sie für Ihren Lebensunterhalt oder sind Sie Umweltschützer?. Sie waren zornig – zornig geboren –, und sie schraken nicht vor körperlichen Aktionen der einen oder anderen Art zurück. Apropos ungute Gefühle – seine Tochter ist erst dreizehn Jahre alt, trotz ihrer Gruftiaufmachung, des Nasenrings und des Haarcapes, das sich wie in der Werbung um ihre Schultern schmiegt, und sie hat noch an keinem einzigen Akt von zivilem Ungehorsam teilgenommen, nicht mal an einer Demo am hellichten Tag mit surrenden Minicams und Tausenden anderen Teilnehmern. »Bitte«, flehte er, »dann eben nur unter den Augen. Um die hellsten Flecken zu tarnen.«
Andrea schüttelte nur den Kopf. Schwarz stand ihr gut, das mußte er zugeben, und die Strickmütze, tief in die Stirn gezogen, sah mächtig sexy aus. Sie waren seit drei Monaten verheiratet, alles an ihr war immer noch neu und eine Offenbarung, bis hin zu der Art, wie sie morgens in ihre Jeans schlüpfte oder über einem Topf mit Ratatouille die Lippen schürzte, zwischen denen ein schmaler grüner Paprikastreifen verschwand, während der Dampf ihr hexenhaft ins Haar stieg. »Und wenn uns die Polizei anhält?« fragte sie. »Schon mal überlegt? Wie willst du die Schminke erklären? ›Wissen Sie, Officer, wir sind nämlich alles Footballstürmer‹? Oder: ›Ach, wir haben gerade bei einer tollen Minstrel-Show mitgespielt‹?« Sie war die Erfahrenste – im Demonstrieren, Protestieren, Organisieren –, und sie steckte keinen Millimeter zurück. »Weißt du«, sagte sie und fuhr sich mit dem Finger unter den Rand der Mütze, »dein Problem ist einfach, daß du zu viele Filme gesehen hast.«
Möglich. Dennoch ist dieser Kommentar nicht wirklich relevant, nicht jetzt und nicht hier. Dies ist die Wildnis, oder was davon übrig ist. Die Nacht ist tief, die Straße unwegsam, die Sterne nur schwache Erinnerungen an die Geburt des Universums. Für jeden lebenden Menschen gibt es da draußen neun Galaxien, jede davon mit rund einhundert Milliarden Sonnen, und trotzdem sieht er kaum die Hand vor Augen, tappt wie ein Schlafwandler dahin, immer einen Fuß vor den anderen. Das hier ist verrückt, denkt er sich, es bringt garantiert Ärger, so als würde man in einer Höhle herumstolpern, in der gleich der Boden einkracht. Er fragt sich, ob die anderen sich auch so mies fühlen, denkt kurz an Vitamin-A-Tabletten und Nachtsichtbrillen, als irgendwo vor ihnen eine Eule ruft, ein einzelner zitternder Schrei, der besagt, daß sie gerade etwas in den Klauen erwürgt.
Seine Tochter, die sich nur durch das rhythmische Manschen ihres Kaugummis bemerkbar macht, fragt in dramatischem Flüsterton, ob das vielleicht ein Fleckenkauz ist. »Ich meine, das wäre doch irre, oder?«
Er kann ihr Gesicht nicht sehen, die Nacht ist wie eine zu weite Jacke, im Geist ist er bereits viele Kilometer weiter, und er antwortet, ohne nachzudenken: »Schön wär’s.«
Unmittelbar neben ihm, aus der Leere zu seiner Linken, mischt sich eine weitere Stimme ein, die von Andrea, seiner zweiten Frau, der Frau, die nicht Sierras leibliche Mutter ist und daher in allen Streitigkeiten, Reibereien, Mißverständnissen, Tatsachenverdrehungen und fehlgeschlagenen Abenteuern problemlos die Rolle ihrer Anwältin übernehmen kann. »Jetzt laß bloß das Mädchen in Ruhe, Ty.« Und dann, mit Flüstern so sanft wie eine Feder, die durch die Dunkelheit schwebt: »Aber sicher, Liebes, das ist ein Fleckenkauz, das hört man sofort.«
Tierwater geht weiter, den feuchten Duft des aktiven nächtlichen Waldes in der Nase, den Geschmack danach auf der Zunge – Moder im Übergang zu einem anderen Element: transsubstantiierter Moder –, aber er ist mit einemmal sauer. Die Sache gefällt ihm nicht. Gefällt ihm ganz und gar nicht. Er weiß, daß es notwendig ist, er weiß, daß die Wälder geschändet werden, daß die Erde bis auf den letzten Zweig abgeholzt wird und daß irgend jemand sie retten muß, dennoch gefällt es ihm nicht. Die zitternde Stimme verrät seine Anspannung. »Jetzt halt aber den Mund, ja? Wir wollen hier unauffällig bleiben – was wir tun, ist gegen das Gesetz, hast du das vergessen? Verdammt, man könnte meinen, wir wären auf einem Naturlehrpfad oder so: Hier hätten wir also den Herrn Specht und dort den großen Baumfarn.«
Ernüchterte Stille, in die die Grillen ihre ganze Geradflüglerfurchtsamkeit ergießen, aber sie hält natürlich nicht an. Eine weitere Stimme mengt sich dazu, ein Kratzen des Kehlkopfs in dem schwarzen Loch zu seiner Rechten. Das ist Teo, Teo Van Sparks, alias der »Leberkopf«. Vor acht Jahren hat er sich in Hollywood auf dem Rodeo Drive vor Sterlings Pelzwarenboutique aufgestellt, eine Scheibe Kalbsleber mit Fäden auf den kahlgeschorenen Kopf geheftet. Er ließ die Leber verwesen – drei, vier Tage, Fliegen darauf wie eine Dornenkrone, die Maden krochen ihm schon die Nase hinunter –, dann riß er sie sich vom Kopf, um sie einer silberhaarigen Vettel im Chinchilla vor die Füße zu knallen oder einem Filmsternchen, das im Blaufuchs durch die Tür stolzierte. Und am nächsten Tag war er wieder zurück, mit einem neuen Stück Fleisch. Inzwischen ist er einunddreißig und eine große Nummer im Getriebe von Earth Forever! (auf seiner Visitenkarte steht Öko-Agitator), Gewichtheber mit Bizeps, Trizeps, Brust- und Rückenmuskulatur zum Herzeigen, und es gibt nichts über die Natur, was er nicht weiß. Jedenfalls würde er es nie zugeben. »Tut mir leid, Mädels«, sagt er, »aber nach den meisten Schätzungen gibt’s nicht mal mehr fünfhundert brütende Fleckenkauzpaare in der gesamten Küstenregion von British Columbia bis runter zur südlichen Sierra, deshalb bezweifle ich...«
»Weniger«, korrigiert Andrea ihn auf ihre pedantische Art. Sie hat heute nacht das Kommando, und sie wird sie alle zurechtweisen, selbst wenn es um Kleinigkeiten der Grammatik und des Sprachgebrauchs geht. Wenn sie ihre Befehle einfach nur methodisch und leidenschaftslos erteilte, das ginge ja noch – aber sie ist so herablassend, so selbstzufrieden, anmaßend und rechthaberisch. Er weiß nicht, ob er das aushält. Nicht heute nacht.
»Stimmt, noch weniger. Das meine ich ja, wahrscheinlich war es ein Rauhfußkauz oder eine Waldohreule oder sogar ein Uhu. Natürlich müßten wir den vollständigen Ruf hören, um sicher zu sein. Der Fleckenkauz hat einen schrillen Schrei, den er drei-, viermal ausstößt, sehr dicht aufeinander, immer lauter.«
»Warum rufst du ihn dann nicht?« flüstert Sierra, und die Stille der Nacht ist keine Stille, sondern der tosende Hintergrund einer dicht bevorstehenden, katastrophalen Überraschung. »Damit er antwortet. Und dann wüßten wir’s, oder?«
Bildet er es sich ein, oder spürt er, wie ihm der Boden unter den Füßen entgleitet? Er ist blind, vollkommen blind, zieht die Schultern ein in Erwartung des ersten unerwarteten Schlags, sein Atem geht rasch, das Herz hämmert gegen das Gitter seines Käfigs. Und die anderen? Die gehen nebeneinander die Straße entlang wie Touristen auf einer Mole, laut und gemächlich, gedankenlos. »Und da wir gerade dabei sind«, sagt er und ist überrascht von der Vehemenz seiner Stimme, »möchte ich dich was fragen, Andrea – hast du an die Windeln gedacht? Oder wird das ein weiterer Fall in der langen Serie von, von...«
»Wobei sind wir gerade?«
»Dabei. Beim Thema Unauffälligkeit und perfekte Vorbereitung.«
Er spricht ins Nichts hinein, in die Leere vor ihm, er geht die unsichtbare Straße entlang und stößt Wortketten aus wie ein brabbelnder Penner. Das Käuzchen ruft noch einmal, dann hört man etwas anderes, ein knatterndes, hartes Schaben in der Finsternis.
»Natürlich hab ich an die Windeln gedacht.« Besänftigend fährt die große, männliche Hand seiner Frau über das doppelt abgesteppte Nylon ihres Rucksacks. »Und an die Sandwiches und die Vollkornriegel, sogar an Sonnencreme. Meinst du, ich weiß nicht, was ich hier tue? Willst du das andeuten?«
Er will gar nichts andeuten, aber er ist knapp davor, sich ungeahnt drastisch auszudrücken. Die Flitterwochen sind vorbei. Er riskiert hier Verhaftung, Demütigung, körperliche Mißhandlung oder noch Schlimmeres – und zwar für sie, alles nur für sie, oder jedenfalls ihretwegen –, und ihr Tonfall ärgert ihn. Er will es ihr heimzahlen, sie irgendwie erwischen, einen schönen altmodischen Ehestreit vom Zaun brechen, aber statt dessen läßt er die Stille für sich sprechen.
»Was für Sandwiches?« will Sierra wissen, eine gepreßte, schüchterne Anfrage, die sie in das Kuvert der elterlichen Zwistigkeit steckt. Mit Mühe erkennt er die Umrisse ihrer Gestalt, schwarz gegen schwarz, die hängenden Schultern, die zu großen Füße, das knospende Wunder ihrer mit Tofu genährten Formen, und da packt ihn gleich wieder die Panik: Was ist, wenn die Sache böse ausgeht? Was dann?
»Etwas Besonderes für dich, Liebes. Eine Überraschung.«
»Tomate, Avocado und Sojasprossen auf Honig-Weizenkleie, mit einem Klecks Mayo dazu?«
Ein leiser Pfiff von Andrea. »Ich kann schweigen.«
»Hummus – Hummus und Tabbouleh auf Vollweizen-Fladenbrot?«
»Wie ein Grab.«
»Erdnußbutter mit Marshmallows? Und Schokoaufstrich?«