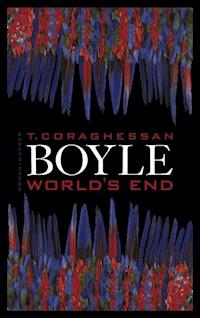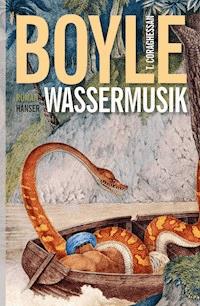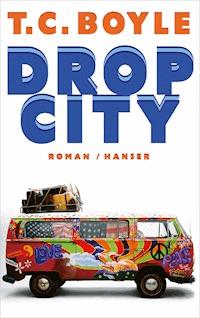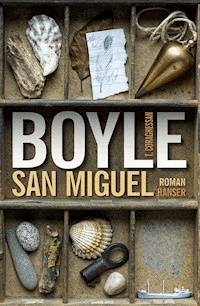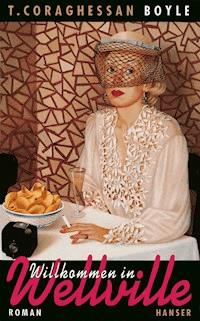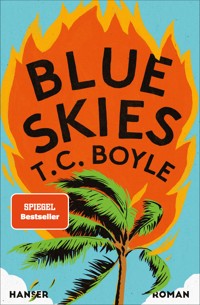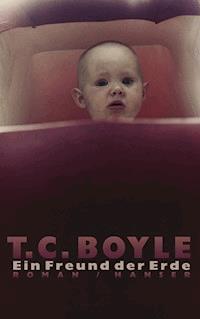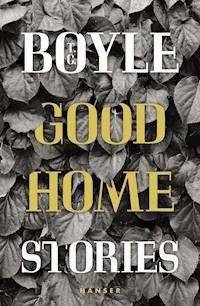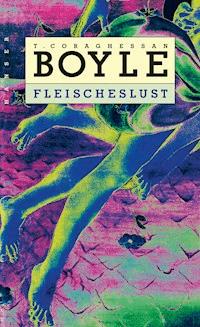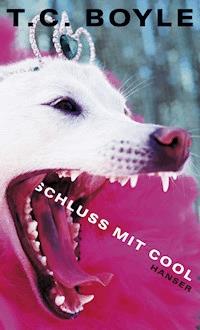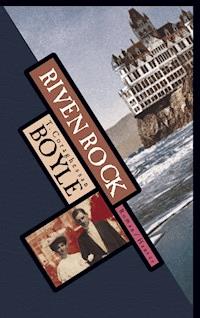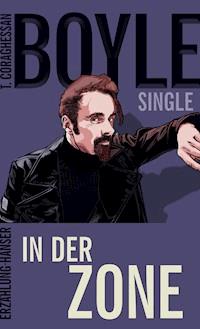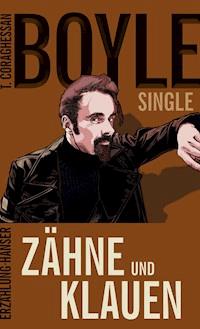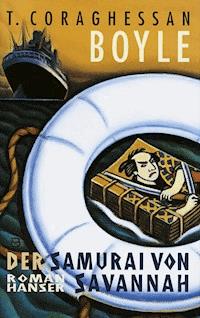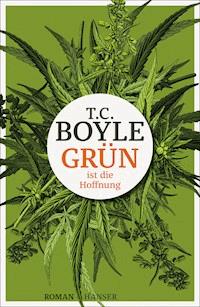Hanser eBook
T. Coraghessan Boyle
WORLD’S END
Roman
Aus dem Amerikanischen von Werner Richter
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe erschien 1987 unter dem Titel World’s End bei Viking Penguin Inc., New York.
ANMERKUNG DES VERFASSERS: Was folgt, ist eine historische Fuge. Sie hat nur wenig mit tatsächlichen Orten und Vorkommnissen und absolut nichts mit lebenden oder verstorbenen Personen zu tun. Die Handlung ist frei erfunden.
DANKSAGUNG: Der Verfasser möchte folgenden Menschen für ihre Hilfe beim Zusammenstellen des Materials für dieses Buch seinen Dank ausdrücken: Alan und Seymour Arkawy, Mitchell Burgess, Richard Chambers, Chuck Fadel, Ken Fortgang, Rick Miles, Jack und Jerry Miller und der Mannschaft der Clearwater.
ISBN 978-3-446-23966-1
© T. Coraghessan Boyle 1987
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München Wien 1989, 2003
Abbildungen von Francesca Belanger
Satz: Clausen & Bosse, Leck
E-Book-Konvertierung: Beltz Bad Langensalza
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
www.tc-boyle.de/
Inhalt
TEIL I MARTYR’S REACH
EIN ZUSAMMENSTOSS MIT DER GESCHICHTE
O PIONIERE!
DER DRECK DER AHNEN
PROTHESE
NEELTJE WINKTE ZURÜCK
DER LETZTE DER KITCHAWANKEN
DER FINGER
DAS VERMÄCHTNIS
UNTER WILDEN
EHEFREUDEN UND ANDERES
MIT DEM SEGEN DES patroon
ADEL OHNE GRUNDBESITZ
DER KLABAUTERMANN VOM DUNDERBERG
MOHONK ODER EINE DOLCHSTOSSLEGENDE
DAS KLAGEWEIB
TOFU
MARTYR’S REACH
SÖHNE UND TÖCHTER
ZUSAMMENSTOSS NUMMER ZWEI
TEIL II WORLD’S END
WIE SACHOES ÜBERTÖLPELT WURDE
TAG DER OFFENEN TÜR
IN DE PEKEL ZITTEN
GARTEN EDEN
EINE FRAGE DES GLEICHGEWICHTS
ZWISCHEN HAMMER UND AMBOSS
ACH, SÜSSES LEID!
VERKLEIDUNGEN
VAN WARTWYCK: SCHLAF UND ERWACHEN
BARROW
TRUMANS GESCHICHTE
DER GALGENHÜGEL
SEI GEGRÜSST, ARCADIA!
WORLD’S END
DER ERBE
Nach solcher Erkenntnis, wie vergeben?
T. S. Eliot: Gerontion
Zum Andenken an meinen eigenen verschwundenen Vater
TEIL I MARTYR’S REACH
Er begann sich zu fragen, ob er, wie auch die Welt ringsum, nicht verhext sei.
Washington Irving: Rip Van Winkle
EIN ZUSAMMENSTOSS MIT DER GESCHICHTE
An dem Tag, als Walter Van Brunt seinen rechten Fuß verlor, hatten ihn sporadisch Spukgestalten der Vergangenheit heimgesucht. Es begann beim Aufwachen, als ihm der Geruch von Kartoffelpuffern in die Nase stieg, ein Geruch, der ihn an seine Mutter erinnerte, die nach den Unruhen von Peterskill 1949 an Kummer gestorben war; weiter ging es während der trostlosen Mittagspause, die er teils nostalgischen Erinnerungen an seine Großmutter väterlicherseits, teils einem Leberwurstbrötchen widmete, das nach totem Fleisch und Chemie schmeckte. Am Nachmittag, an der heulenden Drehbank, stand auf einmal schemenhaft sein Großvater vor ihm, ein mürrischer, bierbäuchiger Mann, behaart wie ein Menschenfresser aus dem Märchen; und dann, kurz vor Feierabend, hatte er noch die vage, verschwommene Vision von einem grinsenden Holländer in Pluderhosen und hohem Spitzhut.
Den ersten Geist, den Kartoffelpuffergeist, beschwor die flinke kulinarische Hand von Lola Solovay, seiner Adoptivmutter, herauf. Obwohl Walter noch nicht einmal vier gewesen war, als seine leibliche Mutter den Mächten der Bigotterie und eines fehlgeleiteten Patriotismus erlag, erinnerte er sich vor allem an ihre Augen, die wie fleischgewordene Seelen gewesen waren, und an die federleichten, leckeren Kartoffelpuffer, die sie immer reichlich mit saurer Sahne und selbstgemachtem Apfelmus übergossen hatte. Er lag im Bett, in dem Dämmerzustand zwischen Wachen und Träumen, und wartete auf den Wecker, der ihn zu seinem höllischen Job im Werk der Depeyster Manufacturing zitieren würde, als er den Duft dieser ätherischen Kartoffelpuffer schnupperte, und einen Moment lang war seine Mutter da, direkt neben ihm.
Der Geist seiner Großmutter, Elsa Van Brunt, stand ebenfalls mit Essensgeruch in Verbindung. Er wickelte das Weißbrot mit Leberwurst aus, das Lola für ihn im morgendlichen Zwielicht kreiert hatte, und auf einmal war er zehn Jahre alt und verbrachte den Sommer mit den Großeltern am Fluß; es war ein Tag, so dunkel wie im Dezember, und ein Gewitter hockte oben auf dem Dunderberg. Die Großmutter war von ihrer Töpferscheibe aufgestanden, um das Mittagessen zu machen, und erzählte ihm dabei die Geschichte von Sachoes’ Tochter. Sachoes, so wußte Walter aus früheren Episoden, war der Häuptling der Kitchawanken, jenes Stammes, dem die Gründer von Peterskill-on-the-Hudson in den Tagen der holländischen Kolonie das Land für die Siedlung abgeschwatzt hatten. Damals waren die Kitchawanken, im Grunde ein lethargischer, friedliebender, Rindenhütten bauender Clan von Faulenzern und Austernessern, den kriegerischen Mohawk im Norden zur Treue verpflichtet. Tatsächlich waren diese Mohawk so wild, so grausam, so kriegerisch und raubgierig, daß sie nur einen einzelnen Krieger zum Abholen des Tributs schicken mußten, und Manitou mochte dem Stamme gnädig sein, der ihn nicht wie einen Gott bewirtete und mit wampumpeak und seawant in rauhen Mengen überhäufte. Kanyengahaga nannten sich die Mohawk selbst: Leute vom Ort des Feuersteins, bei den Kitchawanken und ihren mohikanischen Vettern dagegen hießen sie Mohawk: Leute, die Leute fressen – eine Anspielung auf ihre Neigung, all jene zu braten und zu verzehren, die ihnen nicht zu Willen waren.
Nun ja. Weißbrotscheiben wurden auf den Teller gelegt, Tomaten geschnitten, eine in Zellophan gewickelte Leberwurst aus dem Kühlschrank geholt. Sachoes hatte eine Tochter, sagte Walters Großmutter, und deren Name war Minewa, nach der Göttin des Flusses, die Blitz und Donner schleuderte. Dabei zeigte sie aus dem Fenster über den breiten Rücken des Hudson hinweg zum Dunderberg, auf dessen Gipfel die Blitze wie Nervenenden zuckten. So wie die da.
Eines geruhsamen Nachmittags im August kam ein Mohawkkrieger ins Dorf, nackt bis auf den Lendenschurz und bemalt wie Tod und Teufel. Tribut, verlangte er mit einer Stimme, die wie das Zischen einer Viper klang, dann brach er ohnmächtig zusammen; Blut spritzte ihm aus Mund und Ohren, und die Pockennarben in seinem Gesicht schwollen an. Minewa pflegte ihn. Falls er starb, wäre es aus mit dem Austernessen, mit den lustigen Fahrten in Rindenkanus und dem Auslutschen des süßen weißen Fleisches aus den Panzern der Blauscherenkrebse: es wäre aus mit den Kitchawanken. Dafür würden die Mohawk schon sorgen.
Einen Monat lang lag er in Sachoes’ Hütte flach, den Kopf auf Minewas Schoß gebettet, während sie mit Ottermoschus sein Fieber linderte und ihn mit Kräutern und wilden Zwiebeln labte. Allmählich kam er wieder zu Kräften, bis er eines Tages ohne fremde Hilfe aufstehen und seine Forderung nach Tribut wiederholen konnte. Diesmal jedoch verlangte er weder Biberfelle noch wampumpeak – er wollte Minewa. Sachoes zögerte, aber der Mohawk tobte und drohte und schnitt sich an drei Stellen die Brust auf, um seine Lauterkeit zu beweisen. Er würde sie nach dem Land im Norden bringen und zu einer Königin machen. Natürlich, wenn es Sachoes lieber war, ginge der tapfere Krieger eben mit leeren Händen heim, um irgendwann in einer sternlosen Nacht mit einem Stoßtrupp wiederzukehren und die Kitchawanken wie Hunde niederzumetzeln. Sachoes, der bald darauf von einem holländischen Kaufmann übertölpelt werden sollte, was zur Gründung von Peterskill auf demselben heiligen Felsen führte, von dem aus des Häuptlings Ahnen Manitous Große Frau zur Erde hatten niederfahren sehen, sagte: »Klar, nimm sie mit.«
Zwei Wochen später durchkämmte eine Gruppe Kitchawanken auf der Suche nach Eicheln, Kastanien und Hagebutten das Nachbartal, als sie den Rauch einer Feuerstelle bemerkten. Vorsichtig, voller Mut und Neugier und nicht ohne gehörige Kühnheit – bei Manitou, der Teufel selbst mochte dort sitzen und irgendeine Seuche zusammenbrauen – näherten sie sich der Lichtung, von der Rauch zum Himmel aufstieg wie der Traum eines Kapnomanten. Was sie dort sahen, sagte Walters Großmutter, während sie Mayonnaise verstrich, war Verrat. Was sie sahen, waren Mohawk und Minewa, vielmehr, was von ihr noch übrig war. Von der Hüfte abwärts war nichts mehr da, erzählte seine Großmutter und legte das Sandwich vor ihn hin – die Leberwurst sah aus wie Menschenfleisch, ja sie roch auch so –, nichts als Knochen.
Waren die Bilder von Mutter und Großmutter durch Reizungen des Geruchszentrums wachgerufen worden, so lag der Fall beim Geist seines Großvaters komplizierter. Vielleicht ist es mit Assoziationen ebenso: es braucht nur einen kleinen Anstoß, schon folgt eine auf die andere, und das Gehirn reiht Erinnerungen aneinander wie Perlen auf einer Schnur. In der Hitze des Nachmittags jedenfalls hatte der alte Harmanus Van Brunt gleich links neben der Drehbank Gestalt angenommen, grobschlächtig, bierbäuchig und breitschädlig, behaart wie ein Eber, Schneidöl und Aluminiumspäne in den Haaren seiner Unterarme, eine Tonpfeife zwischen die Zähne geklemmt. Sein ganzes Leben lang war er Fischer gewesen, hatte mit der Kraft seiner Schultern und seinem Bauch als Gegengewicht die Netze eingeholt, und gestorben war er, wie er geboren wurde: auf dem Fluß. Walter war zwölf oder dreizehn gewesen. Sein Großvater war damals schon zu alt, um die schweren Stellnetze mit den Streifenbarschen und Stören an Land zu ziehen, hielt sich aber in Übung, indem er Plötzen einfing, die er aus Trögen als Köder verkaufte. Eines Nachmittags – für Walter war die Erinnerung daran wie ein glühendes Brenneisen – wurde das Gesicht des Alten starr, dann klappte ihn der Schlaganfall wie ein Taschenmesser zusammen, und er fiel kopfüber in den Trog, wo sich das Gewusel der Plötzen über ihm schloß. Bis Walter Hilfe holen konnte, war der alte Mann ertrunken.
Bei dem Holländer war es wieder anders. Eine Figur, wie sie Walter auf der Europareise mit den Solovays in einer Amsterdamer Galerie gesehen hatte. Oder vielleicht auf einer Zigarrenkiste. Er grübelte darüber nach und schrieb das Ganze dann seinen Verdauungsbeschwerden und dem genetischen Gedächtnis zu, zu gleichen Teilen. Als die Fünf-Uhr-Sirene heulte, schüttelte er zweimal den Kopf, wie um ihn klar zu bekommen, und donnerte auf seinem Motorrad zum »Throbbing Elbow«, um dort aus Anlaß seines zweiundzwanzigsten Geburtstags in aller Tristesse ein Bier zu kippen.
Doch selbst hier, in diesem Schrein der Gegenwart mit den grellen Neonröhren, den dröhnenden Tieftönern und den Schwarzlichtstrahlern, ereilte ihn eine Attacke der Geschichte. Als er in seinen neuen Dingo-Stiefeln mit den Sporenriemenattrappen durch die Tür gestolpert kam, hätte er schwören können, daß da sein Vater an der Bar stand, neben einem Mädchen, dessen Kleid so kurz war, daß es die untere Rundung ihres Hinterns freiließ. Er irrte sich. Bei seinem Vater jedenfalls; der Hintern des Mädchens war unbestreitbar. Sie trug ein Minikleid aus Papier, handgefärbt von den Shawangungk-Indianern aus der Reservation südlich von Jamestown, mit dazu passendem Slip. Der Mann neben ihr erwies sich als Hector Mantequilla, struppiges wildes Haar und ein zwanzig Zentimeter langer Spitzkragen. »Van!« sagte er im Umdrehen, »was liegt an?« Auch das Mädchen wandte sich um: Haare bis in die Augen, knallroter Schmollmund, nichts Halbes und nichts Ganzes. Walter hatte seinen Vater seit elf Jahren nicht mehr gesehen.
Walter zuckte die Achseln. Er bemitleidete sich selbst, fühlte sich als Waise und als Märtyrer und total ausgebrannt, voll mit der merde des menschlichen Daseins und angewidert vom Gedanken des Verfalls: er fühlte sich alt. Es war 1968. Sartre machte Schlagzeilen, die Saturday Review fragte: »Können wir den Nihilismus überleben?«, und Life hatte den Theatermacher Jack Gelber auf einer treibenden Eisscholle fotografiert. Walter wußte Bescheid. Er war selbst ein entfremdeter Held, er war ein Meursault, ein Rocquentin, ein Mann aus Eisen und Tränen, ohne jede Hoffnung für die Welt und ebenso mit Ekel durchsetzt wie ein Jarlsberg mit Löchern. Es war zum Beispiel völlig undenkbar, jetzt nach Hause zu fahren, zu dem gefüllten Hähnchen, dem Spargelsalat und der glänzenden Mousse au chocolat, die seine Adoptivmutter für ihn gemacht hatte. Völlig undenkbar, jetzt dankbar das Geschenk seiner Freundin Jessica auszupacken – ein neuer Helm, bronzefarben wie die Sonne und dekoriert mit seinem Namen aus Blümchenaufklebern – und sie danach unter dem Rhododendron zärtlich auszuziehen, die Nacht wie der Atem eines Schlafenden, der ihm ins Ohr hauchte. Undenkbar. Zumindest im Augenblick.
»Was willst du trinken, Mann?« fragte Hector und stützte sich dabei schwer auf die Theke. Sein T-Shirt, das offenbar aus einer Synthetik-Mischung von Zellophan und Schaumgummi bestand, war mit zwei blutunterlaufenen Augen und einer schimmernden rosa Zunge bedruckt, die hinter seinem Hosenbund verschwand.
Walter antwortete nicht sofort, und als er es doch tat, hatte es mit der Frage nichts zu tun. »Hab heute Geburtstag«, sagte er. Obwohl er das Mädchen anblickte, sah er wieder seine Großmutter vor sich, ihre dicken, fleischigen Arme, die über einem Haufen Rübenschalen wabbelten, ihren Gesichtsausdruck, als sie ihm erzählte, sie habe ihr Telefon abgemeldet, weil die Nachbarin – eine berüchtigte Hexe – ihr verhexte Läuse durch den Hörer schickte. Abergläubisch in einem Maße, daß sie so fest mit der Vergangenheit verbunden war wie tief verankerte Grabsteine auf einem Bergfriedhof, hatte sie die letzten zwanzig Jahre ihres Lebens damit verbracht, Keramikaschenbecher in Form von Köderfischen zu töpfern, wie sie ihr Mann aus seinen Netzen klaubte und zum Verfaulen ans Flußufer warf. Das sind die Entrechteten, hatte sie immer gesagt und dabei Walters behaarten Großvater angefunkelt. Geschöpfe Gottes. Im Traum sehe ich sie immer vor mir. Fische, Fische, Fische.
»Ja, ja!« brüllte Hector. »Dein Geburtstag, Mann!« Dann rief er nach Benny Settembre, dem Barkeeper. Hector war aus Muchas Vacas in Puerto Rico, Nachfahre von Sklaven und von Indios, die versklavt worden waren. Und der Nachfahre von noch etwas anderem: seine Augen waren so grün wie die Freiheitsstatue. »Ich hab was für dich, Mann – was ganz Besonderes«, sagte er und zupfte Walter am Ärmel. »Los, komm mit aufs Klo, ja?«
Walter nickte. Die Musikbox dröhnte los mit Geräuschen von klirrendem Glas und von Steinen, die gegen Autobusse geworfen wurden. Hector packte seinen Arm und marschierte los in Richtung Toilette, blieb aber plötzlich stehen. »Ach ja«, sagte er und deutete auf das Mädchen. »Das ist Mardi.«
Sechs Stunden später dachte Walter an Wassersport. Aber nur flüchtig und weil die Situation dies nahelegte. Er befand sich am Fluß, gegenüber lag Peterskill, in direkter Wasserlinie waren es anderthalb Meilen zu ihm nach Hause, mit dem Auto wären es elf oder zwölf gewesen, und er steckte bis zum Hals in der öligen Styx-Brühe des nächtlichen Hudson River. Er schwamm. War jedenfalls kurz davor. Einstweilen tastete er sich noch durch den Schlick am Grund, gegen die Strömung ankämpfend, in der Nase das satte organische Aroma des Flusses, eine Duftnotenkombination von degenerierter Wasserfauna, Apfelsinenschalen, Dieseltreibstoff und, ja, auch von merde. Von vorn, aus der Dunkelheit, drang Mardis Gelächter und das leise, sachte Plätschern ihres Beinschlags zu ihm. »Komm schon«, flüsterte sie. »Es ist toll hier, wirklich.« Und dann kicherte sie los, ein so natürliches Geräusch, als käme es von einem der verliebten Insekten in den Bäumen, die am Ufer wie eine schwarze, unergründliche Mauer aufragten.
»Scheiße!« fluchte Hector leise hinter ihnen, dann erfolgte ein mächtiges Klatschen – es klang wie der Höhepunkt einer Delphinshow, wie Wasserbomben oder vom Pier herabgeworfene Bierfässer – und schließlich sein schrilles, wildes Lachen.
»Pssst!« zischte Walter. Ihm gefiel das nicht, ihm gefiel das überhaupt nicht. Aber er war betrunken – schlimmer noch, er war vollkommen hinüber von Hectors Pillen, die er die ganze Nacht hindurch geschluckt hatte – und deshalb war ihm alles egal. Er spürte den Auftrieb des Wassers wie die Hände der Flußnymphen, als er sich abstieß und vorsichtig die ersten Schwimmzüge machte.
Um zehn waren sie aus dem »Elbow« weggegangen, um in Hectors zerbeultem Pontiac Baujahr ’55 eine Pfeife herumgehen zu lassen. Walter hatte nicht zu Hause angerufen – hatte überhaupt nicht viel unternommen, außer sich Bier in die Kehle zu schütten –, und er dachte mit einer Art perversem Vergnügen an Jessica, an Hesh und Lola und an seine Tante Katrina. Inzwischen vermißten sie ihn sicher schon, soviel war klar. Das gefüllte Hähnchen war im Herd längst knochentrocken, der Spargelsalat aufgeweicht. Die Mousse zusammengefallen. Er stellte sich vor, wie sie mißgelaunt um den Picknicktisch aus Redwoodholz herumhockten, das Eis in den Cocktails geschmolzen, erstarrte Zahnstocher in der fettigen Pfütze auf der Servierplatte, die längst aller Hackfleischklößchen entledigt war. Er stellte sie sich vor – seine Familie, seine Freundin –, wie sie auf ihn warteten, auf Walter Truman Van Brunt, ein Wesen eigener Schicksalsbestimmung, seelenlos, hart, frei von Konventionen und der doppelten Last von Liebe und Pflicht, und jetzt nahm er die Haschischpfeife eines Fremden entgegen. Bestimmt vermißten sie ihn inzwischen, ja, ganz bestimmt.
Doch dann spürte er ein stechendes Schuldgefühl, die Verdammnis des Abtrünnigen, und erblickte wiederum seinen Vater. Diesmal ging der Alte allein quer über den Parkplatz, die Hände tief in den Taschen seiner gestreiften Hose mit Schlag, ein langes malvenfarbenes Halstuch vor der Brust. Er blieb direkt vor dem Autofenster stehen, beugte sich herab und sah herein, mit dem gleichen irren, gequälten Blick wie damals, als er an Walters elftem Geburtstag aus dem Nichts erschienen war.
Aus dem Nichts. Wie ein Gespenst. Riesig, mit rötlichem Stoppelhaar, zerrissenen, ölverschmierten Hosen und einer zu kurzen Jacke, hatte er ausgesehen wie eine Kreuzung zwischen dem Ewigen Juden und Dickens’ Geist der vergangenen Weihnachtsfeste, wie ein Ekstatiker, dem die Ekstase abhanden gekommen war, ein Mann ohne Zukunft, ein Penner. So unwirklich, daß Walter ihn gar nicht bemerkt hätte, wäre da nicht das Geschrei gewesen. Elf Jahre alt, vollgestopft mit rosa Zuckergußkuchen, Malzbier, Schokoladen-Marshmallows und Mars-Riegeln, saß Walter oben in seinem Zimmer und spielte mit seinem neuen Satz von »Präsidenten, Regenten und Minister der Welt« herum, als er vor dem Haus erregtes Stimmengewirr hörte. Heshs Stimme. Lolas. Und noch eine, eine Stimme, die so klang, als wäre sie in seinem eigenen Kopf, als dächte sie für ihn, faszinierend, fremd und vertraut zugleich.
Die Vordertür war offen. Hesh stand im Eingang wie ein Koloß, an seiner Seite Lola. Vor ihnen, auf dem Rasen, war ein Mann mit einem Kopf wie ein Kürbis und farblosen, wäßrigen Augen. Er war sehr aufgeregt, dieser Mann, lief beinahe Amok, tanzte vor Wut auf einem Bein herum und skandierte wie ein Schamane die Litanei seiner Kränkungen, die wie Essig aus ihm heraussprudelte. »Fleisch von meinem Fleisch!« schrie der Mann immer wieder.
Hesh, der große Hesh mit seinem ehrlichen Kahlschädel und den Unterarmen wie Schmiedehämmer, brüllte diesen Mann an, der wie ein Landstreicher aussah – Walters Vater –, als wollte er ihn umbringen. »Du dreckiges Schwein!« tobte Hesh mit schriller, lauter Stimme, jedes Wort klar und deutlich. »Lügner, Dieb, Mörder! Verschwinde! Verschwinde von hier!«
»Kidnapper!« giftete der Mann zurück und bückte sich, um in seiner Rage auf den Boden einzuschlagen. Dann aber trat plötzlich Walter in sein Blickfeld, verwirrt und verschüchtert, und der Mann verstummte. Eine Veränderung ging über sein Gesicht – es war häßlich und wutverzerrt gewesen, und nun war es auf einmal gelassen wie das eines Priesters –, er kniete auf einem Bein nieder und streckte die Arme aus. »Walter«, sagte er, und in diesem Wort lag der verführerischste Klang, den der Junge je gehört hatte. »Weißt du noch, wer ich bin?«
»Truman!« sagte Hesh, gleichzeitig flehend und warnend.
Walter wußte es noch.
Und dann sah er es. Hinter seinem Vater, hinter dem blassen, kurzgeschorenen, verbrauchten Mann in den Pennerklamotten stand ein Motorrad. Eine kleine Pony Parilla, 98 Kubik, grellrot und mit viel Chrom, funkelnd wie eine Wasserlache in der Wüste. »Komm her, Walter«, sagte sein Vater. »Komm zu deinem Vater!«
Walter blickte zu dem Mann auf, den er als seinen Daddy kannte, dem Mann, von dem er Nahrung und Kleidung bekam, der ihm bei all seinen traumatischen Erfahrungen beigestanden hatte, der immer da war, um den Ball zu werfen und ihn aufzufangen, mit seinen Lehrern herumzustreiten und seine Feinde mit einem einzigen Blick in die Knie zu zwingen, der ihm Anker und Beschützer war. Und dann sah er zu dem Mann auf dem Rasen hinüber, zu dem Vater, den er kaum kannte, und zu dem Motorrad dahinter. »Komm schon, ich beiß nicht.«
Walter ging hin.
Und nun war er wieder da, war nach elf Jahren zurückgekehrt, zum zweitenmal an diesem Tag war er zurückgekehrt. Nur jetzt war er schwarz, eine massive Erscheinung mit zwei rotgeränderten Augen und einer Nase, die aussah, als hätte jemand draufgetreten. Jetzt lehnte er sich durch das Fenster des Pontiac, zündete sich an Hectors Joint eine Zigarette an und langte in den Wagen, um Walters Hand zum Soul-Gruß zu packen und ihn zu fragen, wie es ihm ging, verdammt, Mann. Auf einmal war es Herbert Pompey, Stammgast in den Bars der South Street, Dichter, Kornett- und Nasenflötenspieler, Teilzeittänzer im Mann von La Mancha und Wochenendkiffer.
Genervt von der Geschichte, von der Vergangenheit, die wie eine Kolonne gellender Feuerwehrwagen auf ihn einstürmte, konnte Walter Pompeys Händedruck nur matt erwidern. Er murmelte etwas in der Art, daß es ganz gut ginge, aber er habe Kopfschmerzen, fühle sich ziemlich stoned und außerdem dächte er, er habe was an den Augen. Und an den Ohren. Und, fiel ihm dabei ein, am Hirn vielleicht auch.
Es folgte eine Weile, in der Pompey sich zu ihnen in das gewaltige Raumschiff des Pontiac-Fahrgastraums gesellte – Hector, Mardi und Walter saßen vorn, Pompey lag über den Rücksitz hingefläzt und nuckelte an einer Flasche Spañada, die wie von Geisterhand erschienen war –, eine Weile der Besinnung auf das blecherne Plärren des Radios, auf die Textur der Nacht, auf einen grünlichen Lichtfleck am Himmel, der möglicherweise ein Ufo, wahrscheinlich aber eher ein Wetterballon war, und das riesige Sternengeflecht, das sich über der Motorhaube des Pontiac erstreckte wie ein samtenes Meer. Die Schwerkraft zerrte an Walters Unterlippe. Der Hals der Spañadaflasche tauchte zu seiner Rechten auf, der Joint zu seiner Linken. Er war gefühllos wie eine Leiche. Die Attacke der Geschichte war vorüber.
Es war Mardi gewesen, die den Einfall gehabt hatte, zu den Geisterschiffen hinauszuschwimmen. Ein Einfall, dessen theoretische Ausarbeitung leichter gefallen war als seine praktische Durchführung. »Das ist fantastisch«, beharrte sie, »nein, ehrlich, das ist wirklich fantastisch«, als hätte ihr jemand widersprochen. Und deshalb waren sie, Walter, Mardi und Hector (Pompey hatte klugerweise beschlossen, beim Auto zu bleiben), nun im Fluß und schwammen zu den schwarzen, stummen Umrissen hinüber, die in zehn Meter tiefem Wasser am Fuß des Dunderberg vor Anker lagen.
Armschlag, Beinschlag, Armschlag, Beinschlag, sagte Walter leise vor sich hin und versuchte, sich zu erinnern, ob man beim Atmen den Kopf unter oder über die Wasseroberfläche halten sollte. Er dachte an Wassersport. Scuba-Tauchen. Wasserpolo. Seemannsköpfler. Toter Mann. Eine Flasche war er nicht: all das hatte er irgendwann schon gemacht, hatte Gegner untergetaucht und Tore geworfen wie sonst keiner, Flüsse, Seen und Buchten durchmessen, trübe, urzeitliche Teiche und chlorseptische Schwimmbecken, ein Wunder aus windmühlenflügelartigen Armen und zuckenden Beinen. Aber das hier war etwas anderes. Er war viel zu bedröhnt für das hier. Das Wasser war wie dicke Sahne, seine Arme wie Holzbretter. Wo war sie?
Sie war nirgendwo. Die Nacht fiel aus den hintersten Winkeln des Alls über ihn her, mähte über die uralten Berge hinweg, über die Eichen und Lärchen und Nußbäume, um sich schließlich an einer tiefen pechschwarzen Stelle mit dem eisigen, von Klabautermännern heimgesuchten Fluß zu vermischen, der von unten an ihm riß. Armschlag, Beinschlag: er sah überhaupt nichts. Hätte ebensogut die Augen zumachen können. Aber Moment mal – dort drüben, vor dem platten schwarzen Kiel des vordersten Schiffs, war sie das nicht? Dieser weiße Fleck da? Ja, da war sie, diese scharfe Wachtel, ihr rundes Gesicht wie eine Nachtblume, ein Leuchtturm, eine Flagge, die Waffenstillstand oder Kapitulation signalisiert. Der Kiel ragte hinter ihr auf wie eine steile Klippe, Fledermäuse flatterten über die Wasseroberfläche, Insekten zirpten, und irgendwo in der Dunkelheit zappelte Hector wie ein Fisch im Netz. Seine leisen Flüche wurden von der Nacht gedämpft, bis sie sich in der Unendlichkeit verloren.
Walter dachte daran, wie Mardi in der Finsternis des Ufers ihr Papierkleid so lässig abgelegt hatte, als zöge sie sich im eigenen Schlafzimmer aus, er dachte an den Stich, den er in den Lenden gespürt hatte, als sie sich bei ihm angehalten hatte, um erst das eine Bein, dann das andere zu heben, während sie sich das Papierhöschen abstreifte und in den Schlamm fallen ließ. Geisterhaft, eine bleiche Erscheinung vor dem Hintergrund der Nacht, war sie ins Wasser entschwunden, ehe er sich auch nur das Hemd heruntergerissen hatte. Jetzt konzentrierte er sich auf den milchigen Fleck ihres Gesichtes und paddelte auf sie zu.
»Hector?« rief sie, als er an sie heranglitt. Sie versuchte, sich an der Ankerkette hochzuziehen, umklammerte den kalten, zerfressenen Stahl mit ihrem nackten Fleisch, preßte ihn an sich, schwankte über dem Wasser wie die geschnitzte Galionsfigur, die in alten Legenden zum Leben erwacht.
»Nein«, flüsterte er, »ich bin’s, Walter.«
Sie schien das witzig zu finden und kicherte wieder los. Dann ließ sie sich mit einem Klatschen ins Wasser zurückfallen, das alle Matrosengespenster auf allen Schiffen der ausgedienten Flotte hätte aufwecken können – zumindest aber den Nachtwächter, von dem sie ununterbrochen während der Autofahrt geplappert hatte. Walter packte die Ankerkette und spähte zu dem Schiff empor, das bedrohlich über ihm aufragte. Es war ein Handelskahn aus dem Zweiten Weltkrieg, wie die anderen dahinter auch, die stillgelegten Schiffe, die zweimal täglich mit Ebbe und Flut auf- und niedersanken, seit Walter geboren war. Ihre Laderäume waren voll mit Getreide, das die Regierung aufkaufte, um die freie Marktwirtschaft davon abzuhalten, die Farmer in Iowa, Nebraska und Kansas zu erdrosseln. Weiter flußabwärts, irgendwo in einer kleinen Bucht bei Jones Point, lag das Wrack der Quedah Merchant, die William Kidds Leute 1699 dort versenkt hatten. Es ging die Legende, daß man sie bei klarem Wasser immer noch sehen konnte, voll aufgetakelt und segelbereit, beladen mit Schätzen aus Hispaniola und der Berberei.
Doch Walter stand der Sinn nicht nach Schätzen. Auch nicht nach verfaulenden Weizenkeimen unter einer Schicht von Rattenkacke, nicht einmal nach ein bißchen sportlicher Ertüchtigung. Tatsächlich hatte er bis zu dem Moment, als er im Wasser unter der gespannten, rostigen Ankerkette gegen Mardi streifte, überhaupt nicht gewußt, wonach ihm der Sinn stand. »Überraschung!« prustete sie, als sie neben ihm auftauchte und ihm, einen Arm auf die Kette gelegt, den anderen um den Hals schlang. Und dann, indem sie ihren Körper an ihn schmiegte – nein, an ihm rieb, als hätte sie plötzlich eine Art Unterwasser-Juckreiz bekommen –, murmelte sie: »Hast du heute wirklich Geburtstag?«
Er hatte es fast vergessen. Die traurigen, tadelnden Mienen von Jessica, Lola und Hesh zogen in rascher Folge an ihm vorbei, eine plötzliche Manifestation einer umfassenderen Heimsuchung, und dann griff er nach ihr, suchte nach Körperöffnungen, bemühte sich zu küssen und zu streicheln, Wasser zu treten und zu kopulieren, alles zur gleichen Zeit. Er schluckte Wasser und schoß hustend in die Höhe.
Mardi machte ein leise stöhnendes, schmatzendes Geräusch, als schlürfe sie Suppe oder Sorbet. Kleine Wellen schwappten rings um sie. Walter hustete immer noch.
»Hör zu, Geburtstagskind«, flüsterte sie, stieß sich ab und kam dann wieder dicht an ihn heran. »Ich könnte ganz schön lieb zu dir sein, wenn du etwas für mich tust.«
Walter war elektrisiert. Scharf, gierig, allen Urteilsvermögens beraubt. Die eisige, fischige Strömung war auf einmal warm wie ein palmenumsäumter Jacuzzi-Whirlpool. »Häh?« machte er.
Was sie von ihm wollte, die da wie eine Nixe spät in der Nacht das schlammige Wasser des alten Hudson trat, über sich riesenhaft hoch den großen V-förmigen Bug des Schiffes, waren tollkühne Aktionen. Heldentaten. Beweise von Stärke und Geschicklichkeit. Sie wollte, daß Walter sich an der Ankerkette emporhangelte wie ein nackter Pirat und in das unergründliche Dunkel des geheimnisvollen Schiffes verschwand, um dort das Durcheinander seiner Geheimnisse zu entwirren, seine Struktur über den Tastsinn zu absorbieren und sich die Anordnung der Decks einzuprägen. Oder so ähnlich. »Meine Arme sind zu schwach«, sagte sie. »Ich kann es nicht selber machen.«
In einiger Entfernung fuhr ein Schlepper vorbei, der einen Leichter zog. Dahinter konnte Walter die schwachen Lichter von Peterskill erkennen, verschwommen in der Ferne und durch die Dunstglocke, die über der Mitte des Flusses hing.
»Mach schon!« stachelte sie ihn an. »Nur mal reingucken.«
Walter dachte an den angeblichen Nachtwächter, die Strafe, die auf Betreten von Bundesbesitz stand, seine Höhenangst, die verkaterte, narkotisierte, schlaftrunkene Verfassung seines Geistes und Körpers, die jede Bewegung riskant machte, und sagte: »Warum nicht?«
Hand über Hand, Fuß über Fuß kletterte er die Kette hinauf wie ein wahrer Nihilist und existentialistischer Held. Was hieß schon Gefahr? Das Leben besaß weder Sinn noch Wert, man lebte nur auf den eigenen Untergang hin, auf die Leere und das Nichts. Es war gefährlich, auf einem Sofa zu sitzen, eine Gabel zum Mund zu heben, sich die Zähne zu putzen. Gefahr. Walter lachte ihr ins Gesicht. Natürlich hatte er, trotz alledem, schreckliche Angst.
Zwei Drittel der Strecke hinter sich, verlor er den Halt und krallte sich an die Kette wie ein Wahnsinniger. Sechs Liter Blut rauschten ihm in den Ohren. Unter ihm Schwärze; über ihm die schattenhaften Umrisse der Reling. Walter holte tief Luft und zog sich dann weiter, baumelte hoch über dem Wasser wie eine große bleiche Spinne. Als er endlich oben ankam, als er endlich eine tastende Hand ausstrecken und seine Haut die mächtige, kalte Festung des Schiffsrumpfs berühren konnte, bemerkte er, daß die Ankerkette in einem böse blickenden bullaugenartigen Ding verschwand, das auf ihn wie das monströse, eingeschlagene Piratenauge der gesamten Gespensterflotte wirkte. Er lehnte sich zurück, um die riesigen Blockbuchstaben zu entziffern, die das alte Wrack identifizierten – U.S.S. Anima –, zögerte einen Augenblick und schlüpfte dann durch das Bullauge.
Jetzt war er im Innern, in einem undurchsichtigen Raum von äußerster, unwahrscheinlicher, ungemilderter Finsternis. Nackte Füße traten auf nackten Stahl, seine Finger tasteten die Wände entlang. Es roch nach verrottendem Metall, Ölschlick und aufgeweichter Farbe. Zentimeter für Zentimeter arbeitete er sich vorwärts, bis sich Schatten aus dem Dunkel schälten und er auf einmal auf dem Hauptdeck stand. Vor ihm war eine geschlossene Luke, darüber erhoben sich der Großmast und einige Laderäume. Der Rest des Schiffes – Kabinen, Rettungsboote, Masten und Kräne – lag im Dunkeln. Er hatte das Gefühl, als befände er sich in großer Höhe, als flöge er in einem Düsenflugzeug hoch über den Wolken und wankte durch den Mittelgang. Hier gab es nichts außer Schatten. Und das tausendfache Quietschen und Knirschen von lebloser Materie in leiser, rhythmischer Bewegung.
Aber irgend etwas stimmte nicht. Etwas an diesem Ort schien die Flammen der Vergangenheit neu zu entfachen, die den ganzen Tag an ihm geleckt hatten. Er blieb reglos stehen und hielt den Atem an. Als er sich umwandte, war er kaum überrascht, seine Großmutter auf der Reling sitzen zu sehen. »Walter«, sagte sie, und in ihrer Stimme knisterten statische Störungen, als unterhielten sie sich über eine schlechte Fernsprechverbindung. »Walter, du hast ja nichts an.«
»Aber Oma«, sagte er, »ich war doch schwimmen.«
Sie trug ein weites Sackkleid, und sie war genauso fett wie im Leben. »Egal«, sagte sie und winkte mit dem runzeligen Handgelenk ab, »ich wollte dir etwas über deinen Vater erzählen, ich wollte dir erklären ... ich –«
»Ich brauche keine Erklärungen«, schimpfte eine Stimme hinter ihm.
Walter fuhr herum. Das ging jetzt schon den ganzen Tag so – ja, seit er am Morgen die Augen aufgemacht hatte –, und ihm reichte es langsam. »Du«, sagte er.
Sein Vater knurrte. »Ja, ich«, sagte er.
Die elf Jahre hatten ihn verändert. Der Alte wirkte jetzt sogar noch größer, sein Kopf war angeschwollen wie etwas, das man auf den Simsen von Bauwerken eingemeißelt findet oder als Wächter über einem alten Grab. Und sein Haar war gewachsen, die fettigen dunklen Strähnen schlugen ihm ins Gesicht und fielen ihm in den Nacken. Der Anzug – es schien derselbe zu sein, den er an Walters elftem Geburtstag getragen hatte – hing in Fetzen herab, zerrissen von all den Jahren. Und da war noch etwas. Eine Krücke. Wie ein Hexenbesen von irgendeinem Baum am Straßenrand abgehackt, gesprenkelt mit Rindenresten, stützte sie ihn, als wäre er irgendwo angeknackst. Walter blickte an ihm herab, erwartete eine gichtige Zehe oder einen mit Lumpen umwickelten Fuß, sah aber nichts in dem Schattensee, der die untere Körperhälfte seines Vaters wie ein Leichentuch umhüllte.
»Aber Truman«, sagte Walters Großmutter, »ich wollte doch dem Jungen nur erklären, was ich ihm mein ganzes Leben lang gesagt habe ... Ich wollte ihm erklären, daß es nicht deine Schuld war, daß es an den Umständen lag und daran, was du in deinem Herzen geglaubt hast. Der Herrgott weiß –«
»Halt den Mund, Mama. Ich sage dir, ich brauche keine Erklärungen. Ich würde es morgen wieder tun.«
In diesem Augenblick bemerkte Walter, daß sein Vater nicht allein war. Hinter ihm standen noch andere – eine ganze Zuhörerschar. Er konnte sie schniefen und grunzen hören, und jetzt – auf einmal – konnte er sie auch sehen. Penner. Es mußten mindestens dreißig sein, zerlumpt, mit roten Augen, sabbernd und stinkend. O ja: jetzt konnte er sie auch riechen, den Gestank von Viehhöfen, Fußpilz, pissedurchtränkter Unterwäsche. »Amerika den Amerikanern!« rief Walters Vater aus, und die Versammlung der Phantome nahm es mit Schnattern und Keuchen auf, das schließlich zu einem tollwütigen Gemurmel in der Finsternis verebbte.
»Du bist ja betrunken!« sagte Walter und wußte nicht, warum er es gesagt hatte. Vielleicht war es eine Erinnerung aus seinen Kindesjahren, nachdem seine Mutter gestorben und bevor sein Vater verschwunden war, an die Sommer bei seinen Großeltern, bei denen auch sein Vater für mehrere Wochen gewohnt hatte. Ob der Alte nun auf der Couch schlief, seinem eigenen Vater mit den Netzen half, Walter zum Krebsefangen zur Brücke über den Acquasinnick oder zum Baseballspiel auf die Polo Grounds mitnahm – immer hatte er nach Alkohol gestunken. Vielleicht war das auch heute abend im »Elbow« der Auslöser gewesen: der Geruch nach Alkohol, der Schlüssel zu seinem Vater, ebenso wie Kartoffelpuffer und Leberwurst die Schlüssel zu seiner traurig dreinblickenden Mutter und zu der abergläubischen Frau mit den kräftigen Armen waren, die sich bemüht hatte, die Leere auszufüllen, die seine Mutter zurückgelassen hatte.
»Na und?« sagte sein Vater.
In diesem Moment trat ein kleiner Mann mit dem Gesicht eines Wasserspeiers aus dem Schatten. Er trug nicht mehr den Spitzhut und die Pluderhosen – nein, er hatte ein blaues Arbeitshemd an und ausgebeulte Anzughosen mit Taschen in der Seitennaht –, aber Walter erkannte ihn dennoch. »Nicht betrunkener als du«, sagte der Mann.
Walter ignorierte ihn. »Du hast mich im Stich gelassen«, sagte er, wieder zu seinem Vater gewandt.
»Da hat der Junge recht, Truman«, krächzte seine Großmutter mit einer Stimme wie spritzendes Fett in der Pfanne.
Der alte Mann schien in sich zusammenzusinken, die Worte blieben ihm in der Kehle stecken. »Glaubst du denn, es war leicht für mich?« fragte er. »Ich meine, mit diesen Pennern zu leben und so?« Er machte eine kurze Pause, als wollte er sich besinnen. »Weißt du, was wir essen, Walter? Scheiße, das essen wir. Eine Handvoll von diesem verdorbenen Weizen hier, vielleicht mal einen Graskarpfen, von der Reling aus geangelt, oder eine Ratte, die einer mit Glück gefangen hat und am Spieß brät. Teufel auch, wenn wir nicht die Destille hätten, die Piet zusammengebaut hat –« Er beendete den Satz nicht, spreizte nur die Hand und ließ sie fallen wie einen abgeschlagenen Kopf. »Ein langer, sinnloser Fall«, brummte er, »vom Mutterleib ins Grab hinein.«
Und dann zerrte der kleine Mann – Walter bemerkte mit Schrecken, daß er seinem Vater nur bis zur Hüfte reichte – den Alten am Ellenbogen; Truman beugte sich tief hinab, um sich flüsternd mit ihm zu unterhalten. »Muß jetzt weg, Walter«, sagte der Alte und wandte sich zum Gehen.
»Warte!« keuchte Walter auf einmal verzweifelt. Da war noch einiges unerledigt, er mußte etwas fragen, mußte etwas wissen. »Dad!« In diesem Augenblick passierte es: kaum merklich erhellte sich die Atmosphäre, nur einen Sekundenbruchteil lang. Vielleicht lag es am Mond, der gerade aus den Wolken hervortaumelte, oder es war ein Sumpffeuer oder alle Einwohner der Bronx, die gleichzeitig aus ihren Betten herauswankten, um das Licht im Badezimmer anzuschalten – aber egal, was es war, es gestattete Walter einen kurzen, flüchtigen Blick auf das linke Bein seines Vaters, während der Alte in die Dunkelheit davonhinkte. Walter durchfuhr es eiskalt: das Hosenbein war leer.
Ehe er reagieren konnte, schlossen sich die Schatten wieder wie eine Faust, und der kleine Kerl stand an seiner Seite, sah schielend zu ihm auf wie etwas Verderbtes, Unreines, wie der Kobold, der den Menschenfresser anstachelt. »Du willst doch nicht etwa in die Fußstapfen deines Vaters treten, oder?«
Das nächste, was Walter wußte, war, daß er auf seiner Maschine saß (Maschine: es war sein Pferd, ein feuerspeiender, dreckaufwirbelnder Schrecken, eine große Norton Commando der oberen Hubraumklasse, die einem die Füllungen aus den Backenzähnen fliegen ließ), und die ausgewaschene, vogelgespickte Morgendämmerung zischte beiderseits an ihm vorbei wie das Bild auf einem tragbaren Schwarzweiß-Fernseher mit defektem Horizontalabgleich. Er war unbesiegbar, unsterblich, unempfindlich gegen die Kränkungen und Überraschungen des Universums und raste mit hundertfünfzig aus Peterskill hinaus. Die Straße bog nach rechts, und er bog mit ihr; jetzt kam eine Senke, dann eine Kuppe – er klebte an der Maschine wie eine frische Lackschicht. Hundertsechzig. Hundertfünfundsechzig. Hundertsiebzig. Er war auf dem Heimweg, die vergangene Nacht ein dunkler Fleck – war er auf der Rückfahrt vom Dunderberg hinten in Hectors Auto zusammengeklappt? –, er fuhr nach Hause ins Bett eines existentialistischen Helden über der Küche des schindelgedeckten Häuschens seiner Adoptiveltern. Auf der Straße glänzte der Tau. Es war noch nicht richtig hell.
Und dann auf einmal, als wäre ein Schalter in seinem Kopf umgelegt worden, wurde er langsamer – was immer ihn auf hundertsiebzig hinaufgejagt hatte, war plötzlich von ihm gewichen. Er nahm das Gas weg, lockerte seinen Griff – hundertfünfundvierzig, hundertdreißig, hundertzehn –, er war schließlich auch bloß sterblich. Rechts vor ihm (er bemerkte sie kaum, war schon tausendmal daran vorbeigefahren, zehntausendmal) stand eine historische Gedenktafel, ein blau-gelbes Schild, ein Rechteck, das im Zwielicht aufblitzte. Woraus war es – Eisen? Erhabene Lettern, gelb – oder golden – auf blauem Hintergrund. Hatten wahrscheinlich irgendwelche armen Schweine unten in Sing-Sing oder so gemacht. Klar war das hier eine höchst historische Gegend, George Washington und der Verräter Benedict Arnold und all die anderen, aber Geschichte gab ihm im Grunde nicht allzuviel. Tatsache war, daß er die Inschrift auf dem Ding noch nie gelesen hatte.
Noch nie gelesen. Von ihm aus hätte die Tafel auch an Lafayettes regelmäßigen Stuhlgang oder die Entdeckung der Gemüsezwiebel gemahnen können; ihm war das egal. Irgend etwas am Straßenrand, sonst nichts: Geschwindigkeitsbegrenzung, scharfe Kurve, Eichbaum, Reklametafel, historische Stätte, Garteneinfahrt. Auch jetzt hätte er ihr keinen zweiten Blick geschenkt, wäre da nicht der Schatten gewesen, der blitzartig vor ihm über die Straße schoß. Dieser Schatten (er war nicht genau zu erkennen – kein Kaninchen, Opossum, Waschbär oder Skunk – eben nur ein Schatten) brachte ihn dazu, den Lenker zu verreißen. Und durch dieses Reißen verlor er die Kontrolle über das Motorrad. Ja. Und dieser Kontrollverlust ließ ihn einen Moment lang nach rechts kippen, so daß der neue Dingo-Stiefel mit der Sporenriemenattrappe den Asphalt streifte, ließ ihn kippen und, bevor er sich wieder aufrichten konnte, direkt in das blau-gelbe Schild hineinrasen, mit einem Krach, der eines Donnergottes würdig gewesen wäre.
Am nächsten Nachmittag, als er in einem blaßgrünen Zimmer vom Krächzen der Gegensprechanlage und dem beißenden Geruch im Ostflügel des Peterskill Hospital erwachte, spürte er keinen Schmerz. Es war komisch: eigentlich müßte es weh tun. Er betrachtete seinen bandagierten Unterarm, fühlte irgend etwas an seinen Rippen zerren. Einen Moment lang geriet er in Panik – Hesh und Lola waren da und murmelten einschmeichelnde und beschwichtigende Worte, und Jessica saß auch dabei, Tränen in den Augen. War er tot? War es das? Doch dann gewannen die Medikamente die Überhand, und die Lider fielen ihm von selbst zu.
»Walter«, flüsterte Lola wie aus weiter Ferne. »Walter – geht’s dir gut?«
Er versuchte, sich zu erinnern, alles wieder zusammenzufügen. Mardi. Hector. Pompey. Die Gespensterschiffe. War er die Ankerkette hinaufgeklettert? Hatte er das wirklich getan? Er erinnerte sich an das Auto, an Pompeys weggetretenen Gesichtsausdruck und daran, wie sich Mardis Papierkleid langsam auflöste, als es mit ihrer nassen Haut in Berührung kam. Er hatte seine Hände auf ihren Brüsten, und Hectors werkten zwischen ihren Beinen. Sie kicherte. Und dann dämmerte der Morgen. Vögel machten Radau. Der Parkplatz hinter dem »Elbow«. »Na ja«, krächzte er und machte die Augen wieder auf, »geht ganz gut.«
Lola biß sich auf die Unterlippe. Hesh konnte ihm nicht in die Augen sehen. Und Jessica – die sanfte, gepuderte, herrlich riechende Jessica – sah aus, als hätte sie zwei Marathonläufe nacheinander hinter sich und wäre als letzte durchs Ziel gegangen. Bei beiden.
»Was ist passiert?« fragte Walter und bewegte die Beine.
»Es ist alles okay«, sagte Hesh.
»Es ist alles okay«, sagte Lola. »Alles okay.«
Jetzt sah er auf dem Bett hinab, sah auf die Decke, unter der sein linker Fuß wie die Mittelstange eines Zelts aufragte, und dann auf das ärmliche, eingesunkene Häuflein Linnen, wo eigentlich sein rechter Fuß hätte sein sollen.
O PIONIERE!
Circa dreihundert Jahre bevor Walter einem Schatten auswich und auf der scharfen Schneide der Geschichte seine Spur hinterließ, betrat der erste der Peterskillschen Van Brunts das Tal des Hudson River. Harmanus Jochem Van Brunt, frischgebackener Farmer aus Zeeland, stammte von Heringsfischern ab, denen die Netze zwischen den Fingern verfault waren. Als er im März 1663 auf dem Schoner De Vergulde Bever in Nieuw Amsterdam eintraf, lag ihm vor allem daran, möglichst weit von den angestammten Fischernetzen wegzukommen, die er der Obhut des jüngeren Bruders anvertraut hatte. Die Kosten seiner Überfahrt hatte der Sohn eines Haarlemer Bierbrauers beglichen, ein gewisser Oloffe Stephanus Van Wart, der im Namen der Hochmögenden Herren der Generalstaaten von Holland einen Grundbesitz im heutigen nördlichen Westchester County überschrieben bekommen hatte. Van Warts Bevollmächtigter in Rotterdam hatte für die Überseepassage von Harmanus und seiner Familie die fürstliche Summe von zweihundertfünfzig Gulden ausbezahlt. Als Gegenleistung verpflichteten sich Harmanus, seine Gattin (die goude vrouw Agatha, geborene Hooghboom) sowie ihre kinderen Katrinchee, Jeremias und Wouter vertraglich dazu, den Van Warts auf all ihr Lebtag zu dienen.
Man ließ die Familie auf einer Fünf-Morgen-Farm etwa eine Meile hinter dem Handelsposten von Jan Pieterse an der Mündung des Acquasinnick Creek siedeln, auf einem Stück Land, das vor kurzem noch Stammeseigentum der Kitchawanken gewesen war. Dort erwartete sie eine roh gezimmerte, strohgedeckte Holzhütte. Der Gutsherr, der alte Van Wart, gab ihnen eine Axt, einen Pflug, ein halbes Dutzend krätzige Hühner, einen kachektischen Ochsen, zwei Kühe, die nur noch tropfenweise Milch gaben, und ein Sortiment von ausrangierten, verbeulten und verbogenen Küchengeräten. Als Lohn für seine Investition erwartete er fünfhundert Gulden Pacht, zwei Klafter Holz (gespalten, angeliefert und sorgsam in dem höhlenartigen Schuppen beim oberen Gutshaus aufgestapelt), zwei Scheffel Weizen, zwei Hennen und zwei Hähne und zwanzig Pfund Butter. Fällig und zahlbar in sechs Monaten.
Kleinmütigere Seelen wären vielleicht verzweifelt. Doch Harmanus, den in seinem Heimatdorf Schobbejacken alle ›Hau-rein-Manne‹ genannt hatten – in Anerkennung seiner Körperkraft, Beweglichkeit und seines kulinarischen Fassungsvermögens –, ließ sich so leicht nicht entmutigen. Mit seinen beiden Söhnen an der Seite (Jeremias war dreizehn und Wouter neun) gelang es ihm, bis Ende Mai weit mehr als einen Hektar des fruchtbaren, aber steinigen Bodens zu roden und die Saat auszusäen. Katrinchee, eine Fünfzehnjährige mit sprießenden Brüsten und ausladendem Hinterteil, träumte von Kohlköpfen. Als der Sommer heran war, hatten sie und ihre Mutter einen prächtig gedeihenden Küchengarten angelegt, in dem Erbsen, grüne Bohnen, Möhren, Kohlköpfe, Blumenkohl und Rüben wuchsen, außerdem eine Doppelreihe mit Maisstauden und Kürbissen; die Samen hatten sie von Mohonk1, dem degenerierten Sohn des verstorbenen Sachoes, bekommen. Unter Katrinchees geduldiger Fürsorge gewannen die zwei vergreisten Kühe mit den langen Gesichtern – Kaas und Boter, wie sie der kleine Wouter hoffnungsvoll getauft hatte – allmählich wieder die seidige Grazie ihrer Jugend zurück. Jeden Morgen zerrte sie an ihren verschrumpelten Eutern; jeden Abend fütterte sie ihnen einen Brei aus Zürgelbeeren und Wiesenknöterich, wobei sie ihnen mit bebender Altstimme Lieder vorsang, die der Wind über die Felder wehte wie Gespinste aus einem Traum. Der Wendepunkt aber kam, als Mohonk sie zu einer List inspirierte: sie erwarb die frisch gegerbten Felle von zwei jungen Kälbern, die sie mit Stroh ausstopfte und an Stangen im Kuhstall befestigte – und bereits nach einer Woche bestupsten die beiden buckligen Rinder die Attrappen in mütterlicher Glückseligkeit mit ihren Mäulern und füllten die Milchkübel so rasch wie Katrinchee sie leeren konnte. Und als wäre das nicht genug, schien auch das Federvieh verjüngt. Angeregt von ihren gehörnten Kameraden begannen die Hennen zu legen, als wollten sie einen Preis gewinnen, und dem zerzausten Gockel wuchs ein schillernder neuer Schwanzfedernschmuck.
Das Land war fruchtbar, und die Van Brunts taumelten in seine mächtige Umarmung hinein wie Waisen in den Mutterschoß. War Zucker knapp, gab es doch jede Menge Honig. Ebenso Blaubeeren, Holzäpfel, Zichorien und Löwenzahn. Und Wild! Es fiel praktisch vom Himmel. Ein Knall aus der Donnerbüchse ließ Truthähne oder streunende Kaninchen herabregnen wie Korn aus der Tenne, Rotwild lugte durch die offenen Fenster, Wildgänse und Tafelenten fingen sich in der zum Trocknen aufgehängten Wäsche. Kaum fuhr Jeremias auf den Hudson hinaus – oder den Nord-Fluß, wie er damals noch hieß –, schon sprang ihm ein Stör oder Rotbarsch ins Kanu.
Selbst das Haus nahm unter dem rigorosen Regiment von Vrouw Van Brunt Formen an. Sie vergrößerte den Keller, scheuerte die Böden mit Sand, baute Möbel aus Weidenruten und Holz, brachte Fensterläden an, um die Viehbremsen und die heftigen Gewitterstürme fernzuhalten, die an schwülen Nachmittagen urplötzlich vom Gipfel des Dunderberg herunterbrachen. Sie pflanzte sogar Tulpen vor dem Haus – in zwei so schnurgeraden Reihen, daß sie von einem Landvermesser hätten gesetzt sein können.
Dann, Mitte August, liefen die Dinge aus dem Ruder. Äußerlich war das Leben noch nie so gut gewesen: Bäume wurden gefällt, der Brennholzstapel wuchs an, auf den Feldern stand der Weizen kniehoch, die Räucherkammer war prall gefüllt. Katrinchee wurde zur Frau, die Jungen waren braungebrannt, abgehärtet und gesund wie Frösche, Agatha ging summend mit Mop und Besen herum. Und Harmanus, von den väterlichen Schleppnetzen befreit, arbeitete für fünf. Doch ganz langsam, unmerklich wie das erste klammheimliche Nagen der ersten Termite an den Bodenbalken, krochen Leid und Entbehrungen in ihr Leben.
Den Anfang machte Harmanus. Eines Abends kam er vom Feld und setzte sich an den Tisch, mit einem so mächtigen Appetit, daß es ihm wie mit Messern im Bauch rumorte. Während der hutspot aus Rüben, Zwiebeln und Wild noch garte, stellte Agatha einen fünf Pfund schweren Milchkäse und ein steinhartes bruinbrod vom Vortag auf den Tisch. Fliegen und Moskitos surrten in der Luft; die Kinder spielten im Hof Fangen und schrien dabei. Als sie sich umdrehte, waren Brot und Käse verschwunden, und ihr Mann starrte mit sonderbar leerem Blick auf die Krümel hinab, während seine verkrampften Kiefermuskeln arbeiteten. »Mein Gott, Harmanus«, lachte sie, »laß den Kindern noch was übrig.«
Erst beim Abendessen wurde sie unruhig. Abgesehen vom Eintopf – genug für die nächsten drei Tage, mindestens – standen Wildpastete, ein frisches Brot, zwei Pfund Butter, Gartensalate und ein Steintopf mit Fisch in saurer Sahne auf dem Tisch. Die Kinder fanden kaum Zeit, ihre Teller zu füllen. Harmanus fiel über die Speisen her, als habe er zum alljährlichen Pfingst-Wettessen in der Kneipe von Schobbejacken Platz genommen. Jeremias und Wouter rannten nach dem Essen hinaus, um im schwindenden Licht Ball zu spielen, aber Katrinchee, die zum Abwaschen im Haus geblieben war, sah ehrfürchtig zu, wie ihr Vater die Wildpastete anging, sich mit einem Brotkanten den Fisch hineinschaufelte, den Eintopf restlos auskratzte. Er saß fast zwei Stunden lang am Tisch, und während der ganzen Zeit kam ihm kein einziges Wort über die Lippen, bis auf hin und wieder gemurmelte Forderungen nach Wasser, Apfelwein oder Brot.
Am nächsten Morgen war es nicht anders. Wie gewöhnlich stand er mit dem ersten Sonnenstrahl auf, aber anstatt sich einen Brotlaib vom Tisch zu nehmen und mit Axt oder Pflug auf die Felder zu streben, lungerte er in der Küche herum. »Was ist denn los, Harmanus?« fragte Agatha, in deren Stimme sich nun eine Spur von Besorgnis mischte.
Er saß an dem schlichten Holztisch, die großen Hände vor sich gefaltet, und sah zu ihr auf. Einen Augenblick lang meinte sie, einem Fremden in die Augen zu blicken. »Ich habe Hunger«, sagte er.
Sie wischte die Dielen auf, ihre Ellenbogen hüpften wie Mäuse auf und ab. »Soll ich dir ein paar Eier braten?«
Er nickte. »Und Fleisch.«
Im selben Moment kam Katrinchee mit einem Eimer frischer Milch durch die Tür. Harmanus stieß beinahe den Tisch um. »Milch!« sagte er, als stellte er die Assoziation zwischen Wort und Ding zum erstenmal her; seine Stimme war klanglos, tot und ohne Ausdruck, die Stimme eines Phantoms. Er riß ihr den Eimer aus der Hand, hob ihn an die Lippen und trank ihn völlig leer, ohne abzusetzen. Dann warf er ihn zu Boden, rülpste und ließ den Blick im Raum schweifen, als hätte er ihn noch nie zuvor gesehen. »Eier«, wiederholte er. »Fleisch.«
Mittlerweile war die ganze Familie in Schrecken versetzt. Jeremias sah kreidebleich zu, wie sein Vater sich quer durch die Speisekammer fraß, Störe aus der Räucherkammer zerrte, zwei Hühner für den Kochtopf rupfte. Katrinchee und Agatha hetzten durch die Küche, schnitten, kneteten, brieten und buken. Wouter mußte Holz holen, aus dem Kessel stieg Dampf auf. An diesem Tag wurde auf den Feldern nicht gearbeitet. Harmanus aß bis in den frühen Nachmittag, er aß, bis er den Garten geplündert, den Keller ausgeräumt, das Leben des Stallviehs bedroht hatte. Sein Hemd war bunt gemustert mit Fettflecken, Eidotter, Soße und Apfelwein. Er wirkte trunken, wie einer der geneverseligen Bettler in der Amsterdamer Heerengracht. Dann stand er plötzlich auf, wankte vom Tisch wie ein weidwundes Tier und sank auf eine Strohmatte in der Ecke nieder; er war eingeschlafen, ehe er am Boden war.
Die Küche war verwüstet, die Töpfe geschwärzt; Speisereste befleckten die Dielen, den Tisch, den steinernen Herd. Die Räucherkammer war leer – kein Wild, kein Stör, kein Kaninchen oder Truthahn mehr –, und Getreide und Gewürze, die sie von den van der Meulens eingetauscht hatten, waren ebenfalls dahin. Es war, als hätte Agatha das ganze Dorf Schobbejacken bekocht, bei einem Hochzeitsessen von mehrtägiger Dauer. Erschöpft sank sie auf einen Stuhl und begrub den Kopf in den Händen.
»Was ist bloß mit vader los?« fragte Wouter. Neben ihm stand Jeremias. Beide blickten verängstigt drein.
Agatha starrte sie hilflos an. Sie hatte selbst kaum Zeit gehabt, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Ja, was war nur mit ihm los? Sie erinnerte sich an einen ähnlichen Fall aus ihrer Kindheit in Twistzoekeren. Eines Tages hatte Dries Herpetz, der Bäcker des Dorfes, verkündet, Kirschtörtchen seien die ideale Nahrung und er wolle bis an sein Lebensende nichts anderes mehr essen. Aber Suppe, wenigstens Suppe braucht man doch, sagten die Leute. Milch, Grünkohl, Fleisch. Er aber reckte die Nase verächtlich in die Luft, als wären sie eine Horde von Sündern, Teufel, die ihn in Versuchung führen wollten. Ein Jahr lang aß er nichts als Kirschtörtchen. Er wurde fett, unförmig, ging auf wie frischer Teig. Er verlor alle Haare, die Zähne fielen ihm aus. Ein bißchen Fisch nur, flehte seine Frau. Eine schöne braadworst. Käse? Weintrauben? Waffeln? Lachs? Er winkte ab. Sie verbrachte alle Tage mit dem Zubereiten fabelhafter Gerichte, durchkämmte die Märkte nach exotischen Früchten, Speisen aus Arabien und dem Orient, nach Schnecken, Trüffeln, den geschwollenen Lebern von gestopften Gänsen, doch mit nichts ließ er sich locken. Schließlich, nachdem sie sich fünf Jahre lang abgemüht hatte, fiel sie vor Erschöpfung tot um, mit dem Gesicht nach vorn in eine Kasserolle mit Kartoffelauflauf. Dries blieb unberührt. Zahnlos, fett wie ein Schwein, wurde er achtzig Jahre alt, saß vor seiner Bäckerei und lutschte den süßen roten Brei von seinen Daumen, die so groß wie Spachteln waren. Aber das hier, das war etwas anderes. »Ich weiß nicht«, sagte sie, und ihre Stimme war ein Flüstern.
Bei Einbruch der Nacht fing Harmanus an, sich auf der Matte zu wälzen. Er schrie im Schlaf, stöhnte wieder und wieder etwas vor sich hin. Agatha schüttelte ihn sanft. »Harmanus«, wisperte sie. »Ist ja gut. Wach auf.«
Schlagartig machte er die Augen auf. Seine Lippen bewegten sich.
»Ja?« sagte sie und beugte sich über ihn. »Ja, was denn?«
Er versuchte, etwas zu sagen – ein einzelnes Wort –, aber er brachte es nicht heraus.
Agatha wandte sich an ihre Tochter. »Schnell, ein Glas Wasser.«
Er setzte sich auf, trank das Wasser in einem Zug aus. Seine Lippen bebten.
»Harmanus, was ist denn?«
»Kuchen«, krächzte er.
»Kuchen? Du willst Kuchen?«
»Kuchen.«
Das war der Moment, als sie die Fassung verlor. In all den Jahren ihrer Ehe, in denen er oft trübsinnig über seinen zerrissenen Netzen gekauert hatte und sie ihn aus dem Bett locken mußte, damit er mit dem Dory auf die windgepeitschte Schelde hinausfuhr, bei all der Spannung und Unsicherheit des Umzugs in die Neue Welt und den Nöten, die sie durchgemacht hatten, war sie kaum jemals laut zu ihm geworden. Jetzt aber spürte sie auf einmal, wie etwas in ihr aufbrach. »Kuchen?« echote sie. »Kuchen?« Und dann stürzte sie auf das Regal neben dem Herd zu, riß Säcke und Schachteln auf, knallte Kessel, Holzschüsseln, Näpfe und Löffel auf den Boden, als wäre es Unrat. »Kuchen!« kreischte sie und drehte sich zu ihm um, die gußeiserne Pfanne vor die Brust gehalten. »Und mit was soll ich den backen – aus Strandhafer und Flußsand vielleicht? Alles andere hast du ja aufgegessen – Backfett, Mehl, Speckschwarten, Eier, Käse, sogar die getrockneten Ringelblumen, die ich den ganzen weiten Weg von Twistzoekeren mitgenommen habe.« Sie atmete schwer. »Kuchen! Kuchen! Kuchen!« schrie sie plötzlich auf, und es war wie der Schrei eines großen hysterischen Vogels, der von seinem Schlafplatz aufgestört worden war; gleich darauf brach sie von Schluchzen geschüttelt in der Ecke zusammen.
Katrinchee und ihre Brüder saßen eng an die Wand gedrückt, ihre Gesichter klein und weiß. Harmanus schien sie nicht zu bemerken. Er rappelte sich hoch von seinem Lager und begann, den Raum nach etwas Eßbarem zu durchsuchen. Bald stieß er auf einen Sack mit Eicheln, die Katrinchee zum Breimachen gesammelt hatte; er stopfte sie sich in den Mund, samt Schalen und allem, dann zog er davon und verschwand in der Nacht.
Sie fanden ihn erst nach vier Uhr früh. Geleitet vom schwachen Leuchten der Felsen der Van Wart Ridge, durchwateten Agatha und ihre Tochter den Acquasinnick Creek, stolperten das steile Ufer auf der anderen Seite hinauf und kämpften sich durch eine Wirrnis aus Dornen, Nesseln und Ästen, in denen der Nachtnebel in Schwaden hing. Sie hatten schreckliche Angst. Nicht nur um Gatten und Vater, sondern um sich selbst. Flachländer waren sie, gewohnt an Polder und Deiche und eine Aussicht, die immer weiter und weiter ging, bis sie sich in der unendlichen blauen Weite des Meeres verlor, und hier befanden sie sich in einer barbarischen neuen Welt, die von Dämonen und Kobolden wimmelte, voll mit seltsamen Wesen und halbnackten Wilden, eingeschlossen von hohen Bäumen. Sie rangen ihre Panik nieder, bissen die Zähne zusammen und eilten weiter. Völlig ermattet wankten sie am Ende auf eine Lichtung, die vom unsteten Flackern eines Lagerfeuers erhellt war.
Da saß er. Harmanus. Sein großer Kopf und der Oberkörper warfen makabre Schatten auf die gespenstisch verzerrten weißen Birkenstämme hinter ihm, er hielt eine Bratenkeule so dick wie ein Oberschenkel ans Gesicht gepreßt. Sie traten näher. Sein Hemd war zerfetzt, mit Fett und Blut befleckt; über den Flammen brutzelten Stücke von Fleisch – so rosa und prall wie das eines Babys – an einem groben Spieß. Und dann sahen sie, was da zu seinen Füßen lag: Kopf und Schultern, Augen und Ohren, die im Todeskampf verzerrte Schnauze. Kein Baby. Ein Schwein. Ein ganz besonderes Schwein. Der alte Volckert Varken, Van Warts preisgekrönter Eber.
Harmanus war gefügig, seinerseits ein Säugling, als Agatha ihm die Handgelenke auf den Rücken drehte und die Hanfstricke festzurrte, die sie eine halbe Stunde zuvor in der verwüsteten Küche in ihre Schürzentasche gestopft hatte. Dann schlang sie ihm ein Halfter um den Hals und geleitete ihn heim wie ein verirrtes Kalb. Es dämmerte schon fast, als sie das Blockhaus erreichten. Agatha führte ihren Mann durch die Tür, vor den Augen der stumm zusehenden Söhne, und bettete ihn auf die Strohmatte wie eine Leiche. Dann fesselte sie ihm die Füße. »Katrinchee«, schluckte sie, ihre Stimme war festgezurrt wie der verknotete Strick. »Geh und hol Mohonk.«
Da sie in so großer Entfernung von den Zentren der Bildung und der Quacksalberei lebten und da der einzige Arzt in Nieuw Amsterdam damals ein einäugiger Wallone namens Huysterkarkus war, der auf der Insel Manhattoes wohnte, etwa sechs Stunden Bootsfahrt entfernt, konnte Agatha nicht auf die gängigen Methoden der Diagnose und Therapie zurückgreifen. Wären die großen Ärzte aus Utrecht oder Padua allerdings dagewesen, hätten sie wohl auch nicht viel mehr vorzuschlagen gewußt als Aderlaß, Gebet und Mixturen von ausgerissenen Achselhaaren in einem Glas Chinarindenwein oder im Menstruationsblut von Haselmäusen eingeweichtem Kuhmist. Aber die großen Mediziner waren nicht zugegen – es sollte noch fünf oder sechs Jahre dauern, bis Nipperhausen seinen ersten Atemzug tat, und das in der Pfalz –, daher waren die Kolonisten gewohnt, in Extremsituationen auf die Künste und Exorzismen der Kitchawanken, Canarsees und Wappinger zu vertrauen. Deshalb Mohonk.
Eine halbe Stunde später trat Katrinchee durch die Tür, dicht gefolgt von Sachoes’ jüngstem Sohn. Mohonk war zweiundzwanzig, süchtig nach Gewürzbowle, Genever und Tabak, reichte bis zum Dach und war dürr wie ein Storch. Unter der Tür gebückt, umsäumt von seinem struppigen Waschbärmantel, sah er aus wie eine reife Löwenzahnblume. »Ah«, sagte er und ging sein gesamtes holländisches Vokabular durch: »Alstublieft, dank U, niet te danken.« Er schlurfte näher, von schwerem Waschbärenduft umwölkt, und beugte sich über den Patienten.
Harmanus starrte zu ihm auf wie ein gescholtenes Kind, höchst gefügig und zerknirscht. Seine Stimme war kaum zu hören. »Kuchen!« stöhnte er.
Mohonk blickte Agatha an. »Zuviel essen«, sagte sie und stellte es pantomimisch dar. »Eten. Te veel.«
Der Kitchawanke schien verwirrt. »Eten?« wiederholte er. Doch als Agatha nach einem Holzlöffel griff und ihn sich heftig gegen den Mund zu stoßen begann, hellte sich die Miene des Indianers erst auf und verdüsterte sich dann zusehends. Er sprang von Harmanus zurück, als wäre er gebissen worden, und seine langen, kupferfarbenen Hände faßten unsicher nach dem Gürtel seines Mantels.
Agatha stieß ein Keuchen aus, Klein Wouter fing an zu greinen, Jeremias starrte auf seine Fußspitzen. Der Indianer wich zur Tür zurück, als Katrinchee einen Schritt nach vorne machte und ihn am Arm packte. »Was ist?« fragte sie. »Was ist los mit ihm?« Sie redete in der Sprache seiner Vorfahren, in der Sprache, die er sie über die Rücken der Kühe hinweg gelehrt hatte. Doch er antwortete nicht – er leckte sich nur über die Lippen und zog den Mantel fester um sich, obwohl es schon fünfunddreißig Grad hatte und ständig heißer wurde. »Meine Mutter«, sagte er schließlich. »Ich muß meine Mutter holen.«
Die Vögel hatten sich in den Bäumen niedergelassen, und die Moskitos waren in voller Macht und Zahl aus den Sümpfen aufgestiegen, als er mit einer verschrumpelten alten Squaw in schmutzigen Leggins und Schürze zurückkehrte. Vertrocknet wie ein vergessener Maiskolben, tief gebückt und wacklig, ein Gesicht wie eine Senkgrube, sah sie aus, als hätte man sie frisch aus einem Torfmoor ausgegraben oder in den Katakomben vom Haken genommen. Als sie sechs Jahre alt und geschmeidig wie ein Salamander gewesen war, hatte sie mit dem Rest ihres Stammes bis zur Hüfte im Fluß gestanden und zugesehen, wie die Half Moon gegen die Strömung ankämpfte. Das Schiff war ein Wunder gewesen, eine Vision, ein Zeichen der stummen Götter, die die Berge aufgefaltet hatten, um ihr Treiben vor den Augen der Sterblichen zu verbergen. Manche sagten, es sei ein Geschenk von Manitou, ein großer weißer Vogel, der gekommen war, ihre Leben zu heiligen; andere, weniger zuversichtliche Mitmenschen identifizierten es als Teufelsfisch, der gekommen war, um sie alle auszulöschen. Seit damals hatte sie miterlebt, wie ihr Mann von Jan Pieterse und Oloffe Van Wart ausgetrickst, ihre Tochter geschlachtet, ihr jüngster Sohn vom Schnaps verblödet und ein Drittel ihres Stammes von den Pocken, der Bleichsucht und diversen Geschlechtskrankheiten dahingerafft worden waren, die die Wallonen den Holländern, die Holländer den Engländern und die Engländer den Franzosen zuschrieben. Ihr Name war Wahwahtaysee.
Mohonk sagte etwas in seiner Sprache, das Agatha nicht verstand, und seine Mutter, Wahwahtaysee die Leuchtkäferfrau, trat vorsichtig in die Hütte ein. Mit sich brachte sie einen verschnürten Beutel mit teufelsaustreibenden Requisiten (Eckzähne von Opossum und Wölfin, den Wirbelstrang eines Störs, diverse Federn, getrocknete Blätter und mehrere verfärbte Klumpen so esoterischen organischen Materials, daß sogar sie Herkunft und Zweck schon vergessen hatte) und einen scharfen, ranzigen Geruch, der Agatha an die Ebbe bei Twistzoekeren erinnerte. Sie würdigte Harmanus, der inzwischen auf seiner Matte herumzuwüten und wiederum nach Kuchen zu brüllen begonnen hatte, kaum eines Blickes, sondern schlurfte zum Tisch hinüber, auf den sie zwanglos den Inhalt des Beutels entleerte. Dann rief sie ihren Sohn mit knappen, ärgerlichen Silben zu sich, die von ihren Lippen zischten wie aus dem Stock schwärmende Wespen. Mohonk seinerseits sagte etwas zu Katrinchee, die sich an Jeremias und Wouter wandte. »Sie will ein Feuer angefacht haben – ein riesiges Feuer. Holt Holz, schnell!«